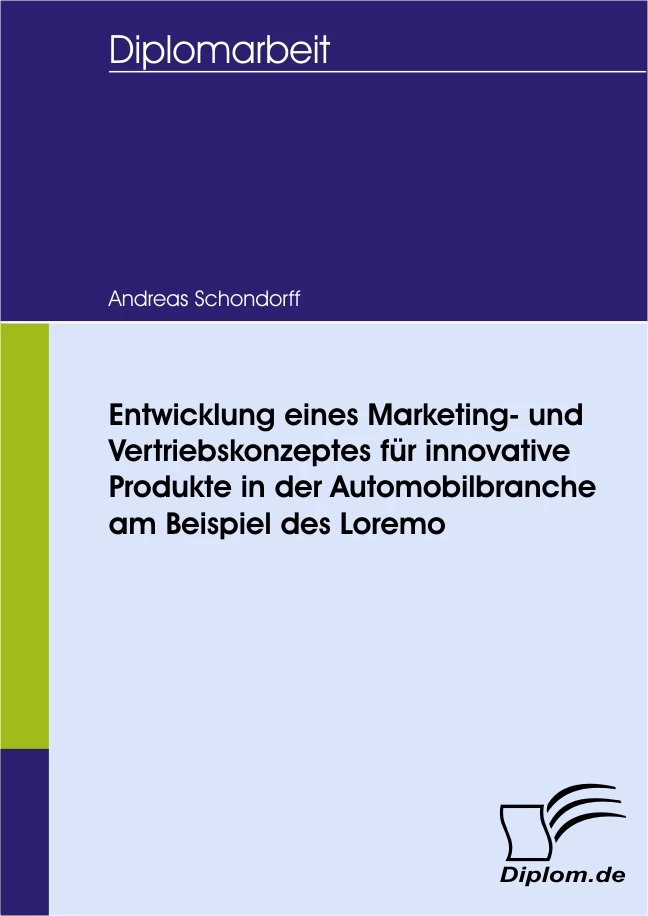Entwicklung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes für innovative Produkte in der Automobilbranche am Beispiel des Loremo
©2006
Diplomarbeit
176 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Laut einer Umfrage des ACI (Automotive-Consumer-Insights)-Trendmonitors sind über 60% der Autokäufer der Meinung, dass die Automobilindustrie ihren Fokus zu wenig auf die Themen Kraftstoffverbrauch und Umweltverträglichkeit legt. Das Thema Umwelt würde nicht nur ungenügend in den Produkten umgesetzt, sondern die Befragten waren gleichermaßen der Meinung, dass diese Angelegenheit ebenso schwach im Marketing der Autohersteller aufgegriffen wurde. Es kristallisiert sich zudem immer mehr heraus, dass die Verbraucher zugunsten der Umwelt erstmals auch Nachteile auf der Produktseite in Kauf nähmen. 57% würden eine geringere Höchstgeschwindigkeit tolerieren, ein Drittel der Autokäufer würde sogar einen höheren Kaufpreis akzeptieren.
Dennoch war das wohl bekannteste 3-Liter-Auto, der Lupo 3L mit einem Verbrauch von 2,99 Litern, ein wirtschaftlicher Misserfolg für die Volkswagen AG, so dass seine Produktion eingestellt werden musste. Die zu geringen Verkaufszahlen resultierten einerseits aus dem zu hohen Verkaufspreis, andererseits sind sie auf ein schlechtes Marketing für dieses Fahrzeug zurückzuführen.
Trotz des Misserfolges dieses Öko-Autos will die Loremo AG im Herbst 2009 mit einem Fahrzeug an den Markt gehen, welches mit einem Verbrauch von 1,5 Litern auf 100 Kilometern und einem Basispreis von 11.000 Euro den Markt der Niedrig-Verbrauch-Autos aufmischen soll. Und dies ohne den finanziellen Background eines großen Automobilkonzerns.
Um dieses Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen, bedarf es angesichts der komplexen sowie dynamischen Markt- und Umweltbedingungen eines schlüssigen, ganzheitlichen, auf Strategien beruhenden Marketingkonzeptes. Dieses konzeptionelle Vorgehen dient dabei der Grundlagenschaffung für schlüssiges Markthandeln auf der Basis differenzierter Informationen und Projektionen. Durch dieses systematisch konzeptionelle Vorgehen wird ein Taktieren verhindert, welches meist zu Ineffizienz des Mitteleinsatzes führt und somit gleichermaßen die Effektivität, also das gewünschte Wachstum des Unternehmens, gefährden kann. Folglich ist es gerade für Existenzgründer in besonderem Maße wichtig, ihren Markteintritt auf der Basis eines in sich schlüssigen Marketingkonzeptes vorzubereiten und durchzuführen.
Aufbau und Struktur der Arbeit:
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes für innovative Produkte in der Automobilbranche. Um einen Praxisbezug herzustellen, […]
Laut einer Umfrage des ACI (Automotive-Consumer-Insights)-Trendmonitors sind über 60% der Autokäufer der Meinung, dass die Automobilindustrie ihren Fokus zu wenig auf die Themen Kraftstoffverbrauch und Umweltverträglichkeit legt. Das Thema Umwelt würde nicht nur ungenügend in den Produkten umgesetzt, sondern die Befragten waren gleichermaßen der Meinung, dass diese Angelegenheit ebenso schwach im Marketing der Autohersteller aufgegriffen wurde. Es kristallisiert sich zudem immer mehr heraus, dass die Verbraucher zugunsten der Umwelt erstmals auch Nachteile auf der Produktseite in Kauf nähmen. 57% würden eine geringere Höchstgeschwindigkeit tolerieren, ein Drittel der Autokäufer würde sogar einen höheren Kaufpreis akzeptieren.
Dennoch war das wohl bekannteste 3-Liter-Auto, der Lupo 3L mit einem Verbrauch von 2,99 Litern, ein wirtschaftlicher Misserfolg für die Volkswagen AG, so dass seine Produktion eingestellt werden musste. Die zu geringen Verkaufszahlen resultierten einerseits aus dem zu hohen Verkaufspreis, andererseits sind sie auf ein schlechtes Marketing für dieses Fahrzeug zurückzuführen.
Trotz des Misserfolges dieses Öko-Autos will die Loremo AG im Herbst 2009 mit einem Fahrzeug an den Markt gehen, welches mit einem Verbrauch von 1,5 Litern auf 100 Kilometern und einem Basispreis von 11.000 Euro den Markt der Niedrig-Verbrauch-Autos aufmischen soll. Und dies ohne den finanziellen Background eines großen Automobilkonzerns.
Um dieses Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen, bedarf es angesichts der komplexen sowie dynamischen Markt- und Umweltbedingungen eines schlüssigen, ganzheitlichen, auf Strategien beruhenden Marketingkonzeptes. Dieses konzeptionelle Vorgehen dient dabei der Grundlagenschaffung für schlüssiges Markthandeln auf der Basis differenzierter Informationen und Projektionen. Durch dieses systematisch konzeptionelle Vorgehen wird ein Taktieren verhindert, welches meist zu Ineffizienz des Mitteleinsatzes führt und somit gleichermaßen die Effektivität, also das gewünschte Wachstum des Unternehmens, gefährden kann. Folglich ist es gerade für Existenzgründer in besonderem Maße wichtig, ihren Markteintritt auf der Basis eines in sich schlüssigen Marketingkonzeptes vorzubereiten und durchzuführen.
Aufbau und Struktur der Arbeit:
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes für innovative Produkte in der Automobilbranche. Um einen Praxisbezug herzustellen, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Andreas Schondorff
Entwicklung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes für innovative Produkte in der
Automobilbranche am Beispiel des Loremo
ISBN: 978-3-8366-4127-2
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover, Hannover, Deutschland, Diplomarbeit,
2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 201
I
Inhaltsverzeichnis Seite
Abbildungsverzeichnis... III
Tabellenverzeichnis... III
Abkürzungsverzeichnis ... IV
1
Einleitung ... 1
2
Aufbau und Struktur der Arbeit... 2
3
Entwicklung und gegenwärtige Sichtweise des Marketing... 4
3.1
Entwicklung des Marketing... 4
3.1.1
Vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt... 4
3.1.2
Vom Käufermarkt zur heutigen Sichtweise des Marketing... 5
3.2
Konzeptionelles Marketing ... 7
3.2.1
Begriffliche Abgrenzung ... 7
3.2.2
Wesen des konzeptionellen Marketing ... 7
3.2.3
Vorgehensweise bei der Erstellung eines Marketingkonzeptes... 8
4
Entwicklung eines Marketingkonzeptes für die Loremo AG ... 11
4.1
Unternehmensanalyse ... 11
4.1.1
Die Loremo AG ... 11
4.1.2
Der Loremo LS und GT... 13
4.2
Umweltanalyse... 17
4.2.1
Einflüsse auf die Betriebskosten eines Pkw... 17
4.2.1.1
Entwicklung der Kraftstoffpreise ... 17
4.2.1.2
Kfz-Steuern in Deutschland... 20
4.2.2
Entwicklungen in der Automobilbranche ... 21
4.2.2.1
Möglicher Wettbewerb... 22
4.2.2.2
Vergleich des Loremo zum Wettbewerb... 28
4.2.2.3
Konzeptfahrzeuge ... 31
4.2.3
Zielgruppenanalyse... 35
4.3
SWOT-Analyse ... 40
4.3.1
Stärken... 40
4.3.2
Schwächen ... 41
4.3.3
Chancen... 43
4.3.4
Risiken ... 44
4.4
Marketingziele ... 45
4.4.1
Unternehmensphilosophie und -vision ... 45
4.4.2
Zielprogramm der Loremo AG ... 47
4.5
Marketingstrategien... 48
II
4.5.1
Marktfeldstrategien... 49
4.5.2
Marktstimulierungsstrategien ... 51
4.5.3
Marktparzellierungsstrategien ... 53
4.5.4
Marktrealstrategien ... 56
4.5.5
Strategieprogramm für die Loremo AG ... 61
4.6
Marketingmix... 62
4.6.1
Product (Produktpolitik)... 62
4.6.2
Price (Preis- und Konditionenpolitik) ... 65
4.6.2.1
Preispolitik ... 65
4.6.2.2
Konditionenpolitik ... 66
4.6.2.3
Besondere Preisstrategien bei der Einführung neuer Produkte ... 68
4.6.3
Promotion (Kommunikationspolitik)... 68
4.6.4
Placement (Distributionspolitik)... 72
4.6.4.1
Trends im Automobilvertrieb... 73
4.6.4.2
Vertrieb über ein eigenes Händlernetz oder ein Vertragshändlernetz... 74
4.6.4.3
Vertrieb über einen Online-Shop ... 76
4.6.4.4
Vertrieb über sonstige Absatzkanäle... 78
4.6.4.5
Vertriebskonzept für die Loremo AG ... 81
5
Zusammenfassung und Ausblick ... 83
Anhang ... 86
Quellenverzeichnis ... 160
Ehrenwörtliche Erklärung ... 169
III
Abbildungsverzeichnis Seite
Abb. 1: Vom Verkäufer- zum Käufermarkt... 5
Abb. 2: Beziehungen zwischen der Umwelt- und Unternehmensanalyse und der
Konzeptionspyramide... 10
Abb. 3: Showcar Loremo LS ... 14
Abb. 4: Einstiegskonzept Loremo... 15
Abb. 5: Ölpreise 1985-2006 ... 18
Abb. 6: Prognose für die Preisentwicklung von Kraftstoffen... 19
Abb. 7: Smart Fortwo Coupé... 23
Abb. 8: Peugeot 107, Toyota Aygo, Citroën C1 ... 24
Abb. 9: Daihatsu Cuore ... 24
Abb. 10: Opel Corsa... 25
Abb. 11: Dacia Logan... 26
Abb. 12: Toyota Prius... 27
Abb. 13: Smart Roadster... 27
Abb. 14: Konzeptfahrzeuge der Volkswagen AG ... 32
Abb. 15: Clever-Project ... 33
Abb. 16: Jetcar ... 34
Abb. 17: Grafische Darstellung der inselförmigen Gebietserschließungsstrategie für die
Loremo AG... 60
Tabellenverzeichnis Seite
Tab. 1: Von der Idee zum Konzeptfahrzeug... 12
Tab. 2: Technische Daten des Loremo LS und GT ... 16
Tab. 3: Kraftfahrzeugsteuer... 20
Tab. 4: Die vier grundlegenden markfeld-strategischen Optionen ... 49
Tab. 5: Marktsegmentierung für die Loremo AG ... 56
Tab. 6: Tabellarische Übersicht zur inselförmigen Gebietserschließungsstrategie für die
Loremo AG... 59
Tab. 7: Strategieprofil für die Loremo AG... 61
Tab. 8: Mögliche Einzelhandelsketten für den Vertrieb des Loremo ... 79
IV
Abkürzungsverzeichnis
4P
Marketing-Instrumente: Product, Price, Promotion und Place
Abb.
Abbildung
ABS
Antiblockiersystem
ACI
Automotive-Consumer-Insights
ADAC
Allgemeiner Deutscher Automobilclub e.V.
AG
Aktiengesellschaft
A. T. U.
Auto Teile Unger Handels GmbH & Co. KG
CI Corporate
Identity
cm³
Kubikzentimeter
CRM
Customer Relationship Management
CwxA
Luftwiderstand
DIN
Deutsche Industrie Norm
EC
Electronic
Cash
ESP
Elektronisches
Stabilitätsprogramm
e.V.
Eingetragener
Verein
f. folgend
ff. fortfolgend
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GVO
Gruppenfreistellungsverordnung
IAA
Internationale Automobil Ausstellung
Kfz
Kraftfahrzeug
kg Kilogramm
km
Kilometer
km/h
Kilometer pro Stunde
kW
Kilowatt
V
l Liter
l x b x h
Länge x Breite x Höhe
Loremo
Low Resistance Mobil
m Meter
mm
Millimeter
m²
Quadratmeter
PC
Personal
Computer
Pkw
Personenkraftwagen
PS
Pferdestärke
SBWH
Selbstbedienungswarenhaus
sek.
Sekunden
SUV
Sport Utility Vehicle
SWOT
Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats
Tab.
Tabelle
USP
Unique Selling Proposition
VCD
Verkehrsclub Deutschland e.V.
vgl.
vergleiche
1
1 Einleitung
Laut einer Umfrage des ACI (Automotive-Consumer-Insights)-Trendmonitors sind über
60% der Autokäufer der Meinung, dass die Automobilindustrie ihren Fokus zu wenig
auf die Themen Kraftstoffverbrauch und Umweltverträglichkeit legt. Das Thema Umwelt
würde nicht nur ungenügend in den Produkten umgesetzt, sondern die Befragten
waren gleichermaßen der Meinung, dass diese Angelegenheit ebenso schwach im
Marketing der Autohersteller aufgegriffen wurde.
1
Es kristallisiert sich zudem immer
mehr heraus, dass die Verbraucher zugunsten der Umwelt erstmals auch Nachteile auf
der Produktseite in Kauf nähmen. 57% würden eine geringere Höchstgeschwindigkeit
tolerieren, ein Drittel der Autokäufer würde sogar einen höheren Kaufpreis
akzeptieren.
2
Dennoch war das wohl bekannteste 3-Liter-Auto, der Lupo 3L mit einem Verbrauch von
2,99 Litern, ein wirtschaftlicher Misserfolg für die Volkswagen AG, so dass seine
Produktion eingestellt werden musste. Die zu geringen Verkaufszahlen resultierten
einerseits aus dem zu hohen Verkaufspreis, andererseits sind sie auf ein schlechtes
Marketing für dieses Fahrzeug zurückzuführen.
3
Trotz des Misserfolges dieses Öko-Autos will die Loremo AG im Herbst 2009 mit einem
Fahrzeug an den Markt gehen, welches mit einem Verbrauch von 1,5 Litern auf 100
Kilometern und einem Basispreis von 11.000 Euro
4
den Markt der Niedrig-Verbrauch-
Autos aufmischen soll. Und dies ohne den finanziellen Background eines großen
Automobilkonzerns.
5
Um dieses Projekt zu einem Erfolg werden zu lassen, bedarf es angesichts der
komplexen sowie dynamischen Markt- und Umweltbedingungen eines schlüssigen,
ganzheitlichen, auf Strategien beruhenden Marketingkonzeptes.
6
Dieses konzeptionelle
Vorgehen dient dabei der Grundlagenschaffung für schlüssiges Markthandeln auf der
Basis differenzierter Informationen und Projektionen. Durch dieses systematisch
konzeptionelle Vorgehen wird ein Taktieren verhindert, welches meist zu Ineffizienz
des Mitteleinsatzes führt und somit gleichermaßen die Effektivität, also das
gewünschte Wachstum des Unternehmens, gefährden kann.
7
Folglich ist es gerade für
Existenzgründer in besonderem Maße wichtig, ihren Markteintritt auf der Basis eines in
sich schlüssigen Marketingkonzeptes vorzubereiten und durchzuführen.
1
Vgl. Weßner, Konrad; Reiser, Stefan (2006), S. 5ff.
2
Vgl. Krafthand (2006), S. 12
3
Vgl. Horrmann, Heinz (2005), S. 21
4
Vgl. Loremo AG (2006f)
5
Vgl. Loremo AG (2005)
6
Vgl. Becker, Jochen (1998), S. 3f.
7
Vgl. Becker, Jochen (2002), S. VIIf.
2
2
Aufbau und Struktur der Arbeit
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erstellung eines Marketing- und Vertriebskonzeptes
für innovative Produkte in der Automobilbranche. Um einen Praxisbezug herzustellen,
werden die Vorgehensweisen am Beispiel der Loremo AG näher erläutert. Bei dieser
Erarbeitung soll der Fokus auf den Zeitraum des Markteintritts gelegt werden, da
spätere Maßnahmen erst in Abhängigkeit des jeweiligen Markterfolgs konkretisiert
werden können.
Kapitel 3 dient der Grundlagenschaffung und wird in Teil 3.1 zunächst auf die
Entwicklung des Marketing vom Verkäufer zum Käufermarkt bis hin zur gegenwärtigen
Sichtweise des Marketing eingehen.
Teil 3.2 wird danach die Besonderheiten des konzeptionellen Marketing aufgreifen und
sie dem Leser näher bringen. In diesem Zusammenhang erfolgt zunächst eine
begriffliche Abgrenzung, woraufhin das Wesen des konzeptionellen Marketing erläutert
wird, bis letztendlich in Abschnitt 3.2.3 die grobe Vorgehensweise bei der Erstellung
eines Marketingkonzeptes vorgestellt wird. Eine ausführlichere Auseinandersetzung
mit den einzelnen Punkten der konzeptionellen Herangehensweise erfolgt in den
jeweiligen Kapiteln während der praktischen Bearbeitung.
Kapitel 4 befasst sich mit der praktischen Ausarbeitung eines Marketingkonzeptes für
die Loremo AG.
Hierfür wird zunächst die augenblickliche Situation geprüft und analysiert. Begonnen
wird in Teil 4.1 mit der Betrachtung des Unternehmens, der Loremo AG, die als
praktischer Bezugspunkt dient. Nach der Darstellung der Loremo AG in Abschnitt
4.1.1, werden in Abschnitt 4.1.2 die Produkte dieses Unternehmens vorgestellt.
Nach diesen internen Ausführungen, befasst sich Teil 4.2 mit der Umwelt des
Unternehmens, die ebenfalls analytisch betrachtet wird. Zunächst wird in Abschnitt
4.2.1 auf die Betriebskosten von Personenkraftwagen eingegangen, damit auf dieser
Basis ein späterer Kostenvergleich zwischen den Produkten des Beispielunternehmens
und denen des Wettbewerbs erfolgen kann. In diesem Rahmen werden im
Unterabschnitt 4.2.1.1 die aktuellen Treibstoffkosten analysiert, und es wird deren
zukünftige Entwicklung prognostiziert. Weiterhin wird die Besteuerung von
Kraftfahrzeugen im Unterabschnitt 4.2.1.2 dargestellt.
Danach fällt der Fokus auf den möglichen Wettbewerb. Dieser wird herausgearbeitet,
indem in Abschnitt 4.2.2 auf mögliche Entwicklungen in der Automobilbranche
eingegangen wird. Nach einer Darstellung aktueller Fahrzeuge, die den Modellen von
3
Loremo Konkurrenz machen könnten, erfolgt in Unterabschnitt 4.2.2.2 ein
Kostenvergleich der einzelnen Modelle, dem die vorher gewonnen Daten über die
Betriebskosten zugrunde liegen. Um der zukünftigen Entwicklung der Modellpaletten
der Autohersteller gerecht zu werden, werden in Unterabschnitt 4.2.2.3 aktuelle
Konzeptfahrzeuge vorgestellt, die den Wettbewerb von morgen darstellen könnten.
Abschnitt 4.2.3 befasst sich den potentiellen Kunden der Loremo AG. Auf Basis einer
Umfrage werden die Zielgruppen und deren besondere Begehren herausgearbeitet,
um die späteren operativen Maßnahmen daran zu orientieren.
In der darauf folgenden SWOT-Analyse in Teil 4.3 werden die vorher erarbeiteten
situationsspezifischen Erkenntnisse zusammenfassend in internen Stärken und
Schwächen sowie externen Chancen und Risiken zusammengeführt und
gegenübergestellt.
Die erste Ebene des Marketingkonzeptes wird in Teil 4.4 behandelt, in dem auf Basis
der Unternehmensphilosophie und -vision das Zielprogramm für die Loremo AG erstellt
wird.
Darauf aufbauend widmet sich Teil 4.5 den Marketingstrategien als zweite Ebene des
Marketingkonzeptes. In den Unterkapiteln werden die einzelnen strategischen Ebenen
zunächst theoretisch vorgestellt, um sie dann am Beispiel der Loremo AG mit Leben zu
füllen. Abschnitt 4.5.5 wird die gewonnenen Erkenntnisse als mehrdimensionales
strategisches Gesamtkonzept zusammenfügen.
Der letzten strategischen Ebene, dem Marketingmix, widmet sich Teil 4.6. Hier erfolgt
die operative Umsetzung der vorher gewonnenen Strategien, um die anfangs
festgelegten Ziele zu erreichen. Bei der Ableitung der marketingpolitischen Mittel wird
in Abschnitt 4.6.4 insbesondere auf die Distributionspolitik eingegangen, wo nach einer
Darstellung der allgemeinen Vertriebstrends im Automobilhandel verschiedene
mögliche Absatzwege für die Produkte des Beispielunternehmens vorgestellt werden,
um im Unterabschnitt 4.6.4.5 ein möglichst vorteilhaftes Vertriebskonzept für die
Loremo AG zu erarbeiten.
Kapitel 5 liefert eine Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse, die sich bei der
Erarbeitung des Marketingkonzeptes hervorgehoben haben und liefert für diese
konkrete Handlungsvorschläge. Nach einem allgemeinen Ausblick erfolgt eine
Vorstellung, wie mit dem gewonnenen Gesamtkonzept zukünftig umgegangen werden
sollte. Daraufhin schließt die vorliegende Arbeit ab, indem kurz ein weiteres
vorstellbares Szenario beleuchtet wird.
4
3
Entwicklung und gegenwärtige Sichtweise des Marketing
3.1 Entwicklung des Marketing
Der Begriff Marketing leitet sich vom englischen Wort ,,market" ab und bedeutet
wörtlich übersetzt ,,markten" oder ,,das, was auf man auf Märkten tut".
8
Bis in die 1960er
Jahre wurde in Deutschland von der Absatzwirtschaft gesprochen. Einhergehend mit
dem Wandel vom Verkäufer- zum Käufermarkt erhielt auch der englische Begriff
seinen Einzug.
9
3.1.1 Vom Verkäufermarkt zum Käufermarkt
Von einem Verkäufermarkt wird gesprochen, wenn ein ungesättigter Markt vorherrscht,
was bedeutet, dass die Konsumenten alle produzierten Produkte nachfragen. Die
Denkhaltung der Unternehmen in einem solchen Markt ist daher sehr produktorientiert
und von Fragen geprägt, wie die Produktion ausgedehnt werden kann und wie die
Stück- oder Grenzkosten anhand von Produktionssteigerungen gesenkt werden
können.
10
Diese Marktsituation war in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis
kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zu beobachten.
11
Durch die zunehmende Industrialisierung und die durch den Einsatz von Maschinen
entstandene Massenproduktion entwickelte sich ein immer stärker werdender
Wettbewerb, wodurch in der Absatzwirtschaft nicht mehr nur das Produkt an sich
betrachtet wurde. Man versuchte vielmehr, Marktpräferenzen aufzubauen, indem man
durch Werbe- und Verpackungskonzepte Qualität kommunizierte, um sich so vom
Wettbewerb abzuheben. Um den Warenfluss vom Hersteller zum Verbraucher stabil zu
halten und zu stimulieren, wurden ferner neue Distributions- und Vertriebssysteme
entwickelt, wodurch die modernen Instrumente des Marketing entstanden. Der
sogenannte Käufermarkt bildete sich.
12
8
Vgl. Kuhlmann, Christian (2004), S. 3
9
Vgl. wemade.org (2006) in Anhang 1
10
Vgl. Wöhe, Günter (1996), S. 597
11
Vgl. Thommen, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin (1999), S. 143f.
12
Vgl. Kotler, Philip; Bliemel, Friedhelm (2001), S. 8ff.
5
3.1.2 Vom Käufermarkt zur heutigen Sichtweise des Marketing
Im Gegensatz zum Verkäufermarkt, auf dem sich die Abnehmer aufgrund mangelnder
Versorgung mit Gütern um die Lieferanten beziehungsweise Hersteller bemühen
mussten, herrscht auf dem Käufermarkt auf der Nachfrageseite ein Untergewicht.
Daher müssen sich hier die Anbieter erheblich mehr um ihre Abnehmer bemühen.
13
Es
galt nicht mehr, nur qualitativ gute Produkte mit wenig finanziellem Aufwand zu
produzieren, um sie mit erheblichen Anstrengungen zu verkaufen. Vielmehr musste
man herausfinden, was in welcher Menge nachgefragt wurde, um danach diese Menge
in der erwarteten Qualität zu produzieren. Durch diese Marktorientierung gerieten der
Markt und die potentiellen Kunden mit ihren Bedürfnissen in den Fokus des Marketing,
was auch heute noch eine zentrale Voraussetzung für erfolgreiche Unternehmen
darstellt. Diese Veränderung der Denkweise wird in der folgenden Abbildung
veranschaulicht.
Abb. 1: Vom Verkäufer- zum Käufermarkt
Eng-
pass-
Käufermarkt
Produktion
Handels-
Marketing
Kun-
den
Pro-
duktion
Administrative
Distribution
Kunden
Eng-
Denk-
pass-
rich-
rich-
rich-
tung
tung
tung
Verkäufermarkt
Quelle: Poth, Ludwig; Poth, Gudrun (2003), S. 296
13
Vgl. Nieschlag, Robert; Dichtl, Erwin; Hörschgen, Hans (1997), S. 9
6
Hinzu kommt die Ausweitung des Marketing in den 1970er Jahren mit einem Blick auf
die gesamte Umwelt des Unternehmens. Es wurden nicht mehr nur die potentiellen
Kunden betrachtet, sondern darüber hinaus auch die Anliegen der Arbeitnehmer,
Kapitalgeber, Lieferanten und die des Staates, ebenso wie ökologische und
gesellschaftliche Auffassungen.
14
Im Hinblick darauf, dass die heutigen Absatzmärkte der Unternehmen immer enger
werden, wird das Marketing sogar zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren der
Unternehmensführung.
15
Durch diese grundlegende Funktion in der
Unternehmensführung kann das Marketing heutzutage auch als eine
Führungsphilosophie gesehen werden,
16
wie es auch in der vorliegenden Arbeit
verstanden werden soll.
Eine passende Darstellung des Marketing aus heutiger Sicht liefern die folgenden drei
Definitionen:
Aktivitätsorientierte Definition:
,,Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion,
and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual
and organizational goals."
17
Führungsorientierte Definition:
,,Marketing ist die bewusst marktorientierte Führung des gesamten Unternehmens oder
marktorientiertes Entscheidungsverhalten in der Unternehmung."
18
Beziehungsorientierte Definition:
,,Marketing is to establish, maintain, enhance and commercialize customer
relationships so that the objectives of the parties involved are met. This is done by a
mutual exchange and fulfillment of promises."
19
14
Vgl. Thommen, Jean-Paul; Achleitner, Ann-Kristin (1999), S. 144f.
15
Vgl. Fritz, Wolfgang; von der Oelsnitz, Dietrich (1998), S. 15
16
Vgl. Becker, Jochen (2002), S. 1
17
American Marketing Association, zitiert bei: Fries, Andreas (2006), S. 8
18
Meffert, zitiert bei: Fries, Andreas (2006), S. 8
19
Grönroos, zitiert bei: Fries, Andreas (2006), S. 8
7
3.2 Konzeptionelles
Marketing
3.2.1 Begriffliche
Abgrenzung
Ein Konzept bedeutet soviel wie ein Entwurf oder ein Plan. Der Begriff Konzeption
hingegen steht für einen schöpferischen Einfall, einen Entwurf oder eine
Grundvorstellung.
20
Im Gegensatz zu einem Konzept geht eine Konzeption in der
Vorüberlegung und in der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Planungsobjekt
mehr ins Detail und ist in der Regel umfassender als ein Konzept.
21
In der betriebswirtschaftlichen Literatur jedoch werden die Begriffe Konzept und
Konzeption im Zusammenhang mit Marketingkonzept und Marketingkonzeption
synonym verwendet. Häufig findet sich auch der Begriff Marketingplan, der ebenso den
selben Sachverhalt darstellen soll.
In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff ,,Konzeptionelles Marketing" als theoretische
Grundlage für die weiter unten erläuterte Herangehensweise verwendet und der Begriff
,,Marketingkonzept" als Resultat des konzeptionellen Marketing.
3.2.2 Wesen des konzeptionellen Marketing
Das Marketing bietet eine Vielzahl von Instrumenten, die es einem Unternehmen
ermöglichen sollen, seinen Markt adäquat bearbeiten zu können. Weil die Situationen
im Markt und in der übrigen Umwelt des Unternehmens äußerst komplex und
ständigen Veränderungen unterworfen sind, ist ein planvoll gelenktes Marketing
unabdingbar. Um ein Unternehmen gezielt markt- und kundengerichtet zu lenken,
bedarf es demnach Handlungsanweisungen, die das konzeptionelle Marketing bietet.
22
Im Marketing wird der Fokus oft nur auf die Marketinginstrumente gelegt. Grundfragen
nach einem zielorientierten und strategieadäquaten Einsatz dieser Instrumente, um sie
auf der Basis eines Marketingkonzeptes aufzustellen, finden meist zu wenig
Beachtung.
23
Durch einen auf einem Marketingkonzept basierenden überlegten Einsatz
der Marketinginstrumente Produkt-, Preis-, Kommunikations- und Distributionspolitik
wird es dem Unternehmen möglich, seine Lage im Markt zu verbessern. Es bietet so
20
Vgl. dtv Lexikon (1995), Band 10, S. 92
21
Vgl. wissen.de GmbH (2006) in Anhang 2
22
Vgl. Becker, Jochen (2002), S. 2ff.
23
Vgl. Becker, Jochen (1998), S. VII
8
seinem Wettbewerb weniger Angriffsflächen, was seine Marktposition noch weiter
stärken kann.
24
Seinen Anfang fand das konzeptionelle Vorgehen im vorher beschriebenen Wandel
vom Verkäufer- zum Käufermarkt. Die wichtigsten Gründe für die herrschende
Komplexität und Dynamik der Unternehmensumwelt, die die Wichtigkeit einer
konzeptionellen Vorgehensweise untermauern, sind folgende:
· dynamische Wandlungsprozesse im Kaufverhalten
· schwaches beziehungsweise zum Stillstand gekommenes Marktwachstum
· Auflösung von Massenmärkten und Entstehung von Marktsegmenten
· klassische Branchenmärkte lösen sich auf
· schneller technologischer Wandel
· Verkürzung der Produktlebenszyklen
· neue gesellschaftliche und ökologische Anforderungen
25
3.2.3 Vorgehensweise bei der Erstellung eines Marketingkonzeptes
In der Marketingwissenschaft sind eine Vielzahl unterschiedlicher Vorgehensweisen
zur Erstellung eines Marketingkonzeptes vorgestellt worden. Die meisten geben dabei
jedoch nicht immer ganz vollständige Handlungsorientierungen wieder. Eine
vollständige Orientierung wird geliefert, wenn Ziele, Strategien und Maßnahmen
betrachtet werden, aus denen ein Marketingkonzept angefertigt wird.
26
Der eigentlichen Erstellung des Marketingkonzeptes muss zunächst eine genaue
Analyse der Marktsituation vorausgehen. Es müssen Informationen zu derzeitigen und
zukünftig möglichen Marktbedingungen des Unternehmens beschafft werden, die
Daten über mögliche Abnehmer, Wettbewerber und Vertriebswege enthalten.
Weiterhin muss das eigene Unternehmen untersucht werden, um seine Stärken und
Schwächen sowie seine Marktchancen und -risiken aufzuzeigen. Auf diesen Analysen
basierend wird das Marketingkonzept erstellt und anhand von drei konzeptionellen
Ebenen aufgebaut:
Die erste Ebene enthält die Marketingziele, die soviel bedeuten wie die ,,Wunschorte".
Die Marketingziele werden für gewöhnlich aus den Unternehmenszielen abgeleitet. Mit
24
Vgl. Nieschlag, Robert; Dichtl, Erwin; Hörschgen, Hans (1997), S. 18
25
Vgl. Becker, Jochen (1998), S. 3f.
26
Vgl. Fritz, Wolfgang; von der Oelsnitz, Dietrich (1998), S. 22
9
ihnen wird der angestrebte zukünftige Zustand festgelegt, der mithilfe der
absatzpolitischen Mittel erreicht werden soll. Als konzeptionelle Grundfrage kann die
Frage ,,Wo wollen wir hin?" gestellt werden.
In der zweiten Konzeptionsebene werden die Marketingstrategien formuliert, was soviel
bedeutet wie die Festlegung der ,,Route". Diese Entscheidungen haben mittel- bis
langfristigen Charakter. An ihnen werden die absatzpolitischen Mittel ausgerichtet, um
die vorher bestimmten Marketingziele zu erreichen. Die Marketingstrategien werden
anhand unterschiedlicher Strategieebenen festgelegt. Diese Ebenen sind erstens die
Marktfeldstrategien, zweitens die Marktstimulierungsstrategien, drittens die
Marktparzellierungsstrategien und viertens die Marktrealstrategien. Diese vier
Strategieebenen werden in Teil 4.5 näher erläutert. Als konzeptionelle Grundfrage für
die Formulierung der Marketingstrategien kann die Frage ,,Wie kommen wir dahin?"
gestellt werden.
In der dritten Ebene wird der Einsatz der absatzpolitischen Maßnahmen geplant, was
als Wahl der ,,Beförderungsmittel" verstanden werden kann. Dieses ist der letzte Schritt
des Marketingkonzeptes. Mit dem Zusammenwirken der absatzpolitischen
Maßnahmen, die in der Literatur oft als 4P bezeichnet werden (Product [Produktpolitik],
Price [Preispolitik], Promotion [Kommunikationspolitik], Place [Distributionspolitik]),
entsteht der Marketingmix. Die passende konzeptionelle Grundfrage wäre ,,Was
müssen wir dafür einsetzen?"
Beim Durchlaufen der drei Konzeptionsebenen findet von Ebene zu Ebene eine
zunehmende Konkretisierung statt.
27
Zusammengefasst kann ein Marketingkonzept aufgefasst werden ,,als ein schlüssiger,
ganzheitlicher Handlungsplan (,,Fahrplan") der sich an angestrebten Zielen
(,,Wunschorten") orientiert, für ihre Realisierung geeignete Strategien (,,Route") wählt
und auf ihrer Grundlage die adäquaten Marketinginstrumente (,,Beförderungsmittel")
festlegt."
28
Die folgende Abbildung bietet einen groben Überblick über die Vorgehensweise bei der
Erstellung eines Marketingkonzeptes und stellt die Beziehung zwischen der Umwelt-
und Unternehmensanalyse und dem Marketingkonzept her. Das obere Dreieck stellt
27
Vgl. Scharf, Andreas; Schubert, Bernd (1997), S. 19f.
28
Becker, Jochen (1998), S. 5
10
dabei die vorher zu erfolgenden Analysen dar, das untere Dreieck veranschaulicht ein
Marketingkonzept mit seinen drei Konzeptionsebenen.
Abb. 2: Beziehungen zwischen der Umwelt- und Unternehmensanalyse und der
Konzeptionspyramide
Umwelt-
analyse
Unternehmens-
analyse
Verdichtung Verdichtung
Verzahnung
Marketingziele
(= Bestimmung
der ,,Wunschorte")
Marketingstrategien
(= Festlegung der ,,Route")
Konzeptionsebenen:
Konzeptionelle
Grundfragen:
1. Ebene
,,Wo wollen
wir hin?"
2. Ebene
,,Wie kommen
wir dahin?"
,,Was müssen
wir dafür
einsetzen?"
3. Ebene
Marketingmix
(= Wahl der ,,Beförderungsmittel")
Quelle: Becker, Jochen (1998), S. 4 und S. 93, überarbeitete Darstellung
11
4
Entwicklung eines Marketingkonzeptes für die Loremo AG
In diesem Kapitel wird ein Marketingkonzept für die Loremo AG anhand der oben
beschriebenen Erkenntnisse entwickelt.
Zunächst werden das Unternehmen und dessen Umwelt analysiert, um darauf
basierend die beschriebenen drei konzeptionellen Ebenen Marketingziele,
Marketingstrategien und Marketingmix zu durchlaufen.
4.1 Unternehmensanalyse
4.1.1 Die Loremo AG
Die Loremo AG ist ein junges Automobilunternehmen mit Sitz in München. Die
Grundidee von Loremo ist die Entwicklung eines Autos, das nur 1,5 Liter Diesel auf
100 Kilometern verbraucht. Wie es von der Idee zum Konzeptfahrzeug kam, zeigt
Tabelle 1 auf der folgenden Seite.
Zur Zeit sind 13 Personen direkt bei der Loremo AG angestellt. Sie übernehmen dabei
hauptsächlich administrative Aufgaben oder die Leitung der Forschung und
Entwicklung. Die restlichen Aufgaben sind Partnerunternehmen übertragen worden, bei
denen insgesamt vier Personen dauerhaft für Loremo tätig sind.
Die Firma RUETZ Technologies, deren Büroräume die Loremo AG nutzt, ist enger
Partner in der Entwicklung, die Nika GmbH macht die Strömungssimulationen und die
QLF, Ingenieurgesellschaft für virtuelle Produktentwicklung, fertigt die Berechnungen
an. Der Prototypenbau wird durch die EDAG Engineering + Design AG getätigt und die
Modelle werden von der Alphaform AG hergestellt. Der Partner in der
Reifenentwicklung ist die Continental AG. Bei den Messenauftritten erfolgt die
Unterstützung durch die Heilmaier GmbH Messedesign. Den bisherigen Aufgaben im
Marketing nahm sich die IMAGO 87 GmbH an.
Die Hauptaktionäre sind einerseits die Gründer der Loremo AG sowie weitere
ausgewählte Investoren.
29
Im Mai 2006 wurde das malaysische Unternehmen Kosmo
Motor Company, eine 100%ige Tochtergesellschaft der börsennotierten Kosmo
Technology Industrial Berhad, mit 26% weiterer Anteilseigner der Loremo AG.
30
29
Vgl. Dehn-Rotfelser, Olaf von (2006a) in Anhang 4
30
Vgl. Planetary Engineering Group Earth (2006) in Anhang 5
12
Die bisherigen Investitionen belaufen sich auf circa 5 Millionen Euro. Hinzu kommen
Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von circa 2,4 Millionen Euro.
Tab. 1: Von der Idee zum Konzeptfahrzeug
1993
Der Ingenieur Uli Sommer hat die Idee für ein umweltfreundliches Auto, das
sich hauptsächlich nach dem Kriterium maximaler Effizienz richten soll und das
sich jeder leisten kann.
1995
Zusammen mit RUETZ Technologies beginnt Uli Sommer mit ersten
konzeptionellen Überlegungen zu einem hocheffizienten Fahrzeug.
2000
Die Loremo GmbH wird von Uli Sommer, Stefan Ruetz und Gerhard Heilmaier
gegründet.
2001
Das Konzept eines 1,5-Liter-Autos wird auf der Internationalen
Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt vorgestellt.
2002
Erste Designs entstehen und erste Modelle werden gebaut. Ein
Ergonomiemodell wird gebaut.
2003
Mit einem 1:4 Modell erfolgen erste Windkanaltests sowie Crash-Simulationen
am Computer.
2004 Um sich weiteren Investoren zu öffnen, gründen die Teilhaber die Loremo AG.
2005 Eine erste Kapitalerhöhung findet statt.
2006
Auf dem internationalen Automobil-Salon in Genf wird erstmalig ein
Konzeptfahrzeug vorgestellt. Eine weitere Ausstellung erfolgt auf der Kuala
Lumpur International Motor Show.
Quelle: Loremo AG (2006a) in Anhang 3; Skork, Kerstin (2006), S. 15;
Der Geschäftsplan sieht vor, bis zum Herbst 2006 einen fahrbaren Prototypen zu
entwickeln, um die ersten Testfahrten durchzuführen. Danach werden weitere Fahr-
sowie Crashtests vollzogen. Im Mai 2007 soll das endgültige Design feststehen, bis im
Oktober 2009 eine Kleinserie von voraussichtlich 10.000 Fahrzeugen produziert und
abgesetzt wird.
31
Der Break-Even-Point wird laut aktuellen Berechnungen bei einer
abgesetzten Menge von 5.000 Fahrzeugen erreicht.
32
31
Vgl. Loremo AG (2006c)
32
Vgl. Loremo AG (2005)
13
Die Produktion soll zunächst bei markenunabhängigen Automobilproduzenten erfolgen
wie zum Beispiel KARMANN. Verläuft der Markteinstieg positiv, ist der Aufbau einer
eigenen Produktion in Dorsten, Nordrhein-Westfalen, beabsichtigt.
33
4.1.2 Der Loremo LS und GT
Der Claim der Loremo AG lautet ,,simple clever fun". Er baut auf das Konzept der
geplanten Fahrzeuge der Loremo AG auf, die durch die gezielte Reduzierung des
Gewichtes und des Luftwiderstandes, wie man es aus der Luftfahrt oder dem
Motorsport kennt, einen durchschnittlichen Verbrauch von 1,5 Litern Dieselkraftstoff auf
100 km erreichen sollen.
Der Aufbau des Loremo (LOw REsistance MObil) basiert auf drei Stahlstreben und
einer patentierten stählernen Linearzellen-Struktur, wodurch eine sehr leichte und
dabei kostengünstige Konstruktion entsteht, da auf teure High-Tech-Materialien
verzichtet werden kann. Außerdem soll durch diese Konstruktionsweise, die eine
Knautschzone von 600 mm bietet, eine Crashsicherheit erreicht werden, die mit
anderen Kleinwagen vergleichbar ist.
Alles am und im Loremo konzentriert sich auf die wesentlichen Bedürfnisse des
Fahrers, um sich von A nach B zu bewegen. Es wird also schon im Vorhinein im Sinne
der Effizienzsteigerung auf Ausstattungen, die den Komfort erhöhen sollen, verzichtet,
wie zum Beispiel einer elektrischen Sitz- oder Spiegelverstellung. Durch diese
konsequente Vorgehensweise bei der Entwicklung wiegt der Loremo mit 450 kg
weniger als die Hälfte aller vergleichbaren Pkw.
Durch das stromlinienförmige Design der Karosserie und durch die sehr geringe
Fahrzeughöhe und breite wird ein Luftangriffsfläche von 0,22 m² erreicht. Im Vergleich
hierzu hat das 3-Liter-Auto der Volkswagen AG, der aerodynamisch optimierte Lupo
3L, einen Wert von 0,57 m²,
34
der damit mehr als doppelt so groß ist.
Um dem ,,fun" als Bestandteil des Claims gerecht zu werden, versprechen die
Entwickler, dass der Loremo dem Fahrer ein Sportwagen-Feeling vermittle.
Unterstrichen wird dies durch das sportlich gehaltene Design des Fahrzeuges, welches
in Abbildung 3 zu sehen ist.
33
Vgl. Dehn-Rotfelser, Olaf von (2006a) in Anhang 4
34
Vgl. Volkswagen AG (2006a) in Anhang 6
14
Abb. 3: Showcar Loremo LS
Quelle: Loremo AG (2006b)
Konzipiert ist der Loremo als 2+2 Sitzer, was bedeutet, dass die Sitze im Fond des
Wagens nicht als vollwertig angesehen werden können. Begründet ist dies damit, dass
einerseits für Passagiere auf den hinteren Sitzen nur wenig Platz vorhanden ist und
andererseits das Heck gleichzeitig als Kofferraum genutzt wird.
35
Laut Hersteller
können Personen bis circa 1,45 m Körpergröße bequem auch für lange Strecken im
Heck Platz nehmen. Für größere Personen sind die Notsitze jedoch allenfalls für
Kurzstrecken geeignet.
36
Die Besonderheit der Notsitze ist ihre Janusanordnung, was
soviel bedeutet, dass die hinteren Fahrgäste mit dem Rücken zur Fahrtrichtung sitzen.
Dieser Aufbau wurde aufgrund der Aerodynamik gewählt, damit das Heck möglichst
weit nach hinten abfallen kann. Zwischen den vorderen und den hinteren Sitzen wird
der Mittelmotor untergebracht, der die Hinterachse antreibt.
Eine weitere herausstechende Besonderheit ist das Einstiegskonzept des Loremo, wie
es in Abbildung 4 gezeigt wird.
35
Vgl. Dehn-Rotfelser, Olaf von (2006a) in Anhang 4; Loremo AG (2006c)
36
Vgl. Heilmaier, Gerhard (2006) in Anhang 15
15
Abb. 4: Einstiegskonzept Loremo
Quelle: Loremo AG (2006b)
Da aufgrund der Steifigkeit und der Crashsicherheit auf ein Türsystem, wie es in
gängigen Pkw vorzufinden ist, verzichtet wurde, wird beim Loremo der komplette
Frontbereich mitsamt des Lenkrads hochgeklappt. Der Einstieg erfolgt wie in eine
Badewanne. Die Fondpassagiere steigen durch die Heckklappe ein.
Geplant ist es, den Loremo mit zwei Motorvarianten anzubieten; einem 20 PS und
einem 50 PS Dieselmotor. Damit soll eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 20
beziehungsweise in 9 Sekunden erreicht werden und eine Höchstgeschwindigkeit von
160 km/h beziehungsweise 220 km/h. Bei der Motorvariante mit 50 PS ist zu
erwähnen, dass hier ein durchschnittlicher Verbrauch von 2,7 Litern auf 100 km
erreicht werden soll.
37
Der Hubraum der kleineren Motorvariante liegt bei 650 cm³, der
der größeren Variante bei 900 cm³.
38
Der geplante Grundpreis liegt für die 20 PS Version unter 11.000 Euro und für die 50
PS Version unter 15.000 Euro.
39
Ferner ist ein modulares Dachkonzept geplant. Durch
einen einfachen Austausch des Dachmoduls kann das oben beschriebene Fahrzeug
37
Vgl. Loremo AG (2006f)
38
Vgl. Loremo AG (2005)
39
Vgl. Loremo AG (2006f)
16
leicht in ein Cabriolet oder einen Pickup verwandelt werden. Man hätte also drei
unterschiedliche Fahrzeugtypen in einem.
40
Die technischen Daten beider Fahrzeuge sind Tabelle 2 zu entnehmen.
Tab. 2: Technische Daten des Loremo LS und GT
Technische Daten
Loremo LS
Loremo GT
Motor 2-Zylinder-Turbo-Diesel
3-Zylinder-Turbo-Diesel
Leistung
15 kW/ 20 PS
36 kW/ 50PS
V max
160 hm/h
220 km/h
Beschleunigung 0-100 km/h
20 sek.
9 sek.
Getriebeart 5-Gang-Schaltgetriebe
5-Gang-Schaltgetriebe
Antrieb
Mittelmotor/ Heckantrieb
Mittelmotor/ Heckantrieb
Verbrauch
1,5 l/ 100 km
2,7 l/ 100 km
Reichweite (20-l-Tank)
1.300 km
800 km
Gewicht
450 kg
470 kg
Luftwiderstand
CwxA=0,22 m²
CwxA=0,22 m²
Sitze 2+2 2+2
Maße (l x b x h)
384 cm x 136 cm x 110 cm 384 cm x 136 cm x 110 cm
Preis
< 11.000 Euro
< 15.000 Euro
Serie
Airbags, Rußfilter, Radio
Airbags, Rußfilter, Radio
Extras
On-Board-PC, Klimaanlage,
MP3-Player,
Navigationssystem
On-Board-PC, Klimaanlage,
MP3-Player,
Navigationssystem
Quelle: Loremo AG (2006f)
Als Antriebskonzept sind zunächst nur die beiden Dieselmotorvarianten vorgesehen.
Es wird jedoch auch über alternative Motorenkonzepte wie einen Hybridantrieb oder
einen Elektromotor nachgedacht. Da aber zur Zeit die Entwicklungskosten für solche
40
Vgl. Loremo AG (2005)
17
Motoren zu hoch sind und sich dies negativ auf das Preisleistungsverhältnis auswirkte,
wird hierauf in der nahen Zukunft kein Schwerpunkt gelegt.
41
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Unique Selling Proposition (USP) des
Loremo die eines sportlichen Kleinstwagens mit einem außergewöhnlichen Design ist,
der einen äußerst geringen Verbrauch und einen relativ geringen Anschaffungspreis
hat.
Auf Kritikpunkte beziehungsweise Schwächen des Loremo wird im Rahmen der
SWOT-Analyse in Teil 4.3 eingegangen.
4.2 Umweltanalyse
4.2.1 Einflüsse auf die Betriebskosten eines Pkw
In diesem Abschnitt wird auf die Betriebskosten von Personenkraftwagen
eingegangen, da der besonders niedrige Verbrauch des Loremo einen seiner großen
Vorteile darstellt und so ein Kostenvergleich zu Konkurrenzprodukten ermöglicht wird.
Auf Kosten, die beispielsweise aus dem Verbrauch von Schmieröl oder der
Reifenabnutzung auftreten, wird hierbei verzichtet, da der signifikante Kostenanteil
dem Kraftstoffverbrauch und den Kfz-Steuern zugerechnet werden kann. Außerdem
wird die Kfz-Versicherung nicht betrachtet, da es hier einerseits regionale Unterschiede
gibt und eine Einordnung des Loremo noch nicht erfolgt ist.
4.2.1.1 Entwicklung der Kraftstoffpreise
Die Kraftstoffe, die die Automobile heutzutage antreiben, sind zum größten Teil
Produkte, die aus Rohöl oder anderen fossilen Brennstoffen gewonnen werden. Von
den insgesamt circa 46 Millionen Pkw am 1. Januar 2006 in Deutschland sind etwa 36
Millionen Fahrzeuge mit einem Benzin- und ungefähr 10 Millionen Fahrzeuge mit
einem Dieselmotor ausgestattet. Nur rund 3.000 Pkw haben ein anderes
Antriebskonzept.
42
Das bedeutet einen Anteil an Benzinmotoren von circa 80% und
einen Anteil von Dieselmotoren von circa 20%. Sonstige Triebwerke machen nur einen
Teil von deutlich unter einem Prozent aus.
41
Vgl. Sommer, Uli (2006e) in Anhang 10
42
Vgl. Kraftfahrtbundesamt (2006) in Anhang 7
18
Auch der Trend, der sich aus Neukäufen von Automobilen ergibt, wird keine deutliche
Wendung im Fahrzeugbestand hervorrufen. 2005 entschieden sich circa 65% der
Neuwagenkäufer für einen Benzinmotor und 30% für einen Diesel. Nur etwa 5%
wählten Erdgas als Treibstoff.
43
Daraus wird leicht ersichtlich, dass in Deutschland die Mobilität mit dem eigenen Pkw
sehr stark von der Entwicklung der Rohölpreise und des Dollars abhängig ist.
Die Preisentwicklung des Erdöls ist dabei abhängig vom Angebot und der Nachfrage
an der Börse, wo das Öl gehandelt wird. Einflüsse auf die Preise sind unter anderem
ein plötzlicher Anstieg der Nachfrage, Versorgungsengpässe durch einen technischen
Defekt und politische Ereignisse. Weiterhin beeinflusst die geplante Fördermenge den
Marktpreis.
Letztendlich ist es für die zukünftige Preisentwicklung unwichtig, wie lange die
Erdölreserven noch reichen. Vielmehr kommt zum Tragen, wie lange die
Förderungsmenge aufgrund der geologischen und technischen Bedingungen noch
erhöht werden kann, um den weiter steigenden Bedarf weiterhin zu decken.
44
Festzustellen ist, dass die Ölpreise seit dem Ende des 20. Jahrhunderts kontinuierlich
steigen, wie es der folgende Graph verdeutlicht.
Abb. 5: Ölpreise 1985-2006
Quelle: Tecson GmbH (2006) in Anhang 9
43
Vgl. Aral AG (2005), S. 14
44
Vgl. Energiekrise.de (2002) in Anhang 8
19
Weitere Einwirkungen, die den Kraftstoffpreis ausmachen, sind der örtliche
Wettbewerb der Tankstellen sowie die Besteuerung der Treibstoffe.
Kraftstoffe sind in Deutschland dreifach besteuert: mit der Ökosteuer, der
Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer. Die Ökosteuer liegt derzeit bei 15,3 Cent pro
Liter Kraftstoff.
45
Die Mineralölsteuer beträgt für einen Liter Dieselkraftstoff 47 Cent
46
und die Mehrwertsteuer liegt derzeit bei 16%, ab dem 1. Januar 2007 bei 19%.
47
Der Preis für einen Liter Kraftstoff setzt sich also folgendermaßen zusammen: zu den
Importkosten werden die Vermarktungskosten sowie die Öko- und Mineralölsteuer
addiert. Auf Basis dieser Summe wird die Mehrwertsteuer errechnet und ebenfalls
aufgeschlagen.
Betrachtet man die Entwicklung der Spritpreise von 2002 bis 2006, wird deutlich, dass
über diesen Zeitraum die Preise für einen Liter jährlich um durchschnittlich 7%
gestiegen sind.
48
Geht man davon aus, dass diese durchschnittliche Steigerungsrate
bis 2010 vorhält, könnten sich die Kraftstoffpreise unter Berücksichtigung der neuen
Mehrwertsteuer ab 2007 folgendermaßen entwickeln, wobei eine solche Prognose nur
als sehr vage angesehen werden kann.
Abb. 6: Prognose für die Preisentwicklung von Kraftstoffen
Preis in Cent je Liter
83,6
88,4
93,7
106,1
112,8
123
132
141
152
102,5
107,1
111,3
119,7
131,9
144
153
164
175
104,6
109,2
113,3
121,7
133,8
146
157
168
179
60
80
100
120
140
160
180
200
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Diesel
Normal
Super
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an ADAC e.V. (2006) in Anhang 13
45
Vgl. Umweltbundesamt (2005), S. 1
46
Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2006a) in Anhang 11
47
Vgl. ZDF (2006) in Anhang 12
48
Vgl. ADAC e.V. (2006) in Anhang 13
20
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei den Dieselpreisen im oberen Viertel
zusammen mit Dänemark auf Platz vier. Deutlich am teuersten ist der Liter Diesel in
Großbritannien gefolgt von Schweden und Italien.
49
4.2.1.2 Kfz-Steuern in Deutschland
Die Kfz-Steuer wird seit geraumer Zeit als umweltpolitisches Steuerungsorgan
verwendet und nimmt somit Einfluss auf zukünftige Mobilitätskonzepte und auf die
Betriebskosten der Pkw. Dieser Steuer unterliegen alle Kraftwagen, die auf öffentlichen
Straßen genutzt werden und wird ab der Zulassung bis zur Abmeldung erhoben.
Bei Pkw erfolgt die Berechnung der Kfz-Steuer aufgrund des Hubraums und der Art
des Motors. Außerdem ist die Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten maßgebend. Alle
steuerlichen Förderungen für besonders schadstoffarme Autos sind am 31.12.2005
ausgelaufen.
50
Zur Zeit gelten die in Tabelle 2 dargestellten emissionsbezogenen Steuersätze je
angefangenen 100 Kubikzentimeter Hubraum:
Tab. 3: Kraftfahrzeugsteuer
Emissionsgruppe
Benzin
Diesel
Euro4, Euro3, 3-Liter-Auto
6,75
15,44
Euro2
7,36
16,05
Euro1 und vergleichbar
15,13
27,35
Pkw, die bei Ozonalarm
fahren dürfen
21,07
33,29
Pkw, die bei Ozonalarm
nicht fahren dürfen
25,36
37,58
Sonstige Pkw
25,36
37,58
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2006b), vereinfachte Darstellung
49
Vgl. AvD Wirtschaftsdienst GmbH (2006) in Anhang 14
50
Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2006b) in Anhang 16
21
4.2.2 Entwicklungen in der Automobilbranche
Betrachtet man die gegenwärtigen Entwicklungen in der Automobilbranche, wird
deutlich, dass die großen Autohersteller vor allem prestigebringende Modelle in den
Vordergrund stellen. Die Autos müssen größer und komfortabler sein und immer mehr
Leistung bringen. Auch der Faktor Spaß und vielfältiger Praxisnutzen entwickelt sich
immer weiter. Dies zeigt eine Studie des ADAC, die besagt, dass die Beliebtheit von
Vans, Sportwagen (inklusive Cabrios und Roadster) sowie SUVs beziehungsweise
Geländewagen immer mehr zunimmt.
51
Um dabei den immer höher werdenden Spritpreisen gerecht zu werden und um das
Image zu erhalten, sich um die Umwelt Gedanken zu machen, wird nicht an einer
optimierten Aerodynamik oder einer gezielten Reduktion des Fahrzeuggewichtes
gearbeitet, sondern es wird primär an neuen Antriebskonzepten geforscht. Im
Mittelpunkt steht derzeit der Hybridmotor, der schon als Zukunft der Automobilbranche
gehandelt und als Übergangskonzept zur Brennstoffzelle gesehen wird. Bei einem
Hybridmotor verfügt ein Fahrzeug über zwei Motoren; einen konventionellen
Verbrennungsmotor und einen Elektromotor. Im Stadtverkehr kann das Auto mit dem
Elektromotor angetrieben werden, bei schnellerem Fahrbetrieb wird auf den
Verbrennungsmotor umgeschaltet und bei voller Beschleunigung arbeiten beide
Motoren gleichzeitig. Die Batterie des Elektromotors wird durch den
Verbrennungsmotor sowie durch regeneratives Bremsen gespeist. Auch
hochgezüchtete Motoren mit 340 PS können so mit unter 10 Litern Spritverbrauch
betrieben werden. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen neuen Antriebskonzepten
liegt bei dem schon vorhandenen Tankstellennetz. Ein großer Nachteil ist der noch
immer recht hohe Anschaffungspreis von Fahrzeugen mit einer solchen
Motorentechnologie.
52
Ein optimierter Luftwiderstand sowie ein reduziertes Fahrzeuggewicht sind beim Lupo
3L, dem wohl bekanntesten 3-Liter-Auto, zu finden, der 1999 von der Volkswagen AG
auf den Markt gebracht wurde. Da die Gewichtsoptimierung jedoch mit teuren
Werkstoffen realisiert wurde, war der Verkaufspreis entsprechend hoch. Der Lupo 3L
wurde vom Markt nicht angenommen und die Produktion somit 2005 eingestellt.
53
Jedoch lassen die weiter steigenden Betriebskosten für Autos die Autokäufer immer
mehr auf ihren Geldbeutel achten. Laut einer Umfrage des
Meinungsforschungsinstitutes Puls wird in naher Zukunft der Trend zu
51
Vgl. ADAC motorwelt (2006), S. 6
52
Vgl. Wirtschaftswoche (2006), S. 68ff.
53
Vgl. Volkswagen AG (2006a) in Anhang 6
22
Oberklasseautos zurückgehen und Kleinwagen und Mittelklassefahrzeuge werden
wieder verstärkt in die Gunst der Käufer rücken.
54
Auch die steigende Zukunftsangst
lässt die deutschen Konsumenten weiter sparen und sogenannte Billigautos werden
bei der Kaufentscheidung für ein neues Automobil wichtiger.
55
Solche Fahrzeuge, die dem Loremo durch ihren niedrigen Verbrauch oder die
günstigen Anschaffungskosten Konkurrenz machen könnten, sollen in den beiden
folgenden Unterpunkten vorgestellt werden.
4.2.2.1 Möglicher
Wettbewerb
In diesem Unterabschnitt werden die Fahrzeuge Smart Fortwo Coupé cdi und 37kW,
Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107, Daihatsu Cuore 1,0, Opel Corsa 1,0 Twinport
und 1,3 CDTI, Dacia Logan, Toyota Prius und der Smart Roadster als mögliche
Konkurrenzprodukte zum Loremo näher betrachtet.
56
Smart Fortwo Coupé
Der Smart Fortwo cdi ist das derzeit einzige 3-Liter-Auto in Serienproduktion. Der
Verbrauch des Dieselmotors mit 41 PS liegt bei 3,8 Litern auf 100 Kilometern. Er
beschleunigt in 19,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h. Der reine Zweisitzer hat ein Kofferraumvolumen
von bis zu 363 Litern und schlägt in der Dieselvariante mit einem Grundpreis von
10.850 Euro zu Buche. Für den Smart mit dem 50 PS Benzinmotor (Super) liegt der
Grundpreis bei 9.450 Euro. Dieser hat einen Verbrauch von 4,7 Litern auf 100
Kilometern und nach einer Beschleunigung in 18,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h
erreicht er die selbe Spitzengeschwindigkeit von 135 km/h.
Smart ist eine Marke der DaimlerChrysler AG. Sie wird jedoch von einem eigenen
Händlernetz in den sogenannten Smart-Centern vertrieben. Nach anfänglichen
Absatzschwierigkeiten ist die Marke mittlerweile zu einem Kultstatus avanciert, was
auch die zahlreichen exklusiven und originellen Smart-Produkte, wie Uhren, Kleidung
und sonstige Accessoires zeigen.
Die große Besonderheit des Smart Fortwo ist seine Länge von nur 2,5 Metern.
Dadurch wird er zu einem optimalen Gefährt in Großstädten, in denen chronische
Parkplatznot herrscht. Es gibt für dieses Auto außerdem die besondere Parkregel,
54
Vgl. Handelsblatt (2006), S. 18
55
Vgl. AUTOHAUS (2005a), S. 26
56
Siehe auch Anhang 17 bis 23
23
dass es quer in Parklücken abgestellt werden darf. In einigen Parkhäusern und
Waschanlagen bekommt man mit einen Smart zudem besondere Rabatte.
57
Abb. 7: Smart Fortwo Coupé
Quelle: Smart GmbH 2006
Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107
58
Die drei Kleinwagen Toyota Aygo, Citroën C1 und Peugeot 107 sind eine
gemeinschaftliche Entwicklung und basieren auf der selben Plattform. Der Citroën mit
einem 54 PS Dieselmotor verbraucht beispielsweise 4,1 Liter auf 100 Kilometern,
beschleunigt in 15,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 154 km/h. In dieser Motorenausführung kostet er
mindestens 10.700 Euro. Nur 8.950 Euro kostet der Toyota mit einem 68 PS
Benzintriebwerk (Normal). Dieser hat einen angegebenen Durchschnittsverbrauch von
4,6 Litern, beschleunigt in 14,2 Sekunden auf 100 km/h und fährt 157 km/h Spitze.
Die drei Wagen sind zu 92% baugleich und unterscheiden sich nur durch
markenspezifische Anbauteile und unterschiedlichen Angeboten bei den Motoren. Auf
einer Länge von 3,4 Metern bieten sie vier Sitzplätze und ein Kofferraumvolumen von
bis zu 782 Litern. Die vier Sterne im Euro-NCAP-Crashtest zeigen das hohe
Sicherheitsniveau der drei Modelle.
59
Der zweite Platz auf der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Auto-Umweltliste
verdeutlicht dazu ihre Umweltverträglichkeit.
60
57
Vgl. Smart GmbH (2006)
58
Da sich die drei Modelle sehr ähneln, wird hier nur auf den Toyota Aygo und den Citroën C1 näher
eingegangen
59
Vgl. Toyota Deutschland GmbH (2006); Citroën Deutschland AG (2006); Peugeot Deutschland GmbH
(2006)
60
Vgl. Verkehrsclub Deutschland e.V. (2006) in Anhang 24
24
Abb. 8: Peugeot 107, Toyota Aygo, Citroën C1
Quelle: Toyota Deutschland GmbH (2006); Citroën Deutschland AG (2006); Peugeot
Deutschland GmbH (2006)
Daihatsu Cuore
Der Daihatsu Cuore 1,0 wird von einem 58 PS Benzinmotor angetrieben und mit
Normalbenzin betankt. Er hat eine Beschleunigung von 12,2 Sekunden von 0 auf 100
km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Sein durchschnittlicher
Verbrauch liegt bei 4,8 Litern. Die Länge des Japaners liegt bei circa 3,4 Metern und er
bietet vier Personen Platz in seinem Innenraum. Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu
421 Litern. Mit einem Preis von nur 7.995 Euro ist der Daihatsu eines der günstigsten
Autos auf dem deutschen Markt.
61
Auch bei diesem Fahrzeug zeigt der 5. Rang (direkt hinter den Drillingsfahrzeugen
Aygo, C1 und 107) auf der VCD Auto-Umweltliste seine Umweltverträglichkeit.
62
Abb. 9: Daihatsu Cuore
Quelle: Daihatsu Deutschland GmbH (2006)
61
Vgl. Daihatsu Deutschland GmbH (2006)
62
Vgl. Verkehrsclub Deutschland e.V. (2006) in Anhang 24
25
Opel Corsa
Der Opel Corsa wird in der günstigsten Variante mit einem 60 PS Benzinmotor (Super)
zu einem Preis von 10.990 Euro angeboten. Das im Verbrauch bessere Modell mit
einem 75 PS Dieselmotor kostet über 2.000 Euro mehr, hat aber einen Verbrauch von
nur 4,6 Litern im Vergleich zu den 5,6 Litern des Benziners. Der Benzinmotor
beschleunigt den Corsa in 18,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Der Diesel benötigt für den Sprint auf 100 km/h
14,5 Sekunden und fährt eine Spitzengeschwindigkeit von 163 km/h.
Die Besonderheit dieses Kleinwagens sind die fünf vorhandenen Sitzplätze auf einer
Länge von fast vier Metern. Bei umgeklappter Rückbank hat der Rüsselsheimer ein
Ladevolumen von bis zu 1.050 Litern.
63
Abb. 10: Opel Corsa
Quelle: Adam Opel GmbH (2006)
Dacia Logan
Der in Rumänien produzierte Logan der Renault-Tochter Dacia gilt als sogenanntes
Billigauto. Mit einem 75 PS Benzinmotor (Super) ist er ab 7.200 Euro zu haben,
verbraucht 6,9 Liter auf 100 Kilometern, beschleunigt in 13 Sekunden auf 100 km/h
und fährt bis zu 162 km/h schnell. In der Version mit einem 68 PS Dieselmotor kostet
er mindestens 9.750 Euro, hat einen Verbrauch von 4,7 Litern, eine Beschleunigung
von 15 Sekunden und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 158 km/h. Mit einer
Länge von circa 4,2 Metern bietet die Stufenhecklimousine Platz für fünf Personen und
einen Kofferraum mit 510 Litern Ladevolumen.
64
63
Vgl. Adam Opel GmbH (2006)
64
Vgl. Renault Nissan Deutschland AG (2006)
26
Negativ an diesem Fahrzeug ist sein Image als Billigauto, sein emotionsloses Design
sowie die in seiner Klasse schlechte Crashsicherheit. Um dem negativen Image
entgegenzuwirken, wurde im November 2005 eine Imagekampagne gestartet. Darüber
hinaus richtet der ADAC im Jahr 2006 eine eigene Tourenwagen-Rennserie für dieses
Fahrzeug, den ADAC Dacia Logan Cup, aus.
65
Abb. 11: Dacia Logan
Quelle: Renault Nissan Deutschland AG (2006)
Toyota Prius
Im Gegensatz zu den anderen vorgestellten Modellen kann der Toyota Prius in das
Segment der unteren Mittelklasse eingeordnet werden. Seine Umweltfreundlichkeit
erreicht er durch seine Hybridtechnologie. Die Kombination aus einem Benzin- (Super)
und einem Elektromotor liefert 78 PS. Der Verbrauch liegt bei 4,3 Litern und die
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h bei 10,9 Sekunden. Der Prius erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von 170 km/h. Im Innenraum finden bis zu fünf Personen Platz
und es kann bis zu 1.210 Liter Gepäck mitgenommen werden. Jedoch hat die
zukunftsweisende Hybridtechnologie ihren Preis. Für das Grundmodell zahlt man
24.250 Euro.
66
Immerhin wird der Prius mit dem ersten Platz in der VCD Auto-
Umweltliste belohnt.
67
65
Vgl. Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. KG (2006) in Anhang 25
66
Vgl. Toyota Deutschland GmbH (2006)
67
Vgl. Verkehrsclub Deutschland e.V. (2006) in Anhang 24
27
Abb. 12: Toyota Prius
Quelle: Toyota Deutschland GmbH (2006)
Smart Roadster
Der zweisitzige Smart Roadster gilt als Vertreter der Sportwagen unter den
Kleinstwagen. Mit einem Benzinmotor (Super) mit 61 PS hat er einen
Durchschnittsverbrauch von 4,9 Litern. In 15,5 Sekunden beschleunigt er von 0 auf 100
km und fährt 160 km/h Spitze. Das Basismodell wird für 14.990 Euro angeboten und
kann Gepäck mit einem Volumen von nur 145 Litern mitführen. Mit einer Länge von 3,4
Metern ist er fast einen Meter länger als der Smart Fortwo, hat jedoch genau wie der
Fortwo die Grundvoraussetzungen, sich zu einem Kultwagen zu entwickeln.
68
Abb. 13: Smart Roadster
Quelle: Smart GmbH (2006)
68
Vgl. Smart GmbH (2006)
28
4.2.2.2 Vergleich des Loremo zum Wettbewerb
Geht man davon aus, dass die durchschnittliche Fahrleistung eines Autofahrers bei
12.000 Kilometern pro Jahr liegt
69
und dass der Wertverlust eines Neufahrzeuges nach
zwei Jahren 25% beträgt,
70
kann man die etwaigen Kosten für das Fahrzeug in diesen
zwei Jahren bestimmen. Legt man die prognostizierten Kraftstoffpreise für 2009
zugrunde
71
ergibt sich nach den Betriebskosten
72
folgende Rangfolge der oben
vorgestellten Fahrzeuge:
73
1.
Loremo
LS
4.570
2.
Daihatsu
Cuore 4.820
3.
Toyota
Aygo
5.080
4. Smart Fortwo Coupé 37kW
5.300
5. Smart Fortwo Coupé cdi
5.330
6. Dacia Logan 1,5 dCi
5.470
7. Dacia Logan 1,4 MPI
5.490
8.
Citroën
C1
5.560
9. Opel Corsa 1,0 Twinport
6.240
10.
Loremo
GT
6.440
11. Opel Corsa 1,3 CDTI
6.580
12.
Smart
Roadster
7.320
13.
Toyota
Prius
10.420
Hieraus wird ersichtlich, dass der Loremo LS auch bei einer jährlichen Fahrleistung von
nur 12.000 Kilometern für diesen Zweijahreszyklus das günstigste Fahrzeug ist, dicht
gefolgt vom Daihatsu Cuore und dem Toyota Aygo, die beide mit einem Benzinmotor
ausgestattet sind. Dadurch ist ihr Anschaffungspreis geringer als der von
Dieselmodellen und die Kfz-Streuer fällt ebenfalls niedriger aus. Das zeigt sich auch
bei den beiden Smart Coupés, bei denen ebenfalls die Benzinvariante die günstigere
ist. Eine höhere jährliche Fahrleistung würde sich letztlich positiv auf die Kosten der
Modelle mit den weniger verbrauchenden Dieselmotoren auswirken und somit den
teureren Dieselmotor und die höhere Kfz-Steuer ausgleichen. Speziell träfe das auf
69
Vgl. UPI Umwelt- und Prognose-Institut e.V. (2006) in Anhang 27
70
Vgl. Autokiste (2006) in Anhang 26
71
Vgl. Unterabschnitt 4.2.1.1
72
Die Kosten für Versicherung, Reifenabnutzung, Ölverbrauch und ähnliches wurden nicht betrachtet
73
Die Berechnung erfolgte folgendermaßen: (Grundpreis) + (Kraftstoffkosten in 2 Jahren) + (Kfz-Steuer in
2 Jahren) (Grundpreis * 0,75)
29
den Loremo zu, bei dem der LS mit 1,5 Litern und der GT mit 2,7 Litern auf 100
Kilometern deutlich den niedrigsten Verbrauch aller vorgestellten Fahrzeuge haben
und so besonders der Loremo GT seinen recht hohen Anschaffungspreis egalisieren
kann. Der durchschnittliche Verbrauch der Wettbewerber liegt zwischen 3,8 Litern
Diesel beim Smart Fortwo cdi und 6,9 Litern Super beim Dacia Logan 1,4 MPI.
Mit 20 PS ist der Loremo LS der am schwächsten motorisierte Wagen. Den stärksten
Motor hat der Toyota Prius mit 78 PS, dem in diesem Vergleich wegen des hohen
Anschaffungspreises und seiner Einordnung als einziges Modell der unteren
Mittelklasse keine weitere Beachtung geschenkt werden soll. Somit sind der Dacia
Logan 1,5 dCi und der Opel Corsa 1,3 CDTI mit 75 PS die leistungsstärksten Modelle.
Mit 50 PS liegt der Loremo GT im Mittelfeld. Hier kommt nun der Vorteil des Konzeptes
der Leichtbauweise und des geringen Luftwiderstandes der Loremo-Modelle zum
Tragen. Neben dem geringen Verbrauch bieten beide Modelle gute bis sehr gute Werte
bei Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. Der Loremo GT erreicht hier sogar die
besten Werte. Er ist das einzige Fahrzeug, das in unter zehn Sekunden von 0 auf 100
km/h beschleunigen kann und eine Höchstgeschwindigkeit von 220 km/h erreicht,
wodurch seine Sportlichkeit unterstrichen wird. Die zügigste Beschleunigung erreichen
ansonsten der Daihatsu Cuore mit 12,2 Sekunden gefolgt vom Dacia Logan mit 13
Sekunden. Die höchste Endgeschwindigkeit erreichen bei den möglichen
Wettbewerbern der Opel Corsa 1,3 CDTI mit 163 km/h, der Dacia Logan 1,4 MPI mit
162 km/h und der Daihatsu Cuore sowie der Smart Roadster mit 160 km/h. Alle diese
Werte entsprechen etwa der Höchstgeschwindigkeit des Loremo LS mit 160 km/h, der
somit ebenfalls zu den schnellsten Fahrzeugen gehört.
Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h bildet der Loremo LS jedoch mit 20
Sekunden das Schlusslicht. Dass sich dieser Wert aber als praxistauglich erweist,
zeigen die nicht viel besseren Zeitspannen während des Sprints auf 100 km/h bei den
Smart Fortwo Coupés mit 19,8 Sekunden beim cdi und 18,3 Sekunden beim 37kW
sowie beim Opel Corsa 1,0 Twinport mit 18,2 Sekunden.
Betrachtet man die Außenmaße der untersuchten Automobile zeigt sich, dass ihre
Länge zwischen 3,4 Metern beim Daihatsu Cuore sowie bei den Drillingsmodellen
Toyota Aygo, Citroën C1 und Peugeot 107 und 4 Metern beim Opel Corsa liegt. Der
Loremo liegt mit einer Länge von 3,8 Metern im oben Mittelfeld der längsten Karossen.
Anzumerken ist hier, dass alle Modelle Vier- beziehungsweise Fünfsitzer sind. Im
Gegensatz hierzu hat der Loremo nur zwei vollwertige Sitze plus zwei Notsitze. Eine
weitere Ausnahme bilden die Modelle von Smart. Der Roadster hat typbedingt nur zwei
Sitze bei einer Länge von 3,4 Metern. Bei den Coupés werden ebenfalls nur zwei Sitze
30
angeboten, jedoch sind diese Modelle mit einer Länge von nur 2,5 Metern
außergewöhnlich kurz.
Mit einer Breite von 1,36 Metern und einer Höhe von 1,1 Metern liegt der Loremo
deutlich unter den Maßen der anderen Fahrzeuge. Diese haben Breiten von 1,47
Metern beim Daihatsu Cuore bis zu 1,94 Metern beim Opel Corsa. Die Fahrzeughöhe
beträgt durchweg um die 1,5 Meter, nur der Smart Roadster misst hier geringe 1,19
Meter. Die geringen Maße des Loremo sind ebenfalls ein Tribut an den Luftwiderstand,
wodurch seine Ladekapazitäten beschränkt werden. Bis auf den Smart Roadster, der
typenbedingt nur zwei Personen Platz bietet und den Smart Coupés, die wegen ihrer
Länge ebenfalls nur zwei Plätze vorweisen können, sind alle weiteren Fahrzeuge
mindestens vollwertige Viersitzer. Im Opel Corsa und Dacia Logan können sogar fünf
Passagiere befördert werden.
Da das endgültige Design des Loremo zur Zeit noch nicht feststeht, kann noch keine
endgültige Aussage über sein Kofferraumvolumen gemacht werden. Stauraum für das
Gepäck sollen momentan im Frontbereich angeboten werden und im Heck bei den
Fondpassagieren. Es besteht auch die Möglichkeit eines etwas größeren Stauraumes
bei einer reinen zweisitzigen Version.
74
Beim vorgestellten möglichen Wettbewerb fällt
das Kofferraumvolumen beim Smart Roadster mit 145 Litern am geringsten aus, wobei
dies auch hier mit der roadstertypischen Bauweise zu erklären ist. Das Smart Coupé
bietet Platz für bis zu 363 Liter, wobei hier der Gepäckraum nicht durch umklappbare
Sitze bei Bedarf vergrößert werden kann. Eine unvariable Kofferraumgestaltung liegt
ebenfalls beim Dacia Logan vor, der aber bis zu 510 Liter fassen kann. Die restlichen
Modelle bieten dank umklappbarer Rücksitzbänke Stauraum von 157 bis 421 Litern
beim Daihatsu Cuore und 130 bis 782 Litern beim Toyota Aygo und den baugleichen
Modellen von Citroën und Peugeot. Der Opel Corsa hat mit 285 bis zu 1.050 Litern das
größte Fassungsvermögen für Gepäck.
Über das Design ein rein objektives Statement zu formulieren, ist an dieser Stelle
schwer machbar. Es ist soviel anzumerken, dass die Modelle von Smart ein eher
auffälliges Design bieten, was gerade dem Coupé zu einem Kultcharakter verholfen
hat. Im Gegensatz dazu wartet der Dacia Logan mit einer eher biederen Form auf. Die
übrigen Modelle haben die kleinwagentypische kompakte Bauweise und zeigen
überwiegend runde und weiche Formen und Linien. Hier sticht der Opel Corsa etwas
mit seiner sportlichen, aber dennoch auch kleinwagentypischen Natur hervor.
Durch seine flache und langgestreckte Form hat der Loremo im Vergleich das wohl
sportlichste Aussehen. Ebenso fällt die komplette Formgebung aus dem Rahmen, was
74
Vgl. Dehn-Rotfelser, Olaf von (2006b) in Anhang 28
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836641272
- DOI
- 10.3239/9783836641272
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule für die Wirtschaft Hannover – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- automobil vertrieb marketing innovation vision
- Produktsicherheit
- Diplom.de