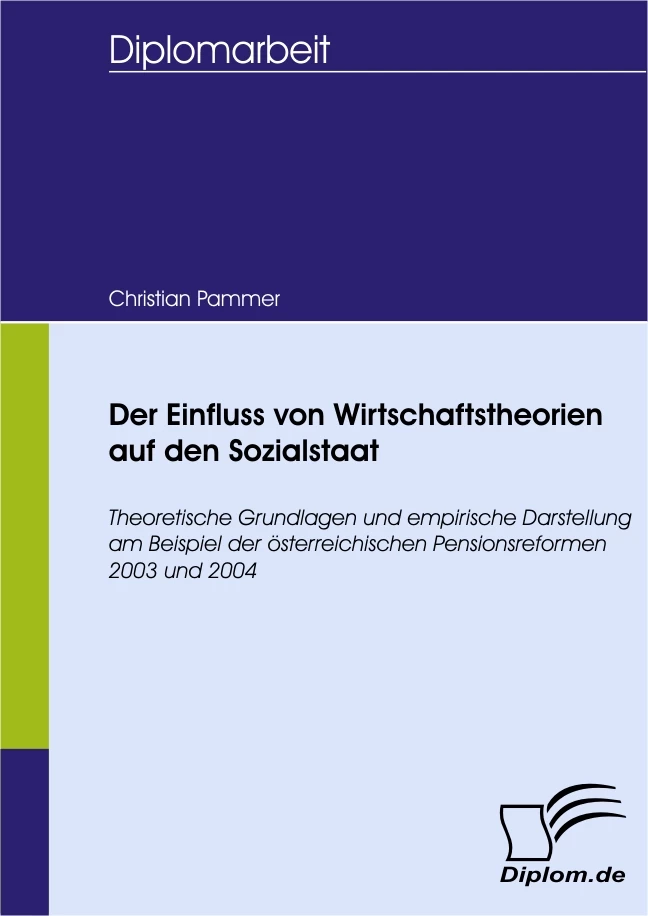Der Einfluss von Wirtschaftstheorien auf den Sozialstaat
Theoretische Grundlagen und empirische Darstellung am Beispiel der österreichischen Pensionsreformen 2003 und 2004
©2006
Diplomarbeit
227 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Ausgangsthese der Arbeit lautet, dass Interdependenzen zwischen wirtschaftstheoretischen Vorstellungen und konkreten Veränderungen in den verschiedenen Politikfeldern bestehen. Selbstverständlich wirkt die wissenschaftliche Theorie nicht direkt, durch ihr bloßes Vorhandensein, auf die politische Praxis ein, aber sie gibt den politischen Akteuren Handlungsanleitungen und/oder Legitimationsinstrumente zur Hand, die sie zur Verfolgung ihrer Interessen nutzen und einsetzen können.
In der Regierungserklärung von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel aus dem Jahr 2000, dem komprimierten Programm der ÖVP-FPÖ Regierungskoalition, wurden die inhaltlichen Vorstellungen zu den verschiedenen Politikfeldern jeweils mit Neu regieren heißt präsentiert. Dieses Neu regieren implizierte, im Bereich des politischen Prozesses, eine Abkehr vom bisherigen konsensorientierten Muster der Entscheidungsfindung und, im Bereich der politischen Inhalte, eine grundsätzliche Veränderung in der inhaltlichen Ausrichtung des österreichischen Sozialstaats.
Die wirtschafts- und sozialpolitischen Zielvorstellungen der ÖVP-FPÖ und später der ÖVP-BZÖ Regierung, ablesbar an Regierungsprogrammen, Regierungserklärungen und Reden von zentralen Repräsentanten der Regierung, orientierten sich dabei wesentlich an neoliberalen beziehungsweise angebotspolitischen Theorien und Konzeptionen. Daraus ergibt sich erstens ein generelles Misstrauen gegenüber vielen Leistungen des öffentlichen Bereichs und die daraus abgeleitete Forderung nach staatlicher Aufgabenbeschränkung und einem schlanken Staat. Zweitens werden als zentrale Staatsaufgabe die Förderung von aktiven, zukunftsorientierten Investitionsleistungen (Forschung und Entwicklung, Infrastruktur) zuungunsten von passiven, gegenwartsbezogen Transferleistungen (Verwaltung, Subventionen, soziale Leistungen) definiert. Mit diesen Festlegungen ist der gut ausgebaute, wenngleich auf manche neuen gesellschaftlichen Entwicklungen nur unzureichend reagierende, österreichische Sozialstaat in die Defensive und unter politischen Druck geraten. Die Unterordnung von sozialpolitischen unter wirtschafts- und standortpolitische Überlegungen muss als gegeben angenommen werden.
Diese politischen und ideologischen Entwicklungen sind allerdings nicht allein mit dem Regierungswechsel - von der Großen Koalition zur Rechtskoalition - zu erklären.
Die politische Unterstützung des Sozialstaats nimmt wenngleich in unterschiedlichem […]
Die Ausgangsthese der Arbeit lautet, dass Interdependenzen zwischen wirtschaftstheoretischen Vorstellungen und konkreten Veränderungen in den verschiedenen Politikfeldern bestehen. Selbstverständlich wirkt die wissenschaftliche Theorie nicht direkt, durch ihr bloßes Vorhandensein, auf die politische Praxis ein, aber sie gibt den politischen Akteuren Handlungsanleitungen und/oder Legitimationsinstrumente zur Hand, die sie zur Verfolgung ihrer Interessen nutzen und einsetzen können.
In der Regierungserklärung von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel aus dem Jahr 2000, dem komprimierten Programm der ÖVP-FPÖ Regierungskoalition, wurden die inhaltlichen Vorstellungen zu den verschiedenen Politikfeldern jeweils mit Neu regieren heißt präsentiert. Dieses Neu regieren implizierte, im Bereich des politischen Prozesses, eine Abkehr vom bisherigen konsensorientierten Muster der Entscheidungsfindung und, im Bereich der politischen Inhalte, eine grundsätzliche Veränderung in der inhaltlichen Ausrichtung des österreichischen Sozialstaats.
Die wirtschafts- und sozialpolitischen Zielvorstellungen der ÖVP-FPÖ und später der ÖVP-BZÖ Regierung, ablesbar an Regierungsprogrammen, Regierungserklärungen und Reden von zentralen Repräsentanten der Regierung, orientierten sich dabei wesentlich an neoliberalen beziehungsweise angebotspolitischen Theorien und Konzeptionen. Daraus ergibt sich erstens ein generelles Misstrauen gegenüber vielen Leistungen des öffentlichen Bereichs und die daraus abgeleitete Forderung nach staatlicher Aufgabenbeschränkung und einem schlanken Staat. Zweitens werden als zentrale Staatsaufgabe die Förderung von aktiven, zukunftsorientierten Investitionsleistungen (Forschung und Entwicklung, Infrastruktur) zuungunsten von passiven, gegenwartsbezogen Transferleistungen (Verwaltung, Subventionen, soziale Leistungen) definiert. Mit diesen Festlegungen ist der gut ausgebaute, wenngleich auf manche neuen gesellschaftlichen Entwicklungen nur unzureichend reagierende, österreichische Sozialstaat in die Defensive und unter politischen Druck geraten. Die Unterordnung von sozialpolitischen unter wirtschafts- und standortpolitische Überlegungen muss als gegeben angenommen werden.
Diese politischen und ideologischen Entwicklungen sind allerdings nicht allein mit dem Regierungswechsel - von der Großen Koalition zur Rechtskoalition - zu erklären.
Die politische Unterstützung des Sozialstaats nimmt wenngleich in unterschiedlichem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christian Pammer
Der Einfluss von Wirtschaftstheorien auf den Sozialstaat
Theoretische Grundlagen und empirische Darstellung am Beispiel der österreichischen
Pensionsreformen 2003 und 2004
ISBN: 978-3-8366-4122-7
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Universität Wien, Wien, Österreich, Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
2
Inhaltsverzeichnis
1
EINLEITUNG ... 8
2
WIRTSCHAFTSTHEORIE ... 15
2.1
Die klassische politische Ökonomie ... 16
2.1.1
Der Ausgangspunkt ... 16
2.1.2
Das klassische Modell ... 18
2.1.3
Die Staatsaufgaben und das Verhältnis von Staat & Ökonomie ... 22
2.1.4
Die Kritik ... 24
2.2
Die Grenznutzenschule ... 26
2.2.1
Der Ausgangspunkt ... 26
2.2.2
Das Grenznutzenmodell ... 27
2.3
Die Wohlfahrtsökonomik ... 29
2.3.1
Der Ausgangspunkt ... 29
2.3.2
Das wohlfahrtsökonomische Modell ... 30
2.3.3
Die Wohlfahrtsfunktion ... 32
2.3.4
Die Staatsaufgaben und das Verhältnis von Staat & Ökonomie ... 33
2.3.5
Kritik der Wohlfahrtsökonomik und der Grenznutzenschule ... 34
2.4
Der Keynesianismus ... 37
2.4.1
Der Ausgangspunkt ... 37
2.4.2
Das keynesianische Modell ... 39
2.4.3
Die Staatsaufgaben und das Verhältnis von Staat & Ökonomie ... 43
2.4.4
Die Kritik ... 45
3
DER NEOLIBERALISMUS ... 47
3.1
Der Neoliberalismus als Wirtschaftstheorie ... 48
3.2
Der Ordoliberalismus ... 48
3.2.1
Der Ausgangspunkt ... 48
3.2.2
Das ordoliberale Modell ... 49
3.2.3
Die Staatsaufgaben und das Verhältnis von Staat & Ökonomie ... 51
3.3
Der Monetarismus ... 53
3.3.1
Der Ausgangspunkt ... 53
3.3.2
Das Monetaristische Modell ... 54
3.3.3
Die Staatsaufgaben und das Verhältnis von Staat & Ökonomie ... 55
3.3.4
Kritik des Monetarismus ... 57
3.3.5
Monetarismus versus Keynesianismus ... 58
3
3.4
Die wirtschaftspolitische Umsetzung von Monetarismus und
Keynesianismus ... 60
3.4.1
Angebotspolitik versus Nachfragepolitik ... 61
3.4.2
Die Wirtschaftspolitik der Angebotsökonomie ... 62
3.4.3
Das Verhältnis von Angebots- und Nachfragepolitik... 69
3.4.4
Die Kritik an der Angebotspolitik ... 70
3.5
Der Neoliberalismus als Gesellschaftstheorie ... 73
3.5.1
Der methodologische Individualismus ... 73
3.5.2
Der homo oeconomicus ... 75
3.5.3
Die Kritik am homo oeconomicus und seiner Gesellschaft ... 83
3.5.4
Das Gesellschaftsmodell von Hayek ... 87
3.6
Durchsetzungsgeschichte des Neoliberalismus... 93
3.6.1
Die Hegemonie bei Gramsci ... 93
3.6.2
Der Aufstieg des Neoliberalismus zur hegemonialen Ordnung: Drei
Erklärungsversuche ... 99
3.7
Neoliberale Kritik am Sozialstaat ... 106
3.8
Kritik an der neoliberalen Sozialstaatskritik ... 113
4
DER ÖSTERREICHISCHE SOZIALSTAAT ... 117
4.1
Charakteristika und historische Entwicklung ... 117
4.2
Gestaltungsprinzipien der österreichischen Sozialpolitik ... 121
4.3
Die Sozialausgaben ... 124
4.3.1
Vorbemerkung ... 125
4.3.2
Sozialausgaben ... 127
4.3.3
Gliederung der Sozialausgaben ... 129
4.3.4
Finanzierungsquellen ... 130
4.3.5
Internationaler Vergleich ... 131
4.4
Akteure der Sozialpolitik ... 132
4.4.1
Veränderungen in der Akteurskonstellation ... 135
4.5
Zusammenfassende Darstellung ... 137
5
DIE SOZIALVERSICHERUNG ... 140
5.1
Institutionen ... 140
5.1.1
Interne Organisation: Selbstverwaltung ... 142
5.2
Versichertenkreis ... 144
4
5.3
Einnahmen ... 145
5.4
Ausgaben ... 147
6
DIE PENSIONSVERSICHERUNG ... 149
6.1
Pensionsversicherte ... 149
6.2
Pensionsarten... 150
6.3
Pensionsvoraussetzungen ... 153
6.3.1
Alterspension nach dem Allgemeinen Pensionsgesetz (APG; Neurecht) ... 153
6.3.2
Alterspension nach dem ASVG (Altrecht) ... 154
6.3.3
Vorzeitige Alterspension aufgrund langer Versicherungsdauer ... 155
6.3.4
Korridorpension ... 156
6.3.5
Schwerarbeitspension ... 156
6.4
Pensionsstände ... 157
6.5
Pensionsantrittsalter ... 158
6.6
Pensionsberechnung ... 160
6.6.1
Pensionsberechnung nach dem APG (Neurecht) ... 160
6.6.2
Pensionsberechnung nach dem ASVG (Altrecht) ... 161
6.6.3
Pensionshöhe ... 164
6.7
Pensionsfinanzierung ... 167
6.8
Pensionsbelastungsquote ... 170
6.9
Die Entwicklung der Pensionsversicherung in der Zweiten Republik
172
6.10
Die Pensionsreform 2003 ... 177
6.10.1
Entstehungsgeschichte ... 177
6.10.2
Inhalt der Pensionsreform 2003 ... 178
6.10.3
Analyse der Pensionsreform 2003 ... 182
6.11
Die Pensionsharmonisierung 2004 ... 190
6.11.1
Entstehungsgeschichte ... 190
6.11.2
Inhalt der Pensionsharmonisierung 2004 ... 191
6.11.3
Analyse der Pensionsharmonisierung ... 196
5
7
BUNDESKANZLER SCHÜSSEL UND FINANZMINISTER
GRASSER: WIRTSCHAFTLIBERALE KRITIK UND UMBAU DES
SOZIALSTAATS ... 199
8
RESÜMEE ... 210
9
LITERATURVERZEICHNIS ... 212
8
1 E
INLEITUNG
Die Ausgangsthese der Arbeit lautet, dass Interdependenzen zwischen
wirtschaftstheoretischen Vorstellungen und konkreten Veränderungen in
den verschiedenen Politikfeldern bestehen. Selbstverständlich wirkt die
wissenschaftliche Theorie nicht direkt, durch ihr bloßes Vorhandensein,
auf die politische Praxis ein, aber sie gibt den politischen Akteuren
Handlungsanleitungen und/oder Legitimationsinstrumente zur Hand, die
sie zur Verfolgung ihrer Interessen nutzen und einsetzen können.
In der Regierungserklärung von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel aus
dem Jahr 2000, dem komprimierten Programm der ÖVP-FPÖ
Regierungskoalition, wurden die inhaltlichen Vorstellungen zu den
verschiedenen Politikfeldern jeweils mit ,,Neu regieren heißt" präsentiert.
Dieses ,,Neu regieren" implizierte, im Bereich des politischen Prozesses,
eine
Abkehr
vom
bisherigen
konsensorientierten
Muster
der
Entscheidungsfindung und, im Bereich der politischen Inhalte, eine
grundsätzliche Veränderung in der inhaltlichen Ausrichtung des
österreichischen Sozialstaats.
Die wirtschafts- und sozialpolitischen Zielvorstellungen der ÖVP-FPÖ und
später der ÖVP-BZÖ Regierung, ablesbar an Regierungsprogrammen,
Regierungserklärungen und Reden von zentralen Repräsentanten der
Regierung,
orientierten
sich
dabei
wesentlich
an
neoliberalen
beziehungsweise angebotspolitischen Theorien und Konzeptionen.
Daraus ergibt sich erstens ein generelles Misstrauen gegenüber vielen
Leistungen des öffentlichen Bereichs und die daraus abgeleitete
Forderung nach staatlicher Aufgabenbeschränkung und einem schlanken
Staat. Zweitens werden als zentrale Staatsaufgabe die Förderung von
9
,,aktiven", zukunftsorientierten Investitionsleistungen (Forschung und
Entwicklung,
Infrastruktur)
zuungunsten
von
,,passiven",
gegenwartsbezogen Transferleistungen (Verwaltung, Subventionen,
soziale Leistungen) definiert. Mit diesen Festlegungen ist der gut
ausgebaute,
wenngleich
auf
manche
neuen
gesellschaftlichen
Entwicklungen nur unzureichend reagierende, österreichische Sozialstaat
in die Defensive und unter politischen Druck geraten. Die Unterordnung
von
sozialpolitischen
unter
wirtschafts-
und
standortpolitische
Überlegungen muss als gegeben angenommen werden.
Diese politischen und ideologischen Entwicklungen sind allerdings nicht
allein mit dem Regierungswechsel - von der Großen Koalition zur
Rechtskoalition - zu erklären.
Die politische Unterstützung des Sozialstaats nimmt wenngleich in
unterschiedlichem Ausmaß quer durch die politischen Parteien hindurch
ab. So gibt es vielen Ländern der Europäischen Union (EU-15), obwohl
sie von unterschiedlichen Parteien bzw. Parteikoalitionen regiert werden,
ähnlich gelagerte Ziele und Maßnahmen in der Wirtschafts- und
Sozialpolitik, die häufig einer neoliberalen Logik folgen.
Im Mainstream der Wirtschaftstheorie wurde dieser neoliberale Trend der
Politik vorweggenommen. Die meisten Ökonomen wandten sich bereits
in den 1960er Jahren von keynesianischen Ansätzen ab und
monetaristischen zu. Da (Teile von) Wirtschaftstheorien häufig von
politischen Akteuren aufgenommen werden um entweder als inhaltliche
Anstöße
oder
als
nachträgliche
Begründung
für
politische
Entscheidungen
zu
fungieren,
sind
die
Konjunkturen
der
Wirtschaftstheorien nicht nur in ihrem unmittelbaren, wissenschaftlichem
Feld, sondern darüber hinaus politisch von großer Bedeutung. Die
ökonomischen Wirkungen sozialstaatlicher Leistungen, zum Beispiel, fällt
10
bei keynesianisch orientierten Wissenschaftern und Politikern sehr viel
positiver aus, als dies bei Anhängern von monetaristischen Konzepten
der Fall ist.
Vor dem Hintergrund dieser wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen
wird der österreichische Sozialstaat, mit dem Schwerpunkt gesetzliche
Pensionsversicherung, dargestellt. Besonderes Augenmerk wird auf die
Analyse der Pensionsreform 2003
1
und der Pensionsharmonisierung 2004
gelegt.
Die mit den Reformen einhergehende Kürzung der durchschnittlichen
Pensionsleistung und der erschwerte Zugang zu Pensionen sowie der
Abgang von der Lebensstandardsicherung und die intendierte Etablierung
eines 3-Säulen Pensionsmodells werden in dieser Arbeit als Ausdruck von
veränderten politischen Prioritäten (Stichwörter: Mehr Privat Weniger
Staat;
Dominanz
der
Wirtschaftspolitik
über
die
Sozialpolitik)
interpretiert.
Ausgangspunkt der Arbeit ist die Wirtschaftstheorie. Zuerst wird die
klassische politische Ökonomie dargestellt, die den Beginn der
Wirtschaftswissenschaft markiert und Staat und Ökonomie erstmals nicht
als Einheit, sondern als Gegensatz betrachtete. Ab diesem Zeitpunkt
beinhaltet makroökonomische Wirtschaftstheorie immer auch eine
Festlegung des Verhältnisses von Staat und Ökonomie und wirkt dadurch
potentiell auf die Politik ein. Dann werden Grenznutzenschule und
Wohlfahrtsökonomik (d.h. die Neoklassik) präsentiert, welche die
1
Eine Analyse der Pensionsreform 2003 aus einer anderen Perspektive, aus Sicht
der Sozialstaatsforschung, liegt bereits vor: Vgl. Wiedermann, Clemens,
Pensionsreform 2003. Sozialstaatsrückbau im Spiegel der Sozialpolitikforschung,
Diplomarbeit, Wien 2004
11
Vorläufer beziehungsweise die Basis des Monetarismus - der führenden
neoliberalen Wirtschaftstheorie - sind. Es folgt die Präsentation des
großen
,,Gegenspielers"
der
neoklassischen
und
neoliberalen
Wirtschaftstheorie, des Keynesianismus. Dieser hat mit zentralen
Theoremen der neoklassischen Wirtschaftstheorien gebrochen, dem
Staat wichtige wirtschaftliche Funktionen zugestanden und legte den
Ausbau des Wohlfahrtsstaats auch aus volkswirtschaftlichen, nicht ,,nur"
aus sozialpolitischen, Gründen nahe.
Das nächste Kapitel behandelt den Neoliberalismus und ist zweigeteilt.
Der erste Teil beschäftigt sich mit neoliberalen Wirtschaftstheorien.
Darunter fallen der Ordoliberalismus, die deutsche Spielart des
Neoliberalismus, vor allem aber der Monetarismus, die aktuell wichtigste
neoliberale Wirtschaftstheorie. Anschließend werden die zentralen
Unterschiede von Monetarismus und Keynesianismus gegenübergestellt
und die wirtschaftspolitischen Grundkonzeptionen der Angebots- und
Nachfragepolitik erläutert.
Im zweiten Teil wird auf die unterschiedlichen neoliberalen Vorstellungen
über den Menschen (Stichwort: homo oeconomicus), die Gesellschaft
und den Staat sowie dessen Aufgaben eingegangen. Weiters wird die
Frage beantwortet, wie es dem Neoliberalismus gelungen ist zur
hegemonialen Wirtschaftstheorie und -politik aufzusteigen. Schließlich
wird die neoliberal und angebotspolitisch motivierte Kritik am Sozialstaat
besprochen, analysiert und kritisiert.
Im Abschnitt über den österreichischen Sozialstaat wird auf die
Charakteristiken
und
Gestaltungsprinzipien
des
österreichischen
Sozialstaats eingegangen. Weiters werden diverse Fakten zu den
Sozialausgaben präsentiert. Auch die Akteure der Sozialpolitik und die
12
historischen
Veränderungen
der
Akteurskonstellationen
werden
besprochen.
Es folgt die Darstellung der Sozialversicherung, dem wichtigsten
Bestandteil des österreichischen Sozialsystems. Zuerst werden die
Institutionen und deren Organisation vorgestellt. Anschließend werden
Daten zu den Versicherten sowie zur Einnahmen- und Ausgabensituation
aufbereitet und analysiert.
Im Kapitel Pensionsversicherung, dabei handelt es sich um den
quantitativ größten Zweig der Sozialversicherung, werden zahlreiche
Daten und Fakten über die wesentlichsten Ausprägungen und Merkmale
der Pensionsversicherung vorgestellt und untersucht. Behandelt werden
überblicksweise die Pensionsarten und die Pensionsvoraussetzungen, die
Pensionsstände und das Pensionsantrittsalter, die Pensionsberechnung,
die Pensionsfinanzierung sowie die Pensionsbelastungsquote.
Danach wird die die Geschichte der Pensionsversicherung in der Zweiten
Republik skizziert. Schwerpunkt des Kapitels sind jedoch die
Entstehungsgeschichte, die Regelungen und die Auswirkungen der
Pensionsreform 2003 und der Pensionsharmonisierung 2004.
Danach
wird
der
Zusammenhang
von
wirtschaftstheoretischen
Vorstellungen und (sozial)politischer Praxis an Hand zweier handelnder
Personen geprüft. Zu diesem Zweck werden zentrale Dokumente von
Bundeskanzler Schüssel und Finanzminister Grasser, hauptsächlich aus
der Zeit der ÖVP-FPÖ Regierungsperiode, analysiert.
Im Resümee wird der methodische Ansatz kurz reflektiert.
13
Methodisch wurde mit Inhaltsanalysen von Sekundärliteratur gearbeitet.
Sekundärliteratur ist aufgrund der thematischen Breite des Themas in
sehr großer Anzahl verfügbar. Das diesbezügliche Problem bestand
deshalb nicht in der Beschaffung, sondern in der sinnvollen Auswahl und
Zusammenstellung der vorhandenen Materialien. Als Ergänzung zu
Monographien
und
Sammelbändern
wurden
auch
Informationsbroschüren, Partei- und Regierungsprogramme sowie
relevante Fachartikel herangezogen.
Für die Analyse der Pensionsreform 2003 beziehungsweise der
Pensionsharmonierung 2004 waren die Stenographischen Protokolle der
zugehörigen Nationalratssitzungen wichtig.
Die für den deskriptiven Teil der Arbeit benötigten Daten und Statistiken
sind hauptsächlich der Homepage des Bundesministeriums für soziale
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz sowie der Homepage
des
Hauptverbands
der
österreichschen
Sozialversicherungen
entnommen.
Für
die
Darstellung
des
Staats-,
Wirtschafts-
und
Sozialpolitikverständnisses
von
Bundeskanzler
Schüssel
und
Finanzminister Grasser werden folgende Dokumente analysiert:
Regierungserklärung
2000,
Regierungserklärung
2003,
Regierungsprogramm 2003-2006, Budgetrede 2003/2004, Homepage
von Karl-Heinz Grasser und von Wolfgang Schüssel.
Zum Abschluss der Einleitung soll festgehalten werden, dass die Arbeit
die komplexe Fragestellung des Einflusses der Wirtschaftstheorie auf die
Wirtschafts- und Sozialpolitik sicher nur in Ausschnitten beantworten
kann.
Die vorliegende Arbeit liefert dennoch einen Beitrag zur Erhellung des
Umstands,
dass
Wirtschaftstheorien
wichtige
Ideen-
und
14
Legitimationslieferanten für die politischen Akteure sind und durch ihre
Aufnahme bzw. Nicht-Aufnahme in den politischen Diskurs für konkrete
Veränderungen im Feld der Sozialpolitik relevant sind.
15
2 W
IRTSCHAFTSTHEORIE
In
diesem
Abschnitt
werden
die
wichtigsten
Phasen
der
nationalökonomischen Dogmengeschichte vorgestellt.
Schwerpunkt
dabei
ist
die
Vermittlung
der
grundlegenden
Charakteristiken des jeweiligen ökonomischen Modells. Danach werden
die mit dem wirtschaftstheoretischen Modell implizierten Auswirkungen
auf die Staatsaufgaben skizziert. Von besonderer Relevanz ist das
Verhältnis von Staat und Ökonomie beziehungsweise die Wichtigkeit der
beiden Sphären.
Dieses Kapitel zur Wirtschaftstheorie fällt deshalb relativ umfangreich, da
diese Arbeit die These vertritt, dass wirtschaftstheoretischen Ideen einen
wesentlichen Einfluss auf das Denken der politischen Akteure und, als
Folge davon, auf die Gestaltung der Gesellschaft besitzen. Diesen
Umstand strich zum Beispiel Keynes stark hervor: ,,Von dieser
zeitgenössischen Stimmung (der 30er Jahre; Anmerkung CP) abgesehen,
sind aber die Gedanken der Ökonomen und Staatsphilosophen, sowohl
wenn sie im Recht, als wenn sie im Unrecht sind, einflussreicher, als
gemeinhin angenommen wird. Die Welt wird in der Tat durch nicht viel
anderes beherrscht. Praktiker, die sich ganz frei von intellektuellen
Einflüssen
glauben,
sind
gewöhnlich
die
Sklaven
irgendeines
verblichenen Ökonomen."
2
Mit der Konzeption der klassischen Ökonomie durch Smith wurde ein
neuer
Gegensatz
entworfen,
Staat
versus
Markt.
In
den
16
vorkapitalistischen Epochen konnten diese beiden Sphären nicht
voneinander getrennt werden. Nun aber gilt: ,,Seit dieser Zeit (Klassik;
CP) wird das gesellschaftspolitische und ökonomische Denken, wie in
einem ständigen Pendelschlag, beherrscht vom Vertrauen auf die
Wirkungskraft des freien Marktes einerseits und vom entgegenstehenden
Vertrauen auf Politik/Staat andererseits(...)"
3
. Dieses Machtverhältnis
zwischen Wirtschaft und Staat ist aufgrund der damit verbundenen,
weitreichenden Folgen für die jeweilige Gesellschaft heftig umkämpft.
2.1 D
IE KLASSISCHE POLITISCHE
Ö
KONOMIE
2.1.1 D
ER
A
USGANGSPUNKT
Das wirtschaftlich immer bedeutender werdende Bürgertum wurde durch
den Feudalstaat und die protektionistische Wirtschaftsordnung des
Merkantilismus
4
in seinen wirtschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten stark
eingeschränkt. Die Ideen des aufkeimenden politischen Liberalismus
(u.a. Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant), insbesondere der zentrale
Wert der Freiheit des Individuums, wurden, ab Ende des
2
Keynes, John Maynard, Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und
des Geldes, Berlin 1936, S. 323
3
Himmelmann, Gerhard, Markt und Politik/Staat, in: Nohlen, D./Schultze, R.O.,
Lexikon der Politik, Band 7: Politische Theorien, München 1998, S. 318
4
Hauptzielsetzung des Merkantilismus war - mittels Steigerung der Produktivität,
einer
zentralisierten
Wirtschafts-
und
Rechtsordnung,
einer
positiven
Handelsbilanz
sowie
einer
Politik
des
Bevölkerungswachstums
-
die
Wirtschaftskraft des eigenen Landes zu steigern, um ökonomisch und dadurch
mittelbar auch politisch mächtiger zu werden. Zu den vorklassischen,
nationalökonomischen Konzepten: Vgl. Schmidt, Karl-Heinz, Merkantilismus,
Kameralismus, Physiokratie, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der
Nationalökonomie, München 2002, S. 37-66
17
18. Jahrhunderts, auch in den wirtschaftlichen Bereich übertragen. Damit
war der Grundstein für eine paradigmatische Gegenbewegung zum
Merkantilismus gelegt.
Großbritannien war die im Jahrhundert der Aufklärung wirtschaftlich am
weitesten fortgeschrittene Nation, in der sich teilweise die kapitalistische
Produktionsweise durchgesetzt hatte. Es wundert daher kaum, dass die
klassische politische Ökonomie schließlich in diesem Land von Adam
Smith (1723-1790) begründet wurde. Weitere wichtige Autoren waren
David Ricardo (1772-1823) und John Stuart Mill (1806-1873).
Smiths zentrale Abhandlung, seine 1776 erschienene ,,Inquiry into the
Nature and the Causes of the Wealth of Nations" zählt neben dem
Marxschen
,,Kapital"
sicherlich
als
bekanntestes
Buch
der
Wirtschaftsgeschichte. Das Werk beinhaltet die erste geschlossene
Wirtschaftstheorie
und
gilt
als
begründendes
Werk
der
Nationalökonomie: ,,Smith gilt als Begründer des sogenannten
,,ökonomischen Liberalismus". ,,Liberalismus" deswegen, weil die
Hauptbotschaft dieser Lehre darin bestand, die wirtschaftlichen
Aktivitäten (...) von allen staatlichen Reglementierungen zu befreien."
5
Smith kann ohne Zweifel als einer der bedeutendsten (politischen)
Ökonomen der Geschichte bezeichnet werden: ,,Seine Vision trägt bis
heute dazu bei, die Grundzüge einer auf freies Handeln gestützten
Wirtschaftsordnung zu bestimmen"
6
.
5
Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 21
6
Vgl. Schefold, Bertram/Carstensen, Kristian, Die klassische Politische
Ökonomie, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München
2002, S. 70
18
Die ökonomischen Vorstellungen Adam Smiths setzten sich bald in allen
entwickelten Ländern durch. Dies ist wohl zwei Umständen zu
verdanken:
1.
Es gelang ihm, die ökonomische Analyse mit einem neuen,
philosophischen Gesamtentwurf für die Gesellschaft zu vereinen.
Sowohl die wirtschafts-, als auch die gesellschaftspolitischen
Implikationen seines Modells lagen im Interesse des Bürgertums,
der aus seiner Sicht zukünftig - herrschenden Klasse.
2.
Die klassische Theorie war in der Angreiferposition (gegen den
Merkantilismus), hatte kaum wirtschaftstheoretische Konkurrenz
und die Unterstützung des Bürgertums. Diese Gründe führten
dazu, dass sich die Klassik (mehr oder weniger stark und
vorübergehend) in allen sich wirtschaftlich entwickelnden Ländern
durchsetzen konnte.
2.1.2 D
AS KLASSISCHE
M
ODELL
2.1.2.1 D
IE
A
RBEITSTEILUNG
/
D
IE
A
RBEITSWERTLEHRE
Entgegen der Annahmen der Merkantilisten, denen es in erster Linie um
einen
größtmöglichen
Anteil
eines
bereits
feststehenden
(Welt)Sozialprodukts geht, geht Smith davon aus, dass die Vermehrung
des Sozialprodukts mittels Produktivitätssteigerung maßgeblich für den
(zukünftigen) Reichtum eines Landes ist. Der Wohlstand eines Landes
19
bestimmt sich Smith zufolge durch die Fortschritte in den Bereichen
Arbeitsproduktivität und Kapitalakkumulation.
7
Die Produktivitätssteigerung soll durch vermehrte Arbeitsteilung
erfolgen. Damit wird Smith auch zum Begründer der Arbeitswertlehre:
,,Die Arbeitswertlehre geht davon aus, dass die Quelle gesellschaftlichen
Reichtums in der Arbeit liegt."
8
Smith hält für frühe Gesellschaften, die
ohne wesentliche gesellschaftliche Differenzierungen funktionierten, fest,
dass der Tauschwert dem Arbeitsaufwand entspricht, das heißt die
jeweils nötigen Arbeitsquantitäten für die Herstellung der Waren sind
gleichzeitig auch ihre Tauschwerte.
9
Allerdings verändert sich dieser Mechanismus, wenn noch andere
Produktionsfaktoren, sprich Kapital oder Boden, zusätzlich zur Arbeit für
die Erstellung einer Ware nötig sind. Dann nämlich gilt etwas gänzlich
anderes: ,,Dabei muss über das hinaus, was zur Bezahlung der
Materialkosten und der Löhne der Arbeiter erforderlich ist, etwas für den
Gewinn des Unternehmers des Ganzen gegeben werden, der bei diesem
Unterfangen sein Vermögen aufs Spiel setzt."
10
Hier
also
verlässt
Smith
bereits
wieder
den
Boden
der
Arbeitswerttheorie, ,,vielmehr wird bei ihm der Tauschwert durch die
7
Vgl. Schefold, Bertram/Carstensen, Kristian, Die klassische Politische
Ökonomie, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München
2002, S. 69f.
8
Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 22
9
Zur Verdeutlichung dieses Postulats das Smithsche Beispiel aus der Praxis:
,,Wenn es in einem Jägervolk zum Beispiel üblicherweise doppelt soviel Arbeit
kostet, einen Biber zu erlegen, wie ein Reh, sollte ein Biber natürlich gegen zwei
Hirsche getauscht werden oder sie wert sein." (Smith, Adam, Untersuchung über
Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, Band I, Düsseldorf 1999,
S. 126)
10
Smith, Adam, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der
Völker, Band I, Düsseldorf 1999, S. 126f.
20
Produktionskosten plus Gewinnzuschlag zur Erzielung der gewöhnlichen
Profitrate bestimmt"
11
.
2.1.2.2 D
ER
M
ARKT
Die klassische Vorstellung des Marktes basiert auf dem gleichzeitigen
Zusammenspiel
von
drei
Teilmärkten
(Kapital-,
Waren-
und
Arbeitsmarkt), die so genau ineinander greifen, dass sich der Markt als
ganzes bei vollständigem Wettbewerb selbständig reguliert. Senf fasst
diese Idee und das Zusammenspiel der drei Teilmärkte folgendermaßen
zusammen: ,,Der Zinsmechanismus am Kapitalmarkt sorgt dafür, dass
der durch Sparen entstandene Nachfrageausfall durch entsprechende
Kredite für Investitionen ausgeglichen wird, so dass gesamtwirtschaftlich
die Nachfrage ins Gleichgewicht zum angebotenen Sozialprodukt kommt.
Dennoch können und werden sektorale Ungleichgewichte auftreten. In
diesem
Zusammenhang
sorgt
der
Preismechanismus
an
den
Gütermärkten dafür, dass Situationen von Nachfragemangel und
Nachfrageüberhang durch entsprechende Preisveränderungen angezeigt
werden und dass sich die jeweiligen Ungleichgewichte abbauen. Der
Lohnmechanismus an den Arbeitsmärkten bewirkt, dass die Arbeitskräfte
aus den Bereichen, in denen sie weniger gebraucht werden, in Bereiche
abwandern, in denen sie mehr benötigt werden und entsprechende
Löhne bekommen."
12
11
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004, S. 78
12
Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 54
21
2.1.2.3 D
IE UNSICHTBARE
H
AND
Laut Smith tendieren Märkte mit Hilfe des Preismechanismus dazu, dass
diverse Handlungen von Individuen auf ein allgemeines Gleichgewicht
hingelenkt werden. Der Markt wird als ein Koordinationssystem gedacht,
dass, unter der Voraussetzung des vollständigen Wettbewerbs, die
individuellen
Interaktionen
der
Wirtschaftssubjekte
aufeinander
abstimmt. Entscheidend ist nun, dass für diese Präferenzabstimmungen
keine übergeordnete Instanz, keine wie auch immer geartete Leistung
gebraucht wird, sondern dass diese Leistung und jetzt kommen wir
wohl zum berühmtesten Diktum von Smith von der ,,unsichtbaren
Hand" der Ökonomie erbracht wird.
Ein möglichst ungestörtes Wirken lassen der ,,unsichtbaren Hand" dient
nicht nur der Herstellung des Marktgleichgewichts, sondern hat zudem
auch gesellschaftlich positive Folgewirkungen: Indem jeder einzelne
Unternehmer danach trachtet, seinen Gewinn zu optimieren, ergibt
dieses Handeln auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene das größtmögliche
Wirtschaftswachstum.
Die
Wirtschaftsleistung
wiederum
ist
die
entscheidende materielle Ausgangsbasis für das Problemlösungspotential
der Gesellschaft. Zusammenfassend bedeutet das, dass zwischen
einzelwirtschaftlichen, gesamtsamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Interessen demzufolge kein Widerspruch besteht.
Damit hat Smith auch ein Modell für den gesellschaftlichen Fortschritt
entworfen: Der Eigennutz der Individuen, der als anthropologische
Grundkonstante gedacht wird, führt unweigerlich und unbewusst zu
gesamtwirtschaftlichen Vorteilen, die in einem nächsten Schritt zum
Wohle der gesamten Gesellschaft genützt werden können.
22
Das eben skizzierte Bild der Wirtschaftspolitik wurde von Smith als das
,,einfache System der natürlichen Freiheit" bezeichnet.
13
Dieses System
kann als Synonym für eine vollendete, perfekte Marktordnung gelten.
Smith
schlug
auch
selbst
die
für
die
Durchsetzung
dieses
marktwirtschaftlichen Systems notwendigen, politischen Maßnahmen
vor: ,,Hebt man alle Systeme einer Förderung oder Beschränkung
vollständig auf, so wird sich daher das nahe liegende und einfache
System natürlicher Freiheit von selbst einstellen."
14
2.1.3 D
IE
S
TAATSAUFGABEN UND DAS
V
ERHÄLTNIS VON
S
TAAT
&
Ö
KONOMIE
Im Smithschen einfachen System der natürlichen Freiheit mit der darin
inkludierten Annahme des vollkommenen Marktes und dessen, neben
den individuellen, auch gesamtwirtschaftlich positiven Ergebnissen, ist
für den Staat nur sehr eingeschränkt Platz.
Dies hält auch Baker mit einer zeitgenössischeren Formulierung fest:
,,Die auf der allgemeinen Gleichgewichtstheorie basierende klassisch-
liberale Wirtschaftskonzeption ist damit ein Plädoyer für marktliche
Lösungen, (...) für eine Theorie der Nicht-Wirtschaftspolitik."
15
13
Vgl. Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus,
Göttingen 2004, S. 83-85, Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie.
Wirtschaftstheorien in der Krise, München 2002, S. 44f. und Schefold,
Bertram/Carstensen, Kristian, Die klassische Politische Ökonomie, in: Issing,
Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S. 70
14
Smith, Adam, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der
Völker, Band II, Düsseldorf 1999, S. 671
15
Baker, Karin, Strukturpolitik der Europäischen Union am Beispiel des
Europäischen Sozialfonds (ESF). Eine Positionsbestimmung des ESF im Kontext
neoliberaler Ideologie, Diplomarbeit, Wien 2005, S. 45
23
Dem Staat verbleiben in der klassischen Konzeption lediglich drei
Funktionen:
1.
das Land gegen Angriffe anderer Staaten zu schützen
2.
durch Errichtung eines zuverlässigen Justizwesens, jeden Bürger
vor Ungerechtigkeit und Unterdrückung durch andere Bürger zu
schützen
3.
Errichtung und Erhaltung von öffentlichen Anstalten, die mangels
potentiellen Profits von der Privatwirtschaft nicht hergestellt
werden
16
Smith selbst formulierte es folgendermaßen: ,,Im System natürlicher
Freiheit hat der Landsherr nur drei Pflichten zu erfüllen (...): Erstens die
Pflicht, die Gesellschaft vor Gewalttaten und Angriffen anderer
unabhängiger Gesellschaften zu schützen, zweitens die Pflicht, jedes
Mitglied der Gesellschaft soweit wie möglich gegen Ungerechtigkeit oder
Unterdrückung seitens jedes anderen Mitgliedes zu schützen, also die
Pflicht, eine verlässliche Rechtspflege einzurichten; und drittens die
Pflicht, bestimmte öffentliche Bauwerke und bestimmte öffentliche
Einrichtungen zu schaffen und instand zu halten, deren Schaffung und
Erhaltung nie im Interesse eines einzelnen oder einer kleinen Gruppe
von Einzelpersonen liegen kann, weil der Gewinn daraus einem einzelnen
oder einer kleinen Gruppe von Einzelpersonen nie ihre Aufwendungen
ersetzen könnte, obwohl er sie einer großen Gesellschaft häufig weit
mehr als zu ersetzen vermag."
17
16
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004, S. 90f.
17
Smith, Adam, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der
Völker, Band II, Düsseldorf 1999, S. 671f.
24
2.1.4 D
IE
K
RITIK
2.1.4.1 T
EILAUFGABE DER
A
RBEITSWERTTHEORIE
Smith geht zwar zuerst davon aus, dass die Arbeit die alleinige Quelle
des (Volks-)Einkommens ist und daher der Wert eines Gutes durch die
verausgabte Arbeit bestimmt wird. Eine solche Bestimmung des Wertes
führt allerdings in der Folge zu zwei Problemen: ,,Damit wird der Wert
der produzierten Güter durch den Wert anderer ebenfalls produzierter
Güter festgelegt: Die Erklärung ist zirkulär. Außerdem hätte das (die
Weiterverfolgung der Arbeitswerttheorie; Anmerkung CP) zur Folge, dass
der produzierende Arbeiter genau den Wert als Lohn erhält, den er
produziert hat."
18
Die angestrebte Kapitalakkumulation mittels Erzielung
von Profit beziehungsweise Mehrwert, das heißt die Grundlage des
kapitalistischen Wirtschaftssystems, wäre damit aber kaum möglich.
Dies ist der Hauptgrund, warum Smith in der Folge seine
Arbeitswerttheorie - und damit deren potentielle gesellschaftliche
Implikationen abschwächt.
2.1.4.2 A
HISTORISCHE
B
ETRACHTUNGSWEISE
Ein wesentlicher Kritikpunkt am Konzept Smiths betrifft sein
ahistorisches Verhältnis von Gesellschaft und Wirtschaft. Er schildert die
kapitalistische
Wirtschaftsordnung
als
eine
Naturnotwendigkeit
beziehungsweise Naturgegebenheit. So ist es für Smith zum Beispiel
selbstverständlich,
dass
Angebot
und
Nachfrage
am
Markt
zusammentreffen und über den Preismechanismus vermittelt werden.
18
Braun, Eberhard/Heine, Felix/Opolka, Uwe, Politische Philosophie: Ein
Lesebuch. Texte, Analysen, Kommentare, Hamburg 1994, S. 160
25
Eine alternative Koordination, zum Beispiel durch staatliche oder
gruppenbezogene Planung, wird dabei nicht in Erwägung gezogen. Eine
weitere scheinbare Selbstverständlichkeit ist die ebenfalls quasi
naturwüchsige Verbindung der Produktionsfaktoren Boden und Kapital
mit dem jeweiligen Eigentümer. Diese (Nicht-)Sichtweise ist zur
Legitimation für den Profitanspruch, der aus dem Eigentumsanspruch
abgeleitet wird, von größter Wichtigkeit.
19
2.1.4.3 I
DEALISIERTES
M
ARKTMODELL
Zinn bezeichnet das Denken der Klassiker als ,,Harmonie-Metaphysik"
und deutet danach die Smithschen Begriffe des Marktes um: ,,Adam
Smith charakterisierte die kapitalistische Konkurrenzökonomie als
,,System der natürlichen Freiheit", plädierte für ein (geregeltes) Laissez-
faire zugunsten der so genannten ,,prästabilisierten Harmonie" (Leibniz)
der freien Marktwirtschaft und benutzte die bis heute populäre Metapher
der
,,unsichtbaren
Hand"
zur
Beschreibung
des
vermeintlich
harmonischen Zusammenspiels auch der erbittertsten Konkurrenten zum
Besten aller"
20
. Sein zentrales wirtschaftspolitisches Ziel ist die
Förderung des Wirtschaftswachstums, Verteilungsfragen behandelt er
kaum. Smith geht davon aus, dass eine proportionale Teilhabe am
Wirtschaftswachstum möglich ist und sich auch einstellen wird. Der
materielle Wohlstand der Gesellschaft ist dann zwar ungerechter verteilt
19
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004,
S.
75f.
Senf,
Bernd,
Die
blinden
Flecken
der
Ökonomie.
Wirtschaftstheorien in der Krise, München 2002, S. 28f. und Braun,
Eberhard/Heine, Felix/Opolka, Uwe, Politische Philosophie: Ein Lesebuch. Texte,
Analysen, Kommentare, Hamburg 1994, S. 156f.
20
Zinn, Georg Karl, Wie Reichtum Armut schafft. Weshalb die neoliberalen
Versprechungen nicht aufgehen, in: Sozialismus 11/2005, S. 20
26
als unter feudalistischen Produktionsverhältnissen, allerdings profitieren
alle von einem höheren Lebensstandard.
Die ideologische Wirkungsmacht des scheinbar neutralen und perfekten
Marktmechanismus, den Smith ,,erfunden" hat, ist gerade heute, im
Zeitalter der Neoklassik, wieder virulent. Er erzeugt das Bild einer
Marktwirtschaft, in der sich das Wirtschaftsgeschehen ohne staatliche
oder sonstige Eingriffe von selbst regulieren kann und soll.
2.2 D
IE
G
RENZNUTZENSCHULE
2.2.1 D
ER
A
USGANGSPUNKT
Um diesen wirtschaftstheoretischen Ansatz adäquat erklären zu können,
müssen wir nochmals zurück zur klassischen Preistheorie nach Smith
(und Ricardo). Gegen diese nämlich revoltierten die Theoretiker der
Grenznutzenschule
und
stellten
in
der
Folge
die
gesamte
Wirtschaftstheorie auf eine neue Grundlage. Wirtschaftstheoretisch war
also die Klassik der Hauptangriffspunkt, gesellschaftspolitisch jedoch der
zu dieser Zeit in den 1870er Jahren - aufkommende und erstarkende
Marxismus.
In den Wirtschaftstheorien der Klassiker (und auch ihrer Vorläufer
21
) war
der Hauptbestimmungsfaktor des Preises eines Gutes dessen jeweilige
Produktionskosten. Der Gebrauchswert eines Gutes war Basis dafür, dass
mit ihm überhaupt getauscht werden konnte. Allerdings ließ sich aus
27
dem Gebrauchswert kein Tauschwert ableiten: ,,Der Gebrauchswert war
nach dieser traditionellen Auffassung für die Preisbildung nicht relevant,
vielmehr wurden die Preise durch die Produktionskosten (Arbeitskosten)
erklärt."
22
Der Tauschwert beziehungsweise Preis konnte - nach klassischem
Verständnis - nur objektiv bestimmt werden. Um diese Bestimmung
vornehmen
zu
können,
entwickelte
Smith
seine
Produktionskostentheorie:
Während
auf
einer
niedrigen,
vorkapitalistischen
wirtschaftlichen
Entwicklungsstufe
das
Austauschverhältnis zweier Güter von der jeweils verausgabten Menge
Arbeit abhängig ist, ist es auf höherer, kapitalistischer Entwicklungsstufe
,,das Verhältnis der jeweils aus Arbeitskosten, Bodenrente und Profit
bestehenden Produktionskosten, das das Preisverhältnis zweier Güter
bestimmt; der Preis hat dementsprechend drei Bestandteile."
23
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die klassische,
objektive Wert- und Preistheorie den Wert eines Gutes durch die
verausgabte Arbeit beziehungsweise durch die Produktionskosten
bestimmt.
2.2.2 D
AS
G
RENZNUTZENMODELL
Der Bruch mit der klassischen Auffassung, und damit die Begründung
der modernen Kosten- und Preistheorie, bestand im Folgenden: ,,Der
subjektivistischen Wertlehre, vertreten durch die Grenznutzenschule,
gelingt, was die Klassiker nicht für möglich hielten, nämlich den relativen
21 Vgl. Priddat, Birger P., Theoriegeschichte der Ökonomie. Eine knappe Skizze
von Aristoteles bis heute, in: WiSt, 5/2004, S. 278-280
22
Chaloupek, Günther, Lehren und Irrlehren der Österreichischen Schule der
Nationalökonomie, in: Arbeit & Wirtschaft 11/2005, S. 16
28
Tauschwert der Güter, (...), aus den Gebrauchswerten, und zwar jeweils
der letzten verbrauchten Gütereinheiten (aus den Grenznutzen),
herzuleiten."
24
Folglich wird der Tauschwert eines Gutes nach dieser Auffassung nicht
mehr durch die, für die Erstellung des Gutes verausgabten
Produktionsfaktoren, sondern durch die subjektiven Nutzenvorstellungen
der Verbraucher bestimmt. Wichtig ist dabei einerseits die Idee eines
positiven und abnehmenden Grenznutzens. Jedes weitere Stück des
gleichen Gutes befriedigt also ein weniger wichtiges Bedürfnis.
Andererseits ist die Beschränkung des Grenznutzens durch das Geld
gegeben. Die Verfügbarkeit über Geld bestimmt somit die Struktur des
Konsums.
Diese beiden, bis heute zentralen, wirtschaftstheoretischen Theoreme
werden als Erstes und Zweites Gossensches
25
Gesetz bezeichnet.
Die
Kostenbestandteile
eines
Gutes
wurden
mit
Hilfe
der
Grenznutzentheorie
aus
einer
einzigen
Ursache,
nämlich
den
Grenzkosten, abgeleitet. Daraus folgt, dass sich der Preis durch den
subjektiv bestimmten Gebrauchswert mit Hilfe des Marktmechanismus
ermitteln lässt.
Im Gegensatz zu dieser Vorstellung wurde von den Klassikern der Preis
(noch)
aus
mehreren
Komponenten
(Lohn,
Profit
[Boden,
Investitionskapital,
Finanzkapital])
zusammengesetzt
und
damit
23
Schumann, Jochen, Wegbereiter der modernen Kosten- und Preistheorie, in:
Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S. 170
24
Schumann, Jochen, Wegbereiter der modernen Kosten- und Preistheorie, in:
Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S. 174f.
25
Benannt nach dem Begründer der subjektiven Wertlehre, Hermann Heinrich
Gossen (1810-1858).
29
marktunabhängig beziehungsweise als bereits vor Markteintritt gegeben,
gedacht.
26
Häufig firmiert die Grenznutzenschule (und auch die auf ihrer
mikroökomischen Basis aufbauende Wohlfahrtsökonomik) auch unter der
Bezeichnung Neoklassik.
27
2.3 D
IE
W
OHLFAHRTSÖKONOMIK
2.3.1 D
ER
A
USGANGSPUNKT
Die Grenznutzentheorie ist eine rein mikroökonomische Konzeption, das
heißt
Untersuchungseinheit
ist
das
Individuum
und
seine
Entscheidungen. Den Übergang von den individuellen Handlungen zum
volkswirtschaftlichen Ergebnis und damit von der Mikro- zur
Makroökonomie bewerkstelligt die Wohlfahrtsökonomik.
Die
Wohlfahrtsökonomik
untersucht
unter
Beibehaltung
des
Grenznutzenkonzepts, wie in einer Volkswirtschaft die Verteilung
beziehungsweise Allokation der vorhandenen Ressourcen (Arbeit, Boden,
Kapital) vorgenommen wird. Ziel ist es, die vorhandenen Ressourcen der
jeweils optimalen Verwendung zuzuführen.
26
Vgl. Schumann, Jochen, Wegbereiter der modernen Kosten- und Preistheorie,
in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S.
174-176, Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus,
Göttingen 2004, S. 211f., und Chaloupek, Günther, Lehren und Irrlehren der
Österreichischen Schule der Nationalökonomie, in: Arbeit & Wirtschaft 11/2005,
S. 16
27 Neumann, Manfred, Neoklassik, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der
Nationalökonomie, München 2002, S. 271-288
30
2.3.2 D
AS WOHLFAHRTSÖKONOMISCHE
M
ODELL
Theoretische Basis des Modells sind die per Definition eigennützig
motivierten Handlungen der Individuen.
Die
Konsumentenrente
misst
den
Nutzen
des
Käufers,
die
Produzentenrente
misst
den
Nutzen
des
Verkäufers
an
der
Marktteilnahme. Die Konsumentenrente errechnet sich dabei aus der
Zahlungsbereitschaft des Käufers minus dem tatsächlich zu zahlenden
Preis für das Gut. Die Produzentenrente resultiert aus dem vom
Produzenten festgelegten Preis minus den Kosten für die Herstellung des
Gutes. Die Maximierung der Summe von Konsumenten- und
Produzentenrente wird angestrebt. Diese Maximierung stellt die optimale
Allokation der Ressourcen sicher, ist also effizient und wird im
Marktgleichgewicht erreicht.
28
Damit ähnelt dieses Marktmodell dem Smithschen. Folgendes Zitat von
Mankiw soll diesen Umstand verdeutlichen: ,,Obwohl die einzelnen Käufer
und Verkäufer nur ihre eigenen Ziele verfolgen, werden sie gemeinsam
durch eine unsichtbare Hand zu einem Marktgleichgewicht geführt, das
die Gesamtnutzen von Käufern und Verkäufern maximiert."
29
Walras (1834-1910), ein Grenznutzentheoretiker, war der Erste, der
versuchte, die individuellen Präferenzen und Handlungen der Haushalte
und Unternehmen zu einem gesamtwirtschaftlichen Ergebnis zu
aggregieren. In seiner Theorie maximieren einerseits die Haushalte ihren
Nutzen und die Unternehmen ihren Gewinn, jeweils mittels individueller
Mengenanpassungen.
Andererseits
gilt
die
28
Vgl. Mankiw, Nicholas Gregory, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart
2001, S. 155-173
29
Vgl. Mankiw, Nicholas Gregory, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart
2001, S. 171
31
Marktgleichgewichtsbedingung,
das
heißt
nach
Ende
des
(Mengen)Anpassungsprozesses
sind
Angebot
und
Nachfrage
im
Gleichgewicht, alle Märkte sind geräumt.
,,Walras gelingt es damit, das Grenznutzenprinzip in ein Modell der
vollständigen Konkurrenz einzubauen, das simultan alle Preise und
Mengen bestimmt; (...) Die auf subjektiven Nutzeneinschätzungen
beruhende Wert- und Preistheorie geht bei Walras in einer Theorie des
allgemeinen ökonomischen Gleichgewichts auf."
30
Das mikroökonomische Konkurrenzgleichgewicht ergibt nun - wie auch
bereits oben festgehalten - die bestmögliche Ressourcenallokation oder,
um ein häufig verwendetes Synonym einzuführen, die Pareto-
Optimalität
31
. Diese Erkenntnis, dass jedes Marktgleichgewicht pareto-
effizient ist, stellt den Ersten Hauptsatz der Wohlfahrtstheorie dar.
,,Pareto-Optimalität bedeutet zum einen, dass die Produktion eines Gutes
nicht erhöht werden kann, ohne dass die mindestens eines anderen
eingeschränkt wird, zum anderen, dass der Nutzen eines Haushalts nicht
erhöht werden kann, ohne dass der mindestens eines anderen reduziert
wird."
32
Folgende Marginalbedingungen sind in der Pareto-Optimalität
erfüllt:
Tauschoptimum,
Optimales
Faktorangebot,
Optimaler
Faktoreinsatz, Optimale Faktorallokation, Optimale Produktionsstruktur
und
Optimale
Akkumulationsrate.
33
Diese
notwendigen
Marginalbedingungen stellen sich durch den Marktmechanismus, unter
der Prämisse der vollständigen Konkurrenz, automatisch ein.
30
Schumann, Jochen, Wegbereiter der modernen Kosten- und Preistheorie, in:
Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S. 177f.
31
Benannt nach dem Nationalökonom Vilfredo Pareto (1848-1923)
32
Schumann, Jochen, Wohlfahrtsökonomik, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte
der Nationalökonomie, München 2002, S. 235
33
Vgl. Donges, Jürgen B./Freytag, Andreas, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 2001, S. 90-114
32
Der zweite Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomie lautet, dass jede pareto-
effiziente Allokation ein Marktgleichgewicht ist. Es gibt also nicht ein
pareto-optimales Gleichgewicht, sondern, je nach (Basis-)Ausstattung
der Individuen mit den unterschiedlichen Produktionsfaktoren, beliebig
viele.
Zusammenfassend
kann
man
zur
Dependenz
zwischen
Wohlfahrtsmaximum und Marktallokation festhalten, ,,dass jedes
denkbare Konkurrenzgleichgewicht pareto-optimal ist und umgekehrt
jedes denkbare Pareto-Optimum als Konkurrenzgleichgewicht gedeutet
werden
kann,
welches
durch
geeignete
Umverteilung
der
Erstausstattungen erreichbar ist."
34
2.3.3 D
IE
W
OHLFAHRTSFUNKTION
Man kann innerhalb der ,,New Welfare Economics"
35
allerdings nicht
festlegen, welche der möglichen pareto-optimalen Allokationen den
anderen vorzuziehen ist. Dazu wäre ein Konzept der sozialen
Wohlfahrtsfunktion (zum Beispiel: Bergson-Samuelson Ansatz) nötig, das
die unterschiedlichen individuellen Präferenzordnungen in eine ordinale
Reihung, das heißt in eine gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktion, bringen
kann. Das aber ist laut wissenschaftstheoretischem Mainstream - nicht
34
Schumann, Jochen, Wohlfahrtsökonomik, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte
der Nationalökonomie, München 2002, S. 236
35
Die ,,Old Welfare Economics" (Marshall, Pigou) konnten dies mit ihrem
Wohlfahrtsbegriff
durchaus.
Gesamtwirtschaftliches
Ziel
war
es,
,,die
gesamtwirtschaftliche Produktion und deren Verteilung so zu gestalten, dass der
gemäß dem utilitaristischen Vorbild über alle Individuen aggregierte Nutzen
möglichst groß ist." (Schumann, Jochen, Wohlfahrtsökonomik, in: Issing, Otmar
(Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S. 232)
33
möglich.
36
Begründet wird diese Unmöglichkeit damit, dass jedes
Individuum seine eigenen Vorstellungen über die gesellschaftliche
Wohlfahrtsfunktion hat (wobei es seinen eigenen Nutzen besonders stark
berücksichtigt), und so eine Verständigung über ein allgemeines, soziales
Wohlfahrtsmaximum nicht erreichbar ist.
Dieses Phänomen firmiert in der Wirtschaftswissenschaft unter dem
Begriff
Arrow-Paradoxon:
,,Das
Arrow-Paradoxon
drückt
die
Unmöglichkeit aus, eigennutzenorientierte individuelle Bewertungen
gesellschaftlicher Konstellationen zu einer gemeinsamen Rangordnung
zusammenzufassen (zu aggregieren); damit entfallen auch Aussagen
über eine sinnvolle oder ein bestmögliche (Gleich- oder Ungleich-)
Verteilung von Erstausstattungen und Nutzen."
37
2.3.4 D
IE
S
TAATSAUFGABEN UND DAS
V
ERHÄLTNIS VON
S
TAAT
&
Ö
KONOMIE
Sowohl bei Donges/Freytag als auch bei Mankiw wird der wohlmeinende
gesellschaftliche Planer (auch Diktator) als hypothetische Figur
eingeführt,
um
die
Marktergebnisse,
die
sich
gemäß
der
Wohlfahrtsökonomik einstellen, bewerten zu können.
38
Die Funktion
dieses gesellschaftlichen Planers nimmt nun in einer demokratischen
Staatsform (teilweise) die Wirtschaftspolitik ein. Die Autoren kommen
nun zu einem ähnlichen Ergebnis, was die Rolle der Wirtschaftspolitik
36
Vgl. Donges, Jürgen B./Freytag, Andreas, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 2001, S. 61-65 und 73f.
37
Schumann, Jochen, Wohlfahrtsökonomik, in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte
der Nationalökonomie, München 2002, S. 245
38
Vgl. Donges, Jürgen B./Freytag, Andreas, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 2001, S. 90 und Mankiw, Nicholas Gregory, Grundzüge der
Volkswirtschaftslehre, Stuttgart 2001, S. 170
34
betrifft: ,,Das Gleichgewichtsergebnis (des Marktes; Anmerkung CP) stellt
eine effiziente Allokation der Ressourcen dar. Die Aufgabe des
wohlmeinenden gesellschaftlichen Planers ist somit sehr leicht: Er kann
die Marktergebnisse unverändert lassen."
39
beziehungsweise ,, Aus
allokationstheoretischer
Sicht
gibt
es
keinen
Grund
für
die
Wirtschaftspolitik, in die marktliche Allokation der Ressourcen
einzugreifen, solange die Annahme der vollkommenen Konkurrenz
besteht."
40
Zusammengefasst handelt es sich bei den angegebenen Zitaten um
Plädoyers für das grundlegende Dogma des Laissez-Faire Kapitalismus,
welches besagt, dass der Staat in wirtschaftliche Abläufe prinzipiell nicht
eingreifen soll.
Aus hegemonietheoretischer Sicht ist es außerdem interessant, dass
zumindest
das
Lehrbuch
von
Mankiw
eines
der
klassischen
Einführungsbücher für angehende Volkswirte weltweit ist.
2.3.5 K
RITIK
DER
W
OHLFAHRTSÖKONOMIK
UND
DER
G
RENZNUTZENSCHULE
Der zentrale Kritikpunkt an der neoklassischen Theorie, dass heißt an der
Gleichgewichtstheorie und deren Fundament, der Wohlfahrtsökonomik,
besteht
darin,
dass
einige
Bedingungen,
welche
für
die
Funktionsfähigkeit der neoklassischen Modelle notwendig sind, in der
komplexen ökonomischen Realität nicht anzutreffen sind.
39
Mankiw, Nicholas Gregory, Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Stuttgart
2001, S. 170
40
Vgl. Donges, Jürgen B./Freytag, Andreas, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 2001, S. 114
35
Drei solch umstrittener Modellbedingungen der Neoklassik stelle ich nun
vor und kontrastiere sie im Anschluss mit der ökonomischen Realität:
1.
Postulat: Auf allen Märkten herrscht vollkommener Wettbewerb
Realität: Am ehesten kann man von vollkommenem Wettbewerb an
der Börse und bei (Internet)Auktionen sprechen. Auf den meisten
Märkten herrscht aber kein vollständiger Wettbewerb, teilweise
existiert sogar das genaue Gegenteil, nämlich ein Monopol (zum
Beispiel: Post).
2.
Postulat: Alle Marktteilnehmer verfügen über alle notwendigen
Informationen und verhalten sich rational
Realität: Im Normalfall sind Informationsasymmetrien einerseits
zwischen Käufer und Verkäufer und andererseits zwischen den
unterschiedlichen Käufern beziehungsweise Verkäufern gegeben.
Viele Informationen sind entweder überhaupt nicht verfügbar oder
es würde zu viel Zeit oder Geld beanspruchen, sie zu erhalten.
Zudem handeln Marktteilnehmer nicht immer rational (zum Beispiel:
falsche Einschätzungen, Image).
3.
Postulat: Die Märkte sogen für eine effiziente und optimale
Allokation der Produktionsfaktoren
Realität:
Die
hohe
Arbeitslosigkeit
oder
die
exzessive
Umweltverschmutzung
sprechen
dagegen.
Ohne
staatliche
Korrekturen des Marktversagens (in manchen Bereichen) würde es
zu gesellschaftlich inakzeptablen Entwicklungen kommen.
41
41
Vgl. Rogall, Holger, Volkswirtschaftslehre für Sozialwissenschaftler. Eine
Einführung, Wiesbaden 2006, S. 62-67
36
Das einige Annahmen des neoklassischen Modells sich nicht in der
Realität finden, kann als gesichert gelten. Allerdings dienen Modelle per
se dazu, die komplexen Realitäten zu vereinfachen. Ihnen vorzuwerfen,
sie würden die Realität nicht unmittelbar wieder spiegeln, macht deshalb
wenig Sinn. Sie sollen ,,nur" bestimmte Grundzusammenhänge besser
erklären.
42
Eine wichtige Frage (die aber alle wirtschaftstheoretischen
Modelle betrifft) besteht meines Erachtens darin, inwieweit aus diesen
Modellen und deren Resultaten wirtschaftspolitische Maßnahmen
abgeleitet werden können.
Zu bedenken ist jedenfalls, dass die gegenwärtige Funktion des
neoklassischen
Modells,
als
theoretischer
Anker
für
reale
Wirtschaftspolitik, kaum davon beeinflusst ist, ob dieses nun die Realität
beschreibt oder nicht. Denn für den Zusammenhang von neoklassischer
Theorie und Realität gilt folgendes: ,,Der Bezug zur Realität wird erst
hergestellt, wenn die Theorie formuliert ist und zwar in der Regel durch
ein einfaches Glaubensbekenntnis; es wird vermutet, dass die
abgeleiteten Bedingungen im großen und ganzen die Realität adäquat
wiederzugeben vermögen."
43
42
Donges/Freytag verteidigen das neoklassische Modell, weil es damit möglich
ist, Marktprozesse in ihrer Reinheit zu analysieren: ,,Die Klarheit der Annahmen
und die Einfachheit der Analyse bringt eindeutige Ergebnisse, die unter
Verwendung einer komplexen, realitätsnäheren Betrachtung so nicht zu erzielen
sind." (Donges, Jürgen B./Freytag, Andreas, Allgemeine Wirtschaftspolitik,
Stuttgart 2001, S. 121)
43
Hoffmann, Hubert, Postkeynesianische Ökonomie Übersicht und
Orientierung, in: Dietrich, Karl/Hoffmann, Hubert/Kromphardt, Jürgen, u.a.
[Hrsg.], Postkeynesianismus: Ökonomische Theorie in der Tradition von Keynes,
Kalecki und Sraffa, Marburg 1987, S. 12
37
2.4 D
ER
K
EYNESIANISMUS
2.4.1 D
ER
A
USGANGSPUNKT
Die Vertreter der subjektiven Wertlehre der 1870er Jahre verwarfen
einerseits die klassische, objektivistische Kosten- und Preistheorie
zugunsten ihrer Grenznutzentheorie und analysierten, ebenfalls im
Gegensatz
zu
den
Klassikern,
beinahe
ausschließlich
die
individualistischen Haushaltsentscheidungen.
Der (vor allem gesellschaftspolitisch zentrale) Kern der Smithschen
Auffassung, dass sich das Wirtschaftssystem selbst reguliert und die
Märkte automatisch zu einem allgemeinen Gleichgewicht tendieren,
wurde
jedoch
vollinhaltlich
übernommen.
Die
Theoretiker
der
Grenznutzenschule untersuchten die makroökonomischen Auffassungen
der klassischen politischen Ökonomie nicht weiter. Ihr wissenschaftliches
Interesse
lag
im
Gebiet
der
Mikroökonomie.
Wenn
die
Grenznutzentheoretiker
ausnahmsweise
doch
Aussagen
über
makroökonomische Sachverhalte trafen, dann wurden ,,(...) einfach die
für isoliert handelnde Individuen oder Unternehmen geltenden Aussagen
auf die Gesamtwirtschaft übertragen (...)"
44
.
Durch ein wirtschaftstheorieexternes Ereignis wurde schließlich das bis
dahin axiomatische Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte der Märkte
nachhaltig erschüttert. Dabei handelte es sich um die verheerende
Weltwirtschaftskrise von 1929, der bis dato größte wirtschaftliche
44
Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 176
38
Einbruch in der kapitalistischen Epoche. Diese Periode wird häufig als
,,Große Depression" tituliert.
Die
Weltwirtschaftskrise,
vor
allem
die
lange
andauernde
Massenarbeitslosigkeit,
konnte
mit
den
vorhandenen
volkswirtschaftlichen Theorien, vor allem der Marktgleichgewichtsdoktrin,
auch nicht näherungsweise erklärt werden. Kromphardt liefert
empirische Beispiele, mit denen gezeigt werden kann, dass sich die
ökonomische Wirklichkeit zu dieser Zeit komplett anders darstellte, als
dies die Wirtschaftheorien vorhersagten:,,(...) insbesonders in den USA
und Deutschland hatte sich gezeigt, dass auch enorm flexible Preise (in
den USA fielen die Güterpreise ab Herbst 1929 in dreieinhalb Jahren um
33 %, in Deutschland etwas weniger) und Löhne den Anstieg der
Arbeitslosigkeit auf eine Quote von 25 % in den USA beziehungsweise 30
% in Deutschland im Jahr 1932 nicht verhinderten."
45
An anderer Stelle
führt er weiter aus: ,,So sank in Deutschland von 1929 bis 1933 der
Preisindex des privaten Verbrauchs um 24 %. Das durchschnittliche
Arbeitseinkommen der Unselbständigen in Industrie und Handwerk
verringerte sich um ca. 27 %. (...) Im Tiefpunkt der Depression belief
sich ungeachtet dessen die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt von
1932 auf 32 % (Zahlen aus Hoffmann 1965)."
46
Diese empirische Widerlegung der Hauptaussagen der traditionellen
ökonomischen Theorie die Ökonomie ist ein selbststeuerungsfähiges
System, da die Märkte (Kapital-, Güter- und Arbeitsmarkt) automatisch
zum Gleichgewicht tendieren - war der wesentliche Grund für die rasche
Ausbreitung der Keynesianischen Wirtschaftstheorie, die Keynes mit
45
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004, S. 177
46
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004, S. 181
39
seinem Werk ,,General Theory of Employment, Interests, and Money"
47
(1936) begründete. Keynes führt in seiner Abhandlung explizit aus, dass
die Smithsche ,,unsichtbare Hand" nur unter bestimmten Bedingungen
funktioniert und brach damit mit DEM zentralen, gut 150 Jahre alten, auf
Smith zurückgehenden, wirtschaftstheoretischen Dogma.
2.4.2 D
AS KEYNESIANISCHE
M
ODELL
Ausgangspunkt der Allgemeinen Theorie von Keynes sind Überlegungen
zu den vorangegangenen neoklassischen Theoremen, in seinem Fall
hauptsächlich in der Fassung von Marshall. Keynes verwirft wichtige
Teile, vor allem nachdem sich in der Weltwirtschaftskrise herausstellte,
dass
die
Wirtschaftstheorie
und
die
daraus
abgeleiteten
wirtschaftspolitischen
Rezepte
nicht
beziehungsweise
sogar
kontraproduktiv auf die ökonomische Wirklichkeit wirkten. Den Glauben
an die unsichtbare Hand gibt Keynes auf, er geht stattdessen von einer
grundsätzlichen
und
im
zeitlichen
Verlauf
zunehmenden
Krisenanfälligkeit des Kapitalismus aus. Nach seiner Kritik an den
vorherrschenden
grenznutzentheoretischen
Konzepten,
die
zur
makroökonomischen
Ursachenforschung
und
-behebung
der
Weltwirtschaftskrise offensichtlich nichts beitragen können, entwirft er
im zweiten Schritt sein makroökonomisches Modell.
47 Keynes, John Maynard, The general theory of employment interest and
money, London 1936. In deutscher Übersetzung: Keynes, John Maynard,
Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes, Berlin 1936
40
2.4.2.1 D
IE
S
PARTHEORIE
Entscheidend für den neuen theoretischen Ansatz ist eine neue
Zinstheorie. Keynes verwirft das Saysche Theorem
48
, wonach sich jedes
Angebot automatisch seine Nachfrage schafft. Übertragen auf den
Kapitalmarkt bedeutet das Saysche Theorem, dass sich Spar- und
Investitionsvolumen mittels Zinsmechanismus immer im Gleichgewicht
befinden. Dies stellt sich in in den Augen von Kritikern aber anders
dar: ,,Das neoklassische Vertrauen in die Zinsabhängigkeit der
Investitionen hat mit der Realität nicht viel zu tun, ebenso wenig wie das
Vertrauen in die Zinsabhängigkeit des Sparens (...)"
49
. Für Keynes ist
Sparen vor allem eine Restgröße (Einkommen minus Konsumausgaben).
Durch diese neue Auffassung kommt dem Zinssatz eine - im Vergleich
zum klassischen Modell - viel geringere Rolle zu. Stattdessen ist nun die
Höhe des Volkseinkommens, und damit die (potentielle) Nachfrage, die
entscheidende ökonomische Größe.
Damit rückt die Beschäftigung ins Zentrum der Aufmerksamkeit und ist
folgerichtig auch der zentrale Bestandteil der Allgemeinen Theorie von
Keynes. Keynes geht wiederum im Gegensatz zu den (Neo)Klassikern
nicht davon aus, dass der Marktmechanismus am Arbeitsmarkt
(zumindest mittelfristig und bei genügender Flexibilität) automatisch
Vollbeschäftigung herstellt. Eine Senkung des allgemeinen Lohnniveaus
ist
kurzfristig
nicht
nur
relativ
schwer
durchsetzbar
(Gewerkschaftsmacht), sondern auch gar nicht wünschenswert. Denn
48
Benannt nach Jean Baptiste Say (1767-1832). Das Saysche Theorem besagt,
dass Angebot und Nachfrage in einer Volkswirtschaft stets gleich hoch sind, da
sich jedes Produkt, mithilfe des Marktmechanismus, selbst ihre entsprechende
Nachfrage schafft.
49
Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 207
41
durch einen Rückgang des Lohnniveaus würde die Massenkaufkraft erst
recht geschwächt und die ohnehin schon gegebene Nachfragelücke nur
noch größer. Mit diesem Argument schafft Keynes eine ökonomische
Begründung dafür, dass Lohnsenkungen nicht nur aus sozialpolitischer,
sondern eben auch aus wirtschaftspolitischer Sicht abzulehnen sind.
50
Gleichzeitig weist Keynes damit nach, dass eine zu geringe
gesamtwirtschaftliche Nachfrage beziehungsweise eine zu
hohe
Sparquote der Haushalte möglich ist. Diesem potentiellen Zustand muss
und kann von staatlicher Seite aber aktiv begegnet werden.
2.4.2.2 D
IE
I
NVESTITIONSTHEORIE
Auch die Investitionen werden nicht, wie von Say und Nachfolgern
angenommen, ausschließlich durch den Zinssatz bestimmt, sondern der
wichtigste Bestimmungsfaktor für die Quantität der Investitionen ist
nach
Keynes
-
die
Renditeerwartung
der
Unternehmer.
Die
Investitionstätigkeit ist somit immer mit einem gewissen Grad von
Unsicherheit behaftet. Das ist allerdings nicht nur ein Problem für den
einzelnen Unternehmer, sondern ein gesamtgesellschaftliches, da die
Gefahr besteht, dass es zu einer Lohn- und Preisspirale nach unten
kommt: ,,Keynes wandte sich damit (mit seinen Überlegungen zur
Investitionsentscheidung; Anmerkung CP) gegen die Erklärung der
Krisen durch das Ansteigen des Zinssatzes und stellt ihr seine Erklärung
durch den plötzlichen Zusammenbruch der Renditeerwartungen
entgegen (...)"
51
.
50
Vgl. Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus,
Göttingen 2004, S. 180-183 und Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie.
Wirtschaftstheorien in der Krise, München 2002, S. 201-204; 213
51
Kromphardt, Jürgen, Konzeptionen und Analysen des Kapitalismus, Göttingen
2004, S. 179
42
Ferner geht Keynes von einer abnehmenden Grenzleistungsfähigkeit des
Kapitals aus, das heißt die Probleme verschärfen sich systemimmanent.
Wenn nun allerdings die Renditeerwartungen unter den Marktzins sinken,
werden weitere Realinvestitionen unterbleiben, stattdessen wird das
Kapital in den Kapitalmarkt wandern. Es kommt von unternehmerischer
Seite her zu einem Nachfrageausfall.
Die klassische und neoklassische Lösung für diese Problemlage würde
folgendermaßen aussehen: Am Kapitalmarkt kommt es aufgrund der
geringen Kapitalnachfrage zu einer Zinssenkung. Dadurch sinken auch
die Sparzinsen, Sparen wird weniger attraktiv, der Haushaltskonsum
springt dadurch automatisch wieder an und der optimale Zustand ist bald
wieder marktimmanent hergestellt. Auch diesen Sachverhalt beurteilt
Keynes aber anders und prägt für seine Ansicht den Begriff
Liquiditätspräferenz.
2.4.2.3 D
IE
L
IQUIDITÄTSPRÄFERENZ
Nach Keynes können Einkommen nicht nur gespart oder investiert,
sondern auch gehortet werden. Der Besitzer sichert sich damit Liquidität
und hat ein Höchstmaß an Freiheit bezüglich der Verwendung des
Geldes, das Spekulationsmotiv wird schlagend. Die ,,Liquiditätspräferenz"
ist, im Gegensatz zum Sparen, sehr stark vom Zinssatz abhängig. Je
niedriger die Zinsen am Kapitalmarkt, desto größer die Liquidität. Da
dieses Geld zumindest vorerst nicht nachfragewirksam wird, entsteht ein
Nachfrageleck mit negativen Folgen für die gesamte Volkswirtschaft.
52
52
Vgl. Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 207-211 und Jarchow, Hans-Joachim, Keynesianismus,
in: Issing, Otmar (Hrsg.), Geschichte der Nationalökonomie, München 2002, S.
204f.
43
Wenn man nun die Keynesschen Aussagen über die Sparfunktion, die
Investitionsfunktion und die Liquiditätspräferenz zusammenfasst, sieht er
den Kapitalismus durch dessen systemimmanente Entwicklungen
zunehmend gefährdet. Senf drückt diese Befürchtungen folgendermaßen
aus: ,,Je höher die Wirtschaft entwickelt, je älter ein kapitalistisches
System ist, je mehr also Sozialprodukt und Volkseinkommen gewachsen
sind, umso mehr würden sich Kreislaufprobleme ergeben weil dem
absolut und relativ wachsenden Sparen auf Dauer keine hinreichend
wachsenden privaten Investitionen entsprechen würden und weil ein
sinkender Zins, anstatt die Investitionen anzuregen, zu verstärktem
Abfluss von Geld in die Spekulation führe."
53
2.4.3 D
IE
S
TAATSAUFGABEN UND DAS
V
ERHÄLTNIS VON
S
TAAT
&
Ö
KONOMIE
Das zentrale Ziel der Allgemeinen Theorie von Keynes sind Maßnahmen
zur
Sicherung
der
Vollbeschäftigung.
Allerdings
basierten
die
diesbezüglichen Überlegungen nicht hauptsächlich auf sozialpolitischen,
sondern auf ökonomischen Zusammenhängen. Meines Erachtens könnte
das auch ein wesentlicher Grund dafür gewesen sein, dass sich der
Keynesianismus, zumindest für einige Zeit, durchsetzen konnte.
Wirtschaftspolitische
Forderungen
scheinen
mehr
Verwirklichungschancen zu haben als sozialpolitische.
Wenn
nun
das
Wirtschaftssystem
nicht
aus
eigener
Kraft
Vollbeschäftigung herstellen kann, muss der Staat einspringen. Dazu hat
53
Vgl. Senf, Bernd, Die blinden Flecken der Ökonomie. Wirtschaftstheorien in der
Krise, München 2002, S. 212
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836641227
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2
- Schlagworte
- sozialstaat wirtschaftstheorie österreich pension neoliberalismus
- Produktsicherheit
- Diplom.de