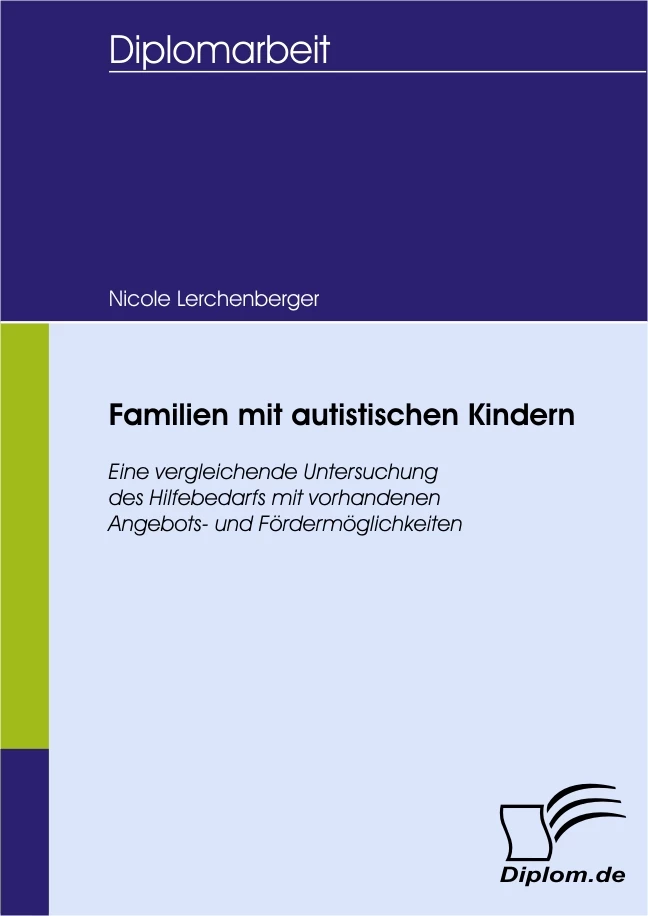Familien mit autistischen Kindern
Eine vergleichende Untersuchung des Hilfebedarfs mit vorhandenen Angebots- und Fördermöglichkeiten
©2009
Diplomarbeit
118 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Intention und Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, eine Erfassung der verschiedensten Auswirkungen des Autismus auf die betroffenen Familien zu erhalten und einen aktuellen Zwischenstand über die Versorgungs- und Hilfemöglichkeiten der Familien und Kinder in der Region Regensburg zu geben.
Der theoretische Teil befasst sich mit den Hintergründen des Autismus, der Diagnosestellung und der Frage der Ursachenforschung. Hierzu werden die verschiedenen Aspekte möglicher Entstehungsgründe im Rahmen neuester Studien untersucht. Ebenso dient die Arbeit der Zusammenfassung von unterschiedlichen Formen, Erscheinungsbildern und Kriterien des gesamten Spektrums autistischer Auffälligkeiten.
Selbst nur autistische Züge eines Kindes haben ebenso wie schwerwiegendere Verhaltensoriginalitäten des frühkindlichen Autismus, besondere Auswirkungen auf die Familie, deren einzelne Mitglieder sowie die Beziehungen untereinander. Zu diesem Zweck werden die grundlegenden Frage- und Problemstellungen der Betroffenen innerhalb des Familiensystems beleuchtet und erörtert.
Außerdem wird auf die Auswirkungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens eingegangen, welches sich für die Familien durch den Autismus ihres Kindes verändert.
Der empirische Teil der Diplomarbeit umfasst die Befragung von Eltern über die Bedarfsdeckung der Therapie- und Hilfemöglichkeiten im Bezirk Oberpfalz und deren Auswertung. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Grafiken verdeutlicht und interpretiert. Zudem erfolgt eine Vorstellung der Zielgruppe der Erhebung sowie der beteiligten Institutionen und Einrichtungen als Kooperationspartner, mit einer kritischen Reflexion der Arbeit.
Abschließend werden einige, der Verfasserin als wichtig erscheinende Ergebnisse und Empfehlungen herausgegriffen und mögliche Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Situation dargestellt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
A)Einleitung5
1.Theoretischer Teil6
1.1AUTISMUS UND HINTERGRÜNDE6
1.1.1Definition und Begriffsbestimmung6
1.1.2Eingruppierung und Diagnostik des ICD 10 und DSM IV7
1.1.3Arten von Autismus11
1.1.3.1Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom)11
1.1.3.2Asperger Autismus13
1.1.3.3Atypischer Autismus und andere tief greifende Entwicklungsstörungen14
1.1.3.4High-functioning-Autismus15
1.1.4Ursachen der Behinderung16
1.1.4.1Neurologische und biochemische Komponente17
1.1.4.2Genetische […]
Die Intention und Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, eine Erfassung der verschiedensten Auswirkungen des Autismus auf die betroffenen Familien zu erhalten und einen aktuellen Zwischenstand über die Versorgungs- und Hilfemöglichkeiten der Familien und Kinder in der Region Regensburg zu geben.
Der theoretische Teil befasst sich mit den Hintergründen des Autismus, der Diagnosestellung und der Frage der Ursachenforschung. Hierzu werden die verschiedenen Aspekte möglicher Entstehungsgründe im Rahmen neuester Studien untersucht. Ebenso dient die Arbeit der Zusammenfassung von unterschiedlichen Formen, Erscheinungsbildern und Kriterien des gesamten Spektrums autistischer Auffälligkeiten.
Selbst nur autistische Züge eines Kindes haben ebenso wie schwerwiegendere Verhaltensoriginalitäten des frühkindlichen Autismus, besondere Auswirkungen auf die Familie, deren einzelne Mitglieder sowie die Beziehungen untereinander. Zu diesem Zweck werden die grundlegenden Frage- und Problemstellungen der Betroffenen innerhalb des Familiensystems beleuchtet und erörtert.
Außerdem wird auf die Auswirkungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens eingegangen, welches sich für die Familien durch den Autismus ihres Kindes verändert.
Der empirische Teil der Diplomarbeit umfasst die Befragung von Eltern über die Bedarfsdeckung der Therapie- und Hilfemöglichkeiten im Bezirk Oberpfalz und deren Auswertung. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Grafiken verdeutlicht und interpretiert. Zudem erfolgt eine Vorstellung der Zielgruppe der Erhebung sowie der beteiligten Institutionen und Einrichtungen als Kooperationspartner, mit einer kritischen Reflexion der Arbeit.
Abschließend werden einige, der Verfasserin als wichtig erscheinende Ergebnisse und Empfehlungen herausgegriffen und mögliche Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Situation dargestellt. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
A)Einleitung5
1.Theoretischer Teil6
1.1AUTISMUS UND HINTERGRÜNDE6
1.1.1Definition und Begriffsbestimmung6
1.1.2Eingruppierung und Diagnostik des ICD 10 und DSM IV7
1.1.3Arten von Autismus11
1.1.3.1Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom)11
1.1.3.2Asperger Autismus13
1.1.3.3Atypischer Autismus und andere tief greifende Entwicklungsstörungen14
1.1.3.4High-functioning-Autismus15
1.1.4Ursachen der Behinderung16
1.1.4.1Neurologische und biochemische Komponente17
1.1.4.2Genetische […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Nicole Lerchenberger
Familien mit autistischen Kindern
Eine vergleichende Untersuchung des Hilfebedarfs mit vorhandenen Angebots- und
Fördermöglichkeiten
ISBN: 978-3-8366-4121-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule Regensburg, Regensburg, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
2
INHALTSVERZEICHNIS
A) Einleitung ...4
1 Theoretischer Teil ...5
1.1 Autismus
und
Hintergründe...5
1.1.1 Definition
und
Begriffsbestimmung ... 5
1.1.2
Eingruppierung und Diagnostik des ICD 10 und DSM IV ... 6
1.1.3 Arten
von Autismus... 10
1.1.3.1 Frühkindlicher
Autismus (Kanner-Syndrom) ... 10
1.1.3.2 Asperger Autismus ... 12
1.1.3.3
Atypischer Autismus und andere tief greifende
Entwicklungsstörungen... 13
1.1.3.4 High-functioning-Autismus... 14
1.1.4 Ursachen
der Behinderung ... 15
1.1.4.1
Neurologische und biochemische Komponente... 16
1.1.4.2 Genetische Faktoren ... 19
1.1.4.3 Neuropsychologie ... 20
1.1.4.4 Umwelteinflüsse... 22
1.2 Auswirkungen
auf die Familie... 23
1.2.1 Entwicklung
des Familienlebens ... 23
1.2.2 Auswirkungen
auf
einzelne Familienmitglieder ... 30
1.2.2.1 Mütter
als
primär Betroffene... 30
1.2.2.2
Effekte auf die partnerschaftliche Beziehung der Eltern ... 32
1.2.2.3 Geschwister... 33
1.2.2.4 Kind mit autistischen Verhaltensweisen... 35
1.2.3
Auswirkungen auf gesellschaftliches Leben der Familie... 38
1.2.3.1 Alltagsgestaltung
und Freizeitaktivitäten... 38
1.2.3.2 Umfeld
und
soziale Kontakte... 39
B) Überleitung... 41
2 Empirischer Teil ... 42
2.1 Quantitative Erhebung durch Fragebögen in Familien ... 42
2.1.1 Zielgruppe der Stichprobe und Zielsetzung ... 42
2.1.2 Umfragebeteiligte Institutionen und Einrichtungen... 43
2.1.3 Methodenbeschreibung ... 44
3
2.2 Auswertung der Fragebögen ... 45
2.2.1 Graphische Auswertung und Interpretation... 45
2.2.2 Weiterführende Ergebnisse durch Fragenkombinationen... 83
2.2.3 Kritische Reflexion der quantitativen Forschungsarbeit...88
C) Fazit/Ausblick ... 89
Anhang
a) Fragebogen...94
b) Überblick/Erstsammlung Angebots- und Hilfsmöglichkeiten für
autistische Kinder im Bezirk Oberpfalz...101
Tabellenverzeichnis Fragebogenerhebung...112
Grafikverzeichnis Fragebogenerhebung...112
Abbildungsverzeichnis Theoretischer Teil...113
Literaturverzeichnis...114
4
A) Einleitung
Die Intention und Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, eine Erfassung der
verschiedensten Auswirkungen des Autismus auf die betroffenen Familien zu
erhalten und einen aktuellen Zwischenstand über die Versorgungs- und
Hilfemöglichkeiten der Familien und Kinder in der Region Regensburg zu geben.
Der theoretische Teil befasst sich mit den Hintergründen des Autismus, der
Diagnosestellung und der Frage der Ursachenforschung. Hierzu werden die
verschiedenen Aspekte möglicher Entstehungsgründe im Rahmen neuester
Studien untersucht. Ebenso dient die Arbeit der Zusammenfassung von
unterschiedlichen Formen, Erscheinungsbildern und Kriterien des gesamten
Spektrums autistischer Auffälligkeiten.
Selbst nur autistische Züge eines Kindes haben ebenso wie schwerwiegendere
Verhaltensoriginalitäten des frühkindlichen Autismus, besondere Auswirkungen
auf die Familie, deren einzelne Mitglieder sowie die Beziehungen untereinander.
Zu diesem Zweck werden die grundlegenden Frage- und Problemstellungen der
Betroffenen innerhalb des Familiensystems beleuchtet und erörtert.
Außerdem wird auf die Auswirkungen des gesellschaftlichen und sozialen Lebens
eingegangen, welches sich für die Familien durch den Autismus ihres Kindes
verändert.
Der empirische Teil der Diplomarbeit umfasst die Befragung von Eltern über die
Bedarfsdeckung der Therapie- und Hilfemöglichkeiten im Bezirk Oberpfalz und
deren Auswertung. Die Ergebnisse werden anhand von Tabellen und Grafiken
verdeutlicht und interpretiert. Zudem erfolgt eine Vorstellung der Zielgruppe der
Erhebung sowie der beteiligten Institutionen und Einrichtungen als
Kooperationspartner, mit einer kritischen Reflexion der Arbeit.
Abschließend werden einige, der Verfasserin als wichtig erscheinende Ergebnisse
und Empfehlungen herausgegriffen und mögliche Verbesserungsvorschläge zur
aktuellen Situation dargestellt.
5
1 Theoretischer Teil
1.1 Autismus und Hintergründe
1.1.1 Definition und Begriffsbestimmung
,,Wenn ich dich nur verstehen könnte...": Mit dieser Beschreibung würden
vielleicht Angehörige und Eltern von Betroffenen den Inhalt des Wortes Autismus
assoziieren.
Wenn man sich jedoch der Literatur zuwendet, wird der Ursprung des Wortes
Autismus in seinen Wurzeln aus der griechischen Sprache abgeleitet und mit dem
Begriff ,,autos" genannt, was soviel heißt wie ,,selbst".
Erstmals benutzte diese neue Art einer gewissen Zustandsbeschreibung der
Schweizer Psychiater Eugen Bleuler im Jahre 1914. Damit beschrieb er eine sehr
in sich gekehrte Verhaltensweise und selbst Bezogenes Denken von Menschen.
1
Zu Beginn der Forschung war man sogar der Ansicht, dass Autismus eine Form
der kindlichen Schizophrenie sei. Wissenschaftler schlossen dies aus der
mangelnden sozialen Interaktion und den Sprachproblemen. Heute sind sich
Experten jedoch einig, dass Autismus und Schizophrenie zwei völlig
unterschiedliche Arten von Erkrankungen sind.
2
Kanner und Asperger
veröffentlichten 1943 und 1944 fast zeitgleich und unabhängig voneinander erste
Beobachtungen zu diesem Phänomen, welches bei Kindern festgestellt wurde.
3
Diese Menschen haben Schwierigkeiten ihre Umwelt und Mitmenschen zu
verstehen, einen Zugang zu finden, Verhaltens- und Kommunikationsformen zu
erkennen oder sich selbst mitzuteilen.
Auch verschiedene Autoren des Leitfadens für Kinder- und Jugendpsychotherapie
beschreiben in belegten und signifikanten Studien, ,,...dass Autismus mit
Störungen der Wahrnehmung assoziiert ist. Sowohl Defizite der Wahrnehmung,
1
vgl. Kehrer (2000), S. 9
2
vgl. Sigman, Capps (2000), S. 11
3
vgl. Förstl (2007), S. 296
6
als auch Empathie sind jedoch nur Teilaspekte des Syndroms und vermutlich
nicht primäre Ursache, sondern Folge eines pathologischen Prozesses."
4
Erste Anzeichen sind bereits im Kleinkindalter zu beobachten, wobei sich die
Diagnose häufig wegen uneindeutiger Anzeichen über Monate und Jahre hinweg
ziehen kann.
Steinhausen hebt allerdings in einem anderen Lehrbuch der Kinder- und
Jugendpsychiatrie hervor, dass sich Betroffene nicht in ihre eigene Welt zurück
ziehen, sondern primär die fehlende Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit eine
Rolle spielt. Der Begriff ,,Tiefgreifende Entwicklungsstörung" wird ebenso
einschlägig in der Literatur verwendet, vor allem im Zusammenhang mit dem
ICD 10 (International classification of diseases).
5
Grundlegend kann Autismus als Spektrumsstörung bezeichnet werden. Die
tiefgreifende Entwicklungsstörung gilt als eine Art Grundstock von Merkmalen. Je
nach Ausprägung können die verschiedenen Formen von Autismus anhand der
spezifischen Indikatoren festgestellt werden. Die qualitativen Auffälligkeiten des
autistischen Bildes spielen eine große Rolle. Im Punkt 1.1.2 Diagnostik wird
darauf noch näher eingegangen.
6
1.1.2 Eingruppierung und Diagnostik des ICD 10 und DSM IV
Im Grunde kann Autismus nach zwei Klassifikationssystemen diagnostiziert
werden. Dies betrifft den DSM IV Katalog (Diagnostisches und statistisches
Manual psychischer Störungen), welcher 1994 von einer Vereinigung
amerikanischer Psychiater veröffentlicht wurde, sowie den ICD 10, welcher
bereits im letzten Abschnitt erwähnt ist.
Durch die Verschiedenheit in dem ein oder anderen Punkt der Kataloge kann es
partiell in manchen Bereichen der Diagnosestellung zu Unterschieden bzw.
Abweichungen kommen.
7
Folgende Tabelle soll einen kurzen Überblick bezüglich
der Hauptkategorien meines Themas geben:
4
Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, Schmötzer - Leitfaden (2004), S. 2
5
vgl. Steinhausen (2006), S. 76 ff
6
vgl.
www.dimdi.de
, Stand: 06.04.2009
7
vgl. Richman (2004), S. 7
7
ICD 10
DSM IV
Frühkindlicher Autismus (F84.0)
Autistische Störung (299.0)
Asperger Syndrom (F84.5)
Asperger Störung (299.80)
Atypischer Autismus (F84.1)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende
Entwicklungsstörung (NNB-TE; 299.80)
Rett-Syndrom (F84.2)
Rett Störung (299.80)
Andere desintegrative Störung des
Kindesalters (F84.3)
Desintegrative Störung im Kindesalter
(299.10)
Überaktive Störung mit
Intelligenzminderung und
Bewegungsstereotypien (F84.4)
Keine Entsprechung im DSM IV
Sonstige tiefgreifende
Entwicklungsstörungen (F84.8)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende
Entwicklungsstörung (NNB-TE)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende
Entwicklungsstörung (F84.9)
Nicht näher bezeichnete tiefgreifende
Entwicklungsstörung (NNB-TE)
Abbildung 1: Vereinfachte Gegenüberstellung der Diagnosekataloge
8
Der Vergleich zeigt einige Differenzen auf, welche auf die Komplexität des
Autismus zurückzuführen sind und Anregung für weitere Forschung geben.
Wie bereits vorher in der Gegenüberstellung der Klassifikationskataloge schon
deutlich wurde, können die Diagnosekriterien je nach Land unterschiedlich
definiert sein. Außerdem spielt auch die Beschaffenheit des Gesundheitssystems
eine große Rolle bei der Einordnung und Feststellung von Krankheiten,
insbesondere auch hier bei Autismus. Folglich ist die Prävalenz sehr
unterschiedlich und es herrschen schlechte Vergleichsmöglichkeiten zu anderen
Ländern.
9
8
Morsch (2008), S. 3
9
vgl. Sigman, Capps (2000), S. 11 ff
8
Untersuchungen der letzten Jahre weisen allerdings zunehmend höhere Zahlen
von Menschen mit autistischen Störungen nach, wohl auch aufgrund der größer
werdenden Sensibilität und besseren Diagnosekriterien. Speziell für Deutschland
gibt es keine Angabe, jedoch kann man auf Forschungen in Europa, Kanada und
den USA zurückgreifen.
Alle autistischen Spektrumsstörungen:
6 7
pro 1000 Einwohner
Frühkindlicher Autismus:
1,3 2,2
pro 1000 Einwohner
Asperger Autismus:
1 3
pro 1000 Einwohner
Andere tiefgreifende Entwicklungsstörung: 3,3
pro 1000 Einwohner
10
Zudem möchte ich noch kurz die drei Hauptmerkmale zur Diagnose von Autismus
aufgreifen, welche Herpertz-Dahlmann in der neuesten Denkschrift des
Bundesverbands für Autismus folgendermaßen erläutert:
Von Bedeutung in der Diagnostik sind:
,,...eine Störung der reziproken (wechselseitigen) sozialen Interaktion
(Beeinträchtigung der zwischenmenschlichen Beziehungen)
...eine Störung der Kommunikation, d. h. der sprachlichen und nicht
sprachlichen Kommunikationsformen wie Gestik und Mimik,
...ein deutlich eingeschränktes Repertoire von Aktivitäten und Interessen
sowie Auftreten stereotyper Verhaltensmuster"
11
Eine weitere Neuerung stellt der so genannte ICF (Internationale Klassifikation
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) dar, welcher allerdings
keine Krankheitsdefinition des autistischen Erscheinungsbildes vermerkt. Fokus
dieses Katalogs ist primär die Teilhabe des Menschen mit Behinderung am Leben
und an der Gesellschaft und hebt eine stärkere Ressourcenorientierung und
Partizipation hervor.
12
Anzumerken ist außerdem, dass ,,zu einer vollständigen diagnostischen
Untersuchung autistischer Störungen ... die Durchführung eines
Elektroenzephalogramms (EEG) und unter Umständen eines weiteren
10
vgl. Autismus Deutschland e. V, Bundesverband zur Förderung von Menschen mit Autismus
(2008), S. 3
11
Herpertz- Dahlmann (2008), S. 5
12
vgl. ebd., S. 5/6
9
bildgebenden Verfahrens..."
13
gehört. Dabei wurde eine ausgeprägte Trefferquote
bezüglich der Indikatoren für autistische Verhaltensweisen erzielt, sowie
teilweise bestimmte Komorbiditäten mit Epilepsie oder ähnlichen Anfallsleiden
festgestellt.
14
Steinhausen merkt zu elektrophysiologischen Studien jedoch an, dass ,,...die
Spezifität von Befunden bildgebender Verfahren (z. B. des Computertomogramms)
oder von Hirnautopsien als Hinweis auf morphologisch neuroanatomische
Abweichungen beim gegenwärtigen Stand des Wissens als gering
einzuschätzen..." ist.
15
Zur Prävalenz bezüglich der Geschlechterverteilung zeigt sich eine deutlich
höhere Betroffenheit von Jungen gegenüber Mädchen, welche mit einem 3 bis 4-
mal häufigerem Vorkommen beziffert wird. Vor allem beim Asperger-Syndrom
lässt sich diese Tendenz erkennen. Jedoch sind andererseits Mädchen mit
frühkindlichem Autismus oft in einem stärkeren Ausmaß von der Krankheit
betroffen.
16
Um einen kurzen Umriss des Verlaufs einer Diagnostik darzustellen, wird nun
noch kurz und zusammengefasst auf verschiedene Elemente nach Poustka
eingegangen:
1. Früherkennung: Je früher die Krankheit erkannt wird, desto wirksamer und
präventiver kann mit Interventionen und Maßnahmen zur Therapie und
Förderung angesetzt werden.
2. Exploration und Befragung der Bezugspersonen: Eine genaue
Anamnese und detaillierte Angaben bezüglich Umfeld, Familie etc. durch
schriftliche Befragungen und Interviews sind unerlässlich als Basis der Diagnostik.
3. Verhaltensbeobachtung und/oder Exploration und Verhaltensanalyse:
Im Zentrum steht natürlich das Kind oder der Erwachsene mit seinen Symptomen.
Diese werden mit wissenschaftlichen Instrumenten eingeordnet und nach
möglichst objektiven Kriterien in gewohnter, aber auch neuer Umgebung
exploriert.
13
Poustka et al (2004), S. 83
14
vgl. Poustka et al. (2004), S. 83
15
Steinhausen (2002), S. 63
16
vgl. Poustka et al. (2004), S. 18
10
4. Testpsychologische Untersuchung: Kognitive und psychologische
Gegebenheiten stehen im Fokus.
5. Körperliche und neurologische Untersuchung: Allgemeiner
Gesundheitszustand, motorische und neurologische Parameter stehen im Fokus.
6. Multiaxiale Klassifikation: Nach Bestandsaufnahme und Sammlung erfolgt
die Einordnung in den ICD-10.
7. Verlaufskontrolle: Obligatorisch bei diesem Krankheitsbild, da Symptomatik
relativ stabil verläuft, jedoch in größeren Abständen durchaus angebracht.
Eine umfassende Diagnostik ist durch diese vielen Elemente der
Bestandsaufnahme somit nur durch ein Konsultieren von verschiedenen
Einrichtungen, Institutionen und Experten gegeben.
17
Schwierigkeiten, Autismus festzustellen, zeigen sich beispielsweise bei Kindern,
die nur vereinzelt Symptome der Krankheit aufweisen. Eine weitere Problematik
ist die ständige Veränderung der pathologischen Kennzeichen im
Entwicklungsverlauf. Zudem sind die verschiedenen Grade der Ausprägung sehr
differenziert.
18
Als diagnostische Verfahren zur Erkennung von Autismus sind beispielsweise der
ADOS (diagnostische Beobachtungsskala für autistische Störungen) zu nennen,
aber auch das diagnostische Interview für Autismus (ADI).
19
1.1.3 Arten von Autismus
1.1.3.1 Frühkindlicher Autismus (Kanner-Syndrom)
,,Kinder mit frühkindlichem Autismus sind in der Regel von Geburt an auffällig,
weisen häufig multiple Entwicklungsstörungen auf und sind auch in ihren
kognitiven Funktionen meist deutlich eingeschränkt", so erläutern Remschmidt
17
vgl. Poustka et al. (2004), S. 44/45
18
vgl. Remschmidt (2005), S. 24
19
vgl. Poustka et al. (2004), S. 125, 129
11
und Kamp-Becker einige Hauptkategorien des Kanner - Autismus, welcher auch
deshalb in den meisten Fällen relativ früh festgestellt werden kann.
20
Ein offensichtliches Indiz für das Symptom ist vor allem die außergewöhnlich
starke Abkapselung von der Umwelt, ein rigides Festhalten an Strukturen und
Abläufen, wie auch die frühe Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung,
welche sich von einer Verzögerung des Erlernens bis zum völligen Verlust oder
Beschränkung auf rudimentäre Äußerungen erstreckt.
21
Remschmidt beschreibt
außerdem ,,...eine Neigung zu Wortneubildungen und zu Echolalien (echoartiges
Nachsprechen von Worten oder Lauten). Die Kinder sprechen von sich in der
dritten Person und lernen erst sehr spät, die eigene Person mit ,ich' zu
bezeichnen."
22
Als weitere unspezifische Indikatoren werden unter anderem Phobien, aggressive
Verhaltensweisen und selbst verletzende Tendenzen angeführt. Die oft völlig
fehlende Aufnahme von Kontakt zu anderen Menschen ist sehr gut in
Spielsituationen zu beobachten, in denen sie in der Regel als Einzelgänger
hervortreten. Sehr sensibel reagieren Kinder und Erwachsene mit diesem
Symptom auf Geräusche und Lärm.
Die bereits zuvor genannten Phobien oder ängstliche Zustände äußern sich in
Handlungen oder Situationen, in denen ihre gewohnte Umwelt verändert wird
und für die Betroffenen Unerwartetes geschieht.
Eine geistige Retardierung geht oft einher mit dem frühkindlichem Autismus,
jedoch muss unterschieden werden, ob diese eine Begleiterscheinung der
Krankheit ist oder sie im Vordergrund steht. Eine kognitive Andersartigkeit allein
weist im Normalfall bei Betroffenen keine oder nur wenig Störungen der
Emotionalität oder der zwischenmenschlichen Beziehungen auf.
Freude erleben die Kinder mit Gegenständen, die sie zweckentfremdet in
rotierenden Bewegungen und Handlungsweisen einsetzen
23
- beispielsweise an
einem umgedrehten Fahrrad die Reifen zu drehen oder eine Kette hinter sich her
zu ziehen.
20
Remschmidt; Kamp-Becker (2007),
www.aerzteblatt.de
, Stand: 22.03.09
21
vgl. Remschmidt (2005), S. 16 ff
22
ebd., S. 18
23
vgl. ebd., S. 16 ff
12
1.1.3.2 Asperger Autismus
Besonders prägnant ist bei dieser Form des Autismus das Problem der
Kontaktschwierigkeiten und des Unvermögens von Kommunikation zu anderen
Menschen. Im Unterschied zur frühkindlichen Variante sind die verbalen
Fähigkeiten, wie auch die intellektuellen, meist nicht von der Krankheit betroffen
oder nur in gewissem Maße vermindert. Dabei treten jedoch hauptsächlich in
nonverbalen Interaktionen Defizite hervor, wie das Herstellen von Blickkontakt,
gestikulierendes Verhalten und Mimik sowie das Initiieren und Weiterführen von
Beziehungen zu Personen im gleichen Alter oder mit Altersunterschieden.
Emotionen des Gegenübers werden nicht wahrgenommen und eine
dementsprechende Reaktion oder ein Mitfühlen somit verhindert. Es besteht ein
Kontakt zur Lebensumwelt von betroffenen Kindern und Erwachsenen, der aber
nur insofern zustande kommt, als dass sie in Kontakt treten und von ihren
Interessen und Belangen sprechen, egal, wie die angesprochene Person reagiert
und wie sie sich äußert. Dabei kommt es oftmals zu einem wahren Redefluss, der
sich nur einseitig abspielt.
Die Sprachmelodie wird häufig als eine Art von ,,Robotersprache" beschrieben,
die monoton und ohne Höhen oder Tiefen verläuft.
Typische Stereotypien und Muster von Bewegungen finden auch in der Form des
Asperger-Autismus Anwendung und zwar in den diagnostischen
Zuschreibungskriterien, die mit motorischen Schwerfälligkeiten und
Verzögerungen einhergehen.
Außerdem spielen verschiedene Zwänge oder extreme Formen von bestimmten
Interessensbereichen, der in mancher Literatur so genannten ,,Aspies", eine Rolle.
Vor allem der Alltag der Menschen ist geprägt von einem Verlangen nach festen
Strukturen und Ritualen.
24
Zur Häufigkeit des Auftretens lassen sich Zahlen von etwa 2 3,3 Kinder auf
10.000 Kinder im Schulalter festmachen.
25
Remschmidt und Kamp-Becker sprechen auch von einer ,,...Beeinträchtigung in
der Prosodie (metrisch-rhythmische Aspekte der Sprache) und Pragmatik der
24
vgl. Remschmidt, Kamp-Becker (2007),
www.aerzteblatt.de
, Stand: 22.03.09
25
vgl. ebd.
13
Sprache ... (sozialer Gebrauch und soziales Verständnis der Sprache). Die
Pragmatik der Sprache regelt den kommunikativen Gebrauch von Grammatik und
Semantik in verschiedenen Kontexten."
26
1.1.3.3 Atypischer Autismus und andere tief greifende Entwicklungsstörungen
Anzeichen der Äußerung einer atypischen Form des autistischen Spektrums
richten sich nach den Kriterien des frühkindlichen Autismus. Fehlend sind hierbei
allerdings das frühe Manifestationsalter, dies lässt sich erst ab oder während des
3. Lebensjahres erkennen, sowie keine vollständige Feststellungsmöglichkeit aller
drei Hauptkriterien des Kanner Syndroms (Soziale Interaktion, Kommunikation,
stereotypes Verhalten).
27
Bemerkenswert ist dabei, dass die atypische Erkrankung auch häufig als eine
,,Intelligenzminderung mit autistischen Zügen" angeführt wird. ,,Zur
Intelligenzminderung kommen die autistischen Züge hinzu. Eltern können es
häufig leichter akzeptieren, wenn ihr Kind, selbst wenn es eine
Intelligenzminderung aufweist, als autistisch bezeichnet wird, als wenn die
Diagnose ,geistige Behinderung' lautet."
28
Zu den sonstigen desintegrativen Störungen des Kindesalters (F 84.3) lässt sich
sagen, dass es ,,... nach einer zunächst regulär verlaufenden frühkindlichen
Entwicklung der ersten 3 bis 4 Lebensjahre, zu einem drastischen Verlust bereits
erworbener Fähigkeiten im Bereich der Sprache, des Spielens, der sozialen
Fertigkeiten, des adaptiven Verhaltens, der Darm- und Blasenkontrolle und der
motorischen Funktionen..." kommt.
29
Diese Darstellung wird auch in Verbindung mit dem Begriff ,,demenzieller
Abbau" gebracht, der Prozess erfolgt schleichend und ist anfänglich kaum zu
erkennen. Er kann jedoch auch wellenförmig verlaufen. Die Diagnose ist sehr
selten, Remschmidt gibt eine Häufigkeit von etwa 10 Fällen auf 1 Million Kinder
an.
30
26
ebd.
27
vgl. Poustka et al., S. 16
28
Remschmidt (2005), S. 63
29
Morsch (2008), S. 8
30
vgl. Remschmidt (2005), S. 65/66
14
Unter den Punkt der anderen tief greifenden Entwicklungsstörungen, fällt zuletzt
noch das Rett-Syndrom. Das Manifestationsalter liegt zwischen dem 7. und 24.
Lebensmonat der betroffenen Person. Eine Kennzeichnung ist gegeben durch
folgende Symptome:
,,Vollständiger Verlust des ziel gerichteten Gebrauchs der Hände,
Verlust oder Teilverlust der Sprache,
Verlangsamung des Kopfwachstums und
Eigenartige, ,windende' Bewegungsstereotypien der Hände."
31
Charakteristisch ist auch der Abbau von Fähigkeiten des Bewegungsapparates
und von Bewegungsabläufen, welche häufig mit neurologischen Problemen und
epileptischen Anfällen einhergehen.
32
1.1.3.4 High-functioning-Autismus
Der High-functioning-Autismus wird erst in den letzten Jahren als neue
Abspaltung des Autismus-Spektrums geführt, deshalb liegen hier noch keine
offiziellen diagnostischen Kriterien vor. Er dürfte jedoch festzustellen sein, wenn
sich die Anzeichen zwischen den Kriterien des frühkindlichen und des Asperger
Autismus befinden und weder markante Symptome des einen noch des anderen
vorliegen. Mit Sicherheit lässt sich trotzdem erkennen, dass Kinder und
Erwachsene mit dieser Auffälligkeit keine geistige Behinderung oder sogar eine
durchschnittliche Intelligenz aufweisen, also der IQ bei über 70 Punkten oder
sogar höher liegt. Die Praxis verfährt in der Zuordnung nach den frühkindlichen
Kriterien mit der Spezifizierung High-functioning-Autismus. Zudem sind die
verbalen Fähigkeiten vergleichsweise gut entwickelt.
33
Durch die Beschreibung der verschiedenen Ausprägungen, vielen Ausnahmen
und Abspaltungen des Autismus und seiner Interpretationen, sollte hier nun ein
Überblick über die wichtigsten Kategorien der Krankheit geschaffen sein.
Zur kurzen und prägnanten Zusammenfassung der Haupteinteilungen, wird
folgende Tabelle angeführt:
31
ebd, S. 63/64
32
vgl. ebd., S. 64
33
vgl. Morsch (2008), S. 9
15
Abbildung 2: Hauptformen Autismus
34
1.1.4 Ursachen der Behinderung
Schon Asperger stellte in den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts
Überlegen an, nachdem die autistische Störung genetischen Ursprungs sein sollte.
Er beschreibt eine von ihm veröffentlichte Studie, in der er rund 200 Familien mit
einem autistischen Kind beobachtete. Dabei fand er heraus, dass seiner Meinung
nach ausnahmslos in jeder Familie, mehr oder weniger starke Kommunikations-
oder Kontaktdefizite vorzufinden waren.
35
Eine andere Hypothese war die der so genannten ,,Kühlschrankmutter". Das Kind
wird nicht adäquat erzogen, Vernachlässigung und der Entzug von Liebe und
Geborgenheit rufen somit autistische Erscheinungen hervor.
34
Remschmidt, Kamp-Becker (2007),
www.aerzteblatt.de
, Stand: 22.03.2009
35
vgl. Remschmidt (2005), S. 11
16
Verschiedene Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass ein solcher Umgang
keine Ursache von Autismus darstellt und derartige Umwelteinflüsse nur zu einer
Steigerung der Symptome führen können.
36
In den folgenden Punkten wird nun auf neuere Untersuchungen eingegangen,
um den aktuellen Stand der Forschung zu ergründen.
1.1.4.1 Neurologische und biochemische Komponente
Chemische Vorgänge spielen im Gehirn eine große Rolle und sind an jeder
Aktivität beteiligt. Zu den wichtigsten und bekanntesten Stoffen gehören die
Neurotransmitter.
37
,,Das sind neurogen gebildete Aktionssubstanzen, die bei der
Erregungsübertragung in den Synapsen der Nervenzellen freigesetzt werden."
38
Die Existenz und Form von Weitergabe der Substanz stehen in Verbindung mit
Reaktionen und Verhaltensweisen. Genaue Zusammenhänge und detaillierte
Vorgänge bedürfen allerdings noch weiterer Untersuchungen.
Vornehmlich stand bisher der Neurotransmitter Serotonin im Fokus der
Forschung und die Frage, ob dieser Wert bei Menschen mit Autismus
ungewöhnliche Abweichungen zeigt. Zur Untersuchung wurde dabei Blut
abgenommen, um den Serotoninwert zu bestimmen. Diese Methode gilt
allerdings als eher unzuverlässig, da die Werte auch tagesformabhängig sind. Im
Gegensatz dazu steht die Entnahme der Liqourflüssigkeit, die als zuverlässiger
gilt, aber auch eine diffizilere Form des Nachweises darstellt.
Kehrer beschreibt in eigenen Untersuchungen, dass bei 129 betroffenen
Personen Serotonin entnommen wurde und nur bei 28,68 % ein erhöhter Spiegel
des Neurotransmitters festzustellen war; bei einigen Patienten war der Wert
normal, andere hatten einen untypisch niedrigen. Somit konnte er keine
Korrelation zwischen den Symptomen des Autismus und dem biochemischen
Stoff Serotonin erkennen.
36
vgl. Kehrer (2000), S. 75
37
vgl. Kehrer (2000), S. 84
38
ebd., S. 84
17
Weitere Untersuchungen galten der Erforschung der Endorphine. Eine Störung in
diesem Bereich könnte auf das häufig auftretende und verminderte
Schmerzempfinden von Kindern mit Autismus hinweisen.
39
In der Literatur angeführt werden außerdem noch zu erforschende Botenstoffe
und Hormone wie das Adrenalin und Noradrenalin als auch der Dopaminspiegel,
denen typische Abweichungen bei der Diagnose von Autismus nachgesagt
werden. Der Dopamin - Stoffwechsel spielt insofern eine Rolle zur Therapie oder
vielmehr der Symptomverminderung von autistischen Verhaltensweisen, da bei
Medikation durch Neuroleptika Verbesserungen hinsichtlich dieser eintraten.
40
In jüngster Zeit legte man auch das Augenmerk auf die so genannten
Spiegelneuronen im präfrontalen Kortex des menschlichen Gehirns. In Versuchen
zeigte sich eine Aktivierung dieser Neuronen, auch wenn man selbst nicht
Handlungen ausführt, sondern die gleichen Bewegungen anderer nur beobachtet.
Deshalb werden sie auch als ,,monkey-see, monkey-do" - Neuronen beschrieben.
Autistischen Kindern und Erwachsenen fehlt diese Form der Imitationsfähigkeit in
Teilbereichen oder vollkommen, was ein weiteres neurologisches Indiz für die
Ursache der Beeinträchtigung wäre.
41
Hirnschädigungen vor, während oder nach der Geburt zählen auch zu den
vielfältigen möglichen Verursachungsvarianten von Autismus.
42
Übermäßig häufig treten bei Menschen mit Autismus außerdem Anfallsleiden auf,
die während der frühen Kindheit oder Pubertät erstmals zum Vorschein kommen.
Ungefähr 20 % der Kinder leiden an epileptischen Anfällen, wenn bei ihnen die
Diagnose des frühkindlichen Autismus besteht. Die Epilepsie tritt bei allen
Formen auf, egal welche Ausprägung der Krankheit vorliegt oder welches
Intelligenzniveau die Personen aufweisen.
43
In einem erst 2007 erschienen Artikel der Zeitschrift Neuron geben verschiedene
Wissenschaftler zu bedenken, dass zwar viele Studien über Gehirnstrukturen im
Bereich des autistischen Syndroms gemacht wurden, dabei jedoch oftmals die
39
vgl. ebd., S. 84 ff
40
vgl. Remschmidt (2005), S. 31
41
vgl. Poustka et al. (2004), S. 33
42
vgl. Remschmidt (2005), S. 74
43
vgl. Poustka et al. (2004), S. 63
18
genaue Untersuchung erst 10 bis 20 Jahre nach der Feststellung und Diagnose
der Behinderung Autismus veranlasst wurde. Der pathologische Hintergrund von
Autismus bleibt zwar im Dunkeln, die Anzeichen und klinischen Symptome sind
jedoch in den ersten Lebensjahren am offensichtlichsten. Die nächstliegende
Folgerung wäre nun, aufgrund der neurobiologischen Besonderheiten in der
frühen Kindheit und des erhöhten Wachstums des Gehirns, genau dort
anzusetzen und weitere Untersuchungen zu initiieren.
Es wird ebenso vermutet, dass die übermäßige Zahl von Neuronen ein möglicher
Grund für das abnormale Gehirnwachstum sei und Defekte in neuronalen
Mustern und Leitungen hervorrufe.
44
Als Zusammenfassung der betroffenen Gehirnregionen soll abschließend folgende
Abbildung dienen, in der auch Bereiche der Amygdala erwähnt werden, die für
Wahrnehmung und Emotionen zuständig ist.
45
Abbildung 3: Neurobiologische Komponenten der einzelnen Hirnareale, die bei Kindern und
Jugendlichen mit autistischen Verhaltensweisen betroffen sind
46
44
vgl. Courchesne, Pierce, Schumann, Redcay, Buckwalter, Kennedy, Morgan (2007),
www.sciencedirect.com
, S. 399, Stand: 30.03.2009
45
vgl. Morsch (2008), S. 18
46
ebd., S. 18
19
1.1.4.2 Genetische Faktoren
Kehrer erwähnt zum Thema Genetik und Blutsverwandtschaft bestimmte
Wesenszüge, die in Familien mit Autismus gehäuft vorkommen. Zu nennen sind
hierbei vor allem Verhaltensweisen wie Kontaktarmut und Zwangsmechanismen.
Seiner Meinung nach ist ein bedingter Zusammenhang in den meisten Fällen
gegeben.
Bereits Kanner stellte bei seinen Forschungen eine gewisse Übereinstimmung,
zwischen dem Verhalten von Eltern und Kindern fest. Häufig zeigten die damals
von ihm untersuchten Eltern der auffälligen Kinder schon eine starke Neigung zu
bestimmten Interessen und Zwängen.
Im Verlauf der Zeit wurden diese Feststellungen von verschiedenen
Wissenschaftlern, unter ihnen auch Kehrer, wiederholt beobachtet. Dies sei
allerdings noch nicht ausreichend für eine definitive genetische Disposition als
Ursache.
In Untersuchungen mit Zwillingspaaren konnten fundiertere Kenntnisse gefunden
werden. Als Beispiel dient eine Studie über 47 Zwillingspaare mit mindestens
einem Autisten. 25 waren eineiig (monozygot) und die anderen 22 zweieiig
(heterozygot). Dabei wurde ersichtlich, dass bei den eineiigen Zwillingen auffällig
viele (15 Pärchen) konkordant, also beide Kinder autistisch waren. Die restlichen
10 wiesen keine Ähnlichkeiten auf. Bei den zweieiigen Pärchen hingegen zeigte
sich eine stark verminderte Konkordanz.
Kehrer erwähnt eine zusammenfassende Studie über 87 Zwillingspärchen, von
denen 48 monozygot und 39 heterozygot waren. Bedeutend war die 77,1%-ige
Übereinstimmung von autistischen Verhaltensweisen beider Kinder bei
monozygoten Pärchen. Bei den zweieiigen trat nur eine Häufigkeit von 23,1 %
auf.
Ergänzend ist jedoch anzuführen, dass bei diesen Studien das besondere Risiko
bei Zwillingsgeburten nicht miteinbezogen wurde. So könnte beispielsweise durch
die Geburt eine übermäßige Häufigkeit von Sauerstoffmangel vorliegen, die bei
normalen Geburten seltener auftritt. Eine genauere Anamnese sollte deshalb bei
künftigen Studien eine wichtigere Rolle spielen.
47
47
vgl. Kehrer (2000), S. 77 ff
20
Einige Gene sind mittlerweile in den Fokus der Forschung gelangt. ,,Eine
steigende Zahl von Genen und DNA-Markern, die mit Autismus in Verbindung
stehen können, wurde ... identifiziert und geprüft. Einige Gene und Marker
wurden mit Priorität untersucht, da aufgrund bestimmter Beobachtungen und
empirischer Ergebnisse die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Störung
zusammenhängen a priori erhöht ist."
48
Dabei wird in der einschlägigen Literatur
auch von bestimmten Kandidaten-Genen gesprochen, bei denen stärker als von
anderen eine Beeinflussung des Zustandekommens von Autismus angenommen
wird.
MacDonald und Kollegen wiesen im Jahre 1989 in einer Geschwisterstudie mit
einem autistischen Familienmitglied nach, dass von 78 untersuchten
Geschwistern 15 % erhöhte Auffälligkeiten in kognitiven Bereichen zeigten,
insbesondere in Form von Sprach- und Sprechstörungen. Geschwister von
Kindern mit Down-Syndrom haben vergleichsweise nur ein erhöhtes Risiko von
4,5 % an vergleichbaren Beeinträchtigungen zu erkranken.
49
Insgesamt lässt sich zum Thema der genetischen Ursachen von Autismus sagen,
dass die vererbte Disposition nachweislich eine Rolle bei der Entstehung des
Krankheitsbildes spielt. Die Genetik darf allerdings in der Ursachenforschung
nicht überbewertet werden und stellt höchstwahrscheinlich nur einen
unspezifischen Auslösemechanismus, unter vielen anderen, im gesamten
Entstehungskontext dar.
50
1.1.4.3 Neuropsychologie
,,In der Neuropsychologie des Autismus werden vorrangig Besonderheiten der
Intelligenzstruktur, Störungen der Theory of Mind, Exekutivfunktionen sowie
schwache zentrale Kohärenz als mögliche psychologische Korrelate autistischen
Verhaltens erforscht."
51
48
Poustka et al. (2004), S. 26
49
vgl. Remschmidt, zit. n. MacDonald (1989), S. 26
50
vgl. Kehrer (2000), S. 79
51
Poustka et al. (2004), S. 28
21
Premack und Woodruff stellten bereits 1978 die Hypothese der Theory of Mind in
den Fokus von Forschungen. Diese bezeichnet eine bestimmte Leistung von
Menschen, Vermutungen über mentale Vorgänge, die sie selbst oder andere
betreffen, zu entwickeln. Mehrere bisher durchgeführte Studien belegen, dass
Kinder und Erwachsene mit frühkindlichem Autismus und High-functioning-
Autismus nur partiell über solche Fähigkeiten verfügen. Somit entstand die
Theorie, dass durch diesen Mangel deutliche Defizite im kognitiven Bereich von
Menschen mit autistischen Verhaltensweisen bestehen. Hierzu gehört vor allem
auch das Unvermögen von Als-ob-Spielen, imaginativer Aktivitäten und nur wenig
bis gar kein Einfühlungsgeschick.
52
Andere Studien über die Messung der Intelligenzleistungen von Betroffenen
machen eine meist höhere Intelligenz der Asperger Autisten deutlich, im
Gegensatz zu den Menschen, die als High-functioning-Autisten diagnostiziert
werden.
53
Mit Exekutivfunktionen sind Problemlösestrategien oder mentale Prozesse, die
Menschen entwickeln, gemeint. Darunter fallen beispielsweise Leistungen wie
,,...Antizipation, Planung, Handlungsorientiertheit, kognitive Flexibilität,
Koordinierung von Informationen und Informationsprozessen."
54
Das Fehlen dieser exekutiven Funktionen als typisches Syndrom des Autismus
darzustellen, gilt in jüngster Zeit als anzweifelbar. Aktuelle Daten belegen, dass
Mängel im Arbeitsgedächtnis nicht als Indikator für die Störungsform
ausschlaggebend sind.
55
Ein anderer wichtiger Aspekt in der Ursachenforschung ist die Beeinträchtigung
der Wahrnehmungsverarbeitung. Es wird vermutet, dass betroffene Kinder und
Erwachsene die Flut von Reizen aus der persönlichen Umwelt nicht richtig ordnen
und filtern können. Das Zusammenfügen von Informationen und die Umsetzung
zur psychischen Funktion oder Reaktion erscheint erschwert, die Auswahl der
passenden Information gelingt nicht.
52
vgl. Förstl (2007), S. 297
53
vgl. Remschmidt (2005), S. 55
54
Morsch (2008), S. 31
55
vgl. Poustka et al., zit n. Ozonoff & Strayer (2001), S. 31
22
Menschen mit Autismus fehlt ein so genannter natürlicher Filter, der relevante
Dinge von Unwichtigem trennt. Zur Orientierung in ihrer persönlichen Lebenswelt
bedarf es jedoch eines solchen Filters.
Kehrer nimmt an, ,,...dass ein Reglersystem im Gehirn gestört ist."
56
Deshalb sind
bestimmte Verhaltensweisen von Kindern erklärbar, wie wenn es ,,...sich
abschirmt, die Augen verdeckt, sich die Ohren zuhält oder sich zurückzieht...",
unter der Fülle von Umweltreizen.
57
Diese Annahme gilt auch als Anzeichen für
Ausweichmechanismen auf grundlegende Sinne, wie gustatorische oder taktile.
Auch das Speichern von Informationen funktioniert in einer anderen Weise. Was
sie sehen und hören vergessen sie nicht, an andere Erlebnisse können sie sich
nicht mehr erinnern.
58
1.1.4.4 Umwelteinflüsse
Bisherige Studien zu Umweltfaktoren haben ergeben, dass Einflüsse von außen
zumindest in manchen Fällen der Ätiologie, etwa 10%, eine Rolle spielen. Der
Begriff ,,Umwelt" lässt eine sehr breite Fächerung von relevanten Bedingungen zu,
welche in einem biopsychosozialen Modell zusammengefasst werden und in
verschiedensten Formen auf den Menschen einwirken.
Nach Poustka sind die am häufigsten genannten Faktoren angeborene Röteln
und Schilddrüsenunterfunktionen des Kindes, wie auch die Einnahme von
Thalidomid, Valproinsäure und eine Schilddrüsenunterfunktion seitens der Mutter.
Weiterhin werden das Pfeifferische Drüsenfieber, Lebensmittelunverträglichkeit
zum Beispiel gegen Gluten und Casein und Antibiotikamedikationen genannt,
wobei die letzten beiden Annahmen ohne empirische Fundierung bestehen. Die
Vermutung, dass Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln und Keuchhusten zu
den Auslösern zählen, konnte mittlerweile widerlegt werden.
Schädigungen, die infolge von Geburtskomplikationen entstehen, sind eher als
Folgeerscheinung und nicht als Ursache zu sehen.
59
56
Kehrer (2005), S. 69
57
ebd., S. 69
58
vgl. ebd., S. 70
59
vgl. Poustka et al. (2004), S. 26 ff
23
Eine andere durchgeführte Studie betrifft die Bindung zu Bezugspersonen, also
normalerweise vornehmlich der Mutter als primäre Erziehungs- und
Betreuungsperson. Die Untersuchung, welche an 44 autistischen und einer
Kontrollgruppe von gesunden Kindern durchgeführt wurde, besagt eine
verhältnismäßig hohe Anzahl von autistischen Äußerungen nach einer längeren
Trennungszeit von der Mutter. Die Trennungen erfolgten in den ersten 30
Lebensmonaten der Kinder, Grund war oftmals ein längerer
Krankenhausaufenthalt. Diese Form von Deprivation, die bei manchen stärker
oder schwächer war, hat in einigen Fällen Formen von Autismus entstehen
lassen.
60
1.2 Auswirkungen auf die Familie
Wenn in Familien eine Behinderung auftritt oder eine Besonderheit diagnostiziert
wird, entstehen für die Betroffenen eine Vielzahl von Veränderungen in ihrem
Leben, ihren Plänen und Wünschen. Dies betrifft nicht nur die Individuen der
Familie allein, sondern auch die gesamte Umwelt und das System, in dem sie
leben und sich bewegen - bis hin zu sozialen, politischen und gesellschaftlichen -
Strukturen. Deshalb werden nun im Folgenden die Auswirkungen und Effekte auf
Familien mit einem autistischen Kind erläutert.
1.2.1 Entwicklung des Familienlebens
Ein autistisches Kind zu haben bedeutet für die gesamte Familie eine Vielzahl
gravierender Umstellungen und enormer Belastungen. Zur selben Zeit ist aber
auch eine große Willensstärke und ambitioniertes Verhalten wichtig. Dieser
Spagat ist eine Lebensaufgabe für jeden Einzelnen in der Familie und bedarf
eines Zusammenhalts in verschiedenen Aspekten.
Alleine die Frage nach der Wohnsituation und der strukturellen Verfügbarkeit von
Betreuungs- und Therapieeinrichtungen sowie Therapiemöglichkeiten stellt eine
60
vgl. Kehrer (2000), S. 76/77
24
Herausforderung und fundamentale Überlegung dar. So ist die lokale
Versorgungsstruktur oft ein Indikator für die Wohnortswahl und den
Lebensmittelpunkt. Dies steht in enger Verbindung mit den finanziellen
Möglichkeiten, dem Verdienst und weiteren finanziellen Unterstützungsformen
der sozialpolitischen Rechtslage.
61
Andererseits wird die finanzielle Unterstützung seitens des Staates subjektiv von
der Familie als eine Form von Abhängigkeit und Stigmatisierung wahrgenommen,
überhaupt diese Leistungen in Anspruch zu nehmen oder nehmen zu müssen.
Die politische Lage und rechtliche Gegebenheiten beeinflussen die Sorge der
Familie um die künftige Betreuungssituation, den Ausbau oder Verringerung von
Angeboten, auch im Hinblick auf das dazugehörende pädagogische Personal.
62
Gleich am Anfang der Entwicklung des Kindes ist auch die Entwicklung der
Bindung zu den Eltern von Bedeutung. Poustka stellt die Schwierigkeit
folgendermaßen dar, dass es ,,besonders schmerzhaft für die Eltern ist, dass sie
keine, ihren Vorstellungen entsprechende, Beziehung zum Kind aufbauen können.
Das Kind wendet sich ihnen kaum zu und kommuniziert wenig."
63
Bemühungen
und Zuwendungen der Eltern werden von ihrem Kind meist nicht in
ausreichender Form rückgemeldet oder erwidert.
In bestimmten Situationen können widersprüchliche Emotionen gegenüber ihrem
Kind entstehen, es gibt nur in einem sehr eingeschränkten Rahmen einen
Beziehungsaufbau, wie er von den Eltern gewünscht ist. Dies liegt auch in der
Natur der Beeinträchtigung durch autistische Verhaltensweisen, dass das Kind
seinen Bezugspersonen nicht in ausreichendem Maße Beachtung, Liebe und
Austauschmöglichkeiten durch Kommunikation geben kann.
64
Vor allem, wenn das Kind nicht sprechen kann, ist es schwierig, Bedürfnisse und
Wünsche zu erkennen. Eine Kommunikationsform stellt dabei oft das Führen der
Hand von Bezugspersonen dar, um erwünschte Objekte oder Handlungen zu
erreichen. Dieses Verhalten ist allerdings häufig ein großes Rätselraten und sehr
anstrengend für beide Seiten. Die Kinder werden dadurch oft frustriert und legen
61
vgl. Poustka, Bölte, Feineis-Matthews, Schmötzer - Ratgeber (2004), S. 36/37
62
vgl. Lorenz (2003), S. 255
63
Poustka et al. Leitfaden (2004), S. 93
64
vgl. Poustka et al. Ratgeber (2004), S. 36
25
ein aggressives Verhalten gegen sich selbst an den Tag. Dazu gehört unter
anderem, sich selbst an den Haaren zu ziehen, zu schlagen oder kratzen.
65
Die meisten Eltern machen sich Vorwürfe wegen der Entwicklung oder des
Zustandes des Kindes und suchen die Schuld bei sich selbst. Sie überlegen
permanent, was sie falsch oder richtig gemacht haben und werden somit wieder
verunsichert. Daneben kann auch Versagensangst auftreten. Für die Eltern ist
es oft nur schwer ersichtlich, inwieweit sie von ihrem Kind angenommen
werden.
66
Aus der Forschung geht mittlerweile hervor, dass Eltern nicht an der Entstehung
des Krankheitsbildes Autismus beteiligt sind, sondern häufig biologische und
genetische Ursachen eine Rolle spielen. Das wiederum heißt nicht, dass auffällige
Verhaltensweisen von den Eltern einfach hingenommen werden dürfen und keine
Regeln oder Verständnislosigkeit in der Familie vorherrschen. Eine konsequente
Förderung der Eltern kann enorme positive Auswirkungen auf die Entwicklung
des Kindes haben.
67
Oft kann sich der Zeitraum über Jahre hinweg strecken, bis sich Ärzte und
Einrichtungen einig sind und eine Diagnose des Autismus und damit
einhergehende Entwicklungsstörungen vorliegen. Zudem kommt es häufig vor,
dass Ärzte und Psychologen Unsicherheiten in Bezug auf die Symptome und
Diagnosestellung zeigen und falsche oder gegensätzliche Ergebnisse festgestellt
werden.
68
Weiterhin findet in vielen Fällen nach der Diagnosestellung kein klärendes
Gespräch statt und die Eltern werden mit ihren vielen Fragen und dem Chaos an
Gefühlen erstmal allein gelassen. Viele verstehen nicht, was die Behinderung
überhaupt bedeutet, zumal sie ja auch Experten oft nicht ganz klar erscheint.
Einerseits sehen Eltern die Diagnose als Erleichterung und endliche Gewissheit
über den Zustand ihres Kindes an, andererseits wirft dies eben neue Fragen und
Überlegungen auf. Lorenz führt die Aussage einer Mutter an: ,,Retrospektiv
65
vgl. Finger (1995), S. 114
66
vgl. Poustka et al. Leitfaden (2004), S. 92
67
vgl. ebd., S. 92/93
68
vgl. Poustka et al. Ratgeber (2004), S. 37
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836641210
- DOI
- 10.3239/9783836641210
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Regensburg – Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- autismus behinderung familienhilfe fördermöglichkeit hilfsangebot
- Produktsicherheit
- Diplom.de