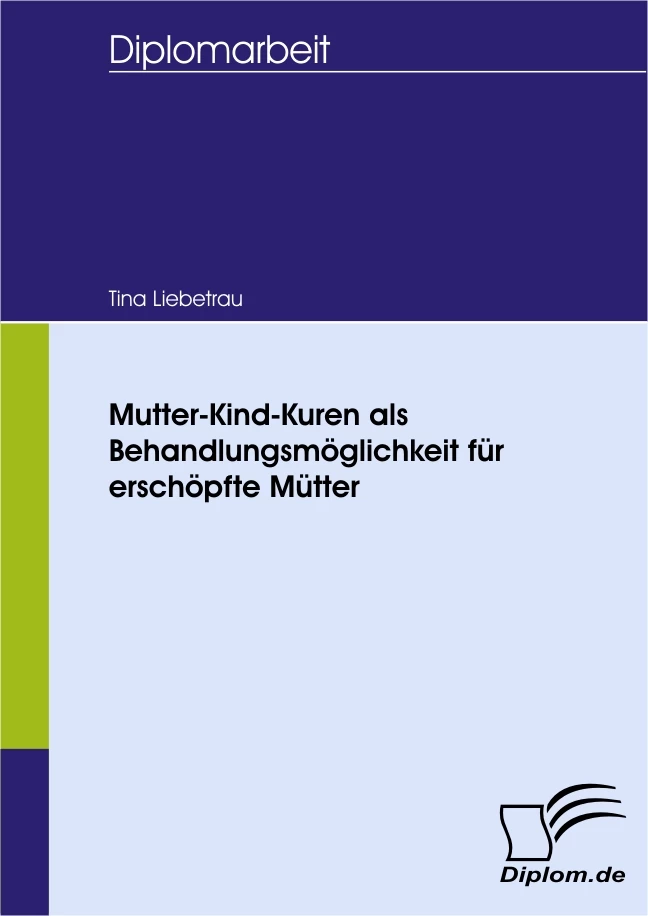Mutter-Kind-Kuren als Behandlungsmöglichkeit für erschöpfte Mütter
©2009
Diplomarbeit
159 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ich fühle mich unglücklich und bin unzufrieden, weil ich zu wenig Zeit für meine Familie habe. Täglich stehe ich morgens bis abends unter Dauerdruck durch die Doppelbelastung Familie und Beruf.Ich habe keine Zeit für mich selbst und reagiere teilweise aggressiv auf meinen Sohn und meinen Mann.
(Mutter eines 4-jährigen Kindes, verheiratet, 35 Jahre alt, berufstätig im Außendienst 40 Stunden/Woche).
Dieses Zitat spiegelt Aussagen von vielen anderen Müttern wider, die heute unter ungünstigen und belastenden sozialen Bedingungen leiden. Sie bewältigen die verschiedensten Anforderungen des Alltags, die mit Kindern, Ehe, Beruf, Haushalt oder häufig auch der Pflege und Versorgung kranker Angehöriger verbunden sind. Diese Mehrfachbelastungen führen oft zur Gefährdung oder Störung der eigenen Gesundheit und viele Mütter leiden unter Erschöpfung, körperlichen Beschwerden und/oder anderen psychischen Belastungen. Aber zu sinnvollen, möglichen Behandlungsmaßnahmen wird ihnen der Zugang erschwert oder nicht ermöglicht. Diese Erfahrungen, die während eines praktischen Semesters im Rahmen des Studiums in einer Mutter-Kind-Klinik gewonnen wurden, stellen den Hintergrund der Themenwahl für diese Diplomarbeit dar. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt, nach den Recherchen der Autorin, in Deutschland weniger vor. Mit dieser Arbeit soll demzufolge versucht werden, eine höhere, notwendige Präsenz dieses Themas in der Gesellschaft hervorzurufen und die gesundheitlichen Beschwerden und Belastungen und die damit verbundene Notwendigkeit an Hilfsangeboten für Mütter zu verdeutlichen.
Daher erfolgt die Bearbeitung des Themas unter folgenden Fragestellungen:
Unter welchen sozialen und gesundheitlichen Belastungen leiden Mütter in unserer Gesellschaft?
Was ist eine Mutter-Kind-Kur? Stellt sie eine adäquate Behandlungsmöglichkeit für erschöpfte Mütter dar?
Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen hat die Soziale Arbeit in diesem Arbeitsfeld?
Methodik:
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die statistischen Daten, die durch eine quantitative Befragung in einer Mutter-Kind-Klinik erhoben wurden. Der Bitte des Ausfüllens dieses Fragebogens kamen 126 Mütter nach, während sie in der Zeit vom 04. Februar bis 08. April 2009 an einer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme nach §§ 24, 41 SGB V in der Mutter-Kind-Klinik der AWO Sano gGmbH Rerik des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern teilnahmen. Untersucht wurden dabei […]
Ich fühle mich unglücklich und bin unzufrieden, weil ich zu wenig Zeit für meine Familie habe. Täglich stehe ich morgens bis abends unter Dauerdruck durch die Doppelbelastung Familie und Beruf.Ich habe keine Zeit für mich selbst und reagiere teilweise aggressiv auf meinen Sohn und meinen Mann.
(Mutter eines 4-jährigen Kindes, verheiratet, 35 Jahre alt, berufstätig im Außendienst 40 Stunden/Woche).
Dieses Zitat spiegelt Aussagen von vielen anderen Müttern wider, die heute unter ungünstigen und belastenden sozialen Bedingungen leiden. Sie bewältigen die verschiedensten Anforderungen des Alltags, die mit Kindern, Ehe, Beruf, Haushalt oder häufig auch der Pflege und Versorgung kranker Angehöriger verbunden sind. Diese Mehrfachbelastungen führen oft zur Gefährdung oder Störung der eigenen Gesundheit und viele Mütter leiden unter Erschöpfung, körperlichen Beschwerden und/oder anderen psychischen Belastungen. Aber zu sinnvollen, möglichen Behandlungsmaßnahmen wird ihnen der Zugang erschwert oder nicht ermöglicht. Diese Erfahrungen, die während eines praktischen Semesters im Rahmen des Studiums in einer Mutter-Kind-Klinik gewonnen wurden, stellen den Hintergrund der Themenwahl für diese Diplomarbeit dar. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt, nach den Recherchen der Autorin, in Deutschland weniger vor. Mit dieser Arbeit soll demzufolge versucht werden, eine höhere, notwendige Präsenz dieses Themas in der Gesellschaft hervorzurufen und die gesundheitlichen Beschwerden und Belastungen und die damit verbundene Notwendigkeit an Hilfsangeboten für Mütter zu verdeutlichen.
Daher erfolgt die Bearbeitung des Themas unter folgenden Fragestellungen:
Unter welchen sozialen und gesundheitlichen Belastungen leiden Mütter in unserer Gesellschaft?
Was ist eine Mutter-Kind-Kur? Stellt sie eine adäquate Behandlungsmöglichkeit für erschöpfte Mütter dar?
Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen hat die Soziale Arbeit in diesem Arbeitsfeld?
Methodik:
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die statistischen Daten, die durch eine quantitative Befragung in einer Mutter-Kind-Klinik erhoben wurden. Der Bitte des Ausfüllens dieses Fragebogens kamen 126 Mütter nach, während sie in der Zeit vom 04. Februar bis 08. April 2009 an einer Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme nach §§ 24, 41 SGB V in der Mutter-Kind-Klinik der AWO Sano gGmbH Rerik des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern teilnahmen. Untersucht wurden dabei […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tina Liebetrau
Mutter-Kind-Kuren als Behandlungsmöglichkeit für erschöpfte Mütter
ISBN: 978-3-8366-3962-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule Erfurt, Erfurt, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei einigen Menschen bedanken, die
mich bei der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben. Ich danke
zunächst der Geschäftsführung, der Leitung und den Mitarbeitern der
Mutter-Kind-Klinik AWO Sano gGmbH aus Rerik/Mecklenburg-
Vorpommern, durch die ich das Interesse an diesem Thema und ein
grundlegendes Wissen über dieses Arbeitsfeld gewinnen konnte, und
speziell bei den Mitarbeiterinnen des Psychosozialen Dienstes, die mich
bei der Erstellung und Durchführung der empirischen Erhebung
unterstützten.
Dem Deutschen Müttergenesungswerk (MGW) der Elly Heuss-Knapp-
Stiftung gebührt mein Dank für das Bereitstellen und Zustellen von
Informationsmaterial und Herrn Golenia von der AOK Erfurt für das
Gespräch, durch das ich einen Einblick in die Position der Krankenkassen
bei der Mutter-Kind-Kur- Bewilligung bekam. Frau Kortländer vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und Dr.
Hendrik Faßmann vom Institut für empirische Soziologie an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg danke ich für den Kontakt und
die Erlaubnis der Verwendung ihrer ,,Bedarfs- und Bestandsanalyse von
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter und Väter in
Einrichtungen des Deutschen Müttergenesungswerkes MGW".
Mein besonderer Dank gilt vor allem meiner Familie, insbesondere meiner
Mama Elvira, meinem Bruder Martin und meinen Großeltern Lisa und
Reinhold, die mir nicht nur während dieser Zeit, sondern auch auf meinem
bisherigen Lebensweg begleitend und unterstützend zur Seite standen.
Ich danke Wolfgang für die tatkräftige Unterstützung am Computer und
Scanner. Meinem Freund Christian danke ich für den liebevollen Beistand,
Verständnis, Ablenkungsversuche und aufmunternde Worte während
dieser Zeit.
II
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ... IV
Abbildungsverzeichnis ... VI
Tabellenverzeichnis ... VI
1
Einleitung...1
1.1
Relevanz des Themas ...1
1.2
Methodik ...2
1.3
Aufbau der Arbeit ...3
2
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft ...5
2.1
Soziale Aspekte ...6
2.1.1
Ausgangslage: die Entwicklung des Frauenbildes ...6
2.1.2
Gegenwärtige gesellschaftliche Umstände von Frauen ...8
2.1.3
Frauen und Erwerbstätigkeit ...10
2.1.4
Frauen und die Familie ...13
2.1.5
Resultierende Belastungen von Frauen...15
2.2
Gesundheitliche Aspekte ...17
2.2.1
Unterschiede zum Gesundheitszustand von Männern...20
2.2.2
Psychische Gesundheit von Frauen ...23
3
Schriftliche Klientenbefragung ...25
3.1
Fragestellung der Untersuchung...25
3.2
Methodisches Vorgehen ...25
3.2.1
Die Befragung...27
3.2.2
Die schriftliche Form ...28
3.2.3
Der Fragebogen...29
3.3
Auswahl der an der Umfrage beteiligten Einrichtung ...31
3.4
Beteiligung und Rücklauf ...32
3.5
Zur Auswertung...34
3.6
Darstellung und Interpretation der Ergebnisse...34
3.6.1
Soziodemographische Merkmale der Mütter...34
3.6.2
Beschwerden, Belastungen und Kurziele der Mütter ...42
3.7
Zusammenfassung der Klientenbefragung ...47
III
4
Erschöpfungssyndrom bei Müttern...50
4.1
Begriffsklärung ...50
4.2
Definitionsversuche...51
4.3
Symptomatik ...54
4.4
Behandlung...56
5
Überblick kurativer Behandlungsmöglichkeiten ...57
6
Die Mutter-Kind-Kur ...61
6.1
Anliegen ...61
6.2
Begriffsklärung ...64
6.3
Rahmenbedingungen...65
6.3.1
Gesetzliche Grundlagen ...65
6.3.2
Wichtige Gesetzesänderungen...67
6.3.3
Finanzierung ...68
6.3.4
Indikationen...70
6.3.5
Die Beantragung ...71
6.4
Angebote...71
6.5
Effektivität und Effizienz ...73
6.6
Vor- und Nachteile der Maßnahme ...75
6.7
Das Bewilligungsverhaltens der Krankenkassen...77
6.8
Betonung der Notwendigkeit von Hilfen für Mütter...80
7
Soziale Arbeit in Mutter-Kind-Kliniken ...83
7.1
Definition Soziale Arbeit ...83
7.2
Arbeitsfelder und Aufgaben...84
7.3
Methoden ...86
7.4
Soziale Arbeit und Gesundheit...87
7.5
Der Psychosoziale Dienst einer Mutter-Kind-Klinik ...90
7.6
Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit ...97
8
Fazit...101
9
Ausblick ...108
Quellenverzeichnis... VIII
Anhang ... XXI
IV
Abkürzungsverzeichnis
ADS
Allgemeine Depressionsskala
ALG
Arbeitslosengeld
AOK
Allgemeine Ortskrankenkasse- eine deutsche
gesetzliche Krankenversicherung
AWO
Arbeiterwohlfahrt
AWO SANO
gemeinnützige Träger an der Ostseeküste
bietet in Einrichtungen Urlaubs- und
Kurangebote an
BDPK
Bundesverband Deutscher
Privatkrankenanstalten
BMFSFJ
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
CDU
Christlich demokratische Union Deutschlands
DAK
Deutsche Angestellten Krankenkasse
DDR
Deutsche Demokratische Republik
DRK
Deutsches Rotes Kreuz
et al.
lateinisches Kürzel für: und andere
e.V.
eingetragener Verein
gGmbH
gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
GWA
Gemeinwesenarbeit
http
Hypertext Transfer Protocol
ICD
International Classification of Diseases
Ifes
Institut für empirische Soziologie
IFSW
International Federation of Social Workers
IKK
Innungskrankenkasse
KKH
Kaufmännische Krankenkasse
MDK
Medizinischer Dienst der Krankenkassen
SGB
Sozialgesetzbuch
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
V
u. a.
unter anderem
usw.
und so weiter
WHO
World Health Organization
Weltgesundheitsorganisation
www
world wide web
z.B.
zum Beispiel
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
VI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Beteiligung an der schriftlichen Befragung ...32
Abbildung 2: Alter der Mütter [%]...35
Abbildung 3: Familienstand der Mütter [%]...36
Abbildung 4: Erwerbsstatus der Mütter [%] ...37
Abbildung 5: Arbeitszeiten der Mütter [%] ...38
Abbildung 6: Anzahl der Kinder pro Frau [%] ...39
Abbildung 7: Alter der Kinder [%] ...40
Abbildung 8: Teilnahme der Kinder an der Kurmaßnahme [%] ...41
Abbildung 9: Die fünf häufigsten Beschwerden der Mütter [%]...43
Abbildung 10: Die fünf häufigsten Belastungen [%]...44
Abbildung 11: Anzahl der Belastungen [%] ...45
Abbildung 12: Die fünf Hauptziele für die Kurmaßnahme [%]...46
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gesetze für Mutter-Kind-Kuren...65
Einleitung
1
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
,,Ich fühle mich unglücklich und bin unzufrieden, weil ich zu wenig Zeit für
meine Familie habe. Täglich stehe ich morgens bis abends unter
Dauerdruck durch die Doppelbelastung Familie und Beruf. Ich habe keine
Zeit für mich selbst und reagiere teilweise aggressiv auf meinen Sohn und
meinen Mann."
(Mutter eines 4-jährigen Kindes, verheiratet, 35 Jahre alt, berufstätig im Außendienst 40
Stunden/Woche)
Dieses Zitat spiegelt Aussagen von vielen anderen Müttern wider, die
heute unter ungünstigen und belastenden sozialen Bedingungen leiden.
Sie bewältigen die verschiedensten Anforderungen des Alltags, die mit
Kindern, Ehe, Beruf, Haushalt oder häufig auch der Pflege und
Versorgung
kranker
Angehöriger
verbunden
sind.
Diese
Mehrfachbelastungen führen oft zur Gefährdung oder Störung der eigenen
Gesundheit und viele Mütter leiden unter Erschöpfung, körperlichen
Beschwerden und/oder anderen psychischen Belastungen. Aber zu
sinnvollen, möglichen Behandlungsmaßnahmen wird ihnen der Zugang
erschwert oder nicht ermöglicht. Diese Erfahrungen, die während eines
praktischen Semesters im Rahmen des Studiums in einer Mutter-Kind-
Klinik gewonnen wurden, stellen den Hintergrund der Themenwahl für
diese Diplomarbeit dar. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
diesem Thema liegt, nach den Recherchen der Autorin, in Deutschland
weniger vor. Mit dieser Arbeit soll demzufolge versucht werden, eine
höhere, notwendige Präsenz dieses Themas in der Gesellschaft
hervorzurufen und die gesundheitlichen Beschwerden und Belastungen
und die damit verbundene Notwendigkeit an Hilfsangeboten für Mütter zu
verdeutlichen.
Einleitung
2
Daher erfolgt die Bearbeitung des Themas unter folgenden
Fragestellungen:
· Unter welchen sozialen und gesundheitlichen Belastungen leiden
Mütter in unserer Gesellschaft?
· Was ist eine Mutter-Kind-Kur? Stellt sie eine adäquate
Behandlungsmöglichkeit für erschöpfte Mütter dar?
· Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Grenzen hat die Soziale
Arbeit in diesem Arbeitsfeld?
1.2 Methodik
Die vorliegende Arbeit stützt sich auf die statistischen Daten, die durch
eine quantitative Befragung in einer Mutter-Kind-Klinik erhoben wurden.
Der Bitte des Ausfüllens dieses Fragebogens kamen 126 Mütter nach,
während sie in der Zeit vom 04. Februar bis 08. April 2009 an einer
Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme nach §§ 24, 41 SGB V in der
Mutter-Kind-Klinik der AWO Sano gGmbH Rerik des Bundeslandes
Mecklenburg-Vorpommern teilnahmen. Untersucht wurden dabei die
körperlichen Beschwerden und Belastungen der Mütter sowie ihre
Vorstellungen und Ziele für eine Behandlungsmaßnahme.
Berücksichtigt werden in der Diplomarbeit schwerpunktmäßig die
Belastungen der Mütter, die Patientinnen in der Mutter-Kind-Klinik Rerik
waren. Somit stellt die Literaturanalyse die Untersuchungsmethode der
Diplomarbeit dar und eine Resonanz aus der Praxis erfolgt durch die
quantitative Forschung.
Einleitung
3
1.3 Aufbau der Arbeit
Die Gliederung der vorliegenden Ausarbeitung umfasst theoretische
Bezüge und einen praktischen Teil und ist thematisch und in logischer
Folge angeordnet.
Zur Beantwortung der Fragestellungen und zur Erreichung des Ziels der
Arbeit wird im ersten Teil die soziale Lage der Mütter aufgezeigt. Zum
besseren Verständnis werden zunächst die historische Ausgangslage der
Mütter und ihre weitere Rollenentwicklung dargestellt, um dann kurz die
aktuellen gesellschaftlichen Umstände, denen Frauen in Deutschland
ausgesetzt sind, zu betrachten. Anschließend werden ihre damit
verbundene Entwicklung bezüglich der Erwerbstätigkeit und ihre Position
im Strukturwandel der Familie herausgearbeitet. Im zweiten Teil des
Kapitels erfolgt die Darlegung der gesundheitlichen Situation der Mütter,
wobei zunächst die Lebensphase, in der Frauen zu Müttern werden,
eingeordnet
wird
und
geschlechtsspezifische
Unterschiede
im
gesundheitlichen Zustand gesucht werden. Anschließend wird im
Speziellen die psychische Gesundheit von Frauen aufgegriffen und auf
ihre Zusammenhänge mit den sozialen Umständen überprüft.
Im zweiten Teil erfolgt die Präsentation der empirischen Erhebung, die
mittels eines Fragebogens mit Müttern in einer Mutter-Kind-Klinik
durchgeführt wurde. Sie soll die physischen und psychischen
Beschwerden und Belastungen der Mütter ermitteln und Aufklärung über
Ziele und Wünsche, die Mütter für eine Behandlungsmaßnahme verfolgen,
bringen. Somit kann auch der Vergleich mit den theoretischen Angaben
des ersten Teils der Arbeit stattfinden.
Der dritte Teil der Abhandlung beschäftigt sich theoretisch mit der
Erschöpfung und dem Erschöpfungssyndrom als Krankheitsbild, unter
denen viele Frauen, erfahrungsgemäß und laut der Erhebungsergebnisse,
leiden. Es wird untersucht, ob die Erschöpfungszustände im
Zusammenhang mit den Rollenkonflikten der Mütter stehen.
Der vierte Theorieteil der Arbeit beinhaltet eine kurze Darstellung von
kurativen Behandlungsmöglichkeiten für Mütter im Vorsorge- und
Einleitung
4
Rehabilitationsbereich des Gesundheitssystems und leitet auf das nächste
Kapitel über.
Im fünften Teil erfolgt die Vorstellung der Vorsorge- und
Rehabilitationsleistungen nach §§ 24, 41 des SGB V, die so genannte
Mutter-Kind-Kur. Neben der Ausführung des Anliegens oder Ziels, den
Rahmenbedingungen und Angeboten einer Mutter-Kind-Kur erfolgt u. a.
auch die Betrachtung der Gesetzesänderungen die die Maßnahme
betreffen und die Vor- und Nachteile der stationären Maßnahme für Mütter
und Kinder. Die Effektivität und Effizienz sowie die Problematik mit dem
Bewilligungsverhalten der Krankenkassen und die Betonung der
Notwendigkeit dieser Behandlungsmaßnahme für Mütter werden ebenfalls
in diesem Kapitel betrachtet.
Im letzten Kapitel wird die Soziale Arbeit mit ihren Aufgaben in einer
Mutter-Kind-Klinik aufgezeigt, einschließlich der Möglichkeiten und
Grenzen des sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen Handelns.
Nach der Darstellung des Fazits der Arbeit wird der Ausblick genutzt, um
einen Vorschlag zur Erreichung langfristiger Effektivität von Mutter-Kind-
Kuren und somit der Verbesserung der Lebensumstände für Mütter, zu
erwähnen.
Zum besseren Verständnis wurde für die Erstellung der Arbeit festgelegt,
dass für die Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen, die nach §§ 24 und
41 SGB V ebenso für Väter (Mutter-/Vater-Kind-Kur, Mütter-Väter-Kuren)
gelten, aufgrund der ausschließlichen Betrachtung der weiblichen Lage,
diese nicht weiter aufgeführt oder erwähnt werden. Somit wird
ausschließlich die Rede von Mütter- oder Mutter-Kind-Kuren die Rede
sein. Allgemein wird immer nur von Müttern und Frauen gesprochen und
deren Lebensumstände in dieser Arbeit betrachtet. Ebenso wird für die
Berufsbezeichnung von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern, die im Feld
der Sozialen Arbeit ihrer beruflichen Ausübung nachkommen, zur
übersichtlicheren Gestaltung der Arbeit ,,nur" die Bezeichnung
,,Sozialarbeiter" gebraucht und auf die weibliche Form verzichtet.
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
5
2 Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist klar, dass die Gesundheitsförderung
von Müttern und Kindern wichtig ist, und trotzdem herrscht ungenügendes
Interesse an der Thematik. Vergleicht man die Forschungen mit anderen
Ländern, wie beispielsweise denen des angloamerikanischen Raumes,
wird deutlich, dass sich in Deutschland weniger mit der Lage und der Ver-
sorgung der Mütter beschäftigt wurde, wie Bonnemann-Böhner in einem
Vortrag zur Gesundheit von Müttern und Kindern im Thüringer Landtag
2005 kritisierte. Die Forschungsgruppe um Jürgen Collatz der Medizini-
schen Hochschule Hannover soll nach ihrer Ansicht eine Ausnahme bilden
und sich seit Jahren mit dieser Thematik beschäftigen.
1
Collatz, Fischer
und Thies-Zajonc sehen bedeutungsvolle Veränderungen in der sozialen
Situation von Frauen durch die Entwicklung ihrer Rolle in unserer Gesell-
schaft.
2
Sie weisen auch auf Studien und Expertisen hin, die die Annahme
widerlegen, die Zeit der Kindererziehung sei für die Mütter allgemein eine
von Krankheit wenig betroffene Lebensphase. Weiter wird betont, wie auf-
fällig problematisch und krankheitsauslösend diese Lebensphase für viele
Frauen mit Kindern ist.
3
Darum folgt im ersten Kapitel dieser Arbeit eine
ausführliche Auseinandersetzung mit der sozialen und gesundheitlichen
Lage von Müttern mit Hilfe der Literatur von Collatz, Fischer, Thies-Zajonc
und anderen Autoren.
1
Bonnemann-Böhner 2006, 1
2
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17
3
Collatz et al. 1996; Sieverding 1995 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 16
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
6
2.1 Soziale Aspekte
Die Betrachtung der sozialen Lage der Frau beginnt zunächst mit einem
historischen Überblick, durch den ein Verständnis für ihre Position und das
bekannte traditionelle Rollenbild der Frau entstehen soll, um im Anschluss
die aktuelle Lage und Entwicklung von Müttern unter heutigen Bedingun-
gen untersuchen und einschätzen zu können.
2.1.1 Ausgangslage: die Entwicklung des Frauenbildes
Bereits im 19. Jahrhundert fand ein Wandel der Familienstruktur statt,
durch den die Frau ihre besondere Position zugeteilt bekam.
4
Während
der industriellen Revolution, wurde die bis dahin herrschende Produkti-
onsgemeinschaft aufgelöst und der Wohn- und Familienbereich räumlich
von der Arbeitswelt getrennt wie Rode und Wilke erwähnen.
5
Ebenso
schildern Brüderl und Paetzold diese Entwicklung und fügen hinzu, dass
dabei die Verantwortung für die Familie der Frau untergeordnet wurde.
Der Familienbereich galt nun, im Gegensatz zur Arbeitswelt, als Ort des
Ausgleichs, der Harmonie und der Erholung. Frauen zeichneten sich
durch Hingabe, Bereitschaft, Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse und
Emotionalität aus und wurden als prädestiniert für die Beziehungsarbeit
innerhalb der Familie angesehen. Während der Mann also für die finan-
zielle Sicherung des Lebensunterhaltes zuständig war, sollte die Frau für
ein Familienklima der Geborgenheit und Zufriedenheit sorgen.
6
Jedoch wurde bald der Umfang und die Qualität der im Haus
verbleibenden Tätigkeiten durch die Zunahme industrielle Herstellung von
Ge- und Verbrauchsgütern und technische Geräte im Haushalt reduziert,
wie Rode und Wilke feststellten. Dadurch ging die Eigenproduktion und
Selbstversorgung der Familie stetig zurück.
7
Somit verlor die Hausarbeit
4
Brüderl/Paetzold 1992, 14
5
Rode/Wilke 1991, 18
6
Brüderl/Paetzold 1992, 15
7
Rode/Wilke 1991, 18
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
7
zunehmend den Charakter einer selbständigen, sinnvollen Arbeit.
8
Die
Hausarbeit für ihre hergestellten Güter und Dienste nicht wie die
Erwerbstätigkeit des Mannes entlohnt wird und es ist der Hausfrau kaum
oder gar nicht möglich ihre berufliche Rolle von ihren anderen Rollen
(beispielsweise als Mutter oder Ehefrau) zu trennen.
9
Als Ausgleich fiel die
Konzentration der Mütter mehr auf das Kind und die soziale Mutterschaft
änderte sich radikal. Kinder wurden als wichtiger angesehen, blieben nun
auch nach der Stillzeit in der Obhut der Frauen. In der Folgezeit wurde
das Mutterideal von Frauen verinnerlicht. Sie übernahmen Versorgungs-
und Erziehungsarbeit und hofften auf die Anerkennung seitens der
Männer.
10
Doch Ende des 19.Jahrhunderts kam es zu Veränderungen der bisher
normalen Lebenszusammenhänge von Frauen, insbesondere in Bezug
auf den Bildungs- und Berufsbereich, die Frauen neue Handlungen er-
möglichte aber auch Widersprüche mit sich brachte, wie Brüderl und
Paetzold bemerken.
11
Die Bundeszentrale für politische Bildung be-
schreibt, dass im 20. Jahrhundert Frauen gegen ihre minderwertige Posi-
tion, für schrittweise bessere Bildung und Ausbildung, berufliche Möglich-
keiten, gesellschaftlichen und politischen Einfluss und damit die Gleichbe-
rechtigung sich engagierten und kämpften.
12
Daraufhin erteilte die Weima-
rer Republik 1918 das volle Wahlrecht und somit durften 17 Millionen
Frauen erstmals wählen und 41 Frauen wurden Abgeordnete im
Reichstag. In der Folge der 1968er Studentenrevolte und der sexuellen
Revolution entstand eine feministische Bewegung und zu Beginn der
1970er gingen Frauen auf die Straße, um öffentlich ihren Schwanger-
schaftsabbruch zu bekunden. Im Jahr 1972 wurde die erste Frau der Ge-
schichte der Bundesrepublik (SPD-Politikerin Annemarie Renger) für vier
Jahre zur Bundestagspräsidentin gewählt. Die zweite Frau in diesem Amt
war ab 1988 die CDU-Politikerin Rita Süssmuth, die einen Schwerpunkt
8
Steppke 1983 in Rode/Wilke 1991, 18
9
Pines/Aronson/Kafry 1993, 99
10
Badinter 1981 in Brüderl/Paetzold 1992, 15 f
11
Brüderl/Paetzold 1992, 16
12
www.bpb.de (20.07.2009)
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
8
auf Gleichberechtigung der Frauen als Bundesministerin für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit legte. 1994 wurde dem Grundsatz in Artikel 3 der
deutschen Verfassung (,,Männer und Frauen sind gleichberechtigt") hinzu-
gefügt, dass der Staat die wirkliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern fördert und auf die Auflösung bestehender
Nachteile hinwirkt. Im gleichen Jahr wurden im Gleichberechtigungsgesetz
Vorgaben zur Frauenförderung, insbesondere im öffentlichen Dienst und
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, erläutert. Die Quer-
schnittsaufgabe ,,Gender Mainstreaming" (wörtlich: Geschlechter-
Hauptströmung) wurde 1999 Leitprinzip der Bundesregierung. Es bedeu-
tet, dass bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Le-
benssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein
und regelmäßig zu berücksichtigen sind.
13
Heute, im 21. Jahrhundert, leben Frauen immer noch mit unerfüllten
Erwartungen auf mehr Gleichheit und Zusammenarbeit in Beruf und
Familie, die auf Widerstand durch den Arbeitsmarkt und das Verhalten der
Männer treffen.
14
Nach diesem historischen Abriss zur Entwicklung der Frauenrolle sollen in
den nächsten Unterpunkten die aktuellen gesellschaftlichen Umstände
verbunden mit der Erwerbstätigkeit und der Familie bezüglich der Lage
der Mütter betrachtet werden.
2.1.2 Gegenwärtige gesellschaftliche Umstände von Frauen
Wandel und Umbruch bestimmt die gesellschaftliche Situation, von der
besonders die Mütter betroffen sind.
15
Dabei lösen sich immer mehr
kulturelle und traditionelle Momente und Wertesysteme geradezu auf.
Werte sind allgemeine und wesentliche Orientierungsmaßstäbe für das
Handeln und Verhalten von Menschen. Sie entwickeln sich in einer
13
www.bundestag.de (20.07.2009)
14
Beck/Beck-Gernsheim 1990, 23 f
15
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 9
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
9
Gesellschaft aus Ideen, Religionen und Ideologien. Aus Werten leiten sich
Normen der Gesellschaft ab und Werte sind generell einem Wandel
unterworfen.
16
Es sind Entwicklungen der Individualisierung zu
erkennen.
17
Damit ist, wie der Begriff ,,Individualisierung" im Fachlexikon
definiert wird, ein Prozess gemeint, bei dem sich der Mensch aus, für die
Gesellschaft rückständigen, Sozialstrukturen löst und neue Lebensformen
und Lebensstile im Zuge einer Modernisierung sucht und nutzt.
18
Individualität meint die ,,Einzigartigkeit, Selbständigkeit und Eigenartigkeit
eines einzelnen Menschen".
19
Unsere ,,flexible Gesellschaft", ist durch eine
zunehmende Verunsicherung der Arbeitssituation, drohende Ängste um
die eigene Existenz, Erwerbslosigkeit und damit drohende Verarmung
sowie einen Wandel der Familienformen geprägt. Mütter sind von diesen
Entwicklungen in besonderer Weise betroffen, denn Familienarbeit und
Kindererziehung erfordert Verlässlichkeit, die unter diesen Umständen
schwer zu bieten ist.
20
Viele Frauen, die Kinder bekommen, können bei
dem Berufsstress nicht mehr mithalten und müssen zunächst einmal ganz
auf
die
Arbeit
verzichten.
21
Eine
klassische
Mütterkarriere
(Berufsausbildung
und
Berufstätigkeit,
Kindererziehungsjahre,
Wiedereinstieg in Teilzeit und Rückkehr in eine Vollzeitbeschäftigung)
kann nicht mehr geplant werden.
22
Staatliche Einrichtungen können die
Frauen wenig oder gar nicht unterstützen, weil in Deutschland zu wenige
Plätze für Fremdbetreuung vorhanden sind, wie auch die
Bundesfamilienministerin von der Leyen in einem Interview negativ
anmerkt. Sie meint, viele der Frauen, die arbeiten wollen, müssen zu
Hause bleiben, weil sie keine Kinderbetreuung finden.
23
Die Zahl der
Sozialhilfeempfänger sowie der Anteil der von Armut betroffenen
Bevölkerung haben sich in den letzten Jahren auf das Vierfache erhöht,
16
Stimmer 2000, 801
17
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 9
18
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2002, 478
19
Stimmer 2000, 326
20
Prinz/Gerstkamp 2007, 10
21
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 16
22
Prinz/Gerstkamp 2007, 10
23
Theile/Demmer 2007 (08.09.2009)
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
10
wovon besonders Mütter und Kinder betroffen sind.
24
Finanzielle Not und
Abhängigkeit und im Gefolge Partnerschaftsprobleme und zerbrechende
Familien sind daher die am häufigsten genannten und drastischsten
Belastungen der Mütter.
25
Viele Menschen fühlen sich Menschen dadurch
stark verausgabt, überlastet, nicht genug anerkannt und dafür nicht in
angemessener Weise entschädigt, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
Erkrankungen führen kann.
26
Bonnemann-Böhner beschreibt unsere
Gesellschaft ganz prägnant. Nach ihrer Meinung ist die Gesellschaft krank
und werde immer älter währenddessen die Zahl der Kinder in unserer
Gesellschaft abnehme.
27
Aus diesem Teil der Arbeit geht also insbesondere das Spannungsfeld, in
dem Mütter sich befinden, hervor. Umrahmt von vielseitigen ungünstigen
strukturellen Umständen der Gesellschaft befindet sich die Mutter
zwischen Beruf und Familie. Dies soll nachfolgend näher beschrieben
werden.
2.1.3 Frauen und Erwerbstätigkeit
Betrachtet man die Entwicklung der Erwerbstätigkeit von Müttern zunächst
historisch, verdeutlicht eine Analyse zum Erwerbsmuster von Frauen, dass
die Beteiligung von Frauen an außerhäuslicher Erwerbstätigkeit seit
Beginn des 20. Jahrhunderts durch verschiedene strukturelle und
gesellschaftliche Strömungen geprägt ist. So mussten Frauen durch die
Rüstungskonjunktur und den Arbeitskräftemangel während des Zweiten
Weltkrieges berufstätig sein. Bis zu den 50er Jahren waren es eher junge,
ledige Mädchen, geschiedene und verwitwete Frauen, die der
Erwerbstätigkeit nachgingen, während Ehefrauen in Familienbetrieben
arbeiteten. Die größten Wandlungsprozesse im Berufsbereich vollzogen
sich jedoch für Frauen in den letzten Jahrzehnten, als die Erwerbsquote
24
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 18
25
Collatz et al. 1996 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 18
26
Sigrist 1996 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 18
27
Bonnemann-Böhner 2006, 1
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
11
verheirateter Frauen deutlich anstieg.
28
Frauen entwickelten ein
verändertes Anspruchsniveau bezogen auf ihre berufliche Orientierung.
Sie arbeiteten nicht mehr ausschließlich aus materiellen Zwängen heraus,
um das nötige Geld zu verdienen, sondern entwickelten eine hohe, von
innen herauskommende, Berufsmotivation.
29
Frauen entschieden sich
auch vermehrt für gehobene Karrieren statt für einfache Anstellungen, die
ihnen kontinuierliches Lernen und großen Einsatz abverlangten.
30
In Deutschland ist bei den mittleren Altersgruppen ein beträchtlicher
Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen zu verzeichnen.
31
Kucklick stellt
fest, dass der Anteil der Frauen an der Erwerbstätigkeit in den letzten 40
Jahren von knapp 38 auf 43% gewachsen ist.
32
Kalb betrachtet speziell
die Daten der Jahre 1962 bis 1987 bezüglich der Erwerbstätigkeit der
Frauen im Alter von 30 bis 45 Jahren. Dabei ist ein Anstieg von ca. 46%
(1962) auf rund 60% (1984) und auf 62,5% (1987) zu verzeichnen.
33
Im
Jahr 2003 gab es, wie Bonnemann-Böhner in ihrem Vortrag angab, 5,8
Millionen Mütter im erwerbstätigen Alter und davon waren 65%
erwerbstätig.
34
2005 waren zwei Drittel aller Mütter erwerbstätig, wie
Lademann und Kolip angaben.
35
Außerdem prognostiziere eine Studie,
dass in 15 Jahren genauso viele Frauen wie Männer im Beruf stehen
werden.
36
Bei Frauen kommt der häuslichen und beruflichen Rolle gleich viel
Bedeutung zu, während in früheren Zeiten die häusliche Rolle als
wichtiger galt. Jedoch geraten Frauen in Rollenkonflikte, wenn sie sich
entschließen Kinder zu bekommen. Sie stellen zu hohe Ansprüche an
sich, in beiden Rollen gleich viel leisten zu müssen. Dadurch entscheiden
sich dann viele Frauen gegen Kinder oder dazu nur der Familie den
28
Lauterbach 1991 in Brüderl/Paetzold 1992, 18 f
29
Brüderl/Paetzold 1992, 19
30
Pines/Aronson/Kafry 1993, 111
31
Kalb 1992, 15
32
Kucklick 2000, 47
33
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 1984, 1989 in Kalb 1992, 15
34
Bonnemann-Böhner 2006, 3
35
www.destatis.de in Lademann/Kolip 2005, 12
36
Kucklick 2000, 47
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
12
Vorrang zu geben und damit gegen die Berufstätigkeit. Es gäbe
Möglichkeiten, die Entscheidung für Beruf und Familie durch
Stellenteilung, Arbeitsteilung und Teilzeitarbeit zu verwirklichen, wie Pines,
Aronson und Kafry feststellen.
37
Jedoch, wie schon Rode und Wilke 1991
anmerkten, erläuterte auch Lademann im Jahr 2005, dass Frauen
unverändert nach dem alten Bild der traditionellen Arbeitsteilung zuständig
für Kinder und Haushalt bleiben.
38
Die Männer engagieren sich leider
kaum gleichberechtigt in Beruf und Familie und sind so keine Entlastung
für die Mütter.
39
Diese fehlende Bereitschaft von Männern, ihren Teil der
Familienarbeit
zu
übernehmen,
ist
unabhängig
vom
Erwerbstätigkeitsumfang der Frauen.
40
Männer weisen eher eine
sporadische Beteiligung an der Hausarbeit auf.
41
So ist es auch nicht
überraschend, dass nur 1,5% der Männer in Deutschland in den
Erziehungsurlaub gehen.
42
Die sozialen Rollen von Müttern und Vätern in
Bezug auf die Erwerbstätigkeit ist stark von gesellschaftlichen
Erwartungen geprägt, die auch heute noch, in Westdeutschland deutlicher
als in Ostdeutschland, dahingehend gelebt werden, dass sich Frauen als
Mütter, speziell in den ersten Lebensjahren, mehr als die Männer der
Erziehung und Betreuung der Kinder widmen. Männer als Väter gehen
dabei in erster Linie ihrer Erwerbstätigkeit nach, um den Lebensunterhalt
der Familie zu sichern.
43
Die Arbeitsbiographien der Männer verlaufen
auch viel geradliniger, während die der Frauen von Ein- und Ausstiegen in
die Erwerbsarbeit und von Variation von Teilzeit- und Vollzeit-
Erwerbstätigkeit geprägt sind.
44
Die Arbeitszeiten von Frauen und
Männern haben sich angeglichen und wenn man die Haus- und
Erwerbsarbeit zusammen rechnet, sind Frauen ebenso wie Männer im
Durchschnitt 50 Stunden pro Woche beschäftigt.
45
37
Pines/Aronson/Kafry 1993, 111
38
Rode/Wilke 1991, 11; Lademann/Kolip 2005, 12
39
Lehner 2004 in Lademann/Kolip 2005, 12
40
Rode/Wilke 1991, 11
41
Berger 1984; Metz-Göckel/Müller 1985 in Rode/Wilke 1991, 11
42
Kucklick 2000, 47
43
Lademann/Kolip 2005, 12
44
Engstler/Menning 2003 in Lademann/Kolip 2005, 12
45
Kucklick 2000, 47
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
13
Staatliche Hilfssysteme, die ausgleichende Funktionen übernehmen
sollen, sind lückenhaft oder nicht erreichbar. Zudem bringen die wenigen
funktionierenden staatlichen Hilfen neben teilweiser Unterstützung oft
neue Abhängigkeiten und Regelungen mit sich.
46
Dabei betont
Bonnemann-Böhner positiv die Familienpolitik der DDR, bei der die volle
Erwerbstätigkeit der Mütter durch die Fremdunterbringung der Kinder
möglich war. Somit war die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kein
Problem.
47
2.1.4 Frauen und die Familie
Im 20. Jahrhundert wurde in den 50er und 60er Jahren in das Grundge-
setz eingearbeitet, dass die Familie unter besonderen Schutz gestellt ist
und im Alltag als angestrebtes Lebensmodell der Gesellschaft angesehen
wurde. In den späten 60er und frühen 70er Jahren führten jedoch die Stu-
denten- und Frauenbewegung einen Aufstand gegen traditionelle Struktu-
ren (siehe dazu Punkt 2.1.2). Die Familie wurde von den protestierenden
Frauen als Ideologie und Gefängnis, einen Ort der Unterdrückung ent-
hüllt.
48
Infolge der Aufklärungswelle der 1960er Jahre wurde die individuel-
le Lebensgestaltung möglich und es wurde sich zunehmend von gesell-
schaftlichen Zwängen und Normierungen gelöst und so das Zusammenle-
ben, Ehe und Sex gelöster betrachtet.
49
Die formelle und rechtliche Absi-
cherung der partnerschaftlichen Beziehungen ,durch beispielsweise das
eingehen einer Ehe, wurde nicht mehr als wichtig angesehen.
50
Auch
empfängnisverhütende und -regelnde Mittel sowie rechtliche Möglichkei-
ten, Schwangerschaften zu beenden, erlaubten Frauen die Herauslösung
aus traditionellen Vorgaben.
51
46
Herlyn/Vogel 1991 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17
47
Bonnemann-Böhner 2006, 3
48
Beck-Gernsheim 2000, 9
49
Löhr 1991 in Brüderl/Paetzold 1992, 18
50
Brüderl/Paetzold 1992, 18
51
Beck/Beck-Gernsheim 1990, 45
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
14
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Familienstrukturen weiter un-
klar.
52
Diese Behauptung kann nicht nur durch relevante Fachliteratur er-
läutert werden, denn jüngst wurde sich mit dem Thema im Medium Fern-
sehen beschäftigt und zeigt die derzeitige Präsenz des Themas. Eine
Fernseh-Dokumentation berichtete, wie sich das Familienleben in
Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute in Ost und West verän-
dert hat.
53
Anhand von Familiengeschichten in der Dokumentation wird
dargestellt, wie unsere Welt vom Wandel geprägt ist.
54
Dieser Fernsehbe-
richt entspricht genau den für diese Arbeit aufgefundenen Literaturausfüh-
rungen. Einige Gruppen leben nach dem traditionellen Bild von Familie
und andere wenden sich deutlich dagegen. Sie leben nach einer wider-
sprüchlichen Mischung aus traditionellen Sehnsüchten und neuen Erwar-
tungen unterschiedlich verteilt auf die Generationen und Geschlechter.
Dadurch ist eine Vielfalt von Lebens-, Liebes- und Beziehungsformen ent-
standen. Resultierend daraus ist für die Politik, Wissenschaft und den All-
tag nun nicht mehr klar, wer oder was zur Familie gehört.
55
Es ist ein
Trend zu erkennen, der zeigt, dass immer weniger Personen in einem
Haushalt leben.
56
Die traditionelle Familie ist dabei mit Vater, Mutter, Kin-
dern längst nicht mehr das einzige Lebensmodell. Nur noch ein Drittel der
deutschen Haushalte setzt sich aus dieser Konstellation zusammen. Die
Patchworkfamilie oder Alleinerziehende sind inzwischen gesellschaftlich
anerkannt.
57
Bis zu 2,5 Millionen Personen leben in unehelichen Lebens-
gemeinschaften und immer mehr Menschen leben allein.
58
Der Leitgedan-
ke einer Ehe ,,bis dass der Tod uns scheidet" galt früher und heute schei-
den sich viele lieber selbst.
59
Nahezu jede dritte Ehe, in den Großstädten
fast jede zweite Ehe wird geschieden.
60
Zugleich wagen immer weniger
52
Beck-Gernsheim 2000, 9
53
Ausstrahlung der dreiteiligen ZDF-Dokumentation ,,Nicht von schlechten Eltern" am 07.
Juli 2009 um 22.45 Uhr, am 08. Juli 2009 um 22.45 Uhr und am 09. Juli 2009 um 22.15
Uhr.
54
www.zdf.de (10.07.2009)
55
Beck-Gernsheim 2000, 9
56
Rode/Wilke 1991, 18
57
www.zdf.de (10.07.2009)
58
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17
59
www.zdf.de (10.07.2009)
60
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
15
Menschen überhaupt den Schritt eine Heirat einzugehen.
61
Die Mutterrolle
stellt für Frauen immer eine unausweichliche unabweisbare Rollenver-
pflichtung dar, die weit überwiegend ihnen die Hauptlast der Verantwor-
tung für das Kind auferlegt. Denn die Gestaltung des Lebens erfolgt selb-
ständig und oftmals nicht mehr mit der Berücksichtigung einer durch den
Beruf des Ehemanns gesicherten Schutzzone.
62
Dadurch ist vielleicht
auch die Anzahl der Kinder pro Frau in Deutschland eine der niedrigsten
in Europa und erklärbar, warum 30% der Frauen in Deutschland sogar
ganz kinderlos bleiben, wie Zahlen von Bonnmann-Böhner aufzeigen.
63
Durch die obigen Ausführungen ist ein klarer Widerspruch in den
Lebensbedingungen der Mütter erkennbar. Die positiv wirkende steigende
Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bezüglich der
Erwerbstätigkeit steht dem Auflösen stabiler Familienstrukturen entgegen.
Es entsteht eine ungerechte Rollenverteilung, die Frauen für die
Erziehung, Betreuung der Kinder und den Haushalt zuständig erklärt, und
ohne die Unterstützung der Männer/Väter oder staatliche Einrichtungen
können Frauen nicht der anspruchsvollen Erwerbstätigkeit nachgehen.
Dieser Umstand erzeugt eine hohe Belastung für Mütter in der heutigen
Gesellschaft, wie im folgenden Punkt erläutert wird.
2.1.5 Resultierende Belastungen von Frauen
Ungleiche Arbeitsbeanspruchung führt dazu, dass gerade erwerbstätige
Mütter doppelt belastet sind und ihre Berufstätigkeit wegen der familiären
Erfordernisse einschränken.
64
Die vielen Rollen (Berufstätige, Hausfrau,
Mutter, Geliebte etc.), die Frauen nach gesellschaftlichen Erwartungen
erfüllen, lässt die Lebenssituation der Frauen zwischen dem 20. und 40.
Lebensjahr
durch
eine
vielfältige
Bandbreite
an
hohen
Leistungsanforderungen kennzeichnen.
65
Vielfach prägen besondere
61
www.zdf.de (10.07.2009)
62
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 9
63
Bonnemann-Böhner 2006, 2
64
Calame/Fiedler 1982 in Rode/Wilke 1991, 11
65
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
16
Belastungen wie die Berufstätigkeit, eine instabile oder zerbrochene
Partnerschaft, wirtschaftliche Schwierigkeiten oder die Pflege eines
Familienmitgliedes den Alltag der Frauen.
66
Denn aufgrund der Zunahme
von chronischen Erkrankungen von Kindern und älteren Menschen
müssen Frauen vermehrt Angehörige betreuen.
67
Laut Ergebnissen der
Arbeitsmedizin gehört die häusliche Pflege zu den härtesten
Arbeitbelastungen, denen Personen ausgesetzt sein können. Zu
begründen ist dies mit der Zusammensetzung aus dauerhafter
Zuständigkeit ohne geregelte Pausen oder Feierabend und teilweise
langfristige Situationen mit Schlafentzug, verbunden mit emotionaler
Bindung an die kranken Verwandten. Diese aufgezeigten Anforderungen,
bei gleichzeitigen Verlusten sozialer Sicherung und Tendenzen der
Ausgrenzung durch die Gesellschaft, stellen ein immer höheres
Belastungspotential für Mütter dar.
68
Das Frauenschicksal ,,Mutter" ist
durch den Verlust eines eigenen Lebensentwurfs gekennzeichnet, was zu
sozialer Ausweglosigkeit und Krankheitsflucht führen kann.
69
Diese
erschöpfenden, tagtäglichen Anforderungen ohne Pause, können Mütter
bei geringer Anerkennung, in einen Ausbrennprozess und in so
überfordernde
Lebenslagen
bringen,
dass
daraufhin
häufig
gesundheitsgefährdende
Bewältigungsstrategien
oder
Gesundheitsstörungen auftreten.
70
Was in anderen Ländern professionelle
öffentliche Einrichtungen an frühkindlicher Förderung bieten, müssen die
Mütter in unserem Land selbst übernehmen. Diese Leistungen sind den
Müttern sogar nicht einmal bewusst, woraus folgt, dass sie weder
Anerkennung einfordern noch sich selbst Erholung gönnen. Persönliche
Schuldzuweisungen und Versagensängste sind die Folgen, wenn die
Erziehung und Entwicklung der Kinder misslingt oder gefährdet ist. Die
sich einstellende Selbstabwertung kann sehr krank machen.
71
Die
66
www.kidsgo.de (23.02.2009)
67
Mayring et al. 1987; Schmitt et al. 1996; Grunow et al. 1994 in Collatz/Fischer/Thies-
Zajonc 1998, 20
68
Friedrich et al. 1992 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 21
69
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 9
70
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 17 f
71
Bonnemann-Böhner 2006, 2
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
17
Belastungen von Müttern steigen stetig.
72
In einer Untersuchung des
Müttergenesungswerks wurden Frauen befragt, wodurch sie sich am
stärksten belastet fühlen. 58% der Mütter benannten den ständigen
Familieneinsatz, 42,3% die Arbeit im Haushalt und ihre Familienrolle und
35,2% die (alleinige) Verantwortung für die Kinder.
73
Somit ist feststellbar, dass die soziale Situation und die Lebensbedingun-
gen einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Mütter haben. Daher
soll im nächsten Kapitel die Lage der Mütter in unserer Gesellschaft hin-
sichtlich ihrer gesundheitlichen Aspekte betrachtet werden. Bevor aber die
spezifische Erläuterung zur Gesundheit von Frauen und Unterscheidun-
gen zum gesundheitlichen Zustand von Frauen und Männern vorgenom-
men werden, sollen zunächst die Begriffe ,,Gesundheit" und ,,Krankheit"
definiert werden, um ein besseres Verständnis zu erlangen.
2.2 Gesundheitliche Aspekte
Franke gibt an, dass es keine eindeutigen Definitionen zu den beiden
Zuständen ,,Gesundheit" und ,,Krankheit" gibt, wodurch eine
Unterscheidung eher schwierig erscheint. Sie erklärt weiter, dass es
Gesundheitsdefinitionen in großer Zahl gibt, jedoch keine allgemein
akzeptierte. Dadurch existiert auch kein eindeutiges Kriterium, durch das
man sagen kann, dass jemand gesund ist. Einzelne Krankheitsbilder
werden in Klassifikationssystemen (z.B. ICD) beschrieben, welche
allerdings keine Definitionen von Krankheit geben. Auch in
Gesetzestexten ist Krankheit jeweils anders definiert, wobei der
Krankheitsbegriff wesentlich durch die laufende Rechtsprechung bestimmt
wird.
74
Eine Aufführung selbst ausgewählter Definitionen erleichtert aber
gewiss das Verständnis für die weitere Themenbearbeitung.
72
www.openpr.de (25.02.09)
73
www.muettergenesungswerk.de (a) (25.02.2009)
74
Franke 2006, 18
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
18
Gesundheit und Krankheit sind kulturell bestimmt und unterliegen
subjektiven sowie geschlechts- und altersabhängigen Deutungen.
75
Definition: Gesundheit
Die WHO definiert Gesundheit als einen ,,Zustand völligen psychischen,
physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von
Krankheit und Gebrechen. Ein bestmöglicher Gesundheitszustand ist ein
Grundrecht jedes Menschen, ohne Unterschied der Rasse, der Religion,
der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen
Stellung."
76
Gesundheit ist kein einmal erreichter und dann beständiger
,,Zustand", sondern eine lebensgeschichtlich und alltäglich immer wieder
neu und aktiv herzustellende ,,Balance".
77
Franke geht es bei Gesundheit um die Störungsfreiheit, das
Wohlbefinden, die Fähigkeit, geforderte und erwartete Leistungen erfüllen
zu können, sozialen Rollen gerecht zu werden zu können, seinen Zustand
als ausgeglichen, ausgewogen, im Gleichgewicht betrachten zu können
und in der Lage zu sein, sich flexibel an sich verändernde Begebenheiten
anpassen zu können, also Störungen aktiv zu begegnen und sie zu
überwinden und sich an die äußere, physikalische, soziale und
gesellschaftliche Umgebung anpassen zu können.
78
Gesundheit wird
negativ abgegrenzt durch z.B. Beschwerdefreiheit und Abwesenheit von
Krankheit, aber auch positiv eingeordnet durch beispielsweise seelisches
Wohlbefinden und Freude, körperliche und soziale Leistungsfähigkeit.
79
75
Basaglia-Ongaro 1985; Flick 1998 in Chassé/von Wensierski 1999, 354
76
www.bmgfj.gv.at (27.07.2009)
77
www.bmgfj.gv.at (27.07.2009)
78
Franke 2006, 30 ff
79
Chassé/von Wensierski 1999, 354 f
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
19
Definition: Krankheit
Brüggemann, Irle und Mai definieren Krankheit als ,,Störung der
Lebensvorgänge in Organen oder im gesamten Organismus mit der Folge
von persönlich empfundenen und/oder objektiv feststellbaren körperlichen,
geistigen bzw. seelischen Veränderungen."
80
Für Franke sind
Kennzeichen von Krankheit das Vorhandensein von geistigen und/oder
seelischen Störungen bzw. Veränderungen, die Störung des körperlichen,
seelischen und sozialen Wohlbefindens, die Einschränkung der
Leistungsfähigkeit und Rollenerfüllung und die Erfordernis medizinischer,
sozialer und gesellschaftlicher Betreuung. Die Anzeichen werden dabei
nicht nur von mir selbst sondern auch von anderen nachgewiesen.
81
Nach
dem WHO-Gesundheitsmodell ist Krankheit ein Zustand, der durch
Umweltschädigungen, gesellschaftliche Lebensbedingungen, Erbanlagen
oder
durch
eigene
gesundheitsschädigende
Lebens-
und
Verhaltensweisen erworben wurde.
82
Nach diesem allgemeinen Überblick der Begriffe ,,Gesundheit" und
,,Krankheit" soll nun näher auf die gesundheitliche Lage speziell von
Frauen/Müttern in Deutschland eingegangen werden.
Die Forschung über Müttergesundheit wurde in Deutschland
vernachlässigt. Jedoch liegen einige Forschungsergebnisse vor, die die
Gesundheitsgefährdungen von Müttern belegen.
83
So zeigt die Sozial- und
Gesundheitsberichterstattung
die
Zusammenhänge
und
besorgniserregenden Entwicklungen von Notlage, Armutsprozessen und
Krankheit bei Müttern.
84
Außerdem sind geschlechtsspezifische
Unterschiede bei Erkrankungen von der Frauengesundheitsforschung gut
80
Brüggemann/Irle/Mai 2007, 297
81
Franke 2006, 54
82
Chassé/von Wensierski 1999, 355
83
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc, 1998, 19
84
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
1995; Snatsverwaltung für Gesundheit Berlin 1995; Behörde für Arbeit, Gesundheit und
Soziales der Freien Hansestadt Hamburg 1995 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998,
18 f
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
20
belegt.
85
Nach Lademann und Kolip, die sich auf Daten des Statistischen
Bundesamtes beziehen, befinden sich Frauen, die Mütter werden, meist
im mittleren Lebensalter. Dieses wird definiert als die Zeit der
Familiengründung (Eheschließung, Geburt der Kinder) und der
Etablierung im Berufsleben. Dabei liegt das durchschnittliche Alter von
Frauen und Männern etwa bei 30 Jahren.
86
Viele Frauen erleben in
diesem Zeitraum die Geburt ihrer Kinder. Sowohl bei Männern als auch
bei Frauen nehmen im Verlauf dieser Lebensphase gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu. Vor allem chronische Krankheiten treten
zunehmend auf, verursachen Beschwerden und die Inanspruchnahme von
medizinischen Behandlungen und lassen den Konsum von Medikamenten
steigen.
87
Die Darstellung des Gesundheitszustands erfolgt mit Hilfe der
Unterscheidung zur männlichen Gesundheit.
2.2.1 Unterschiede zum Gesundheitszustand von Männern
Zwischen Männern und Frauen bestehen beachtliche Unterschiede in der
Art der Erkrankungen und in der Art des Inanspruchnahmeverhaltens von
medizinischen Leistungen.
88
Frauen und Männer unterscheiden sich nach Franke
· in der Art der Erkrankungen
· in der Häufigkeit von Erkrankungen
· im eigenen Empfinden von Gesundheit und Krankheit
· in der Art ihres Krankheitsverhaltens
· im Umgang mit ihrem Körper und ihren Emotionen
· im Medikamentenkonsum
85
Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 20
86
www.destatis.de in Lademann/Kolip 2005, 11
87
Lademann/Kolip 2005, 11
88
Maschewsky-Schneider 1996 in Franke/Kämmerer 2001, 51
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
21
· in der Inanspruchnahme aller medizinischen und psychosozialen
Einrichtungen
· in Art und Häufigkeit gesundheitsriskanten Verhaltens
· im Umgang mit gesundheitsbeeinflussenden Stressoren und
Ressourcen
· im Schmerzerleben und -ausdruck
89
Ähnlich führt das Müttergenesungswerk die Unterscheidung des
gesundheitlichen Zustands von Frauen und Männern des Berichts ,,Zur
gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland" des BMFSFJ auf.
Dabei werden Ungleichheiten bezüglich der Krankheiten und
gesundheitlichen
Einschränkungen
und
der
Arbeits-
und
Lebensbedingungen, die die Gesundheit und Lebensweise bestimmen,
aufgeführt. Außerdem werden Unterschiede in den körperlich-biologischen
Bedingungen,
den
Erfahrungen
in
der
Sozialisation,
den
Lebensbedingungen und in der Inanspruchnahme von gesundheitlichen
Versorgungsangeboten gesehen.
90
Frauen sind anderen Krankheitsrisiken als Männer ausgesetzt. Auch die
Krankheitsverläufe und Krankheitsbewältigung unterscheiden sich oftmals
sehr stark.
91
Insbesondere in der Zeit des mittleren Lebensalters finden
sich deutliche Unterschiede in Morbidität und Mortalität zwischen Frauen
und Männern. Die Sterblichkeit der Frauen im Alter von 30 bis 64 Jahren
ist halb so hoch wie die der Männer, besonders bei äußeren Ursachen
(Unfälle,
Suizide),
Kreislaufkrankheiten
und
Krankheiten
der
Verdauungsorgane. Dieses Ergebnis lässt eine höhere Risikobereitschaft
der Männer im Umgang mit ihrem Körper und in ihren Arbeitsbedingungen
erkennen.
92
Weitere geschlechtsspezifische Unterschiede lassen sich
bezüglich der persönlichen Einschätzung des Gesundheitszustands der
Männer und Frauen machen. Frauen geben, in allen Altersgruppen, bei
Befragungen mehr Beschwerden an als Männer. Dabei ist allerdings
89
Franke 2006, 183
90
www.muettergenesungswerk.de (b) (31.08.2009)
91
Angier 1999; Kuhlmann Babitsch 2000 in Franke/Kämmerer 2001, 51
92
Lademann/Kolip 2005, 16
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
22
unklar, ob Frauen wirklich häufiger unter Beschwerden leiden oder ob sie
nur eher geneigt sind, hierüber zu berichten. Dass Männer weniger
Beschwerden angeben, kann darauf zurückzuführen sein, dass das
Eingeständnis von Beschwerden nur schwer mit einem traditionellen
männlichen Status vereinbar ist.
93
Interessant ist, dass die an Frauen und
Männer
gestellten
Erwartungen
im
Krankheitsfall,
auch
an
geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen gebunden sind. Männer
dürfen weniger jammern, sind aber in der Regel als Kranke von allen
Aufgaben freigestellt, während Frauen ihr Leiden deutlicher äußern,
allerdings trotzdem ihren Aufgaben wie der Hausarbeit und der Rolle als
Mutter nachgehen müssen. Die Rollenunterschiede spiegeln sich auch bei
der gesundheitlichen Versorgung wider. Frauen tragen die wesentliche
Verantwortung für die Gesundheit der Familie und sind z.B. zuständig für
die Sauberkeit, die gesunde Ernährung, die richtige Kleidung der Kinder,
die Medikamenteneinnahme des Mannes.
94
Frauen übernehmen in der
Familie üblicherweise die Behandlung von leichten gesundheitlichen
Beeinträchtigungen. Außerdem reagieren Frauen im Allgemeinen auf
Signale ihres Körpers sensibel und rasch, kennen ihren Körper besser und
beziehen das psychische und soziale Wohlbefinden in ihre Auffassung
von Gesundheit und Krankheit mit ein. Frauen pflegen einen
,,gesundheitsbewussteren Lebensstil" als Männer, was sich in der
Ernährungsweise oder auch im Umgang mit Stress zeigt.
95
Sie nehmen
auch mehr Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch
und es kann vermutet werden, dass sie sich eher an
Untersuchungsergebnisse erinnern, da sie für gesundheitliche Fragen
stärker sensibilisiert sind.
96
Bei Frauen lassen sich zahlreiche Krankheiten identifizieren, die bei ihnen
häufiger auftreten, wie z.B. bei Schilddrüsenerkrankungen, Blutarmut,
Nierenbeckenentzündung, Migräne und allergischem Kontaktekzem. Auch
93
Lademann/Kolip 2005, 19 f
94
Franke 2006, 184
95
Fischer 2005, 23
96
Lademann/Kolip 2005, 21
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
23
bezüglich der Beeinträchtigung durch Schmerzzustände sind Frauen
gesundheitlich stärker betroffen. Besonders häufig sind Rücken-, Nacken-
und Schulterschmerzen sowie Magenschmerzen.
97
Doppelt oder genauer
gesagt dreimal so viele Frauen wie Männer geben an, jemals an einer
psychischen Erkrankung gelitten zu haben.
98
Während bei Männern
Verletzungen aufgrund von Unfällen häufiger sind, ist die Gesundheit von
Frauen durch eine schlechtere psychische Gesundheit und durch stärkere
Befindlichkeitsbeeinträchtigungen gekennzeichnet.
99
Prägnante Gründe für die gesundheitlichen Unterschiede zwischen
Frauen und Männern sind die sozialen Veränderungen, die bereits im
Punkt 2.1 Soziale Aspekte ausführlich erläutert wurden und auch von
Kämmerer in Verbindung mit dem gesundheitlichen Zustand gebracht
werden. Der Anstieg der Erwerbsbeteiligung der Frauen oder die
Verschiebung
der
Altersstruktur
durch
das
Anwachsen
der
Bevölkerungszahl, aber auch der Wandel der Lebensformen, speziell die
Kinderlosigkeit der Frauen oder die Zunahme an ledigen Personen,
beeinträchtigen die Gesundheit der Frauen. Kämmerer geht von einer
sozialen Isolation aus, durch die Störungen zunehmen werden. Auch
Überforderungssyndrome
aufgrund
alleine
zu
bewältigender
Lebensanforderungen sind in Zukunft vermehrt zu erwarten.
100
2.2.2 Psychische Gesundheit von Frauen
Wie schon erwähnt, ist die hohe Zahl an Frauen, die an psychischen und
psychosomatischen Befindlichkeitsstörungen leiden, sowie deren stärkere
Betroffenheit von psychiatrischen Erkrankungen besonders auffallend.
101
Zu ungefähr 30% bilden bei Frauen multiple psychosomatische
Befindlichkeitszustände, körperlichen Beschwerden und Erkrankungen
ohne nachweisbaren körperlichen Befund, die Kernursache für das
97
Lademann/Kolip 2005, 19
98
Bundes-Gesundheitssurvey in Lademann/Kolip 2005, 22 f
99
Lademann/Kolip 2005, 19
100
Kämmerer 2001 in Franke/Kämmerer 2001, 52
101
Lademann/Kolip 2005, 19
Zur Lage von Müttern in unserer Gesellschaft
24
Aufsuchen ambulanter ärztlicher Dienste. Auf fast 40% steigen die Zahlen
bei Frauen im Alter von 25 bis 45 Jahren.
102
In einer Studie, die den
Zusammenhang von Stress und Herzinfarkten untersuchte, zeigte sich,
dass die meisten Frauen mit Herzinfarkt Hausfrauen waren. Berufstätigkeit
bei Frauen senkt das Risiko eines Herzinfarktes dagegen um 20%. Es
wird weiterhin angegeben, dass bei ca. 10 bis 15% der Mütter schwere
Erschöpfungszustände und Burn-out-Syndrome im letzten Stadium (Stufe
V-VII)
103
festgestellt wurden.
104
Faßmann erkennt bei Müttern einen
Zusammenhang zwischen dem Leiden an Stress und Burn-out und den
familiären Anforderungen und Überforderungen sowie der mangelnden
Entlastung und Erholung.
105
Die theoretisch herausgearbeitete Lebenssituation der Mütter und
insbesondere ihre Beschwerden, Belastungen sollen im folgenden Kapitel,
durch eine eigene schriftliche Befragung mit Müttern überprüft werden.
102
Üexküll/Köhle 1990 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 20
103
Burisch 1989 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 20
104
Collatz et al. 1996 in Collatz/Fischer/Thies-Zajonc 1998, 20
105
Faßmann 2008, 14
Schriftliche Klientenbefragung
25
3 Schriftliche Klientenbefragung
3.1 Fragestellung der Untersuchung
,,Ausgangspunkt
einer
Befragung
sind
die
Anliegen
und
Erkenntnisinteressen des Forschers. Die Interessen des Forschers sind so
etwas wie die Tür zum untersuchten Forschungsfeld."
106
In der
praktischen Phase des Studiums wurden in der AWO Sano Mutter-Kind-
Klinik Rerik/Ostsee Erfahrungen gewonnen, die die alltägliche
Mehrfachbelastung
und
Erschöpfung
in
einem
prägnanten
Zusammenhang zu der Kurbedürftigkeit der Mütter sehen lassen. Diese
Erfahrungen überraschten, da von Beginn der Arbeit vorwiegend andere
Motive für eine Kurbeantragung vermutet wurden, wie beispielsweise die
körperlichen Beschwerden der Kinder und die Mutter-Kind-Beziehung, die
verbessert werden sollen. Die Frage, aus welchen Gründen oder aufgrund
welcher Beschwerden die Mütter eine Mutter-Kind-Kur in Anspruch
nehmen, interessierte die Autorin und animierte sie, sich mit der Thematik
sorgfältiger zu beschäftigen und mit Hilfe einer empirischen Studie zu
untersuchen.
3.2 Methodisches Vorgehen
Die empirische Sozialforschung kann als eine Gesamtheit von Techniken,
Methoden und Instrumenten zur korrekten Durchführung der
wissenschaftlichen
Untersuchung
menschlichen
Verhaltens
und
gesellschaftlicher Phänomene gesehen werden.
107
Zur Durchführung
wissenschaftlicher Forschung erfordert es die Einhaltung bestimmter
Kriterien.
108
Unterscheiden kann man bei der Planung der empirischen
Erhebung einige typische Phasen.
109
Bei dieser Erhebung wurde sich bei
106
Konrad 2005, 17
107
Häder 2006, 20
108
Schnell et al. 2005, 6
109
Atteslander 2008, 17; Häder 2006, 75; Diekmann 2005,162; Klammer 2005, 34;
Schnell/Hill/Esser 2005, 7
Schriftliche Klientenbefragung
26
der Durchführung an dem Phasenmodell von Diekmann orientiert. Er
unterteilt den Ablauf grob in die Formulierung und Präzisierung des
Forschungsproblems, die Planung und Vorbereitung der Erhebung, die
Datenerhebung, Datenauswertung und die Berichterstattung.
110
Den Ausgangspunkt für die empirische Studie bildet in der Phase des
Entdeckungszusammenhanges ein bestimmtes Problem bzw. eine
Fragestellung.
111
Bei einer selbst definierten Fragestellung wird im
Gegensatz zur Auftragsforschung in der Regel die zu untersuchende
Problemstellung selbst definiert.
112
Im Rahmen dieser Erhebung soll die
Frage ,,Wie belastet sind Mütter?" mit einer schriftlichen Befragung
beantwortet werden.
Diekmanns zweite Phase, die Umsetzung des Forschungsproblems,
beinhaltet die Konzeptspezifikation, in der eine theoretische Klärung von
Begriffen der zu untersuchenden Thematik erfolgt.
Zur Messung bieten sich verschiedene Mess- und Skalierungsmethoden
an. Es wird das ,,Messinstrument der Sozialwissenschaften", in diesem
Fall der Fragebogen, festgelegt und konstruiert. Anhand der Messungen
lassen sich Aussagen über den Gegenstandsbereich treffen und eine
Einschätzung der zu überprüfenden Theorie vornehmen.
Ebenfalls in der Phase der Planung und Vorbereitung der Erhebung
werden das Forschungsdesign, die Untersuchungsebene, der zeitliche
Aspekt der Datenerhebung, Typ und Größe der Stichprobe etc.
festgelegt.
113
In diesem Fall handelt es sich bezüglich des zeitlichen
Aspekts um eine Querschnittserhebung. Außerdem sollte eine bestimmte
Kommunikationsform gewählt werden, die eine standardisierte
Vorgehensweise zur Übermittlung der Fragebogen darstellt. Bei dieser
Erhebung leiteten die Sozialarbeiter und Psychologen aus der
Kureinrichtung die Fragebogen an einem festgelegten Zeitpunkt (im
Zwischengespräch) persönlich an ihre Patientinnen weiter, die dann frei
entscheiden konnten, ob sie an der Befragung teilnehmen möchten.
110
Diekmann 2005, 162 ff
111
Diekmann 2005, 162
112
Diekmann 2005, 164
113
Diekmann 2005, 168
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836639620
- DOI
- 10.3239/9783836639620
- Dateigröße
- 2.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Erfurt – Sozialwesen
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- erschöpfungssyndrom burnout belastung krankenkasse gesundheit
- Produktsicherheit
- Diplom.de