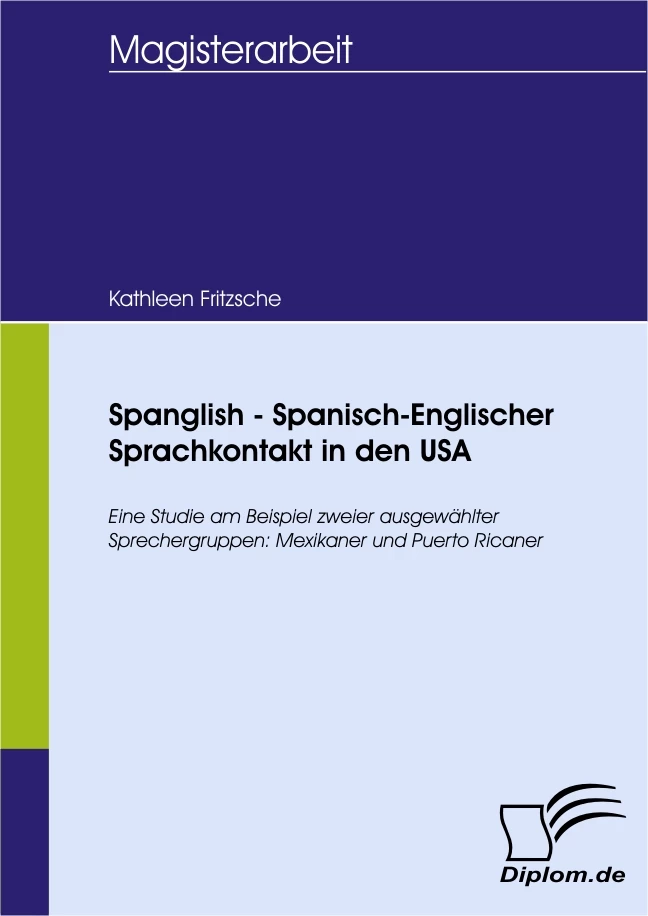Spanglish - Spanisch-Englischer Sprachkontakt in den USA
Eine Studie am Beispiel zweier ausgewählter Sprechergruppen: Mexikaner und Puerto Ricaner
Zusammenfassung
Sprachkontakt ist seit jeher die Norm in der Koexistenz verschiedenster Sprachen und nicht die Ausnahme. Einer der ältesten historischen Beweise dafür ist der Stein von Rosetta aus dem Jahre 196 v. Chr., der 1799 von Soldaten Napoleons nahe der heutigen Stadt El-Rashid in Ägypten entdeckt wurde. Darauf befinden sich Inschriften zur Verehrung des ägyptischen Pharaos Ptolemaios V. in ägyptischen Hieroglyphen, demotischen ägyptischen Symbolen und in Altgriechisch. Dieser Stein trug als wichtiges kulturelles Erbe zur Entzifferung der Hieroglyphen bei und ist zugleich das sprachliche Zeugnis dreier Sprachen. Eine komplette Isolation einer Sprache ist vor allem in der heutigen Zeit der Globalisierung unrealistisch. Es findet immer ein Kontakt zu anderen Sprachen oder Varietäten statt. Li definiert Sprachkontakt folgendermaßen: [P]eople speaking different languages coming into contact with one another. Sprache als System menschlicher Kommunikation ist aber nicht nur [ ] a collection of vocabulary, sounds, and grammatical rules divorced from the geographical, ethnic, racial, gender, and class identities of its speakers. Membership in one or more speech communities is reflected in our dialect(s), that is, in the specific configuration of vowels, consonants, intonation patterns, grammatical constituents, lexical items, and sentence structure shared with other community members, as well as in the rules for when, where, how to speak.
Die Dynamik der sprachlichen Systeme und der kontaktbedingte Sprachwandel (engl. contact-induced language change) entstehen durch die in Kontakt stehenden Sprecher und deren Interaktion. Strukturelle Veränderungen einer Sprache finden dabei nicht in einem social or socio-political vacuum statt, sondern außersprachliche Faktoren spielen eine bedeutende Rolle. Dies muss bei der Untersuchung des Sprachkontakts beachtet werden. Sprachkontakt kann dabei überall auftreten: innerhalb der Gesellschaft eines Landes, in der mehrere Sprachen koexistieren, in einer kleineren Einheit wie der Familie und sogar in einem Individuum selbst.
Auch die USA sind keineswegs ein monolinguales Land, wie dies oft nach außen hin dargestellt wird. Vielmehr treten eine Vielzahl an Minderheitensprachen wie z.B. die Ureinwohnersprachen, Spanisch und Französisch gesprochen von mono- und bilingualen Sprechern in Kontakt mit Englisch, der Sprache der angloamerikanischen Mehrheit. Durch den starken Einfluss des Englischen auf […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Allgemeine Aspekte des Bilingualismus und Sprachkontakts
2.1 Definitionen des Bilingualismus und Sprachkontakts
2.2. Arten des Bilingualismus
2.2.1 Individueller Bilingualismus
2.2.2 Sozialer Bilingualismus
2.3 Sprachwahl
2.4 Ethnische Identität
2.5 Bikulturalismus
2.6. Ergebnisse des Sprachkontakts
2.6.1 Pidgin-, Kreol- und Mischsprachen
2.6.2 Spracherhalt, Sprachverschiebung und Sprachverlust
2.6.3 Einfluss der Eltern auf Spracherhalt und -verschiebung ihrer Kinder
3. Kontaktbedingter Sprachwandel
3.1 Interferenz
3.2 Strategien bilingualer Sprecher
3.3 Code-Switching als Sonderform der Interferenz
4. Das amerikanische Spanisch als Grundlage des Spanglish unter besonderer Beachtung der mexikanischen und puertoricanischen Varietäten
4.1 Der Ursprung der spanischen Sprache
4.2 Die Herausbildung des amerikanischen Spanisch
4.3. Sprachliche Besonderheiten des amerikanischen Spanisch
4.3.1 Phonologie
4.3.2 Morphosyntax
4.3.3 Lexik und Semantik
4.3.4 Der Einfluss des Englischen auf das mexikanische und puertoricanische Spanisch
5. Kurzer Abriss über die Geschichte des Spanischen und der Latino-Immigranten in den USA
5.1 Die spanische Kolonialmacht auf dem nordamerikanischen Kontinent
5.2 Die Verbindung Mexikos zu den USA
5.3 Puerto Rico als Teil der USA
5.4 Die Latino-Immigranten in den USA
5.5 Bilinguale Erziehung in den USA
6. Die Varietäten des Spanglish und die Identitäten der Latinos in den USA
6.1. Die Varietäten des Spanglish in den USA
6.2. Spanglish als Mittel zum Ausdruck der Identitäten der Latinos in den USA
6.2.1 Die Identitäten der Latinos
6.2.2 Die generationsbedingte Sprachverschiebung und deren Auswirkungen auf die Identitäten der Latinos
6.2.3 Einfluss der Rasse und des sozialen Status auf die Identitäten der Latinos
6.2.4 Spanglish und die öffentlichen Institutionen
6.2.5 Kulturelle Konfrontation der Latinos mit der Mehrheitskultur
7. Ausgesuchte sprachliche Phänomene des Spanglish in den USA
7.1. Die mexikanische Varietät des Spanglish
7.1.1 Hintergrundinformationen zu Silva-Corvaláns Studie
7.1.2 Sprachliche Phänomene
7.2. Die puertoricanische Varietät des Spanglish
7.2.1 Hintergrundinformationen zu Zentellas Studie
7.2.2 Sprachliche Phänomene
7.3 Der Status des Spanglish
8. Schlusswort
9. Literaturverzeichnis
10. Anhang
0. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abbildungen:
1. Die generationsbedingte Sprachverschiebung der Latinos in den USA
2. Die spanischen und englischen Varietäten in El Barrio, New York City
Tabelle:
1. Stadien der Vereinfachung und des Verlusts der Verbformen im Spanglish mexikanischstämmiger Latinos in East Los Angeles
1. Einleitung
Sprachkontakt ist seit jeher die Norm in der Koexistenz verschiedenster Sprachen und nicht die Ausnahme. Einer der ältesten historischen Beweise dafür ist der Stein von Rosetta aus dem Jahre 196 v. Chr., der 1799 von Soldaten Napoleons nahe der heutigen Stadt El-Rashid in Ägypten entdeckt wurde.[1] Darauf befinden sich Inschriften zur Verehrung des ägyptischen Pharaos Ptolemaios V. in ägyptischen Hieroglyphen, demotischen ägyptischen Symbolen und in Altgriechisch.[2] Dieser Stein trug als wichtiges kulturelles Erbe zur Entzifferung der Hieroglyphen bei und ist zugleich das sprachliche Zeugnis dreier Sprachen. Eine komplette Isolation einer Sprache ist vor allem in der heutigen Zeit der Globalisierung unrealistisch.[3] Es findet immer ein Kontakt zu anderen Sprachen oder Varietäten statt. Li definiert Sprachkontakt folgendermaßen: „[P]eople speaking different languages coming into contact with one another.“[4] Sprache als System menschlicher Kommunikation ist aber nicht nur
[…] a collection of vocabulary, sounds, and grammatical rules divorced from the geographical, ethnic, racial, gender, and class identities of its speakers. Membership in one or more speech communities is reflected in our dialect(s), that is, in the specific configuration of vowels, consonants, intonation patterns, grammatical constituents, lexical items, and sentence structure shared with other community members, as well as in the rules for when, where, how to speak.[5]
Die Dynamik der sprachlichen Systeme und der kontaktbedingte Sprachwandel (engl. contact-induced language change) entstehen durch die in Kontakt stehenden Sprecher und deren Interaktion.[6] Strukturelle Veränderungen einer Sprache finden dabei nicht in einem „social or socio-political vacuum” statt, sondern außersprachliche Faktoren spielen eine bedeutende Rolle.[7] Dies muss bei der Untersuchung des Sprachkontakts beachtet werden. Sprachkontakt kann dabei überall auftreten: innerhalb der Gesellschaft eines Landes, in der mehrere Sprachen koexistieren, in einer kleineren Einheit wie der Familie und sogar in einem Individuum selbst.[8]
Auch die USA sind keineswegs ein monolinguales Land, wie dies oft nach außen hin dargestellt wird. Vielmehr treten eine Vielzahl an Minderheitensprachen[9] wie z.B. die Ureinwohnersprachen, Spanisch und Französisch – gesprochen von mono- und bilingualen Sprechern – in Kontakt mit Englisch, der Sprache der angloamerikanischen Mehrheit.[10] Durch den starken Einfluss des Englischen auf das Spanische entsteht das Spanglish als eigene Sprachvarietät der spanischsprachigen Immigranten und deren Nachkommen in den USA.[11] Die Kreation des Begriffes Spanglish für das Produkt des spanisch-englischen Sprachkontakts beansprucht der puertoricanische Journalist Salvador Tío für sich. Er verdammte Spanglish in seinen Artikeln in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts als degenerierte Sprache und versuchte, dagegen anzukämpfen.[12] Stößlein definiert Spanglish folgendermaßen:
[…] eine im Sprachkontakt des Spanischen mit dem amerikanischen Englisch resultierende Mischung beider Sprachsysteme. […] Sprachkontakt, -begegnung, -druck und Sprachverschiebung […].[13]
Die Betrachtung des Spanglish als Kontinuum und nicht als feststehende Einheit ist ausgesprochen wichtig.[14] Morales beschreibt das Spanglish treffend als das „what we speak, but it is also who we Latinos are, and how we act, and how we perceive the world.“[15] Morales nennt hier einen Kernpunkt der Spanglish-Forschung, nämlich dass bestimmte soziokulturelle Umstände zum Entstehen des Spanglish in den USA beigetragen haben:
[…] Spanglish bezeichnet neben dem Lebensstil, dem Lebensgefühl […] amerikanischer Latinos, aus deskriptiver, normistisch-puristischer Sicht wie aus der Sicht sprachlicher Laien eine im Sprachkontakt des Spanischen mit dem amerikanischen Englischen resultierende Mischung beider Sprachen, wobei die Basissprache […] in der Regel Spanisch ist und der Prozess der Mischung nicht arbiträr verläuft […].[16]
Spanglish als Sprachkontaktprodukt weist Einflüsse aus dem Englischen auf, wobei diese durch sprachliche Einschränkungen gelenkt werden.[17] Hinzu kommt, dass die Kontaktvarietät des Spanglish vor allem bei spanischsprachigen Bilingualen der zweiten Generation zu beobachten ist.[18] Weitere Bezeichnungen für das Spanglish sind u.a. el espanglés[19], el español bastardo (dt. ‚das entartete Spanisch’) oder inglañol sowie Tex-Mex.[20] Nash verwendet die Bezeichnung Englañol für das Produkt des englisch-spanischen Sprachkontakts auf Puerto Rico, bei welchem das Englische stark durch das Spanische beeinflusst wird.[21] Diese Varietät wird in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet.
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, zentrale Problemstellungen des spanisch-englischen Sprachkontakts zu erläutern. Folgende entscheidende Fragen stellen sich dabei: Welche inner- und außersprachlichen Faktoren wirken beim spanisch-englischen Sprachkontakt in den USA und führen zum Sprachwandel? Wie konstruieren sich die Identitäten der Latinos in den USA und welchen Einfluss hat ihre Sprache auf diese Identitäten? In welchem Verhältnis stehen dabei die Latinos und die angloamerikanische Mehrheitskultur? Welche sprachlichen Phänomene treten in der Sprache der Latinos auf? Ist das Spanglish wirklich eine „entartete“ Sprache? Welchen Status nimmt das Spanglish ein? Ist es ein Pidgin, ein Kreol, eine interlanguage, eine Mischsprache oder ein Dialekt? Die vorliegende Arbeit wird diesen Fragestellungen nachgehen. Dabei wird nicht eine bestimmte linguistische Theorie unterstützt, sondern verschiedene Theorien werden mit einbezogen. Die Situation in den USA und die für diese Arbeit zentralen Begriffe sollen an dieser Stelle einführend vorgestellt werden, um den Rahmen der Arbeit frühzeitig zu umreißen.
In unserer heutigen Zeit der Globalisierung gehört es immer mehr dazu, dass Menschen und Gemeinschaften mehr als eine Sprache fließend sprechen und im Alltag anwenden: so auch die Spanischsprecher in den USA. Diese sind meist Immigranten aus den spanischsprachigen Ländern Mittel- und Südamerikas, vorwiegend aber aus Mexiko, Puerto Rico und Kuba.[22] Das amerikanische Englisch und das amerikanische Spanisch bilden die Grundlage für den in der vorliegenden Arbeit erläuterten Sprachkontakt in den USA. Das Englische wird heutzutage als Lingua Franca vor allem im internationalen Umfeld von Politik und Wirtschaft verwendet. Durch den steigenden Machteinfluss des Britischen Empires und der ab dem 16. Jahrhundert in Nordamerika gegründeten Kolonien begann die weltweite Verbreitung des Englischen. Nach dem Zweiten Weltkrieg trug der steigende kulturelle und wirtschaftliche Einfluss der USA dazu bei, das Englische weltweit noch weiter zu verbreiten.[23] Mit etwa 215,4 Mio. englischen Muttersprachlern im Jahr 2000 stellen die USA das Land mit der größten nationalen Gemeinschaft auf der Welt dar, deren Erstsprache Englisch ist.[24] Die USA haben keine in der Verfassung festgelegte offizielle Sprache. Englisch ist somit nur de facto offizielle Sprache, sie ist als solche aber nicht gesetzlich festgelegt.[25] Nach Englisch ist Spanisch mit ca. 28,1 Mio. Sprechern über fünf Jahren (im Jahre 2000) die zweite Sprache der USA.[26] Die US-Bundesstaaten mit der größten Spanischsprecherzahl im Vergleich zur Gesamteinwohnerzahl sind New Mexico, Kalifornien, Texas, Arizona und Colorado. Weitere wichtige Spanischsprecherkonzentrationen befinden sich in Florida, New York und New Jersey.[27] Weltweit wird Spanisch von insgesamt ca. 400 Mio. Sprechern gesprochen, Muttersprachler und Zweitsprachler eingeschlossen.[28] Verbreitet ist es in Spanien selbst sowie in den ehemaligen spanischen Kolonien. Insgesamt 26 Staaten oder staatsähnliche Konstrukte gehören zur spanischsprachigen Welt. Die wichtigsten sind neben Spanien Mexiko, Argentinien und Kolumbien.[29] In den USA hat die spanische Sprache den Status einer Minderheitensprache und ist einem starken kulturellen und sprachlichen Druck durch das amerikanische Englisch ausgesetzt.[30] Das amerikanische Englisch ist im US-amerikanischen Kontext die dominierende Sprache, das Spanische die dominierte.
Die allgemeine Bezeichnung Latino für alle spanischsprachigen Einwanderer und deren Nachkommen in den USA ist vielschichtig und kann kaum eindeutig definiert werden. Die Latinos als ethnische Gruppe definieren sich vor allem durch ihre Sprache, das amerikanische Spanisch und dessen Varietäten, obwohl die Sprache allein eigentlich nicht zur Definition einer ethnischen Gruppe genügt.[31] Im Englischen wird anstatt Latino auch oft der Begriff Hispanic benutzt, der in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von der US-Regierung geprägt wurde.[32] Im Folgenden sollen einige Definitionsversuche beider Begriffe dargestellt werden.
Allatson definiert den Begriff Latino folgendermaßen:
Latino/a is the broad panethnic identity term that includes the Chicano/a and Puerto Rican historical minorities and any citizen or resident with Latin American heritage. Latino is the preferred term of many Latino/as when adopting a panethnic identification or speaking of self and community in national terms; it thus circulates as a self-adopted alternative of the government-imposed and media-preferred Hispanic.[33]
Das Merriam-Webster’s Online Dictionary gibt für Latino als Substantiv folgende Definition an:
Etymology: American Spanish, probably short for latinoamericano Latin American
Date: 1946
1 : a native or inhabitant of Latin America
2 : a person of Latin-American origin living in the United States[34]
Für hispanic als Adjektiv findet man darin folgendes:
Etymology: Latin hispanicus, from Hispania Iberian Peninsula, Spain
Date: 1584
1: of or relating to the people, speech, or culture of Spain or of Spain and Portugal
2: of, relating to, or being a person of Latin American descent living in the United States; especially: one of Cuban, Mexican, or Puerto Rican origin[35]
Hierbei lässt sich ein klarer Unterschied in der Konnotation beider Bezeichnungen erkennen. Morales fasst beide Konzepte treffend zusammen:
Hispanic–a term invented by the Nixon administration […]–was designed to allow the lighter-skinned to claim a European heritage. Latino–derived from Latin America, originally coined by Napoleon-era France as a public relations ploy to explain why a French emperor was installed in Mexico City–was a mid-‘70s incarnation of the term meant to allude to a separate identity from Spain. […] Although Latino importantly alludes to an allegiance to, or at least a sympathy with, Latin America […], its most significant implication is that Latinos are not just Spaniards, but a mixture of Spaniards, Africans, and indigenous people.[36]
Der Begriff Hispanic ist eher unklar definiert, indem er „all persons of Mexican, Puerto Rican, Cuban, Central or South American, or other Spanish culture or origin, regardless of race“ bezeichnet.[37] Zudem weckt er bezüglich der Spanischsprecher in den USA falsche Assoziationen. Er impliziert die hispanische, d.h. iberische, Herkunft der Sprecher. Dies ist aber irreführend, da der größte Teil der Spanischsprecher aus Lateinamerika[38] in die USA einwandert. Die Bezeichnung Hispanic wird zudem vorwiegend von der US-amerikanischen Regierung verwendet, wohingegen Latino der bevorzugte Begriff der nach einer eigenen Identität strebenden Immigranten und deren Nachkommen selbst ist.[39] Beide Bezeichnungen beschreiben die Minderheit aufgrund ihres sprachlichen und kulturellen Erbes, beziehen die Rasse aber nicht als Unterscheidungsmerkmal mit ein.[40] Dennoch werden die Termini Latino und Hispanic fälschlicherweise von vielen, u.a. von den US-amerikanischen Medien, in Verbindung mit Rasse gebracht.[41] Im Folgenden wird der Begriff Latino zur Bezeichnung aller spanischsprachiger Immigranten und deren Nachkommen in den USA verwendet, da der Begriff von den Betroffenen selbst am häufigsten verwendet wird.[42]
In der vorliegenden Arbeit wird ein besonderes Augenmerk auf die Spanglish-Varietäten der mexikanischen und puertoricanischen Einwanderer und deren Nachkommen in den USA gelegt. Die mexikanischstämmigen Latinos stellen die größte Gruppe der Spanischsprecher in den USA dar, gefolgt von den puertoricanischen.[43] Beide Gemeinschaften weisen grundlegende historische, kulturelle und sprachliche Unterschiede auf.[44] So wurde die mexikanische Kultur bedeutend von indigenen Elementen beeinflusst, wohingegen die puertoricanische entscheidende Elemente aus den afrikanischen Kulturen übernommen hat.[45] Seit der Besiedlung durch spanische Siedler im 16. Jahrhundert steht Mexiko durch die gemeinsame Grenze in engem Kontakt mit den heutigen USA, auf kultureller, wirtschaftlicher und auf sprachlicher Ebene.[46] Auch die heutigen US-Bundesstaaten Arizona, Kalifornien, New Mexico, Texas und Teile Colorados gehörten zeitweise zu Mexiko.[47] Das koloniale Verhältnis Puerto Ricos zu den USA unterscheidet dessen Geschichte grundlegend von der Mexikos.[48] Puerto Rico ist seit dem Vertrag von Paris 1898 zwischen den USA und Spanien ein Teil der USA. Die Puerto Ricaner haben zudem seit 1917 auch automatisch die US-Staatsbürgerschaft.[49] Beide Gemeinschaften haben aber auch Gemeinsamkeiten. Die spanische Sprache verbindet sie, auch wenn in beiden Ländern unterschiedliche Varietäten gesprochen werden. Zudem bestehen sowohl die mexikanischen als auch die puertoricanischen Gemeinschaften in den USA aus gerade eingewanderten und langfristig sesshaften Immigranten und deren Nachkommen, die mit der amerikanischen Mehrheitskultur konfrontiert werden.[50]
Zunächst erfolgt in der vorliegenden Arbeit eine Betrachtung der allgemeinen Aspekte des Bilingualismus und des Sprachkontakts, wobei auch auf die ethnische Identität, den Bikulturalismus sowie die sprachlichen Strategien bilingualer Sprecher und auf die Ergebnisse des Sprachkontakts eingegangen wird. Weiterhin werden der kontaktbedingte Sprachwandel und dessen Merkmale erläutert. Danach wird auf die Sprachgeschichte und sprachliche Besonderheiten des amerikanischen Spanisch eingegangen, wobei dem mexikanischen und puertoricanischen Spanisch besondere Beachtung geschenkt wird. Hinzu kommt ein kurzer Abriss der Geschichte des Spanischen und der Latino-Immigranten sowie der bilingualen Erziehung in den USA. Zudem werden die Varietäten des Spanglish und die Identitäten der Latinos in den USA näher betrachtet. Abschließend erfolgt eine Analyse ausgewählter sprachlicher Phänomene der mexikanisch- und puertoricanischstämmigen Spanglishsprecher in den USA sowie eine Erläuterung der Diskussion zum Status des Spanglish.
2. Allgemeine Aspekte des Bilingualismus und Sprachkontakts
Um eine Basis für die Betrachtung des spanisch-englischen Sprachkontakt in den USA zu schaffen, erfolgt zunächst eine allgemeine Beschreibung des Bilingualismus und Sprachkontakts.
2.1 Definitionen des Bilingualismus und Sprachkontakts
Uriel Weinreich hat mit seinem 1953 veröffentlichten Buch Languages in Contact. Findings and Problems einen wichtigen Grundstein für die Sprachkontaktforschung im 20. und 21. Jahrhundert gelegt.[51] Seine Definition des Sprachkontakts und des Bilingualismus stellt auch heutzutage noch eine wichtige Ausgangsbasis für weitere Betrachtungen auf diesem Gebiet dar:
[…] two or more languages will be said to be in contact if they are used alternately by the same persons. The language-using individuals are thus the locus of the contact. The practice of alternately using two languages will be called bilingualism, and the persons involved, bilingual.[52]
Silva-Corvalán benutzt die Termini bilingual und Bilingualismus folgendermaßen:
[…] the bilingual is used to refer to an individual who has a certain degree of competence in the use of two languages as vehicles of oral communication. Bilingualism, then, is the situation which obtains when a bilingual individual exists.[53]
Die folgenden Betrachtungen stützen sich auf diese Definition, da sie auch den Faktor des Sprachkompetenzgrades eines Sprechers mit einbezieht. Demnach müssen die Sprecher nicht beide involvierte Sprachen auf einem ausgeglichenen, sehr hohen Niveau sprechen, um als bilingual bezeichnet zu werden, sondern es reicht ein gewisses Kompetenzlevel aus. Die bilinguale Fähigkeit eines Sprechers muss auf einem Kontinuum von unterschiedlichen Fähigkeiten angesiedelt werden. Dabei steht der monolinguale Sprecher an einem Ende und der ideale bilinguale Sprecher am anderen.[54] Der bilinguale Sprecher befindet sich dabei auf einem dynamischen Kompetenzlevel, welches sich zu jedem Zeitpunkt vom einen zum anderen Ende des Kontinuums bewegen kann. Der Sprecher kann dabei während seines gesamten Lebens verschiedene Stadien des Kontinuums der Sprachkompetenz durchqueren.[55] Das Kontinuum sollte vor allem dann beachtet werden, wenn die Ergebnisse der Sprachproduktion und -rezeption miteinander verglichen werden. Das Spanisch eines bilingualen Latinos, der Englisch und Spanisch etwa gleich gut beherrscht und das Spanisch eines dominant englischsprachigen Latinos, der nur noch wenige spanische Aussagen produzieren bzw. verstehen kann, muss voneinander unterschieden werden.[56] Silva-Corvalán spricht daher im Kontext des spanisch-englischen Sprachkontakts von einem bilingualen Kontinuum (engl. bilingual continuum) einer Gemeinschaft, deren Sprecher mehr als eine Sprache sprechen. Sie definiert das Kontinuum als „[…] a series of lects ranging from unrestricted or standard Spanish to an emblematic use of Spanish (and vice versa in the other language).”[57] Insgesamt ist eine zufrieden stellende Definition des Bilingualismus schwierig, da dieser von vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist und beeinflusst wird.[58] Neben rein sprachlichen spielen auch außersprachliche Faktoren eine große Rolle. Diese werden später näher betrachtet.
Zunächst muss man zwischen dominanter bzw. bevorzugter Sprache und rezessiver Sprache eines bilingualen Sprechers unterscheiden. Dabei ist es nicht notwendigerweise der Fall, dass die dominante Sprache auch die Muttersprache L1 des Sprechers ist.[59] Im Folgenden wird trotzdem die Muttersprache eines bilingualen Sprechers als L1 und die Zweitsprache als L2 bezeichnet. Bei Sprechern, die gleichzeitig zwei Sprachen im Erstspracherwerb erlernt haben, gilt diese einfache Unterscheidung nicht.
Bilingualismus und Sprachkontakt sind meist untrennbar miteinander verbunden, da der bilinguale Sprecher einer der Orte sein kann, wo der Sprachkontakt stattfindet. Sie beeinflussen sich gegenseitig und sind meist voneinander abhängig, denn Sprachen können zudem durch Bilingualismus einer Gemeinschaft in Kontakt treten.[60] Volksgruppen und Individuen unterschiedlichster Herkunft treten immer wieder in Kontakt miteinander.[61] Sprachkontakt kann durch Wirtschaftsbeziehungen verschiedener Länder oder Gemeinschaften entstehen, aber auch dadurch, dass Gemeinschaften in fremde Gebiete einwandern. Dabei kann ein asymmetrischer Bilingualismus entstehen, bei dem eine Sprechergruppe beide involvierte Sprachen spricht, die andere Sprechergruppe jedoch monolingual ist. Die bilinguale Gemeinschaft ist dabei üblicherweise die Minderheit, wohingegen die sozial dominante Mehrheit monolingual bleibt.[62]
Sprachkontakt, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, zieht unweigerlich auch Sprachwandel nach sich und beeinflusst neben den Sprachen auch die beteiligten Individuen sowie die Gemeinschaften.[63] Sprachwandel ist ein dynamisches Phänomen und findet nicht abrupt statt.[64] Die Intensität des Sprachkontakts beeinflusst als bedeutsamer Faktor den Sprachwandel. Je intensiver zwei Sprachen in Kontakt treten, desto einschneidender können die Ergebnisse in beiden Sprachen sein.[65] Die möglichen Veränderungen durch Sprachkontakt werden in Kapitel 3 näher erläutert.
Der kulturelle Druck und die Dauer des Sprachkontakts sowie die Größe der in Kontakt stehenden Gemeinschaften spielen beim Ausmaß der sprachlichen Veränderungen eine wichtige Rolle, wobei die sozioökonomische und kulturelle Dominanz einer der Sprechergruppen der wichtigste Faktor ist: „[…] [T]he more socioeconomic dominance one of the groups exerts, the more likely it is that the subordinate group will adopt features from the dominant group’s language.“[66] Die dominierte Sprache wird somit von der dominanten beeinflusst.[67] Der extreme kulturelle Druck führt außerdem üblicherweise dazu, dass die sozial niedriger gestellte Sprechergruppe bilingual wird und zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Herkunftssprache ganz aufgibt. Dies ist bei vielen Immigrantengruppen in den USA zu beobachten, die nach einem gewissen Zeitraum zum Englischen als Hauptsprache wechseln.[68] Dann spricht man von subtraktivem Bilingualismus (engl. subtractive bilingualism).[69] Auch das kulturelle Prestige einer Sprache spielt beim Sprachkontakt und dessen Auswirkungen eine enorme Rolle. Mehrere Faktoren, wie die wirtschaftliche und ideologische sowie kulturelle Kraft einer Sprache wirken zusammen, um deren Prestige zu bestimmen.[70] Öffentliche Institutionen wie die Regierung eines Landes, Schulen, Organisationen und die Medien können zudem das Prestige einer Sprache beeinflussen, indem sie die öffentliche Wahrnehmung lenken und sogar bestimmen.[71] Für individuelle Sprecher stellen u.a. die Nützlichkeit der Sprache als Kommunikationsmittel, die Möglichkeit, diese häufig zu sprechen und die Identifikation mit der Sprache Faktoren für das Prestige einer Sprache dar. Zudem wird der Sprecher von den Werten der Sprachgemeinschaft, in der er lebt, beeinflusst.[72] Das Prestige der am Kontakt beteiligten Sprachen hat Einfluss auf deren Anfälligkeit für Einflüsse aus einer anderen Sprache und auch die Art der Einflüsse.[73] Allgemein gilt, dass der Transfer von Sprachen mit größerem Prestige zu Sprachen mit weniger Prestige quantitativ viel leichter vonstatten geht.[74] Sobald eine Sprache als höherwertig im Sinne von vorteilhaft für den sozialen Aufstieg in einer Gesellschaft begriffen wird, wird diese von Sprechern einer Minderheit meist bevorzugt.[75] Unterschiedlichen Sprachen kann in verschiedenen Domänen[76] Prestige zugeordnet werden. Dies wiederum beeinflusst die Einstellung des Sprechers zu einer Sprache.[77] Die Einstellung zur Sprache und die Motivation des Sprechers beeinflussen dessen Sprachlernprozess:
The learner’s attitudes towards the target-language community are believed to affect his success in learning considerably because the motivation to learn the second language is determined by these attitudes […]. Learners with an integrative motivation, i.e. the aim to become a member of the target-language community, will learn the second language better than those with an instrumental motivation, i.e. learners who only want to learn the new language because of (limited) commercial, educational or other instrumental reasons.[78]
Thomason und Kaufman betonen, dass Sprachkontakt und dessen Ergebnisse vorwiegend durch soziale Einflussfaktoren bedingt werden und kaum durch innersprachliche Faktoren: „[S]ocial factors can and very often do overcome structural resistance to interference at all levels.“[79] Der soziolinguistische Hintergrund eines Sprechers ist hierbei besonders bedeutsam: „[I]t is the sociolinguistic history of the speakers, and not the structure of their language, that is the primary determinant of the linguistic outcome of language contact.”[80] Silva-Corvalán präzisiert diese These, indem sie die Struktur der Sprache mit einbezieht:
[…] [T]he structure of the languages involved, to a large extent constrained by cognitive and interactional processes, governs the introduction and diffusion of innovative elements in the linguistic systems; the sociolinguistic history of the speakers is the primary determinant of the language direction and the degree of diffusion of the innovations as well as of the more distant (in terms of time-span) linguistic outcome of language contact […].[81]
Die Struktur einer Sprache ist dabei nicht durch strukturelle Schwächen für Einflüsse einer anderen Sprache empfänglich, sondern durch oberflächlich ähnliche Strukturen in beiden in Kontakt stehenden Sprachen.[82] Sprachliche Veränderungen können durch den Sprachkontakt auf allen Sprachebenen stattfinden.[83] Diejenige Sprache, aus der Elemente entlehnt werden, wird im Folgenden als Quellsprache (engl. source language) bezeichnet. Die Sprache, die die entlehnten Elemente aufnimmt, wird hier Zielsprache (engl. recipient language) genannt.[84] Dabei ist zu beachten, dass bei der Betrachtung des Sprachkontakts Quell- und Zielsprache meist als idealisierte Normen dargestellt werden, um den Vergleich der Ergebnisse in der Kontaktvarietät klarer veranschaulichen zu können.[85] Im Folgenden sollen die Arten des Bilingualismus, welche durch Sprachkontakt entstehen können, näher erläutert werden.
2.2. Arten des Bilingualismus
Bei der Betrachtung des Bilingualismus unterscheidet man zwei Arten des Bilingualismus: den individuellen und den sozialen Bilingualismus.
2.2.1 Individueller Bilingualismus
Der individuelle Bilingualismus bezieht sich nur auf ein Individuum und dessen ganz persönliche Ausprägung des Bilingualismus. Dabei ist bedeutend, dass Bilingualismus nie einheitlich und voraussehbar ist, sondern von Sprecher zu Sprecher variiert.[86] Es wird zwischen Spracherwerb direkt nach der Geburt, d.h. bilingualem Erstspracherwerb, und Spracherwerb im späteren Leben, d.h. Zweit- bzw. Fremdspracherwerb, unterschieden:
Learning two languages from birth, or bilingual first-language acquisition, is a different process from sequential bilingualism in which a person grows up monolingual and only then learns another language.[87]
Etwa auf das Alter von zwölf Jahren setzen Befürworter der „critical period hypothesis“ die Grenze zwischen bilingualen Erstspracherwerb und Zweitspracherwerb fest. Die Spracherwerbsstrategien jüngerer Kinder unterscheiden sich dabei bedeutend von denen Erwachsener.[88] Frühe bilinguale Sprecher lassen sich zudem weniger gut von monolingualen trennen, da sie ihre Sprachen während den prägenden Jahren ihrer Sprachentwicklung erlernt haben. Dies liegt auch daran, dass sie weniger Interferenzen[89] in den erlernten Sprachen aufweisen als spätere Bilinguale, welche normalerweise keine der Muttersprache entsprechende Kompetenz in der L2 erreichen. Sie unterscheiden sich von Muttersprachlern beispielsweise in ihrem fremdsprachlichen Akzent in der Aussprache.[90] Neben sozialen und emotionalen Faktoren spielen auch kognitive eine entscheidende Rolle beim Zweitspracherwerb. Deshalb kann man kein gleiches Ergebnis für mehrere gleichaltrige Lerner einer L2 erwarten.[91] Kinder, die bilingual aufwachsen und zwei oder mehr Sprachen gleichzeitig erlernen, haben unter günstigen Bedingungen die Möglichkeit, ein annähernd muttersprachliches Niveau in beiden erreichen zu können. Dennoch ist auch bei Kindern, die von Geburt an zwei Sprachen erlernt haben, eine Sprache meist dominanter als die andere. Dies hängt wiederum mit der Häufigkeit des Gebrauchs der jeweiligen Sprache, deren Prestige und den persönlichen Einstellungen des Sprechers zur Sprache zusammen.[92] Diese Rollenverteilung der Dominanz kann sich im Laufe des Lebens eines Sprechers verändern.[93]
Ein Unterschied kann auch bei der Sprachkompetenz eines Sprechers gemacht werden. Ein ausgeglichen bilingualer Sprecher beherrscht beide Sprachen etwa gleich gut und seine Sprachkompetenz entspricht im Allgemeinen der eines monolingualen Sprechers. Dennoch können beide Sprachen von der monoglotten Norm einer Sprache abweichen und somit Merkmale von Interferenz aufweisen.[94] Komplett ausgeglichene bilinguale Sprecher sind aus Sicht einer monoglotten Norm kaum oder gar nicht möglich, da die meisten Menschen üblicherweise eine der beteiligten Sprachen in irgendeiner Form besser beherrschen als die andere und sich in ihr wohler fühlen.[95] Daneben kommt es häufig zur funktionalen Spezialisierung des Sprachgebrauchs, da ein Sprecher meist eine Sprache in einer bestimmten Domäne besser verwenden kann als in einer anderen.[96] Der unausgeglichene bilinguale Sprecher stellt eher die Norm dar als der ausgeglichene bilinguale Sprecher. Ersterer zeigt klare Abweichungen von der monoglotten Sprachnorm, zumindest in einer der beteiligten Sprachen.[97] Die Tatsache, dass ein Sprecher meist nur unausgeglichen bilingual ist wird bei der Betrachtung der sprachlichen Phänomene des Spanglish in den USA in Kapitel 7 von Bedeutung sein.
Individueller und sozialer Bilingualismus sind eng miteinander verbunden, da sozialer Bilingualismus den individuellen Bilingualismus voraussetzt.[98] Im folgenden Kapitel wird der soziale Bilingualismus näher erläutert.
2.2.2 Sozialer Bilingualismus
Man spricht von sozialem Bilingualismus, wenn in einer Gemeinschaft zwei oder mehr Sprachen von deren Mitgliedern gesprochen werden.[99] Bei der Betrachtung des sozialen Bilingualismus liegt der Fokus darauf, zu verstehen „what linguistic forces are present in a community, their inter-relationships, the degree of connection between political, economic, social, educative and cultural forces and language.“[100] In komplexen Gesellschaften sind soziale Werte und Normen sowie die Kultur eng mit einer Sprache und deren Verwendung verbunden. Die sozialen Umstände sind dabei der Hintergrund, der die historischen und sozialen Prozesse erklärt, die zum Bilingualismus der Sprecher geführt haben.[101] Wie schon erwähnt können verschiedene Sprachen verschiedene Domänen des Lebens abdecken.[102] Diese Situation bezeichnet man auch als Diglossie.[103] Der Begriff Diglossie wurde zuerst von Charles Ferguson definiert:
diglossia is a relatively stable language situation in which, in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, […], which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation.[104]
Nach Ferguson existieren somit zwei Varietäten einer Sprache in einer Gemeinschaft nebeneinander, wobei jede Varietät in bestimmten Bereichen des Lebens verwendet wird.[105] In dieser Situation gibt es eine Varietät mit einem höheren sozialen Einfluss (engl. High Variety) und eine Varietät mit niedrigerem Einfluss (engl. Low Variety).[106] Neuere Definitionen der Diglossie gehen von einer funktionalen Verteilung von zwei oder mehr Sprachen in einer Gemeinschaft aus. Die hierarchische Rollenverteilung wird vom politischen und sozioökonomischen Prestige der Sprachen bestimmt. Die High Variety ist üblicherweise die Sprache der dominanten Mehrheit, die Low Variety die der dominierten Minderheit, meist der Immigranten.[107]
Diglossie und Bilingualismus können parallel oder separat auftreten, sodass eine Diglossiesituation auch bestehen kann, wenn zwei Sprechergruppen nicht die Sprache der jeweils anderen Gruppe sprechen.[108] Die Situation der Latinos in den USA kann in bestimmten Fällen als Diglossiesituation gewertet werden. Für Grosjean sieht der Kontakt zwischen Spanisch und Englisch in den USA zu einer Art Diglossie. Spanisch wird in den Gemeinschaften der spanischsprachigen Einwanderer in den USA als Gefühlssprache vor allem im vertraulichen und familiären Umfeld verwendet, während Englisch die Sprache der wirtschaftlichen und formalen sozialen Beziehungen ist.[109] Zentella hingegen kommt anhand ihrer Studie puertoricanischer Einwanderer und deren Nachkommen in New York City zu dem Ergebnis, dass in dieser Gemeinschaft keine Diglossiesituation vorherrscht.[110] Die unterschiedlichen Gemeinschaften können somit auch unterschiedliche Sprachverwendungsmuster aufweisen. Die mögliche funktionale Verteilung der Sprachen innerhalb einer Gemeinschaft hat Auswirkungen auf die Sprachwahl der Sprecher. Diese wird im folgenden Kapitel erläutert.
2.3 Sprachwahl
Die Frage der Sprachwahl (engl. language choice) eines bilingualen Sprechers und der Gemeinschaft ist immer auch eine Frage der Identität der Sprecher, die durch eine bestimmte Sprache ausgedrückt wird. Diese Identität entwickelt und verändert sich mit der Zeit durch verschiedene Erlebnisse und Beziehungen der Sprecher innerhalb und außerhalb der eigenen Sprachgemeinschaft.[111] Die Sprachwahl hängt von Faktoren ab, die Fishman treffend wie folgt formuliert: „[…] who speaks what language to whom and when […].“[112] Das Sprachverhalten von Sprecher und Zuhörer, das Thema der Konversation, das Verhältnis der Gesprächspartner zueinander, deren eventuelle Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gemeinschaft sowie der Anlass und die Funktion des Gespräches spielen für die Sprachwahl eine ebenso wichtige Rolle wie die Häufigkeit des Sprachgebrauchs und das Kompetenzlevel in den beteiligten Sprachen.[113] All diese Faktoren zusammen entscheiden über die Wahl der Sprache.[114] Die Sprachwahl zwischen zwei Gesprächspartnern in einer bestimmten Situation ist also keineswegs eine unüberlegte Entscheidung.[115] Um eine geeignete Wahl hinsichtlich der Sprache einer Konversation zu treffen, benötigt ein Sprecher eine gewisse kommunikative Kompetenz, welche
takes into account the interaction of grammatical systems (what is formally possible), psycholinguistic systems (what is feasible in terms of human information processing), sociocultural systems (what is the social meaning or value of a given utterance), and probabilistic systems (what actually occurs).[116]
Beim Sprachkontakt und dessen Erforschung ist die kommunikative Kompetenz eines Sprechers sehr wichtig. Diese beinhaltet nicht nur die Beherrschung einer Sprache, sondern auch die Kenntnis der sozialen Regeln und die Konsequenzen der Wahl einer bestimmten Sprache.[117] Wenn ein bilingualer Sprecher folglich mit einem anderen Sprecher spricht, der den gleichen sprachlichen Hintergrund besitzt, dann ist es möglich, dass beide Sprachen verwendet werden. Derselbe Sprecher würde diese Freiheit aber im Gespräch mit einem monolingualen Sprecher nicht empfinden und versuchen, nur eine Sprache zu verwenden.[118]
Trotz allen Vorraussagen, die man über die Sprachwahl in einer bestimmten Situation treffen kann, bleibt sie doch äußerst unvorhersehbar, da alle Faktoren in unterschiedlichen Gemeinschaften auch eine unterschiedliche Gewichtung erfahren. Zudem erschweren unerwartete Ereignisse und Stress die Bestimmung der Sprachwahl.[119]
Der bilinguale Sprecher kann in seiner Hin- und Hergerissenheit zwischen zwei Sprachen innerhalb einer Gemeinschaft auch ein Gefühl der Frustration und Verwirrung erfahren, ausgelöst durch Konflikte und Unterschiede zwischen Herkunftssprache und -kultur einerseits und der Sprache und Kultur des Gastlandes andererseits. Dabei kann die ethnische Identität der Sprecher und deren Gemeinschaft in Frage gestellt werden.
2.4 Ethnische Identität
Die ethnische Identität einer Gemeinschaft definiert sich durch deren Abgrenzung von anderen Gemeinschaften und Gruppen:
Everything that differentiates a group from another group constitutes the group’s identity. Although there are no fixed criteria, a group is considered to be an ethnic group with a specific ethnic identity when it is sufficiently distinct from another group.[120]
Ethnizität definiert sich über die Werte, Handlungen und Traditionen einer Gemeinschaft.[121] Sie besteht aus einer Kombination ererbter und erlernter Elemente, die zugleich stabil und wandelbar sind. Zudem binden diese Faktoren Individuen durch soziale Integration an eine Gemeinschaft. Ethnizität basiert sowohl auf einer kollektiven Selbsterkennung als auch auf Fremdwahrnehmungen. Bei Individuen und ethnischen Gemeinschaften findet man deshalb oft das Bedürfnis und die Suche nach den eigenen Wurzeln, die gleichzeitig mit einer Abgrenzung von anderen Gemeinschaften einhergehen.[122] Die Latinos als ethnische Minderheit in den USA definieren sich vor allem durch ihre Abgrenzung von der dominanten angloamerikanischen Gemeinschaft und ihren Werten. Erst durch ihre Ankunft in den USA entwickelt sich diese ethnische Identität.[123]
Sprachliche Minderheiten können auch eine negative Einstellung gegenüber ihrer ethnischen Identität annehmen. Dabei spielt erneut das gesellschaftliche Prestige der Sprachen eine wichtige Rolle.[124] Der kulturelle Druck der Mehrheitskultur und -sprache führt nach einer gewissen Zeit üblicherweise dazu, dass Sprecher einer Minderheitensprache diese aufgeben. Dieser Sprachverlust zieht dann meist auch Konsequenzen für die ethnische Identität der Sprecher nach sich, da mit diesem Prozess oftmals eine Assimilation der Sprecher an die Mehrheitskultur einhergeht.[125] Die Aufgabe der Minderheitensprache ist dabei aber nicht die Lösung aller Probleme:
A shift from bilingualism to monolingualism does not prevent problems. Because of the assimilative forces of the majority community many members from ethnic minority groups adopt the cultural values of that community, try to learn and speak its language, while they are in the process of losing their mother tongue. At the same time, they are not really ‘admitted’ to the majority community, i.e. to the better jobs, houses and educational opportunities. They will often encounter discriminating and racist attitudes of the majority population who nevertheless require them to assimilate.[126]
Die Auswirkung dieser Entwicklung auf die Gemeinschaft der Latinos wird in Kapitel 6 dargestellt.
Ethnie und Rasse dürfen nicht miteinander gleich gestellt werden, da letztere biologische und phänotypische Merkmale aufweist. Die Latinos in den USA können sich also durchaus einer gemeinsamen Ethnie zugehörig fühlen, auch wenn sie verschiedenen Rassen angehören, u.a. Schwarze, Weiße und Mestizen.[127] Stößlein geht davon aus, dass für die Latinos in den USA die gemeinsame Sprache als ein Ersatz für „nicht vorhandene gemeinsame, phänotypische Merkmale, die anderen Minderheiten in den USA besitzen (etwa race)“ fungiert, auch wenn man über diese allein keine ethnische Gruppe definieren kann.[128] Neben Werten und Traditionen einer Gemeinschaft kann somit die Sprache ein Symbol der ethnischen Identität eines Individuums oder einer Gruppe darstellen.[129] Sie dient dem Ausdruck dieser eigenen Identität und ist ein Mittel der Abgrenzung von anderen Gemeinschaften.[130] Es gibt aber auch Gemeinschaften, die sich zu einer bestimmten Ethnie zählen, ohne über Kenntnisse in der jeweiligen Sprache zu verfügen. Deren Identitätsbildung wird in Kapitel 6 genauer erläutert.
Es gibt ebenfalls die Möglichkeit der mehrfachen Loyalität und Identität.[131] Besonders in stabilen bilingualen Gemeinschaften besteht die Möglichkeit einer bikulturellen Identifikation.[132] Im folgenden Kapitel wird der Bikulturalismus skizziert.
2.5 Bikulturalismus
In bilingualen Gemeinschaften stehen nicht nur Sprachen im Kontakt, sondern auch unterschiedliche Kulturen.[133] Die Kultur spiegelt die Lebensweise einer Gemeinschaft wieder, „including its rules of behaviour; its economic, social, and political systems; its language; its religious beliefs; it’s laws […]. Culture is acquired, socially transmitted, and communicated in large part by language.”[134] Zudem ist sie eng mit Sprache verbunden.[135] Verknüpft mit dem Bilingualismus kann somit der Bikulturalismus (engl. biculturalism) auftreten. Dieser bezeichnet die „coexistence and/ or combination of two distinct cultures […].“ innerhalb einer Gemeinschaft oder eines Individuums.[136] Der Bilingualismus kommt nicht unbedingt zusammen mit dem Bikulturalismus vor, aber meist ist dies der Fall.[137] Die Kombination ist grundlegend für eine erfolgreiche Kommunikation in der Zweitsprache:
Much of the friction across different linguistic communities can arise out of situations where speakers of two languages have acquired two sets of linguistic patterns but then proceed to use the second set with the cultural values of the first. […] [A]t the worst it can lead to interpretations of ignorance, rudeness or arrogance. Moreover, the further one progresses in bilingual ability the more important the bicultural element becomes, since higher proficiency increases the expectancy rate of sensitivity towards the cultural implications of language use.[138]
Bikulturalismus wird vor allem bei additivem Bilingualismus (engl. additive bilingualism) erreicht, wenn der Sprecher eine ausreichende kommunikative Kompetenz in beiden Sprachen aufweist:[139]
The successful second language learner gradually adopts aspects of behaviour which characterise members of another linguistic-cultural group, particularly if the learner’s ethnocentric tendencies are not over-strong and if the motivation is integrative (i.e., wishing to become an insider in the community of the language that is being learnt) rather than instrumental (i.e., learning the language out of necessity, for job requirements, examination criteria, and so on, without wishing to participate in the culture borne by that language).[140]
Weitere Faktoren wie die Größe der Minderheit, das Immigrationsmuster, die geographische Konzentration der Minderheit und der Sprachgebrauch beeinflussen den Bikulturalismus.[141]
Bilinguale Sprecher, die ihre doppelte kulturelle Zugehörigkeit als problematisch empfinden, weisen oft auch schlechtere Ergebnisse in der Kompetenz beider Sprachen auf als Sprecher, die sich in zwei ethnischen Gruppen und Kulturen wohl fühlen.[142] Insbesondere bei Immigrantenkindern kann es zu Konflikten kommen, wenn sich die Herkunftskultur sehr stark von der Gastkultur unterscheidet:
The need for absolute identity with peers in such domains as values, attitudes, language, clothes, and leisure, along with the fear of ridicule, may lead to a state of conflict between the home and the outside society.[143]
Dieser Konflikt kann dann auch sprachliche und kulturelle Konflikte zwischen den Generationen, v.a. den Eltern und Kindern, hervorrufen.[144] Oft wollen die Kinder, wie auch in einer monolingualen Gemeinschaft, einen anderen sozialen Status beanspruchen als ihre Eltern. Besonders dann, wenn diese einen niedrigen sozialen Status innehaben wählen die Kinder oftmals für ihre regelmäßige Kommunikation eine andere Sprache, die soziales Prestige besitzt. Somit versuchen sie, zur Mehrheitskultur zu gehören.[145] Die Ergebnisse des Sprachkontakts werden im Folgenden vorgestellt.
2.6. Ergebnisse des Sprachkontakts
Der Sprachkontakt kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen: Es können durch Sprachmischungen neue Sprachen entstehen, wie z.B. Pidgin- und Kreolsprachen oder Mischsprachen (engl. bilingual mixed languages).[146] Beim Kontakt der Sprachen einer dominanten und einer Minderheitengemeinschaft kann es weiterhin dazu kommen, dass die Minderheitensprache erhalten bleibt, üblicherweise mit gewissen sprachlichen Veränderungen. Auch die Sprachverschiebung und der Sprachverlust sind mögliche Ergebnisse des Sprachkontakts.[147]
2.6.1 Pidgin-, Kreol- und Mischsprachen
Pidgins entstehen, wenn zwei oder mehr Sprechergruppen aufeinander treffen, die keine Kenntnisse der jeweils anderen Sprachen haben und für gewisse Zwecke, wie z.B. Handelsbeziehungen, miteinander kommunizieren müssen.[148] Pidgins zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Vergleich zu den miteinander in Kontakt getretenen Sprachen eine vereinfachte Struktur aufweisen und dass die Sprecher keine Muttersprachler des Pidgins sind.[149] Die vereinfachte Struktur entsteht durch das fehlerhafte Erlernen der jeweils anderen Sprachen.[150] Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der Großteil des Lexikons eines Pidgins aus der Sprache der sozial dominanten Gemeinschaft stammt und die grammatischen Strukturen aus der dominierten Sprache.[151] Ein Beispiel dafür sind die Pidgins in ehemaligen Handelsstützpunkten der europäischen Kolonialmächte, z.B. das Chinese Pidgin English. Es entstand als das britische Englisch mit der chinesischen Varietät Cantons im späten 17. Jahrhundert in Kontakt trat.[152]
Kreolsprachen entstehen, wenn ein Pidgin in der weiteren Entwicklung die Muttersprache einer meist neu entstandenen Gemeinschaft wird, welche ein Kommunikationsmittel für alle Lebensbereiche benötigt.[153] Dabei wird ein gewisser sprachübergreifender Kompromiss (engl. cross-language compromise) hinsichtlich der Grammatik der entstehenden Sprache eingegangen.[154] Kreolsprachen werden vor allem in den ehemaligen Kolonien der europäischen Großmächte gesprochen, u.a. in der Karibik von den Nachkommen der afrikanischen Sklaven. Ein Beispiel ist das Haitian Creole, welches durch den Kontakt des Französischen mit afrikanischen Sprachen entstand.[155] Eine andere Art, die abrupten Kreolsprachen, entsteht wie Pidginsprachen durch das unvollständige Erlernen einer Sprache durch eine Sprechergruppe während eines Prozesses der Sprachverschiebung und weist ähnliche Strukturmerkmale wie Pidgins auf. Die abrupten Kreolsprachen werden dann jedoch ohne Zwischenstation eines Pidgins zum Hauptkommunikationsmittel einer neu entstandenen Sprechergruppe.[156] Das Isle de France Creole, gesprochen auf Mauritius, ist hierfür ein Beispiel.[157]
Die so genannten Mischsprachen entwickeln sich in einer Kontaktsituation zwischen zwei Sprachen mit Sprechern, die zumindest umfassende, wenn nicht sogar volle bilinguale Kompetenzen in den beteiligten Sprachen aufweisen können.[158] Die Mischsprachen entwickeln sich in beständigen ethnischen Gruppen durch einen langen Prozess des Sprachwandels, welcher bis zur Sprachaufgabe der ursprünglichen Sprache führen kann. Mischsprachen entstehen durch das Bedürfnis einer Minderheit, ein eigenes Kommunikationssystem, getrennt von der dominanten Gemeinschaft, zu schaffen. Die Minderheit setzt sich somit gegen eine volle kulturelle Assimilation zur Wehr, obwohl der Sprachkontakt mit der dominanten Sprache stattfindet. Im Gegensatz zu den Pidgin- und Kreolsprachen spielt bei der Entstehung der Mischsprachen das fehlerhafte Erlernen keine Rolle, da die Sprecher Kompetenz in beiden Ausgangssprachen aufweisen.[159] Ein Beispiel für eine solche Mischsprache ist die Media Lengua in Ecuador, die sich durch den Kontakt des Quechua mit dem Spanischen entwickelt hat. Sie besteht vorwiegend aus einem vom Quechua abgeleiteten grammatischen System und einem vom Spanischen abgeleiteten Lexikon.[160] All die hier behandelten Sprachformen als mögliche Ergebnisse eines Sprachkontakts werden in der Diskussion hinsichtlich des Status des Spanglish in den USA noch eine bedeutende Rolle einnehmen.
2.6.2 Spracherhalt, Sprachverschiebung und Sprachverlust
Bei dem Phänomen des Spracherhalts (engl. language maintenance) bestehen alle in Kontakt stehenden Sprachen als unabhängige Sprachen weiter. Eine soziale Minderheit behält dabei ihre Sprache in einer Kontaktsituation bei.[161] Wichtig sind u.a. die Anzahl der Sprecher der Minderheitensprache und ob öffentliche Institutionen die Sprache unterstützen sowie eine bikulturelle Entwicklung seitens der Minderheit.[162] Bezogen auf die Latinos in den USA bedeutet das, dass viele Wissenschaftler davon ausgehen
dass die politischen, sozialen und demographischen Faktoren, wie demographische Konzentration, weiterer Zuzug, der Kontakt mit dem Ursprungsland, die Dauer des Aufenthalts in den USA, die Sprache am Arbeitsplatz, Prestige der Minderheitssprache, die wirtschaftliche Mobilität und die individuelle Kompetenz eine wesentliche Rolle spielen.[163]
Auch beim Spracherhalt kann es zu kontaktbedingten Veränderungen in der Minderheitensprache kommen. Diese betreffen dabei oftmals Entlehnungen aus dem Lexikon der dominierten Sprache.[164]
Eine strikte Trennung der Sprachen nach Domänen kann eine Stabilisierung des Bilingualismus und den Erhalt einer Sprache bedeuten:
[…] [I]f a strict domain separation becomes institutionalized, such that each language is associated with a number of important but distinct domains, bilingualism can become both universal and stabilized even though an entire population consists of bilinguals interacting with other bilinguals […].[165]
Nach Fishman halten bestimmte Sprachdomänen, wie beispielsweise die familiäre, einer Sprachverschiebung länger stand, als andere.[166] Wenn die Familie und das nähere soziale Umfeld Kindern genug Möglichkeiten bieten, die Minderheitensprache anzuwenden, dann haben sie gute Aussichten, bilingual zu bleiben.[167]
Durch die Konfrontation eines Sprechers mit zwei oder mehr Sprachen kann es aber auch zum Prozess der Sprachverschiebung (engl. language shift) kommen. Dabei wird eine der am Sprachkontakt beteiligten Sprachen von einem Sprecher oder einer Sprechergruppe schrittweise zu Gunsten einer anderen aufgegeben. Die aufgegebene Sprache kann auch die Muttersprache L1 der Sprecher sein.[168] Viele Minoritäten verspüren von der Mehrheitsgemeinschaft den Druck, sich sowohl sprachlich als auch kulturell an ihre Umgebung anpassen zu müssen. Diese Anpassung geht meist mit dem Wunsch nach einem sozialen Aufstieg einher. Wenn die Minderheitensprache in immer weniger Bereichen des Lebens gesprochen wird, dann verliert sie für ihre Sprecher an Wert. Sie sind dann immer weniger motiviert, die Sprache zu sprechen und es kommt zur Sprachverschiebung.[169] Bei der Sprachverschiebung sind Veränderungen in der Struktur der dominierten Sprache typisch.[170] Der Verlust struktureller Elemente in der Minderheitensprache eines individuellen Sprechers wird im Englischen als attrition bezeichnet, d.h. „the loss of proficiency in a language”.[171] Dabei werden die verlorenen gegangenen sprachlichen Elemente nicht ersetzt, sondern es kommt nach und nach zum Verlust von sprachlichen Ressourcen, wobei gleichzeitig Entlehnungen aus der dominanten Sprache stattfinden können. Meist ist die attrition nur ein Merkmal der Sprache eines Sprechers auf dem Weg zum Sprachverlust.[172]
Der Sprachverlust (engl. language loss) als Endergebnis des Prozesses der Sprachverschiebung ist ein häufiges Phänomen bei Immigranten und kann auf kollektiver wie auch auf individueller Ebene stattfinden.[173] Das System der Minderheitensprache bei weniger kompetenten Sprechern wird immer weiter reduziert und vereinfacht. Mit dem Verlust einer Sprache verliert ein Individuum oder eine Gemeinschaft zudem auch ein Identifikationssymbol.[174]
Verschiedene Faktoren wirken bei Spracherhalt und -verschiebung zusammen. Wenn eine bestimmte Immigrantengruppe vor langer Zeit in ein Gebiet oder ein Land eingewandert ist und nicht durch neue Zuwanderung erneuert wird, dann ist es üblich, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Sprache der Mehrheitskultur übergeht. Gemeinschaften, die hingegen immer wieder durch neue Zuwanderung monolingualer Sprecher erneuert und bereichert werden, behalten ihre Minoritätensprache viel eher bei. Dieser Prozess ist auch bei spanischsprachigen Immigranten in die USA zu beobachten, wodurch das Spanische zumindest auf der Gemeinschaftsebene erhalten bleibt.[175] Zudem ist die Größe und die geographische Konzentration einer Gemeinschaft entscheidend für den Spracherhalt. Konzentrieren sich viele Spanischsprecher in einem Gebiet, verlangsamt sich die Sprachverschiebung zumeist. Die Isolation einer Sprachgruppe kann den Spracherhalt begünstigen, wenn die Minoritätengruppe nicht mit anderen Sprachgruppen kommunizieren muss, um das alltägliche Leben zu bestreiten.[176]
Daneben nehmen ruraler und urbaner Lebensraum Einfluss auf die Sprachverschiebungsprozesse. In urbanen Gebieten tendiert eine Gemeinschaft dazu, die Minderheitensprache viel länger zu erhalten als in urbanen Gebieten.[177] Die Latinos in den USA konzentrieren sich vorwiegend in urbanen Gebieten.[178]
Das soziale Netzwerk, welches die Einwanderer umgibt, spielt zudem beim Spracherhalt oder der -verschiebung eine bedeutende Rolle.[179] Milroy und Milroy haben 1985 einen erkenntnisreichen Artikel zur Bedeutung von menschlichen Netzwerken beim Sprachwandel veröffentlicht. Innerhalb von Gemeinschaften stehen demnach Menschen durch starke und schwache Beziehungen (engl. strong ties vs. weak ties) miteinander in Kontakt:
Exchange networks constitute persons such as kin and close friends with whom ego not only interacts routinely, but also exchanges direct aid, advice, criticism, and support; such ties may therefore be described as ‘strong’. Interactive networks on the other hand consist of persons with whom ego interacts frequently and perhaps over prolonged periods of time, but on whom ego does not rely for personal favours and other material or symbolic resources; such ties may therefore be described as ‘weak’.[180]
Diese Beziehungen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die von einem Sprecher benutzte Sprache. Milroy und Milroy kommen zu der Erkenntnis, dass es schwache Beziehungen sind, die sprachliche Innovationen an andere Gemeinschaften weitergeben und fördern, wohingegen starke Beziehungen den Spracherhalt fördern.[181] Die Innovationen werden von einer Gruppe zur anderen durch Personen weitergegeben, die mit beiden Gruppen durch schwache Beziehungen in Kontakt stehen:[182]
[…] [W]eak ties between groups provide bridges through which information and influence are diffused, and that weak ties are more likely to link members of different small groups than strong ones, which tend to be concentrated within particular groups.[183]
Soziale und geographische Mobilität der Sprecher trägt dabei zum Erfolg der Weitergabe von sprachlichen Innovationen bei.[184] Milroy und Milroy nennen u.a. Immigration von Sprechergruppen in ein neues Gebiet sowie kommerziellen und kulturellen Kontakt als Beispiele, wodurch sich schwache Beziehungen entwickeln können. Dennoch müssen sprachliche Veränderungen oder Neuerungen von den Sprechern als positiv bewertet werden, d.h. ein gewisses Prestige der Quellsprache in Sprachkontaktsituationen ist nötig, damit die Innovationen auch wirklich von den Sprechern übernommen werden. Außerdem muss eine große Anzahl von Personen der Innovation ausgesetzt sein und diese annehmen, damit sie dann auch weiter innerhalb des Netzwerks verbreitet werden kann.[185] Aufgrund der verschiedenartigen Netzwerke unterscheiden sich Gemeinschaften in ihrer Offenheit gegenüber stattfindendem Sprachwandel, so dass es zu ungleichen sprachlichen Ergebnissen in unterschiedlichen Sprachkontaktsituationen kommt.[186] Die Netzwerktheorie spielt bei den sprachlichen Phänomenen des Spanglish der Latinos in den USA eine wichtige Rolle.[187]
2.6.3 Einfluss der Eltern auf Spracherhalt und -verschiebung ihrer Kinder
Der Ursprung der Sprachkompetenz im Erwachsenenalter liegt in der Kindheit der Sprecher. Sobald die spanische Sprache während der Kindheit sehr viel im familiären Umfeld der Sprecher genutzt wurde, desto besser sind die Voraussetzungen für deren Sprachkenntnisse im Erwachsenenalter.[188] Bei der Erziehung der Kinder ist entscheidend, wie die Eltern die Bedeutung ihrer Herkunftssprache einschätzen und ob sie Vor- oder Nachteile in der bilingualen Erziehung sehen.[189] Wenn sie Vorteile für ihre Kinder im Bilingualismus sehen und die Herkunftssprache als wertvoll für ihre Identität betrachten, dann bemühen sie sich weitgehend, diese weiterzuvermitteln. In diesem Fall bleibt die Minderheitensprache durch die Kinder länger erhalten.[190] Wichtig für den Spracherhalt sind neben der Sprachverwendung der Eltern auch die Nähe zu anderen Sprechern der Minderheitensprache, Reisen in das Herkunftsland und der Gebrauch von Medien in der jeweiligen Sprache.[191] Wenn die Eltern aber möchten, dass ihre Kinder später nicht aufgrund ihrer Sprache diskriminiert bzw. stigmatisiert werden und ihre Kinder sozial aufsteigen sollen, dann ist es üblicherweise der Fall, dass die Eltern ihre Kinder dazu ermuntern oder sogar zwingen, nur die Sprache der Mehrheitsgemeinschaft zu lernen und zu sprechen.[192] Die Kinder erhalten dann nicht genügend Input der Sprache und die negative Einstellung der Eltern zu ihrer Herkunftssprache wird auch auf die Kinder übertragen.[193] Hier ist zu beachten, dass vor allem Mütter den Sprachwandel durch besondere soziale Interaktion vorantreiben, wohingegen Väter sprachlichen Veränderungen oft konservativer gegenüber stehen.[194] Da Mütter häufig bedeutend mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen als Väter, ist dies eine gute Voraussetzung für die Weitergabe von sprachlichen Veränderungen an die Kinder.[195]
Mittlerweile ist wissenschaftlich erwiesen, dass bilinguale Kinder in ihren kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten klar im Vorteil gegenüber monolingualen Kindern sind.[196] Dies ist aber nur der Fall, wenn bestimmte positive soziale Umstände gegeben sind:
These social factors include the social economic position of the bilingual (and his or her community or group), the prestige of the two languages, and the educational situation.[197]
Sobald die sozialen Umstände ungünstig sind, kann dies auch negative Auswirkungen auf die Entwicklung der bilingualen Fähigkeiten haben.[198] Kinder in Minderheitsgemeinschaften profitieren generell von bilingualen Erziehungsprogrammen, in welchen ihre Herkunftssprache eine wichtige Rolle spielt. Für sie ist die bilinguale Erziehung ein wichtiges Mittel, um ihre kulturelle Identität zu erhalten und mit positiven Assoziationen in Verbindung zu bringen.[199] Krashen geht am Beispiel der USA von drei notwendigen Faktoren aus, wodurch die bilinguale Erziehung in Minderheitensprachen bei Kindern erfolgreich ist:
Subject matter knowledge and literacy, both gained through the primary language, provide indirect but powerful support for English language development and are two of the three components of quality bilingual programs. The third component is direct support for English language development, through English as a Second Language classes and sheltered subject matter teaching […].[200]
Bilinguale Erziehung hat einen positiven Effekt auf die Muttersprache und die Zweitsprache. Bei Minderheitensprechern muss dabei die Muttersprache in der Schule weiterentwickelt werden, um eine Basis für das erfolgreiche Erlernen der Mehrheitssprache zu bieten. Oftmals können die Kinder in Alltagssituationen beide Sprachen mit einer gewissen Kompetenz verwenden, doch meist mangelt es ihnen an Lese- und Schreibkompetenz.[201] Wenn dieses Wissen in der L1 verfügbar ist, dann können die Kinder auch eine hohe Kompetenz in diesen Bereichen in der Zweitsprache erreichen.[202] Vor allem wenn die Minderheitensprache auch außerhalb der Schule eine wichtige Funktion für die Kinder einnimmt, kann dies positive Effekte auf beide Sprachen haben.[203] Minderheiten in den USA können durch eine Erziehung, die auf additiven Bilingualismus abzielt und diese Erziehung in ihrer eigenen Sprache mit ihren eigenen Traditionen verknüpft besser die Konfrontation mit der angloamerikanischen Gesellschaft und deren Normen bzw. Traditionen meistern, als dies ohne diese Erziehung möglich ist.[204] Selbst bilinguale Kinder aus ärmeren Verhältnissen können bei guter bilingualer Erziehung Erfolg in der Schule haben.[205]
[...]
[1] The British Museum: http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/t/the_rosetta_stone.aspx (07.09.2008).
[2] Thomason 2001: 6
[3] Thomason 2001: 8, 10; Hornby 1977: 1
[4] Li 2000: 3
[5] Zentella 1997: 269
[6] Milroy, Milroy 1997: 99
[7] Milroy, Milroy 1997: 75
[8] Li 2000: 5; Thomason 2001: 46
[9] Appel, Muysken 1987: 59: „In most bilingual communities the two (or more) languages do not have equal status. Side by side with majority languages, which have prestige and positive social-economic connotations, there are the minority languages, often associated with low social-economic status and lack of educational achievement. They are more or less stigmatized, and not considered as suitable vehicles for communication in school or subjects to be taught.”
[10] Hornby 1977: 1; Grosjean 1982: 43; Thomason 2001: 31
[11] Cf. Fishman 1975: 15/16
[12] Nash 1970: 231
[13] Stößlein 2005: 11
[14] Grosjean 1982: 331
[15] Morales 2002: 3
[16] Stößlein 2005: 71
[17] Stößlein 2005: 84
[18] Silva-Corvalán 1994: 91
[19] Dieser Begriff wird zusammengesetzt aus den spanischen Wörtern (el) español ‚Spanisch’ und (el) inglés ‚Englisch’.
[20] Stavans 2003: 3/4, 12/13
[21] Nash 1971: 106
[22] Lipski 2003: 231
[23] Cf. Thomason 2001: 24; Kinder et al. 2006, 247b
[24] U.S. Census Bureau 2000: Language Use and English-Speaking Ability: 2000. www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf (16.12.2008)
[25] Fishman 1985b: 58/59
[26] U.S. Census Bureau 2000: Language Use and English-Speaking Ability: 2000. www.census.gov/prod/2003pubs/c2kbr-29.pdf (16.12.2008)
[27] Grosjean 1982: 46
[28] Zentella 2002: 323
[29] Berschin et al. 2005: 16, 18
[30] Berschin et al. 2005: 19; Stößlein 2005: 12
[31] Stößlein 2005: 123; v. dazu auch Kapitel 2.4 zur ethnischen Identität
[32] Wallerstein 2005: 33
[33] Allatson 2007: 140
[34] http://www.merriam-webster.com/dictionary/latino (09.08.2008)
[35] http://www.merriam-webster.com/dictionary/hispanic (07.09.2008)
[36] Morales 2002: 2
[37] Wallerstein 2005: 33/34
[38] Wallerstein 2005: 32: Die Bezeichnung Lateinamerika wurde 1899 von der katholischen Kirche geprägt, um die spanischsprachigen Länder sowie Brasilien als ehemaligen Kolonien Spaniens und Portugals auf dem amerikanischen Kontinent zu benennen.
[39] Morales 2002: 2; Stavans 2001: 23; Stavans 2001: 24: „[…] Hispanic meaning ‘citizen of Hispania’, the way the Romans addressed Spaniards […].“
[40] Cf. Stavans 2001: 25; Stößlein 2005: 44
[41] Stößlein 2005: 43
[42] Cf. Stößlein 2005: 46; Stavans 2001: 25.
Die Bezeichnung Latino und deren Plural Latinos wird in der vorliegenden Arbeit als geschlechtsneutraler Begriff verwendet und soll keineswegs den weiblichen Teil dieser Gemeinschaft diskriminieren.
[43] Lipski 2003: 231
[44] Zentella 1997: 5
[45] Morales 2002: 204; Stavans 2001: 44, 132
[46] Hidalgo 2001: 57/58
[47] Perissinotto 1992: 531b; Grosjean 1982: 49; v. Karte der US-Bundesstaaten im Anhang 1
[48] Zentella 1997: 272
[49] Berschin et al. 2005: 27
[50] Zentella 1997: 272
[51] Baetens Beardsmore 1982: 102: „[…] the cornerstone of much thinking in the field of bilingualism […].“
[52] Weinreich 1953: 1
[53] Silva-Corvalán 1995: 3
[54] Baetens Beardsmore 1982: 4, 31. Der Begriff des Bilingualismus wird zudem oft als Oberbegriff für Situationen gebraucht, in denen mehr als zwei Sprachen beteiligt sind, d.h. Multilingualismus.
[55] Silva-Corvalán 1995: 4; v. auch Li 2000: 25
[56] V. Silva-Corvalán 1994: 10/11
[57] Silva-Corvalán 1995: 4
[58] Baetens Beardsmore 1982: 2, 3
[59] Baetens Beardsmore 1982: 30
[60] V. Weinreich 1953: 1; Grosjean 1982: 341: „[…] [B]ilingualism is at the source of language borrowing. As long as languages continue to come into contact with one another, through individual bilinguals and in bilingual communities, they will not fail to influence one another. Language borrowing is the legacy of those who live with two languages.”
[61] Thomason 2001: 8
[62] Thomason 2001: 3; cf. auch Thomason 2001: 4: „Asymmetrical bilingualism is especially common when […] a subordinate bilingual group is shifting to the language of a monolingual dominant group.”
[63] Hornby 1977: 8/9: „When speakers of different languages come into contact for extended periods of time, significant changes in one or both of the language systems involved invariably result.”
[64] Milroy, Milroy 1997: 98; Appel, Muysken 1987: 40/41
[65] Thomason, Kaufman 1998: 47ff.
[66] Thomason 2001: 66
[67] Torres 1997: 64
[68] Thomason 2001: 9
[69] Lambert 1977: 18/19: Beim subtraktiven Bilingualismus werden sprachliche Minderheiten durch sozialen Druck und Sprachpolitik einer Gesellschaft gezwungen, ihre Herkunftssprache nach einer Übergangsphase für die Mehrheitssprache aufzugeben.
[70] Thomason, Kaufman 1988: 118: „’Prestige’ is a trait recognized by the fact that people behave as if they thought it was either useful or necessary to have some of it, i.e., by imitation.”
[71] Fishman 1975: 137, 139; Appel, Muysken 1987: 37ff.
[72] Hornby 1977: 4, Silva-Corvalán 1995: 4
[73] Baetens Beardsmore 1982: 47
[74] Fishman 1975: 136
[75] Cf. Appel, Muysken 1987: 20
[76] Stößlein 2005: 21: „Domänen sind bestimmte Bereiche, Kontexte bzw. settings in denen menschliche Interaktion stattfindet (z.B. Arbeitsplatz, Ausbildungsplatz, Familie, Kirche, Freizeit usw.).“
[77] Stößlein 2005: 63/64
[78] Appel, Muysken 1987: 83, 92
[79] Thomason, Kaufman 1988: 15
[80] Thomason, Kaufman 1988: 35
[81] Silva-Corvalán 1994: 6
[82] Silva-Corvalán 1994: 217
[83] Thomason, Kaufman 1988: 9
[84] Cf. Thomason Kaufman 1988: 63
[85] Baetens Beardsmore 1982: 47
[86] Li 2000: 25; Thomason 2000: 174
[87] Thomason 2001: 49
[88] Thomason 2001: 51; v. Bernal-Enríquez 2000: 125, 128. Die Frage, ob das Grenzalter des Erstspracherwerbs wirklich bei ca. 12 Jahren liegt, wird von Sprachwissenschaftlern sehr kontorvers diskutiert. Auf diese Diskussion soll hier nicht näher eingegangen werden.
[89] Bei bilingualen Sprechern werden die Elemente in der Sprache, die nicht der monoglotten Norm der jeweiligen Sprache angehören, als Interferenz bezeichnet. Die Interferenz wird durch den Kontakt zweier oder mehrerer Sprachen ausgelöst. Die weitere Diskussion dieses Begriffes erfolgt in Kapitel 3.1.
[90] Baetens Beardsmore 1982: 100, 103
[91] Baetens Beardsmore 1982: 100; Appel, Muysken 1987: 89/90, 95
[92] Cf. Silva-Corvalán 1994: 5
[93] V. Zentella 1997: 141ff.
[94] Baetens Beardsmore 1982: 9; id. 11: „For although many bilinguals’ performance in two languages may well differ distinctively from that of two separate monoglots in terms of the totality of the range of abilities, the bilingual may well achieve a similar, if different repertoire.”
[95] Hornby 1977: 3
[96] Baetens Beardsmore 1982: 8
[97] Baetens Beardsmore 1982: 10, 14
[98] Hornby 1977: 7: „Since bilingualism always occurs within some particular social setting, the potential effects that it will have on the individual may vary widely depending on the particular social significance and function of the two languages.”
[99] Appel, Muysken 1987: 1
[100] Baetens Beardsmore 1982: 4
[101] Baetens Beardsmore 1982: 4; Zentella 1997: 5
[102] Appel, Muysken 1987: 22/ 23
[103] Appel, Muysken 1987: 82
[104] Ferguson 1959: 75
[105] Ferguson 1959: 65; Hornby 1977, 7: „[…] [S]ocieties in which widespread bilingualism exists will tend to move toward diglossia and in almost all diglossic societies there will be some individuals who for economic, political, geographic, or other reasons will form a link between the two speech communities and hence will have to be bilingual.”
[106] Baetens Beardsmore 1982: 33; v. auch Ferguson 1959: 66
[107] Appel, Muysken 1987: 26
[108] Fishman 1967: 82ff.
[109] Grosjean 1982: 139
[110] V. Zentella 1997: 80
[111] Li 2000: 14, 24
[112] Fishman 1965: 89
[113] Fishman 1965: 90ff., 96ff.; Grosjean 1982: 136
[114] Grosjean 1982: 143
[115] Fishman 1965: 89
[116] Baetens Beardsmore 1982: 39
[117] Baetens Beardsmore 1982: 38; Zentella 1997: 182
[118] Baetens Beardsmore 1982: 40
[119] Grosjean 1982: 145
[120] Appel, Muysken 1987: 12
[121] Fishman 1985b: 70
[122] Fishman 1977: 16ff.
[123] Cafferty 2000: 71
[124] Bechert, Wildgen 1991: 60
[125] Bechert, Wildgen 1991: 4; Fishman 1977: 26/27; Cafferty 2000: 71; v. auch Kapitel 2.6.2 zum Sprachverlust.
[126] Appel, Muysken 1987: 114
[127] Stößlein 2005: 122
[128] Stößlein 2005: 123
[129] Fishman 1977: 25; Thomason 2001: 21
[130] Fishman 1977: 28; Appel, Muysken 1987: 11
[131] Fishman 1977: 33
[132] Appel, Muysken 1987: 114
[133] Appel, Muysken 1987: 145
[134] Grosjean 1982: 157
[135] Stößlein 2005: 126
[136] Grosjean 1982: 157
[137] Baetens Beardsmore 1982: 20; Grosjean 1982: 157
[138] Baetens Beardsmore 1982: 20
[139] Baetens Beardsmore 1982: 128; Lambert 1977: 18/19: Beim additiven Bilingualismus wird von einem Sprecher neben der schon vorhandenen Sprache noch eine weitere sozial vorteilhafte Sprache erlernt und erhalten.
[140] Baetens Beardsmore 1982: 130
[141] Grosjean 1982: 160
[142] Baetens Beardsmore 1982: 132
[143] Grosjean 1982: 162
[144] Grosjean 1982: 162; Appel, Muysken 1987: 42
[145] Appel, Muysken 1987: 41; Stößlein 2005: 183
[146] Thomason 1995: 16ff.
[147] Thomason 2001: 10
[148] Wildgen 2004: 16/17; Thomason, Kaufman 1988, 167: „[…] one important aspect of pidgin genesis: the process of linguistic negotiation by which members of the new contact community develop a common means of communication.“
[149] Appel, Muysken 1987: 175, Thomason 1995: 16, 22. Die Gegentheorie von Michel DeGraff zur Nicht-Einfachheit der Pidgins wird hier nicht betrachtet.
[150] Cf. Appel, Muysken 1987: 181
[151] Thomason, Kaufman 1988: 171
[152] V. Thomason, Kaufman 1988: 187f.
[153] Appel, Muysken 1987: 175
[154] Thomason, Kaufman 1988: 154
[155] Appel, Muysken 1987: 177/178
[156] Thomason 1995: 22, 28; Thomason, Kaufman 1988: 150: „[…] [P]rocess of abrupt creolization […]. In this process the emerging contact language at once becomes the primary language of the community and is learned as a first language (though not necessarily as their only first language) by any children born into the new multilingual community. That contact language therefore expands rapidly into a creole rather than stabilizing as a functionally and linguistically restricted pidgin […].”
[157] Thomason, Kaufman 1988: 150
[158] Thomason 1995: 16
[159] Matras, Bakker 2003: 1
[160] Matras, Bakker 2003: 4
[161] Sarhimaa 1999: 44; Thomason 2001: 5
[162] Stößlein 2005: 128
[163] Stößlein 2005: 128
[164] Thomason, Kaufman 1988: 113; Sarhimaa 1999: 145
[165] Fishman 1965: 101; Cf. auch Silva-Corvalán 1994: 202
[166] Fishman 1965: 100
[167] Grosjean 1982: 105
[168] Thomason 2001: 5ff.; Appel, Muysken 1987: 40/41
[169] Appel, Muysken 1987: 32, 41; Die Sprachverschiebung über mehrere Generationen hinweg wird in Kapitel 6 betrachtet.
[170] Sarhimaa 1999: 145
[171] Torres 1997: xv
[172] Thomason 2000: 178
[173] Appel, Muysken 1987: 33
[174] Appel, Muysken 1987: 43ff.
[175] Grosjean 1982: 108/109
[176] Grosjean 1982: 107ff.
[177] Appel, Muysken 1987: 36
[178] Lipski 2003: 232; Moore, Pachon 1985: 27
[179] Appel, Muysken 1987: 40; v. Torres 1997: 34
[180] Milroy, Li 1995: 138
[181] Milroy, Milroy 1985: 362ff.
[182] Milroy, Milroy 1985: 380
[183] Milroy, Milroy 1985: 364
[184] Milroy, Milroy 1985: 366
[185] Milroy, Milroy 1985: 368; v. auch Milroy, Milroy 1997; 76
[186] Milroy, Milroy 1997: 80
[187] V. dazu Kapitel 7
[188] Bernal-Enríquez 2000: 125, 128
[189] Grosjean 1982: 104
[190] Cf. Stößlein 2005: 120
[191] Krashen 2000: 438
[192] Grosjean 1982: 123/124; Zentella 1997: 212
[193] Grosjean 1982: 126
[194] Miltroy, Milroy 1997: 96/97
[195] Cf. Stößlein 2005: 172
[196] Lambert 1977: 16, 18; Krashen 2000: 440; Cafferty 2000: 83
[197] Appel, Muysken 1987: 112
[198] Appel, Muysken 1987: 113
[199] Appel, Muysken 1987: 62, 71
[200] Krashen 2000: 433
[201] Appel, Muysken 1987: 105
[202] Zentella 1997: 275; Lambert 1977: 24
[203] Appel, Muysken 1987: 105, 107
[204] Lambert 1977: 26; v. auch Cummins 1994: 171
[205] Zentella 1990b: 161
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836638487
- Dateigröße
- 5.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Philologie I, Vergleichende Sprachwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- spanglish spanisch-englisch mexikaner puerto ricaner
- Produktsicherheit
- Diplom.de