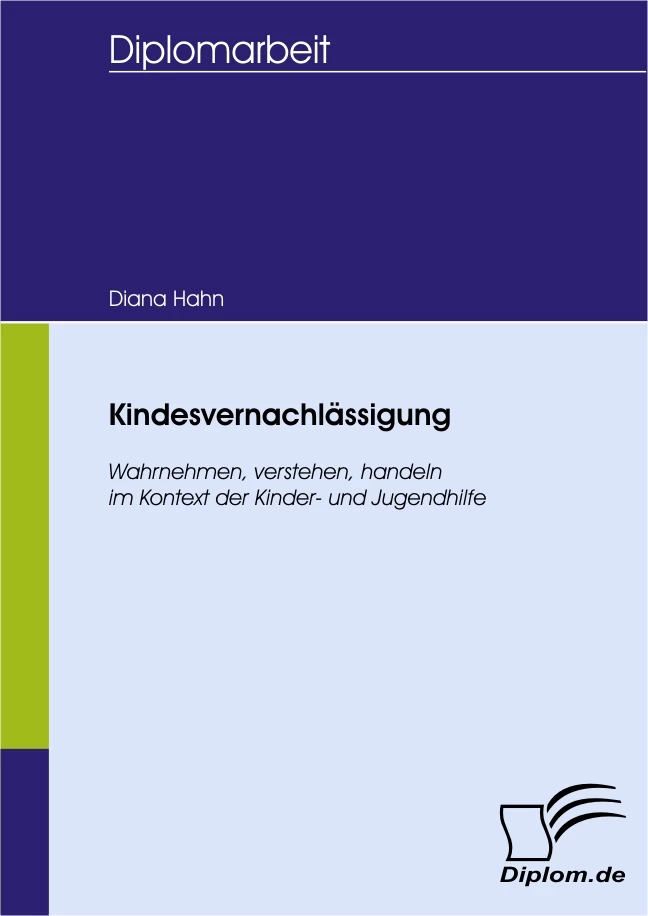Kindesvernachlässigung
Wahrnehmen, verstehen, handeln im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe
©2009
Diplomarbeit
161 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Köln, in einer eher bescheidenen Gegend ein 6-jähriger Junge afrikanischer Abstammung berichtet mit aufgerissenen Augen: Meine Mama ist bei der Polizei, sie hat geklaut eine Mitarbeiterin des Jugendamtes betrachtet den Jungen leichtes Untergewicht trockene und schürfende Hautstellen entzündliche Augenpartie diese traurigen und angsterfüllten Augen das Jäckchen, das ihn vor der winterlichen Witterung schützen sollte, ist über ein T-Shirt gesteift der Schieber des Reisverschlusses fehlt nackte Füße sind aus den mit Schnürsenkeln fehlenden Schuhen sichtbar Was passiert nun mit dem Jungen? Welche sozialpädagogische Diagnose wird gefällt? Ist es Kindesvernachlässigung oder liegt gar eine Kindeswohlgefährdung vor? Wie hätte man der Mutter helfen können? Wer war verantwortlich für die Familie und das Kind? Und wer ist es nun? Diese und viele weitere Fragen schwirren in den Köpfen der Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule. Nicht selten begegnen sie Kindern, dessen nicht nur äußeres Erscheinungsbild, sondern auch ihre soziale Umgänglichkeit, höchst bedenklich erscheint, doch ist es ein ausreichender Grund für die Annahme, dass das Kind in seinen Lebensbedürfnissen vernachlässigt wird oder ist es doch eine übliche und allgegenwärtige Folge der sozioökonomischen Gesamtsituation ärmliche Verhältnisse, alleinerziehende Mutter, fehlende familiäre und soziale Unterstützung?
Die Tatsache, dass eine Kindesvernachlässigung nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist auch noch nicht mal für den professionell Handelnden, stiftet Unsicherheiten im sozialpädagogischen Handeln. Merkmale, die eine Vernachlässigung aufzeigen können, gibt es (noch) nicht in ihrer Deutlichkeit und nicht in empirisch gesicherter Form. Doch aus den Erfahrungen der Praxis gibt es Anhaltspunkte, die vor allem, wenn diese gehäuft auftreten, ernstzunehmende Hinweise auf eine Kindesvernachlässigung geben können. Um einen zielsicheren Blick für Vernachlässigungsfälle zu entwickeln, Anhaltspunke rechtzeitig zu erkennen und richtig deuten zu können, soll diese Arbeit im ersten Schritt das Grundwissen über Kindesvernachlässigung vermitteln. Neben der Begriffbestimmung Kindesvernachlässigung und Erläuterung der einzelnen Kategorien, in der ein Kind unzureichend versorgt werden kann bzw. die Benennung der Lebensbedürfnisse, die erfüllt werden sollen, um eine gesunde Entwicklung der Kindes zu gewährleisten, werden auch die einzelnen Formen […]
Köln, in einer eher bescheidenen Gegend ein 6-jähriger Junge afrikanischer Abstammung berichtet mit aufgerissenen Augen: Meine Mama ist bei der Polizei, sie hat geklaut eine Mitarbeiterin des Jugendamtes betrachtet den Jungen leichtes Untergewicht trockene und schürfende Hautstellen entzündliche Augenpartie diese traurigen und angsterfüllten Augen das Jäckchen, das ihn vor der winterlichen Witterung schützen sollte, ist über ein T-Shirt gesteift der Schieber des Reisverschlusses fehlt nackte Füße sind aus den mit Schnürsenkeln fehlenden Schuhen sichtbar Was passiert nun mit dem Jungen? Welche sozialpädagogische Diagnose wird gefällt? Ist es Kindesvernachlässigung oder liegt gar eine Kindeswohlgefährdung vor? Wie hätte man der Mutter helfen können? Wer war verantwortlich für die Familie und das Kind? Und wer ist es nun? Diese und viele weitere Fragen schwirren in den Köpfen der Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule. Nicht selten begegnen sie Kindern, dessen nicht nur äußeres Erscheinungsbild, sondern auch ihre soziale Umgänglichkeit, höchst bedenklich erscheint, doch ist es ein ausreichender Grund für die Annahme, dass das Kind in seinen Lebensbedürfnissen vernachlässigt wird oder ist es doch eine übliche und allgegenwärtige Folge der sozioökonomischen Gesamtsituation ärmliche Verhältnisse, alleinerziehende Mutter, fehlende familiäre und soziale Unterstützung?
Die Tatsache, dass eine Kindesvernachlässigung nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist auch noch nicht mal für den professionell Handelnden, stiftet Unsicherheiten im sozialpädagogischen Handeln. Merkmale, die eine Vernachlässigung aufzeigen können, gibt es (noch) nicht in ihrer Deutlichkeit und nicht in empirisch gesicherter Form. Doch aus den Erfahrungen der Praxis gibt es Anhaltspunkte, die vor allem, wenn diese gehäuft auftreten, ernstzunehmende Hinweise auf eine Kindesvernachlässigung geben können. Um einen zielsicheren Blick für Vernachlässigungsfälle zu entwickeln, Anhaltspunke rechtzeitig zu erkennen und richtig deuten zu können, soll diese Arbeit im ersten Schritt das Grundwissen über Kindesvernachlässigung vermitteln. Neben der Begriffbestimmung Kindesvernachlässigung und Erläuterung der einzelnen Kategorien, in der ein Kind unzureichend versorgt werden kann bzw. die Benennung der Lebensbedürfnisse, die erfüllt werden sollen, um eine gesunde Entwicklung der Kindes zu gewährleisten, werden auch die einzelnen Formen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Diana Hahn
Kindesvernachlässigung
Wahrnehmen, verstehen, handeln im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe
ISBN: 978-3-8366-4168-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Fachhochschule Köln, Köln, Deutschland, Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Inhaltsverzeichnis
2
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... 2
Abbildungsverzeichnis... 5
Tabellenverzeichnis ... 5
Abkürzungsverzeichnis ... 6
Einleitung... 8
1
Begriffsbestimmung ... 10
2
Lebensbedürfnisse eines Kindes... 12
3
Formen von Vernachlässigung... 16
3.1 Körperliche
Vernachlässigung ... 17
3.2
Kognitive und erzieherische Vernachlässigung ... 18
3.3
Sozial emotionale Vernachlässigung... 19
4
Risikofaktoren für eine Gefährdungslage ... 24
4.1 Persönliche
Faktoren
der Erziehungsperson ... 26
4.1.1 Eigene negative Kindheitserlebnisse... 26
4.1.2 Persönlichkeitsmerkmale... 27
4.1.3 Chronische
Erkrankungen ... 28
4.2
Risikofaktoren des Kindes... 29
4.3 Familiärer
Risikofaktoren... 31
4.4 Sozioökonomische
Situation ... 35
5
Mögliche Folgen von Vernachlässigung ... 39
5.1 Körperliche
Symptome
und Fehlentwicklungen ... 39
5.2 Kognitive
Fehlentwicklungen ... 41
5.3
Psychosoziale Schäden und Fehlentwicklungen ... 41
6
Interventionsmöglichkeiten und ihre rechtlichen Grundlagen... 44
6.1 Finanzielle
und
materielle
Hilfen ... 44
6.2
Leistungen und Aufgaben der Jugendhilfe... 47
6.2.1 Hilfeplanung ... 48
6.2.2 Ambulante
Hilfen ... 48
6.2.3 Anrufung des Gerichts... 50
6.2.4 Inobhutnahme
und
Fremdunterbringung... 51
Inhaltsverzeichnis
3
7
Gesetznovellierungen und politische Maßnahmen... 52
7.1
Gesetzliche Regelungen und Gesetznovellierungen im Bereich des
Kinderschutzes auf Bundesebene ... 52
7.2
Landesgesetzliche Regelungen in Bereich des Kinderschutzes und der
Gesundheitsvorsorge ... 54
7.2.1 Basiselement:
kinderärztliche Früherkennungsuntersuchungen ... 55
7.2.2 Weitere
länderspezifische
Maßnahmen zur Qualifizierung des
Kinderschutzes ... 60
7.2.3 Meldesysteme:
Datenweitergabe an die Jugendämter... 66
8
Handeln in der Sozialen Arbeit methodische Herangehensweise
sozialpädagogischer Fachkräfte ... 68
8.1 Umgang
mit
(Fremd-)Meldung ... 68
8.2
Systemische Informationssammlung und Verarbeitung... 71
8.3 Kontaktaufnahme
und
Datenrekonstruktion... 75
8.4
Einschätzung und Bewertung der Fallsituation... 81
8.5
Fachliche Diagnose und Umsetzung sozialpädagogischer Hilfs- und
Interventionsstrategien ... 84
8.6
Bewertung der Hilfe- und Veränderungsprozesse... 88
Ausblick ... 91
Literaturverzeichnis ... 93
Anhang... 97
Anlage I Rechtliche Grundlage... 97
Anlage II Abbildungen ... 101
Anlage III Auszug aus ICD-10 Internationale Klassifikation der Krankheiten
(WHO-Version 2006)... 102
Anlage IV Früherkennungsuntersuchungen für Kinder (U1 J1) ... 104
Anlage V Übersicht zu den landesgesetzlichen Regelungen im Bereich
Kinderschutz bzw. Gesundheitsvorsorge ... 106
Anlage VI - Genogramme... 118
Anlage VII Prüfbögen... 120
Meldebogen ,,Kindeswohlgefährdung" ... 120
Prüfbogen / Einordnungsschema ,,Erfüllung kindlicher Bedürfnisse" ... 126
Einschätzung des Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisikos ... 127
Einschätzung des Förderungsbedarfs des Kindes... 131
Einschätzung der Ressourcen des Kindes... 134
Einschätzung der Veränderungsfähigkeit der Eltern ... 136
Pflege und Versorgung ... 139
Inhaltsverzeichnis
4
Bindung... 141
Regeln und Werte ... 144
Förderung... 147
Anlage VIII Schutzplan ... 148
Anlage IX Erstellung des Hilfeplans ... 151
Anlage X Fortschreibung des Hilfeplans... 156
Abbildungsverzeichnis
5
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Möglichkeit einer Vernachlässigung in folgenden Kategorien ... 11
Abbildung 2: Bedürfnispyramide nach Maslow ... 13
Abbildung 3: Risikofaktoren der Vernachlässigung von Kindern... 24
Abbildung 4: Kindliche Lebensbedürfnisse und deren Mangelerscheinungen ... 43
Abbildung 5: Beteiligte und Stationen des Meldeverfahrens... 58
Abbildung 6: Netzwerkkarte ... 75
Abbildung 7: Belastungen allein erziehender Mütter ... 101
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Formen von Vernachlässigung ... 16
Tabelle 2: Gesellschaftliche und psychische Risikofaktoren ... 25
Tabelle 3: Gedanken und Gefühle vernachlässigter Eltern... 27
Tabelle 4: Risikofaktoren Hinweise für die Praxis... 38
Tabelle 5: Ressourcenkarte... 74
Tabelle 6: Beispielhafte Fragen an die Familie zur Abklärung von
Kindesvernachlässigung ... 80
Tabelle 7: Fragen zur eigenen Bewertung... 83
Abkürzungsverzeichnis
6
Abkürzungsverzeichnis
Abs. Absatz
AO Anordnung
Art.
Artikel
ASD
Allgemeiner Sozialer Dienst
BAföG Bundesausbildungsförderungsgesetz
BEEG
Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit
BGB Bürgerliches
Gesetzbuch
BKGG Bundeskindergeldgesetz
d.h. das
heißt
Dipl. Päd.
Diplom Pädagoge/in
einstw. einstweilige
EBst Erziehungsbeistandschaft
EStG
Einkommenssteuergesetz
etc. et
cetera (lat), und so weiter
e.V.
eingetragener Verein
evtl.
eventuell
FamG Familiengericht
gem. gemäß
GG Grundgesetz
ggf. gegebenenfalls
ggü. gegenüber
i.V.m.
in Verbindung mit
JA Jugendamt
JGG Jugendgerichtsgesetz
KJHG
Kinder- Jugendhilfegesetz
LIGA
Landesinstitut für Gesundheit und Arbeit
LSJV
Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung
MuSchG Mutterschutzgesetz
Abkürzungsverzeichnis
7
NRW Nordrhein-Westfalen
o.a.
oder
andere[s]
o.ä. oder
ähnliche[s]
PSB Personensorgeberechtigte
SGB Sozialgesetzbuch
spFH
sozialpädagogische Familienhilfe
UKRK
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes
u.s.w. und
so
weiter
UTeilnahmeDatVO
Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüher-
kennungsuntersuchungen/U-Untersuchungen
UVG Unterhaltsvorschussgesetz
WoGG Wohngeldgesetz
z.B. zum
Beispiel
Einleitung
8
Einleitung
... Köln, in einer eher bescheidenen Gegend ein 6-jähriger Junge afrikanischer Ab-
stammung berichtet mit aufgerissenen Augen: ,,Meine Mama ist bei der Polizei, sie hat
geklaut..." eine Mitarbeiterin des Jugendamtes betrachtet den Jungen leichtes Unterge-
wicht trockene und schürfende Hautstellen entzündliche Augenpartie diese traurigen
und angsterfüllten Augen das Jäckchen, das ihn vor der winterlichen Witterung schützen
sollte, ist über ein T-Shirt gesteift der Schieber des Reisverschlusses fehlt nackte Füße
sind aus den mit Schnürsenkeln fehlenden Schuhen sichtbar Was passiert nun mit dem
Jungen? Welche sozialpädagogische Diagnose wird gefällt? Ist es Kindesvernachlässigung
oder liegt gar eine Kindeswohlgefährdung vor? Wie hätte man der Mutter helfen können?
Wer war verantwortlich für die Familie und das Kind? Und wer ist es nun? Diese und viele
weitere Fragen schwirren in den Köpfen der Mitarbeiter der Offenen Ganztagsschule. Nicht
selten begegnen sie Kindern, dessen nicht nur äußeres Erscheinungsbild, sondern auch ihre
soziale Umgänglichkeit, höchst bedenklich erscheint, doch ist es ein ausreichender Grund
für die Annahme, dass das Kind in seinen Lebensbedürfnissen vernachlässigt wird oder ist
es doch eine übliche und allgegenwärtige Folge der sozioökonomischen Gesamtsituation
ärmliche Verhältnisse, alleinerziehende Mutter, fehlende familiäre und soziale Unterstüt-
zung?
Die Tatsache, dass eine Kindesvernachlässigung nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist
auch noch nicht mal für den professionell Handelnden, stiftet Unsicherheiten im sozialpä-
dagogischen Handeln. Merkmale, die eine Vernachlässigung aufzeigen können, gibt es
(noch) nicht in ihrer Deutlichkeit und nicht in empirisch gesicherter Form. Doch aus den
Erfahrungen der Praxis gibt es Anhaltspunkte, die vor allem, wenn diese gehäuft auftreten,
ernstzunehmende Hinweise auf eine Kindesvernachlässigung geben können. Um einen ziel-
sicheren Blick für Vernachlässigungsfälle zu entwickeln, Anhaltspunke rechtzeitig zu er-
kennen und richtig deuten zu können, soll diese Arbeit im ersten Schritt das Grundwissen
über Kindesvernachlässigung vermitteln. Neben der Begriffbestimmung ,,Kindesvernach-
lässigung" und Erläuterung der einzelnen Kategorien, in der ein Kind unzureichend versorgt
werden kann bzw. die Benennung der Lebensbedürfnisse, die erfüllt werden sollen, um eine
gesunde Entwicklung der Kindes zu gewährleisten, werden auch die einzelne Formen von
Vernachlässigungen benannt.
Die in darauffolgendem Kapitel genannte Risikofaktoren und anschließende Aufarbeitung
möglicher Folgen können bei der Urteilsbildung, ob eine Gefährdungslage eines Kindes
gegeben ist, eine entscheidende Rolle übernehmen. Denn Erkennungszeichen spiegeln sich
nicht nur im unmittelbaren Verhalten (Agieren und Reagieren) der Eltern und des Kindes
wieder, sondern auch in der Gegebenheit bestimmter Merkmale von Personen, Situationen
oder Beziehungen, die eine Vernachlässigung noch wahrscheinlicher machen. Zu Folgen
sollte es im Idealfall nicht kommen, doch deren Eintreten und Erkennbarkeit kann ein letz-
Einleitung
9
ter Hinweis, ein letztes Signal für physische und/oder psychische Unterversorgung des Kin-
des sein.
Doch auch wenn Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung an Deutlichkeit, familiäre Prob-
leme an mehr Transparenz, gewinnen und alles als offensichtlich erscheint, wissen viele
Sozialpädagogen und -arbeiter nicht damit fachkompetent umzugehen. Ungeklärte Fragen
und Wissenslücken in Bezug auf Handlungsbefugnis, aktueller Gesetzeslage, Präventions-
und Interventionsmöglichkeiten und effiziente Umsetzbarkeit verhindern ein offensives
Herantreten der Fachkräfte an die Betroffenen. Wo doch gerade nicht nur das Erkennen der
Problematik, sondern viel mehr die Beratung bzw. die darauffolgenden adäquaten Hilfen
ausschlaggebend für eine gelungene Sozialarbeit ist.
In Anschluss an die Auflistung staatlicher Interventionsmöglichkeiten, die zum einen aus
finanziell-materiellen Hilfen und zum anderen aus Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
bestehen, folgt eine Zusammenfassung der (vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen)
politischen Maßnahmen auf Bundes- und Länderebene im Bereich des Kinderschutzes. Eine
effektive Hilfe setze jedoch nicht nur gute theoretische Fachkenntnisse über das aktuelle
Rechtssystem und Handlungsabläufe bei Kindesvernachlässigungsfällen voraus, auch eine
sicher gehandhabte praktische Ausgestaltung ist ein wesentlicher Teil davon. Schwerpunkt
dieser Arbeit ist das Handeln in der Sozialen Arbeit, das kleinschrittige Verfahren bei An-
haltspunkten einer Kindesvernachlässigung mit sozialpädagogischen Methoden und Tech-
niken. In diesem Teil der Arbeit, wird jeder notwendige Arbeitsschritt in seinem gesamten
Umfang erläutert mit Hinweisen und Ratschlägen und unter Einbezug hilfreicher Metho-
den und Instrumente.
1 Begriffsbestimmung
10
1 Begriffsbestimmung
Kindesvernachlässigung ist eine Form von Kindeswohlgefährdung. In §1666 Abs. 1 BGB
wird Vernachlässigung ausdrücklich als eigenständiges Bestandsmerkmal einer Kindes-
wohlgefährdung genannt.
Die Gefährdung des Kindeswohls wird, ,,in Anlehnung an Garbarino und Gilliam (1980)
grundlegend danach unterschieden, ob die Gefahr von bestimmten Handlungen der Betreu-
ungspersonen oder vom Unterlassen bestimmter Handlungen durch die Betreuungspersonen
ausgeht, so bezeichnet der Begriff der Vernachlässigung das gesamte Spektrum relevanter
Unterlassungen. Entsprechend definieren im deutschsprachigen Raum etwa Schone et al.
(1997)
1
Vernachlässigung als
'
andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen
Handelns sorgeverantwortlicher Personen (Eltern oder andere von ihnen autorisierte Betreu-
ungspersonen), welches zur Sicherstellung der physischen und psychischen Versorgung des
Kindes notwendig wäre
'."
2
Die Unterlassung vorsorglichen Handels sorgeverantwortlicher Personen zeichnet sich bei
dem betroffenen Kind in erster Form der chronischen Unterernährung, unzulänglicher Be-
kleidung, mangelnde Versorgung und Pflege, fehlender Gesundheitsvorsorge, unbehandel-
ten Krankheiten und fehlender Schutz vor Gefahren aus.
3
Schone at al. (1997) führen in der Definition weiter aus: Die Unterlassung kann aktiv oder
passiv (unbewusst) aufgrund unzureichender Einsicht oder unzureichenden Wissen erfol-
gen.
4
Die durch Vernachlässigung bewirkte chronische Unterversorgung des Kindes durch
die nachhaltige Nichtberücksichtigung, Missachtung oder Versagung seiner Lebensbedürf-
nisse hemmt, beeinträchtigt oder schädigt seine körperliche, geistige und seelische Entwick-
lung und kann zu gravierenden bleibenden Schäden oder gar zum Tode des Kindes führen.
In der nachfolgenden Abbildung wird dargestellt in welchen Bereichen es zu Vernachlässi-
gung kommen kann. In Umkehrschluss zeigt das Bild, welche Aspekte zu beachten sind,
um eine erfolgreiche Versorgung und Erziehung eines Kindes zu gewährleisten.
1
Die von Schone et al. vorgelegte Definition wird in einer Vielzahl deutschsprachiger Publikationen aufgegrif-
fen (z.B. Münder et al. 2000; Kinderschutzbund-NRW 2006).
2
Vgl. Reinhold/ Kindler o.J.
3
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2006, 8
4
Siehe dazu Kapitel 3, S. 16
1 Begriffsbestimmung
11
Abbildung 1
: Möglichkeit einer Vernachlässigung in folgenden Kategorien
(Quelle: Kin-
derschutzbund-NRW 2006, 14)
2 Lebensbedürfnisse eines Kindes
12
2 Lebensbedürfnisse
eines
Kindes
Das Recht des Kindes auf eine individuelle, personelle und soziale Entwicklung, einer ge-
waltfreien, sowie fürsorglichen Erziehung ist in Rahmen der UN-Konvention und weiteren
Gesetzgebungen auf nationaler Ebene geschützt.
Der Art. 3 UKRK (UN- Konvention über die Rechte der Kinder) verpflichtet den Staat, dem
Kind Schutz und Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind.
Der Art. 19 UKRK besagt, dass alle nötigen Maßnahmen zu treffen sind, um das Kind vor
jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Miss-
handlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder
Ausbeutung einschließlich des sexuellen Missbrauchs zu schützen.
Der § 1631 Abs. 1 BGB (Inhalt und Grenzen der Personensorge) definiert die (elterliche)
Personensorge als die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsich-
tigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen. Der Abs. 2 verdeutlicht das Recht der Kinder
auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere
entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig und werden strafrechtlich verfolgt.
Der Artikel 6 Abs. 2 GG und § 1 Abs. 2 SGB VIII verdeutlicht, dass die Pflege und Erzie-
hung der Kinder das natürliche Recht der Eltern ist und vor allem die ihnen obliegende
Pflicht.
Weitere rechtliche Regelungen, die im thematischen Zusammenhang stehen, sind in der
Anlage 1, S. 97 zu finden.
Die genannte rechtliche Grundlage definiert nur ansatzweise was vonnöten ist, damit Kin-
der zu verantwortungsvollen, selbständigen und gemeinschaftlichen Persönlichkeiten he-
ranwachsen. Zur Konkretisierung der tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder sind die Er-
kenntnisse der Entwicklungspsychologie hilfreich. Demnach gehören zu den elementaren
Grundbedürfnissen der Kinder:
· körperliche Bedürfnisse: Essen, Trinken, Ausscheidungen, Schlaf, Wach-Ruhe-
Rhythmus, Zärtlichkeit, Körperkontakt etc.
· Schutzbedürfnisse: Schutz vor Gefahren, Krankheiten, vor Unbilden des Wetters,
vor materiellen Unsicherheiten etc.
· Bedürfnisse nach einfühlendem Verständnis und sozialer Bindung: Dialog und Ver-
ständigung (verbal und nonverbal), Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, Familie
etc.
· Bedürfnisse nach Wertschätzung: bedingungslose Anerkennung als seelisch und
körperlich wertvoller Mensch, seelische Zärtlichkeit, Unterstützung der aktiven
Liebesfähigkeit, Anerkennung als autonomes Wesen etc.
2 Lebensbedürfnisse eines Kindes
13
· Bedürfnisse nach Anregung, Spiel und Leistung: Förderung der natürlichen Neu-
gierde, Anregungen und Anforderungen, Unterstützung beim Erleben und Erfor-
schen der Umwelt etc.
· Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung: Unterstützung bei der Bewältigung von Le-
bensängsten, Entwicklung eines Selbstkonzeptes, Unterstützung der eigenständigen
Durchsetzung von Bedürfnissen und Zielen, Bewusstseinsentwicklung etc.
5
Die genannten Grundbedürfnisse sind Inhalt der Maslowschen Bedürfnispyramide (siehe
dazu Abbildung 2), die im Jahre 1943 veröffentlicht wurde. Das Modell dient dazu die Mo-
tivation des Menschen (hier: Kind) zu beschreiben.
Die Maslowsche Theorie besagt, dass zuerst das Bedürfnis der niedrigsten Stufe bis zu ei-
nem gewissen Maß befriedigt werden muss, damit sich bei dem Kind überhaupt ein Interes-
se für die nächste Bedürfnisebene entsteht.
6
So gelingt es einer Mutter, zum Beispiel, kaum
einen hungrigen Säugling durch Ablenkung und Spiel zufrieden zu stellen.
Abbildung 2
: Bedürfnispyramide nach Maslow
(Quelle: Kinderschutzbund-NRW 2006, 20)
5
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2006, 19
6
Vgl. ebd. Kinderschutzbund-NRW 2006; vgl. auch Gerrig/Zimbardo 2008, 420-422
Je früher die Vernachlässigung stattfindet, d.h. je niedriger die unbefriedigten Bedürfnisse
in der Hierarchie der Bedürfnispyramide angesiedelt sind, desto schwerwiegender sind die
zutragenden Schäden bei dem Kind.
7
Daher ist grundsätzlich Achtung geboten, wenn die
Eltern den Verpflichtungen zur Befriedigung der 1. und 2. Stufe der Bedürfnispyramide in
Form von Nahrungszufuhr, Pflege und ausreichenden Schutz nicht sorgfältig nachkommen,
so kann es im schlimmsten Fall sogar zum Tode des Kindes führen.
8
Je höher die Bedürfnisstufe ist und/oder je mehr Ebenen vernachlässigt werden, desto viel
höher liegt die Gefahr einer (zusätzlich) seelischen und psychischen Beeinträchtigung.
9
Bei
der Erfüllung der kindlichen Bedürfnisse, ab der dritten Ebene, ist seitens der Eltern eine
emotionale Standfestigkeit, vermehrte Zuwendung, Aufmerksamkeit und Liebe erforder-
lich. Damit steigt zusätzlich die Anforderung, wie auch die Gefahr einer Überforderung der
Eltern.
A. Werner (o.J.) beschreibt in ihrem Beitrag
10
, dass die einzelnen Bedürfnisse einen wech-
selseitigen Einfluss auf einander haben. ,,Die Grundbedürfnisse stehen miteinander in Zu-
sammenhang und sind in ihrer Wirkung voneinander abhängig. Sie können als gleichwertig
und grundlegend angesehen werden". So bildet zum Beispiel ein Säugling in den ersten
Lebensjahren eine starke emotionale Bindung zu einer Person, meistens der Mutter, die
seine körperlichen und psychischen Bedürfnisse regelmäßig befriedigt, d.h. die ersten zwei
Ebenen hatten einen Einfluss auf die Entfaltung der dritten Ebene, Ebene der sozialen Bin-
dung. Durch die bereits von Erfahrung geprägte Beziehung zu der Bindungsperson, weiß
das Kind, dass es nun bei physischen Bedürfnissen, sowie bei Gefahr und Schmerz bei der
Bezugsperson Sorge und Schutz finden kann, d.h. es findet eine wechselseitige Wirkung der
dritten Ebene zu der ersten und zweiten Ebene statt.
Das Bedürfnis nach sozialer Bindung
11
und Verständnis ,,...wird grundlegend durch das
Heranwachsen des Kindes in einer beständigen und liebevollen Beziehung zu mindestens
einer Bezugsperson erfüllt einer Beziehung, die sich durch Nähe, Empathie, Verfügbar-
keit und Verlässlichkeit der Bezugsperson(en) auszeichnet."
12
Das Bedürfnis nach sozialer Bindung und Verbundenheit, nach A. Werner (o.J.), weist die
gleichen inhaltlichen Aspekte auf, wie die dritte Ebene der Maslowschen Bedürfnispyrami-
de das Bedürfnis nach Verständnis und sozialer Bindung und zusätzlich noch die vierte
Ebene, nämlich das Bedürfnis nach seelischer und körperlicher Wertschätzung. Daran lässt
sich erkennt in welchen engen Zusammenhang diese beiden Ebenen zueinander stehen. Es
scheint nicht nur ausreichend zu sein zu einer stabilen und unterstützenden Familie zugehö-
7
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2006, 21
8
Vgl. dazu Kapitel 5.1, S. 39
9
Vgl. dazu Kapitel 5.3, S. 41
10
Siehe Werner o.J.
11
Siehe dazu Kapitel 3.3, S. 21
12
Vgl. Werner o.J.
2 Lebensbedürfnisse eines Kindes
15
ren, zuverlässige Bezugs- und Bindungspersonen zu haben, sondern viel mehr den wert-
schätzenden und anerkennenden Umgang der Bindungspersonen zu erfahren.
Die fünfte Ebene ,,Das Bedürfnis nach Anregung, Spiel und Leistung" ist altersspezifisch
ausgeprägt und benötigt unterschiedlichste Formen der Förderung. Der Wissens- und For-
schungsdrang entwickelt sich schon im Säuglingsalter. Für eine gesunde Entwicklung be-
dürfen diese eine anregungsreiche materielle (z.B. Spielzeug, Mobile etc.) und soziale Um-
welt, jedoch sowohl ständige Über- als auch Unterforderung können sich negativ auf die
kindliche Entwicklung auswirken.
13
Die letzte Ebene der Bedürfnispyramide, nämlich das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung,
kann erst erreicht werden, wenn alle grundlegenden Bedürfnisse verwirklicht worden sind.
Das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung versteht man auch als das Bedürfnis nach Auto-
nomie. Die Entwicklungspsychologie bezeichnet die Erfüllung dieser Bedürfnisebene als
einen erfolgreichen Ablösungsprozess von dem Erziehenden. Das Kind wird in dieser Phase
der Entwicklung zu einer eigenständigen Person, das autonom handeln kann, d.h. es trifft
Entscheidungen ohne jeglichen Fremdeinfluss, plant und gestaltet sein Leben frei nach sei-
nen Vorstellungen und Wünschen.
13
Vgl.
Werner o.J.
3 Formen von Vernachlässigung
16
3 Formen
von
Vernachlässigung
Wie im vorherigen Kapitel aufgeführt wurde, haben Kinder zu einem gegebenen Alterszeit-
punkt in den jeweiligen Entwicklungs- und Lebensbereichen unterschiedlich ausgeprägte
Bedürfnisse, die von A. Maslow in sechs verschiedene Ebenen kategorisiert worden sind.
Auf jeder dieser Ebenen kann eine Vernachlässigung stattfinden, daher wird von zahlrei-
chen Theoretikern versucht die jeweiligen Formen von Vernachlässigung sinngemäß zu
klassifizieren, jedoch hat sich bis jetzt keine einheitliche Struktur der Kategorisierung her-
ausgebildet. Beim Vergleich zahlreicher Publikationen von unterschiedlichsten Autoren
zum Thema ,,Formen von Vernachlässigung" sind wesentliche Übereinstimmungen zu er-
kennen.
14
So lässt sich Vernachlässigung in drei wesentliche Unterformen unterteilen:
körperliche Vernachlässigung
z.B. unzureichende Versorgung mit Nah-
rung, Flüssigkeit, (sauberer) Kleidung, Hy-
giene, Wohnraum und medizinischer Ver-
sorgung.
kognitive und erzieherische Vernachlässi-
gung
z.B. Mangel an Konversation, Spiel und
anregenden Erfahrungen; fehlende erziehe-
rische Einflussnahme auf einen unregelmä-
ßigen Schulbesuch, Delinquenz oder Sucht-
mittelgebrauch des Kindes; fehlende Beach-
tung eines besonderen und erheblichen Er-
ziehungs- oder Förderbedarfs
sozial emotionale Vernachlässigung
z.B. Mangel an Wärme in der Beziehung
zum Kind, fehlende Reaktion auf emotiona-
le Signale des Kindes.
Tabelle 1:
Formen von Vernachlässigung (eigene Darstellung)
Wie vorhin kurz im Kapitel 1 (S. 10) aufgegriffen, gibt es eine passive und aktive Form von
Vernachlässigung.
15
Passive Vernachlässigung entsteht aus mangelnder Einsicht, eventuell
auch aus mangelnder (Grund-)Kenntnis, Nichterkennen von Bedarfssituationen (Wahrneh-
mungsstörung) oder unzureichenden Handlungsmöglichkeiten der sorgeberechtigten Perso-
nen (z. B. Alleinlassen des Kindes über eine unangemessen lange Zeit, Vergessen von
notwendigen Versorgungsleistungen, unzureichende Pflege, Mangelernährung etc.). Als
14
Z.B. Kindler et al. 2006/ Gellert 2007/ Kinderschutzbund-NRW 2007
15
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2007, 15-16
3 Formen von Vernachlässigung
17
aktive Vernachlässigung ist die absichtliche Verweigerung von Handlungen anzusehen, (z.
B. Verweigerung von Versorgung, Körperhygiene, Nahrung, Schutz, Zuneigung, Anerken-
nung etc.). In der Praxis lässt es sich nur schwer beurteilen, ob es sich um eine passive oder
aktive Vernachlässigung handelt.
16
Jedoch ist es für die Handlungsstrategien der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe von großer Bedeutung, ob die Vernachlässigung ein Resultat von
Überforderung und Nichtwissen ist, oder ob Eltern die Vernachlässigung erkennen und
trotzdem keine Abhilfe schaffen, bzw. sie im Extremfall sogar bewusst herbeiführen. Denn
nur eine richtige Einschätzung der familiären Situation ermöglicht eine angemessene und
zugeschnittene Hilfeleistung mit erfolgreichen Ergebnissen.
3.1 Körperliche Vernachlässigung
Körperliche Vernachlässigung findet in Form von Unterernährung, fehlender Hygiene,
mangelnder medizinischer Versorgung und einer Vernachlässigung schon während der
Schwangerschaft und Geburt statt.
Unterernährung und fehlende Hygiene ist die häufigste Form von körperlicher Vernachläs-
sigung.
17
Nicht ausreichende, dem Alter entsprechend angepasste Nahrung- und Flüssig-
keitszufuhr oder auch mangelhafte und unangebrachte Ernährung, wie beispielsweise bei
Allergikern, ebenso wie fehlende Hygiene schwächen das Immunsystem des Kindes und
machen es anfälliger für Krankheiten. Und gerade in solchen Fällen ist eine medizinische
Versorgung von Nöten, wobei dieser Verpflichtung oftmals nicht nachgegangen wird.
Eine Vernachlässigung kann schon bei einem ungeborenen Kind bzw. Fötus beginnen.
18
Wenn während der Schwangerschaft das Konsumverhalten von Zigaretten, Alkohol und
sonstigen Drogen nicht eingestellt oder zumindest verringert wird und somit das Kind einer
höheren Gefahr einer Schädigung und abnormer Entwicklung aussetzt, so ist es ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass die eigenen Bedürfnisse der Mutter über den Bedürfnisse des Kin-
des stehen und so auch das Wohlergehen und der Schutz des Kindes von geringschätzender
Bedeutung ist. Nicht nur das wissentliche Aussetzen des Kindes einer zusätzlichen Gefahr
durch Konsumverhalten, auch die Form einer Unterlassung medizinischer Versorgung in-
nerhalb der Schwangerschaft können negative Folgen für das Kind haben. Denn das Fehlen
von notwendigen Medikamenten und Vorsorgeuntersuchungen kann Störrungen und Defizi-
te beim Fötus bzw. Kind hervorrufen. Auch eine Geburt außerhalb vorgesehener und pro-
fessionell überwachter Unterbringung kann aufgrund mangelnder ärztlicher Kontrolle wäh-
rend der Geburt und mangelnde Erstversorgung des Kindes nach der Geburt als körperliche
Vernachlässigung definiert werden.
16
Kinderschutzbund-NRW 2007, 16
17
Vgl. Gellert 2007, 13
18
Vgl. ebd. Gellert 2007, 14
3 Formen von Vernachlässigung
18
3.2 Kognitive und erzieherische Vernachlässigung
Die kognitive und erzieherische Vernachlässigung wird hier in vier Themenbereiche kate-
gorisiert: fehlende Grenzen und Strukturen, mangelnde kognitive Förderung, mangelnde
Beaufsichtigung und Parentifizierung der Kinder.
Kinder brauchen für ihre gesunde Entwicklung von den Eltern gesetzte Grenzen und vorge-
lebte Strukturen, denn in Laufe der Entwicklung werden die fremdgesetzte Verhaltensvor-
gaben und Strukturen zu einem autonomen inneren Wertesystem des Kindes.
19
Geben die
Eltern den Kindern keine Orientierung, weder als Person (Grenzen angeben, Konsequenzen
aussprechen) noch durch geregelte Tages- und Alttagsstrukturen, so fehlt dem Kind ein
Orientierungsrahmen, der für eine gesunde Entwicklung notwendig ist. Dieses führt dazu,
dass sie keine Möglichkeit erhalten einen geregelten Tagesablauf zu erfahren und zu erler-
nen. Häufig entwickeln diese Kinder ein mangelndes Gefühl für Verlässlichkeit. Die Kinder
können sich beispielsweise nicht darauf verlassen, dass sie von ihren Eltern nach der Schu-
le/ Kindergarten erwartet werden, dass eine warme Mahlzeit zubereitet ist, dass sie jemand
bei den Hausaufgaben anleitet oder ihnen angibt wann sie zu Bett gehen sollen. Die Kinder
sind meist auf sich allein gestellt, wo doch eine Orientierungsperson in der Entwicklungs-
phase eines Kindes notwendig ist. Die Eltern haben nicht nur die Verantwortung dem Kind
eine Tagesstruktur und gewisse Verhaltensregeln anzugeben, wichtig ist auch auf die Ein-
haltung dieser Vorgaben zu achten und notfalls Grenzen zu setzten bzw. Konsequenzen
aussprechen. Wird das von den Eltern nicht erfüllt, so ist eine erfolgreiche/notwendige Er-
ziehung nicht gewährleistet. Somit steigt das Risiko, dass das Kind als Folge der erzieheri-
schen Vernachlässigung des Öfteren zu Abweichungen im Sozialverhalten neigt. Doch eine
erzieherische Vernachlässigung in Form von mangelnder Grenzsetzung, Problembagatelli-
sierung, mangelnde Aufmerksamkeit oder Interesse, kann sich auch in späteren Jahren aus-
zeichnen, wenn Kinder anfangen, die Schule zu ,,schwänzen", Suchtmittel, wie Alkohol,
Zigaretten oder Rauschmittel zu konsumieren, sich immer mehr in ,,mediale Welten" zu-
rückzuziehen (Fernseher, PC, Chats, Computerspiele etc.).
Der letzte genannte Punkt muss nicht immer einen negativen Aspekt beinhalten, denn her-
vorragende Computerkenntnisse zum Beispiel können auf besondere Fähigkeit/ Talent des
Kindes deuten. Den Bedarf an besonderer Förderung, sei es durch verwurzelte Talente oder
Entwicklungsverzögerung, zu erkennen und diesen durch eigene oder professionelle Hilfen
zudecken bzw. zu fördern, liegt in der erzieherischen Verantwortung der Eltern. Doch nicht
nur bei ,,besonderem" Bedarf ist die elterliche Förderung von Nöten, auch generell brau-
chen die Kinder zur erfolgreichen kognitiven Entwicklung
20
vermehrt Anregungen durch
Konversation, Spiel und ähnliche Fördermaterialien.
21
Verweigerung jeglicher Form an
19
Vgl. Tschöpe-Scheffler 2003, 70-72
20
Kognitive Entwicklung ist die Entwicklung all jener Funktionen, die dem Erkennen und Erfassen der Ge-
genstände und Personen der Umgebung und der eigenen Person gelten. Zu diesen Funktionen gehören In-
telligenz bzw. Denken, Wahrnehmung, Problemlösen, Gedächtnis, Sprache etc.
21
Vgl. Kindler o.J.
3 Formen von Vernachlässigung
19
Förderung bzw. der Mangel an kognitiver Förderung, gilt ebenfalls als eine Form von Kin-
desvernachlässigung kognitive Vernachlässigung.
Gesetzte Grenzen wie vorhin erläutert haben nicht nur einen erzieherischen Zweck,
auch gelten sie als Methode der Gefahrenabwendung. Kleinkinder stehen von überdurch-
schnittlicher Häufigkeit Gefahren im Alltag gegenüber. Da diese in ihren jungen Jahren
Gefahren und ihre Auswirkungen noch nicht abwägen und einschätzen können, ist hier die
elterliche Beaufsichtigung unerlässlich.
22
Bei Säuglingen steigt die Gefahr einer Verletzung
zusätzlich durch ihre mangelnde Körperbeherrschung, daher ist eine kontinuierliche Beauf-
sichtigung von höchster Notwendigkeit.
In einigen Fällen gehen die Eltern nicht nur unzureichend ihren elterlichen Pflichten nach,
oftmals übergeben sie die Elternrolle schlichtweg an ihre Kinder. Den Vorgang des Rolle-
numkehrs zwischen Eltern und Kind wird in der Psychologie als Parentifizierung bezeich-
net.
23
Meist sind das die ältesten Geschwisterkinder oder diejenigen, die das meiste Maß an
Einfühlungsvermögen und Reife haben, die in die Elternrolle schlüpfen und die Elternfunk-
tionen gegenüber seinen Geschwistern und dem Elternteil vertreten. Trotz der doch
schwerwiegenden Nachteile, wie z.B. Vernachlässigung der Schule, Freunde, Hobbys bzw.
eigener Bedürfnisse, versuchen viele Kinder die nicht kindgerechte Rollenerwartung zu
erfüllen. Meistens sind die Eltern distanziert, zurückgezogen und fast unnahbar, daher ist
die Bemühung seitens des parentifizierten Kindes groß, um weitere Verluste zu vermeiden
und so eine gewisse Nähe zu den Eltern zu erhalten oder zurückzugewinnen. Doch meist
wird dieser Kraftaufwand und die Bemühung von den Eltern nicht gesehen oder bewusst
nicht anerkannt. Anstatt, wie von dem Kind erhofft und erwartet, elterliche Anerkennung
und Wertschätzung zubekommen, wird das Kind meist noch kritisiert und seine Arbeit be-
mängelt. Ebenso wird es für Fehlschläge, Unordnung oder Probleme der Geschwister ver-
antwortlich gemacht. Nichts was das Kind tut ist gut genug für die Eltern. Oft kommt es zu
Erniedringungen und gleichzeitig zu einer Schädigung des Selbstwertgefühls. Mit ihrem
Handeln verursachen die Eltern eine Persönlichkeitsverzerrung und hemmen damit die
Entwicklung von Autonomie und Individuation.
3.3 Sozial emotionale Vernachlässigung
Sozial-emotionale Vernachlässigung meint eine ungenügende Vermittlung von Basisele-
menten einer liebevollen und intakten Beziehung zwischen Eltern(teil) und Kind, als auch
Eigenschaften zur erfolgreichen Anpassung an die Gesellschaft Liebe, Zuwendung, Re-
spekt, Akzeptanz, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft etc.
Nach Tschöpe-Scheffler (2003) gehört zu einer entwicklungsfördernden Erziehung bzw. zu
einem entwicklungsfördernden Miteinander von Eltern und Kind unter anderem das Ele-
22
Vgl. Gellert 2007, 11
23
Vgl. Graf /Frank 2001, 314-316; vgl. auch Bürgin/Rost 1997, 149-151
3 Formen von Vernachlässigung
20
ment Liebe. Gemeint ist ein liebevoller Umgang der Bezugspersonen (Mutter und Vater)
mit dem Säugling/ Kind. Der Gegenpol von Liebe ist Unterbehütung und emotionaler Kälte.
Tschöpe-Scheffler beschreibt es, als ein Mangel an Fürsorge, Schutz, emotionaler Stützung,
Nähe und Verantwortung dem Kind gegenüber. Der Erwachsene lehnt das Kind offen ab,
ignoriert es und zeig Desinteresse an seiner Person und seinem Verhalten. Sein Auftreten ist
abweisend, kühl und distanziert zu den Belangen des Kindes. Er ist weniger anteilnehmend
und vermeidet Körperkontakt. Bedürfnisse des Kindes werden weder gesehen noch befrie-
digt. Das Kind wird physisch, psychisch und/oder sozial vernachlässigt. Die Ablehnung
oder Abwertung des Kindes wird entweder dem Kind direkt (verbal) mitgeteilt (z.B.
,,Komme mir nicht zu nahe!", ,,Du bist zu anhänglich, lass das!"), oder indirekt durch be-
stimmte Handlungen (z.B. sich abwenden, ignorieren, nicht zuhören, das Kind aufs Zimmer
schicken und somit räumliche Distanz schaffen). Die Ablehnung, von der zum Teil wich-
tigsten Bindungsperson, erschüttert die gesamte Persönlichkeitsentwicklung des Kindes.
Solche Erfahrungen prägen das Selbstkonzept und spiegeln sich dann auch in seinem (Sozi-
al-) Verhalten wieder.
Sozial-emotionale Vernachlässigung zeigt sich nicht nur in der drastischen Form der Ab-
lehnung und Abwertung des Kindes, sondern auch in Form von falscher bzw. fehlender
Förderung der kindlichen Kompetenzen.
24
Der Erwerb von Kompetenz kann durch zahlreiche Wege erfolgen. Hier werden nur die
Praktiken genannt, auf die die Eltern einen Einfluss haben können (im Gegensatz zu Selbst-
reflexion, autodidaktisches Lernen). Kinder erwerben ihre Kompetenzen durch Bildung
(Kindergarten, Schule), (informelle) Weiterbildungsmaßnahmen (Förderunterricht, Lern-
spiele, Bücher bzw. Lesestunden, Musik-, Tanz-, etc.- Unterricht) und Erfahrung. Werden
(mangelnde) Kompetenzen des Kindes nicht erkannt und gefördert, dann entwickelt sich
das Kind nicht dem Durchschnitt oder nicht seiner intellektuellen Möglichkeit angemessen.
Die kognitive Förderung wurde im vorherigen Abschnitt schon angesprochen, hier geht es
viel mehr nun um soziale Kompetenzen.
Der primäre Ort zum Erlernen der sozialen
Kompetenz ist traditionell die Familie.
Daher liegt die meiste Verantwortung in den Hän-
den der Eltern. Hat das Kind keine Selbstkontrolle (z.B. Geduld, Kritikfähigkeit), mangeln-
de Selbstbehauptung (z.B. eigenwillige Wunschäußerungen; Selbständigkeit), mangelnde
Perspektivenübernahme (bietet von sich aus Hilfe an, wenn nötig; Unterscheidet zwischen
Absicht und Ergebnis) oder kennt nicht die Bedeutung von Kooperation (häufige Spielre-
gelverletzung; hohe Konfliktbereitschaft)
25
, dann können die Ursachen dafür durchaus aus
dem Elternhaus kommen. Das falsche Vorleben bzw. die fragliche Lebensführung der Be-
zugspersonen, z.B. durch häufige Impulsivität, das Nichteinhalten sozialer Regeln (Verbote
ignorieren, Grenzen überschreiten), die Vermittlung, dass Gefühlsoffenbarung, wie zum
Beispiel das Weinen als Zeichen der Schwäche gilt (überwiegend bei Jungen) etc., aber
24
Vgl. Gellert 2007, 12
25
Beispielhafte Fähigkeiten, die Soziale Kompetenz beschreiben
3 Formen von Vernachlässigung
21
auch keine, mangelnde oder falsche Vermittlung von Normen und Werten
26
sind eine Form
der Kindesvernachlässigung, nämlich die Vernachlässigung der normgerecht-sozialen Ent-
wicklung.
Oftmals merken die Eltern selbst, dass ihre Lebensführung und der Umgang mit den Kin-
dern nicht den Idealen entspricht und bekommen Angst vor staatlichen Eingriffen (Jugend-
amt) oder andere Formen von Konsequenzen (z.B. durch Ablehnung von Freunden, Ver-
wandten und Nachbarn), falls es von Außenstehenden erkannt und evtl. gemeldet wird. Da-
her wird der Kontakt nach außen so gering wie möglich gehalten. Nicht nur die Erwachse-
nen ziehen sich immer mehr zurück, ebenfalls wird den Kindern der Kontakt zu Gleichaltri-
gen oder sonstigen Kontaktpersonen verboten, um die Gefahr der ,,Überführung" möglichst
gering zu halten. Aber auch Familien ohne eine absichtliche Problemlagenkaschierung kön-
nen ein Kind sozial isolieren. Es ist unklar, welche Beweggründe dazu führen, dass das
Kind sozial isoliert wird, wichtig ist es nur dies zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Denn eine Isolierung von Unterstützung, Kontakten, Freundschaften ist eine absichtliche
Einschränkung der freien Entfaltung des Kindes und demnach eine weitere Form von Ver-
nachlässigung.
Eine sozial-emotionale Vernachlässigung zu erkennen, um dementsprechend handeln zu
können, ist meist nicht einfach. Die ethologische Bindungstheorie
27
soll da Abhilfe schaf-
fen. Die Beschreibung von Erlebens- und Verarbeitungsweisen von Säuglingen und Klein-
kindern, sowie den Aufbau und die Entwicklung von Erwachsenen-Kind-Beziehungen ver-
bessert das Verständnis von Wirkungsmechanismen psychologischer Vernachlässigung. Die
von John Bowlby aufgestellte Bindungstheorie ist das theoretische Modell, das sozial-
emotionale Entwicklung im Lebenslauf am umfassendsten abdeckt und empirisch belegt
hat.
Danach ist eine positive sozial-emotionale Entwicklung davon abhängig, ob zum einen
die Sicherheits- und Bindungsbedürfnisse und zum anderen die Erkundungs- und Autono-
miebedürfnisse gleichermaßen und ausgewogen befriedigt werden. Beide Bedürfnisse ste-
hen in einer ständigen Wechselwirkung und Beeinflussung zueinander. Befindet sich ein
Kind in einer ihm vertrauten Situation oder Umgebung und ist es zum Zeitpunkt emotional
ausgeglichen, so hat es einen vermehrten Wissensdrang und zeigt mehr Interesse an etwas
Neuem. Ist die Situation oder Umgebung unvertraut und/oder ist das Kind emotional verun-
sichert, dominiert sein Sicherheits- und Bindungsbedürfnis. Die Kinder suchen dann nach
einer personifizierten Sicherheitsquelle, ihren Bindungspersonen. Können sich die Kinder in
solchen Situationen ihre Bindungsperson als eine sichere Basis zusichern, dann steht einer
erfolgreichen Erkundung und zunehmenden Autonomie nichts mehr im Wege.
Ziegenhain (Nr.2/2001) sieht solcherart feinfühliges und zuverlässiges elterliches Verhalten
in dem ersten Lebensjahr nicht nur als Vorraussetzung für eine spätere sichere Bindung,
sondern auch als Voraussetzung positiver sozialer Kompetenzen und positiver Selbstent-
26
Dazu gehören Eigenschaften, wie z.B. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Verlässlichkeit, Freundlichkeit, Anstand
oder Höflichkeit. Aber auch Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit
3 Formen von Vernachlässigung
22
wicklung. Die Beziehungserfahrungen und erwartungen, die Säuglinge und Kleinkinder
mit ihren Bindungspersonen machen, prägen ihre gesamte sozial-emotionale Entwicklung.
Ein Kind das von klein auf feste Bindungspersonen erfährt und diese auch als emotional
verfügbar und unterstützend erlebt, entwickelt sich zu einer emotionalstabilen Persönlich-
keit. Es ist selbstbewusst und verhält sich, entsprechend seinen vorherigen Beziehungser-
fahrungen, offen und vertrauensvoll. Ist für gewöhnlich beliebt und sozial kompetent. Kin-
der, denen eine emotional unsichere Bindung, mit mangelnder Zuwendung und Wärme, und
evtl. eine zusätzlich unzureichende körperliche Fürsorge widerfahren ist, empfinden sich
selbst als einen wenig liebenswerten und von anderen nicht akzeptierten Menschen. Die
unsichere Bindung wird in zwei Typen unterteilt: unsicher-ambivalente und unsicher-
vermeidende Bindung. Kinder, deren Bindungspersonen sich überwiegend nicht nachvoll-
ziehbar verhalten und zwischen feinfühligem und nicht-feinfühligem oder ärgerlichem Ver-
halten wechseln, entwickeln eine unsicher-ambivalente Bindungsbeziehung. Durch die un-
konsistente Interaktionserfahrung ist es für das Kind fast unmöglich eine verlässliche Er-
wartung im Zusammenhang mit der Bezugsperson zu entwickeln, daher ist es in seinem
Verhalten und Umgang mit dieser Person stark verunsichert. Bei kleinsten Verunsicherun-
gen begegnen Kinder mit verstärkter Nähe- und Kontaktsuche und äußern häufig gleichzei-
tig gemischte Gefühle von Angst und Ärger. Mit zunehmendem Alter wird das unsichere
Verhalten taktisch in wechselseitige schüchtern-entwaffnende und drohende Verhalten aus-
gelegt, um sich so Kontrolle und permanente Aufmerksamkeit zu sichern. Dies beinhaltet
jedoch eine große emotionale Anstrengung und bringt eine starke Abhängigkeit von der
Bezugsperson mit sich. Begegnen Bindungspersonen dem Kind mit Zurückweisung, Igno-
ranz oder gar mit Feindseligkeit, dann entwickelt das Kind eine unsicher-vermeidende Bin-
dung. Das Kind stößt immer wieder auf emotionale Unsicherheit, wenn die Person, von der
es Sicherheit und Geborgenheit erhofft, sich zurückweisend und aggressiv verhält. Zudem
erfährt das Kind, dass wenn es seiner Bindungspersonen Gefühle offenbart, es zu Verstär-
kung von Spannungsverhältnissen kommt. ,,Bindungstheoretisch betrachtet befinden sie
sich in einem Konflikt: Die Bindungsperson, bei der sie Sicherheit und Entlastung finden
sollen, ist gleichzeitig, in Personalunion, diejenige, von der sie erwarten müssen, zurückge-
stoßen oder ignoriert zu werden."
28
Kleinkinder lernen mit der Zeit auch bei Belastung und
Verunsicherung ihre Gefühlsausbrüche, wie z.B. das Weinen zu vermeiden und Bedürfnisse
nach Nähe zu der Bindungsperson zu unterdrücken oder weitgehend zu drosseln. Als Aus-
weg aus diesem Konflikt entwickelt sie ein Verhaltenskompromiss, indem sie die größt-
mögliche Nähe zur Bindungsperson suchen, bei der sie (noch) nicht zurückgewiesen wer-
den. Vernachlässigte Kinder zeigen häufig diese Art von Bindungsstörung auf. Die Bin-
dungspersonen reagieren hierbei nur im geringen Maße auf das Kind und sind emotional
sehr zurückgezogen. Die Strategie des Kindes als Schutzmaßnahme verläuft in Form von
Unterdrückung jeglicher beziehungsbezogener Gefühle und Emotionen, bis hin zu Unter-
27
Vgl. Ziegenhain (Nr.2/2001), 6; vgl. auch Gellert (2007), 14-17
28
Ziegenhain (Nr.2/2001), 7
3 Formen von Vernachlässigung
23
drückung und Vermeidung der gesamten Kommunikation. Das hat zufolge, dass das Kind,
aufgrund mangelnder Fürsorge der Bindungsperson, bei der Erkundung seiner Selbst und
der Umwelt, sowie bei der gesamten kognitiven und sozialen Entwicklung, auf sich allein
gestellt ist. Viele Kinder beginnen um das zweite Lebensjahr, wenn sie dann zunehmend
realisieren, dass sie eine gewisse Wirkung auf andere Menschen haben, vermeidende Stra-
tegien zu entwickeln und ob verbal oder nonverbal, Gefühle vorzutäuschen. Kinder lernen
mit der Zeit, dass die Gefahr von der Bindungsperson nicht beachtet zu werden größer ist,
als die Gefahr zurückgewiesen zu werden, wenn sie dem Bedürfnis der emotionalen und
körperlichen Nähe nachgehen. Durch Albernheiten oder durch liebevolles und fürsorgliches
Verhalten bemühen sie sich aktiv um die Aufmerksamkeit ihrer Bindungsperson. Letzteres
kann sogar schlimmstenfalls zu Übernahme der Mutterrolle führen.
29
Durch die ständigen
Bemühungen um andere Menschen, verleugnen sie ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche.
Dies hat später zur Folge, dass sie von starkem Selbstzweifel und innerer Unzufriedenheit
geprägt sind.
29
Vgl. dazu Kapitel 3.2, S. 19
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
24
4
Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
Die verschiedenen Formen der Vernachlässigung können aus unterschiedlichsten Gründen
entstehen. Zahlreiche Elternpaare realisieren erst mit der Geburt eines Kindes, dass ein
Säugling nicht nur Glück und Freude, sondern auch zunehmend Pflichten und Lasten mit
sich bringt. Die richtige Balance zwischen den Bedürfnissen der Familie, der Anforderung
der Existenzsicherung durch den Arbeitsmarkt und der Wunsch auf ,,ein eigenes Leben"
scheinen manchen fast unmöglich zu sein. Weitere Faktoren, wie z.B. eigene (negative)
Kindheitserlebnisse und -erfahrungen oder auch gesundheitliche Faktoren können den Akt
einer Vernachlässigung, bedingt durch Überlastung, Überforderung und Mangel an interner
und externer Unterstützung, beschleunigen.
30
Die einzelnen in diesem Kapitel aufgeführten
Risikofaktoren können die Ursachen kindlicher Vernachlässigung sein. Da es keine eindeu-
tigen wissenschaftlich bewiesenen Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge gibt, sind diese
viel mehr als Hinweise einer möglichen Vernachlässigung zu sehen.
Abbildung 3
: Risikofaktoren der Vernachlässigung von Kindern
(Quelle: Kinderschutzbund-
NRW 2006, 29)
30
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2006, 26-30
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
25
Es ist jedoch von einem erhöhten Grad der Gefährdung auszugehen, je mehr Risikofaktoren
in einer Familie zusammenfallen. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss keinesfalls, dass
wenn mehrere Faktoren zusammenkommen dann auch Vernachlässigung vorliegen muss.
Bei den formulierten Hypothesen geht es vielmehr darum, Aufmerksamkeitsstrukturen für
die Praxis sozialer Arbeit zu schaffen.
Es gibt keine einheitliche Unterteilung der Risikofaktoren. Der Kinderschutzbund-NRW
(2006) benennt fünf Risikofaktoren (siehe Abbildung 3), diese Arbeit beschränkt sich
jedoch auf vier wesentliche, inhaltlich identische Unterteilungen (siehe Tabelle 2). Vor-
ab lässt sich sagen, dass die psychosoziale Vernachlässigung von Kindern ebenso auf
gesellschaftliche wie auf psychische Faktoren der Eltern zurückzuführen ist.
Im Folgenden werden diese im Fokus betrachteten Faktoren näher dargelegt.
Persönliche Faktoren der Erziehungs-
person
Eigene negative Kindheitserlebnisse; Per-
sönlichkeitsmerkmale, wie z.B. mangelnde
oder negative Emotionalität; Chronische
Erkrankungen, wie Suchterkrankungen oder
psychische Erkrankungen in Form von De-
pressionen, Apathie etc.
Risikofaktoren des Kindes
Alter eines Kindes (bei Kindern zwischen 0-
3 Jahren besteht höchstes Gefährdungsrisi-
ko), Entwicklungs- und Gesundheitstand
(körperliche u./o. geistige Behinderung,
chronische Erkrankungen) Regulations- und
Verhaltensstörungen (von der Norm abwei-
chendes (Sozial-)Verhalten, z.B. Hyperakti-
vität)
Familiärer Risikofaktoren
Alleinerziehende, junge Mütter bzw. Eltern,
Migrantenfamilien
Sozioökonomische Situation
Arbeitslosigkeit, Armut, schlechte Wohn-
verhältnisse, fehlende soziale Unterstüt-
zungsnetze, Isolation
Tabelle 2:
Gesellschaftliche und psychische Risikofaktoren (eigene Darstellung)
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
26
4.1 Persönliche Faktoren der Erziehungsperson
Bei der Frage nach den Ursachen von kindlicher Vernachlässigung konzentrieren sich viele
Forschungen auf die Kindheit der Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, deren Persön-
lichkeit und ihre psychischen Ressourcen. Die Ergebnisse beziehen sich viel mehr auf die
betroffenen Mütter, denn trotz der modernen Zeit und einer Reduzierung typisierter Män-
ner- und Frauenrollen, ist überwiegend die Frau, die die meiste Zeit mit den Kindern ver-
bringt und gleichzeitig die meiste Last der Kindererziehung trägt.
31
Jedoch schließt dies
nicht aus, dass auch Väter ihre Kinder vernachlässigen können.
4.1.1 Eigene negative Kindheitserlebnisse
Prozentual gesehen ist die intergenerationale Weitergabe von Vernachlässigung und Ge-
fährdung des Kindeswohls gering und dennoch kann es eine von vielen Ursachen sein.
Nach gegenwärtigem Wissensstand können derartige belastende Kindheitserfahrungen der
Eltern die Erziehungsfähigkeit auf verschiedenen Wegen beeinträchtigen, wie von C. Rein-
hold und H. Kindler (o.J.)
32
dargestellt.
Zum Teil können durch falsches Vorleben oder Erleben der Mutter-Kind-Beziehung Beein-
trächtigungen entstehen. Ein bestimmtes Beziehungsbild oder -modell aus der Kindheit
wird von jedem Menschen unbewusst gespeichert. Bei Müttern, die selbst in ihrer Kindheit
vernachlässigt wurden, kann dieses dazu führen, dass sich ein inadäquates Beziehungsbild
aus ihrer Kindheit verfestigt und so einen falschen Einfluss auf die Wahrnehmung des eige-
nen Kindes und die Bewertung deren Signale nimmt. In Längsschnittstudien kann belegt
werden, dass es bei Eltern, die zu Beginn der Studien solche negativ geprägten Bezie-
hungsmodelle aufweisen, nachfolgend mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu ungünstigen und
konflikthaften Verläufen in der Eltern-Kind-Beziehung kommt.
Eine weitere Beeinträchtigung kann, zwar indirekt, aber auch durch eine kindlich negativ
geprägte Lebens- und Partnerschaftssituation kommen. Kinder aus instabilen Familien nei-
gen im frühen Erwachsenenalter erhöht zu überstürzten Eheschließungen, früheren Eltern-
schaft oder gewalttätigen Partnerschaftskonflikten. Diese Lebensumstände können wieder-
um zu Vernachlässigung oder gar Gefährdung ihrer eigenen Kinder führen.
Ebenfalls ungünstige Auswirkungen haben negative Kindheitserlebnisse auf die Persönlich-
keitsentwicklung und psychische Gesundheit. Nachfolgend werden diese zwei Handicaps
der Eltern vertieft.
31
Vgl. Kinderschutzbund-NRW 2006, 17
32
Vgl. Reinhold/ Kindler o.J.
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
27
4.1.2 Persönlichkeitsmerkmale
Jeder Mensch hat eine eigene besondere Persönlichkeitsform. Einige Eltern zeigen in Bezug
auf Vernachlässigungsneigung vermehrt auffällige charakteristische Züge
33
(siehe dazu auch
Tabelle 3
), wie z.B. eine ausgeprägt negative Emotionalität, d.h. leicht auszulösende, inten-
sive Gefühle von Trauer, Niedergeschlagenheit oder Ärger. Mangelnde oder negative Emo-
tionalität der Eltern kann die Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens verzerren. So kann,
zum Beispiel ein weinendes Kind bei den Eltern das Gefühl von absichtlichem Ärgernisses
erzeugen. Leicht abweichendes Verhalten des Kindes kann als eine absichtliche Provozie-
rung und Bedrohung wahrgenommen werden, denen sie mit Strenge und starrer Kontrolle
entgegenwirken wollen. Drastischer Formen von Konsequenzen, wie beispielsweise Igno-
ranz, Drohungen, körperlicher Tadel werden dabei als effektivste Erziehungsformen gese-
hen. Persönlichkeitsschwächen, wie hohe Impulsivität und eine deutliche Neigung zu einem
problemvermeidenden Bewältigungsstil, sind bei diesen Eltern ebenfalls ausgeprägt. Cha-
rakteristisch sind auch unrealistische Erwartungen an das Wohlverhalten und die Eigen-
ständigkeit des Kindes, wie auch ein eingeschränktes Einfühlungsvermögen in die Situation
des Kindes.
Merkmale bei Eltern, die das Kind vernachlässigen oder das Kindeswohl gefährden
· altersunangemessene Erwartungen bezüglich der Fähigkeiten und der Selbstständigkeit des
Kindes;
· ein eingeschränktes Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse des Kindes;
· überdurchschnittlich ausgeprägte Gefühle der Belastung durch das Kind;
· überdurchschnittlich ausgeprägte Gefühle der Hilflosigkeit in der Erziehung und des Verlustes
von Kontrolle durch das Kind;
· feindselige Erklärungsmuster für Problemverhaltensweisen des Kindes und ein negativ verzerr-
tes Bild des Kindes;
· überdurchschnittlich ausgeprägte Zustimmung zu harschen Formen der Bestrafung und Unter-
schätzung negativer Auswirkungen kindeswohlgefährdender Verhaltensweisen;
· eingeschränkte Fähigkeit oder Bereitschaft, eigene Bedürfnisse zugunsten kindlicher Bedürf-
nisse zurückzustellen.
Tabelle 3:
Gedanken und Gefühle vernachlässigter Eltern
(Quelle: DJI Online Handbuch
Kindeswohlgefährdung o.J., Frage 18)
33
Vgl. Deutscher Jugendinstitut, Prüfbogen zur Einschätzung des Misshandlungs- und Vernachlässigungsrisi-
kos, URL: db.dji.de/asd/misshandlungsrisiko.dot, Stand 24.04.09
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
28
4.1.3 Chronische Erkrankungen
Zahlreiche durchgeführte Studien
34
belegen, dass bei ca. 1/3 aller Vernachlässigungs- und
Gefährdungsfällen den Eltern entweder eine psychische Erkrankungen und/oder eine Su-
cherkrankungen zugewiesen werden kann. Sowohl das Risiko einer Kindesvernachlässi-
gung als auch Kindeswohlgefährdung steigt statistisch gesehen bei Eltern mit psychischen
Erkrankungen, wie Depressionen, Apathie und anderen Formen von psychischer Labilität
an. Durch die erhöhte Irritierbarkeit, die eine psychische Erkrankung mit sich bringt, macht
es dem erkrankten Elternteil schwer bis unmöglich gelassen und geduldig mit einem Kind
umzugehen. Liegt bei einem Elternteil gar eine Psychose (Schizophrenie) vor, so kann es
nicht nur zur Kindesvernachlässigung kommen, sondern auch zu einem höchsten Grad der
Kindeswohlgefährdung. Nicht selten erfährt man durch mediale Schlagzeilen von Kindstö-
tung (Filizid
35
) unter dem Einfluss von psychotischen Symptomen, wie Stimmenhören. Psy-
chisch Erkrankte leiden meist nicht nur an einer Beeinträchtigung der Wahrnehmung, was
allein für eine Vernachlässigung ausreichen kann,
36
meistens kommt noch zusätzlich eine
geistige Beeinträchtigung hinzu. Sind die Kinder an einer Entwicklungsstufe angelangt, an
der sie ihren Eltern geistig überlegen sind, so können sie leicht in die rollentauschende Pa-
rentifizierung
37
geraten.
Auch physische Erkrankungen, die mit langfristigem und immer wiederkehrendem Kran-
kenhausaufenthalt verbunden sind, können verstärkt zu familiären Dysfunktion und somit
zur Vernachlässigung des Kindes führen. Der ständige Verlust der Bindungsperson verhin-
dert eine verlässliche Bindung des Kindes zu diesem, wodurch eine Bindungsstörung
38
ent-
stehen kann.
Einen ebenfalls gravierenden Einfluss auf die elterliche Fürsorge- und Erziehungsfähigkeit
nehmen Suchterkrankungen.
39
Eine Abhängigkeit von Alkohol, Heroin, Kokain oder ande-
ren Suchtstoffen (z.B. Beruhigungsmittel), führt, in Phasen des Suchtmittelgebrauchs, zu
chronischem oder wiederholtem Auftreten der Einschränkung in der Fähigkeit eines Eltern-
teils, dem Kind als feinfühlige Person zur Verfügung zu stehen, notwendige Regeln zu ver-
mitteln und die geistige Entwicklung zu fördern. Folge von Alkoholkonsum ist eine einge-
schränkte Wahrnehmung der kindlichen Signale. Die Einsicht über die Konsequenzen des
eigenen Handelns sinkt. Aus Frustration ziehen sich die Betroffenen zurück (verstärkte Un-
erreichbarkeit), ignorieren, blenden das Kind völlig aus oder geben dem, durch erhöhte
Reizbarkeit, Ausdruck. Zusätzlich können bei Suchterkrankungen Begleiterscheinungen,
34
Siehe Reinhold/ Kindler o.J.
35
Tötung eines Kindes durch einen oder beide Elternteile
36
Wahrnehmungsstörung als passive Form der Vernachlässigung. Es ist den Eltern nicht möglich die Bedürf-
nisse ihres Kindes zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Eltern erkennen die Vernachlässigung
nicht als solches und sind der Ansicht, dass alles was sie tun, oder nicht tun, ausreichend für ihr Kind ist.
(Gellert 2007, 6)
37
Siehe Kapitel 3.2, S. 19
38
Siehe Kapitel 3.3, S. 21-23
39
Vgl. Kindler o.J.; Gellert 2007, 29-30
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
29
wie z.B. erhöhte Häufigkeit der Partnerschaftsgewalt, häufiger Partnerwechsel, Scheidung,
finanzielle Probleme oder auch erhöhte Neigung zur Kriminalität, das kindliche Wohlerge-
hen gefährden.
40
Doch nicht nur durch die Sucht veranlassende Handlungen der Eltern, auch durch den allei-
nigen Konsum während der Schwangerschaft kann das Kind zu Schaden kommen. Die
Auswirkung von übermäßigen Tabakkonsum auf die Entwicklung des Kindes sind von ho-
hem Ausmaß Beeinträchtigung der Ausbildung und Funktionsweise des Gehirns, vermin-
dertes Geburtsgewicht (aufgrund schlechter Versorgung mit Nährstoffen), Wachstums-
schwierigkeiten, erhöhtes Diabetesrisiko oder geschwächtes Immunsystem (erhöhte Anfäl-
ligkeit für Allergien und Asthma) können auf Grund des Missbrauchs auftreten.
41
Der Alko-
holkonsum bringt noch schwerwiegendere Folgen für das Kind. Fetales Alkoholsyndrom
(FAS) oder auch Alkoholembryopathie ist eine schwere Hirnschädigung, das geistige Be-
hinderungen und Entwicklungsverzögerungen des Kindes, mit sich bringt.
Sichtbare körperliche Schäden, die durch den Drogenkonsum der Eltern beim Kind entste-
hen, sind: Minderwuchs und Untergewicht, zu kleiner Kopfumfang (Mikrozephalie), Miss-
bildungen im Gesicht
42
, geistige Störungen wie Lernschwierigkeiten, gestörte Feinmotorik,
Hyperaktivität, Hör- und Sprachstörungen, Labilität oder Schlafstörungen.
43
Durch das
Suchtverhalten der Mutter entstandenen Schädigungen und Einschränkungen der kindlichen
Entwicklung können ihrerseits auch zu Risikofaktoren für spätere Vernachlässigung führen.
4.2 Risikofaktoren des Kindes
In diesem Abschnitt ist keineswegs eine Mitverantwortung des vernachlässigten Kindes
zuzuweisen. Es soll viel mehr zum besseren Verstehen und Nachvollziehen von Faktoren,
die zu Vernachlässigung führen können, dienen.
Als allererster Risikofaktor ist das Alter des Kindes zu benennen.
Aus zahlreichen Studien
44
,
mitunter auch einer deutschen, geht hervor, dass auch ältere Kinder und Jugendliche von
Vernachlässigung gefährdet sind; jedoch ist hierbei eine deutliche Überpräsentation von
Kleinkindern der Altersspanne 0-3 Jahren (25 Prozent aller Fälle) zu sehen.
45
Die Tatsache,
dass sich Säuglinge und Kleinkinder, auf Grund ihren niedrigen physischen und psychi-
schen Entwicklungsstands, nicht fähig sind sich selbst zu versorgen und daher auf ihre Ver-
40
Vgl. Kindler o.J.
41
Siehe Optikur - Bewusstes Leben!, Rauchen während der Schwangerschaft Die Risiken,
URL:
http://www.optikur.de/gesundheit/vorsorge/rauchen/schwangerschaft/
, Stand 23.04.09
42
Z.B. kleine, schräge Augenöffnungen, eine kurze, flache Nase, schmale, dünne Oberlippe oder fehlende
Rinne zwischen Oberlippe und Nase
43
Siehe Medizinauskunft, Alkohol in der Schwangerschaft schädigt Hirn des Kindes, URL:
http://www.medizinauskunft.de/artikel/familie/schwangerschaft_geburt/22_02_fas.php
, Stand 23.04.09
44
Z.B. Amerikanische Studie von Powers / Eckenrode (1988), Studie aus Großbritannien von Creighton
(1985), deutsche Studie von Münder et. al. (2000)
45
Siehe Reinhold/ Kindler o.J.
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
30
sorger (Eltern) angewiesen sind, wird einem Teil der Kinder zum Verhängnis. Befunde zur
Altersstruktur bei schweren körperlichen Schädigungen (Unterernährung), sowie von To-
desfällen, bestätigen, dass Säuglinge und Kleinkinder über die Hälfte bis zwei Drittel der
Opfer von Vernachlässigung stellen.
46
Das Vernachlässigungs- bzw. Gefährdungsrisiko steigt weiter an, je mehr Kinder mit einem
geringen Altersunterschied zu einander, in einem Haushalt leben.
47
Die Versorgung von
mehreren Kindern, nebst Säugling, bringt vernachlässigte Eltern schnell an ihre persönli-
chen Grenzen.
Kommt es in der Kindesentwicklung, wie auch in dem allgemeinen gesundheitlichen
Befinden, zu zusätzlichen Komplikationen, kann dies die familiäre Gesamtsituation wei-
ter oder erneut massiv erschüttern.
Die genannten Komplikationen können zahlreiche Ur-
sachen haben. Überwiegend entstehen sie durch übermäßige Zufuhr giftiger Stoffe während
der Schwangerschaft
48
, eine zeitweise unzureichende Sauerstoffversorgung im Mutterleib,
verkürzte Schwangerschaftsdauer (Frühgeburt) und eine Reihe von Infektionen.
49
Eine phy-
sische und psychische Beeinträchtigung (Behinderung) des Kindes oder chronische/ lang-
widrige Erkrankung benötigt eine besondere Form der Fürsorge und Förderung
50
. Das kann
wiederum zu verstärkten Belastung und folglich zur Überforderung der Eltern führen. Die
Gefahr einer Vernachlässigung kann aber nicht nur für das ,,erkrankte" Kind bestehen, son-
dern in umgekehrter Weise auch für dessen Geschwister. Wird die gesamte Zeit, Energie
und Zuwendung dem erkrankten Kind erteilt, so kann es durchaus zu einer Vernachlässi-
gung der Geschwisterkinder auf mehreren Ebenen kommen.
Regulations- und Verhaltensstörungen gelten ebenfalls als Risikofaktoren eines Kindes.
Claudia Reinhold und Heinz Kindler (o.J.) erklären in ihrer Publikation zum Thema ,,Kind-
liche Risikofaktoren bei Kindeswohlgefährdung"
51
, dass neben Entwicklungsverzögerungen
und Behinderungen auch frühkindliche Regulations-
52
und Verhaltensstörungen
die Eltern
erheblich belasten können. Bei vielen Eltern werden dadurch Gefühle von Hilflosigkeit,
Überforderung, Angst und Ärger ausgelöst. Oft werden eben solche Verhaltensauffälligkei-
ten als ein Infragestellen der elterlichen Erziehungskompetenz angesehen, welches wieder-
um zu einem Ohnmachtsgefühl und folglich zu einem Nutzlosigkeitsgefühl im Umgang mit
46
Siehe Reinhold/ Kindler o.J.
47
Gellert 2007, 33-34
48
Vertieft in Kapitel 4.1.3, S. 29
49
Siehe Reinhold/ Kindler o.J.
50
Häufige Arztbesuche verbunden mit höheren Aufwandskosten, Zusatzpflege, höhere Kontrollen und Über-
wachungspflichten, Aufmerksamkeit und Zuwendung etc.
51
Siehe Reinhold/ Kindler o.J.
52
,,Unter Regulationsstörung wird eine für das Alter bzw. den Entwicklungsstand des Säuglings bzw. Klein-
kindes außergewöhnliche Schwierigkeit verstanden, sein Verhalten in einem, häufig aber in mehreren Inte-
raktions- und regulativen Kontexten (Selbstberuhigung, Schreien, Schlafen, Füttern, Zwiegespräch und
Spiel, kurze Trennung, Grenzsetzung u.a.) angemessen zu regulieren.", zitiert aus AWMF (Arbeitsgemein-
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften), Regulationsstörungen im Säuglings-
und Kleinkindalter, URL:
http://www.uni-duesseldorf.de/AWMF/ll/028-028.htm
, Stand 25.04.09
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
31
dem Kind führen kann. Verspüren die Eltern das Gefühl nutzlos zu sein, so wird jeder Ver-
such, eine Veränderung herbeizuführen, eingestellt und der Prozess des Rückzugs vom
Kind wird nach und nach verstärkt. Demnach bedeutet das, dass das von der Norm abwei-
chende Verhalten des Kindes einen negativen Einfluss auf die Reaktion und Handlung des
Elternteils hat. Zum anderen aber kann es umgekehrt der Fall sein die unzureichende Für-
sorge (Handeln der Eltern) beeinflusst das Auftreten von Regulations- und Verhaltensstö-
rungen bei dem Kind. In diesem Zusammenhang machen Reinhold & Kindler (o.J.) auf
Ketteneffekte aufmerksam, [...] bei denen sich etwa eine unzureichende elterliche Fürsorge
negativ auf das Verhalten des Kindes auswirkt und sich dadurch wiederum das Misshand-
lungsrisiko erhöht.
53
Sie verdeutlichen aber auch die Möglichkeit von Rückkopplungsschlei-
fen, bei denen sich ein vernachlässigendes elterliches Verhalten und ein zunehmend re-
signatives, zurückgezogenes Sozialverhalten des Kindes, gegenseitig bestärken.
4.3
Familiärer Risikofaktoren
Die gesellschaftliche Strukturen verändern sich und mir ihr die familiäre Situation des Ein-
zelnen. Mütter und Väter sind heute in ihren Erziehungsaufgaben vielfach auf sich allein
gestellt. Unterstützungssysteme wie Herkunftsfamilie und nachbarschaftliche Gemein-
schaft, die ,,einem unter die Arme greifen" können, erfüllen diesen Zweck schon lange nicht
mehr. Die Scheidungsraten steigen an (51,9% in Jahr 2005
54
) und mit ihr die Zahl der Al-
leinerziehenden (7,8% von allen Familienformen, 2007
55
). In Vergleich zu andern Familien-
formen weisen Alleinerziehende besonders große Belastungsfaktoren in ihrem Alltag auf
56
.
Aufgrund der vielseitigen Anforderungen, kommt es oft zu physischen und psychischen
Überforderung der allein erziehenden Mütter und Väter
57
und damit erhöhte sich automa-
tisch das Vernachlässigungsrisiko. Aus fast identischen Gründen steigt das Risiko einer
Vernachlässigung auch bei jungen Müttern
58
. Diese haben, aufgrund mangelnder Erfahrung,
eigener Unreife und durch einen möglichen selbst erfahrenen Mangel in der eigenen prob-
lematischen Familie, fehlende Kompetenz an Erziehung und Herstellung einer guten Bezie-
hung zum Kind. Sie haben oftmals Schwierigkeiten, die kindlichen Signale richtig oder
überhaupt wahrzunehmen und auf diese adäquat einzugehen. Allgemeine und selbst allein
verantwortete Belastungen erschweren den einfühlsamen Umgang mit dem Kind und den
Aufbau einer sicheren Bindung. Nicht selten wird das Verhalten des Kindes von solcherma-
ßen überforderten Müttern als problematisch interpretiert und dementsprechend häufig wer-
53
Vgl. Reinhold/ Kindler o.J.
54
Siehe Scheidung, Eheschließung und Scheidungsraten in Deutschland, URL:
http://www.efg-
hohenstaufenstr.de/downloads/tabellen/scheidungen_eheschliessungen.htm
, Stand 25.04.09
55
Siehe VAMV-Bundesverband, Statistische Informationen, Allgemeine Entwicklung, URL (PDF-Datei):
http://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Pressemitteilungen/Hintergrundinformationen
/Statistik/Statistik_AEZahl_0808.pdf
, Stand 25.04.09
56
Siehe Anlage II Abbildungen, S. 101
57
10,1% von der Gesamtzahl der Alleinerziehenden; Siehe obd. VAMV-Bundesverband 07/08
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
32
den rigide und dem Entwicklungsalter nicht angemessene Erziehungsmethoden angewen-
det.
59
Einige Mütter haben Schwierigkeiten mit ihrem Neugeborenen zu artikulieren. Die
Babys werden wortlos und fast ohne Mimik gewickelt, gebadet oder gefüttert - ein Aus-
druck depressiver Grundstimmung, aber auch von Affektunterdrückung bzw. gestörter Af-
fektregulation.
60
Jedoch auch bei den Säuglingen und Kleinkindern können Störungen der
Affektregulation entstehen. Dies äußert sich durch Schlaf-, Ess- oder Kommunikationsstö-
rungen, als auch durch starke Erregbarkeit, Unruhe und Schreistörungen. Es entsteht ein
belastender Teufelskreis, der Affekthandlungen auf beiden Seiten auslöst und von Seiten
der überlasteten Eltern, in einigen Fällen, in gravierenden Vernachlässigungsformen, als
auch Kindesmisshandlung enden kann. Die Situation der jungen Mütter wird durch die
meist ebenfalls sehr jungen Partner (Vater des Kindes) nicht unbedingt entlastet. Sie haben
häufig eine belastende Kindheit hinter sich und sind selber eine instabile Persönlichkeiten.
So fehlt nicht nur die notwendige psychische und physische Unterstützung für die junge
Mutter und das Kind, sondern es besteht auch die Gefahr, dass Mutter und Kind zusätzlich
gefährdet werden. Ein solches Konfliktbereitschaftsrisiko geht nicht nur von den leiblichen
Vätern aus, allzu oft gehen die jungen und/oder allein erziehenden Mütter überstürzt
61
eine
difusse Bindung ein, dessen Partner vermehrt zur Gewaltbereitschaft neigt. Kommt es in der
Partnerschaft des Öfteren zu (körperlichen oder verbalen) Konflikten, so steigt das Risiko
eins Übergriffs auf das Kind
62
. Reinhold und Kindler (o.J.)
63
nennen zwei Erklärungsansät-
ze, warum sich Partnerschaftsgewalt, als einer der bedeutsamsten Risikofaktoren im Be-
reich der familiären Faktoren erwiesen hat. Zum einen weist das Elternteil, das gegen
den/die PartnerIn Gewalt anwendet, zugleich häufig erhebliche Einschränkungen ihrer Er-
ziehungsfähigkeit
64
und zum anderen belastet die erfahrene Gewalt auch das andere Eltern-
teil erheblich und kann, vor allem im Zusammenspiel mit weiteren Risikofaktoren (z.B.
Misshandlungserfahrungen in der Kindheit, depressive Verstimmung), zu zeitweiligen Zu-
sammenbrüchen der Fürsorgebereitschaft, Rückzug oder aggressiven Übergriffen gegen das
Kind, führen.
58
3% aller Neugeborenen werden von Frauen unter 21 geboren; 1% sind minderjährige Mütter, Quelle: Bächer
2008, 2
59
Siehe Bächer 2008, 5-6,
60
Siehe ebd. Bächer 2008
61
Aus dem Bedürfnis der Sehnsucht nach körperlicher Nähe, Zuwendung, finanzieller Sicherheit.
62
Verschiedene Forschungsübersichten (Kindler 2002, Humphreys/Mullender 2001, Edleson 1999, Appel/
Holden 1998) kommen auf der Grundlage von mehr als 40 vorliegenden Studien aus verschiedenen Län-
dern zu dem Schluss, dass in Familien mit Partnerschaftsgewalt 30 bis 60 % der Kinder auch am eigenen
Leib Misshandlungen erfahren, sodass Partnerschaftsgewalt mit einer sechs- bis zwölffachen Erhöhung des
Misshandlungsrisikos einhergeht.
63
In Kindler et al. 2006, Kapitel 19
64
,,Untersuchungen zeigen, dass sich Teile Partnerschaftsgewalt ausübender Eltern durch eine sehr hohe
Selbstbezogenheit oder übermäßig autoritäre Erziehungsvorstellungen auszeichnen, wodurch ihnen eine
angemessene kindbezogene Kontaktgestaltung sehr schwer fällt.", zitiert aus Fabian 2006, 163
4 Risikofaktoren für eine Gefährdungslage
33
Neben den Alleinerziehenden und jungen Müttern gelten die Ausländer- und Migrantenfa-
milien als eine weitere Risikogruppe. Auch sie haben in diesem Zusammenhang einen be-
sonderen Stellenwert.
In Deutschland leben 8,2% Ausländer und 18,7% Menschen mit Migrationshintergrund.
65
Die Bundeskriminalamtstatistik von 2005 belegt, dass 14% der Kindesmisshandlungen bei
9% Bevölkerungsanteil von ausländischen Staatsangehörigen begangen werden (Bundes-
kriminalstatistik 2005). Noch aufschlussreicher ist eine Studie von Pfeiffer und anderen von
1999. Die Befragungen an Jugendlichen ergeben Folgendes: 7,1% der befragten deutschen
Jugendlichen geben an von ihren Eltern misshandelt zu werden, im Gegenzug sind es 24,8
% der türkischen Jugendlichen, 18,8% der Ex-Jugoslawer und 17,3% von anderen südeuro-
päische Jugendlichen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Zahl der misshandelten Kinder
bei Familien mit Migrationshintergrund weit höher liegt, als bei ,,rein" deutschen Familien.
Statistiken und Studien zu Kindesvernachlässigungen in Ausländer- und Migrantenfamilien
gibt es (noch) nicht, doch es lässt sich annehmen, dass die Zahl der Vernachlässigungen in
eben diesen Familien bei weitem höher liegt, als bei deutschen Familien. Denn es ist nach
Ece Wendler (2005) sehr wahrscheinlich, dass Belastungsfaktoren, wie z.B. Verlust der
alten Heimat, Verwandten und Freunden; die neue Sprache und Mentalität; Geldmangel etc.
einen ungünstigen Einfluss auf das Erziehungsverhalten der Eltern haben kann. Treffen
mehrere Stress- bzw. Belastungsfaktoren auf die Eltern, was auf Migrantenfamilien über-
wiegend zutrifft, dann steigt das Risiko einer Überforderung und gleichzeitig die Gefahr
einer Vernachlässigung.
Ausländer und Migranten sind verstärkt individuellen und gesellschaftlichen Problemlagen
(spezifische ,,Ausländerprobleme") ausgesetzt, als ihre deutschen Mitbürger. Reiner Geißler
(1996) beschreibt in seinem Buch ,,Die Sozialstruktur Deutschlands" zehn Bereiche in de-
nen Ausländer und Migranten mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert werden Arbeit,
Einkommen, Wohnen, Familie, Gesundheit, Soziale Mobilität, Bildungs- und Berufschan-
cen der 2.Generation, Vorurteile, soziale Kontakte und Kriminalität
66
, zusätzlich kommen
u.a. Belastungsfaktoren der sozialen Benachteiligung und Stigmata hinzu:
Ausländische Mütter und Väter haben häufig ein niedriges berufliches Ausbildungsniveau
(sind überwiegend als Un- und Angelernte tätig) und arbeiten dazu noch hauptsächlich in
dem krisenanfälligen und schrumpfenden Sektor der Produktion, wie Industrie und Bauge-
werbe (überproportional häufig belastende und gefährliche Arbeit, trotz niedrigerem Ein-
kommen) und sind so den Risiken des industriekapitalistischen Wirtschaftssystems stärker
ausgesetzt (stärker von Arbeitslosigkeit bedroht). Aufgrund eines finanziellen Mangels, sei
es durch geringes Einkommen oder Arbeitslosigkeit, was ein weiterer Belastungsfaktor ist,
bleibt vielen Familien keine Alternative, als der Bezug einer Sozialwohnung. Ist die Familie
von einer hohen Mitgliederzahl geprägt, fallen die Wohnverhältnisse meist sehr beengt aus,
65
Stand 2007, Statistisches Bundesamt Deutschland, Migration und Integration
66
Vgl. Geißler 1996, 214-229
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836641685
- DOI
- 10.3239/9783836641685
- Dateigröße
- 3.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Hochschule Köln, ehem. Fachhochschule Köln – Angewandte Sozialwissenschaften, Studiengang Soziale Arbeit
- Erscheinungsdatum
- 2010 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kindesvernachlässigung risikofaktoren folgen interventionsmöglichkeiten kinderschutz
- Produktsicherheit
- Diplom.de