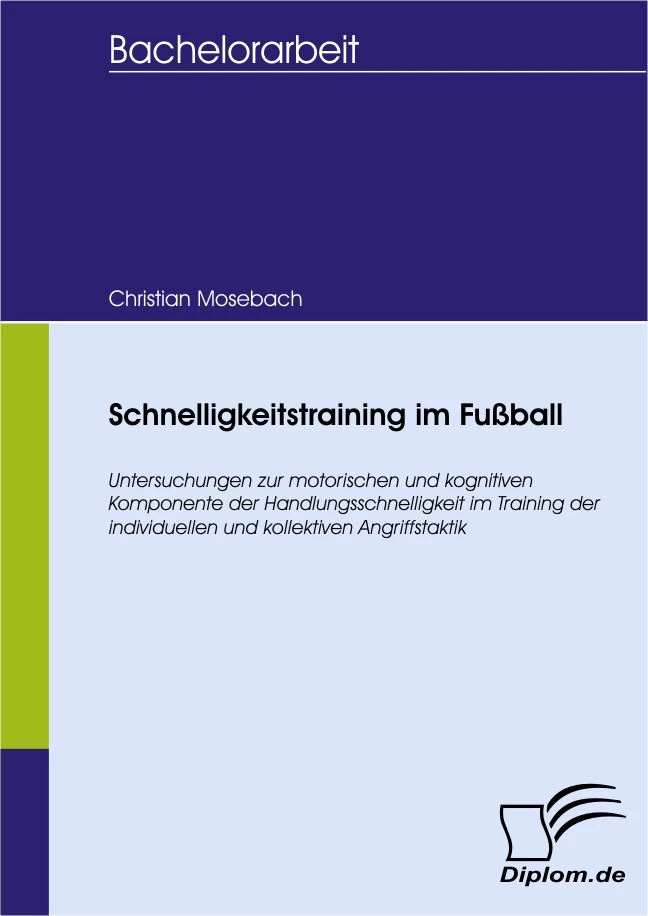Schnelligkeitstraining im Fußball
Untersuchungen zur motorischen und kognitiven Komponente der Handlungsschnelligkeit im Training der individuellen und kollektiven Angriffstaktik
©2009
Bachelorarbeit
80 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Problem- und Zielstellung:
Der moderne und professionelle Fußball zeichnet sich durch ein hohes Spieltempo aus. Die Anforderungen an den Fußballer, Bewegungen mit und ohne Ball schnellstmöglich und kontrolliert auszuführen, sind erheblich gewachsen. Insbesondere im Angriffsspiel stellt ein schnelles Handeln eine Grundvoraussetzung dar, sich gegen zunehmend aktivere Deckungsarbeit und Unterzahlspiel erfolgreich durchzusetzen. Auch bei der Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2008 formten neben taktischer Disziplin, blitzschnelles Umschalten nach Ballbesitz sowie ein schnelles, direktes Spiel in die Angriffszone den Fußball. Der Geschwindigkeitsfußball wird auch das künftige Turnier in Afrika prägen. Diese Entwicklung lässt sich auch an den Spitzenmannschaften im nationalen und internationalen Fußball belegen. So kamen in der Champions League genau diese beiden Mannschaften ins Finale, welche sich durch einen temporeichen, handlungsschnellen Fußball auszeichneten. Nicht ohne Grund spricht der neue Cheftrainer des FC Bayern München, Louis van Gaal, davon, dass Barcelona als das Vorbild gelten müsse. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Teamleistung, sondern eben auch auf ihr präzises, schnelles und daher erfolgreiches Spiel im Angriff. Der FC Barcelona ist sozusagen ein Beweis dafür, dass Spiele auf höchstem Niveau zwar von Taktik bestimmt, aber eben nicht in der Abwehr, sondern im Angriff entschieden werden. Nun kann der VfL Wolfsburg nicht unbedingt mit dem FC Barcelona und Manchester United verglichen werden, aber dennoch dominierte dieser Verein in der vergangenen Saison, besonders in der Rückserie, unsere Bundesliga wie kein Zweiter. Es waren vor allen die beiden Stürmer, welche durch eine schnelle Annahme und Mitnahme des Balls, technische Präzision im Torschuss und einen ausgeprägten Torriecher maßgeblich den Erfolg des Teams bestimmten.
Unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen kommt der Fähigkeit schnell zu sein und schnell zu handeln kontinuierlich größere Bedeutung bei. Nach den Angaben von Verheijen, der Schnelligkeitsstatistiken von niederländischen Profis und A-Junioren erstellte, ist das Spieltempo umso schneller, je höher die Spielklasse im Fußball ist. Dies erfordert eine höhere Handlungsschnelligkeit jedes einzelnen Fußballspielers. Dabei geht es nicht ausschließlich um das Tempo der Spielhandlung, sondern um das Erkennen des geeigneten Momentes dafür. Darüber hinaus muss die […]
Problem- und Zielstellung:
Der moderne und professionelle Fußball zeichnet sich durch ein hohes Spieltempo aus. Die Anforderungen an den Fußballer, Bewegungen mit und ohne Ball schnellstmöglich und kontrolliert auszuführen, sind erheblich gewachsen. Insbesondere im Angriffsspiel stellt ein schnelles Handeln eine Grundvoraussetzung dar, sich gegen zunehmend aktivere Deckungsarbeit und Unterzahlspiel erfolgreich durchzusetzen. Auch bei der Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2008 formten neben taktischer Disziplin, blitzschnelles Umschalten nach Ballbesitz sowie ein schnelles, direktes Spiel in die Angriffszone den Fußball. Der Geschwindigkeitsfußball wird auch das künftige Turnier in Afrika prägen. Diese Entwicklung lässt sich auch an den Spitzenmannschaften im nationalen und internationalen Fußball belegen. So kamen in der Champions League genau diese beiden Mannschaften ins Finale, welche sich durch einen temporeichen, handlungsschnellen Fußball auszeichneten. Nicht ohne Grund spricht der neue Cheftrainer des FC Bayern München, Louis van Gaal, davon, dass Barcelona als das Vorbild gelten müsse. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die Teamleistung, sondern eben auch auf ihr präzises, schnelles und daher erfolgreiches Spiel im Angriff. Der FC Barcelona ist sozusagen ein Beweis dafür, dass Spiele auf höchstem Niveau zwar von Taktik bestimmt, aber eben nicht in der Abwehr, sondern im Angriff entschieden werden. Nun kann der VfL Wolfsburg nicht unbedingt mit dem FC Barcelona und Manchester United verglichen werden, aber dennoch dominierte dieser Verein in der vergangenen Saison, besonders in der Rückserie, unsere Bundesliga wie kein Zweiter. Es waren vor allen die beiden Stürmer, welche durch eine schnelle Annahme und Mitnahme des Balls, technische Präzision im Torschuss und einen ausgeprägten Torriecher maßgeblich den Erfolg des Teams bestimmten.
Unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen kommt der Fähigkeit schnell zu sein und schnell zu handeln kontinuierlich größere Bedeutung bei. Nach den Angaben von Verheijen, der Schnelligkeitsstatistiken von niederländischen Profis und A-Junioren erstellte, ist das Spieltempo umso schneller, je höher die Spielklasse im Fußball ist. Dies erfordert eine höhere Handlungsschnelligkeit jedes einzelnen Fußballspielers. Dabei geht es nicht ausschließlich um das Tempo der Spielhandlung, sondern um das Erkennen des geeigneten Momentes dafür. Darüber hinaus muss die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Christian Mosebach
Schnelligkeitstraining im Fußball
Untersuchungen zur motorischen und kognitiven Komponente der
Handlungsschnelligkeit im Training der individuellen und kollektiven Angriffstaktik
ISBN: 978-3-8366-3753-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2010
Zugl. Universität Leipzig, Leipzig, Deutschland, Bachelorarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2010
Inhaltsverzeichnis
III
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
······································································································································
1
1.1 Problem- und Zielstellung
··································································································
1
1.2 Anliegen der Arbeit
·············································································································
3
1.3 Aufbau der Arbeit
················································································································
4
2 Leistungsvoraussetzungen im Fußball
·················································································
5
2.1 Der konditionelle Leitungsfaktor
······················································································
5
2.2 Der koordinative Leitungsfaktor
·······················································································
5
2.3 Der konstitutionelle Leitungsfaktor
·················································································
5
2.4 Der technisch-taktische Leistungsfaktor
·········································································
6
2.5 Der psychisch-kognitive Leitungsfaktor
·········································································
6
3 Individuelle und kollektive Angriffstaktik
·········································································
7
3.1 Individualtaktik Angriff
······································································································
7
3.2 Kollektivtaktik Angriff
·······································································································
8
4 Schnelligkeit
·······························································································································
10
4.1 Begriffsbestimmung
··········································································································
10
4.2 Formen der Schnelligkeit
·································································································
10
4.3 Einflussgrößen und Leistungskomponenten
································································
12
4.4 Schnelligkeitstraining im Fußball
···················································································
13
4.4.1 Allgemeine Grundlagen des Schnelligkeitstrainings
······································
13
4.4.2 Prinzipien
·················································································································
13
4.4.3 Ziele
···························································································································
14
4.4.4 Methoden
··················································································································
14
4.4.5 Trainingsmethodische Orientierungen
·······························································
15
4.5 Konsequenzen für die Trainingspraxis
··········································································
16
5 Handlungsschnelligkeit
···········································································································
18
5.1 Definition und Bedeutung
································································································
18
5.2 Zusammenhang von Handlungsregulation und Handlungsschnelligkeit
···············
20
Inhaltsverzeichnis
IV
5.3 Komponenten der Handlungsschnelligkeit
···································································
23
5.3.1 Motorische Komponenten
····················································································
24
5.3.1.1 Kondition
···································································································
24
5.3.1.2 Koordination
······························································································
25
5.3.2 Kognitive Komponenten
·······················································································
26
5.3.2.1 Wahrnehmung
···························································································
26
5.3.2.2 Antizipation
·······························································································
27
5.3.2.3 Entscheidung
·····························································································
28
5.3.2.4 Aufmerksamkeit und Konzentration
····················································
30
5.3.2.5 Motivation und Willenskraft
··································································
30
5.3.2.6 Reaktion
·····································································································
31
5.3.2.7 Belastungswirkungen auf kognitive Leistungsvoraussetzungen
····
32
5.3.3 Schlussfolgerungen zu den kognitiven Komponenten
····································
33
5.3.4 Zusammenspiel der beiden Komponenten
························································
35
5.4 Lernphasen
··························································································································
36
5.5 Steuerungs- und Regelprozesse
······················································································
36
6 Praktische Ableitungen für ein fußballspezifisches Training der Handlungs-
schnelligkeit
······························································································································
38
6.1 Methoden
·····························································································································
38
6.2 Methodische Hinweise zur Entwicklung der Handlungsschnelligkeit
···················
39
7 Zusammenfassung und Ausblick
·························································································
43
8 Literaturverzeichnis
················································································································
44
9 Eigenständigkeitserklärung
··································································································
50
10 Anhang (Trainingsmittelkatalog)
······················································································
51
10.1 Anmerkungen und Aufbau des Trainingsmittelkatalogs
·········································
51
10.2 Zeichenerklärung
·············································································································
53
10.3 Wettkampfübungen zur individuellen Angriffstaktik
··············································
54
10.4 Spielformen zur kollektiven Angriffstaktik
·······························································
63
Abbildungsverzeichnis
V
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Mittel der individuellen Angriffstaktik
Abbildung 2
Mittel der kollektiven Angriffstaktik
Abbildung 3
Einflussgrößen und Leistungskomponenten der Schnellig-
keit
Abbildung 4
Trainingsprinzipien und ihre Einteilung anhand biologi-
scher Adaptationsprozesse
Abbildung 5
Verhältnis von Schnelligkeit und Genauigkeit sportlicher
Handlungen
Abbildung 6
Komponenten der Handlungsschnelligkeit
Abbildung 7
Komponenten der Schnelligkeit
1 Einleitung
1.1 Problem- und Zielstellung
1
1
Einleitung
1.1 Problem- und Zielstellung
Der moderne und professionelle Fußball zeichnet sich durch ein hohes Spieltempo aus.
Die Anforderungen an den Fußballer, Bewegungen mit und ohne Ball schnellstmöglich
und kontrolliert auszuführen, sind erheblich gewachsen. Insbesondere im Angriffsspiel
stellt ein schnelles Handeln eine Grundvoraussetzung dar, sich gegen zunehmend
aktivere Deckungsarbeit und Unterzahlspiel erfolgreich durchzusetzen. Auch bei der
Weltmeisterschaft 2006 und der Europameisterschaft 2008 formten neben taktischer
Disziplin, blitzschnelles Umschalten nach Ballbesitz sowie ein schnelles, direktes Spiel
in die Angriffszone den Fußball. Der Geschwindigkeitsfußball wird auch das künftige
Turnier in Afrika prägen. Diese Entwicklung lässt sich auch an den
Spitzenmannschaften im nationalen und internationalen Fußball belegen. So kamen in
der Champions League genau diese beiden Mannschaften ins Finale, welche sich durch
einen temporeichen, handlungsschnellen Fußball auszeichneten. Nicht ohne Grund
spricht der neue Cheftrainer des FC Bayern München, Louis van Gaal, davon, dass
,,Barcelona als das Vorbild" gelten müsse. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die
Teamleistung, sondern eben auch auf ihr präzises, schnelles und daher erfolgreiches
Spiel im Angriff. Der FC Barcelona ist sozusagen ein Beweis dafür, dass Spiele auf
höchstem Niveau zwar von Taktik bestimmt, aber eben nicht in der Abwehr, sondern im
Angriff entschieden werden. Nun kann der VfL Wolfsburg nicht unbedingt mit dem FC
Barcelona und Manchester United verglichen werden, aber dennoch dominierte dieser
Verein in der vergangenen Saison, besonders in der Rückserie, unsere Bundesliga wie
kein Zweiter. Es waren vor allen die beiden Stürmer, welche durch eine schnelle
Annahme und Mitnahme des Balls, technische Präzision im Torschuss und einen
ausgeprägten Torriecher maßgeblich den Erfolg des Teams bestimmten.
Unter den konditionellen Leistungsvoraussetzungen kommt der Fähigkeit schnell zu
sein und schnell zu handeln kontinuierlich größere Bedeutung bei. Nach den Angaben
von Verheijen (2000), der Schnelligkeitsstatistiken von niederländischen Profis und A-
Junioren erstellte, ist das Spieltempo umso schneller, je höher die Spielklasse im
Fußball ist. Dies erfordert eine höhere Handlungsschnelligkeit jedes einzelnen
Fußballspielers. Dabei geht es nicht ausschließlich um das Tempo der Spielhandlung,
1 Einleitung
1.1 Problem- und Zielstellung
2
sondern um das Erkennen des geeigneten Momentes dafür. Darüberhinaus muss die
Bewegungsausführung zum Zwecke des Spiels präzise und effektiv erfolgen. Die
Anforderungen an die Schnelligkeit der Spieler nahmen auch im Laufe der
Fußballgeschichte zu. So erhöhte sich unter anderen die Anzahl der kurzen
Sprints über eine Distanz bis zu zehn Metern stetig. Während eines Fußballspiels stellen
Sprintdistanzen von ein bis fünf Meter die häufigsten Spielaktionen dar, gefolgt von
sechs bis zehn Meter Sprints. Zusammen bestimmen sie rund siebzig Prozent der
Sprintdistanzen. Die Anzahl der Strecken über zehn Meter stellen dagegen nur einen
Bruchteil dar. Auch wenn die Ergebnisse von Verheijen schon einige Jahre
zurückliegen, reichen sie aus, um die tendenzielle Entwicklung und die Bedeutung der
Schnelligkeit im Fußball auszudrücken. Aus seinen Analysen wird deutlich, dass gerade
bei den Angriffsspielern
1
, auf die sich die Arbeit beziehen soll, die Anzahl der Sprints
im Gegensatz zu Abwehr- und Mittelfeldspielern wesentlich höher ist. Nach Angaben
von Gerisch und Bisanz (2008), welche die Untersuchungsergebnisse von Verheijen
fortführten und erweiterten
2
, nehmen Sprintdistanzen bis zwanzig Meter im
Spitzenfußball einen Anteil bis zu neunzig Prozent ein. Dabei wird der Sprint mit circa
sechzig Prozent meist aus der Bewegung (Gehen, Trab, Lauf, nach kurzer Drehung)
eingeleitet.
Ausgehend von Statistiken der Welt- und Europameisterschaft werden in etwa neunzig
Prozent der Tore im Strafraum erzielt. Da hier die Abwehrspieler oft sehr nah am
Angreifer stehen (mit Körperkontakt), ist schnelles Handeln erforderlich. Insgesamt
fallen die meisten Tore mit nur einem, maximal zwei Ballkontakten (Bisanz & Gerisch,
2008). Neben der technischen Präzision des Torschusses ist folglich die
schnellstmögliche Ballverarbeitung im Strafraum zu trainieren.
Obwohl die konditionellen Anforderungen zunehmen (seit den 60er Jahren hat sich laut
Weineck (2004) die durchschnittliche Laufleistung pro Spiel mehr als verdreifacht),
wächst die Nachfrage nach schnellen und beweglichen Spielern (Renner, 1996). Auch
international steigen die Anforderungen an eine ,,hohe Spielhandlungsschnelligkeit"
(Stiehler, Konzag & Döbler, 1988, S. 47). Das höhere Spieltempo und die intensivere
1
Als Angriffsspieler gilt jeder Spieler, dessen Mannschaft sich im Ballbesitz befindet. In meiner Arbeit
möchte ich ausschließlich auf den Fußball in der Offensive eingehen. Diesbezüglich soll in der Arbeit der
Begriff Angriffsspieler als Synonym für Stürmer verwendet werden.
2
Da es sich bei den Schnelligkeitsuntersuchungen von Bisanz und Gerisch überwiegend um Stichproben
handelt, beziehe ich mich fast ausschließlich auf die repräsentativen Werte Verheijens.
1 Einleitung
1.2 Anliegen der Arbeit
3
Abwehrarbeit (frühes Stören, Gegenspieler doppeln, geschicktes Zustellen) erhöhen den
Zeitdruck des Angriffsspielers für Spielaktionen und verlangen eine zunehmende
Ausprägung der Handlungsschnelligkeit (Bisanz & Vieth, 2000; Weineck, 2004).
1.2 Anliegen der Arbeit
Die auf Literaturstudium beruhende Arbeit soll einen Beitrag zur Effektivierung des
Schnelligkeitstrainings leisten. Sie beschäftigt sich besonders mit den Komponenten,
welche die Spieler erst in die Lage versetzen, schnell und effektiv zu Handeln.
Maßgeblich möchte ich dabei auf die komplexeste Form der Schnelligkeit eingehen
die Handlungsschnelligkeit. Diese drückt sich sowohl in einer schnellen, zielgenauen
und sinnvollen Bewegungshandlung aus. Genau dieser allbekannte eine Schritt zu spät,
die oft zitierte und ausschlaggebende Fußspitze, die eine Idee zu langsam am Ball, eine
Sekunde der Unentschlossenheit oder schlicht das Fehlen von Alternativmöglichkeiten
sind oft das Zünglein an der Waage, um ein Spiel zu seinen Gunsten zu entscheiden,
oder es verloren geben zu müssen. Auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen und
Anforderungen im Fußball, muss dem Training der Handlungsschnelligkeit besondere
Aufmerksamkeit zukommen. Dabei sollen neben den motorischen, insbesondere die
Bedeutung der oft unterschätzten und im Trainingsprozess vernachlässigten kognitiven
Komponenten der Handlungsschnelligkeit erläutert und diskutiert werden. Aus diesen
Erkenntnissen möchte ich Spiel- und Wettkampfformen entwickeln, um ein
bestmögliches und effektives Training der Handlungsschnelligkeit in hohen
Spielklassen zu optimieren.
Wie und in welchem Maße sollte aber eine Schulung der Handlungsschnelligkeit im
Schnelligkeitstraining erfolgen? Welche Rolle spielt dabei der Zusammenhang
zwischen den Faktoren Schnelligkeit und Genauigkeit im fußballspezifischen Handeln?
Wodurch werden diese Faktoren begünstigt und inwiefern müssen sie für einen
förderlichen Trainingsprozess aufgearbeitet werden? Diese Problemstellungen sollen im
weiteren Verlauf beatwortet werden.
Einige Autoren wie G. und I. Konzag, O. Berthold sowie H. Schellenberger befassten
sich bereits sehr früh und intensiv mit der Fähigkeit, schnell und effektiv in Sportspielen
zu handeln. Auch in jüngster Zeit besteht die Auseinandersetzung mit dieser
Schnelligkeitsform.
1 Einleitung
1.3 Aufbau der Arbeit
4
Mit der vorliegenden Literaturarbeit soll der aktuelle Wissensstand zur
fußballspezifischen Handlungsschnelligkeit zusammengetragen und aufgearbeitet
werden, um einen derzeitigen Überbrick zur angesprochenen Thematik zu erhalten. Da
solche Arbeiten bisher fehlen, soll nun eine Verknüpfung von älteren und neueren
Untersuchungen aufgezeigt werden, um daraus methodische Ableitungen für ein
Training der Handlungsschnelligkeit im Fußball zusammenzufassen.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegend Arbeit ist in neun Punkte aufgliedert. Zu Beginn wird in das Thema
eingeleitet. Dabei soll insbesondere die Problem- und Zielstellung der Arbeit
verdeutlicht werden (vgl. Gliederungspunkt 1). Im zweiten Punkt sollen die
verschiedenen Leistungsvoraussetzungen im Fußball kurz gekennzeichnet werden.
Anschließend erfolgt in Punkt 3 eine Vorstellung der Mittel zur individuellen und
kollektiven
Angriffstaktik.
Diese
bilden
den
Ausgangspunkt
für
den
Trainingsmittelkatalog. Im Gliederungspunkt 4 soll auf einige grundlegende Aspekte
der Schnelligkeit und deren Training im Fußball eingegangen werden, um im Anschluss
daran die Handlungsschnelligkeit zu charakterisieren (vgl. Gliederungspunkt 5). Dabei
sollen sowohl die motorischen, als auch die kognitiven Komponenten sowie deren
Bedeutung für die Handlungsschnelligkeit beschrieben werden. Darauf aufbauend
werden im sechsten Punkt praktische Ableitungen für das Training der
Handlungsschnelligkeit
getroffen.
Im
Gliederungspunkt
7
erfolgen
eine
Zusammenfassung und ein Ausblick. Am Schluss meiner Arbeit stehen das
Literaturverzeichnis (vgl. Gliederungspunkt 8), die Eigenständigkeitserklärung (vgl.
Gliederungspunkt 9) und der Anhang mit Spiel- und Wettkampfformen (vgl.
Gliederungspunkt 10).
Die nun folgenden Ausführungen beziehen sich auf ein Fußballtraining im
Erwachsenenbereich, wobei der Fußballer bereits über gute technisch-taktische und
konditionelle Leistungsvoraussetzungen verfügen soll.
2 Leistungsvoraussetzungen im Fußball
2.1 Der konditionelle Leistungsfaktor
5
2
Leistungsvoraussetzungen im Fußball
2.1 Der konditionelle Leitungsfaktor
Hierzu zählen energetisch bestimmte Fähigkeiten wie Ausdauer, Kraft und
Schnelligkeit. Ihre Entwicklung sollte fortlaufendes Ziel im Übungsprozess sein, da sie
die Grundlage der Fußballleistung bilden. Während ein Training der Ausdauerfähigkeit
für die Handlungsschnelligkeit eher eine untergeordnete Rolle einnimmt, ist neben dem
Schnelligkeitstraining eine Verbesserung der Kraftqualitäten für schnelles Handeln
(Antrittsschnelligkeit und Sprungkraft) unverzichtbar (Stiehler et al., 1988).
2.2 Der koordinative Leitungsfaktor
Im Fußball dreht sich alles um die Koordination. Sie ist Grundlage für Ballkontrolle.
Nur durch den sicheren Umgang mit dem Ball kann dieser in den eigenen Reihen
gehalten und so ein Torabschluss vorbereitet werden. Der genannte Leistungsfaktor
stellt den Ausgangspunkt für das Erlernen und schnelle Ausführen von technischen
Ansprüchen dar und ermöglicht einen effizienten Energieeinsatz. Sowohl das inter- als
auch intramuskuläres Zusammenspiel muss aufeinander abgestimmt sein, um
Handlungen effizient, zweckmäßig und erfolgreich steuern zu können. Dieser
Leistungsfaktor stellt somit eine wesentliche Voraussetzung für das Lösen einer
spieltechnischen Aufgabe dar (Stiehler et al., 1988; Bisanz & Gerisch, 2008).
2.3 Der konstitutionelle Leitungsfaktor
Diesem Leistungsfaktor, speziell der Körperhöhe, kommt im Fußballspiel eine wichtige
und spielentscheidende Rolle zu, besonders wenn es um das Zweikampfverhalten, die
Defensivarbeit oder um das Verteilen von Bällen für die Angriffsspieler geht. Wird
dieser Leistungsfaktor allerdings auf die Fähigkeit, schnell zu Handeln, reduziert, ist er
eher von untergeordneter Bedeutung. Da sich die Arbeit im weiteren Verlauf mit dem
Schwerpunkt Handlungsschnelligkeit auseinandersetzt, soll die konstitutionelle
Leistungskomponente an dieser Stelle nicht weiter charakterisiert werden. Zumal die
Konstitution eines jeden Spielers in erster Linie genetisch- und entwicklungsbedingt
festgelegt ist und durch den Trainingsprozess nicht weiter beeinflusst werden kann.
2 Leistungsvoraussetzungen im Fußball
2.4 Der technisch-taktische Leistungsfaktor
6
2.4 Der technisch-taktische Leistungsfaktor
Für schnell durchgeführte Bewegungen ist die Güte ihrer Technik wichtig. Je intensiver
ein Bewegungsablauf verinnerlicht und automatisiert wurde, desto stärker kann sich der
Fußballer auf das Spiel konzentrieren. Da eine gute Bewegungstechnik, vor allem die
Qualität der technischen Handlung, ein zweckmäßiges und erfolgreiches
Lösungsverfahren der Spielaktion darstellt, ist sie sozusagen die Voraussetzung für eine
hohe Bewegungsgeschwindigkeit. Das Techniktraining im Fußball ist bei der
Ausbildung der Schnelligkeit unabdingbar (Geese & Hillebrecht, 2006). Der
Ausbildung von technischen Fähigkeiten liegen wiederum Lernvorgänge zu Grunde, auf
welche im weiteren Verlauf meiner Arbeit noch näher eingehen wird.
Da für die Lösung taktischer Aufgaben im Spiel immer technische und konditionelle
Voraussetzungen gegeben sein müssen, hat eine Schulung der Technik und Taktik im
praktischen Bereich stets als Komplex zu erfolgen (Herzog & Müller, 1982).
2.5 Der psychisch-kognitive Leitungsfaktor
Auf diese, für den Fußball notwendige und sehr einflussreiche Leistungskomponente,
soll ausführlich im Gliederungspunkt 5.3.2 eingegangen werden.
3 Individuelle und kollektive Angriffstaktik
3.1 Individualtaktik Angriff
7
3
Individuelle und kollektive Angriffstaktik
Neben der Handlungsschnelligkeit und Handlungskreativität (koordinativ-technische
Leistungsvoraussetzungen), ist es die taktische Handlungsfähigkeit, durch die eine
Spielhandlung erst optimal ausgeführt wird (Lottermann, 2005). Aus diesem Grund
sollen die taktischen Aspekte für den Angriff kurz erläutert werden.
Die folgenden Ausführungen unter den Gliederungspunkten 3.1 und 3.2 gehen auf
Stiehler et al. (1988) zurück, welche sich frühzeitig und ausführlich mit den taktischen
Aspekten im Fußball auseinandersetzten.
Das Fußballspiel wird von technischen und taktischen Anforderungen geprägt, welche
vom Fußballer spielgemäß umzusetzen sind.
3.1 Individualtaktik Angriff
Sie ,,umfaßt die zielorientierten, zweckmäßigen Aktionen eines einzelnen Spielers zur
Lösung von Spielsituationen" (Bisanz & Vieth, 2000, S. 48). Zweckmäßige
Einzelhandlungen und zielorientiertes Verhalten des Angreifers bilden nicht nur die
Grundlage für den Spielerfolg, sondern sind Voraussetzung für eine erfolgreiche
Gruppen- und Mannschaftsarbeit. Einen Überblick zur Individualtaktik des
Angriffsspielers gibt die nachfolgende Tabelle (Abb. 3).
Individuelle Angriffstaktik
Individuelle taktische Mittel:
Dribbling
Torschuss
Finte
Standardaktionen:
Durchbruch
1 gegen 1
Abb. 1: Mittel der individuellen Angriffstaktik (mod. nach Stiehler et al., 1988)
Beim Dribbling wird der Ball vom Angriffsspieler in der Bewegung gehalten. Dabei
kann ein Gegner umspielt oder auf sich gezogen werden. Mit einem erfolgreichen
Dribbling bleibt der Spieler und folglich seine Mannschaft im Ballbesitz. Voraussetzung
hierfür ist eine gute Technik (Ballführung, Täuschungshandlung). ,,Eine Finte und die
3 Individuelle und kollektive Angriffstaktik
3.1 Individualtaktik Angriff
8
Folgehandlung bilden die Bewegungskombination einer Täuschungshandlung" (Stiehler
et al., 1988, S. 275). Der Gegner soll über die eigentliche Idee der Handlung im
Unklaren bleiben. Die Finte dient zur Ballbehauptung im Zweikampf und soll günstige
Positionen für Folgehandlungen schaffen. Dribbling und Finte sind im Fußballspiel eng
miteinander verknüpft.
,,Der Torschuß ist eine spielentscheidende individuelle taktische Handlung" (Stiehler et
al., 1988, S. 277). Er stellt ein ausschlaggebendes Mittel im Training der
Handlungsschnelligkeit dar.
3.2 Kollektivtaktik Angriff
Eine
kollektive
Angriffstaktik
setzt
sich
aus
einer
Gruppen-
und
Mannschaftsangriffstaktik zusammen, welche einzelne Mittel beinhalten (Abb. 4). Sie
,,umfaßt alle aufeinander abgestimmten Angriffs- [...] konzepte, an denen alle Spieler
einer Mannschaft beteiligt sind" (Bisanz & Vieth, 2000, S. 48)
Kollektive Angriffstaktik
Mannschaftsangriffstaktik
Gruppenangriffstaktik
Schneller
Angriff
(Konter-
angriff)
Positionsangriff
(Flügel- und
Zentralangriff)
Standard-
aktionen
- Doppelpass
- Grundlinienspiel
- Spielverlagerung
Nichtstandardisierte
Aktionen
- Zuspiel
- Freilaufen
- Positionswechsel
Standard-
situationen
- An/Abstoß
- Frei/Eckstoß
- Einwurf
Abb. 2: Mittel der kollektiven Angriffstaktik (mod. nach Stiehler et al., 1988)
Innerhalb der Gruppentaktik befinden sich die Spieler räumlich eng beieinander.
Beim Zusammenspiel können noch verschiedene Zuspielarten unterschieden werden
(Kurz-, Lang-, Steil-, Quer-, Diagonal- und Rückpass). Aber auch beim Freilaufen,
wenn sich der Angriffsspieler der gegnerischen Abwehrbereitschaft entzieht um
Folgehandlungen besser umzusetzen, gibt es unterschiedliche Formen (Anbieten,
Weglaufen, Zurückspringen, Überlaufen, Mitlaufen). Für den Positionswechsel wird die
Grundposition zeitweilig verlassen und mit einem Mitspieler getauscht. Bei den
standardisierten Aktionen lassen sich drei Mittel feststellen, welche stets nach
3 Individuelle und kollektive Angriffstaktik
3.2 Kollektivtaktik Angriff
9
verwandten taktischen Gesichtspunkten ablaufen. Mit einem Doppelpass wird ein
Abwehrspiel von zwei Angreifern ausgespielt. Beim Grundlinienspiel versucht der
Angriffsspieler die verlängerte Torlinie zu erreichen, um beispielsweise das Abseits
aufzuheben oder in den Strafraum einzudringen. Mit der Spielverlagerung kann die
Spielsituation mit einem weiten Pass gewechselt werden. Die in der Tabelle
aufgeführten Standardsituationen ergeben sich aus den Spielregeln.
Ziel der Mannschaftstaktik ist der Torerfolg. Für die Umsetzung lassen sich zwei
Angriffsformen unterscheiden. Beim Schnellen Angriff erfolgt das unverzügliche
Umschalten nach Ballbesitz von Abwehr auf Angriff. Beim Positionsangriff wird das
Spiel aus einer sicheren Abwehr über mehrere Stationen aufgebaut.
Zwischen der individuellen und kollektiven Angriffstaktik bestehen enge
Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Mit geeigneten Mitteln werden die
Spielaufgaben durch den Einzelnen und das Kollektiv gelöst.
4 Schnelligkeit
4.1 Begriffsbestimmung
10
4
Schnelligkeit
4.1 Begriffsbestimmung
Nach aktuellen Wissensstand sehen Grosser und Renner (2007) die Schnelligkeit
einerseits als elementare Fähigkeit (neuro-biologisch, inter- und intramuskulär-
koordinativ und tendo-muskulär erklärbar), andererseits als einen Fähigkeitskomplex,
welcher sich aus der elementaren Schnelligkeit, diversen Kraftfähigkeiten sowie
mechanischen und energetischen Komponenten ergibt. Schnelligkeit bezeichnen sie als
,,die Fähigkeit, aufgrund kognitiver Prozesse, maximaler Willenskraft und
der Funktionalität des Nerv-Muskel-Systems höchstmögliche Reaktions- und
Bewegungsgeschwindigkeiten zu erzielen" (Grosser & Renner, 2007, S. 14).
Dabei tritt die Schnelligkeit als isolierte Fähigkeit nahezu nicht auf, sondern muss stets
als ein Kriterium einer sportlichen Leistung gesehen werden. Speziell für den Fußball
wird die Komplexität der Schnelligkeit durch folgende Definition ausgedrückt:
,,Die Schnelligkeit des Fußballspielers ist eine recht vielseitige Fähigkeit.
Dazu gehören nicht nur das schnelle Reagieren und Handeln, der schnelle
Start und Lauf, die Schnelligkeit der Ballbehandlung, das Sprinten und
Stoppen, sondern auch das schnelle Erkennen und Ausnutzen der jeweils
gegebenen Situation." (Benedek & Palfai, 1980, zitiert nach Weineck, 2007,
S. 609-610).
Werden die Spielsituationen im Fußball schneller wahrgenommen, eigene Handlungen
schneller ausgeführt und auf die Gegner- und Ballbewegungen schneller reagiert, wird
die Erfolgswahrscheinlichkeit des Fußballers steigen (Bauersfeld & Voß, 1992).
4.2 Formen der Schnelligkeit
Allgemein können Bewegungen reaktiv, zyklisch und azyklisch realisiert werden. Dabei
treten sie allerdings oft in kombinierter Weise auf. In der Literatur lässt sich
diesbezüglich eine Fülle von Schnelligkeitsarten unterschiedlicher Einordnung finden.
Bezogen auf die Spielsportart Fußball lässt sich ihre Einteilung auf sieben Bewegungs-
und Schnelligkeitsformen reduzieren:
4 Schnelligkeit
4.2 Formen der Schnelligkeit
11
1.
Sequenzschnelligkeit
2.
Frequenzschnelligkeit
3.
Kraftschnelligkeit
4.
Beschleunigungsvermögen
5.
Sprintvermögen in kurzen Intervallen
6.
Maximale Schnelligkeitsausdauer
7.
Reaktionsschnelligkeit
Die Fähigkeit des Fußballers, schnellstmögliche zyklische und azyklische Bewegungen
(gegen
geringe
Widerstände)
auszuüben,
wird
als
Frequenz-
und
Sequenzschnelligkeit bezeichnet. Ihr Training führt zu einer gesamten Steigerung der
Geschwindigkeit des Fußballers. Die Grundlage sich vom Gegner zu lösen ergibt sich
aus einer hohen Kraftschnelligkeit. Innerhalb der Literatur wird sie auch oft als
Antrittsschnelligkeit oder Sprintkraft betitelt. Sie kommt vor allem bei Antritten,
Sprüngen und Stößen zum Tragen und ist vom Training der psychischen, neuronalen,
tendo-muskulären Komponenten sowie der intermuskulären Koordination abhängig.
Falls neben den kurzen, nun längere Distanzen (20 bis 40 Meter) zurückgelegt werden
müssen, gewinnt das Beschleunigungsvermögen des Fußballers an Bedeutung. Ziel ist
das schnellstmögliche Erreichen der maximalen Geschwindigkeit. Die Fähigkeit zu
beschleunigen ist abhängig von der Kraftentwicklung des Sportlers. Da es im Spiel auch
zu Situationen kommen kann, in denen die Fußballer mehrere Sprints hintereinander
durchführen müssen ohne sich vollständig zu erholen, muss der Spieler ein gutes
Sprintvermögen in kurzen Intervallen besitzen. Dieses Sprintvermögen stellt die
Regenerationsfähigkeit des Fußballers dar, sich zwischen den Sprints zu erholen, so
dass seine Antrittsschnelligkeit nicht merklich abnimmt. Bei größeren Laufstrecken, wie
beispielsweise beim Konterspiel, ist wiederum die maximale Schnelligkeitsausdauer
entscheidend. Sie kommt bei einer Sprintdauer zwischen 6 und 20 Sekunden zum
Tragen. Im Fußballspiel ist sie eher von untergeordneter Bedeutung, da Sprints über 30
Meter eher die Ausnahme darstellen. Ausgangspunkt der Fußballaktion stellt aber ein
schnelles situatives Reagieren dar (Reaktionsschnelligkeit), was ein anschließendes
schnelles und präzises Handeln erforderlich macht.
Solch ein Handeln unter höchstmöglicher Geschwindigkeit ist die komplexeste Form
der Schnelligkeit. Sie wird als Handlungsschnelligkeit bezeichnet und durch die oben
genannten
Komponenten
geprägt
(Verheijen,
2000;
Weineck,
2004;
4 Schnelligkeit
4.3 Einflussgrößen und Leistungskomponenten
12
Geese & Hillebrecht, 2006; Grosser & Renner, 2007). Auf diese Schnelligkeitsform soll
im Gliederungspunkt 5 noch detailiert eingegangen werden.
4.3 Einflussgrößen und Leistungskomponenten
Abb. 3: Einflussgrößen und Leistungskomponenten der Schnelligkeit (mod. nach Geese & Hillebrecht,
2006; Grosser & Renner, 2007)
In welchem Umfang nun die einzelnen Größen die Schnelligkeit genau beeinflussen ist
wissenschaftlich nicht zu bestimmen. Da aber insbesondere die sensorisch-kognitiven
und psychischen Einflussfaktoren die Handlungsschnelligkeit prägen, soll auf diese
Größen im Gliederungspunkt 5.3.2 noch näher eingegangen werden. Weitere
leistungsbestimmende Komponenten der Schnelligkeit sind das Aufwärmen,
Regenerationsmaßnahmen zur Unterstützung der Adaptationsprozesse und zum
Ausgleich zeitlich nicht zu realisierender Erholungsphasen sowie das Abwärmen bzw.
Auslaufen zur Stabilisierung der Homöostase, für Lockerung und Entspannung der
Muskulatur und zur beschleunigten Senkung des Blutlaktatspiegels (Grosser& Renner,
2007).
Motorisch-
sensorische
Einflussgrößen
Bewegungstechnik
Motorische
Lernfähigkeit
Koordination
Antizipation
Steuerung
und Regelung
Wahrnehmung
Informations-
verarbeitung
Wissen, Erfahrung
Psychische
Einflussgrößen
Konzentration
Aufmerksamkeit
Motivation
Willenskraft
Anstrengungs-
bereitschaft
Psychische
Regulations-
fahigkeit
Anlage-,
entwicklungs-
und
lernbedingte
Einflussgrößen
Geschlecht
Talent
Konstitution
Alter
Sozialisierung
Lernfähigkeit
Sportliche
Technik
(Qualitätsgrad)
Neuro-
physiologische
Einflussgrößen
Reizverarbeitungs-
geschwindigkeit
Intramuskuläre
Koordination
Intermuskuläre
Koordination
Reflexaktivität
Stoffwechsel
Energieflussrate
Vorinnervation
Anatomisch/
biomechanische
Einflussgrößen
Muskelkraft
Muskelquerschnitt
Muskel-
kontraktions-
geschwindigkeit
Muskelfasertypen-
verteilung
Gewebeeigenschaften
(Viskosität)
Muskellänge
(Hebeverhältnisse)
Energiebereitstellung
Muskeltemperatur
Muskuläre Balence
4. Schnelligkeit
4.4 Schnelligkeitstraining im Fußball
13
4.4 Schnelligkeitstraining im Fußball
4.4.1 Allgemeine Grundlagen des Schnelligkeitstrainings
Als Basis für das Ausführen von Bewegungen dient eine koordinierte Muskeltätigkeit
des Sportlers. Die Aktivierung der Muskeln wird dabei vom zentralen Nervensystem
übernommen (Nerv-Muskel-System). Desweiteren muss ein Schnelligkeitstraining unter
Beachtung
biologischer
Grundlagen
(Reflexzeiten,
Muskelfaserverteilung,
Nervenleitgeschwindigkeit) stattfinden (Bauersfeld & Voß, 1992).
Das Training sollte nach Weineck (2004) auf folgenden Ebenen ablaufen:
1.
Allgemeines Koordinationstraining durch Laufschulung
2.
Verbesserung des Start- und Reaktionsvermögens durch disziplinnahe
Trainingsformen
3.
Schnelligkeitsschulung durch fußballballspezifische Trainingsformen mit Ball
4.
Krafttraining
4.4.2 Prinzipien
In Anlehnung an Grosser und Renner (2007) lassen sich die Trainingsprinzipien
hinsichtlich ihrer Adaptation wie folgt einteilen:
Bedeutung für das Geschehen
Trainingsprinzip (P)
Auslösung der
Anpassung
P. des wirksamen Belastungsreizes
P. der progressiven Belastungssteigerung
P. der Variation der Trainingsbelastung
(Optimale) Sicherung
der Anpassung
P. der optimalen Gestaltung von Belastung und Erholung
P. der Wiederholung und Kontinuität
P. der Periodisierung und Zyklisierung
Spezifische und individuelle
Steuerung der Anpassung
P. der Individualität und Altersgemäßheit
P. der zunehmenden Spezialisierung
P. der regulierenden Wechselwirkung einzelner Trainingselemente
Abb. 4: Trainingsprinzipien und ihre Einteilung anhand biologischer Adaptationsprozesse
Diese Trainingsprinzipien bedingen sich stets gegenseitig und treten nie allein für sich
auf.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836637534
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Leipzig – Sportwissenschaftliche Fakultät, Sportwissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- schnelligkeit schnelligkeitstraining handlungsschnelligkeit fußball taktik
- Produktsicherheit
- Diplom.de