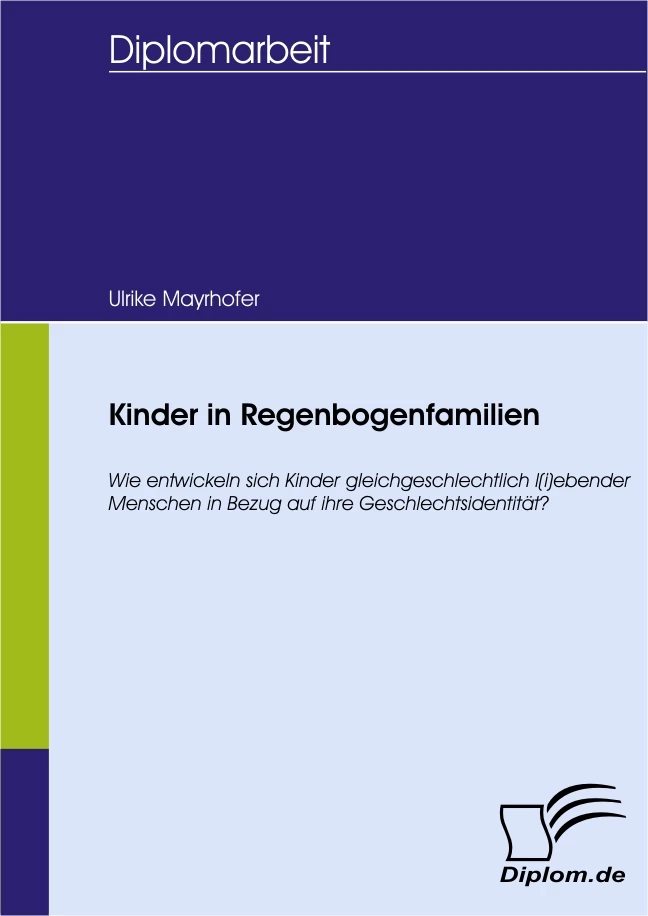Kinder in Regenbogenfamilien
Wie entwickeln sich Kinder gleichgeschlechtlich l(i)ebender Menschen in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität?
Zusammenfassung
In den modernen Industriestaaten leben immer mehr Menschen in alternativen Familienformen. Die traditionelle Familie bestehend aus Vater Mutter Kind verschwindet immer mehr. Einelternfamilien, Patchwork-Familien (Fortsetzungsfamilien), aber auch Regenbogenfamilien sind längst Teil unserer gesellschaftlichen Realität. Dennoch sind gleichgeschlechtliche Familien auch heute noch sehr umstritten. Wenn es um Kinder geht, die bei ihren lesbischen oder schwulen Eltern aufwachsen, zeigen auch jene Menschen Bedenken, die von sich behaupten, offen und tolerant gegenüber Homosexuellen zu sein.
Die häufigsten Argumente die man hört sind, dass Kinder für ihre Entwicklung Mutter und Vater bräuchten und dass es den Kindern schaden würde, wenn die Eltern homosexuell sind; dass die Eltern und in der Folge auch die Kinder psychisch labil seien; Probleme in sozialen Beziehungen hätten und mit der Stigmatisierung und Diskriminierung nicht zurecht kämen; außerdem, dass die Kinder durch den Einfluss der Eltern selbst homosexuell würden und dass sie vermehrt Störungen der Geschlechtsidentität aufwiesen.
Wie sieht nun die Realität aus? Wie leben Regenbogenfamilien und wie wachsen die Kinder auf? Wie entwickeln sie sich im Vergleich zu Kindern aus traditionellen Familien? Gibt es tatsächlich Unterschiede in der Entwicklung der Geschlechtsidentität? Zugegeben, dies sind höchst interessante und auch naheliegende Fragen, wo doch das Leben von Homosexuellen scheinbar alles andere als unserer gesellschaftlichen Norm entspricht.
Präzisierung und Eingrenzung der Fragestellung:
Für die Bearbeitung des Themas im Rahmen meiner Diplomarbeit stellen sich nun folgende Fragen: Wie entwickeln sich Kinder die in Regenbogenfamilien aufwachsen im Vergleich zu Kindern in traditionellen Familien? Welche Bedeutung hat die Familienkonstellation bzw. die sexuelle Orientierung der Eltern für die Entwicklung der Geschlechtsidentität dieser Kinder? Was bedeutet es beispielsweise für einen Jungen, ohne Vater/männliches Rollenvorbild bzw. für ein Mädchen, ohne Mutter/weibliches Rollenvorbild aufzuwachsen? Schadet es dem Kind in seiner Entwicklung oder besteht darin vielleicht sogar eine Chance, unvorbelastet in die eigene männliche bzw. weibliche Rolle hineinzuwachsen in eine neue männliche bzw. weibliche Rolle? Und schließlich - wie entwickeln sich Regenbogenkinder in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung?
Um aussagekräftige Daten zu erhalten, wurde eine […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Entwicklung der Geschlechtsidentität
2.1 Geschlechterdimensionen
2.1.1 Geschlecht
2.1.2 Geschlechtsidentität
2.1.3 Geschlechtsrollen
2.1.4 Geschlechtsstereotype
2.1.5 Geschlechtstypische Unterschiede
2.2 Verschiedene Theorien und Ansätze
2.2.1 Psychoanalytische Ansätze
2.2.2 Biologischer Ansatz
2.2.3 Sozialisationstheoretische Ansätze
2.2.4 Kognitive Ansätze
2.3 Entwicklung über die Lebensspanne
2.4 Resümee
2.5 Fazit
3. Familie und andere Sozialisationsagenten
3.1 Familien im Wandel/alternative Familienformen
3.2 Weitere Sozialisationsagenten
4. Regenbogenfamilien
4.1 Geschichtlicher Rückblick zur Homosexualität
4.2 Die „Regenbogenfamilie“
4.3 Arten von Familienkonstellationen und deren Entstehung
4.4 Familienleben
4.5 Das fehlende Geschlecht
4.6 Der fehlende Dritte – Triangulierung
4.7 Soziales Umfeld
4.8 Coming-Out
4.9 Eltern-Kind-Beziehung
4.10 Psychologische Entwicklung der Kinder
4.11 Aus der Sicht der Kinder – Erlebnisberichte
4.12 Resümee
5. Aktueller Stand der Forschung
5.1 Studien im Detail
5.2 Forschungslücken
5.3 Resümee
6. Empirische Umsetzung der Fragestellung
6.1 Explikation der Fragestellung und Hypothesenformulierung
6.2 Design der Studie
6.3 Stichprobe
6.4 Methodik der Studie
6.4.1 Erhebungsmethoden
6.4.2 Datenaufbereitung
6.4.3 Auswertungsmethoden
6.5 Ergebnisse der Studie
6.6 Beantwortung der Fragestellung
7. Resümee
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Vorwort
Seit rund 15 Jahren lebe ich ausschließlich in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Mein Kinderwunsch begleitete mich dabei von Anfang an. Lange Zeit wusste ich nicht, ob ich eine Möglichkeit finden würde, trotz meiner Homosexualität ein Kind zu bekommen. Zwischendurch gab es Phasen in denen ich mich schon damit abgefunden hatte, dass ich wohl nie ein eigenes Kind haben würde, zumal meine Lebensgefährtin, die ich in dieser Zeit hatte, diesen Wunsch nicht mit mir teilte. In der darauffolgenden Beziehung war der Kinderwunsch etwas, das mich und meine Partnerin ganz stark verband und schließlich fanden wir trotz unserer gleichgeschlechtlichen Orientierung eine Möglichkeit, ein gemeinsames Kind zu bekommen.
Unser Sohn ist mittlerweile fast neun Jahre alt und für ihn ist es nichts Außergewöhnliches, zwei Mütter zu haben. Er weiß inzwischen auch, dass er durch eine Insemination entstand und die Möglichkeit hat, seinen Vater später einmal kennen zu lernen, wenn er das möchte.
Als er vier Jahre alt war sprach ich erstmals mit ihm über unsere Familienkonstellation. Anlass war ein Gespräch zwischen ihm und anderen Kindern das ich hörte, in dem er erzählte, er hätte keinen Papa. Ich versuchte daraufhin ihm die Situation zu erklären, aber erst langsam war er in der Lage die Zusammenhänge zu begreifen und zu verstehen, dass auch er einen biologischen Vater besitzt wie jedes andere Kind, dieser aber keine solche Vaterrolle einnehmen würde, wie Väter es gewöhnlich tun. Als er sechs oder sieben Jahre alt war, fragte ich ihn schließlich, ob ihm sein Papa eigentlich fehle und ich muss gestehen, dass ich mit einer derart klaren Antwort nicht gerechnet hatte. Er sagte: „Nein - ich hab dafür ja zwei Mamas!“ Und als ich ihn weiter fragte, wie das für ihn sei, zwei Mamas und nicht wie andere Kinder eine Mama und einen Papa zu haben, meinte er schlicht und einfach: „Toll!“
Dennoch stellte er zwischendurch natürlich immer wieder Fragen zu seinem Vater und ich machte mir Sorgen, ob ich meinem Sohn nicht einen ganz wichtigen Teil in seinem Leben vorenthalten würde. Ich machte mir Gedanken darüber, welche Folgen unsere Familienkonstellation für seine Entwicklung wie beispielsweise seine männliche Geschlechtsrolle haben würde und ob ihm nicht grundsätzlich eine konstante männliche Bezugsperson fehlen würde. Auch wenn ich erlebte, dass er sich vor allem durch die Auseinandersetzung mit seinem Onkel, die phasenweise sehr intensiv war und dann wieder überhaupt keine Bedeutung zu haben schien, seinen eigenen Zugang zur „Männlichkeit“ gestaltete, so hatte ich doch große Bedenken.
Beispielsweise war er mit vier Jahren überzeugt davon, später auch eine Frau zu sein - genauso wie meine Partnerin und ich. Ich war ausgesprochen verunsichert, denn er wollte damals gar nicht akzeptieren, dass das nicht der Fall sein würde. Heute weiß ich, dass es sich dabei um einen ganz normalen Prozess im Laufe der Entwicklung der Geschlechtsidentität bei Kindern handelt - damals war ich erschrocken.
Schon zu Beginn meines Studiums spielte ich mit dem Gedanken, meine Diplomarbeit über Kinder in gleichgeschlechtlichen Beziehungen zu schreiben, aber aus Angst und Unsicherheit verwarf ich ihn immer wieder. Schließlich war das Bedürfnis, mich endlich mit dem Thema auseinander zu setzen, größer als die Angst, mit meinem eigenen Versagen als Mutter konfrontiert zu werden. Meine Sorge um die Entwicklung meines Sohnes aber auch mein eigenes Interesse sowie das Interesse in meinem Freundes- und Bekanntenkreis an diesem spannenden Thema waren schließlich ausschlaggebend, dass ich mich doch dafür entschied. Ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit einen kleinen aber interessanten und aufschlussreichen Einblick in das Thema geben kann.
Durch meine alltäglichen Erfahrungen als lesbische Mutter und die Meinung meines Sohnes zu verschiedenen Themen habe ich viele Anregungen für meine Arbeit bekommen. Außerdem erhielt ich die Bestätigung, dass er sich glücklich und zufrieden entwickelt und auf seine eigene Art und Weise lernt, mit der Situation umzugehen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich möchte ihm dafür danken, dass er in den letzten Monaten so viel Geduld mit mir hatte. Ich schätze mich überglücklich, dass es ihn in meinem Leben gibt - nichts könnte mein Leben mehr bereichern als er.
Abschließend möchte ich mich bei allen Familien bedanken, die sich mit Interesse und Begeisterung für meine Studie zur Verfügung gestellt haben und nicht zuletzt auch allen anderen, die mir mit Tipps und Ratschlägen zur Seite standen.
1. Einleitung
In den modernen Industriestaaten leben immer mehr Menschen in alternativen Familienformen. Die traditionelle Familie bestehend aus „Vater – Mutter – Kind“ verschwindet immer mehr. Einelternfamilien, Patchwork-Familien (Fortsetzungsfamilien), aber auch Regenbogenfamilien sind längst Teil unserer gesellschaftlichen Realität (vgl. Udo Rauchfleisch, 1997). Dennoch sind gleichgeschlechtliche Familien auch heute noch sehr umstritten. Wenn es um Kinder geht, die bei ihren lesbischen oder schwulen Eltern aufwachsen, zeigen auch jene Menschen Bedenken, die von sich behaupten, offen und tolerant gegenüber Homosexuellen zu sein.
Die häufigsten Argumente die man hört sind, dass Kinder für ihre Entwicklung Mutter und Vater bräuchten und dass es den Kindern schaden würde, wenn die Eltern homosexuell sind; dass die Eltern und in der Folge auch die Kinder psychisch labil seien; Probleme in sozialen Beziehungen hätten und mit der Stigmatisierung und Diskriminierung nicht zurecht kämen; außerdem, dass die Kinder durch den Einfluss der Eltern selbst homosexuell würden und dass sie vermehrt Störungen der Geschlechtsidentität aufwiesen (vgl. Bernd Eggen, 2003, Rauchfleisch, 1997).
Wie sieht nun die Realität aus? Wie leben Regenbogenfamilien und wie wachsen die Kinder auf? Wie entwickeln sie sich im Vergleich zu Kindern aus traditionellen Familien? Gibt es tatsächlich Unterschiede in der Entwicklung der Geschlechtsidentität? Zugegeben, dies sind höchst interessante und auch naheliegende Fragen, wo doch das Leben von Homosexuellen scheinbar alles andere als unserer gesellschaftlichen „Norm“ entspricht.
Was ist eine Regenbogenfamilie?
Von einer Regenbogenfamilie spricht man, wenn mindestens einer der beiden Elternteile lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell ist (vgl. Frank Ebel, 2001, Elke Jansen & Melanie C. Steffens, 2006). Im angloamerikanischen Raum werden sie auch als „LGBT-Families“ bezeichnet. LGBT steht hier für Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender.
Regenbogenfamilien in der Gesellschaft
Auch wenn die Institution Familie in den letzten Jahrzehnten enorme Veränderungen durchgemacht hat und vieles heute für uns selbstverständlich geworden ist - gleichgeschlechtliche Familienformen rufen noch immer Unsicherheit und Ängste hervor und führen zu moralischer Ablehnung (vgl. Gabriele Schöttler, 2001, S. 11). Rauchfleisch (1997) betont, dass gleichgeschlechtlich orientierte Eltern aufgrund der Vorurteile gegenüber ihrer sexuellen Orientierung und der Elternschaft als solche doppelt stigmatisiert sind. So sprechen beispielsweise in der Studie von Calmbach aus dem Jahr 1997, die Rauchfleisch (1997) anführt, ein Viertel der in sozialen Bereichen Tätigen Homosexuellen erzieherische Kompetenzen ab und sogar 40% von ihnen würden die Möglichkeit der Adoption für Homosexuelle strikt ablehnen (vgl. S. 43).
Gleichgeschlechtliche Paare die Kinder großziehen, haben, wie schon erwähnt, mit den verschiedensten Vorurteilen zu kämpfen. Die gängigsten Vorbehalte, warum Lesben und Schwule keine Kinder aufziehen sollten, wurden von Jansen & Steffens (2006) zusammen gefasst. Neben den bereits erwähnten Bedenken führen sie weiters dazu an, dass gleichgeschlechtliche Paarbeziehungen keine Beständigkeit aufwiesen; das Coming-out der Eltern für diese Kinder zu belastend sei; sich sowohl Mädchen als auch Jungen aufgrund des gestörten Geschlechtsrollenverhaltens der Eltern in Bezug auf ihre eigene Geschlechtsrolle nicht entsprechend entwickeln könnten und sich diese Kinder von ihren Freunden zurückziehen würden und damit soziale Isolation erleiden müssten, weil die Gesellschaft solche Familien noch nicht akzeptiere (vgl. dazu auch Birgit Sawatzki, 2004, S. 49). Weiters führen die Autoren dazu an, dass diese Kinder einem erhöhten Risiko ausgesetzt seien, ihre Eltern durch Aids, Suizid oder Drogenmissbrauch zu verlieren und vor allem in schwulen Beziehungen Opfer sexuellen Missbrauchs zu werden (S. 102).
Aber nicht nur die Gesellschaft begegnet Regenbogenfamilien gegenüber ablehnend, es sind in vielen Ländern vor allem auch die Gesetzgebung und die Rechtssprechung, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Zeitschrift JusAmandi berichtet hier in Österreich z.B. von der Absage des Obersten Gerichtshofs im Falle einer Stiefkind-Adoption, die im September 2006 verhandelt wurde. Die Begründung für die Absage lautete: „Die Erziehung und die Sorge durch geeignete und verantwortungsbewusste Personen könne nur bei einer Mann-Frau- (wortwörtlich: „natürlichen“) -Familie erreicht werden.“ Der Fall wurde dem Menschenrechtsgerichtshof übergeben und wartet dort auf eine Entscheidung (JusAmandi 01/2007, S. 3).
Kinder in Regenbogenfamilien
Überdurchschnittlich viele Regenbogenkinder sind Wunschkinder und die Elternschaft somit eine ganz bewusste. Handelt es sich nicht um Kinder aus ehemaligen heterosexuellen Beziehungen, so nimmt die Planung oft mehrere Jahre in Anspruch, sodass sich die werdenden Eltern intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, wie Birgit Sasse (1995, S. 138) schreibt (vgl. auch Melanie C. Steffens & Erin Marie Tompson, 2003, S. 110).
Zahlen und Fakten
Es ist ausgesprochen schwierig genaue Zahlen darüber zu bekommen, wie viele Kinder tatsächlich in Regenbogenfamilien aufwachsen. In Deutschland haben schätzungsweise insgesamt ein bis zwei Millionen Kinder lesbische Mütter oder schwule Väter. Die meisten dieser Eltern leben allerdings nicht geoutet, sondern vielfach in heterosexuellen Beziehungen. Laut Jansen & Steffens (2006) wachsen aber tausende dieser Regenbogenkinder tatsächlich auch in einem gemeinsamen Haushalt mit ihren zwei Müttern bzw. Vätern auf. Eggen (2003) spricht beispielsweise von rund 11.000 solcher Kinder in Deutschland, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen. Damit wären es „deutlich weniger als ein halbes Prozent“ der 21 Millionen deutschen Kinder insgesamt. Diese Angaben stammen aus dem deutschen „Mikrozensus der amtlichen Statistik“. Demnach gab es im Jahre 2001 49.200 zusammenwohnende gleichgeschlechtliche Paare, die sich offen auch als solche bezeichneten. Jedes sechste Paar davon hat Kinder und jedes zehnte Paar minderjährige Kinder. Diese Zahlen sind mit Angaben aus den Niederlanden vergleichbar. Allerdings wird geschätzt, dass die tatsächliche Anzahl der zusammenlebenden gleichgeschlechtlichen Paare in etwa drei Mal so hoch sein dürfte - laut einer Schätzung für Deutschland wären das ca. 147.000 solcher Paare (Eggen, 2003, vgl. dazu auch Sawatzki, 2004, S. 20).
Hier in Österreich gibt es leider keine vergleichbaren Statistiken darüber, wie viele Kinder lesbische Mütter oder schwule Väter haben, aber eine grobe Hochrechnung würde zu folgendem Ergebnis führen: Betrachten wir, dass in etwa 2% der Frauen und 4% der Männer homosexuell sind (vgl. Kap. 2.2.2) und davon jede dritte Lesbe und jeder fünfte Schwule Kinder hat (vgl. Jansen & Steffens, 2006), so ergibt dies bei grober Berechnung für Österreich eine Zahl, die zumindest in die Tausende wenn nicht sogar „zig-Tausende“ geht. Wie viele Kinder davon tatsächlich bei einem lesbischen oder schwulen Elternpaar aufwachsen kann ebenfalls nur sehr grob geschätzt werden. Ich gehe davon aus, dass es zwischen 1000 und 1200 Kinder sein dürften, deren gleichgeschlechtliches Elternpaar sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, wenn ich auch hier einen direkten Vergleich mit Deutschland anstelle, wo Eggen (2003) von 11.000 spricht (vgl. auch Sawatzki, 2004). Tatsächlich dürften es aber auch hierzulande insgesamt circa drei Mal so viele homosexuelle Paare sein, die zusammen leben und gemeinsam Kinder aufziehen.
Forschung
Die ersten größeren empirischen Studien über Regenbogenfamilien wurden Ende der 70er Jahre in den USA durchgeführt. Auslöser waren Scheidungs- und Sorgerechtsprozesse lesbischer Mütter. Allerdings nahmen an diesen Studien hauptsächlich homosexuelle Frauen und Männer teil, die aus der Mittelschicht stammten und über einen gehobenen Bildungsstatus verfügten, weshalb keine Repräsentativität angenommen werden kann. Eggen (2003) verweist außerdem auf zu geringe Stichproben dieser Studien und macht darauf aufmerksam, dass wichtige Informationen zum Familienhintergrund - wie beispielsweise die Scheidung der Eltern oder das Coming-Out - unberücksichtigt blieben. Dadurch sei der Einfluss der sexuellen Orientierung der Eltern bzw. anderer Faktoren, wie der oben genannten, nicht genau festzustellen (vgl. auch Wassilios E. Fthenakis und Arndt Ladwig, 2002, Judith Stacey und Timothy J. Biblarz, 2001).
Die Forschung über Regenbogenfamilien gestaltet sich generell sehr schwierig, weil sich viele Lesben und Schwule aus Angst vor Diskriminierung und rechtlicher Benachteiligung bedeckt halten. Vor allem schwule Väter fürchten um ihr Sorgerecht und ziehen es deshalb häufig vor, ein heterosexuelles Familienleben aufrechtzuerhalten (vgl. Fthenakis und Ladwig, 2002, S. 129ff).
Die meisten Untersuchungen die bisher gemacht wurden brachten keine bis wenig signifikante Ergebnisse. Sie konzentrierten sich in erster Linie auf Themen wie Mütterlichkeit, Eltern-Kind-Beziehung, die psychische Gesundheit der Kinder, die Entwicklung ihrer Geschlechtsidentität und ihres Selbstwertgefühls und darauf, ob sie ein Problemverhalten zeigten (vgl. Charlotte Patterson, 2006, Steffens & Thompson, 2003).
Im Mittelpunkt stand die Frage, ob diese Kinder durch die sexuelle Orientierung der Eltern Schaden nehmen. Heute weiß man aus gesicherten Studien, dass dies nicht der Fall ist und sich Kinder in Regenbogenfamilien genauso gut entwickeln wie Kinder in traditionellen Familien. Jansen (2006) schreibt: „Psychosoziale Studien zur Lebenswirklichkeit von Regenbogenfamilien attestieren lesbischen Müttern und schwulen Vätern seit langem eine angemessene Erziehungsfähigkeit und ihren Kindern eine gelungene emotionale, soziale und sexuelle Entwicklung. Dennoch ist ein adäquater, sach- und zeitgemäßer Umgang mit Regenbogenfamilien in Politik und Gesellschaft nicht überall gegeben“ (S. 644).
Für die Zukunft verweist Bernd Eggen (2003) - wie mittlerweile auch andere Forscher - darauf, dass „die Betonung der Unterschiedslosigkeit von Kindern aus homo- und heterosexuellen Familien (…) auf lange Sicht an der Realität vorbeigehen“ und aus politischer Sicht „in die Irre führen“ dürfte. Er betont aber, dass es sich dabei keineswegs um Defizite dieser Kinder handle, sondern einfach nur um Unterschiede (Eggen, 2003, vgl. auch Stacey und Biblarz, 2001, S. 164). Bereits 2001 haben Stacey und Biblarz auf dieses Problem hingewiesen. Auch sie sind der Meinung, dass die Ergebnisse unplausibel sind und geben zu bedenken, dass viele Studien, statt offene Fragestellungen zu untersuchen, dem Maßstab heterosexueller Elternschaft unterworfen sind und deshalb der Blick auf möglicherweise doch vorhandene Unterschiede versperrt sei (vgl. Uli Streib-Brzič & Stephanie Gerlach, 2006, S. 179, Stacey und Biblarz, 2001).
Solange es aber passieren kann, dass homosexuelle Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren und solange Lesben und Schwule bei Adoption, Pflegschaft sowie künstlicher Befruchtung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung abgewiesen werden können, wird die Forschung sehr behutsam bei der Untersuchung von Unterschieden vorgehen. Sie steht also hier zweifellos vor einer großen Herausforderung.
Geschlechtsidentität
Es gibt leider nur wenige Studien, die sich mit der Entwicklung der Geschlechtsidentität von Regenbogenkindern auseinandersetzen. Der Grund dafür dürfte in der schwierigen empirischen Umsetzung zu suchen sein (vgl. Stacey und Biblarz, 2001). Die bisherigen Ergebnisse die es dazu gibt zeigen aber auch hier keine oder nur wenige signifikante Unterschiede zu Kindern aus traditionellen Familien.
Insgesamt gibt es nach Stacey und Biblarz (2001) nur zwei Studien, die grundlegende Hinweise auf den Zusammenhang zwischen der elterlichen und kindlichen Entwicklung der Geschlechtsidentität erbrachten. Es sind dies jene von R. Green et al. aus dem Jahr 1986 und von Tasker und Golombok aus dem Jahr 1997. Diese beiden und die wenigen anderen Studien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, widerlegen, so Stacey und Biblarz (2001), den Anspruch, es bestünden „keine Unterschiede“, da in diesen Studien die Kinder aus den Regenbogenfamilien weniger traditionelles, geschlechtstypisches Verhalten zeigen und gleichgeschlechtlichen erotischen Erfahrungen offener gegenüber stehen als Kinder aus traditionellen Familien. Die Autoren zeigen sich in ihren Ausführungen überrascht, dass gerade dieser Bereich bisher so wenig untersucht wurde, da sich gerade in der sexuellen Orientierung wie auch dem geschlechtstypischen Verhalten theoretisch begründet viel wahrscheinlicher Unterschiede zeigen dürften als in anderen Bereichen (ebenda).
Präzisierung und Eingrenzung der Fragestellung
Für die Bearbeitung des Themas im Rahmen meiner Diplomarbeit stellen sich nun folgende Fragen: Wie entwickeln sich Kinder die in Regenbogenfamilien aufwachsen im Vergleich zu Kindern in traditionellen Familien? Welche Bedeutung hat die Familienkonstellation bzw. die sexuelle Orientierung der Eltern für die Entwicklung der Geschlechtsidentität dieser Kinder? Was bedeutet es beispielsweise für einen Jungen, ohne Vater/männliches Rollenvorbild bzw. für ein Mädchen, ohne Mutter/weibliches Rollenvorbild aufzuwachsen? Schadet es dem Kind in seiner Entwicklung oder besteht darin vielleicht sogar eine Chance, unvorbelastet in die eigene männliche bzw. weibliche Rolle hineinzuwachsen – in eine „neue“ männliche bzw. weibliche Rolle? Und schließlich - wie entwickeln sich Regenbogenkinder in Bezug auf ihre sexuelle Orientierung?
Um aussagekräftige Daten zu erhalten, wurde eine Vergleichsstudie zwischen Regenbogenfamilien und traditionellen Familien durchgeführt. Dafür wurden zwei Fragebögen entwickelt, die einen direkten Vergleich zwischen den beiden Familienformen zuließen und die Beantwortung folgender zentraler Fragestellung ermöglichten:
Wie entwickeln sich Kinder in Regenbogenfamilien in Bezug auf ihre Geschlechtsidentität im Vergleich zu Kindern in traditionellen Familien?
Der Begriff der Geschlechtsidentität umfasst hier die von Wolfgang Mertens (1992) formulierten drei Komponenten der Geschlechtsidentität: die Kern-Geschlechtsidentität, die Geschlechtsrolle und die Geschlechtspartner-Orientierung.
Bezugnehmend auf die von Stacey und Biblarz (2001) sowie Eggen (2003) formulierte Vermutung, dass es tatsächlich einen Unterschied in der Entwicklung der Kinder zwischen den beiden Familienformen geben müsste, wurde eine entsprechende Forschungshypothese für den Bereich der Geschlechtstypizität formuliert. Zur Überprüfung dieser Forschungshypothese wurde die GTS+ (Geschlechtstypizitäts-Skala) eingesetzt - ein Messinstrument, das eine reliable Erfassung von „zwei zentralen Aspekten des geschlechtsrollenbezogenen Selbstkonzepts“ (Christine Altstötter-Gleich, 2004, S. 136) ermöglicht und damit eine konkrete Beantwortung der Fragestellung in Bezug auf die Geschlechtstypizität der Kinder zulässt.
Zusätzlich wurden die Kinder von mir gebeten, für meine Studie eine Zeichnung über ihre eigene „zukünftige Familie“ zu machen. So erhielt ich schließlich einen direkten Zugang zu ihrer eigenen Vorstellungswelt, was den empirischen Teil meiner Arbeit auch für mich abrundete.
Aufbau und Gliederung der Diplomarbeit
Kapitel eins dient der Einführung in das Thema und gibt einen kurzen Überblick über die gesamte Diplomarbeit. In den Kapiteln zwei bis vier werden die theoretischen Grundlagen des Themas erörtert. Kapitel zwei behandelt die Entwicklung der Geschlechtsidentität im Detail. Zum einen geht es hier um die verschiedenen (Lebens-)Bereiche in denen das Geschlecht von Bedeutung ist und zum anderen um die entwicklungspsychologischen Theorien und Ansätze zur Entwicklung der Geschlechtsidentität. Kapitel drei behandelt schließlich den Bereich „Familie und andere Sozialisationsagenten“. Der Wandel der Familie in den letzten Jahrzehnten sowie der Einfluss von Peergroups und anderen Sozialisationsagenten auf die Entwicklung von Mädchen und Jungen werden hier dargestellt. Regenbogenfamilien werden schließlich in Kapitel vier ausführlich behandelt. Ausgehend von einem kurzen geschichtlichen Überblick zur Homosexualität werden die Besonderheiten und Alltäglichkeiten dieser Familienkonstellation näher besprochen; was sind Regenbogenfamilien, wie entstehen sie, worin unterscheiden sie sich von anderen Familienkonstellationen bzw. was haben sie mit ihnen gemeinsam, wie sieht das Familienleben aus und wie entwickeln sich die Kinder in dieser besonderen Familienkonstellation im Allgemeinen sowie bezüglich ihrer Geschlechtsidentität im Speziellen. Kapitel fünf gibt im Anschluss daran einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung und in Kapitel sechs erfolgt die Darstellung der empirischen Umsetzung der Fragestellung. Kapitel sieben und acht dienen schließlich der Zusammenfassung der gesamten Arbeit, der Formulierung einer Schlussfolgerung sowie einem kurzen Ausblick in die Zukunft bezüglich der Forschung auf diesem Gebiet.
2. Entwicklung der Geschlechtsidentität
Wie wird man zur Frau bzw. zum Mann? Was bedeutet es Frau bzw. Mann zu sein? Welche Folgen sind damit verbunden? Warum „denken, fühlen und handeln“ wir unterschiedlich? Und tun wir das wirklich? Haben wir die Freiheit der Entscheidung oder gar keine Wahl?
Diese und viele weitere Fragen beschäftigen seit jeher die Forschung und haben vielfach zu großer Verwirrung und Unstimmigkeiten geführt, statt klare Antworten zu geben.
Einer der namhaftesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Sexualmedizin, Hartmut Bosinski (2000), bringt es auf den Punkt: „Die Herausbildung der Geschlechtsidentität, von Geschlechtsrollenverhalten und –vorstellungen sind seit Jahren Gegenstand einer kaum überschaubaren Fülle von Untersuchungen und Publikationen der Sozialpsychologie, der Differentiellen Psychologie, der empirischen Entwicklungspsychologie usw.“ (S. 112). Sie „gehören zu den spannendsten, aber auch umstrittensten Problemen humanwissenschaftlicher Forschung überhaupt“ (S. 96).
Zur Frage wie sich die Geschlechtsidentität entwickelt, gibt es verschiedene Theorien und Ansätze, auf die ich im Laufe meiner Arbeit noch näher eingehen werde. Zuvor erscheint es mir aber wichtig, noch einige Begriffe zu definieren und auf die Dimensionen des menschlichen Geschlechts einzugehen.
2.1 Geschlechterdimensionen
Dorothee Alfermann (1996, S. 7) schreibt: „Das Geschlecht eines Menschen ist ein Merkmal, das nicht nur die biologische und sexuelle Entwicklung entscheidend beeinflußt, sondern auch für die psychosoziale Entwicklung eines Menschen große Bedeutung hat“ (vgl. dazu auch Eleanor E. Maccoby, 2000, S. 103 u. 352).
2.1.1 Geschlecht
Hier haben sich die beiden Begriffe „sex“ und „gender“, die auf Money ins Jahr 1955 zurückgehen, längst etabliert. Das biologische Geschlecht wird als „sex“, das soziale Geschlecht als „gender“ bezeichnet (Mertens, 1992, S. 25) und ist als solches ein zentrales Forschungsthema, unter anderem auch der „Gender-Studies“, geworden.
2.1.2 Geschlechtsidentität
Aufgrund der Komplexität des Konstrukts „Geschlechtsidentität“ erscheint mir eine umfangreichere Definition des Begriffes unumgänglich.
John W. Money (1973) definierte Geschlechtsidentität „als das Erleben, wie der Betreffende sich in seiner Binnenwahrnehmung als weiblich/männlich über die Zeit hinweg fühlt“ (Money, 1973 nach Mertens, 1992, S. 27).
Dorothee Alfermann (1996, S. 58) betrachtet Geschlechtsidentität als die „Erkenntnis über die Zugehörigkeit der eigenen Person wie auch anderer Personen zum männlichen oder weiblichen Geschlecht“, also als einen biologisch determinierten Sachverhalt.
Philip G. Zimbardo und Richard J. Gerrig (2004, S. 491) definieren Geschlechtsidentität ähnlich als „Bewusstsein des eigenen Mannseins oder Frauseins“ wozu „normalerweise auch das Bewusstsein und die Akzeptanz des biologischen Geschlechts“ gehört.
Für Eleanor E. Maccoby (2000, S. 199) bedeutet Geschlechtsidentität „das Gewahrsein, daß man entweder ein männliches oder ein weibliches Individuum ist und die Integration dieser Erkenntnis in das Selbstkonzept“.
Vera King (2000, S. 245) meint dazu: „Geschlechtsidentität bezeichnet die Kontinuität des Selbsterlebens eines Individuums in Hinblick auf sein Geschlecht und umfasst die Gesamtheit jener Aspekte des Selbst oder der Identität, die als mit dem Geschlecht genuin verbunden angesehen werden.“
Wolfgang Mertens (1992) stellt schließlich fest: „Die Geschlechtsidentität stellt das Erleben gefühlshafter Gewissheit dar, dass man „männliche und weibliche“ Anteile in sich zu einer harmonischen Ganzheit gebracht hat“ (S. 28).
Er betont die Bedeutung, dass diese Erkenntnis aufgrund Selbstattribuierung erfolgt. So kann ein Mann weibliche Einstellungen und Verhaltensweisen entwickeln und sich in seiner so entwickelten Identität trotzdem voll und ganz als Mann fühlen, obwohl er von seiner Umgebung deswegen als weniger männlich oder sogar unmännlich betrachtet wird. Daraus folgernd würde eine Entwicklung die stark zwischen weiblich und männlich polarisiert eine eher neurotische statt einer gesunden Entwicklung der Geschlechtsidentität darstellen. Mertens (1992) führt weiter aus: „Die Idealvorstellung von einem psychisch gesunden und ausgewogenen Menschen ist nach neueren sozialwissenschaftlichen und psychoanalytischen Erkenntnissen und Optionen nicht der männliche oder der weibliche, sondern der Mensch, der männliche und weibliche Anteile integriert hat, was bislang aber manchen Frauen leichter zu fallen scheint als Männern“ (S. 29).
Mertens definiert in Anlehnung an Robert J. Stoller, Money und anderen drei Bausteine der Geschlechtsidentität, auf die ich später noch im Detail eingehen werde. Er unterscheidet dabei die Komponenten Kern-Geschlechtsidentität von Stoller (1968), Geschlechtsrolle und Geschlechtspartner-Orientierung (S. 23f).
Bei Betrachtung der Definitionen wird deutlich, wie schwer es ist, den Begriff „Geschlechtsidentität“ klar abzugrenzen. Dadurch gestaltet sich die Forschung auch sehr schwierig und vielschichtig.
2.1.3 Geschlechtsrollen
Der Begriff „Geschlechtsrolle (gender role)“ stammt ebenfalls von Money aus dem Jahr 1955. Er verstand darin den verhaltensmäßigen Ausdruck der Geschlechtsidentität in der Interaktion mit anderen. Mertens (1992) spricht in seiner Definition nicht nur von Verhalten sondern auch von Persönlichkeitsmerkmalen, die ganz klar als typisch weiblich oder typisch männlich - sowohl interaktions- als auch situationsabhängig - zu sehen sind (Mertens, 1992, S. 25ff). Und Hartmut A. G. Bosinski (2000) betont schließlich dabei das Kontinuum im Empfinden zwischen typisch männlich und typisch weiblich, das im Geschlechtsrollenverhalten zum Ausdruck kommt (S. 100).
Geschlechtsrollen können schließlich auch als „kognitive Konstrukte“ (Alfermann, 1996, S. 33) verstanden werden, die sich auf „Erkenntnisse, Einstellungen, Präferenzen und Handlungsweisen [beziehen], die üblicherweise mit einem bestimmten Geschlecht verbunden“ sind (ebenda, S. 58). Dabei spielen der jeweilige kulturelle Rahmen, in dem sich die Geschlechtsrollen entwickeln und die damit verbundenen normativen Erwartungen bzw. definierten Verhaltensregeln, beispielsweise im sozialen Umgang, aber auch in der Arbeitsteilung in Beruf und Familie, eine bedeutende Rolle, so Alfermann (1996, S. 31 u. 33, vgl. auch Mertens, 1992, S. 25, Zimbardo, Gerrig, 2004, S. 491).
Die Übernahme der Geschlechtsrolle bzw. die Übernahme der damit verbundenen Erwartungen in das Selbstbild bezeichnet Alfermann (1996) als maskuline oder feminine Identität bzw. Geschlechtsrollenidentität. Sie sieht darin den über die Geschlechtsidentität hinausgehenden „psychologisch und sozial determinierten“ kognitiven Erwerb von geschlechtsbezogenen „Eigenschaften, Verhaltensweisen, Berufen, Rollen usw.“ (ebenda, S. 58, vgl. dazu Kap. 2.1.4).
2.1.4 Geschlechtsstereotype
Unter „Stereotype“ können allgemeine Annahmen verstanden werden, die sich auf bestimmte Eigenschaften von Personengruppen beziehen, „im Laufe der Sozialisation erworben“ werden und über die gesamte Lebensspanne stabil bleiben, so Alfermann (1996, S. 9 u. 10). Maccoby (2000, S. 198) bezeichnet Geschlechtsstereotype als „Prototypen“, die durch ein Bündel von Eigenschaften gekennzeichnet sind, die das Verständnis von männlichem und weiblichem Verhalten definieren. Es sind also „typische Eigenheiten von Frauen und Männern“ (Alfermann 1996, S. 31) die in den Bereichen Kompetenz, Aktivität und Emotionalität zu finden sind.
Zu den weiblichen Stereotypen zählen beispielsweise Emotionalität, Einfühlungsvermögen, Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft - Frauen sollen sanft, freundlich und nachgiebig sein. Als männliche Stereotype gelten Durchsetzungsfähigkeit, Kompetenz und Dominanz - von Männern werden sachbezogenes Denken, technisches Interesse, Unabhängigkeit sowie Führungsqualitäten erwartet (Alfermann, 1996, S. 21 u. 22, Barbara Rendtorff, 2003, S. 26).
Die Stereotypenforschung bestätigt über die Jahrzehnte hinweg ein stabiles Bild, das interkulturell betrachtet große Gemeinsamkeiten aufweist. Es gibt beispielsweise keine Kultur, in der weibliche und männliche stereotype Eigenschaften umgekehrt auftreten. Insgesamt bestehen mehr männliche Stereotypen, die nicht nur stärker ausgeprägt sind, sondern auch gesellschaftlich höher bewertet werden (Alfermann, 1996, S. 14 u 17). Bereits im Alter von zwei bis drei Jahren sind Geschlechtsstereotype ansatzweise bei Kindern zu finden. Im Alter von fünf Jahren sind sie so weit ausgeprägt, dass sie inhaltlich jenen von Erwachsenen entsprechen und bis zum Ende der Grundschule ist die Entwicklung schließlich, so wird vermutet, zur Gänze abgeschlossen (ebenda, S. 13). Entsprechende Messungen an Kindern zeigen, dass Stereotype im Alter von sieben Jahren ihre stärkste Ausprägung erreichen, auch wenn danach noch weitere gebildet und bestehende erweitert werden. Zwischen sechs und elf Jahren werden stereotype Verhaltensweisen, Eigenschaften und Einstellungen schließlich wieder flexibler - vor allem bei Mädchen, die hier eine wesentlich offenere Einstellung entwickeln als Jungen (Maccoby, 2000, S. 210, 215 u. 216, vgl. Rendtorff, 2003, S. 149).
Die Ursprünge der Geschlechtsstereotypen sind, so Alfermann (1996), in der unterschiedlichen Machtverteilung zwischen Mann und Frau „im öffentlichen und religiösen Leben“ zu suchen, die sich schließlich z.B. nicht nur in der geschlechtstypischen Arbeitsteilung widerspiegelt, sondern auch im privaten Leben. Vielfach wird bei der Suche nach dem Ursprung aber auch von biologischen Ursachen ausgegangen und beispielsweise eine Verknüpfung zwischen Gebärfähigkeit und allen weiteren Tätigkeiten, die mit Pflege, Fürsorge und Nahrungszubereitung zusammenhängen, hergestellt (ebenda, S. 20 u. 21).
Erwerb von Stereotypen – Geschlechtstypisierung (sex-typing)
Bis „Anfang der siebziger Jahre“ ging die Psychologie davon aus, dass sich dieser Prozess „im Wesentlichen während des Kindesalters im Rahmen der familiären Sozialisation abspielt“, so Hanns M. Trautner (2002, S. 651 u. 652). Heute weiß man allerdings, dass Geschlechtsstereotype omnipräsent sind und sowohl durch eigene Beobachtung als auch durch den Austausch mit der Umwelt erlernt werden. Die wichtigsten Sozialisationsagenten die dabei eine Rolle spielen sind Eltern, Peergroups, LehrerInnen und vor allem auch die Medien (Alfermann, 1996, S. 24 u. 25). Maccoby (2000) schreibt: „Kulturelle Vorstellungen über die Geschlechter finden ihren Ausdruck ebenso in Mythen, in Spielen und in Geschichten wie im alltäglichen Leben. Sie “liegen in der Luft“ und bieten sich den Kindern in einer Vielzahl von Quellen an“ (S. 192). So sammeln Kinder im Laufe ihrer Entwicklung Informationen, die sich in ihrem Wissen über Geschlechtsstereotype niederschlagen - wobei allerdings zwischen dem, was Kinder einerseits über Geschlechtsstereotype wissen und dem, was sie andererseits in ihr eigenes Selbstkonzept aufnehmen, zu unterscheiden ist (ebenda, S. 195).
Der gesamte Prozess, bei dem Geschlechtsstereotype und Geschlechtsrollenerwartungen kognitiv erlernt, entsprechende Einstellungen und Vorlieben dazu entwickelt und in das eigene Selbstbild bzw. Verhaltens- oder Rollenrepertoire übernommen werden, wird als Geschlechtstypisierung (sex-typing) bzw. Geschlechts(rollen)erwerb bezeichnet (Alfermann, 1996, S. 57). Trautner (2002) spricht hier auch von Geschlechtsrollenübernahme oder Geschlechtsrollenidentifikation.
2.1.5 Geschlechtstypische Unterschiede
Geschlechtstypische Unterschiede können sich auf „körperliche, psychische oder soziale Eigenschaften, Funktionen und Verhaltensweisen“ beziehen, so Bosinski (2000, S. 99). Maccoby & Jacklin haben 1974 erstmals alle Fakten zusammen getragen und im Zuge einer Metaanalyse eine Reihe an geschlechtstypischen Unterschieden gefunden, die mehr oder weniger stark ausgeprägt sein können. Dabei handelt es sich um Unterschiede in räumlichen Fähigkeiten, Aggression, prosozialem Verhalten, sprachlichen Fähigkeiten, Interesse an okkasionellen Sexualkontakten sowie der sexuellen Orientierung (Bosinski, 2000, S. 108 u. 109, vgl. dazu Kapitel 2.2.2).
Wie Rendtorff (2003) schreibt, zeigt die Forschung der letzten Jahrzehnte allerdings, dass es tatsächlich nur wenige Bereiche gibt, in denen empirisch gesicherte Unterschiede bestehen. Im Bereich der körperlichen Merkmale sind dies beispielsweise ein durchschnittlich geringeres Geburtsgewicht bzw. eine geringere Geburtsgröße bei Mädchen - der Unterschied besteht die gesamte Kindheit über; „ein Reifungs- bzw. Entwicklungsvorsprung der Mädchen (von ein bis zwei Jahren) über den gesamten Entwicklungszeitraum bis ins frühe Erwachsenenalter und die höhere Vulnerabilität (Krankheitsanfälligkeit) von Jungen“ (Rendtorff, 2003, S. 59).
Alfermann (1996) kommt ebenfalls zu dem Schluss: „Der auffallendste Befund zu Geschlechterunterschieden besteht darin, daß sie sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten weiter verringert haben“ (S. 160). Vor allem konnten hinsichtlich der psychologischen Merkmale von Frauen und Männern immer weniger bzw. gar keine Geschlechtsunterschiede mehr nachgewiesen werden.
Im Gegensatz dazu sprechen aber Geschlechtsstereotypen nach wie vor von bedeutsamen Unterschieden, die sich in unserer Gesellschaft beispielsweise noch immer in einer auffallend stark ausgeprägten geschlechtstypischen Arbeitsteilung zeigen. Hier prallen, so Alfermann (1996, S. 8), die beiden Geschlechterdimensionen „individuelles Merkmal“ und „soziale Kategorie“ aufeinander. Auch Rendtorff (2003) betont hier einen starken Zusammenhang mit Geschlechtsrollenerwartungen, die im Leben eine ganz große Rolle spielen und ihrer Meinung nach zu viel stärkeren Entwicklungsunterschieden zwischen den Geschlechtern führen, als dies aufgrund von psychologischen Erkenntnissen zu erwarten wäre (S. 116 u. 117).
Dennoch - vergleicht man wiederum das „psychologische Geschlecht“ mit dem „biologischen Geschlecht“ so ist festzustellen, dass das psychologische Geschlecht eine große Variabilität aufweisen kann, beispielsweise wenn „ein feminines Selbstbild (…) mit maskulinen Eigenschaften“ einhergeht (Alfermann, 1996, S. 58).
Abschließend kann gesagt werden, dass sich im Bereich der „Geschlechtsunterschiede“ immer wieder lebhafte Diskussionen entzünden und es keineswegs klar ist, ob es tatsächlich welche gibt bzw. wenn ja, wie groß diese letztendlich wirklich sind. Maccoby (2000) gesteht schließlich, dass sie vor Jahren selbst noch eine ganz andere Meinung dazu vertreten hatte als heute. In ihrem Buch „Psychologie der Geschlechter“ kommt sie zu dem Schluss, dass das Geschlecht sowohl in der Kindheit als auch später „eine ganz besondere Rolle spielt“, da die Unterschiede in jedem Fall groß genug sind „um wichtige soziale Konsequenzen nach sich zu ziehen“, wie die Zusammenfassung von Alice Eagly über verschiedene Metaanalysen aus dem Jahr 1995 zeigt (ebenda, S. 103).
In Kapitel 2.2.2 werden einige der von Maccoby und Jacklin 1974 aufgelisteten Geschlechtsunterschiede noch im Detail besprochen. Weitere wichtige Aspekte und Geschlechtsunterschiede die dort nicht behandelt werden, aber für eine vollständige Bearbeitung des Themas von Bedeutung sind, möchte ich hier aufgreifen. Es sind dies:
Geschlechtshomogene Gruppen
Geschlechtshomogene Gruppen entstehen aus der Interaktion der Kinder selbst; es besteht kein Druck vonseiten der Erwachsenen wie angenommen werden könnte. Gleichgeschlechtliche Gruppen haben viele Funktionen. Unter anderem tragen sie bei der Entwicklung geschlechtsbezogener Normen bei (Maccoby, 2000, S. 362 u. 375).
Geschlechtsunterschiede zeigen sich beispielsweise darin, dass Jungenfreundschaften weniger intim sind als Mädchenfreundschaften. Mädchen spielen lieber in Dyaden - sie fühlen sich wohler darin (ebenda, S. 124) und sie suchen in gleichgeschlechtlichen Gruppen in erster Linie einen emotionalen Austausch, während Jungen körperliche Stimulierung wichtig ist. Jungen suchen die direkte Konfrontation - ihre Spielinteressen sind daher „viel stärker aktivitäts- und körperbetont“ als die der Mädchen (Rendtorff, 2003, S. 146). Sie nehmen grundsätzlich auch einen größeren Raum für sich in Anspruch, beispielsweise beim Fußballspielen oder Herumtoben, während sich Mädchen eher auf einen kleineren Bereich beschränken. Der Explorationsdrang bei den Jungen wird schließlich nicht nur eher geduldet, sondern auch stärker gefördert als bei Mädchen, bei denen im Gegensatz dazu viel mehr Wert auf Wohlverhalten und Reinlichkeit gelegt wird (ebenda, S. 98, 105 u. 106). Maccoby (2000) meint dazu, dass sich Mädchen grundsätzlich genauso aktiv verhalten wie Jungen, sich aber eher anpassen und an Beschränkungen halten, z.B. in Gebäuden wie Schulen oder Kindergärten. Außerdem weist die Autorin darauf hin, dass Jungen ihr Aktivitätsniveau ganz erheblich steigern, wenn andere Kinder mit im Spiel sind, während bei allein spielenden Jungen kein Unterschied zu Mädchen zu erkennen ist (S. 130 u. 131).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Verhältnis zwischen Mädchen und Jungen in der Kindheit von einer „Geschlechtertrennung“ gekennzeichnet ist, die sich erst in der Adoleszenz langsam aufzulösen beginnt. Somit entwickeln sich in Mädchen- bzw. Jungengruppen zweifellos unterschiedliche Kulturen und auch „Identitäten“, so Maccoby (2000).
Sprache
Für die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen ist die Sprache von grundlegender Bedeutung. Im Laufe der kindlichen Entwicklung wird sie langsam immer differenzierter, sodass sich aus einem anfänglichen Lallen schließlich ein Kommunikationsmittel entwickelt, mit dem „Ironie, Schwindel und Mehrdeutigkeit“ möglich sind, so Rendtorff (2003, S. 88ff).
Die geschlechtstypischen Formen, die die Sprache zweifelsfrei besitzt, dürften, so die derzeitige Meinung, auf unterschiedliche Sozialisationserfahrungen zurückzuführen sein und sich schon recht früh in geschlechtstypischen rhetorischen Fähigkeiten und Stilen niederschlagen. Mädchen verfügen beispielsweise über einen „emotionalen und bindungsbetonten“ Sprachstil, im Gegensatz zu Jungen, die einen „distanz- und abgrenzungsbetonten“ Sprachstil haben und sich in der Kommunikation prinzipiell stärker durchsetzen. Im Erwachsenenalter haben Frauen schließlich einen eher „explorativen“ Sprachstil ausgebildet und unterscheiden weniger „zwischen Sprech- und Hörposition“, während Männer einen eher „expositorischen“ Sprachstil entwickelt haben, der sich in einem verstärkten Interesse an der Sprecher- bzw. Expertenrolle zeigt (ebenda, S. 130ff).
Im Umgang mit Männern benutzen Frauen, so Maccoby (2000, S. 246), verstärkt eine durch ausgesprochene Zurückhaltung gekennzeichnete Sprechweise und bei Männern zeigt sich, dass sie im Gespräch mit Freundinnen auch über ihre Gefühle sprechen können, was im Gespräch mit anderen Männern selten der Fall ist (ebenda, S. 250 u. 251).
Auch in der Konfliktbearbeitung gibt es geschlechtstypische Unterschiede. Zwischen Mädchen treten Konflikte seltener auf. Ist dies doch der Fall, so ist ihr Verhalten von einer konfliktmildernden Umgangsweise geprägt, die auf ein Miteinander ausgerichtet ist. Jungen stellen sich im Gegensatz zu Mädchen gerne in den Mittelpunkt, sie prahlen und drohen öfter und gehen egoistischer vor. Sie ignorieren ihren Gesprächspartner oder schneiden ihm das Wort ab und erteilen weit öfter direkte Befehle als Mädchen (vgl. dazu Maccoby, 2000, S. 68 u. 368).
Die Ursache für diese unterschiedliche Art der Interaktion sieht Maccoby (2000) in der unterschiedlichen Art der Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Mütter thematisieren Gefühlszustände beispielsweise häufiger mit ihren Töchtern als mit ihren Söhnen (S. 173). Nicht nur, dass Jungen von den Eltern wesentlich seltener mit Gefühlsthemen konfrontiert werden, diese scheinen Gefühlsäußerungen bei ihren Söhnen sogar „aktiv zu unterdrücken“ (ebenda, S. 177).
Mehrere Studien lassen schließlich erkennen, dass Mädchen in der Entwicklung der Sprache einen Vorsprung aufweisen, wofür, so wird vermutet, neurale Substrate ausschlaggebend sein könnten. Auch im Bereich der „emotionalen Selbstregulation“ entwickeln sich Mädchen, wie es scheint, schneller als Jungen (ebenda, S. 137, 138 u. 149).
Naturwissenschaftliches Gebiet
Auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet gibt es zum Thema „Geschlechtsunterschiede“ bereits relativ viele Ergebnisse, sodass sich die Autoren mittlerweile einig sind, dass es hier keine anlagebedingten Unterschiede gibt, sondern sozialisatorische Ursachen dafür verantwortlich sind. Erst in der Pubertät erzielen Jungen hier bessere Ergebnisse, was darauf zurückzuführen sein dürfte, dass Mädchen in dieser Zeit beginnen, sich intensiv mit ihrem Selbstbild als Frau auseinander zu setzen und deshalb andere Prioritäten setzen. Hinzu kommt das fehlende Selbstvertrauen von Mädchen im naturwissenschaftlichen Bereich, was auf eine mangelnde Unterstützung von elterlicher aber auch schulischer Seite zurückgeführt werden kann und zusätzlich zu Motivationsschwächen führt (Rendtorff, 2003, S. 123ff). Väter halten bei ihren Söhnen beispielsweise länger an einem hohen Begabungskonzept fest als bei ihren Töchtern. Jungen werden sowohl von Eltern- als auch von LehrerInnenseite generell mehr gefordert und können dadurch wesentlich mehr Selbstvertrauen entwickeln als Mädchen. Dies zeigt sich schließlich auch in einer positiveren Selbstdarstellung von Jungen (Rendtorff, 2003, S. 140).
Daneben haben Mädchen und Jungen unterschiedliche Denk- und Problemlösestile, die in schulischen Belangen eine Rolle spielen. Mädchen sind „prädikative Denker“ und Jungen „funktionale Denker“, das bedeutet, Mädchen denken länger über den Gesamtzusammenhang einer Aufgabe nach und spielen Lösungen zuerst gedanklich durch, während Jungen sofort beginnen, Lösungen auszuprobieren und so aus den gemachten Fehlern lernen. Rendtorff (2003) ist der Meinung, dass sich dadurch Leistungsunterschiede beispielsweise in Chemie und Physik erklären ließen und somit eine dementsprechende Anpassung des Unterrichtes unbedingt notwendig sei.
Aggression und Gewalt
Aggression ist als „aktiver Triebanteil in allen menschlichen Handlungen enthalten“, so Rendtorff (2003, S. 176). Auch wenn Studien ergaben, dass Eltern aggressives Verhalten bei Mädchen und Jungen gleichermaßen tolerieren bzw. verbieten, so lassen sich doch ganz klar Geschlechtsunterschiede feststellen, so Maccoby (2000, S. 171). Als Ursache dafür sieht sie unter anderem aber doch auch die tolerantere Haltung, die Eltern und LehrerInnen Jungen entgegenbringen (S. 236). Jungen erhalten in diesem Bereich außerdem von ihren Vätern „mehrdeutige Botschaften“ (ebenda, S. 172) - Väter vermitteln ihren Söhnen beispielsweise die Erwartung, sich „wie ein Mann“ zu benehmen, was aggressives Verhalten gewöhnlich miteinschließt.
Nach Maccoby (2000) sind außerdem pränatale hormonelle Einflüsse zweifellos zum Teil für aggressives Verhalten mitverantwortlich (S. 236). Rendtorff (2003) stellt allerdings dazu fest, dass die Alltagsmeinung, Männer seien „von Natur aus aggressiver“ und dass dies „mit dem Testosteron zusammen[hinge]“ nicht beweisbar sei (S. 201).
Der Begriff der Gewalt ist vor allem im Alltagsverständnis ganz schwer von dem der Aggression zu trennen. Dennoch ist es wichtig hier klar zu unterscheiden. Reicht die Sprache nicht mehr aus um Spannungen auszugleichen, kommt es zur Gewalt (Rendtorff, 2003, S. 177 u. 178).
Gewaltverbrechen sind „eine ganz überwiegend männliche Domäne“ (ebenda, S. 175); es überrascht deshalb auch nicht, dass bei den in psychologischen Beratungsstellen erfassten Fällen bei Jungen „antisoziales und aggressives Verhalten“, bei Mädchen hingegen Selbstwertprobleme, Trennungs- bzw. Verlustängste und suizidale Handlungen überwiegen.
Untersuchungen zur Aggression ergaben schließlich, dass - obwohl Mädchen/Frauen und Jungen/Männer „quantitativ etwa gleich aggressiv sind“ - diese völlig konträr ausagiert wird (ebenda, S. 189). Bei Mädchen überwiegen verdeckte Formen von Aggression, bei denen sie beispielsweise hinterlistiges oder manipulatives Verhalten an den Tag legen. Sie benutzen eher verbale Mittel wie Anschreien, Auslachen oder Beschimpfen (ebenda, S. 182). Jungen greifen im Gegensatz dazu häufiger zu körperlichen Mitteln wie Schlagen oder Treten, wie Studien mehrfach belegen. Eine von Rendtorff (2003) angeführte Studie von Mirjam Felten (o. A.) belegt hierzu, dass Kinder mit höherer Schuldbildung generell weniger zu körperlicher Gewalt neigen - statt sich zu prügeln ziehen sie eine verbale Auseinandersetzung vor (Rendtorff, 2003, S. 177).
Weiters tragen Frauen Probleme häufiger am eigenen Körper aus als Männer. Sie leiden beispielsweise an Magersucht, Medikamentenmissbrauch oder Depressionen während Männer stärker nach außen gehen. Sie versuchen Probleme über Dritte z.B. durch Körperverletzungen oder Selbstgefährdung durch Alkohol oder im Straßenverkehr zu kompensieren (ebenda, S. 231 u. 243).
Auf der Suche nach Ursachen für geschlechtstypische Unterschiede in den Bereichen Aggression und Gewalttätigkeit stellt Rendtorff (2003) schließlich fest, dass Mädchen bzw. Frauen oft ein Problem mit Selbstständigkeit, Autonomie und Abgrenzung haben, dass sie Konflikte nur schwer aushalten können und Schwierigkeiten haben, jemanden zurückzuweisen oder zu kritisieren. Jungen bzw. Männer haben im Gegensatz dazu „oftmals Probleme im Bereich [der] Beziehungsfähigkeit“. Es fällt ihnen schwer Empathie zu zeigen, sich anderen anzuvertrauen, sich auf andere einzulassen, Schwächen auszuhalten oder Grenzen zu akzeptieren (ebenda, S. 188). Beispielsweise - auch wenn Jungen im Grundschulalter „weder größer noch stärker als Mädchen“ sind, noch bessere schulische Leistungen erbringen, so wirken in dieser Zeit Männlichkeitsstereotype doch schon so stark, dass Jungen meinen, diesen Erwartungen gerecht werden zu müssen und sich deshalb stark, aktiv und überlegen geben, auch wenn sie das gar nicht sind (ebenda, S. 191).
Sexualität
Auch wenn Mädchen und Frauen im Bereich der Sexualität mittlerweile selbstbewusster zu ihren Bedürfnissen stehen und diese einfordern, so können sie nach wie vor keineswegs ein „freies Sexualleben“ genießen, wie dies in der heutigen Zeit immer wieder betont wird (Rendtorff, 2003, S. 211ff). Männer haben nach wie vor die Rolle des Eroberers, des Erfahrenen, des Aktiven. Ihnen wird es zugestanden, sexuelle Kontakte mit vielen verschiedenen Frauen zu haben, während umgekehrt Frauen dieses Recht nach wie vor abgesprochen wird (Maccoby, 2000, S. 252). So gab es nach Meinung von Rendtorff (2003) auch in diesem Bereich bisher nur oberflächliche Veränderungen (S. 226).
Untersuchungen im Bereich der Sexualität zeigen beispielsweise, dass Mädchen an sexuellen Erlebnissen, bei denen es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, mehr Spaß haben als Jungen, für die der Geschlechtsakt ausgesprochen wichtig ist. Geht es nur um Körperkontakt, so empfinden Jungen diesen statistisch gesehen „signifikant weniger angenehm als Mädchen“ (ebenda, S. 217), die wiederum beim Thema Selbstbefriedigung unsicherer sind als Jungen.
Nicht nur bei der Entwicklung der Sexualität als solche, sondern auch bei der Entwicklung des Geschlechtstriebes im Speziellen, spielen eine Reihe von Einflussfaktoren eine bedeutsame Rolle. Diese sind beispielsweise die Medien, die vielfach ein ganz falsches Bild von Sexualität vermitteln und so zu einem großen Erfolgsdruck bei Jugendlichen führen. Dazu gehört auch der gesellschaftliche Druck, der, so ist die Autorin überzeugt, der Grund dafür ist, dass beispielsweise sehr viele Jugendliche ihre gleichgeschlechtliche Neigung unterdrücken (ebenda, S. 214).
Abschließend sei auf die Studie von Clement aus dem Jahr 1984 hingewiesen, die belegt, dass Männer eher als Frauen dazu neigen, „nichtsexuelle Spannungen und Konflikte auf sexuelle Weise auszudrücken“ und dass Frauen ein größeres Repertoire an emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten besitzen, während Männer auch in ihrer emotionalen Erlebnisweise stärker blockiert sind. Dementsprechend kreisen die sexuellen Phantasien von Frauen um Themen wie Leidenschaft, Verführung und Hingabe, während sich die Phantasien von Männern um Erobern und Besitzen drehen (Rendtorff, S. 226ff).
2.2 Verschiedene Theorien und Ansätze
Trautner (2002, S. 665) schreibt: „Erklärungsansätze für die Entwicklung der Geschlechtsidentität versuchen die Frage zu beantworten, wie aus biologisch männlichen oder weiblichen Individuen (psychologisch) maskuline oder feminine Persönlichkeiten werden.“
Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts dominierte die simple Vorstellung, dass psychische Geschlechtsunterschiede von körperlichen Geschlechtsunterschieden bestimmt seien. Daneben galten Frauen aufgrund ihrer Geschlechtlichkeit als minderwertig, was vor allem von religiösen und/oder wissenschaftlichen Seiten vertreten wurde. Erst politisch-ökonomische Veränderungen machten es möglich, dass sich Frauenbewegungen etablieren konnten und Ansichten wie diese grundlegend in Frage gestellt wurden. Auch „sexuologische und psychoneuroendokrinologische Forschungen“ brachten Ergebnisse, die in der darauffolgenden Zeit die Meinung entstehen ließen, dass für die Entwicklung der Geschlechtsidentität in erster Linie „sozialisatorische und psychosoziale“ Faktoren verantwortlich seien (Bosinski, 2000, S. 97). Daneben gab es aber auch damals schon biopsychosoziale Ansätze, wie sie beispielsweise von Money vertreten wurden. Die Forschung der letzten Jahre brachte erneut Ergebnisse, die möglicherweise ein Umdenken in Richtung Biologie erforderlich machen könnten (ebenda).
Betrachtet man das Thema „Geschlechtsidentität“ von einem entwicklungspsychologischen Standpunkt aus, so spricht Trautner (2002) von drei aktuellen Hauptansätzen, die als einander ergänzend zu betrachten sind: der biologische, der sozialisationstheoretische und der kognitive Ansatz (S. 665 u. 666).
Obwohl der psychoanalytische Ansatz heute für viele nur noch historische Bedeutung zu haben scheint, würde ich meinen, dass bei der Behandlung dieses Themas kein Weg daran vorbei führt. Schließlich war es Freud, der sich als erster mit der „psychosexuellen Entwicklung“ des Menschen auseinander gesetzt hat. An ihm und seinen Theorien orientierten sich die Wissenschaftler seiner Zeit genauso wie jene, die nach ihm kamen. Dadurch ist die Psychoanalyse für die Frage der Entwicklung der Geschlechtsidentität auch heute noch von grundlegender Bedeutung.
2.2.1 Psychoanalytische Ansätze
Die Geschlechtsidentität ist wie bereits erwähnt ein sehr komplexes Konstrukt, das durch vielschichtige Erfahrungen und Einflüsse in den verschiedensten Bereichen des Lebens mitbestimmt wird. Die Psychoanalyse als „Konfliktpsychologie“ geht bei der Frage nach der Entwicklung der Geschlechtsidentität im Gegensatz zu den anderen Ansätzen davon aus, dass es sich um einen durch unbewusste Konflikte bedingten störanfälligen Prozess handelt (Mertens, 1992, S. 10, 50).
Freud hat den Begriff der Geschlechtsidentität selbst noch nicht verwendet. Er sprach von „sexueller Identität“ und entwickelte aufbauend auf seinen analytischen Erkenntnissen die Triebtheorie und die Phasenlehre.
Zu seiner Zeit herrschte eine starke Geschlechterspannung, die auch in der Wissenschaft ihren Niederschlag fand. In seiner Auseinandersetzung mit Geschlechterdifferenzen, die durch den Zeitgeist stark mitgeprägt war, vertrat er die Vorstellung der „Minderwertigkeit der Frau“ - einer defizitären Männlichkeit des weiblichen Körpers durch das Fehlen des Penis. Wegen seiner Theorien wurde er nicht nur von feministischer Seite angegriffen sondern auch in den eigenen Reihen heftig kritisiert, wie z.B. von C.G. Jung oder Alfred Adler. 1969 wurde schließlich der Begriff der „sexuellen Identität“ von der APA (American Psychological Association) durch den Begriff der „Geschlechtsidentität“ ersetzt. (Objekt-) Beziehungstheorien sowie selbstpsychologische Ansätze und affektive Prozesse traten immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses - die Triebtheorie verlor damit ihre Bedeutung (Mertens, 1992, S. 21ff).
Die Auseinandersetzung mit der Geschlechtlichkeit fand zu dieser Zeit vermehrt von einem biologischen, vor allem aber auch von einem sozialen Standpunkt aus statt. In den 60er und 70er Jahren interessierte weniger die Differenz der Geschlechter, als viel mehr die Entwicklung der Identität in Zusammenhang mit der Frage der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau (Vera King, 2000, S. 240ff).
Freuds Theorien
Triebmodell
Freuds „Triebkonflikt-Paradigma“ geht davon aus, dass das ganze Leben des Menschen letztlich von seinen Trieben gesteuert wird. Diese tragen stets eine sexuelle Komponente in sich und führen dadurch immer wieder zu Konflikten, welche wiederum Abwehrmechanismen aktivieren. Der Triebbegriff selbst war von Freud als „Schnittstelle“ zwischen Körperlichem und Seelischem gedacht; die Energie des Sexualtriebes bezeichnete er als „Libido“ (vgl. Rendtorff, 2003, S. 45ff).
Gerade das „Triebkonflikt-Paradigma“, das unter anderem Objektbeziehungen zu wenig berücksichtigt, war der Grund, warum die Psychoanalayse und Freud massiv angegriffen wurden und sich andere Richtungen wie die „Individualpsychologie“ von Alfred Adler, die „Tiefenpsychologie“ von C.G. Jung oder die „Selbstpsychologie“ von Heinz Kohut entwickeln konnten (vgl. Reimut Reiche, 2004, S. 14ff).
Dennoch ist Mertens (1994) davon überzeugt, dass die triebtheoretische Sichtweise auch heute noch von Bedeutung ist, allerdings verknüpft mit familiendynamischen und objektbeziehungstheoretischen Konzepten (S. 14 u. 15).
Phasenlehre
Freud war der Meinung, dass die Libido in der Entwicklung des Kindes ganz bestimmte, an einzelne Körperregionen orientierte, Phasen durchläuft. Diese Phasen werden von den verschiedenen Autoren zum Teil unterschiedlich bezeichnet oder differenziert betrachtet. Mertens (1992, S. 10) führt hier die orale, die anale, die phallische und die ödipale Phase sowie die Latenz und die Pubertät an. In der Adoleszenz kommt es schließlich zur „Unterordnung aller sexueller Partialtriebe unter den Primat der Genitalien“ zum Zweck der Fortpflanzung, so Freud (1917, S. 323).
Von zentraler Bedeutung für die Entwicklung der „sexuellen Identität“ ist dabei die „ödipale Phase“, in der das Kind vor die Aufgabe gestellt ist, den „Ödipuskomplex“ zu überwinden und sich mit elterlichen Anteilen zu identifizieren, was zur Ausformung von „Über-Ich“ und „Ich-Idealen“ führt.
Ödipuskomplex
Jungen haben in der phallischen Phase den Ödipuskomplex zu überwinden, indem sie ihr sexuelles Begehren, das sie der Mutter gegenüber hegen, aufgeben und sich mit dem Vater identifizieren. Möglich wird dies nach Freud durch die Angst vor der Kastration durch den Vater. Der Sohn identifiziert sich mit dem Vater und verwandelt die sexuelle Komponente der Beziehung zur Mutter in eine zärtliche. Beim Mädchen steht zu Beginn der ödipalen Phase ebenfalls das sexuelle Interesse am gegengeschlechtlichen Elternteil, aber anstelle der Angst vor Kastration tritt, so Freud, der Penisneid und die Identifikation mit der Mutter, die aus Angst vor Liebesverlust und aufgrund von Schuldgefühlen erfolgt (Trautner, 2002, S. 665). Das weibliche Gegenstück zum Ödipuskomplex wurde von C.G. Jung als „Elektrakomplex“ bezeichnet, was von Freud allerdings abgelehnt wurde (vgl. Mertens, 1994, S. 24 u. 26).
Freuds Auffassungen in Bezug auf den Ödipuskomplex sind heute nicht mehr zutreffend. Dennoch ist er für Mertens nach wie vor von Bedeutung. Er betont dazu allerdings: „Aus einer bloßen Reifungstheorie muß (…) eine psychoanalytische Sozialisationstheorie des Ödipuskomplexes werden, die auch die Phantasien, Konflikte und Haltungen der Eltern mitberücksichtigt“ (ebenda, S. 21). Wir wissen heute, dass auch die elterliche Sexualisierung von Wünschen und Phantasien in der Interaktion mit dem Kind eine bedeutende Rolle spielt.
Penisneid
Reiche (2004) drückt die Einstellung Freuds zum weiblichen Körper sehr nüchtern aus. Er meint: „Freud neigte dazu, die Frau als ein männliches Mängelwesen, als kastrierten Mann zu sehen“ (S. 23). Er betont allerdings weiters, dass Freud „hier die Dinge ganz körperlich“ sah. Freud (1924) selbst schreibt beispielsweise dazu: „Das Kind nimmt durch die Vergleichung mit einem männlichen Gespielen wahr, daß es „zu kurz gekommen“ ist, und empfindet diese Tatsache als Benachteiligung und Grund zur Minderwertigkeit“ (S. 249).
Freud (1923) sprach außerdem von einem „Primat des Phallus“ (S. 239) in der kindlichen Genitalorganisation. Als konstitutiv für die Bildung der weiblichen Identität sah er beispielsweise den Moment der Erkenntnis des anatomischen Geschlechtsunterschiedes durch das Mädchen (vgl. Mertens, 1994, S. 37).
Freuds Sichtweise der Weiblichkeit musste zwangsläufig zu heftiger Kritik führen, er selbst gesteht ja auch: „Im ganzen muß man aber zugestehen, daß unsere Einsichten in diese Entwicklungsvorgänge beim Mädchen unbefriedigend, lücken- und schattenhaft sind“ (Freud, 1924, S. 250, vgl. dazu Rendtorff, 2003, S. 53ff).
Vaginalneid
Die heutigen Erkenntnisse lassen vermuten, dass es neben dem Penisneid beim Mädchen auch einen Brust- und Vaginalneid beim Jungen gibt. Mertens (1994) spricht sogar davon, dass der Junge einem intensiven „Gebärneid“ (S. 59) ausgesetzt ist.
Penisneid und Vaginalneid als Metapher
Es kann heute davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um eine Verdichtung vieler verschiedener Themen handelt. Im übertragenen Sinne geht es also darum, dass der oder die Andere etwas besitzt, was man selbst nicht hat. Das führt einerseits zu großer Angst und Unsicherheit, andererseits aber auch zu Neid, woraus sich schließlich „Geschlechterspannungen“ ergeben, die historisch, kulturell, ökonomisch und psychisch begründet sein können (Reiche, 2004, S. 24).
Beim Penisneid handelt es sich beispielsweise um die Erkenntnis der Benachteiligung von Frauen und Mädchen bzw. der Privilegien von Männern und Jungen durch die noch immer vorherrschenden patriarchalen Strukturen. Es geht bzw. ging also in erster Linie dabei nicht um den Penis als Organ, sondern um den Wunsch, männliche Rollen und Privilegien wie beispielsweise größere Autonomie zu übernehmen (vgl. Mertens, 1994, Rendtorff, 2003, S. 76ff).
Phallischer Kastrationskomplex versus weibliche Kastrationsangst
Ebenso umstritten wie der Penisneid ist Freuds „phallischer Kastrationskomplex“. Hier ist es vor allem die Bezeichnung des Phallus, die im Zusammenhang mit der weiblichen Entwicklung umstritten ist. Mertens (1992, S. 116) spricht von einer „begrifflichen Fehlkonstruktion“. Das Mädchen ist sich seiner Vagina sehr wohl bewusst, es erlebt sich körperlich als weiblich.
Beim Jungen entsteht der Kastrationskomplex nach Freud deshalb, weil er beim Mädchen das Fehlen des Penis feststellt und davon ausgeht, dass er vorhanden war, aber weggenommen wurde. „Der Penismangel wird als Ergebnis einer Kastration erfaßt, und das Kind steht nun vor der Aufgabe, sich mit der Beziehung der Kastration zu seiner eigenen Person auseinanderzusetzen“, so Freud (1923, S. 239).
Beim Mädchen bedeutet der „klassische psychoanalytische Kastrationskomplex“, dass das Mädchen erkennt und akzeptiert, dass ihm der Penis weggenommen wurde. Freud schreibt dazu: „Es ergibt sich also der wesentliche Unterschied, daß das Mädchen die Kastration als vollzogene Tatsache akzeptiert, während sich der Knabe vor der Möglichkeit ihrer Vollziehung fürchtet“ (Freud, 1924, S. 250).
Im Gegensatz dazu wird von „weiblicher Kastrationsangst“ gesprochen, wenn es um die Angst geht, „das genuin weibliche Genitale zu verlieren“ (Mertens, 1992, S. 121 und 1994, S. 26 u. 41).
Resümee
Auch wenn Freuds „Theorie der psychosexuellen Identifikation“ heute aufgrund fehlender empirischer Belege nur noch historische Bedeutung hat, so bleibt es doch sein Verdienst, so Reiche (2004), „zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ein Körper und Geist zusammendenkendes Entwicklungsmodell der Sexualität entworfen zu haben, das die gesamte Lebensspanne umfaßt. Dieses Modell hat sich als so brauchbar erwiesen, daß es zum Maß geworden ist, an dem sich alle späteren Entwicklungspsychologien messen, auch wenn sie andere Maßeinheiten entwerfen“ (S. 20).
Mertens-Modell
Wolfgang Mertens (1992, S. 23) unterscheidet drei Komponenten bei der Entwicklung der Geschlechtsidentität, die mir für ein Verständnis des Sachverhaltes und die Bearbeitung meiner Fragestellung sehr sinnvoll erscheinen. Es sind dies:
1. Kern-Geschlechtsidentität
Dieser Begriff stammt von Stoller und geht in das Jahr 1968 zurück. Dabei handelt es sich um die Gewissheit des Kindes, biologisch betrachtet ein Mädchen oder ein Junge zu sein. Diese Gewissheit entsteht aber nicht nur aus dem Wissen um sein biologisches Geschlecht, sondern vor allem auch aus bewussten und unbewussten Erfahrungen biologischer wie psychischer Natur. Dabei spielen die Eltern mit ihren Phantasien über das Geschlecht ihres Kindes sowie die Einstellungen zum eigenen Geschlecht eine wichtige Rolle.
Von Geburt an macht das Kind verschiedene Sozialisationserfahrungen die geschlechtsspezifisch sind, wobei verschiedene Umgangsweisen, Interaktionsmodi, subtile Verhaltensäußerungen und Belohnungs- und Bestrafungsmuster vor allem vonseiten der Eltern eine wichtige Rolle spielen. Mit zwei Jahren hat das Kind schließlich ein relativ stabiles Bild seiner Geschlechtlichkeit als „Kern-Geschlechtsidentität“ erworben (vgl. Mertens, 1992, S. 24 u. 84, Rauchfleisch, 2000, S. 282).
2. Geschlechtsrolle
In der Geschlechtsrolle sieht Mertens (1992, S. 24) die „Fortsetzung der Kern-Geschlechtsidentität“. Bildlich betrachtet könnte man sagen, es handelt sich dabei um die nächsthöhere Stufe. Auch hier spielen wieder bewusste und unbewusste Erwartungen, Phantasien und Verhaltensweisen der Eltern das Geschlecht des Kindes betreffend eine wichtige Rolle. Allerdings kommen hier immer stärker bewusste kognitive Prozesse vonseiten des Kindes hinzu, die im Rollenlernen sowie in der selektiven Identifikation zum Ausdruck kommen und sich in der Geschlechtsrolle niederschlagen (vgl. dazu Kap. 2.2.3).
Im Gegensatz zur Kern-Geschlechtsidentität bietet die Geschlechtsrolle in ihrer Entwicklung wesentlich mehr Spielraum. Mertens (1992) spricht von einer interaktionsbezogenen Erlebnisweise, die sich ständig weiterentwickelt. Er wirft dabei die Frage auf, ob es möglich wäre, dass die Eltern intuitiv auf geschlechtstypische Bedürfnisse der Kinder eingehen und es sich, wie oft behauptet, weniger um Geschlechtsrollenstereotypien handelt, die hier vermittelt werden – eine Frage, die bisher noch nicht beantwortet wurde.
Dennoch werden Kinder gerade in den ersten Lebensjahren intensiv mit Geschlechtsstereotypien konfrontiert. Aus zunächst sensomotorisch codierten Wahrnehmungen entwickeln sich später „sprachlich symbolisierbare Über-Ich-Inhalte („so etwas tut man als Mädchen nicht“) und Ich-Ideal-Themen („ein Junge weint nie, er ist immer tapfer“)“ (ebenda, S. 38).
3. Geschlechtspartner-Orientierung
Diese Komponente der Geschlechtsidentität bezieht sich auf das bevorzugte Geschlecht des Geschlechts- oder Liebespartners, wobei auch erotische und sexuelle Phantasien dazu gehören. Nach der Meinung Mertens (1992) ist sie die am wenigsten erforschte Komponente und beginnt sich bereits in der Kindheit zu entwickeln. Ihre endgültige Ausprägung findet allerdings erst in der Adoleszenz statt, wenn aufgrund körperlicher bzw. hormoneller Veränderungen wie auch Veränderungen im sozialen Rollenerleben eine Neuorientierung und –strukturierung stattfindet. In Anlehnung an Freud spricht Reiche (2004), im Gegensatz zu Mertens, von einer schicksalshaft bestimmten Objektwahl, die schon in sehr frühem Alter festgelegt wird (S. 27).
Freud ging von einer genetisch bedingten Bisexualität des Menschen aus. Im Gegensatz zu manchen anderen Psychoanalytikern vertrat er stets die Meinung, dass es sich bei der Homosexualität keineswegs um eine pathologische Entwicklung handelt (Rauchfleisch, 2000, S 281 u. 282, Mertens, 1992, S. 26, vgl. Eva Poluda, 2007. S. 37).
Zusammenfassend kann aus heutiger Sicht wohl gesagt werden, dass es keine „psychoanalytische Theorie der Homosexualität“ gibt, da die vielen verschiedenen Erscheinungsformen keine einheitliche Genese zulassen (vgl. Poluda, 2007. S. 37 u. 38).
Bedeutung von Mutter und Vater für die kindliche Entwicklung
Heute weiß man wie wichtig nicht nur Mutter und Vater jeweils für sich genommen für die geschlechtliche Entwicklung des Kindes sind, sondern auch das Elternpaar als solches. Man weiß auch, dass es sich bei der Eltern-Kind-Interaktion um keinen, wie ursprünglich angenommen, unilinearen Verlauf handelt, sondern dass es hier von Geburt an einen intensiven verbalen und vor allem auch nonverbalen Austausch zwischen Eltern und Kind gibt (Mertens, 1992).
Kennzeichnend für den psychoanalytischen Ansatz ist die Bedeutung der elterlichen bewussten und unbewussten Phantasien in Bezug auf ihre Kinder. Mertens (1992) meint, dass „das Thema der unbewußten Transferierung unbewußter elterlicher Phantasien gerade bei der Entstehung der Geschlechtsidentität von wichtiger Bedeutung“ (S. 44) ist. Und auch King (2000) spricht davon, dass elterliche Phantasien, ungelöste Trennungs- und Individuierungs-, sowie Beziehungsproblematiken, die sich auf die Kinder übertragen, für eine Vielzahl kindlicher Probleme verantwortlich sein können (S. 246).
Integration weiblicher und männlicher Anteile
Es geht für Mädchen gleichermaßen wie für Buben um die Integration sowohl weiblicher als auch männlicher Anteile (King, 2000, S. 247). Dies wird umso verständlicher, wenn man bei der Betrachtung der Geschlechtsidentität nicht von einem bipolaren Konstrukt ausgeht, sondern davon, dass sowohl männliche als auch weibliche (Geschlechtsrollen-)Anteile miteinander in Einklang gebracht werden sollen (Mertens, 1992, S. 38).
Die Bedeutung des Vaters
Die Psychoanalyse beschäftigt sich erst in den letzten drei Jahrzehnten intensiver mit der Rolle des Vaters innerhalb der Familie. Die „väterliche Abwesenheit in den ersten Jahren der Kindheit wurde lange Zeit mit Bedeutungslosigkeit gleichgesetzt“, so Mertens (1992, S. 76). Erst mit dem Eintritt in die ödipale Phase wurde dem Vater Aufmerksamkeit geschenkt. Vor allem aber wurde die Vater-Tochter-Beziehung in der Vergangenheit viel zu wenig beachtet.
Der Vater stellt ein wichtiges Triangulierungs- und Identifikationsobjekt für die Individuation und Loslösung des Kindes von der Mutter dar. Durch ihn bekommt das Kind das Gefühl, dass eine gefahrlose Trennung von der Mutter möglich ist.
Zur Identifizierung mit dem Vater kommt es in erster Linie nicht wegen seiner andersartigen Geschlechtsrolle, „sondern wegen seiner Andersartigkeit im familiären Szenario“, so Mertens (1994, S. 80). Betrachtet aus der Sicht der Mutter-Kind-Symbiose ist der Vater ein Außenstehender, der besondere Privilegien genießt und deshalb das kindliche Interesse weckt. Er verkörpert „aufgrund der herkömmlichen Rollenverteilung (…) für seine Kinder abenteuerliche Ungebundenheit und erotische Freiheit“, so Mertens weiter (1992, S. 109, vgl. Rendtorff, 2003, S. 81).
Ein liebevoller, unterstützender Vater stärkt den Selbstwert des Kindes und fördert seine Beziehungs- und Liebesfähigkeit.
Für den Jungen bildet die innige Liebe zu seinem Vater die Grundlage für eine gelungene Entwicklung einer männlichen Identität. Daneben stellt der Vater für ihn aber auch ein omnipotentes Wesen dar - unendlich groß, stark und unabhängig. Und er wird von der Mutter begehrt, was im Sohn den Wunsch weckt, so wie er zu sein. Es ist also nicht der Phallus, der für die männliche Identifikation ausschlaggeben ist, sondern der Wunsch, den gleichen Status wie sein Vater zu erlangen, um sich von der Mutter zu lösen (ebenda S. 105 u. 107).
Für die Entwicklung der weiblichen Geschlechtsidentität spielt der Vater ebenfalls eine ganz entscheidende Rolle. Er ermöglicht dem Mädchen eine Identifikation mit männlichen Aspekten wie Unabhängigkeit und Durchsetzungsvermögen, was das Selbstwertgefühl des Mädchens für künftige Herausforderungen steigert. Das Verhältnis vom Vater zu Frauen im Allgemeinen, sowie zu seiner Mutter und zur Mutter seiner Kinder im Speziellen, ist dabei von Bedeutung. Genauso wichtig scheint aber auch das Bild zu sein, das er von sich selbst und seiner Männlichkeit besitzt. Die Einstellung des Vaters zur Weiblichkeit, die das Mädchen zum Teil von ihm übernimmt, wirkt sich schließlich auf die Einstellung des Mädchens zu seinem eigenen Geschlecht aus.
Die Abwesenheit des Vaters kann dazu führen, dass sich das Mädchen nicht begehrt fühlt, was mitunter ein ganzes Leben lang anhalten kann. Mertens betont, „wie wichtig eine liebevoll-anerkennende und erotisch-zärtliche Beziehung zwischen Vater und Tochter für die Weiblichkeit einer Frau tatsächlich ist“ (Mertens, 1992, S. 74, 103 u. 104).
Kindliche Entwicklung bis zur Adoleszenz
Die Darstellungen von Mertens zur Entwicklung der Geschlechtsidentität orientieren sich in erster Linie nicht an den einzelnen Phasen der psychosexuellen Entwicklung sondern am Alter der Kinder.
Erstes Lebensjahr
Das erste Jahr, das der „oralen Phase“ entspricht, ist geprägt von einer intensiven Mutter-Kind-Beziehung. Durch die Anwesenheit und Fürsorge der Mutter kann sich das Kind vertrauensvoll und entspannt entwickeln. Affektive und sensomotorische Erfahrungen werden in dieser Zeit im „körperlichen Handlungsgedächtnis“ (Mertens, 1992, S. 55) gespeichert. Aus psychosexueller Sicht sind Mund und Haut für die sinnlich-körperlichen Erfahrungen im ersten Lebensjahr von größter Bedeutung.
Das Kind entwickelt also von Beginn an ein körperliches Lustempfinden, vor allem durch das Saugen und Lutschen an der Mutterbrust, was sich in autoerotischen Handlungen fortsetzt. Wie frei sich die Entwicklung dieses Lustempfindens gestaltet hängt unter anderem von der Einstellung der Eltern zu Themen wie Zärtlichkeit, Nacktheit, Sexualität und Selbstbefriedigung, aber auch zu gesellschaftlichen Normvorstellungen ab.
Das geschlechtstypisierende Verhalten der Eltern wirkt in dieser Zeit auf einer sehr subtilen Ebene, beispielsweise über die Sprache oder die Berührung (ebenda, S. 61, vgl. auch Rendtorff, 2003, S. 60ff).
Zweites Lebensjahr
Das zweite Jahr ist gekennzeichnet durch den Spracherwerb des Kindes und durch die Ausformung der Kern-Geschlechtsidentität. Das Kind lernt, dass es zwei Geschlechter gibt und beginnt sich selbst als Mädchen bzw. Junge einzuordnen. Die klassische Psychoanalyse spricht von der „analen Phase“, da sich die Libido jetzt verstärkt auf die analen erogenen Zonen konzentriert und das Kind von außen mit Themen wie „Sauber werden“ und Reinlichkeit konfrontiert wird (Mertens, 1992, S. 85 u. 86). Währenddessen erfreut sich das Kind am Schmieren und Kleckern und auch daran, seinen Körper zu erforschen, was allerdings oft mit der Erzeugung von Schamgefühl vonseiten der Eltern einhergeht und sich auf die sexuelle Entwicklung des Kindes sehr belastend auswirken kann.
In dieser Zeit bekommt die Triangulierungsfunktion des Vaters eine immer stärkere Bedeutung für das Unabhängigkeitsstreben des Kindes. Mädchen fällt es oft schwerer sich von der Mutter zu lösen als Jungen, die den Vater aufgrund der anatomischen Gleichheit schnell als Vorbild für die männliche Geschlechtsrolle entdecken. Nicht nur der Sohn sondern auch die Tochter muss sich, wie schon erwähnt, mit männlichen Eigenschaften, wie beispielsweise Unabhängigkeit und Durchsetzungsvermögen identifizieren, um später den Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Häufig kommt es dabei zu Trennungsängsten, aber auch anderen intensiven Affekten, die bewältigt werden müssen (ebenda).
Drittes und viertes Lebensjahr (präödipale genitale Phase)
Mertens nimmt hier Bezug auf Mahler et al. (1978) die von der Aufgabe der „Loslösung und Individuation“ spricht, die für das Kind in dieser Zeit vorrangig wird. Dazu muss es unter anderem entstandene Trennungsängste überwinden und ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens aufbauen. Es muss lernen Affekte zu regulieren und seinen Handlungsspielraum und seine Fähigkeiten auf ein realistisches Niveau zu bringen, was schließlich zu einer „Konsolidierung des Gefühls für das eigene Selbst“ führt (Mahler et al., 1978 zit. in Mertens, 1992, S. 111).
In der „phallischen Phase“ ist das Kind intensiv mit seinen Genitalien und den Geschlechtsunterschieden beschäftigt, die wahrgenommen und verarbeitet werden müssen. Außerdem bildet sich das Geschlechtsrollenverhalten immer stärker und differenzierter aus. Es kommt nach Freud in dieser Zeit zum „Penisneid“ und zur „Kastrationsangst“, wobei Mertens betont, dass es sich beim „Penisneid“ bei nichtneurotischen Kindern um einen wesentlich milderen Prozess handelt.
Der eigene Körper und die eigenen Genitalien stehen in dieser Zeit sowohl für Jungen wie auch für Mädchen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aufgrund der kognitiven Entwicklung des Kindes kann es nun ganz klar Geschlechtsunterschiede erkennen. Das Mädchen weiß somit sehr wohl, dass es eine Vagina besitzt, deren Erforschung ihm nicht weniger Spaß bereitet als dem Jungen die Beschäftigung mit seinem Penis. Das in dieser Zeit verstärkte zur Schau stellen des Körpers ist für die Entwicklung des Selbstwertgefühls und die Konsolidierung der Geschlechtsidentität wichtig, ebenso wie die Anerkennung der Autoerotik durch die Eltern.
Die bisher entstandenen Vorstellungen über Geschlechterkategorien bilden sich weiter aus, sodass der Junge erkennt, dass er keine Babies bekommen kann und das Mädchen, dass ihm kein Penis mehr wachsen wird (vgl. Mertens, 1992, S. 119).
Fünftes und sechstes Lebensjahr (ödipale Phase)
Die zentrale Aufgabe des Kindes in dieser Phase stellt die Überwindung des „Ödipuskomplexes“ dar. Grundvoraussetzung für eine gelungene Bewältigung des Ödipuskomplexes ist die Unterstützung beider Eltern, die ihrerseits bereit sein müssen, sich in dieser Zeit ihren eigenen noch nicht bewältigten ödipalen Konflikten zu stellen, die hier mitunter besonders stark zum Tragen kommen können. Ein gut bewältigter Ödipuskomplex führt zu einer stabilen Geschlechtsidentität und zu einer wertschätzenden Einstellung zum anderen Geschlecht (Mertens, 1994, S. 113).
Mädchen in der ödipalen Phase
Durch die Identifikation mit der Mutter entsteht das Fundament für die weibliche Geschlechtsidentität (Mertens, 1994, S. 36). Kommt es hier zu Problemen durch eine missglückte Identifikation oder das Nicht-loslassen-können der Mutter, kann dies in der Pubertät und auch später zu einer Verweigerung des eigenen weiblichen Körpers führen. Viele Frauen können kein Gefühl für ihre Weiblichkeit entwickeln oder sie leiden ihr Leben lang unter einem Gefühl der „Mangelhaftigkeit“. Essstörungen sind beispielsweise hier die Folge.
Erfährt das Mädchen zu wenig Zuneigung von der Mutter, kann ein Übermaß an sehnsüchtig gebrauchter Liebe entstehen und dazu führen, dass es sich als erwachsene Frau von Männern abhängig macht. Bringt in diesem Fall der Vater aber dem Mädchen aufrichtige Liebe entgegen und gibt ihm das Gefühl der Vollständigkeit, kann dadurch das Selbstwertgefühl sowie das weibliche Identitätsgefühl ausreichend stabilisiert werden, obwohl die Mutter versagt. Gleiches gilt natürlich auch im umgekehrten Fall des Versagens des Vaters (vgl. ebenda).
In der „ödipalen Phase“ ist das Mädchen aber auch gefordert, sich aus der entstandenen libidinösen Verbindung zum Vater zu lösen und sich „partiell“ mit ihm zu identifizieren. Gelingt dies, so folgt nach Poluda (2001, S. 5) daraus eine „unbekümmerte Abenteuerlust und Extraversion“ des Mädchens. Puppenspiele verwandeln sich langsam in Rollen- und Verkleidungsspiele mit Gleichaltrigen, in denen der eigene weibliche Körper immer mehr Bedeutung bekommt und auch immer lustvoller erlebt wird (ebenda).
Ist der Vater abwesend oder lässt er die Identifikation aus anderen Gründen nicht zu, so kann es zu Beeinträchtigungen im Selbstwertgefühl kommen oder zu gestörten Beziehungen im späteren Leben führen, vor allem auch dann, wenn eine Identifikation zwar möglich ist, der Vater aber beispielsweise Weiblichkeit (z.B. weibliche Tätigkeiten) entwertet (Mertens, 1994).
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836636919
- Dateigröße
- 6.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Alpen-Adria-Universität Klagenfurt – Kulturwissenschaften, Studiengang Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- regenbogenfamilie geschlechtsidentität homosexualität kindesentwicklung
- Produktsicherheit
- Diplom.de