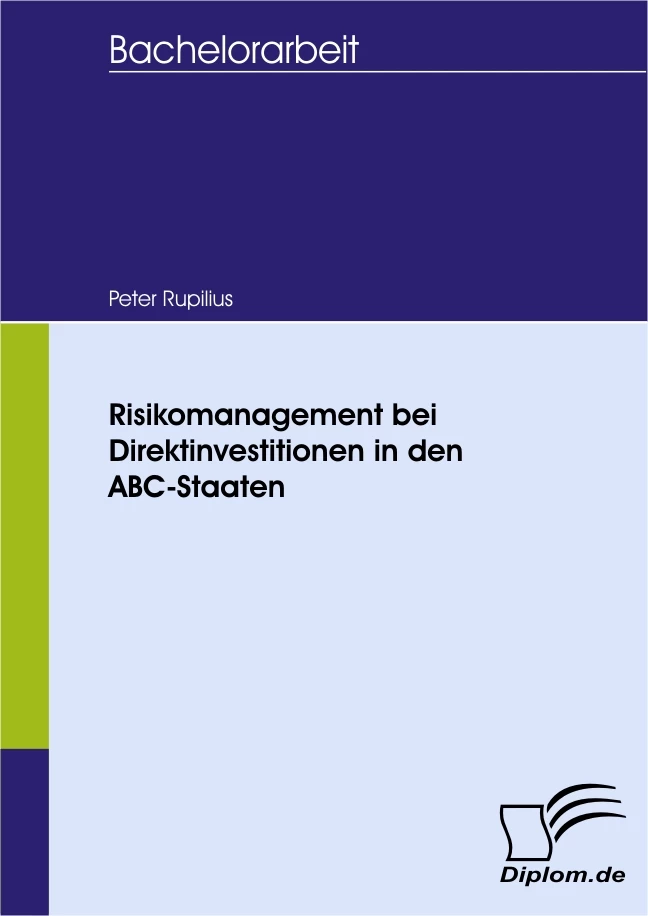Risikomanagement bei Direktinvestitionen in den ABC-Staaten
©2008
Bachelorarbeit
88 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung
Südamerika hat sein politisches Landschaftsbild in den vergangenen drei Jahrzehnten stark verändert. Prägten in den 80er Jahren Militärregierungen, Wirtschaftskrisen und galoppierende Inflationen das klassische Bild der Länder, vollzog sich in den 90er Jahren eine beeindruckende Demokratisierung, welche einen starken wirtschaftlichen Aufschwung für den Kontinent mit sich brachte.
Heute gilt Südamerika als großer Gewinner der Globalisierung. Die stark steigende Nachfrage von Rohstoffen und Nahrungsmitteln und die damit einhergehenden Preissteigerungen erlaubten vielen Ländern Südamerikas ihre Haushalte zu konsolidieren und sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Führten die steigenden Preise der Exportgüter zu mehr Einnahmen, dauerte es nicht lange bis auch die Binnenmärkte stark an Fahrt gewannen.
Steigende Gesamtwachstumsraten stabile Wechselkurse, niedrige Inflation und fallende Risikobewertung sowie ein zentraler Zugang zu den immer wichtiger werdenden Rohstoffen, die erforderlichen Investitionen in den Ausbau ihrer Infrastruktur und das wohl auch in den kommenden Jahren nicht abbrechende Wachstum der Binnenmärkte sind nur einige Gründe, die den Kontinent für Unternehmen aus aller Welt für Investitionen interessant macht.
Viele Unternehmen versuchen an den wachsenden Märkten durch ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) zu partizipieren. Dabei wird der Begriff der ausländischen Direktinvestition von der OECD wie folgt definiert: Foreign direct investment re?ects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in an economy other than that of the investor (direct investment enterprise). The lasting interest implies the existence of a longterm relationship between the direct investor and the enterprise and a signi?cant degree of in?uence on the management of the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent capital transactions between them and among af?liated enterprises, both incorporated and unincorporated. Sie bezeichnen damit die Beteiligung eines Unternehmens am Eigenkapital einer Firma in einem anderen Land mit einem langfristigen Interesse und Kontrollmotiv an dem ausländischen Unternehmen. Diese im Vordergrund stehenden Aspekte differenzieren sie auch im wesentlichen von Portfolioinvestitionen, in denen Rendite und Risikoüberlegung die […]
Südamerika hat sein politisches Landschaftsbild in den vergangenen drei Jahrzehnten stark verändert. Prägten in den 80er Jahren Militärregierungen, Wirtschaftskrisen und galoppierende Inflationen das klassische Bild der Länder, vollzog sich in den 90er Jahren eine beeindruckende Demokratisierung, welche einen starken wirtschaftlichen Aufschwung für den Kontinent mit sich brachte.
Heute gilt Südamerika als großer Gewinner der Globalisierung. Die stark steigende Nachfrage von Rohstoffen und Nahrungsmitteln und die damit einhergehenden Preissteigerungen erlaubten vielen Ländern Südamerikas ihre Haushalte zu konsolidieren und sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Führten die steigenden Preise der Exportgüter zu mehr Einnahmen, dauerte es nicht lange bis auch die Binnenmärkte stark an Fahrt gewannen.
Steigende Gesamtwachstumsraten stabile Wechselkurse, niedrige Inflation und fallende Risikobewertung sowie ein zentraler Zugang zu den immer wichtiger werdenden Rohstoffen, die erforderlichen Investitionen in den Ausbau ihrer Infrastruktur und das wohl auch in den kommenden Jahren nicht abbrechende Wachstum der Binnenmärkte sind nur einige Gründe, die den Kontinent für Unternehmen aus aller Welt für Investitionen interessant macht.
Viele Unternehmen versuchen an den wachsenden Märkten durch ausländische Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) zu partizipieren. Dabei wird der Begriff der ausländischen Direktinvestition von der OECD wie folgt definiert: Foreign direct investment re?ects the objective of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy (direct investor) in an entity resident in an economy other than that of the investor (direct investment enterprise). The lasting interest implies the existence of a longterm relationship between the direct investor and the enterprise and a signi?cant degree of in?uence on the management of the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between the two entities and all subsequent capital transactions between them and among af?liated enterprises, both incorporated and unincorporated. Sie bezeichnen damit die Beteiligung eines Unternehmens am Eigenkapital einer Firma in einem anderen Land mit einem langfristigen Interesse und Kontrollmotiv an dem ausländischen Unternehmen. Diese im Vordergrund stehenden Aspekte differenzieren sie auch im wesentlichen von Portfolioinvestitionen, in denen Rendite und Risikoüberlegung die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Peter Rupilius
Risikomanagement bei Direktinvestitionen in den ABC-Staaten
ISBN: 978-3-8366-3676-6
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Fachhochschule Wiesbaden, Wiesbaden, Deutschland, Bachelorarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
...
II
Abkürzungsverzeichnis
...
IV
Abbildungsverzeichnis
...
VIII
Tabellenverzeichnis
...
IX
1. Einleitung
...
1
1.1. Problemstellung
...
1
1.2. Zielsetzung
...
4
1.3. Struktur der Untersuchung
...
4
2. Bedeutung und Formen von Direktinvestitionen
...
5
2.1. Horizontale und vertikale Direktinvestitionen
...
5
2.2. Bedeutung von Direktinvestitionen für Staaten und Unternehmen
...
6
3. Die Situation der ABC-Staaten und Identifikation der Risiken
...
8
3.1. Politische Situation
...
8
3.1.1. Die ,,verlorene Dekade" Südamerikas
...
8
3.1.2. Aktuelle Regierungen
...
9
3.1.3. Einflussnahmen des Staates
...
10
3.1.4. Wirtschaftliche Kooperationen der Staaten
...
11
3.1.4.1. MERCOSUR
...
12
3.1.4.2. FTAA
...
15
3.2. Wirtschaftliche Situation
...
17
3.2.1. Bevölkerungsstruktur
...
17
3.2.2. Beschäftigungs- und Lohnstruktur
...
18
3.2.3. Infrastruktur
...
19
3.2.4. Erwartete wirtschaftliche Entwicklung
...
21
4. Analyse der Risiken und Instrumente für das Risikomanagement
...
24
4.1. Politische Risiken
...
24
4.1.1. Analyse
...
24
4.1.2. Absicherungsinstrumente
...
27
4.1.2.1. Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur
...
28
III
4.1.2.2. Investitionsgarantie des Bundes
...
28
4.1.3. Kritische Würdigung der Absicherungsinstrumente
...
31
4.2. Rechtliche Risiken
...
32
4.2.1. Analyse
...
32
4.2.1.1. Internationales Privatrecht
...
33
4.2.1.2. Zoll
...
35
4.2.2. Absicherungsinstrumente für IPR & Zoll
...
35
4.2.3. Kritische Beurteilung
...
39
4.3. Wirtschaftliche Risken
...
41
4.3.1. Geschäftsrisiko
...
41
4.3.1.1. Analyse
...
41
4.3.1.2. Absicherungsinstrumente
...
42
4.3.1.3. Kritische Würdigung der Absicherungsinstrumente
...
43
4.3.2. Wechselkursrisiko
...
44
4.3.2.1. Analyse
...
44
4.3.2.2. Absicherungsinstrumente
...
47
4.3.2.3. Kritische Würdigung der Absicherungsinstrumente
...
51
4.4. Kulturelle Risiken
...
52
4.4.1. Analyse
...
53
4.4.2. Absicherungsmethoden
...
57
4.4.3. Kritische Würdigung der Absicherungsmethoden...
...
59
5. Kritische Würdigung
...
60
Literaturverzeichnis
...
65
Internetquellen
...
72
IV
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
ABC-Staaten
Argentinien, Brasilien, Chile
Abs.
Absatz
AG
Aktien Gesellschaft
AGA
Auslandsgeschäftsabsicherung
AktG
Aktiengesetz
ArbR
Arbeitsrecht
Art.
Artikel
BERI
Business Eviroment Risk Intelligence
Bfai
Bundesagentur für Außenwirtschaft
BGB
Bürgerliche Gesetzbuch
BIG
Bundesinvestitionsgarantien
BIP
Bruttoinlandprodukt
BRD
Bundesrepublik Deutschland
BSP
Bruttosozialprodukt
Bspw.
Beispielsweise
BGB
Bürgerliche Gesetzbuch
BMWi
Bundesministerium für Wirtschaft und Technik
BMZ
Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
Bra.
Brasilianisch
Bsp.
Beispiel
Bzgl.
Bezüglich
Bzw.
Beziehungsweise
CAFTA
Central America Free Trade Agreement
CAN
Comunidad Andina de Naciones
CIA
Central Intelligence Agency
CISG
United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods
V
D.h.
Das heißt
EGBGB
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
ERA
Einheitlichen Richtlinien für
Dokumentenakkreditive
EU
Europäische Union
E.V.
Eingetragener Verein
F.
folgende
FDI
Foreign Direct Investment
Ff.
fortfolgende
FTAA
Free Trade Area of the Americas
GmbHG
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung
HDI
Human Development Index
HGB
Handels- und Gesellschaftsrecht
ICC
Internationale Handelskammer
ICSID
International Centre for Settlement of Investment
Disputes
I.d.R.
In der Regel
IMA
Interministerielle Ausschuss
IDV
Individualism
Incoterms
International Commercial Terms
ICSID
International Centre for Settlement of Investment
Disputes
IPR
Internationales Privatrecht
ISI
Importsubstituirende Industrialisierung
IFV
Investitionsförderungs- und Schutzverträge
KfW
Kreditanstalt für Wiederaufbau
KfZ
Kraftfahrzeug
KonTraG
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich
LB
Landesbank
VI
LTO
Long Term Orientation
MIGA
Multilateral
Investment
Guarantee
Agency/
Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (Teil der
Weltbankgruppe)
NDF
Non-Deliverable Forwards
MAS
Masculinity
Max.
Maximal
MERCOSUR
Mercado Común del Sur
MIGA
Multilateral Investment Guarantee Agency
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
NAFTA
North American Free Trade Agreement
NZZ
Neue Zürcher Zeitung
O.ä.
Oder ähnliches
OECD
Organisation for economic Co-operation and
ORI
Operational Risk Index
P.a.
Pro anno
PDI
Power Distance Index
PRI
Political Risk Index
PwC
PricewaterhouseCoopers
R-Factor
Remittance- and Repatriation of Capital
S.
Seite
S.a.
Siehe auch
Sog.
Sogenannte
U.a.
Unter anderem
U.ä.
Und ähnliches
UCP
Uniform Customs and Practice
UAI
Uncertainty Avoidance Index
UN
United Nations
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
VII
USA
United States of America
Vgl.
Vergleiche
Z.B.
Zum Beispiel
Z.Z.
Zur Zeit
VIII
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Mitgliedsstatten des MERCOSUR
...
12
Abb. 2 Bevölkerungsstatistik Lateinamerikas
...
17
Abb. 3 Ablauf eines Akkreditiv-Geschäfts
...
43
Abb. 4 Währungsentwicklung der ABC-Staaten gegenüber dem Euro
...
46
Abb. 5 Abgesicherte und nicht abgesicherte Währungspositionen
...
52
Abb. 6 Monochron vs. Polychron, wesentliche Unterschiede
...
53
Abb. 7 CPI 2007
...
57
Abb. 8 Preisentwicklung bei Kupfer
...
.63
IX
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Monatslohnentwicklung
...
19
Tabelle 2: Gesamtwirtschaftliche Prognose
...
22
Tabelle 3: BERI Index
...
26
Tabelle 4: Index Verteilung nach Hofstede
...
54
Tabelle 5: CPI 2007
...
56
1
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Südamerika hat sein politisches Landschaftsbild in den vergangenen drei Jahrzehn-
ten stark verändert. Prägten in den 80er Jahren Militärregierungen, Wirtschaftskri-
sen und starke Inflationen das Bild der Länder, vollzog sich in den 90er Jahren eine
beeindruckende Demokratisierung, welche einen starken wirtschaftlichen Auf-
schwung für den Kontinent mit sich brachte.
Heute gilt Südamerika als großer Gewinner der Globalisierung. Die stark steigende
Nachfrage von Rohstoffen und Nahrungsmitteln und die damit einhergehenden
Preissteigerungen erlaubten vielen Ländern Südamerikas ihre Haushalte zu konso-
lidieren und sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Führten die steigenden Preise der
Exportgüter zu mehr Einnahmen, dauerte es nicht lange bis auch die Binnenmärkte
stark an Fahrt gewannen.
Steigende Gesamtwachstumsraten, stabile Wechselkurse, niedrige Inflation und
fallende Risikobewertung sowie ein zentraler Zugang zu den immer wichtiger wer-
denden Rohstoffen, die erforderlichen Investitionen in den Ausbau ihrer Infrastruk-
tur und das wohl auch in den kommenden Jahren nicht abbrechende Wachstum der
Binnenmärkte sind nur einige Gründe, die den Kontinent für Unternehmen aus aller
Welt für Investitionen interessant macht.
Viele Unternehmen versuchen an den wachsenden Märkten durch ausländische
Direktinvestitionen (Foreign Direct Investment, FDI) zu partizipieren. Dabei wird
der Begriff der ausländischen Direktinvestition von der OECD wie folgt definiert:
,,Foreign direct investment reflects the objective of obtaining a lasting interest by a
resident entity in one economy (``direct investor'') in an entity resident in an eco-
nomy other than that of the investor (``direct investment enterprise''). The lasting
interest implies the existence of a longterm relationship between the direct inve-
stor and the enterprise and a significant degree of influence on the management of
the enterprise. Direct investment involves both the initial transaction between the
2
two entities and all subsequent capital transactions between them and among
affiliated enterprises, both incorporated and unincorporated.,,
1
Sie bezeichnen da-
mit die Beteiligung eines Unternehmens am Eigenkapital einer Firma in einem an-
deren Land mit einem langfristigen Interesse und Kontrollmotiv
2
an dem ausländi-
schen Unternehmen. Diese im Vordergrund stehenden Aspekte differenzieren sie
auch im wesentlichen von Portfolioinvestitionen, in denen Rendite und Risikoüber-
legung die dominierende Rolle spielen.
Eine leichtere Markterschließung, niedrigere Arbeitskosten, Steuern und Transport-
kosten sowie verringerte Wechselkursrisiken sind nur einige der zahlreichen mögli-
chen Vorteile, die sich die Unternehmen durch Direktinvestitionen erhoffen.
3
Deutschland ist mit den Staaten Lateinamerikas historisch und kulturell mehr als
mit jeder anderen Region außerhalb der Europäischen Union (EU) und Nordameri-
kas eng verbunden.
4
Dabei nehmen in Südamerika die sog. ABCStaaten Argenti-
nien, Brasilien und Chile eine Schlüsselposition ein. So finden sich über 2000 deut-
sche Unternehmen, davon alleine über 800 Niederlassungen im Ballungsraum Sao
Paulo, Brasilien, die Direktinvestitionen in den ABC-Staaten getätigt haben. Da
viele dieser Unternehmen Schlüsselpositionen in wichtigen Wirtschaftszweigen
haben, erscheint für diese Arbeit der Blick auf die Risken und das für deutsche Un-
ternehmen verfügbare Instrumentarium des Risikomanagements von besonderer
Bedeutung.
Trotz ihrer geographischen Nähe unterscheiden sich die drei Länder hinsichtlich
ihrer Strukturen erheblich voneinander. Neben vielfältigen Chancen beherbergen
die Staaten teilweise divergente Risiken, welche häufig von ausländischen Unter-
nehmen aufgrund mangelnder Kenntnisse der Gegebenheiten vor Ort falsch einge-
schätzt werden. Dabei wird unter Risiko allgemein die Gefahr verstanden, das er-
wartete Ergebnis einer Direktinvestition zu verfehlen.
1
Vgl. OECD, S. 7.
2
Siehe genauer zu Kontrollmotiv Kutschker/ Schmid 2006, S. 406.
3
Vgl. Putnoki, 2000, S. 6.
4
Vgl. Auswärtige Amt deutsche Außenpolitik.
3
Als operationelles Risiko wird in Basel II definiert: ,,The risk of loss resulting from
inadequate or failed internal processes, people and systems, or from external
events"
5
. Die Erkennung von Risiken in Folge mangelhafter Prozesse und Verhal-
tensweisen ist bei Betrachtung Südamerikas besonders bedeutsam, da gerade in
diesen Ländern mangelhafte Systeme auf Grund ihrer historischen Entwicklung
entstanden sind.
Direktinvestitionen weisen auch weitere schwerwiegende Risiken auf. Hohe An-
fangskosten der Investition und die dadurch erhöhte Amortisationsdauer erhöhen
das Risiko eines kommerziellen Scheiterns. Sie unterliegen auch dem politischen
Risiko, welches von der Einschränkung der unternehmerischen Dispositionsfähig-
keit bis hin zu verschiedenen Formen der Enteignung reichen kann. Weiterhin for-
dern unterschiedliche Rechtsstrukturen, z.B. im Privatrecht, sowie kulturelle Barrie-
ren wie z.B. die Sprache eins Landes einen erhöhten Informations- und
Kommunikationsaufwand.
6
Unter Risikomanagement im weiteren Sinne wird der Umgang mit allen Risiken
verstanden, welche aus dem Führungs- und Durchführungsprozess in einem Unter-
nehmen entstehen können. Damit entspricht es den generellen Managementzielen
der Sicherung, Erhaltung und erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens.
7
Eine sorgfältige Risikovorsorge und die gesicherte Finanzierung sind daher für Di-
rektinvestitionen unerlässlich.
Durch rechtliche Rahmenbedingungen, wie das Gesetzt zur Kontrolle und Transpa-
renz in Unternehmen (KonTraG) vom 27.04.1998, und seine Erweiterung des Akti-
en- und GmbH-Gesetzes (§91 (2) AktG, § 43 GmbHG), welches es um die Sorg-
faltspflichten der Unternehmensführung erweitert und den Ausweise der
Unternehmensrisiken im Lagebericht fordert, ist Risikomanagement bereits seit
mehreren Jahren vom Gesetzgeber explizit gefordert.
5
Vgl. BASEL II - Risiko, S. 137.
6
Vgl. Lukas, 2004, S. 53.
7
Vgl. Fiege, 2006, S. 52.
4
Ein wachsendes Interesse von Aktionären hinsichtlich der Absicherung der auslän-
dischen Vermögenswerte sowie der Verpflichtung zur Verringerung des politischen
Risikos durch das Inkrafttreten des Basel II Abkommens, hier speziell für Banken
und Finanzinstitute sowie Solvency II bei Versicherungen, werden die Anforderung
an das Risikomanagement dabei deutlich erhöhen.
8
Direktinvestitionen muss daher eine umfassenden Risikobetrachtung auf Manage-
ment-Ebene vorgeschaltet werden.
1.2. Zielsetzung
Das Problem bei der Bearbeitung eines so umfangreichen Themas in Bezug auf die
Materialbasis besteht einerseits in der Fülle an Literatur bzgl. der Einzelthemen von
Risikomanagement, Direktinvestitionen und den ABC-Staaten, andererseits an der
fehlenden Literatur hinsichtlich einer gemeinsamen Schnittmenge der drei Themen.
Aus diesem Grund soll hier auf die wesentlichen Risiken eingegangen werden und
kein Anspruch einer vollständigen Auswertung der Literatur erhoben werden.
Die konstitutive Zielsetzung neben einer grundlegenden Sensibilisierung der Unter-
nehmen bei wichtigen Fragestellungen hinsichtlich der Risiken bei Direktinvesti-
tionen in den ABC-Staaten, ist die Unterstützung bei der Identifikation und Analyse
spezifischer Risiken in Politik, Recht, Wirtschaft und Kultur. Weitere Zielsetzung
ist die Vorstellung unterschiedlicher Risikoabsicherungsmaßnahmen, bzw. Risiko-
absicherungsinstrumente, die zur Minimierung, bzw. Vorbeugung der analysierten
Risiken dienlich sind. Diese werden hinsichtlich ihres Nutzens bei Direktinvestitio-
nen in den jeweiligen Ländern, soweit möglich, genauer betrachtet.
1.3. Struktur der Arbeit
Zu Erreichung der genannten Ziele setzt sich der folgende zweite Abschnitt mit den
unterschiedlichen Formen von Direktinvestitionen auseinander und analysiert deren
Bedeutung für Staaten und Unternehmen.
8
Vgl. Einblicke Absicherung.
5
Der dritte Teil beschäftigt sich mit den Strukturen der ABC-Staaten in den wesent-
lichen Bereichen der Politik, Wirtschaft, Recht und Kultur. Dabei stehen die für das
Risikomanagement essentiell wichtigen Strukturen der Länder im Vordergrund.
Kapitel vier betrachtet im ersten Schritt die allgemeinen Risiken der Direktinvesti-
tionen in Politik, Recht, Wirtschaft, sowie Kultur, und analysiert diese im Bezug
auf die ABC-Staaten. Im zweiten Schritt werden in den Unterpunkten entsprechen-
de Maßnahmen bzw. Instrumente zur Absicherung von Risiken präsentiert und län-
derspezifisch analysiert. Abschließend werden diese hinsichtlich ihres Nutzens kri-
tisch beurteilt.
Die kritische Würdigung fasst die Ergebnisse der Arbeit hinsichtlich den unterneh-
merischen Einflussmöglichkeiten auf Risiken, der Effektivität der Absicherungsin-
strumente und Methoden, sowie den diversen zukünftigen Chancen und Risiken
der ABC-Staaten abschließend zusammen.
2. Bedeutung und Formen von Direktinvestitionen
2.1. Vertikale und Horizontale Direktinvestitionen
Eine weitere Unterscheidung hinsichtlich der Position in der Wertschöpfungskette
findet sich zwischen vertikalen und horizontalen Direktinvestitionen. Vertikale Di-
rektinvestitionen können vor- und rückwärts ausgerichtet sein und dienen der Aus-
nutzung international unterschiedlicher Faktorpreise. So ist z.B. beim Aufbau eines
Vertriebsnetzes im Ausland zum Verkauf im Inland produzierter Güter von einer
vorwärtsgerichteten Direktinvestition die Rede. Handelt es sich um Rohstoffbe-
schaffung, -bearbeitung oder Veredelung von Gütern, welche im Inland verkauft
werden, ist die Rede von rückwärtsgerichteten Direktinvestitionen. Damit wirken
vertikale Direktinvestitionen grundsätzlich außenhandelsfördernd, da sie nicht die
Produktion ersetzen.
9
Horizontale Direktinvestitionen können hingegen mit einer Produktionsverlagerung
gleichgesetzt werden, da in diesem Fall im Empfängerland die gleichen Produkte
9
Vgl. Haas/ Eschlbeck/ Neumair, 2006, S. 217.
6
wie im Geberland hergestellt werden. Damit ersetzt die Produktionsstätte vor Ort
die Exporte des Mutterkonzerns. Ein wesentlicher Grund für viele Unternehmen ist
hier die Reduzierung der Kosten, wie z.B. Lohn-, Transport- und Zollkosten womit
eine einhergehende Wettbewerbsverbesserung zu erreichen ist.
10
Im Gegensatz zu den horizontalen Direktinvestitionen finden sich bei den vertika-
len Direktinvestitionen seltener Anzeichen für einen technologischen spill-over
Effekt.
11
2.2. Bedeutung von Direktinvestitionen für Staat und Unternehmen
Direktinvestitionen haben in Ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Wirtschaft
und des Wohlstandes der Länder in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Sie
schaffen Arbeitsplätze und damit Perspektiven für die Menschen. Sie tragen zur
Steigerung der Exportfähigkeit bei und helfen damit bei der Integration in die
Weltwirtschaft. Sie steigern die Steuereinnahmen der Staaten, welche es den Regie-
rungen ermöglichen, bspw. Investitionen ins Bildungswesen, Infrastruktur und
diverse Sozialausgaben zu finanzieren. Insbesondere sind auch das technische und
betriebswirtschaftliche Wissen zu nennen, welche durch Direktinvestitionen in die
Länder getragen werden.
12
Sie genießen bei den Ländern und Entwicklungsökono-
men ein wesentlich höheres Ansehen als Portfolioinvestitionen, welche ihren
schlechten Ruf im wesentlichen ihrer hohen Volatilität verdanken, deren negative
Auswirkungen sich während der Finanzkrise der 90er Jahre zeigten.
13
Damit ist es für die jeweiligen Regierungen der Länder von großer Bedeutung, ak-
tiv zur Gestaltung von attraktiven Rahmenbedingungen für Direktinvestitionen bei-
zutragen. So betrachtet auch die Deutsche Bundesregierung Direktinvestitionen als
ein geeignetes Mittel zur Krisenprävention und Entwicklungshilfe und rückt die
10
Vgl. Moran/ Graham/ Blomström, 2005, S. 46.
11
Vgl. Moran/ Graham/ Blomström, 2005, S. 48.
12
Vgl. Wieczorek-Zeul, 2005, S. 58 f.
13
Vgl. Schularick, 2006, S. 71.
7
gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen für die Investitionsländer zu-
nehmend in den Vordergrund
14
.
Für viele Unternehmen in den Industrienationen kann von einer Notwendigkeit ge-
sprochen werden, sich internationaler aufzustellen. Die Ursachen finden sich dabei
in einer weltwirtschaftlichen Entwicklung, in der ein direkter Zugang zu den Roh-
stoffen notwendig ist. Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern und direktem
Zugang zu Rohstoffen formieren sich zunehmend zu ,,Global Playern" und fordern
Reaktionen seitens der Unternehmen in den Industrieländern.
Ebenfalls fehlt es am Wachstum der häufig gesättigten Binnenmärkte innerhalb
vieler Industrienationen, die eine Suche nach anderen Wachstumsmärkten erfordert.
,,Globales Denken" wird dabei von neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien einerseits überhaupt erst ermöglicht, gleichzeitig wird gerade durch sie der
Wettbewerbsdruck erhöht, und so eine internationale Ausrichtung gefor-
dert.
15
Durch die Internationalisierung von Geschäften und die wachsende Mobilität
von Kapital und Know-how, sind Direktinvestitionen in Form von Neugründungen,
Übernahmen, Fusionen, oder Joint Ventures zwischenzeitlich gang und gäbe.
16
Dabei stehen für International tätige Unternehmen deutliche Investitionsprinzipien
wie die Wettbewerbsfähigkeit, Steigerung der Marktanteile und die Gewinnmaxi-
mierung im Vordergrund. Folgende Internationalisierungsmotive, insbesondere für
die ABC-Staaten von Bedeutung, sollen kurz erwähnt werden
17
:
· Aussicht auf höhere Renditen
· Erschließung neuer Märkte
· Erhaltung, bzw. Ausbau von Marktanteilen
· Schaffung einer Exportbasis zu Nachbarländern
· Rohstoffsicherung
· Niedrigere Lohn- und Lohnebenkosten
14
Vgl. Bericht der Bundesregierung, S. 42.
15
Vgl. Boettcher/ Herder-Dorneich/ Schenk, S. 50.
16
Vgl. Bergmann/ Bergmannm, 2005, S. 27.
17
Vgl. Dülfer, 2001, S. 108-110.
8
3. Die Situation der ABC-Staaten und Identifikation der Risiken
3.1. Politische Situation
Die historische politische Entwicklung sowie die aktuelle Regierung eines Landes
sind für das Vertrauen von Direktinvestoren von entscheidender Bedeutung. Insbe-
sondere in Lateinamerika prägt die Vergangenheit die politische und wirtschaftliche
Landkarte.
3.1.1. Die ,,verlorene Dekade" Südamerikas
Die meisten Länder Südamerikas waren in den 80er Jahre durch ein sich verrin-
gerndes Bruttosozialprodukt (BSP) und einen versiegenden Strom ausländischer
Direktinvestitionen geprägt. Hohe Inflation, steigende Auslandsverschuldung, star-
ker Einfluss der Regierungen auf die Wirtschaft und insbesondere die Politik der
importsubstituierenden Industrialisierung (ISI) waren meist Ursache für die sog.
,,verlorene Dekade" Südamerikas. Die ISI findet dabei Ihren Ursprung in der Welt-
wirtschaftskrise von 1929, der viele exportorientierte Länder Südamerikas zu einem
Wechsel zu binnenorientierten Wachstumsstrategien zwang.
18
Die ISI versuchte
den Aufbau der heimischen Industrie durch Protektion zu fördern und schottete sich
gezielt gegen Importware ab. Langwierige und komplexe Prozesse der Lizenzertei-
lung, hohe Importzölle sowie die Gründung von Staatsunternehmen waren deren
wichtigsten Instrumente.
In Argentinien wurden die importierten Güter in drei Kategorien eingeteilt: 1: Güter
die mit dem Importverbot belegt wurden. 2: Waren, die mit einer eidesstattlichen
Erklärung genehmigt wurden, welche knapp 50% der Importgüter widerspiegelten
und 3: genehmigte Importgüter. Die eidesstattliche Erklärung beinhaltete eine Be-
stätigung der Produzentenverbände Argentiniens, welche die Nichtherstellung des
jeweiligen Gutes im Lande bestätigte, was einem 100% Schutz der inländischen
Produzenten gleich kam.
18
Vgl. LASON Entwicklungsdiktatoren.
9
Einhergehend mit dieser Entwicklung war die Herausbildung eines typischen politi-
schen Gepräges Lateinamerikas, den nationalistisch-populistischen Regimen, deren
Einfluss bis heute spürbar ist.
19
Der wirtschaftliche Populismus verstand es der Be-
völkerung Versprechungen zu machen, ohne jegliches Konzept der Finanzierung
mit sich zu bringen.
Um die Versprechen einzuhalten war es den Staaten selten möglich, die nötigen
finanziellen Mittel vom privaten Sektor oder von ausländischen Investoren zu be-
sorgen. Am Ende wurde das benötigte Geld von den Staatsbanken gedruckt, was
unweigerlich zu Entfachung von Hoch- bzw. Hyperinflation führte, so geschehen
Mitte der 70er Jahre in Chile, 1989 in Argentinien und 1994 in Brasilien.
20
Die Si-
tuation beeinflusste stark den Planungshorizont der Unternehmen und wirkte sich
nachteilig auf die Bewertung der Länder aus.
Bis heute sind die Auswirkungen der ,,verlorenen Dekade" präsent. Hinsichtlich der
Frage, ob die Länder sich mit ihren tiefen populistischen Wurzeln sich ändern kön-
nen, findet man zwei stark konträre Entwicklungen. Schaffte es Brasilien mit sei-
nem ,,Plano Real"
21
eine stabile wirtschaftliche und politische Entwicklung 1994
einzuleiten, zeigte Argentinien tragisch die Instabilität, als 2002 eine eins-zu-eins
Verknüpfung des Pesos mit dem Dollar aufgehoben wurde und das Land in eine
tiefe Finanzkrise stürzte.
22
3.1.2. Aktuelle Regierungen
In Argentinien wurde im Oktober 2007 Christina Fernández de Kirchner mit 45%
der Stimmen zur Präsidentin gewählt. Dabei profitierte sie stark von ihrem Amts-
vorgänger und Ehemann Néstor Kirchner, welcher das Land seit 2003 erfolgreich
aus der Depression führte. In den 70er Jahren war Christina Kirchner während ihres
Jurastudiums zusammen mit ihrem Mann in der links-peronistischen Jugend poli-
19
Vgl. LASON Entwicklungsdiktatoren.
20
Vgl. Greespan, 2007, S. 340.
21
Näheres zur Stabilisierungspolitik Brasiliens und dem damit verbundenen Plano Real in Xavier.
22
Vgl. Greenspan, 2007, S. 341 f.
10
tisch aktiv und gilt ebenso wie ihr Mann als links gerichtete Politikerin.
23
Das poli-
tische Programm orientiert sich am interventionistischen Kurs ihres Mannes, wird
aber zunehmend sowohl vom Ausland wie aber auch von der eigenen Bevölkerung
als kritisch betrachtet. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass die Bevölkerung
ihre Unzufriedenheit in organisierten Protesten zum Ausdruck bringt .
In Brasilien regiert seit 2002 der ehemalige Gewerkschaftsführer Luiz Inácio Lula
da Silvas das Land. Mit über 70% der Stimmen genießt Lula einen starken Rückhalt
in der brasilianischen Bevölkerung, welcher durch den wirtschaftlichen Auf-
schwung des Landes seit 2003 so wie unter anderem durch das Transferzahlungs-
programm ,,Bolsa Familia" für die mittellose Bevölkerung bewirkt wird.
Chile wird seit 2006 von Präsidentin Michelle Bachelet Jeria regiert. Ihre Sozialisti-
sche Partei gehört dem Mitte-Links-Bündnis von Christdemokraten und Sozialisten
an, welche das Land seit der Wiederkehr zur Demokratie im Jahre 1990 regiert.
24
Ebenso wie der brasilianische Präsident Lula gilt sie als links orientierte Politikerin.
In allen drei Ländern finden sich Ansätze populistischer Neigungen der Regierun-
gen.
3.1.3. Einflussnahme des Staates
Die Einflussnahme des Staates in Argentinien ist unter den drei Ländern am stärk-
sten. Jüngstes Beispiel ist der Versuch, per Dekret die Exportabgaben bei Soja kurz
vor Erntebeginn um ein Drittel zu erhöhen, welche zu starken Demonstrationen der
Landwirte führte. Die Eingriffe der Regierung mit dem Ziel künstlich die Konsu-
mentenpreise niedrig zu halten führen zwischenzeitlich zu gleichbleibenden bzw.
sinkenden Gewinnen bei den Landwirten, per Dekret auf dem Weltmarkt durch die
gestiegenen Preise wesentlich besser verdienen könnten.
25
Im Zuge der Finanzkrise unterzeichnete Kirchner ein Dekret zur Verstaatlichung
privater Pensionsfonds. Dieser Schritt wurde von der Regierung mit der internatio-
23
Vgl. Bayern LB, Argentinien, 2008, S. 1.
24
Vgl. Hoogensen/ Solheim/ Campbell, 2006, S. 119 f.
25
Vgl. NZZ online.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836636766
- DOI
- 10.3239/9783836636766
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule RheinMain – Wirtschaft, Insurance and Finance
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Oktober)
- Note
- 2,7
- Schlagworte
- risikomanagement direktinvestition südamerika staaten lateinamerika
- Produktsicherheit
- Diplom.de