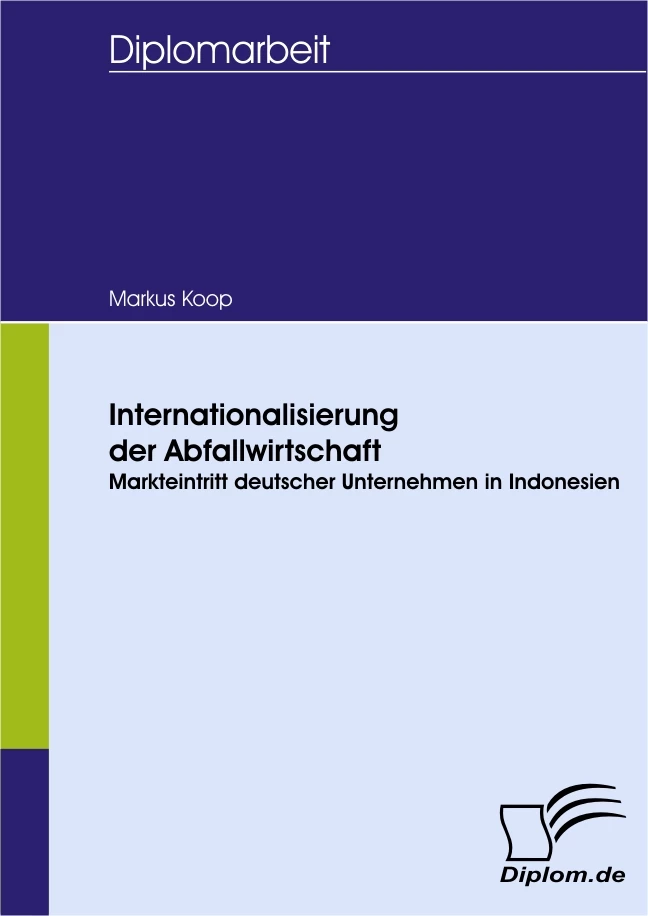Internationalisierung der Abfallwirtschaft: Markteintritt deutscher Unternehmen in Indonesien
Zusammenfassung
Problemstellung:
Private Unternehmen sind seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Abfallwirtschaft und aus dem Gesamtbild nicht mehr wegzudenken. Die Bereitschaft der Kommunen zur Kooperation, die Unterstützung durch die Regierungen und das aufkeimende Umweltbewusstsein führten in Deutschland zu einer Vielzahl von Anbietern von Dienstleistungen und regem Wettbewerb in der deutschen (Abfall-) Branche. Mit der Anzahl der Anbieter steigen auch die Kapazitäten, sodass der inländische Markt immer weniger Wachstumspotenziale bietet. Außerhalb der Grenzen Deutschlands hingegen befinden sich Märkte, welche noch weitgehend von den Kommunen bearbeitet werden, ähnlich wie vor 35 Jahren in Deutschland. Die erfolgreiche Verschiebung von kommunaler zu privatwirtschaftlicher Leistungserstellung im deutschen Markt legt die Option der Internationalisierung und Vervielfältigung des deutschen Modells nahe.
Die Internationalisierung der Abfallwirtschaft ist jedoch eine besondere Herausforderung für Unternehmen, denn die Branche besitzt sehr spezielle Eigenschaften, welche in einzigartiger Kombination auftreten. Neben dem Dienstleistungscharakter (z.B. Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Deponien) existieren auch Elemente der produzierenden Wirtschaft (z.B. Rohstofferzeugung durch Recycling, Dünger aus Kompostierung von Bioabfällen, Energiegewinnung aus Müllverbrennung). Zusätzlich dazu wirtschaftet sieunter Anderem mit bads, also Gütern mit negativen Preisen (Atommüll, Schadstoffe, Restmüll), ist teilweise eintrittsbeschränkt, sehr stark reguliert und durch die mangelnde Mobilität von Abfällen oftmals lokal gebunden.
In der ökologisch motivierten Diskussion zur Abfallwirtschaft werden den Entwicklungsländern sehr große Potenziale zum umweltverträglichen Abfallmanagement zugesprochen, da sich diese auf einem stark ausbaufähigen Niveau befinden. Diese Potenziale wirtschaftlich zu nutzen könnte eine Aufgabe der deutschen Unternehmen werden. Technische Verfahren hierzu werden in ihren Wirkungsweisen und Auswirkungen bereits bis ins Detail erforscht. Auch in der ökologischen und juristischen Literatur wird das Abfallmanagement ausführlich behandelt. Doch finden sich in der Fachliteratur kaum relevante Beiträge, welche diesen speziellen Wirtschaftszweig aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive betrachten. So bleiben diese Potenziale in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern weitgehend unerforscht. Die Konsequenzen daraus haben die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Zielformulierung
1.3. Themeneingrenzung
1.4. Vorangehensweise und Untersuchungsverlauf
2. Internationalisierung der deutschen Abfallwirtschaft
2.1. Motive und Ziele der Internationalisierung
2.2. Theorien der Internationalisierung
2.2.1.Überblick und Anwendbarkeit der Theorien
2.2.1.1.Außenhandelstheorien
2.2.1.2.Theorien der Internationalen Direktinvestition
2.2.1.3.Übergreifende Theorien
2.2.2.Wettbewerbsmodell für Nationen von Porter
2.2.2.1.Porters Diamant in der deutschen Abfallwirtschaft
2.2.2.2.Schlussfolgerungen aus und Kritik an Porters Ansatz
2.2.3.Kritische Würdigung der Theorie in Bezug auf die Abfallwirtschaft
2.3. Entwicklung von Markteintrittsstrategien
2.3.1.Interne Unternehmens- und Umweltanalyse
2.3.2.Länderauswahl Länderanalyse
2.3.3.Die Markteintrittsstrategie
2.3.3.1.Leistungserstellung im Inland
2.3.3.2.Leistungserstellung im Ausland
2.3.3.3.Markteintrittsstrategien in der Abfallwirtschaft
3. Analyse der Abfallwirtschaft in Indonesien
3.1. Länderprofil Indonesien
3.2. Abfallmanagement in Indonesien
3.2.1.Typischer Weg indonesischer Siedlungsabfälle
3.2.2.Bestimmung des Abfallvolumens
3.2.3.Komposition indonesischer Siedlungsabfälle
3.3. Das Modell der Abfallhierarchie
3.3.1.Determinierende Faktoren des Modells
3.3.2.Erweiterung des Modells für Entwicklungsländer
3.4. Evaluierung der Markt- und Rahmenbedingungen
3.4.1.Gesetzgebung Institutionen
3.4.2.Umweltschutz
3.4.3.Finanzen, Wirtschaft
3.4.4.Kultur, Bewusstsein Partizipation
3.4.5.Know-How Kapazitäten
3.4.6.Technische Aspekte
3.4.7.Sozio-Ökonomie
3.5. Kritische Bewertung der Marktsituation Rahmenbedingungen
3.6. Identifizierung wirtschaftlich realisierbarer Optionen für deutsche Unternehmen
4. Konzept für den erfolgreichen Markteintritt
4.1. Entwurf des deutschen Unternehmens in Indonesien
4.2. Integration der Zielsetzungen
4.3. Strategie zur Erschließung des Marktes
4.3.1.Auswahl der Markteintrittsform
4.3.2.Der passende Kooperationspartner
4.3.3.Umfang der Auslandstätigkeiten
4.3.4.Die Frage nach dem Standort
4.4. Chancen und Risiken der Markterschließung
4.4.1.Chancen durch Vorteilhaftigkeit der Diversifizierung
4.4.2.Risiken des deutschen Markteintritts in Indonesien
4.5. Kritische Konzeptbewertung
4.6. Einfluss der aktuellen globalen Finanzmarkt- Wirtschaftskrise
5. Schlussbetrachtung Ausblick
Literaturverzeichnis
ErklÄrung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Porters Diamant zur Bestimmung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit
Abbildung 2: Der Weg zur Markteintrittsstrategie
Abbildung 3: Markteintrittsformen
Abbildung 4: Typischer Weg der Siedlungsabfälle
Abbildung 5: konzeptionelles Abfallwirtschaftsunternehmen in Indonesien
Abbildung 6: Abfallmengen als Standortkriterium
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
Private Unternehmen sind seit Jahren fester Bestandteil der deutschen Abfallwirtschaft und aus dem Gesamtbild nicht mehr wegzudenken. Die Bereitschaft der Kommunen zur Kooperation, die Unterstützung durch die Regierungen und das aufkeimende Umweltbewusstsein führten in Deutschland zu einer Vielzahl von Anbietern von Dienstleistungen und regem Wettbewerb in der deutschen (Abfall-) Branche. Mit der Anzahl der Anbieter steigen auch die Kapazitäten, sodass der inländische Markt immer weniger Wachstumspotenziale bietet. Außerhalb der Grenzen Deutschlands hingegen befinden sich Märkte, welche noch weitgehend von den Kommunen bearbeitet werden, ähnlich wie vor 35 Jahren in Deutschland. Die erfolgreiche Verschiebung von kommunaler zu privatwirtschaftlicher Leistungserstellung im deutschen Markt legt die Option der Internationalisierung und Vervielfältigung des deutschen Modells nahe.
Die Internationalisierung der Abfallwirtschaft ist jedoch eine besondere Herausforderung für Unternehmen, denn die Branche besitzt sehr spezielle Eigenschaften, welche in einzigartiger Kombination auftreten. Neben dem Dienstleistungscharakter (z.B. Müllabfuhr, Straßenreinigung oder Deponien) existieren auch Elemente der produzierenden Wirtschaft (z.B. Rohstofferzeugung durch Recycling, Dünger aus Kompostierung von Bioabfällen, Energiegewinnung aus Müllverbrennung). Zusätzlich dazu wirtschaftet sieunter Anderem mit ‚bads’, also Gütern mit negativen Preisen (Atommüll, Schadstoffe, Restmüll), ist teilweise eintrittsbeschränkt, sehr stark reguliert und durch die mangelnde Mobilität von Abfällen oftmals lokal gebunden.
In der ökologisch motivierten Diskussion zur Abfallwirtschaft werden den Entwicklungsländern sehr große Potenziale zum umweltverträglichen Abfallmanagement zugesprochen, da sich diese auf einem stark ausbaufähigen Niveau befinden. Diese Potenziale wirtschaftlich zu nutzen könnte eine Aufgabe der deutschen Unternehmen werden. Technische Verfahren hierzu werden in ihren Wirkungsweisen und Auswirkungen bereits bis ins Detail erforscht. Auch in der ökologischen und juristischen Literatur wird das Abfallmanagement ausführlich behandelt. Doch finden sich in der Fachliteratur kaum relevante Beiträge, welche diesen speziellen Wirtschaftszweig aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive betrachten. So bleiben diese Potenziale in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern weitgehend unerforscht. Die Konsequenzen daraus haben die Abfallwirtschaftsbetriebe zu tragen, welche sich in ihren Internationalisierungsbestrebungen nicht auf fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse oder strategische Konzepte stützen können. Dieses aus Unsicherheit resultierende unternehmerische Risiko beim Markteintritt in den Auslandsmarkt stellt eine Gefahr für die deutschen Unternehmen und eine Lücke in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung dar.
1.2. Zielformulierung
Die vorliegende Arbeit nimmt die Öffnung der indonesischen Abfallwirtschaft für privates Engagement zum Anlass, einen Beitrag zur Schließung einer wirtschaftswissenschaftlichen Wissenslücke zu leisten. Aus diesem Grund liegt der Fokus auf dieser weitgehend vernachlässigten Branche, deren Internationalisierung in Bezug auf die Option des Markteintritts deutscher Unternehmen nach Indonesien untersucht wird. Die größte Nation Südostasiens steht dabei repräsentativ für Entwicklungs- und Schwellenländer, denen die Potenziale im Abfallmanagement zugesprochen werden. An diesem Beispiel wird ein Konzept für den erfolgreichen Markteintritt entwickelt, das den privaten Unternehmen der Branche
1. einen Einblick in die wirtschaftlichen Aspekte der Internationalisierung unter den speziellen Anforderungen der Abfallwirtschaft gibt,
2. die Möglichkeiten in diesem neuen geographischen Markt identifiziert und
3. Gestaltungsempfehlungen zur optimierten Markteintrittsstrategie unter den außergewöhnlichen Rahmenbedingungen Indonesiens herausstellt.
Der Anspruch dieser Arbeit ist es dabei, das Konzept nicht auf unternehmensspezifischer Basis zu erstellen, sondern eine konzeptionelle Hilfestellung für alle Unternehmen der Branche zu geben, welche eine Expansion in Entwicklungsländer anstreben.
1.3. Themeneingrenzung
Der Begriff der Abfallwirtschaft ist sehr weitläufig. Er umfasst ein weites Spektrum an Leistungen von der Entsorgungsdienstleistung über Recycling bis zur Energieerzeugung. Auch werden viele Abfallarten unterschieden, sodass in Deutschland 837 Abfallschlüsselnummern existieren (Abfallverzeichnis-Verordnung). Siedlungsabfälle umfassen 40 dieser Schlüsselnummern, stellen jedoch einen Großteil des gesamten Abfallaufkommens dar und erfordern daher auch einen Großteil des wirtschaftlichen Engagements. Auf diesen Bereich ist diese Arbeit ausgelegt, d.h. es wird ausschließlich der Teil der Abfallwirtschaft betrachtet, der sich mit privatem Hausmüll und den hausmüllähnlichen Abfällen beschäftigt. Dies schließt unter Anderem Abfälle der Bauwirtschaft, industriellen Abfall, gefährliche Abfälle (früher Sondermüll) und nicht-feste Stoffe (z.B. Klärschlamm) explizit aus.
Innerhalb des Bereichs der Siedlungsabfälle werden weiterhin jene Bereiche zurückgestellt, welche starke Synergien mit der Energiewirtschaft aufweisen. Diese beinhalten Biogaskraftwerke, alternative Brennstoffe, energetische Abfallverbrennung, etc. undstellen eher eine Schnittstelle zur Energiewirtschaft dar als eine rein abfallwirtschaftliche Thematik. Zudem werden diese Geschäftsfelder tendenziell eher von den großen Energiekonzernen besetzt, als von Abfallwirtschaftsunternehmen.
Somit wird der Untersuchungsgegenstand definiert als die branchenspezifische undleistungsbezogene Internationalisierung der Abfallwirtschaft in Bezug auf die Konzepterstellung einer Markteintrittsoption privater deutscher Unternehmen in den indonesischen Markt im Bereich des Umgangs mit Siedlungsabfällen und unter Ausschluss energiewirtschaftlicher Aktivitäten und Führungsmodellen.
1.4. Vorangehensweise und Untersuchungsverlauf
Eine Analyse der deutschen Abfallwirtschaft auf ihre Fähigkeiten und Optionen zum Markteintritt in Indonesien ist ohne eine fundierte wissenschaftliche Basis nicht zielführend. Aus diesem Grund erfolgt in Kapitel 2 eine eingehende Betrachtung der theoretischen Grundlagen der Internationalisierung. Dabei werden ausgewählte Theorien vorgestellt und unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Branche auf ihre Anwendbarkeit und Zweckmäßigkeit geprüft. Schon bei der Sichtung der Theorie wird jedoch deutlich, dass diese nicht ohne weiteres auf die Abfallwirtschaft übertragbar ist. Weiterhin wird der Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen und der Entwicklung von Markteintrittsstrategien in dieser speziellen Branche nachgegangen. In diesem Sinne dient Kapitel 2 dem Aufbau eines soliden theoretischen Fundamentes auf das sich sowohl spätere Teile dieser Arbeit als auch die Unternehmen in ihrem Internationalisierungsprozess stützen können.
Das dritte Kapitel beinhaltet eine Analyse Indonesiens, da detailliertere Informationen über die Märkte und Rahmenbedingungen des Ziellandes für die strategische Planung des Markteintritts unumgänglich sind. Zur Durchführung dieser Analyse wird das Abfallhierarchiemodell verwendet, welches spezieller auf die Eigenschaften der Branche eingeht, als herkömmliche Analyseverfahren. Dennoch bedarf es für den Einsatzes in Entwicklungsländern einer zusätzlichen Modifikation, um die Analysefähigkeit zu verfeinern, welche in Kapitel 3.3.2 eingeführt wird. Aus dieser ersten Analyse des Ziellandes lassen sich eine Reihe von Potenzialen in der indonesischen Siedlungsabfallwirtschaft ableiten, welche den deutschen Unternehmen als Ansatzpunkt dienen können.
Anschließend folgt die Zusammenführung der Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen und der Ziellandanalyse. Durch die Informationen über die Märkte und Rahmenbedingungen in Indonesien werden die möglichen Markteintrittsstrategien aus Kapitel 2 auf ihre Erfolgschancen hin überprüft und fließen danach in einem theoretischen Konzept zusammen. Anhand dieses spezifischen Konzeptes wird deutlich, auf welche Weise der Markteintritt in die Abfallwirtschaft von Entwicklungs- und Schwellenländern erfolgversprechend stattfinden kann. Darüber hinaus zeigt es Unterschiede zur deutschen Abfallwirtschaft auf, denen im Internationalisierungsprozess Beachtung geschenkt werden muss.
Im gesamten Verlauf dieser Arbeit wird verdeutlicht, wie lückenhaft bisher aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive in der Abfallwirtschaft geforscht wurde. Insbesondere aber bzgl. der Internationalisierung der Branche stehen bis heute keine verlässlichen Daten oder Modelle zur Verfügung. Aus diesem Grund stehen an vielen Stellen qualitative Analysen im Vordergrund, um auch wissenschaftlichen Folgeprojekten eine Übersicht und Ansatzpunkte zu bieten.
2.Internationalisierung der deutschen Abfallwirtschaft
Der Begriff der Internationalisierung wird in der Literatur für viele Phänomene verwendet. In dieser Arbeit wird eine der abstraktesten Definitionen des Begriffs verwendet, welche sie als länderübergreifende Ausdehnung des unternehmerischen Aktionsfeldes festlegt (Perlitz 2004, S. 8). Dabei sei hier jedoch das Aktionsfeld etwas enger gefasst, sodass sich ausschließlich auf die Leistungserstellung des Unternehmens bezogen wird. Die Kreditaufnahme auf einem ausländischen Kapitalmarkt ist bspw. nicht Teil des Leistungsspektrums der Abfallwirtschaft und damit im Sinne dieser Arbeit auch nicht mit Internationalisierung zu bezeichnen.
Um nicht ungeplant und unkontrolliert abzulaufen bedarf es einer grundsätzlichen, länderübergreifenden Handlungskonzeption, die auf Wettbewerbsvorteilen aufbaut, die für die Auslandsaktivität des Unternehmens notwendig oder nützlich sind (Perlitz 2004, S. 64). Dies wird im Folgenden etwas näher betrachtet.
2.1. Motive und Ziele der Internationalisierung
Motive sind die grundlegenden Beweggründe für jedes Handeln. In der privaten Wirtschaft stehen im Wesentlichen drei Motive im Vordergrund: die Unternehmenswertsteigerung im Sinne des Unternehmensfortbestandes, die Risikominderung (Ringsletter Skrobarczyk 1994, S. 333 f.) sowie die Erlangung von Kontrolle über Märkte, Ressourcen und/oder Kapazitäten (Haas Neumair 2006, S. 215).
Damit jeder im Unternehmen, unabhängig von seinen persönlichen Motiven, im Sinne der Unternehmung handelt, sind in Inhalt, Ausmaß und zeitlichem Bezug präzise formulierte Ziele notwendig (Heinen 1976, S. 59 ff.). Jedes Ziel beschreibt einen Aspekt eines erstrebenswerten zukünftigen Realitätszustands und zusammen bilden sie ein Zielsystem, welches es zu erreichen gilt (Hauschildt, 1977, S. 8 f.). Somit dienen Ziele den Akteuren als richtungweisende Orientierungshilfe im unternehmerischen Entscheidungsprozess (Macharzina Wolf, 2005, S. 209) und richten alle Beteiligten auf die Verfolgung der Unternehmensmotive aus.
Auch in Bezug auf die Internationalisierung von Unternehmen ist dies der Fall. Die Steigerung des Unternehmenswertes soll durch den Gewinnbeitrag des Auslandsgeschäfts erfolgen, welcher mittels marktstrategischem Wachstum oder Kostenreduzierungen generiert wird. Obwohl die empirische Zielforschung die Dominanz des Gewinnziels relativiert hat (Heinen 1976, S 29 ff.), geben doch 65% der deutschen Unternehmen diese Motive als Hauptgrund ihres Kapitaleinsatzes im Ausland an (DIHK 2008, S. 3). Auch kann der Schritt ins Ausland das Gesamtrisiko reduzieren, indem er, trotz des erheblichen Eigenrisikos des Misserfolgs, die Abhängigkeit von den nationalen Märkten und deren Schwankungen verringert.
In der Abfallwirtschaft verhält es sich ähnlich. Basierend auf gesetzlichen Bestimmungen[1], welche den Abfallbegriff und die Deponierung weiter einschränken und gefördert durch z.B. das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), erfreut sie sich zunehmender Wirtschaftlichkeit. Hinzu kommen die jahrelang gestiegenen Marktpreise für Wert- und Rohstoffe, welche die Branche überdies für private Investoren attraktiv machen. Mit dieser sich vollziehenden Verschiebung von der kommunalen zur privaten Abfallwirtschaft ändern sich auch die Zielsetzungen. Kommunale Betriebe unterliegen weitgehend dem Kostendeckungsprinzip. Ihr Hauptziel ist die flächendeckende Versorgung aller Bürger unter der Bedingung eines Nullgewinns, welcher wohlfahrtsökonomisch optimal ist (Nowotny 1999, S. 243, 221). Die privatwirtschaftlichen Aktivitäten hingegen sind renditeorientiert und haben daher langfristige und dauerhafte Gewinnerzielung in Form einer angemessenen Zielrendite als oberste Priorität. Diese lassen sich durch unternehmerisches Wachstum erreichen. Dabei streben deutsche Unternehmen der Branche neben Erschließung neuer Geschäftsfelder und Regionen insbesondere die Erweiterung der Entsorgungswertschöpfungskette an, um durch eine Gesamtoptimierung der Leistungserstellung höhere Renditen zu erzielen (Schulze Wehninck 2008, S 95 f.).
Folglich sind die ökonomischen Ziele vorrangig, welche unter der Bedingung erfüllt werden müssen, dass die vorgegebenen ökologischen Richt- und Grenzwerte bzw. Vorgaben zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz eingehalten werden. In den letzten Jahren wurden diese ständig verschärft, sodass dieser Trend wahrscheinlich weiter anhalten wird. Diese ökologischen, aber auch imagebedingten Faktoren etc. bilden die nicht-ökonomischen Ziele der Unternehmung.
2.2.Theorien der Internationalisierung
Die wirtschaftswissenschaftliche Literatur verweist auf eine Vielzahl unterschiedlicher Theorien zur Internationalisierung, welche in ihrer abstrahierten Form möglichst allgemeingültig sein sollen. Die teilweise atypischen Bedingungen der Abfallwirtschaft erfordern jedoch eine Prüfung der Anwendbarkeit der Theorien.
2.2.1. Überblick und Anwendbarkeit der Theorien
2.2.1.1. Außenhandelstheorien
Die Außenhandelstheorien bilden die frühesten Versuche, grenzüberschreitende Unternehmensaktivität zu erklären. Smith, Ricardo, Heckscher/Ohlin, Leontief usw. zeigen anhand ihrer Theorien diverse Erklärungsvariablen wie Faktorausstattung, Kostenvorteile oder Kapitalausstattung auf, welche auch in der Internationalisierung der Abfallwirtschaft relevant sein können. Aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Orientierung finden sie jedoch in der betriebswirtschaftlichen Internationalisierung kaum Anwendung (Perlitz 2004, S. 115). Zudem wird die Möglichkeit, selber mit Kapitaleinsatz im Ausland tätig zu werden gänzlich außer Acht gelassen. Grund hierfür ist die Annahme, dass alle Produktionsfaktoren völlig immobil seien (Welge Holtbrügge, 1998 S. 62). Dies trifft in bedingtem Maße zwar auf die Siedlungsabfälle als Produktionsfaktor zu, da die starke Bindung der Abfallwirtschaft an den Ort der Abfallerzeugung den internationalen Handel weitgehend[2] ausschließt. Es sind jedoch auch noch weitere Faktoren einzubeziehen, auf welche diese Annahme nicht zutrifft, wie z.B. das Investitions- oder Humankapital.
2.2.1.2. Theorien der Internationalen Direktinvestition
Theorien der internationalen Direktinvestition (FDI) greifen diesen Kritikpunkt auf und versuchen, den Transfer von Kapital und Ressourcen ins Ausland zu erklären. Dabei ist die Direktinvestition definiert als Kapitaltransfer, der auf die Einflussnahme der Geschäftstätigkeit des kapitalnehmenden Unternehmens abzielt (Dt. Bundesbank 1999, S. 59). Die FDI beruht folglich maßgeblich auf dem Kontrollmotiv der Internationalisierung. Zu den Theorien der FDI zählen unter Anderem die Standorttheorie, Monopol-Theorie, Kapitalmarktorientierte Ansätze, sowie Aharonis handelsschrankenbasierte Theorie.
Diese Theorien der FDI beruhen auf einem situativen Kontext, welcher sie in ihrer Anwendbarkeit stark einschränkt. Zudem sind sie meist monokausal und relativ statisch. Damit sind sie zwar zur Erklärung von vielen Internationalisierungsaspekten und als Ansatzpunkte für Unternehmens- und Umweltanalysen gut geeignet, genügen jedoch keineswegs den Ansprüchen an eine allgemeingütige Theorie der Internationalisierung (Perlitz 2004, S. 115 ff.). Dies begründet sich maßgeblich in ihrem Mangel an konzeptioneller Integration der Erklärungsvariablen in den Internationalisierungsprozess (Macharzina Wolf 2004, S. 930).
2.2.1.3. Übergreifende Theorien
Die übergreifenden Theorien der Internationalisierung sind nicht allein von der Markteintrittsform abhängig, wodurch sie der Komplexität der Thematik eher gerecht werden können. Zu dieser Kategorie zählen u.A. Dunnings Elektische Theorie, Standortansätze und die Produktlebenszyklus (PLZ) Theorie.
Die Elektische Theorie von Dunning ist eine Theorie, welche sowohl ein sehr breites Spektrum von unterschiedlichen Erklärungsvariablen aus Unternehmens- und Umweltanalyse integriert, multikausale Zusammenhänge analysiert als auch den Markteintritt selbst und seine Form berücksichtigt. Durch die Integration derart vieler Elemente aus den bestehenden Theorien erreicht Dunning einen relativ hohen Realitätsgehalt. Allerdings verliert die Theorie wieder an Aussagekraft, da teilweise unvereinbare Erklärungsebenen miteinander verglichen werden (Welge Holtbrügge 1998, S. 75; Perlitz 2004, S. 109 ff.).
Auch Prozessaspekte finden Berücksichtigung in der Theorie, so in der Lerntheorie von Johanson und Vahlne (Uppsala-Modell) oder Aharonis Verhaltensorientierter Theorie. Relativ vernachlässigt bleibt dabei die zugrunde liegende ökonomische Unternehmens- und Umweltsituation (Welge Holtbrügge 1998, S. 69 f.). Die Standorttheorie ähnelt durch die Exportfokussierung stark der Außenhandelstheorie und ist daher wieder in der Abfallwirtschaft quasi irrelevant. Sie greift aber mit dem Transportkostenansatz einen elementaren Aspekt auf, da dieser einen kritischen Faktor in der Branche darstellt. Das Triade-Modell von Ohmae ist ebenfalls ungeeignet, da es eine Standortwahl in den höchstentwickelten Ländern predigt, die durch die Effizienz von Technologie und Fachkräften kostengünstiger sind als die Produktion in Niedriglohnländern. Hier ist die relative Immobilität in der Abfallwirtschaft der ausschlaggebende Faktor, da die Entsorgung nahe des Entstehungsortes geschehen muss, um die Transportkosten gering zu halten.
Nach demselben Prinzip können alle gängigen Theorien der Internationalisierung relativiert werden. Kaum eine vermag den speziellen Eigenheiten der Abfallwirtschaft zu genügen und als Erklärungsmodell zu dienen. Eine Ausnahme jedoch bildet Porters Wettbewerbsmodell der Nationen, das mit einer gänzlich anderen Herangehensweise die Internationalisierung analysiert.
2.2.2. Wettbewerbsmodell für Nationen von Porter
Das weite Spektrum an Theorien vermag eine große Anzahl von Teilaspekten abzudecken, aber sie vermögen nicht zu erklären, warum gerade die deutsche Abfallwirtschaft prädestiniert ist, den unternehmerischen Schritt ins Ausland zu wagen. Dieser Ansatz lässt sich mit Porters Wettbewerbsmodell für Nationen verfolgen.
Das Modell, auch bekannt als Porters Diamant, dient ursprünglich der Erklärung, warum international erfolgreiche Unternehmen oft aus demselben Land stammen. Es verknüpft daher diverse Aspekte aus Unternehmens- und Umweltanalyse auf nationaler Ebene zu einer umfassenden Gesamtkonzeption. Bezogen auf die deutsche Abfallwirtschaft kann durch diese Theorie das Vorhandensein branchenspezifischer nationaler Wettbewerbsvorteile nachgewiesen werden, welche der Branche internationale Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen (Porter 1990, S. 77). Falls keine internationale Wettbewerbsfähigkeit bestehen würde, dann wäre der Markteintritt deutscher Unternehmen in Indonesien nur dann sinnvoll, wenn sich durch den Markteintritt selbst ein Wettbewerbs- oder marktstrategischer Vorteil generieren ließe. In jedem anderen Fall wäre die Aktivität im Ausland nur temporär bis ein Konkurrent mit solchen Vorteilen den Markt für sich beansprucht.
2.2.2.1. Porters Diamant in der deutschen Abfallwirtschaft
Das nationale Umfeld nimmt für die Internationalisierung von Unternehmen eine bedeutende Stellung ein. Der Grund hierfür ist, dass es bestimmende nationale Faktoren gibt, die die Wettbewerbsfähigkeiten von Unternehmen einiger Branchen fördern.
Abbildung 1: Porters Diamant zur Bestimmung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Porters Diamant zur Bestimmung nationaler Wettbewerbsvorteile (nach Perlitz 2000, S. 137)
Porter zufolge sind vor allem vier Bestimmungsfaktoren für die Ausprägung von nationalen Wettbewerbsvorteilen maßgeblich (im Folgenden: Porter 1990, S. 78 ff.), welche sich untereinander wechselseitig beeinflussen können (vgl. Abbildung 1).
1. Faktorbedingungen stellen die Verfügbarkeit von wichtigen Wertschöpfungsfaktoren dar. Diese umfassen sowohl Ressourcen wie qualifiziertes Personal, Rohstoffe, Produktionsmittel und Kapital, als auch Faktoren wie dem Lohnniveau, technologischen Standards, der Infrastruktur bis hin zur Arbeitsmotivation.
Der Standort Deutschland bietet der Abfallwirtschaft sehr gute Bedingungen in Form von Infrastruktur, Ausbildungsniveau und Kapitalverfügbarkeit für Investitionen. Die technischen Standards gehören zu den höchsten der Welt und resultieren in der international bekannten ‚deutschen Qualität’. Ein hohes Lohnniveau stellt nicht zwangsläufig einen Nachteil dar, sondern regt zu effizienteren, weniger personalintensiven Innovationen an. Natürliche Rohstoffe sind ein Mangel im Inland, doch ist dieses in der Abfallwirtschaft nur wenig relevant, da hauptsächlich Abfälle als ‚Produktionsfaktoren’ dienen.
2. Nachfragebedingungen stehen für die Art und Höhe der Inlandsnachfrage nach den Produkten und Leistungen der Branche. So sorgen z.B. qualitätsbewusste Konsumenten für einen kontinuierlichen Innovationsdruck und fördern den Fortschritt von Technologie, Prozessen und Mitarbeiterfähigkeiten. Wenn die Konsumenten im Inland ausländische Nachfragestrukturen antizipieren, können zudem wichtige Indikatoren für die Bearbeitung des Auslandsmarktes gewonnen werden. (Welge Holtbrügge 1998, S. 72)
Die inländische Nachfrage sowohl nach Dienstleistungen als auch nach Produkten aus der Abfallwirtschaft ist stagnierend. Stilllegungen von Deponien und Eingrenzungen des Abfallbegriffs durch den Gesetzgeber erfordern immer effizientere Anlagen und Methoden, um die vorgegebenen Grenzwerte einzuhalten. Diese zu errichten wirkt positiv auf die Nachfragebedingungen. Hierzu zählen z.B. die Abfallbehandlung und verbesserte Effizienzgrade des Recycling. Auch am Endverbrauchermarkt werden Erzeugnisse wie umweltfreundliche Verpackungen und aus Recycling stammende Waren vermehrt gefordert, um konventionellen Rohstoffeinsatz zu substituieren. Deutschland gilt international als ein Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, was auch die Abfallwirtschaft einschließt. Es ist zu erwarten, dass sich international die Nachfragestrukturen an die hochentwickelten deutschen Systeme annähern, um Umwelt- und Klimaziele zu erreichen. Zu beachten ist jedoch, dass bei derzeitigem Anstieg der Kapazitäten und Rückgang des Abfallaufkommens (BMU-Website) das inländische Nachfragewachstum begrenzt ist[3] und weiteres Wachstum in anderen Bereichen oder geografischen Märkten zu suchen sein wird.
3. Den dritten Faktor bilden verwandte und unterstützende Branchen. In Form von starken Zulieferindustrien sorgen sie für günstigen Zugang zu den Produktionsfaktoren. Noch wichtiger dabei ist die Verflechtung der Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, denn so können Potenziale von Wissen, Patenten und Mitarbeitern nutzbar gemacht werden (Perlitz 2004, S. 139).
In Deutschland konzentrieren sich diverse synergetische Branchen. Forschungsinstitute entwickeln neue Methoden und Technologien, welche im Maschinenbau umgesetzt werden, um den immer höheren Anforderungen gerecht zu werden. Auf die Anlagen kann die Abfallwirtschaft zurückgreifen und damit ihre Effizienz steigern. Der deutsche Automobilbau ist ebenfalls weltweit führend und stellt die benötigten Spezialfahrzeuge her, um die Abfuhr zu optimieren. Natürlich führen auch die engen Verknüpfungen mit der Energiewirtschaft zu verbesserter Nutzung des Abfalls als Ressource zur Energiegewinnung.
Dieses weite Netz innerhalb und um die Abfallwirtschaft herum sowie der Einbezug von Mitarbeiterideen, Produktentwicklungskooperationen und die sprichwörtliche ‚Ordnungsliebe’ der Deutschen unterstützen dabei die kontinuierliche Optimierung der Prozesse und Technik und führten insgesamt zu der heutigen Spitzenposition Deutschlands in der Branche.
4. Unternehmensstrategie, Strukturen und Konkurrenz vereinen im vierten Hauptelement des Diamanten Elemente der Unternehmensanalyse mit Konkurrenzaspekten innerhalb der eigenen Branche. Ein direkter Zusammenhang zwischen Organisationsstrukturen, kulturbedingten Führungsstilen und der Wettbewerbsfähigkeit ist bereits durch die kulturvergleichende Managementforschung nachgewiesen (Welge Holtbrügge 1998, S. 72). Zusätzlich zieht Porter den zeitlichen Horizont der Unternehmensstrategie und die Stellung nationaler Konkurrenz heran. Wenn letztere stark ist, so dient sie lt. Porter als ein elementarer Faktor der Innovationskraft, welche wiederum Wettbewerbsvorteile fördert und damit die Erschließung von Auslandsmärkten vorantreibt.
Die in Kapitel 2.1 erwähnte Verschiebung von kommunaler zu privater Abfallwirtschaft durch staatliche Anreizsysteme und das stärker werdende Umweltbewusstsein wirkten in Deutschland wettbewerbsfördernd. Auf allen Stufen des Bearbeitungsprozesses sind heute Privatanbieter beteiligt, als Konkurrenz zu den kommunalen Entsorgern oder als Kooperationspartner und Dienstleister in Form von Public-Private-Partnerships (PPP).
Die Fusionen und Übernahmen der letzten Jahre durch die Großen der Branche[4] konzentrieren die Wettbewerbsstrukturen im Markt. Auch das zunehmende Engagement der kapitalstarken Energiekonzerne in diesem Bereich sowie das kontinuierlich sinkende Siedlungsabfallaufkommen wirken sich auf die Wettbewerbsverhältnisse aus. Heute gibt es vor allem die Großen der Branche, die den Markt weitgehend unter sich aufteilen, jedoch durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im Wachstum gehindert sind. Neben diesen bestehen sehr viele kleinere Unternehmen und Kommunale Betriebe, die regional begrenzt wirtschaften oder Nischen besetzen. Daher lässt sich feststellen, dass die Konkurrenz hauptsächlich in den früheren Stadien der Marktentwicklung als treibende Kraft wirkt, schwächt sich jedoch mit fortschreitender Konsolidierung im Markt ab. Vergleichbar ist dies etwa mit der noch weiter fortgeschrittenen Situation auf dem Energiemarkt.
Die internen Unternehmensaspekte, wie die Strategie und Strukturen, sind auf Mikroebene zu analysieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf Branchenebene argumentiert, sodass der Einbezug einzelunternehmerischer Aspekte nicht zielführend ist. Dennoch zeigt sich verallgemeinert für die Grossen der Branche, dass sie als Unternehmensgruppen mit Länderdivisionen organisiert sind. In jedem Land sind Geschäftsbereiche nach der Funktion definiert, welche auf regionaler Basis von weitgehend selbständigen Unternehmen ausgeführt werden. Überregionale Aufgaben (Beratung, Forschung, etc.) werden auf nationaler Ebene erbracht. In diese Strukturen ließe sich eine weitere Division ‚Indonesien’ relativ leicht einbinden.
Für die kleineren Unternehmen mit regionalem Bezug kann die Einbindung in die vorhandenen Strukturen hingegen kompliziert sein, da diese nicht auf Auslandsgeschäfte ausgelegt sind. Dies hängt jedoch von der jeweiligen Organisationsform ab.
Um die vier Bestimmungsfaktoren herum sieht Porter den Staat und den Zufall als zwei ergänzende Faktoren. Beide liegen außerhalb des Einflussbereichs der Branche[5], können sich jedoch auf diese auswirken. Zu den relevanten Zufallsereignissen zählen u.A. Technologiesprünge, große Verschiebungen auf den Finanzmärkten oder der Nachfrage oder politische Entscheidungen des Auslands. Diese großen, unvorhersehbaren Ereignisse der Umwelt können den gesamten Diamanten vollständig aufmischen, aber auch neue Vorteile und Potenziale schaffen (Perlitz 2004, S. 140). Dem Staat obliegt die Funktion eines Katalysators. Durch nationale Strukturanpassungen, Anreize und rechtliche Bestimmungen sollen neue Prozesse und Innovationen angestoßen werden. Dies geschieht in Deutschland sehr intensiv. Die deutsche und europäische Gesetzgebung für die Abfallwirtschaft sind sehr streng und präzise definiert. Für jeden Tätigkeitsbereich existieren Vorschriften, sei es in Form des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der Verpackungsverordnung, TASI oder der Deponieverordnung. Allein schon die Erreichung der verlangten Grenzwerte innerhalb der Übergangsfristen ist eine Herausforderung an die Anpassungsfähigkeit der Branche und fordert ständig neue innovative Prozesse und Verfahren. Weiterhin ist es lt. Porter Aufgabe des Staates, wettbewerbsschädigende Konstellationen zu minimieren (Porter 1990, S. 87 f.), wie es z.B. im deutschen Kartellrecht weitgehend geschieht.
2.2.2.2. Schlussfolgerungen aus und Kritik an Porters Ansatz
Auf Grundlage von Porters Wettbewerbsmodell sind die allgemeinen Voraussetzungen deutscher Abfallwirtschaftsunternehmen für die Internationalisierung sehr positiv zu bewerten. Die Faktoren des Diamanten ergänzen sich relativ gut für die Branche, auch wenn die Konkurrenzsituation eher ungünstig zu bewerten ist. Insbesondere auch die Stellung Deutschlands als ‚Unternehmenscluster’, der durch das Zusammenspiel von diversen Branchen und Forschungseinrichtungen einen Innovationsvorsprung ggü. der internationalen Konkurrenz darstellt. Dies stellt eine geeignete Ausgangssituation dar, welche international einen Wettbewerbsvorteil bedeuten kann und damit die Internationalisierung begünstigt. Porters extensive empirische Belege des Modells, sowie die Erfolge deutscher Unternehmen der Abfallwirtschaft bei der innereuropäischen Expansion bestätigen diese Theorie und bestärken die Vermutung der Anwendbarkeit in der Abfallwirtschaft.
Dennoch ist Porters Modell nicht ohne Grenzen verwendbar. Etablierte multinationale Unternehmen vereinen Wettbewerbsvorteile aus diversen Standorten, sodass für diese der Diamant im Heimatland nur noch wenig Bedeutung hat. Relevant ist das Modell daher hauptsächlich in einer frühen Internationalisierungsphase, wie bei den kleinen Unternehmen der Branche in Deutschland. Es kann theoretisch auch im Falle von sehr großen Sprüngen des Unternehmens zutreffend sein, wie für die Großen der Abfallwirtschaft zutreffend sein kann. Diese agieren bisher fast ausschließlich europäisch und bleiben damit geographisch, kulturell und in Bezug auf die Gesetzeslage sehr nahe am Heimatmarkt. Ein Sprung nach Indonesien stellt ganz andere Bedingungen an das Unternehmen und könnte den Diamanten wieder relevant werden lassen.
Alle einfließenden Faktoren des Modells weisen des Weiteren einen Vergangenheitsbezug auf, sodass die Prognosefähigkeit auf historischen Trends und individuellen Bewertungen der Faktoren beruht. Damit darf die ‚Dynamik des Diamanten’ in Frage gestellt werden (Perlitz 2004, S. 151). Zudem ist Porters Behauptung der langfristigen Abnutzung von Wettbewerbsvorteilen bei Kooperationen empirisch widerlegt, sodass Innovation nicht nur auf Druck von Außen, sondern auch auf Kooperation beruhen kann (Aktouf et al. 2005, S. 198).
Trotz dieser und anderer Kritikpunkte stellt Porters Diamant eine fundierte Grundlage zur Ausgangssituation der Internationalisierung dar und verdeutlicht, dass die deutsche Abfallwirtschaft (als Branche) prädestiniert ist, international tätig zu werden. Die Verwendung dieses Modells ermöglicht es den Unternehmen, die eigene Position und die internationalen Chancen deutlicher darzustellen und dadurch die subjektive Risikowahrnehmung der Entscheider positiv zu beeinflussen. Dies sind jedoch auch die einzigen Implikationen zur Entscheidungsfindung, da der Markteintrittsstrategien und die Form des Eintritts unberücksichtigt bleiben. Somit bildet Porters Diamant zwar auch nur eine Partialtheorie, erklärt aber, warum es gerade deutsche Unternehmen sein sollten, die in Indonesien aktiv werden.
Über die relative Größe des nationalen Wettbewerbsvorteils ließen sich durch Anwendung des Modells auf die Hauptkonkurrenznationen Schlüsse ziehen. In der vorliegenden Arbeit genügt hingegen der erbrachte Nachweis des Vorteils, da die Entwicklung eines Markteintrittskonzeptes für Indonesien nicht auf dessen beruht, sondern auf dessen Existenz. Eine länderübergreifende, vergleichende Betrachtung der Wettbewerbsvorteile wäre folglich keine notwendige Bedingung.
2.2.3. Kritische Würdigung der Theorie in Bezug auf die Abfallwirtschaft
Eine grundlegende, allgemeingültige und umfassende theoretische Grundlage zur Internationalisierung von Unternehmen existiert bis heute nicht (Perlitz 2004, S.238). Stattdessen handelt es sich um Partialansätze, welche kontextbezogenen Erklärungswert besitzen (Kutschker Schmid, 2008, S. 378). Am weitesten untersucht ist der Bereich der produzierenden Industrie und auch Dienstleistungen sind in den Fokus der Internationalisierungsforschung aufgenommen. Die wirtschaftlich relevanten Aspekte für die Internationalisierung der Abfallwirtschaft sind jedoch bisher ein weitgehend unerforschtes Gebiet in der Fachliteratur.
In diesem Kapitel sind viele Theorien der Internationalisierung aufgegriffen und in Ihrer Bedeutung für die Abfallwirtschaft relativiert worden. Die Abfallwirtschaft kann zwar durchaus im produzierenden Bereich tätig sein (Energiewirtschaft) und in diesen Fällen teils auch mit den bestehenden Theorien zur Internationalisierung weitgehend erklärt werden, es existieren jedoch auch noch branchenspezifische Eigenheiten, welche mit der Theorie nicht oder nicht zielführend vereinbar sind. Hierzu zählen vor allem die relative Immobilität von Abfällen mit der daraus resultierenden lokalen Bindung oder der Dienstleistungscharakter der Branche, der die rein outputbezogenen Theorien (z.B. Produktlebenszyklus-Theorie) unwirksam macht.
Die Theorien sind demnach mit ihren gegebenen Annahmen und in ihrem Kontext durchaus relevant, im Kontext der Abfallwirtschaft jedoch tendenziell ungenügend. Aufgrund der speziellen Eigenschaften der Branche können sie als Quelle von Einflussgrößen für die Umwelt- und Unternehmensanalysen verwendet werden, jedoch nicht als erklärende Theorie. In diesem Zusammenhang sind auch die Auswirkungen abgeschwächt, welche aus den teilweise bestehenden Interdependenzen zwischen den Faktoren der Theorie stammen (Kutschker Schmid 2008, S. 378), da diese durch die Anzahl der Einflussgrößen weniger ins Gewicht fallen.
Lediglich Porters Wettbewerbsmodell der Nationen ist ohne große Einschränkungen verwendbar und verdeutlicht die Position deutscher Unternehmen im Internationalisierungsprozess der Abfallwirtschaft.
2.3. Entwicklung von Markteintrittsstrategien
Wie bereits erörtert existiert zum heutigen Tage noch keine allgemeingültige, umfassende und aussagekräftige Theorie der Internationalisierung. Weiterhin finden sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Fachliteratur keine speziellen Theorien zur Internationalisierung einer untypischen Branche wie der Abfallwirtschaft. Dennoch lassen sich im Rahmen der Entwicklung von Markteintrittsstrategien diverse Teilaspekte aus der Theorie heranziehen.
Aus diesem Grund sind im Folgenden für die Abfallwirtschaft verwendbare Elemente aus den Theorien in einem Modell verbunden. Durch die geeignete Kombination der Erklärungs- und Entscheidungsvariablen unter Berücksichtigung der Branchencharakteristika wird die Ermittlung einer geeigneten Markteintrittsstrategie möglich (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2 : Der Weg zur Markteintrittsstrategie
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Selbsterstellte Grafik in Anlehnung an Perlitz 2004, S.155 ff. Cullen 1999, S. 166 ff.
Der Weg zur Markteintrittsstrategie, auch als Form der Internationalisierung bezeichnet (hier stark abstrahiert dargestellt), setzt sich aus mehreren Blöcken zusammen. Im Folgenden sind die einzelnen Bausteine des Modells näher erläutert.
2.3.1. Interne Unternehmens- und Umweltanalyse
Der erste Block beschreibt die Analysen auf inländischer Ebene. Es handelt sich dabei einerseits um eine interne Unternehmensanalyse und eine nationale Umweltanalyse.
Auf die interne Unternehmensanalyse wird in dieser Arbeit kein Bezug genommen, um die branchenspezifische Objektivität nicht zugunsten einzelunternehmerischer Anwendungen des Modells einzuschränken. Dieses interne Analyseverfahren, oftmals in Form einer SOWT-Analyse, kann von jedem Unternehmen der Branche selbständig durchgeführt und auf das Modell übertragen werden. Wichtig ist dabei auch die Abstimmung der Ziele des Unternehmens auf die Internationalisierung, da nicht-integrierte Zielsetzungen des Unternehmens einen Konflikt mit den Zielen und der Internationalisierung hervorrufen können.
Bei der nationalen Umweltanalyse ist zu beachten, dass im vorliegenden Fall keine vollständige Analyse notwendig ist. Dies resultiert aus den besonderen Voraussetzungen im Verfahren zur Findung einer geeigneten Markteintrittsstrategie. Viele nationale Einflussfaktoren (z.B. nationale rechtliche Bestimmungen) sind in Bezug auf die Internationalisierung nicht notwendig, da das Engagement auf dem Auslandsmarkt weitgehend von den Bestimmungen des Gastlandes abhängt und kaum von denen des Heimatlandes. Daher ist in der nationalen Umweltanalyse der Fokus auf die Ermittlung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit gelegt, wie es im Rahmen von Kapitel 2.2.2 (Porters Diamant) bereits auf Branchenebene durchgeführt wurde.
2.3.2. Länderauswahl Länderanalyse
Das zweite Element umfasst den Prozess der Länderauswahl und -analyse. Die Funktion dieses Schrittes ist es, unter „weitgehender Ausschaltung subjektiver Faktoren und unter Berücksichtigung aller unternehmens- und produktrelevanten Einflussgrößen jene Märkte zu identifizieren, welche ein Optimum aus Marktattraktivität und Marktrisiko bieten“ (Lasserre 2007, S. 161). Diesem Abschnitt kommt eine besondere Bedeutung zu, da mit dem wirtschaftlichen Engagement im Ausland eine längerfristige Bindung an dieses Land angestrebt werden sollte, um die Kosten der Markterschließung durch die Anzahl der Transaktionen vor Ort zu relativieren.
Die Standorttheorie von Peter Tesch (1980, S. 364 ff.) zeigt bereits eine Reihe von Einflussfaktoren bei der Standortwahl auf, welche bei der Länderwahl zu berücksichtigen sind. In diversen empirischen Studien wurden die Bestimmungsfaktoren der Standorttheorie relativiert und marktbezogene Faktoren, sowie Rechtssicherheit und politische Stabilität als Hauptfaktoren identifiziert sind (Welge Holtbrügge 1998, S. 73).
Im Rahmen dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt auf der Option des Markteintritts in Indonesien, sodass der Prozess der Länderauswahl per Annahme als bereits abgeschlossen betrachtet wird. Daher wird an dieser Stelle auf eine ländervergleichende Analyse verzichtet und direkt auf die landesspezifischen Faktoren eingegangen. Die Betrachtung Indonesiens bedeutet dennoch nicht zwingend, dass es sich hierbei um die bestmögliche Alternative für die Internationalisierungsbemühungen deutscher Unternehmen handelt. Vielmehr wird es als Beispiel gewählt, um die Optionen, Potenziale und Hemmnisse für die Internationalisierung in der Abfallbranche herauszustellen.
Die Landesanalyse Indonesiens mit den speziellen Charakteristika der Abfallwirtschaft findet in Kapitel 3 durch die Ermittlung der Rahmen- und Marktbedingungen statt.
2.3.3. Die Markteintritts strategie
Die Markteintrittsstrategie umfasst alle Maßnahmen, die den Markteintritt eines Unternehmens betreffen und spiegelt sich wesentlich in seiner Form wider. Sie setzt sich zusammen aus den strategischen Entscheidungen über die Marktbearbeitungs-, der Eigentums- und der Ansiedlungsform im Gastland (Welge Holtbrügge 1998, S. 105). In roter Farbe gibt Abbildung 3 einen Überblick über die existierenden Markteintrittsstrategien und deren Kategorisierung (unabhängig vom Koordinatensystem). In Blau zeigt sie die zu jeder Strategie theoretisch möglichen Markteintrittsformen. Letztere definieren sich im Wesentlichen über die Dimensionen der Kontroll- und Steuerungsfähigkeit, sowie der Höhe der Ressourcenbindung (und damit implizit das verbundene Risiko) und ordnen sich wie dargestellt in das Koordinatensystem ein. Je nach Strategie kann jede dieser Formen für sich allein oder in Kombination mit anderen realisiert werden, wie bspw. beim Export über eine eigene Verkaufsniederlassung im Ausland.
[...]
[1] z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), welches die EU-Richtlinien in Deutschland umsetzt oder die Technische Anleitung Siedlungsabfälle (TASI), welche u.A. die unterirdische Ablagerung von unbehandeltem Hausmüll seit Juni 2005 verbietet
[2] Dies betrifft die als Abfall [gem. Art. 3 (1) i.V.m. Art. 6 (1) der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.11.2008] definierten Fraktionen. Diese Aussage ist für den Handel mit daraus erzeugten Roh- oder Wertstoffen ist nur bedingt gültig.
[3] Bereits 2005 wurde in Deutschland lt. BMU eine Verwertungsquote von 64% der Siedlungsabfälle erreicht.
[4] insbesondere im Bereich der Abfallsammlung (z.B. Fusion von Rethmann und RWE Umwelt zum Marktführer Remondis, Übernahme von Cleanaway und Veiola durch Sulo oder Zusammenschluss von Interseroh und Alba).
[5] Annahme: Unabhängigkeit der Staatsorgane von Lobbyismusbestrebungen und Vorteilsannahme.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836636353
- DOI
- 10.3239/9783836636353
- Dateigröße
- 673 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Osnabrück – Wirtschaftswissenschaften, Studiengang Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Oktober)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- abfallwirtschaft internationalisierung indonesien asien markteintritt
- Produktsicherheit
- Diplom.de