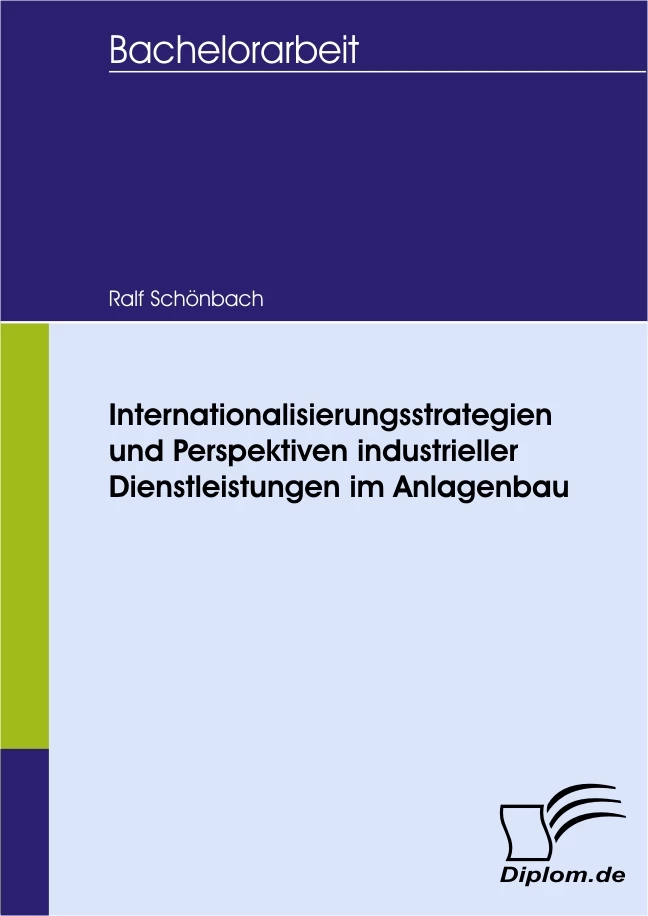Internationalisierungsstrategien und Perspektiven industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau
Zusammenfassung
Ziel der Arbeit:
Die Weltwirtschaft ist heute durch die Globalisierung gekennzeichnet, einem Phänomen, das durch eine zunehmende internationale ökonomische Verflechtung und einer veränderten Arbeitsteilung zwischen einzelnen Volkswirtschaften gekennzeichnet ist. Zudem wird die Globalisierung als eine besonders weitreichende Form der Internationalisierung angesehen. Dieses Phänomen führt zu einer Verstärkung und Ausweitung der globalen Präsenz sowohl von produzierenden Unternehmen als auch in der Dienstleistungsbranche. So sehen Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau die Notwendigkeit ihre Leistungen nicht nur national, sondern auch international anbieten zu müssen. Gründe dafür ergeben sich durch gesättigte Märkte, der Trend zu schlüsselfertigen Anlagen und einem steigenden Wettbewerb durch die zunehmende Internationalisierung und der aktuellen Konjunkturabschwächung. Einerseits bieten sich für Dienstleistungsunternehmen durch das Auslandsengagement neue Wachstumschancen an, andererseits stehen diesen mit dem Eintritt in einen neuen Markt neue politische, rechtliche sowie wirtschaftliche und kulturelle Risiken gegenüber.
Für Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau, die sich auf ausländischen Märkten etablieren wollen, stellen sich deshalb folgende Fragen, die diese Arbeit beantworten soll:
Welche Schritte und Strategien sind für eine Internationalisierung bedeutend?
Welche Erfolgsfaktoren lassen einen Markteintritt im Ausland effektiv erscheinen und welche Markteintrittsform sollte gewählt werden?
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen möglichen Internationalisierungsprozess für Dienstleistungsunternehmen darzustellen. Da sich die Literatur zum Anlagenbau in dieser Form noch nicht damit beschäftigt hat, soll dieser Prozess anhand eines Dienstleistungsunternehmens im Anlagenbau aufgezeigt werden.
Internationalisierungstheorien und strategien in Bezug auf Dienstleistungen werden literarisch ebenfalls nur in geringem Umfang abgehandelt. Daher legt der empirische Teil dieser Arbeit dar, inwiefern sich ausgewählte Theorien und Strategien auf ein Dienstleistungsunternehmen, speziell bei einem ausgewählten Anlagenbauer, anwenden lassen.
Vorgehensweise:
In der vorliegenden Arbeit beschäftigen sich die Kapitel I bis IV mit dem theoretischen und Kapitel V mit dem empirischen Teil.
Im theoretischen Teil werden im Anschluss an die Einleitung die Definitionen erläutert, die dieser Arbeit zugrunde liegen. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
A Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
1. Ziel der Arbeit
2. Vorgehensweise
II. Definition der Begriffe
1. Internationalisierung und Internationalisierungsstrategie
2. Anlagenbau
3. Dienstleistungen
3.1 Allgemeine Definition
3.2 Die Definition der industriellen Dienstleistung
3.3 Der Begriff der industriellen Dienstleistung im Anlagenbau
III. Die Internationalisierung der Dienstleistungsbranche
1. Aktuelle Lage des Dienstleistungsexports in Deutschland
2. Ziele und Motive der Internationalisierung
3. Perspektiven für die Internationalisierung industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau
IV. Theoretische Grundlagen zur Internationalisierung
1. Internationalisierungstheorien
1.1 Der Diamant-Ansatz von Porter
1.2 Eklektische Theorie von Dunning
1.3 Uppsala-Modell der Internationalisierung
2. Internationalisierungsstrategien
2.1 Internationalisierungsvoraussetzungen
2.2 Zielmarktstrategie
2.2.1 Ländermarktattraktivität
2.2.2 Ländermarktrisiken
2.2.3 Markteintrittsbarrieren
2.3 Mögliche internationale Markteintrittsstrategien
2.3.1 Export
2.3.2 Managementvertrag
2.3.3 Internationale Joint Venture
2.3.4 Konsortien
2.3.5 Generalunternehmerschaft
2.3.6 Ausländische Betriebsstätte versus Auslandsniederlassung
2.3.7 Die 100%ige Tochtergesellschaft
2.4 Standardisierung und Individualisierung von Dienstleistungen
3. Mögliche internationale Wettbewerbs- und Wachstumsstrategien
3.1 Generische Wettbewerbsstrategie nach Porter
3.1.1 Qualitätsführerschaft
3.1.2 Kostenführerschaft
3.1.3 Konzentration auf Schwerpunkte
3.2 Internationale Wachstumsstrategie
3.2.1 Generische internationale Wachstumsstrategie
3.2.2 Segmentstrategie des internationalen Wachstums
3.3 Instrumentalstrategie
V. Fallbeispiel: Montagewerk GmbH Leipzig
1. Ziel und Methodik der Untersuchung
2. Tätigkeitsbereich der Montagewerk GmbH Leipzig
3. Der Internationalisierungsprozess
3.1 Ausgangssituation
3.2 Motive, Ziele und Voraussetzungen für die Internationalisierung
3.3 Die Zielmarktstrategie
3.4 Die Markteintrittsstrategie
3.5 Wettbewerbs- und Instrumentalstrategie
3.6 Aktuelle Veränderungen und damit verbundene Strategieänderung
4. Zusammenfassung der Ergebnisse
5. Vergleich der empirischen Befunde mit den theoretischen Grundlagen
5.1 Die Anwendbarkeit der eklektischen Theorie auf Dienstleistungen eines Anlagenbauers
5.2 Der Vergleich mit den Internationalisierungsstrategien
6. Fazit
7. Handlungsempfehlungen und Perspektiven für Anlagenbauer
Anhang
Fragebogen zum Interview
Literaturverzeichnis
B Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
C Abbildungsverzeichnis
Abb.1: Einordnung industrieller Dienstleistungen
Abb.2: Phasenschema – Dienstleistungen im Anlagengeschäft
Abb.3: Auftragseingang im Großanlagenbau von 1999-2008
Abb.4: Systematisierung der Theorien internationaler Unternehmungen
Abb.5: Der Diamant von Porter
Abb.6: Entscheidungsbaum der Auslandmarktbearbeitung nach der eklektischen Theorie von Dunning
Abb.7: Strategische Entscheidungsfelder der Internationalisierungsstrategien
Abb.8: Internationalisierungsformen in Abhängigkeit von Kapital- und Managementleistungen im Stamm- und Gastland
Abb.9: Pfadmodell der Markteintrittsstrategien
Abb.10: Wettbewerbsstrategien nach Porter
Abb.11: Generische internationale Wachstumsstrategie
Abb.12: Segmentstrategie des internationalen Wachstums
Abb.13: Markteintrittsstrategie der Montagewerk GmbH Leipzig am Beispiel Belgien
Abb.14: Pfadmodell am Beispiel des Markteintritts der Montagewerk GmbH Leipzig in Belgien
I. Einleitung
1. Ziel der Arbeit
Die Weltwirtschaft ist heute durch die Globalisierung gekennzeichnet, einem Phänomen, das durch eine zunehmende internationale ökonomische Verflechtung und einer veränderten Arbeitsteilung zwischen einzelnen Volkswirtschaften gekennzeichnet ist.[1] Zudem wird die Globalisierung als eine besonders weitreichende Form der Internationalisierung angesehen.[2] Dieses Phänomen führt zu einer Verstärkung und Ausweitung der globalen Präsenz sowohl von produzierenden Unternehmen als auch in der Dienstleistungsbranche.[3] So sehen Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau die Notwendigkeit ihre Leistungen nicht nur national, sondern auch international anbieten zu müssen. Gründe dafür ergeben sich durch gesättigte Märkte, der Trend zu schlüsselfertigen Anlagen und einem steigenden Wettbewerb durch die zunehmende Internationalisierung und der aktuellen Konjunkturabschwächung.[4] Einerseits bieten sich für Dienstleistungsunternehmen durch das Auslandsengagement neue Wachstumschancen an, andererseits stehen diesen mit dem Eintritt in einen neuen Markt neue politische, rechtliche sowie wirtschaftliche und kulturelle Risiken gegenüber.
Für Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau, die sich auf ausländischen Märkten etablieren wollen, stellen sich deshalb folgende Fragen, die diese Arbeit beantworten soll:
Welche Schritte und Strategien sind für eine Internationalisierung bedeutend?
Welche Erfolgsfaktoren lassen einen Markteintritt im Ausland effektiv erscheinen und welche Markteintrittsform sollte gewählt werden?
Die vorliegende Arbeit zielt darauf ab, einen möglichen Internationalisierungsprozess für Dienstleistungsunternehmen darzustellen. Da sich die Literatur zum Anlagenbau in dieser Form noch nicht damit beschäftigt hat, soll dieser Prozess anhand eines Dienstleistungsunternehmens im Anlagenbau aufgezeigt werden.
Internationalisierungstheorien und –strategien in Bezug auf Dienstleistungen werden literarisch ebenfalls nur in geringem Umfang abgehandelt. Daher legt der empirische Teil dieser Arbeit dar, inwiefern sich ausgewählte Theorien und Strategien auf ein Dienstleistungsunternehmen, speziell bei einem ausgewählten Anlagenbauer, anwenden lassen.
2. Vorgehensweise
In der vorliegenden Arbeit beschäftigen sich die Kapitel I bis IV mit dem theoretischen und Kapitel V mit dem empirischen Teil.
Im theoretischen Teil werden im Anschluss an die Einleitung die Definitionen erläutert, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Hierbei wird zunächst der allgemeine Begriff der Dienstleistung geklärt. Anschließend erfolgt eine Abgrenzung zu industriellen Dienstleistungen im Allgemeinen. Daraufhin erfolgt nochmals eine Abgrenzung zu industriellen Dienstleistungen, die sich auf den Anlagenbau beziehen.
Über die aktuelle Lage des Dienstleistungsexports berichtet das dritte Kapitel. Es wird untersucht, welche Motive und Ziele zu einer Internationalisierung beitragen und welche Perspektiven für eine Internationalisierung industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau bestehen.
Das vierte Kapitel stellt ausgewählte Theorien und Strategien der Internationalisierung vor. Dabei werden diejenigen Theorien und Strategien ausgewählt, die sich auf Dienstleistungsunternehmen anwenden lassen und für das im empirischen und letzten Teil der Arbeit vorgestellte Unternehmen relevant sind.
In Bezug auf die Internationalisierungstheorien weist der Autor darauf hin, dass bisher noch keine allgemeine Theorie der Internationalisierung in Bezug auf Dienstleistungen entwickelt wurde. Bezüglich der Internationalisierungstheorie wird der Fokus auf die eklektische Theorie gelegt und mit dem empirischen Ergebnis im letzten Teil der Arbeit verglichen.
Weiterhin soll gezeigt werden, welche Voraussetzungen ein Unternehmen für ein Auslandsengagement besitzen sollte und welche Handlungsmöglichkeiten den Unternehmen für einen Markteintritt und der Marktbearbeitung im Ausland zur Verfügung stehen.
Im Anschluss werden internationale Wettbewerbs-, Wachstums- und Instrumentalstrategien vorgestellt, die die Wettbewerbsposition international tätiger Dienstleistungsunternehmen verbessern.
Das letzte Kapitel der Arbeit stellt den Internationalisierungsprozess eines Dienstleistungsunternehmens im Anlagenbau vor. Dieses Beispiel veranschaulicht, welche Gründe zur Internationalisierung beitrugen und wie sich ein Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau international etablieren konnte. Daraufhin erfolgt die Untersuchung auf die Anwendbarkeit der eklektischen Theorie auf das Dienstleistungsunternehmen.
Im Anschluss werden die im theoretischen Teil der Arbeit vorgestellten Internationalisierungsstrategien mit dem empirischen Ergebnis verglichen und abschließend Handlungsempfehlungen für Dienstleistungsunternehmen im Anlagenbau vorgeschlagen.
Da die Literatur zum Thema Internationalisierung und Dienstleistungen sehr umfangreich ist, kann nicht auf alle Aspekte eingegangen werden.
Deshalb werden diejenigen Internationalisierungstheorien und –strategien ausgewählt, die geeignet erscheinen, den Internationalisierungsprozess industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau zu beschreiben und auch empirisch belegt werden können.
Die Literaturauswahl beschränkt sich auf aktuelle Monographien sowie auf relevante wissenschaftliche Internetseiten, um einen aktuellen Stand der Forschung zu gewährleisten.
I. Definition der Begriffe
1. Internationalisierung und Internationalisierungsstrategie
Für den Begriff der Internationalisierung existiert in der Literatur keine einheitliche Definition. Der Begriff beschreibt eine Vielzahl von Aktivitäten und Prozessen, die sich nachhaltig auf das Unternehmen durch seine Auslandstätigkeiten auswirken und zur Unternehmenssicherung und zum –wachstum beitragen.[5]
Beispielsweise erfolgt eine Trennung hinsichtlich der Beschreibung, Erklärung und Gestaltung bestimmter Funktionsbereiche (Absatz und Marketing) sowie der funktionsbereichsübergreifenden Ausweitung der Aktivitäten von Unternehmen in andere Länder.
Die Praxis zeigt allerdings, dass eine Verengung des Begriffs auf Marketing und Absatz zu kurz gegriffen wäre[6], da der Internationalisierungsprozess von Unternehmen einen gesamtunternehmensbezogenen Charakter besitzt.[7] Dazu erwähnt Bamberger, dass die Internationalisierung ein Prozess des vielfältigen organisatorischen und strategischen Wandels ist und betrachtet es als Komponente der Unternehmenspolitik.[8]
Im Allgemeinen wird die Internationalisierung als eine Strategie betrachtet den Umsatz des Unternehmens, wie z. B. durch die traditionelle Form des Exports, zu steigern.[9]
Die Internationalisierung ist aber auch durch weitere Arten von Auslandsaktivitäten gekennzeichnet, wie die Verlagerung von Wertschöpfungsketten ins Ausland, die Erteilung von Lizenzen, das Eingehen von Managementverträgen sowie die Gründung internationaler
Joint Venture[10], um u. a. Wissen und Technologie auszutauschen sowie die internationale
Position zu festigen.
Das Ausmaß der Internationalisierung zeigt sich dabei in der Zielsetzung, Strategie und den Denk- und Handlungsweisen des Managements.[11]
Bevor auf den Begriff der Internationalisierungsstrategie eingegangen wird, wird kurz der Begriff der Strategie vorgestellt.
Für den Begriff der Strategie existiert in der Literatur eine Vielzahl von Definitionen. Kutschker/Schmid bezeichnen Strategien sowohl als geplante Maßnahmebündel zur Erreichung ihrer langfristigen Ziele als auch als ungeplante, sich ergebende Entscheidungs- und Handlungsmuster eines Unternehmens. Mit diesen Strategien versucht das Unternehmen Erfolgspotentiale zu erschließen und Wettbewerbsvorteile zu erlangen, wobei die Umwelt und auch die eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen berücksichtigt werden.[12] Dabei verfolgen Unternehmen eine Kombination aus mehreren, interdependenten Strategien, die sich gegenseitig beeinflussen und somit permanent rejustiert werden müssen.
Zur Definition der Internationalisierungsstrategie herrscht in der Literatur Uneinigkeit. So findet zum Einen eine Eingrenzung auf die Art der Ländermarkterschließung statt. Zum Anderen werden auch die Organisationsformen (ethnozentrisch, polyzentrisch, geozentrisch) von Perlmutter als Internationalisierungsstrategie bezeichnet.[13]
Nach Perlitz ist die Internationalisierungsstrategie die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Internationalisierung. Sie ist „die Entwicklung einer grundsätzlichen, länderübergreifenden Entwicklungskonzeption, die auf Wettbewerbsvorteilen aufbaut, die für die Auslandsaktivitäten des Unternehmens notwendig oder nützlich sind.“[14]
Die Internationalisierungsstrategien müssen so formuliert werden, dass sie u.a. die Frage beantworten, welche Markteintrittsstrategie und welcher Zielmarkt gewählt werden soll.[15]
Wichtig ist vor allem, dass die Internationalisierungsstrategie in die gesamte Unternehmensstrategie integriert wird. Das heißt, dass sie z.B. mit Wachstums-, Wettbewerbs-, Innovations- und Marketingstrategien abgestimmt werden müssen. Schließlich schaffen Internationalisierungsstrategien keine Wettbewerbsvorteile, wenn sie nicht auf anderen Strategien aufbauen.[16]
2. Anlagenbau
Unter dem Anlagenbau versteht man „…die gesamtverantwortliche Kombination und Integration verschiedener Lieferungen und Leistungen zu einem funktionsfähigen System (Industrieanlage) zur Bewirkung eines Prozessablaufs, der verschiedene, miteinander verbundene, Prozessschritte umfasst.“
Durch den Aufbau von Anlagen zur Herstellung von Nahrungsmitteln, Textilien und Baustoffen sowie zur Wasser- und Abwasserbehandlung und Energieerzeugung tragen Anlagen zum Aufbau und Aufrechterhaltung der menschlichen Grundversorgung bei.[17]
Während beim Produktgeschäft Leistungen auf einem anonymen Markt vermarktet werden und einen geringen Spezifitätsgrad ausmachen[18], ist der Anlagenbau durch die Vermarktung komplexer Projekte und einem abgeschlossenen Kaufprozess gekennzeichnet.[19]
Gemeint ist damit die Lieferung und Errichtung einer schlüsselfertigen Betriebsanlage durch ein Unternehmen.[20] Diese Anlagen werden kundenindividuell von einem Anlagenbauunternehmen in Einzel- oder Kleinserienfertigung erstellt und überwiegend beim Kunden zu funktionsfähigen Einheiten montiert. Hierbei liegt der Vermarktungsprozess zeitlich vor dem Fertigungsprozess.[21] Aus diesem Grund stützten sich die Kunden auf die bisher gemachten Erfahrungen der Anbieter und deren Erfahrungsberichte.
Ein weiteres Kennzeichen für den Anlagenbau stellt die Nachbetreuung des Anlagenbauers durch die Individualität und hohe Komplexität der Anlagen dar.[22]
Die Dienstleistung der Anlagenbauer umfasst u.a.:
- Risiko- und Umweltverträglichkeitsstudien
- Finanzierungskonzepte
- Verfahrenstechnische und konstruktive Auslegung von Industrieanlagen
- Projektmanagement
- Vertrags- und Versandmanagement
- Montage, Inbetriebsetzung, Instandhaltung
- Produktvermarktung[23]
Der Begriff Anlagenbau, welcher für eine Vielzahl von Industrieanlagen gilt, grenzt der Autor auf Großanalagen ein. Die Eingrenzung ist notwendig, da sich der empirische Teil dieser Arbeit auf ein Unternehmen konzentriert, das Großanlagen errichtet.
Großanalagen werden u.a. in Walzwerken, Energieerzeugungsanlagen, Flugsicherungsanlagen, Meerwasserentsalzungsanlagen[24], Chemieanlagen und Anlagen für Raffinerien errichtet.[25]
3. Dienstleistungen
3.1 Allgemeine Definition
Bis heute gibt es noch keine Einigkeit zur Definition des Begriffs „Dienstleistung“.[26]
Die Gründe liegen in der Heterogenität der am Markt angebotenen Varianten, die zu einer Vielzahl unterschiedlicher Definitionen führen.[27]
Im Allgemeinen wird die Dienstleistung von Sachleistungen dadurch abgegrenzt, dass keine Rohstoffe eingesetzt werden. Des Weiteren sind Dienstleistungen immateriell und vergänglich.[28]
In der Literatur wird der Dienstleistungsbegriff überwiegend in drei Gruppen unterteilt:
- Enumerativdefinitionen
- Negativdefinitionen
- Konstitutivdefinitionen
Die Enumerativdefinition erfasst den Dienstleistungsbegriff über eine Aufzählung von Beispielen. Hierbei werden einzelne Dienstleistungen deskriptiv erfasst, in einer möglichst sinnvollen Kategorisierung zusammengefasst und aufgelistet.[29]
Die Eingrenzung liegt dabei im Ermessensspielraum des jeweiligen Betrachters. Diese Definition genügt allerdings nicht den Anforderungen einer wissenschaftlichen Definition und ermöglicht keine fundierten Aussagen.[30]
Dagegen grenzen Negativdefinitionen Dienstleistungen von Sachgütern durch eine Gegenüberstellung ab. Dabei werden alle Leistungen, die keine Sachleistungen sind, als Dienstleistungen bezeichnet. Dennoch ist diese Definition umstritten, da sie Abgrenzungsprobleme aufweist.
Bei der Definition über konstitutive Merkmale unterscheidet man potential-, prozess- und ergebnisorientierte Definitionsansätze.[31] Diese Methode wird als die Sinnvollste bezeichnet. Mit diesen Definitionsansätzen lassen sich Dienstleistungen anhand spezifischer Eigenschaften erklären[32] und werden im weiteren Verlauf für die Definition industrieller Dienstleistungen herangezogen und beschrieben.
3.2 Die Definition der Industriellen Dienstleistung
Genauso vielgestaltig wie die allgemeine Definition des Dienstleistungsbegriffs, sind auch die Ansätze zur Definition der industriellen Dienstleistung.[33] Deshalb wird an dieser Stelle zunächst eine begriffliche Abgrenzung von Dienstleistungen vorgenommen, die zum Verständnis und der weiteren Eingrenzung auf Industriedienstleistungen im Anlagenbau notwendig ist.
Anschließend kann dann auf die zuvor erwähnten konstitutiven Merkmale genauer eingegangen werden.
In Anlehnung an Sanche lassen sich, wie in Abbildung 1 dargestellt, industrierelevante Dienstleistungen in konsumtive und investive Dienstleistungen unterteilen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1: Einordnung industrieller Dienstleistungen
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Speth 2001, S.19.
Hierbei werden konsumtive Dienstleistungen von Endkonsumenten und investive Dienstleistungen von Unternehmen nachgefragt.[34] Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff der industriellen Dienstleistungen auf den Bereich Business-to-Business eingegrenzt und den investiven Dienstleistungen zugeordnet.
Die investive Dienstleistung wird weiter unterteilt in industrielle und rein investive Dienstleistungen.
Nach Garbe stellt eine industrielle Dienstleistung z. B. die Wartung einer Maschine durch den Hersteller dar. Dagegen würde sie als rein investive Dienstleistung angesehen werden, wenn sie von einem Dienstleistungsunternehmen durchgeführt werden würde. Weiterhin wird eine grundsätzliche Trennung von Sachgütern und Dienstleistungen abgelehnt, da zwischen beiden Leistungskomponenten eine zu enge Verbindung besteht.
Dies ist dann der Fall, wenn das Produkt nur noch den Kern innerhalb einer aus vielen Einzelteilen bestehenden Systemleistung bildet. Ein Beispiel dafür ist der System- und Anlagenbau, der durch umfangreiche Dienstleistungskomponenten gekennzeichnet ist.
Hier bestehen die Dienstleistungen z. B. aus der Planung, Projektierung und Montage, die zur Erstellung einer schlüsselfertigen Anlage führen. Aus diesem Grund erreicht die rein investive Dienstleistung einen größeren Wert als die Sachleistungskomponente.[35]
Zudem werden zur Betrachtung industrieller Dienstleistungen drei Dimensionen unterschieden. Es handelt sich dabei um die zuvor erwähnten konstitutiven Merkmale, die sich in der potentialorientierten, prozessorientierten und ergebnisorientierten Dimension unterscheiden lassen.
Die potentialorientierte Definition interpretiert die industrielle Dienstleistung als menschliche oder maschinelle Leistungsfähigkeit, mit der am Nachfrager oder an dessen Verfügungsobjekt eine gewollte Änderung bewirkt, oder ein Zustand erhalten werden soll.[36]
Hierbei wird die Dienstleistung als Leistungsversprechen des Anbieters verstanden[37] und kann sowohl immateriellen (menschliche Leistungsfähigkeit) als auch materiellen Charakter (z.B. Maschinen und Werkzeuge für Montage- oder Instandhaltungsarbeiten) besitzen.[38]
Die prozessorientierte Definition beschreibt den Ablauf der Dienstleistungserbringung.[39]
Das Besondere ist die Integration eines externen Faktors, der aus Menschen, Tieren, materiellen oder nichtmateriellen Objekten bestehen kann. Weiterhin kann dieser Dienstleistungsprozess nicht ohne den Kunden stattfinden.
Dabei werden die Kundenwünsche vor der Leistungserstellung spezifiziert und arbeiten teilweise an der Problemlösung während der Leistungserstellung mit (z.B. im Anlagenbau oder der Softwareentwicklung).[40]
Die ergebnisorientierte Dimension betrachtet die Dienstleistung als Ergebnis von materiellen und immateriellen Tätigkeiten oder Leistungsprozessen.[41]
Zwar wird der Nutzen für den Kunden häufig durch eine bestimmte Dimension generiert, allerdings ergibt sich dieser aufgrund der engen Verzahnung der drei Dimensionen immer aus der Gesamtleistung an sich und kann nicht allein anhand einer Dimension festgemacht werden.
Demzufolge kann die industrielle Dienstleistung als Kombination dieser Dimensionen definiert werden, die als selbständige, marktfähige Leistungen mit der Bereitstellung oder dem Einsatz von Leistungsfähigkeiten verbunden sind (Potenzialorientierung).
Im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses werden die internen und externen Faktoren kombiniert (Prozessorientierung). Des Weiteren wird die Faktorkombination des Dienstleistungsanbieters mit dem Ziel eingesetzt, an den externen Faktoren nutzenstiftende Wirkungen zu erzielen (Ergebnisorientierung).[42]
3.3 Der Begriff der industriellen Dienstleistung im Anlagenbau
Der Autor weist, in Anlehnung an Weiber, darauf hin, dass eine Definition industrieller Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Anlagenbau in der Literatur kaum auffindbar ist. Durch die vielfältigen Begriffe und Formen von Dienstleistungen, wird der Begriff der Dienstleistungen im Anlagenbau im Folgenden für den Fortgang und zum Verständnis der Arbeit festgelegt.
Wie bereits weiter oben geklärt, wird bei industriellen Dienstleistungen eine grundsätzliche Trennung von Sachgütern und Dienstleistungen abgelehnt und kann auch auf den Anlagenbau bezogen werden, weil zwischen dem Produkt Anlage und den Dienstleistungen eine enge Verbindung besteht. Schließlich stellt die Anlage nur noch den Kern dar, der aus vielen einzelnen Dienstleistungen erstellt wurde.
Ebenso lassen sich die industriellen Dienstleistungen im Anlagenbau auf die konstitutiven Merkmale übertragen. Ein weiteres Merkmal fügt Weiber hinzu. Er bezeichnet industrielle Dienstleistungen im Anlagengeschäft als Sekundärleistungen, deren Ziel in der Gebrauchs- und Absatzförderung der Primärleistung, also der Anlage, besteht.[43]
Als mögliche Sekundärleistungen können hier die Instandhaltung, die Ersatzteilversorgung und die Anpassung des Sachgutes an technische Weiterentwicklungen genannt werden.
Ein weiteres Merkmal der Dienstleistungen im Anlagenbau wird in Abbildung 2 dargestellt. Die industrielle Dienstleistung wird kundengerecht gestaltet und in Vorprojekt-, Projekt- und Nachprojektphase unterteilt.[44]
Um den Begriff der industriellen Dienstleistung im Anlagenbau weiterhin in Bezug auf diese Arbeit zu verwenden, gilt als Grundlage folgende Definition, bei der sich der Autor auf die Aussage von Weiber stützt:
Die industriellen Dienstleistungen im Anlagenbau umfassen alle Leistungen mit immateriellen Charakter, die zur Vorbereitung und Förderung des Baus einer industriellen Großanlage dienen, nach Erstellung ihre Funktionsfähigkeit sichern oder spezielle Nachfragewünsche, die im Zusammenhang mit dem Kauf einer Anlage entstehen, befriedigen können und damit in besonderer Weise den Absatz einer Großanlage fördern.[45] Zu diesen Leistungen zählen u.a.: die Montage, die Planung und technische Beratung[46], Konstruieren und Projektieren, Warten und Schulen.[47]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Phasenschema – Dienstleistungen im Anlagengeschäft
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Grill-Kiefer 2000, S.57.
III. Die Internationalisierung der Dienstleistungsbranche
Im Folgenden wird zunächst allgemein auf die Entwicklung und die aktuelle Situation des Dienstleistungsexports eingegangen. Anschließend werden kurz die Ziele und Motive einer Internationalisierung genannt und die Perspektiven des Anlagenbaus erläutert.
An dieser Stelle hebt der Autor hervor, dass hierbei die Situation der Großanlagenbetreiber betrachtet wird. Der Grund dafür liegt darin, dass der Begriff des Anlagenbaus für eine Vielzahl diverser Industrieanlagen gilt. Die Eingrenzung ist wichtig, weil der empirische Teil dieser Arbeit ein Unternehmen vorstellt, das Großanlagen errichtet. Zu diesen Anlagenarten gehören u. a.: Kraftwerke, Hütten- und Walzwerke, Chemieanlagen, elektrotechnische Ausrüstungen und Anlagen für die Baustoffindustrie.
1. Aktuelle Lage des Dienstleistungsexports in Deutschland
Die Produktion von Dienstleistungen überwiegt in Deutschland und anderen Industrienationen schon seit langem. Ihr Anteil an der gesamten inländischen Produktion blieb im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 in Deutschland stabil.[48]
Nach den Angaben der Welthandelsorganisation stieg Deutschland zum weltweit drittgrößten Exporteur von Dienstleistungen auf und in Branchen der Bau- und Postdienstleister gilt Deutschland sogar als Exportweltmeister.[49]
Die Mehrzahl der Unternehmen sind in Deutschland im Dienstleistungssektor tätig, erwirtschaften mit 64% den größten Anteil der Bruttowertschöpfung[50] und erreichten im Jahr 2005 einen Exportwert von über 140 Mrd. US-Dollar.
Dennoch schöpft Deutschland seine Wachstums- und Beschäftigungspotentiale beim Export von Dienstleistungen nicht aus.[51]
Dies zeigt sich daran, dass der Anteil der Dienstleistungsexporte am Gesamtexport erst bei 15 % liegt.[52] Die Gründe dafür reichen von Sprach- und Kulturbarrieren bis hin zu rechtlichen Hindernissen und Problemen bei der Finanzierung.[53]
Abhilfe schafft dabei die EU – Dienstleistungsrichtlinie, deren Ziel die Beseitigung rechtlicher und administrativer Hindernisse ist[54], um einen echten Binnenmarkt für Dienstleistungen zu schaffen.[55] Im Jahr 2007 erreichte der Anteil des Dienstleistungssektors an der Gesamterwerbstätigkeit bereits über 72 % und bei dem Anteil der Dienstleistungen an der Bruttowertschöpfung fast 70 %.[56]
Dagegen ist das Jahr 2009 von einer negativen Entwicklung gekennzeichnet.
Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) meldet zwar noch mehrheitlich eine positive Geschäftslage, doch die sinkende Industrienachfrage führt durch die Wirtschaftskrise auch zu sinkenden Investitionen in der Dienstleistungswirtschaft.
Die wirtschaftlich schlechte Situation und die Aussicht, dass die Konjunktur im Jahr 2009 weiter abkühlen wird, verunsichert einerseits die Dienstleistungsunternehmen und hat einen Abbau der Arbeitsplätze zur Folge. Andererseits ergeben sich durch sinkende Zinsen und Energiepreise sowie durch die Konjunkturpakete Chancen für eine positive Entwicklung der Dienstleistungsbranche.[57]
2. Ziele und Motive der Internationalisierung
Die Bereitschaft zur Internationalisierung eines Unternehmens hängt von diversen internen und externen Einflussfaktoren ab, die sowohl die Beweggründe für eine global orientierte Unternehmenstätigkeit beeinflussen, als auch zur Strategieauswahl beitragen können.[58]
Eine wichtige Voraussetzung für die Internationalisierung von Dienstleistungen ist der Abbau von Barrieren des internationalen Dienstleistungshandels.[59]
Dieser Abbau erfolgte durch die Liberalisierung des Dienstleistungshandels, z. B. durch das General Agreement on Tariffs in Services (GATS)[60], Deregulierungen und die Schaffung einer Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union.[61]
Die Ziele und Motive für eine Internationalisierung unterscheiden sich zwischen den Unternehmen. Die Motive lassen sich z.B. in Push- und Pull-Faktoren unterteilen.
Im Fall von Push-Faktoren ist der Heimatmarkt entweder für ein Nischenprodukt zu beschränkt oder der Wettbewerb ist auf dem Heimatmarkt zu intensiv. Von Pull-Faktoren wird u.a. gesprochen wenn wichtige Kunden ein Dienstleistungsunternehmen auffordern, ihnen auf einen ausländischen Markt zu folgen.[62]
In vielen Fällen folgen Dienstleistungsanbieter den Kunden, da meistens eine einheitliche internationale Lösung gefordert wird und die Gefahr besteht, den Kunden auch im Heimatmarkt zu verlieren, wenn sie ihm nicht folgen.[63] Zu weiteren Motiven können u.a. gezählt werden: die Ausnutzung von Größenvorteilen (economies of scale), Risikodiversifikation, Zugang zu internationalem Wissen, die Internationalisierung der Wettbewerber und die Sicherung der Arbeitsplätze.
Die Ziele liegen u.a. in der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, im Zugang zu größeren Märkten durch den verstärkten Wettbewerb im Heimatmarkt und in der Minimierung der Arbeitskosten.[64] Neben den ökonomischen Zielen wie Gewinnerzielung, Umsatz- und Marktanteilsziele kann auch ein nicht-ökonomisches Ziel, wie die Steigerung des Images, verfolgt werden.[65]
3. Perspektiven für die Internationalisierung industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau
Um auf die Perspektiven der Internationalisierung von Anlagenbauern eingehen zu können, ist es wichtig die Perspektiven derjenigen Sektoren zu betrachten, in denen Anlagen gebaut werden, da Anlagenbauer stark von den Investitionen der Anlagenbetreiber abhängig sind. Nach Angaben des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) erzielte der deutsche Großanlagenbau zum vierten Mal in Folge 2008 einen Auftragsrekord.
Selbst im Ausland war die Branche trotz Finanzkrise und konjunkturellen Abschwung mit einer Exportquote von 80% erfolgreich. Insgesamt erreichte der Auftragseingang im deutschen Anlagenbau 2008 einen Rekordstand von 32,8 Mrd. Euro (siehe Abb. 3).
Durch die erwähnten hohen Auftragseingänge stieg der Umsatz von 20,6 Mrd. Euro im Jahr 2007 auf 21,9 Mrd. Euro im Jahr 2008, wobei der Auslandsumsatz von 17,1 Mrd. Euro auf 18,1 Mrd. Euro stieg. Dagegen betrug der Inlandsumsatz im Jahr 2008 3,8 Mrd. Euro.
Jedoch ging die Auftragsnachfrage im zweiten Halbjahr 2008 um 11% zurück.
Der Grund dafür liegt im Absatzrückgang, wodurch Investitionen reduziert werden.
Des Weiteren erschwert die weltweite Bankenkrise die Realisation von Projekten bei Kunden, die auf Finanzierungen angewiesen sind. Zudem spekulieren finanzstarke Abnehmer auf sinkende Anlagenpreise und halten sich deshalb mit den Investitionen zurück.
Dennoch sind die Auftragsbücher deutscher Anlagenbauer gut gefüllt, denn die durchschnittliche Laufzeit der Projekte beträgt etwa zwei bis drei Jahre.
Dadurch sind die Abwicklungen im Jahr 2009 gesichert. Des Weiteren werden auch laufende Projekte zeitlich verlängert, oder der Bau neuer Anlagen verschoben, die in Zukunft abgewickelt werden können, wenn sich die konjunkturelle Lage verbessert.
Die Verschiebung neuer Bauvorhaben wirkt sich dennoch positiv auf industrielle Dienstleistungen im Anlagenbau aus, da die Anlagenbetreiber ihre Produktionsanlagen instand halten oder modernisieren müssen.
Weiterhin folgt der Trend zu großen Projekten und Partnerschaften, um Größenvorteile zur Kostenreduzierung auszunutzen und um Risiken zu streuen. Um langfristig global wettbewerbsfähig zu bleiben, werden Großanlagen in Low-Cost-Standorten, wie in China, Indien und Osteuropa weiter ausgebaut.
Langfristige Aufträge, die Instandhaltung und Modernisierung sowie der Bau von Anlagen im Ausland zur Kostensenkung, wirken sich positiv auf die Internationalisierung industrieller Dienstleistungen im Anlagenbau aus.[66]
[...]
[1] Vgl. Graf 2005, S. 1.
[2] Vgl. Kutschker/Schmid 2006, S. 166.
[3] Vgl. Gardini 2004, S. 1.
[4] Vgl. o.V. VDMA 2009, S. 32 f.
[5] Vgl. Krystek/Eberhard 1997, S. 5.
[6] Vgl. Simon 2007, S. 14.
[7] Vgl. Górna 2006, S. 13.
[8] Vgl. Bamberger/Pleitner, 1988, S. 276.
[9] Vgl. o.V. Beobachtungsnetz der europäischen KMU, http://ec.europa.eu/enterprise/
enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2003_report4_de.pdf, S. 7, (22.03.2009).
[10] Vgl. Bamberger/Pleitner 1988, S. 275.
[11] Vgl. o.V. Beobachtungsnetz der europäischen KMU, http://ec.europa.eu/enterprise/
enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2003_report4_de.pdf, S. 7, (22.03.2009).
[12] Vgl. Kutschker/Schmid 2008, S. 824.
[13] Vgl. Gardini/Dahlhoff 2004, S. 93.
[14] Vgl. Perlitz 2004, S. 64.
[15] Vgl. Schmid 2006, S. 12.
[16] Vgl. Schmid 2006, S. 12 f.
[17] Vgl. o.V. VDMA 2009, http://www.erlebnis-maschinenbau.de/wps/portal/!ut/p/kcxml/
04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3NwbJgFhuPvqRyCIG8cam6CKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NDQiHJHRQAc5XBC/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0FfU0U!?initsearch=agab, o.S., (11.05.2009).
[18] Vgl. Backhaus 1999, S. 305 f.
[19] Vgl. Casagranda1994, S. 44.
[20] Vgl. Dülfer 2001, S. 183.
[21] Vgl. Backhaus 1995, S. 431.
[22] Vgl. Casagranda 1994, S.44 f.
[23] Vgl. Krystek/Eberhard 1997, S. 261.
[24] Vgl. Backhaus 1995, S. 431.
[25] Vgl. o.V. VDMA 2009, http://www.erlebnis-maschinenbau.de/wps/portal/!ut/p/kcxml/
04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLd4x3NwbJgFhuPvqRyCIG8cam6CKOcIEgfW99X4_83FT9AP2C3NDQiHJHRQAc5XBC/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82X0FfU0U!?initsearch=agab, S.14, (11.05.2009).
[26] Vgl. Günther 2001, S. 11.
[27] Vgl. Pepels 2003, S. 3.
[28] Vgl. Bieger 2007, S. 8.
[29] Vgl. Burger 2007, S. 14.
[30] Vgl. Sanche 2002, S. 14.
[31] Vgl. Günther 2001, S. 11.
[32] Vgl. Graf 2005, S. 45.
[33] Vgl. Günther 2001, S. 12.
[34] Vgl. Sanche 2002, S. 21.
[35] Vgl. Garbe 1998, S. 28 f.
[36] Vgl. Casagranda 1994, S. 54 f.
[37] Vgl. Graf 2005, S. 46.
[38] Vgl. Casagranda 1994, S. 54 f.
[39] Vgl. Speth 2001, S. 16.
[40] Vgl. Garbe 1998, S. 10.
[41] Vgl. Casagranda 1994, S. 58.
[42] Vgl. Bieger 2007, S. 10.
[43] Vgl. Weiber 1985, S. 3 f.
[44] Vgl. Grill-Kiefer/Biedermann 2000, S. 56 f.
[45] Vgl. Weiber 1985, S. 7.
[46] Vgl. Grill-Kiefer/Biedermann 2000, S. 56.
[47] Vgl. Bochum/Meißner 2000, S. 3.
[48] Vgl. o.V. Verflechtung der deutschen Wirtschaft mit dem Ausland, http://www.destatis.de/jetspeed/
portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Content/Publikationen/Querschnittsveroeffentlichungen/WirtschaftStatistik/VGR/VerflechtungWirtschaftAusland,property=file.pdf,S. 28, (28.03.2009).
[49] Vgl. o.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, http://www.bmwi.de/BMWi/
Navigation/Presse/pressemitteilungen,did=148788.html, (27.03.2009).
[50] Vgl. o.V. Der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Kennzahlen der Dienstleistungswirtschaft,
http://xa3332.xa3.serverdomain.org/index.php?id=9, (10.05.2009).
[51] Vgl. o.V. Die Bundesregierung. Dienstleistungsexport stärken, http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Magazine/MagazinWirtschaftFinanzen/063/s-b-dienstleistungsexport-staerken.html,
(27.03.2009).
[52] Vgl. Schmied 2006, S. 5.
[53] Vgl. o.V. Die Bundesregierung. Dienstleistungsexport stärken, http://www.bundesregierung.de/
Content/DE/Magazine/MagazinWirtschaftFinanzen/063/s-b-dienstleistungsexport-staerken.html,
(27.03.2009).
[54] Vgl. o.V. Europäische Kommission. Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt,
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_de.htm, (28.03.2009).
[55] Vgl. o.V. Die „Dienstleistungsrichtlinie“, http://europa.eu/scadplus/leg/de/lvb/l33237.htm, (28.03.2009).
[56] Vgl. o.V. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Dienstleistungswirtschaft,
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/dienstleistungswirtschaft.html, (28.03.2009).
[57] Vgl. o.V. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V, http://www.magdeburg.ihk24.de/
produktmarken/starthilfe/Anlagen/Dienstleistungen/DL_Report_2009_Fruehjahr.pdf,
(28.04.2009).
[58] Vgl. Bogner/Brunner 2007, S. 70.
[59] Vgl. Meffert/Wolter 2000, S. 3 f.
[60] Vgl. o.V. Liberalisierung von Dienstleistungen durch GATS, http://www.bundestag.de/
gremien/welt/glob_end/3_3_3.html, (29.04.2009).
[61] Vgl. Meffert/Wolter 2000, S. 3 f.
[62] Vgl. o.V. Beobachtungsnetz der europäischen KMU, http://ec.europa.eu/enterprise/
enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2003_report4_de.pdf, S. 31, (22.03.2009).
[63] Vgl. Bogner/Brunner 2007, S. 88.
[64] Vgl. o.V. Beobachtungsnetz der europäischen KMU, Vgl. Beobachtungsnetz der europäischen KMU,
http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/doc/smes_observatory_2003_report4_de.pdf,
S. 29, (22.03.2009).
[65] Vgl. Bogner/Brunner 2007, S. 70 f.
[66] Vgl. o.V. VDMA 2009, S. 10 ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836636131
- DOI
- 10.3239/9783836636131
- Dateigröße
- 514 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Chemnitz – Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2009 (September)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- markteintrittsstrategien porter export kostenführerschaft qualität
- Produktsicherheit
- Diplom.de