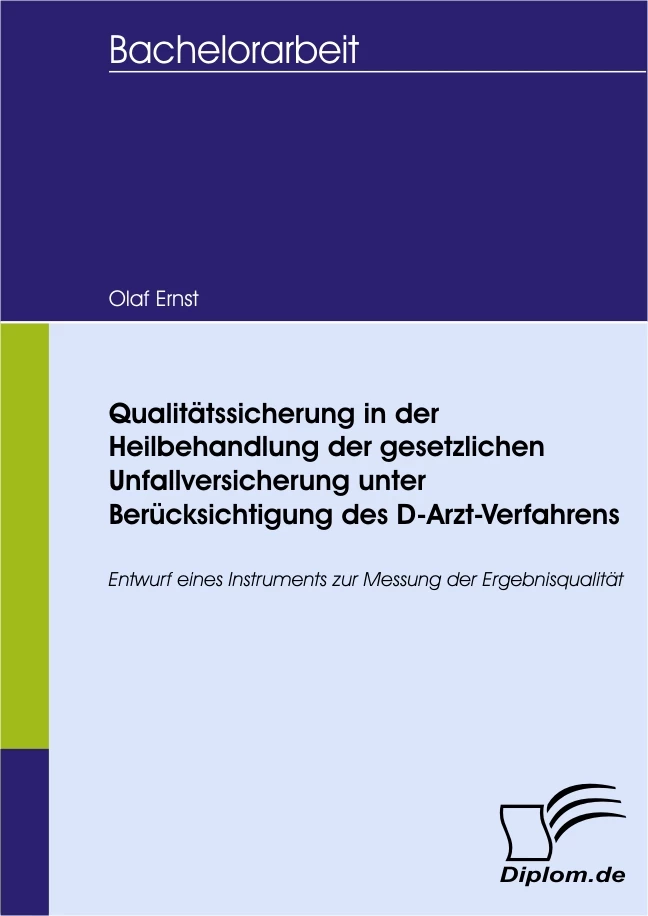Qualitätssicherung in der Heilbehandlung der gesetzlichen Unfallversicherung unter Berücksichtigung des D-Arzt-Verfahrens
Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität
©2009
Bachelorarbeit
129 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) hat am 27./28.11.2008 einen ersten Entwurf der Eckpunkte zur Neuausrichtung der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung beschlossen (Anhang 1). In diesem Papier werden Gedanken fixiert, wie das Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung überprüft und neu strukturiert werden könnte. Bezüglich des ambulanten Heilverfahrens wurde in den Bemerkungen zur Tagesordnung unter anderem angeregt, über eine strukturierte Qualitätssicherung der D-ärztlichen Tätigkeit nachzudenken. Begründet wurde dieser Vorschlag damit, dass es bislang für den durchgangsärztlichen Bereich an einer kontinuierlichen Einbeziehung der Ergebnisqualität fehle. Die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) sollten deshalb erörtern, welche Parameter und Instrumente zur Messung der Ergebnisqualität im Durchgangsarztverfahren entwickelt und wie diese regelhaft und mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden könnten. Denkbar sei ein übersichtliches und valides Bewertungskonzept, das verschiedene Ebenen der Qualität (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) berücksichtige und die Ergebnisse an die UV-Träger und Durchgangsärzte (D-Ärzte) zurückspiegele.
Die vorliegende Arbeit nimmt sich dieser Thematik an und beleuchtet im ambulanten Heilverfahren das Durchgangsarztverfahren näher. Sie hat insbesondere folgende Ziele:
- Die Untersuchung des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens hinsichtlich der Qualitätssicherung (QS) im Durchgangsarztverfahren und die Zuordnung der Ergebnisse zu den Qualitätsdimensionen.
- Die Klärung der Fragen, in welchen Bereichen des Durchgangsarztverfahrens die Landesverbände der DGUV bisher QS betrieben haben bzw. künftig die QS intensivieren sollten.
- Den Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität im ambulanten Durchgangsarztverfahren durch die Landesverbände der DGUV.
- Fragen zur QS außerhalb des Durchgangsarztverfahrens werden nicht behandelt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Literaturrecherche über die Online-Kataloge der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Universitätsbibliotheken Heidelberg und Mannheim, dem Zentralen Informationssystem der Gesetzlichen Unfallversicherung und dem Online Rechtsportal Juris.de durchgeführt. Herangezogen wurden Bücher, Aufsätze und Dissertationen, die sich mit den Fragen der QS, der Qualitätsmessung in der medizinischen Versorgung (insbesondere in der Trauma-Versorgung) und der […]
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) hat am 27./28.11.2008 einen ersten Entwurf der Eckpunkte zur Neuausrichtung der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung beschlossen (Anhang 1). In diesem Papier werden Gedanken fixiert, wie das Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung überprüft und neu strukturiert werden könnte. Bezüglich des ambulanten Heilverfahrens wurde in den Bemerkungen zur Tagesordnung unter anderem angeregt, über eine strukturierte Qualitätssicherung der D-ärztlichen Tätigkeit nachzudenken. Begründet wurde dieser Vorschlag damit, dass es bislang für den durchgangsärztlichen Bereich an einer kontinuierlichen Einbeziehung der Ergebnisqualität fehle. Die Unfallversicherungsträger (UV-Träger) sollten deshalb erörtern, welche Parameter und Instrumente zur Messung der Ergebnisqualität im Durchgangsarztverfahren entwickelt und wie diese regelhaft und mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden könnten. Denkbar sei ein übersichtliches und valides Bewertungskonzept, das verschiedene Ebenen der Qualität (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) berücksichtige und die Ergebnisse an die UV-Träger und Durchgangsärzte (D-Ärzte) zurückspiegele.
Die vorliegende Arbeit nimmt sich dieser Thematik an und beleuchtet im ambulanten Heilverfahren das Durchgangsarztverfahren näher. Sie hat insbesondere folgende Ziele:
- Die Untersuchung des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens hinsichtlich der Qualitätssicherung (QS) im Durchgangsarztverfahren und die Zuordnung der Ergebnisse zu den Qualitätsdimensionen.
- Die Klärung der Fragen, in welchen Bereichen des Durchgangsarztverfahrens die Landesverbände der DGUV bisher QS betrieben haben bzw. künftig die QS intensivieren sollten.
- Den Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität im ambulanten Durchgangsarztverfahren durch die Landesverbände der DGUV.
- Fragen zur QS außerhalb des Durchgangsarztverfahrens werden nicht behandelt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Literaturrecherche über die Online-Kataloge der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Universitätsbibliotheken Heidelberg und Mannheim, dem Zentralen Informationssystem der Gesetzlichen Unfallversicherung und dem Online Rechtsportal Juris.de durchgeführt. Herangezogen wurden Bücher, Aufsätze und Dissertationen, die sich mit den Fragen der QS, der Qualitätsmessung in der medizinischen Versorgung (insbesondere in der Trauma-Versorgung) und der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Olaf Ernst
Qualitätssicherung in der Heilbehandlung der gesetzlichen Unfallversicherung unter
Berücksichtigung des D-Arzt-Verfahrens
Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität
ISBN: 978-3-8366-3504-2
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg, Bonn, Deutschland, Bachelorarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
"Stille ist eine Qualität, die uns gut tut."
Anselm Grün, Benediktinermönch der Abtei Münsterschwarzach
- III -
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis... VI
Abbildungsverzeichnis ... XI
Abkürzungsverzeichnis ...XII
1. Einleitung ... 1
2. Qualität und Qualitätssicherung... 3
2.1 Qualität... 3
2.2 Qualitätssicherung... 4
2.3 Qualitätsdimensionen nach Donabedian ... 4
2.3.1 Strukturqualität... 5
2.3.2 Prozessqualität... 5
2.3.3 Ergebnisqualität... 5
2.3.4 Qualitätsdimensionen in der Arbeit der Landesverbände der DGUV ... 5
2.4 Möglichkeiten der Qualitätsmessung... 6
2.5 Maßstäbe für Qualität in der Heilbehandlung... 7
2.6 Zyklus der Qualitätsverbesserung ... 7
3. Das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren ... 8
3.1 Rechtliche und vertragliche Grundlagen... 8
3.2 Ablauf... 10
3.2.1 Kassenarzt/Hausarzt... 10
3.2.2 Durchgangsarztverfahren ... 11
3.2.3 Verletzungsartenverfahren ... 12
3.2.4 Handchirurgen nach § 37 Abs. 3 ÄV ... 12
3.2.5 H-Arzt-Verfahren ... 13
3.2.6 Regelungen bei Augen- und Hals-Nasen-Ohren-Verletzungen ... 14
3.2.7 Hautarztverfahren... 14
3.3 Modellverfahren der Landesverbände der DGUV ... 14
3.3.1 Modellverfahren ,,Psychotherapeuten" ... 14
3.3.2 Modellprojekt ,,Verbesserung der handchirurgischen Versorgung"... 15
3.4 Rückblick und Ausblick auf das Heilverfahren ... 15
4. Untersuchung der Qualitätssicherungen in der Heilbehandlung unter
Berücksichtigung des Durchgangsarztverfahrens ... 18
- IV -
4.1 Qualitätssicherungen in den Anforderungen für das D-Arzt-Verfahren... 18
4.2 Qualitätssicherungen im Ärztevertrag... 23
4.3 ,,Konkurrenz" D-Arzt- versus H-Arzt-Anforderungen ... 30
4.4 Aufgaben eines Landesverbandes der DGUV ... 31
4.5 Qualitätssicherungen durch den Landesverband... 31
4.5.1 Qualitätssicherung bei der erstmaligen Beteiligung ... 31
4.5.2 Qualitätssicherung während der Beteiligung ... 32
4.6 Vorschläge für künftige Schwerpunkte in der Qualitätssicherung bei der
Landesverbandsarbeit... 34
5. Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität im
Durchgangsarztverfahren durch den Landesverband... 36
5.1 Zielsetzungen ... 36
5.2 Ausgewählte vorhandene Patientenfragebogen ... 37
5.2.1 Patientenfragebogen Indikatoren des Reha-Status (IRES) ... 38
5.2.2 Polytrauma-Outcome-(POLO-)Chart... 38
5.2.3 SF-36 Lebensqualitätsindex (Health Survey Short Form 36) ... 39
5.3 Entwicklung eines Fragebogens... 40
5.4 Der Patienten-Fragebogen... 44
5.5 Sozialdatenschutz... 48
5.6 Ablauf des Pilotprojektes POEMDA ... 50
5.7 Vorschläge für die Auswertung ... 51
6 Fazit... 53
Anhang 1: Eckpunkte-Papier der DGUV... 55
Anhang 2: Anforderungen für das Durchgangsarztverfahren ... 61
Anhang 3: Programm D-Arzt-Einführungsseminar ... 63
Anhang 4: Verletzungsartenverzeichnis ... 64
Anhang 5: Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger (Ärztevertrag) ... 67
Anhang 6: Ärztliche Unfallmeldung (F 1050) ... 90
Anhang 7: Durchgangsarztbericht (F 1000)... 91
Anhang 8: Anforderung für das H-Arzt-Verfahren... 92
Anhang 9: Synopse D-Arzt-/H-Arzt-Anforderungen... 94
- V -
Anhang 10: Antragsvordruck Durchgangsarztverfahren ... 97
Anhang 11: Vordruck D-Arzt-Praxisbesichtigung... 102
Anhang 12: D-Arzt-Statistikbogen ... 103
Anhang 13: Vermerk Gespräch mit Dr. med. Studier-Fischer... 105
Anhang 14: POEMDA-Fragebogen ... 107
Anhang 15 Auswertung Tracer-Diagnosen 2007 DGUV ... 113
- VI -
Literaturverzeichnis
Bähr, K. et al.: Qualität und Qualitätsmanagement - eine Perspektive für das
moderne
Gesundheitswesen?, in: Arbeitsmedizin - Sozialmedizin -
Umweltmedizin, 2000, S. 500.
Baumann,
W.
et
al.:
Patientenzufriedenheit
in
onkologischen
Schwerpunktpraxen, in: Deutsches Ärzteblatt, 2008, S. 871.
Bereiter-Hahn, W./Mehrtens, G.: Gesetzliche Unfallversicherung, Siebtes Buch
Sozialgesetzbuch, Handkommentar, Losebl., Berlin (Stand Dezember 2008).
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie: 100 Jahre BG Chemie,
Heidelberg, 1985.
Böttger-Linck, K. et al.: Der Patient als Kunde in Amon, U. (Hrsg.):
Qualitätsmanagement in der Arztpraxis - Patientenbindung, Praxisorganisation,
Fehlervermeidung, 2. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York, 2004.
Braun, B./Müller, R.: Auswirkungen von Vergütungsformen auf die Qualität der
stationären Versorgung, in: GEK Gemünder Ersatzkasse (Hrsg.): Schriftenreihe
zur Gesundheitsanalyse, Bd. 14, St. Augustin, 2003.
Breuer, J.: Wandel der gesetzlichen Unfallversicherung, in: Trauma und
Berufskrankheit, Supplement 1, 2008, S. 78.
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (Hrsg.): Gemeinsame
Empfehlung Qualitätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX, Online im Internet:
http://www.bar-
frankfurt.de/upload/Gemeinsame_Empfehlung_Qualitätssicherung_79.pdf
[06.02.2009].
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.: Weißbuch Schwerverletzten-
Versorgung, Empfehlungen zur Struktur, Organisation und Ausstattung der
Schwerverletzten-Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 2006.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (Hrsg.): Landesverband Südwest
- Rundschreiben Nr. D 13/2004 vom 23.06.2004, Online im Internet:
http://www.dguv.de/landesverbaende/de/rundschreiben/lv8_suedwest/archiv_d04/
pdf_archiv_d04/lv8_d13_04.pdf [06.02.2009].
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (Hrsg.): Landesverband Südwest
- Rundschreiben Nr. D 03/2005 vom 26.01.2005, Online im Internet:
http://www.dguv.de/landesverbaende/de/rundschreiben/lv8_suedwest/archiv_d05/
pdf_archiv_d05/lv8_d03_05.pdf [06.02.2009].
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (Hrsg.): Landesverband Südwest
-
Rundschreiben
Nr.
D
09/2005
vom
29.04.2005,
Online
im
Internet:http://www.dguv.de/landesverbaende/de/rundschreiben/lv8_suedwest/arc
hiv_d05/pdf_archiv_d05/lv8_d09_05.pdf [09.02.2009].
- VII -
Deutsche
Gesetzliche
Unfallversicherung
e.V.
(Hrsg.):
Statistiken
Durchgangsarztverfahren,
Online
im
Internet:
http://www.dguv.de/landesverbaende/de/zahlen/d_arzt/bad_wuertt/index.jsp und.
http://www.dguv.de/landesverbaende/de/zahlen/d_arzt/saarland/index.jsp
[16.02.2009].
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: Empfehlungen der Gesetzlichen
Unfallversicherung zur Prävention und Rehabilitation von psychischen Störungen
nach Arbeitsunfallen, Rheinbreitbach, 2008.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. et al.: Vertrag gem. § 34 Abs. 3
SGB VII zwischen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV),
Berlin, dem Bundesverband der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften
e.V., Kassel, einerseits und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung K.d.ö.R,.
Berlin, anderseits über die Durchführung der Heilbehandlung, die Vergütung
sowie Art und Weise der Abrechnung der ärztlichen Leistungen (Vertrag
Ärzte/Unfallversicherungsträger) gültig ab 1. April 2008.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: Eckpunkte zur Neuausrichtung
der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung, o. O., o. J.
Deutsche
Gesetzliche
Unfallversicherung
e.V.:
Bemerkungen
zum
Tagesordnungspunkt 5 der Mitgliederversammlung am 27./28.11.2008, o. O., o. J.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: BGV A1 - BG-Vorschrift -
Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention, o. O., o. J.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: Satzung des Verbandes
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV), o. O., o. J.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.: Statut der regionalen
Gliederungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V., o. O., o. J.
Drechsel-Schlund, C. et al.: Modellverfahren der Landesverbände der
gewerblichen Berufsgenossenschaften - Einbindung von ärztlichen und
psychologischen
Psychotherapeuten
in
das
berufsgenossenschaftliche
Heilverfahren bei psychischen Gesundheitsschäden - Daten, Fakten und eine.
erste Bilanz, in: Trauma und Berufskrankheit, 2005, S. 134.
Eckkernkamp, A.: Aufgaben der Traumatologie aus Sicht des SGB V und SGB
VII, in: Die BG, 2007, S. 225.
Forschungsgesellschaft für angewandte Systemsicherheit und Arbeitsmedizin
mbh (Hrsg.): Steuerung des Heilverfahrens - Weller-Datenbank, die
Expertendatenbank aus der Praxis für die Praxis, Online im Internet: .
http://www.fsa.de/fsa_gmbh/download/Broschuere_2005_Weller_web.pdf
[20.02.2009].
Frank, M.: Qualitätsmanagement in der Arztpraxis - erfolgreich umgesetzt,
2. Aufl., Stuttgart/New York, 2005.
- VIII -
Geiger, W./Kotte, W.: Handbuch Qualität - Grundlagen und Elemente des
Qualitätsmanagements: Systeme - Perspektiven, 5. Aufl., Wiesbaden, 2008.
Gerlach, F.: Qualitätsförderung in Praxis und Klinik - Eine Chance für die
Medizin, Stuttgart/New York, 2001.
Gottschalk, F.: Das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren, in: TIEFBAU
2004, S. 207.
Grausgruber, A.: Patientenbefragung als Instrument zur Qualitätssicherung, in:
Soziale Sicherheit Österreich, 2001, S. 261.
Helou, A. et al.: Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in Deutschland -
Übersicht auf der Grundlage des Gutachtens "Bedarfsgerechtigkeit und
Wirtschaftlichkeit" des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion im
Gesundheitswesen 2000/2001, in: Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung
- Gesundheitsschutz, 2002, S. 205.
Hopp, F.-P.: Qualitätscontrolling im Krankenhaus - Die Gewinnung von
Qualitätsindikatoren durch Befragung zur Patientenzufriedenheit, Bayreuth, 2000.
Jahn, K./Klose, W.: Sozialgesetzbuch (SGB) für die Praxis - Erstes Buch (I)
Allgemeiner Teil, Kommentar, Losebl., Freiburg (Stand Januar 2009).
Jaster, H.-J.: Von der Bedeutung der Qualität in der Industrie zum
Qualitätsbegriff in der Medizin, in: Jaster, H.-J. (Hrsg.): Qualitätssicherung im
Gesundheitswesen, Stuttgart/New York, 1997, S. 9.
Junghanns, K.: Sind Mindestmengen der falsche Weg in der Qualitätssicherung?,
in: ArztRecht, 2007, S. 4.
Lauterbach, H. et al.: Unfallversicherung Sozialgesetzbuch VII, Kommentar,
Losebl., Bd. 3, 4. Aufl., Stuttgart (Stand: Mai 2008).
Leuftink, D.: "Heilbehandlung" mit allen geeigneten Mitteln "im Zeitalter der
Wirtschaftlichkeit"
-
Behandlungsergebnisse,
Kostananalyse
und
Wirtschaftlichkeit, in: Trauma und Berufskrankheit, Supplement 1, 2001, S. 2.
Leuftink, D./Butz.: UV-GOÄ - Gebührenordnung für Ärzte für die Leistungs-
und Kostenabrechnung mit den Unfallversicherungsträgern, 39. Aufl., Eppingen,
2007.
Mehrhoff, F./Weber-Falkensammer, H.: Qualität und Wirtschaftlichkeit der
Leistungen zur Heilbehandlung und Rehabilitation in der gesetzlichen
Unfallversicherung, in: Die BG, 2000, S. 104.
Mehrtens, G./Erhard, H.: Alles unter einem Dach - die Bedeutung der
berufsgenossenschaftlichen Krankenhäuser, in: Die BG, 2007, S. 214.
Neugebauer, E./Tecic, T.: Lebensqualität nach Schwerstverletzungen, in:
Trauma und Berufskrankheit, Supplement 1, 2008, S. 99.
- IX -
Neugebauer, E./Tecic, T.: Outcome-Beurteilung nach Polytrauma, in: Oestern,
H.-J. (Hrsg.): Das Polytrauma - Praklinisches und klinisches Managemant,
München, 2008, S. 302.
Noeske/Franz: Erläuterungen zum Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger,
Kommentar, Losebl.,Berlin (Stand Juni 2008).
o. V.:Entschließung der Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen
Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder am
21.11.1996 in Cottbus, in: Pinter, E. et al. (Hrsg.): BEST OF QualiMed -
Ausgewählte Beiträge aus Qualitätsmanagement in Klinik und Praxis, Frankfurt,
1998, S. 19.
Pietsch-Breitfeld, B. et al.: Qualität in deutschen Krankenhäusern - Strategien
zur Einführung von Qualitätsmanagement - Ein Bericht über das
Demonstrationsprojekt
"Qualitätsmanagement
im
Krankenhaus"
des.
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung, Baden-Baden, o.J.
Pirente, N. et al.: Systematische Entwicklung eines Messinstruments zur
Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität beim polytraumatisierten
Patienten - Die Polytrauma-Outcome-(POLO-)Chart, in: Der Unfallchirurg, 2002,
S. 413.
Plamper, E./Lünger, M.: Die stationäre Versorgung, in: Lauterbach, K.W. et al.
(Hrsg.): Gesundheitsökonomie - Lehrbuch für Mediziner und andere
Gesundheitsberufe, Bern, 2006, S. 149.
Ritter, F. et al.: Rehabilitationsmanagement, in: Trauma und Berufskrankheit,
Supplement 1, 2006, S. 93.
Schneeweiss, S. et al.: Qualitätsmodell Krankenhaus (QMK) - Ergebnis-Messung
in der stationären Versorgung - Abschlussbericht, Bonn, 2003.
Schupp, W.: Externe Qualitätssicherungsprogramme der gesetzlichen Sozial-
versicherung für die medizinische Rehabilitation - Vorgehensweise und erste
Ergebnisse, in: Arbeitsmedizin - Sozialmedizin - Umweltmedizin, 2005, S. 542.
Simoes, E. et al.: Qualitätsmessung im Gesundheitswesen - Indikatoren und
Outcome-Betrachtung, in: Arbeitsmedizin - Sozialmedizin - Umweltmedizin,
2004, S. 86.
Simoes, E. et al.: Indikatoren im Rahmen des internen Qualitätsmanagements in
Arztpraxen, in: Arbeitsmedizin - Sozialmedizin - Umweltmedizin, 2005, S. 398.
Spier, R./Wirthl, H.-J.: Die Heilverfahren der Unfallversicherungsträger bei
Arbeitsunfällen - Aufgaben des Kassenarztes/Hausarztes, in: Leuftink, D. (Hrsg.):
Arzt & BG, 4. Aufl., Eppingen 2008, S. 92.
Spier, R./Wirthl, H.-J.: Durchgangsarztverfahren, in: Leuftink, D. (Hrsg.): Arzt
& BG, 4. Aufl., Eppingen 2008, S. 106.
- X -
Spier, R./Wirthl, H.-J.: H-Arzt-Verfahren, in: Leuftink, D. (Hrsg.): Arzt & BG,
4. Aufl., Eppingen 2008, S. 134.
Spier, R./Wirthl, H.-J.: Modellverfahren "Arbeitsunfall und psychische
Gesundheitsschäden", in: Leuftink, D. (Hrsg.): Arzt & BG, 4. Aufl., Eppingen,
2008, S. 168.
Spier, R./Wirthl, H.-J.: Dokumentation/Berichterstattung/Formtexte, in:
Leuftink, D. (Hrsg.): Arzt und BG, 4. Aufl., Eppingen, 2008, S. 181.
Verband der deutschen gewerblichen Berufsgenossenschaften e.V.: 50 Jahre
Unfallversicherung - eine Denkschrift, Berlin, 1935.
Weidringer, J.W./Klünspies-Lutz, A.: Status quo des Qualitätsmanagements im
deutschen Gesundheitswesen, in: Amon, U. (Hrsg.): Qualitätsmanagement in der
Arztpraxis - Patientenbindung, Praxisorganisation, Fehlervermeidung, 2. Aufl.,
Berlin/Heidelberg, 2004, S. 1.
Weller, S.: Die "Steuerung des Heilverfahrens der Berufsgenossenschaften" -
Gesetzliche Unfallversicherung, eine Qualitätssicherungsmaßnahme, in: Deutsche
Gesellschaft für Chirurgie - Mitteilungen, 2007, S. 251.
Wirthl, H.-J.: Der "neue" Facharzt für Unfallchirurgie und Orthopädie: Anspruch
des Heilverfahrens, in: Trauma und Berufskrankheit, Supplement 3, 2004, S. 310.
Wittemann, M.: Die sog. "kleine Handverletzung" und ihre sozioökonomischen
Folgen, in: Der Chirurg, 1994, S. 1004.
Zwingmann, C.: Der IRES-Patientenfragebogen - Psychometrische Reanalysen
an einem rehabilitationsspezifischen Assessmentinstrument, in: Bengel,J./Jäckel,
W. (Hrsg.): Der IRES-Patientenfragebogen - Psychometrische Reanalysen an
einem rehabilitationsspezifischen Assessmentinstrument, Regensburg, 2002.
- XI -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Veranschaulichung des Begriffs ,,Qualität" anhand einer Waage ... 3
Abbildung 2: Vorstellungspflichten im D-Arzt- und Verletzungsartenverfahren 13
Abbildung 3: Ablaufdiagramm der durchgangsärztlichen Versorgung ... 29
Abbildung 4: Synopse D-Arzt-/H-Arzt-Anforderungen ... 30
- XII -
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angegebenen Ort
a. F.
alte Fassung
Abs.
Absatz
ÄV
Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger (Ärztevertrag)
Aufl.
Auflage
BAR
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
BÄK
Bundesärztekammer
Bd.
Band
BGSW
Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung
bzw.
beziehungsweise
D-Arzt
Durchgangsarzt
DGU
Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.
DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
EAP
Erweiterte Ambulante Physiotherapie
ebd.
ebenda
et al.
et alii
F
Formtext
f.
und die folgende
ff.
und die folgenden
Hrsg.
Herausgeber
H-Arzt
der an der berufsgenossenschaftlichen Heilbehandlung nach
§ 30 des Ärztevertrages beteiligte Arzt
ICD-10-GM
Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten
und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision,
German Modification, Version 2009
ICF
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-
derung und Gesundheit
- XIII -
IRES
Patientenfragebogen Indikatoren des Reha-Status
Losebl.
Loseblatt
Lig.
Ligamentum
LVF
Landesverbandsforum
MVZ
Medizinisches Versorgungszentrum
Nr.
Nummer
o. J.
ohne Jahr
o. O.
ohne Ort
POEMDA
Patientenorientierte Ergebnismessung im Durchgangsarzt-
verfahren (Pilotprojekt)
POLO
Polytrauma-Outcome-Chart
QS
Qualitätssicherung
RABl.
Reichsarbeitsblatt
RKI
Robert-Koch-Institut
Rn.
Randnummer
RVA
Reichsversicherungsamt
SGB I
Erstes Buch Sozialgesetzbuch
SGB V
Fünftes Buch Sozialgesetzbuch
SGB VII
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
SGB IX
Neuntes Buch Sozialgesetzbuch
SGB X
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch
sog.
sogenannte
S.
Seite
vgl.
vergleiche
UVCD
Unfallversicherungs-Controlling-Datenbank
- XIV -
UVG
Unfallversicherungsgesetz
UV-GOÄ
Leistungs- und Gebührenverzeichnis für die Vergütung
ärztlicher Leistungen in der gesetzlichen Unfallversicherung
UV-Träger
Unfallversicherungsträger
WHO
Weltgesundheitsorganisation
z. B.
zum Beispiel
-1-
1. Einleitung
Die Mitgliederversammlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.
(DGUV) hat am 27./28.11.2008 einen ersten Entwurf der ,,Eckpunkte zur Neuaus-
richtung der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung"
1
beschlossen
(Anhang 1). In diesem Papier werden Gedanken fixiert, wie das Heilverfahren der
gesetzlichen Unfallversicherung überprüft und neu strukturiert werden könnte.
Bezüglich des ambulanten Heilverfahrens wurde in den Bemerkungen zur Tages-
ordnung unter anderem angeregt, über eine ,,strukturierte Qualitätssicherung der
D-ärztlichen Tätigkeit nachzudenken".
2
Begründet wurde dieser Vorschlag damit,
dass es bislang für den durchgangsärztlichen Bereich an einer kontinuierlichen
Einbeziehung der Ergebnisqualität fehle. Die Unfallversicherungsträger (UV-
Träger) sollten deshalb erörtern, welche Parameter und Instrumente zur Messung
der Ergebnisqualität im Durchgangsarztverfahren
3
entwickelt und wie diese regel-
haft und mit vertretbarem Aufwand eingesetzt werden könnten. Denkbar sei ein
übersichtliches und valides Bewertungskonzept, das verschiedene Ebenen der
Qualität (Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität) berücksichtige und die Ergeb-
nisse an die UV-Träger und Durchgangsärzte (D-Ärzte) zurückspiegele.
Die vorliegende Arbeit nimmt sich dieser Thematik an und beleuchtet im ambu-
lanten Heilverfahren das Durchgangsarztverfahren näher. Sie hat insbesondere
folgende Ziele:
Die Untersuchung des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens hin-
sichtlich der Qualitätssicherung (QS) im Durchgangsarztverfahren und die
Zuordnung der Ergebnisse zu den Qualitätsdimensionen.
Die Klärung der Fragen, in welchen Bereichen des Durchgangsarztverfah-
rens die Landesverbände der DGUV bisher QS betrieben haben bzw. künf-
tig die QS intensivieren sollten.
Den Entwurf eines Instruments zur Messung der Ergebnisqualität im am-
bulanten Durchgangsarztverfahren durch die Landesverbände der DGUV.
1
Vgl. DGUV, Entwurf von Eckpunkten zur Neuausrichtung der Heilverfahren in der gesetzlichen Unfallversicherung,
Stand: 26.11.2008, Tagesordnungspunkt 5 der Mitgliederversammlung der DGUV am 27./28.11.2008.
2
DGUV, Überprüfung und Neuausrichtung der Heilverfahren der gesetzlichen Unfallversicherung, Bemerkungen zu
Tagesordnungspunkt 5 der Mitgliederversammlung der DGUV am 27./28.11.2008.
3
In dieser Ausarbeitung wird aus Gründen der Verständlichkeit von der Verwendung der weiblichen und männlichen
Fassung einer Personenbezeichnung abgesehen. Die verwendete Personenbezeichnung umfasst die weibliche und männli-
che Form des Begriffs.
-2-
Fragen zur QS außerhalb des Durchgangsarztverfahrens werden nicht behandelt.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Literaturrecherche über die Online-Kataloge
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, der Universitätsbibliotheken Heidelberg und
Mannheim, dem Zentralen Informationssystem der Gesetzlichen Unfallversiche-
rung und dem Online Rechtsportal Juris.de durchgeführt. Herangezogen wurden
Bücher, Aufsätze und Dissertationen, die sich mit den Fragen der QS, der Quali-
tätsmessung in der medizinischen Versorgung (insbesondere in der Trauma-
Versorgung) und der Erstellung von Patientenfragebogen auseinandersetzten.
Grundsätzlich wurde Literatur berücksichtigt, die im Jahr 2000 oder später publi-
ziert wurde. Im Rahmen eines Gespräches mit einem Facharzt für Chirur-
gie/Unfallchirurgie wurden Tracer-Diagnosen für den Patientenfragebogen ermit-
telt.
Die Arbeit erläutert im zweiten Kapitel zunächst die Begriffe Qualität, QS und die
Qualitätsdimensionen nach Donabedian und zeigt Möglichkeiten und Maßstäbe
zur Qualitätsmessung auf. Der Zyklus der Qualitätssicherung wird angesprochen.
Im dritten Kapitel werden die rechtlichen und vertraglichen Grundlagen des be-
rufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens und der Ablauf des Durchgangsarztver-
fahrens und weiterer Verfahren der Akutbehandlung dargestellt. Es folgt ein
Rückblick und Ausblick auf die berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung. Das
vierte Kapitel widmet sich der Untersuchung des berufsgenossenschaftlichen
Heilverfahrens hinsichtlich der QS im Durchgangsarztverfahren. Hierzu werden
die Anforderungen für das Durchgangsarztverfahren und der Vertrag
Ärzte/Unfallversicherungsträger (Ärztevertrag ÄV) begutachtet. Die Ergebnisse
werden den Dimensionen Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität zugeordnet.
Weiterhin werden zwei ,,Anforderungen" aus Qualitätsgesichtspunkten gegen-
übergestellt und verglichen sowie die Maßnahmen der QS eines Landesverbandes
der DGUV beleuchtet. Das Kapitel endet mit Vorschlägen, in welchen Bereichen
künftig Schwerpunkte in der QS eines Landesverbandes gesetzt werden sollten.
Im fünften Kapitel wird ein Patientenfragebogen entwickelt und vorgestellt, der
im ambulanten Durchgangsarztverfahren eingesetzt werden kann und die Ergeb-
nisqualität messen könnte. Die Arbeit endet mit einer Zusammenfassung der ge-
wonnenen Erkenntnisse.
-3-
2. Qualität und Qualitätssicherung
Die Begriffe Qualität und Qualitätssicherung (QS) kommen in vielen Bereichen
vor. In diesem Kapitel werden diese Begriffe definiert und Informationen zu den
Qualitätsdimensionen und den Möglichkeiten der Qualitätsmessungen gegeben.
2.1 Qualität
Das Wort ,,Qualität" stammt aus dem Lateinischen (von qualitas, qualitatis = Be-
schaffenheit, Eigenschaft). In der Alltagssprache wird es in zweifacher Hinsicht
verwendet: Einerseits bezeichnet Qualität eine objektive Beschaffenheit anhand
feststellbarer Eigenschaften (z. B. die Zusammensetzung eines Produktes),
andererseits meint Qualität die ,,Güte" und den ,,hohen Wert" von Waren und
Dienstleistungen aus subjektiver Sicht.
4
Qualität wird auch als ,,Relation zwischen
realisierter Beschaffenheit und geforderter Beschaffenheit" definiert.
5
Die interna-
tionale Norm DIN EN ISO 9000:2005 definiert Qualität als ,,den Grad, in dem ein
Satz inhärenter Merkmale Anforderungen erfüllt". Frank weist darauf hin, dass
Qualität im Sinne von Qualitätsmanagement immer eine relative, auf die Quali-
tätsanforderungen bezogene Größe und nicht als absolute Aussage zu verstehen
sei.
6
Der Begriff Qualität kann anhand einer Waage bildlich veranschaulicht wer-
den (siehe Abbildung 1).
Abbildung 1: Veranschaulichung des Begriffs ,,Qualität" anhand einer Waage
Quelle: Eigene Darstellung nach Geiger, W./Kotte W., Handbuch Qualität, 2008, S. 71.
4
Vgl. Gerlach, F., Qualitätsförderung in Praxis und Klinik Eine Chance für die Medizin, 2001, S. 1.
5
Geiger, W./Kotte, W., Handbuch Qualität, 2008, S. 68.
6
Vgl. Frank, M., Qualitätsmanagement in der Arztpraxis - erfolgreich umgesetzt, 2005, S. 16.
-4-
Jaster führt aus, dass es im medizinischen Bereich so viele Definitionen der Quali-
tät gäbe, wie Ärzte, die diese definierten. Qualität könne nach seiner Auffassung
im weitesten Sinne als etwas bezeichnet werden, was in einem ständigen Be-
obachtungs- und Anpassungsprozess verbessert werden kann.
7
Auf der Ebene der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) bedeutet Qualität von Leis-
tungen zur Teilhabe ,,eine wirksame und bedarfsgerechte, am Krankheitsmodell
der WHO (ICF) orientierte fachlich qualifizierte, aber auch wirtschaftliche Leis-
tungserbringung."
8
2.2 Qualitätssicherung
Nach dem Wortlaut bedeutet QS, dass die Qualität gesichert oder - um ein Syn-
onym zu gebrauchen - geschützt wird. Ziel muss es sein, dass die realisierte Be-
schaffenheit über oder zumindest gleich der geforderten Beschaffenheit liegt. Im
Gesundheitswesen hat QS das Ziel, die Transparenz in der gesundheitlichen Ver-
sorgung zu erhöhen, die Wirksamkeit (Effektivität) gesundheitsbezogenen Han-
delns ständig zu entwickeln und auch die Wirtschaftlichkeit (Effizienz) der er-
brachten Leistungen zu gewährleisten.
9
QS wird auch als Qualitätszusicherung
bezeichnet; demnach soll sowohl innerhalb der Organisation (z. B. des Kranken-
hauses, der Praxis) als auch gegenüber Dritten (z. B. Patienten, Sozialversiche-
rungsträgern) das Vertrauen geschaffen werden, dass die jeweiligen Qualitätsan-
forderungen erfüllt werden.
10
QS wird auch als Gesamtheit aller qualitätsorientier-
ten Maßnahmen und Zielsetzungen verstanden.
11
QS kann innerhalb einer Organi-
sation oder von außerhalb betrieben werden (interne oder externe QS). Ein Auf-
trag zur QS wird für die gesetzliche Unfallversicherung im SGB VII nicht geson-
dert erwähnt
12
(im Gegensatz zur gesetzlichen Krankenversicherung z. B.
§§ 135a, 136 SGB V). Dieser ergibt sich vielmehr in Ausfluss von § 20 SGB IX.
2.3 Qualitätsdimensionen nach Donabedian
Seit Jahren gibt es den international verwendeten Ansatz, den Qualitätsbegriff der
medizinischen Versorgung zu operationalisieren und in die Dimensionen
7
Vgl. Jaster, H.-J., Von der Bedeutung der Qualität in der Industrie zum Qualitätsbegriff in der Medizin, 1997, S. 9.
8
BAR (Hrsg.), Gemeinsame Empfehlung Qualitätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX, http://www.bar-
frankfurt.de/Startseite.bar [06.02.2009]
9
Vgl. Mehrhoff, F./Weber-Falkensammer, H., Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungen zur Heilbehandlung und
Rehabilitation in der gesetzlichen Unfallversicherung, 2000, S. 104 (104).
10
Vgl. Entschließung der Konferenz für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und
Senatoren der Länder am 21.11.1996 in Cottbus, 1998, S. 19.
11
Vgl. Helou, A. et al., Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung in Deutschland, 2002, S. 205 (205).
12
Vgl. Mehrhoff, F./Weber-Falkensammer, H., a. a. O., S. 104 (111).
-5-
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität aufzuteilen.
13
Dieser Lösungsansatz geht
auf Arvedis Donabedian zurück.
2.3.1 Strukturqualität
Sämtliche Voraussetzungen, die zur Erbringung einer medizinischen Leistung
erforderlich sind, werden der Strukturqualität zugeordnet. Hierzu gehören insbe-
sondere die personelle, materielle und bauliche Ausstattung des Krankenhauses
und der Arztpraxis, die fachlichen Qualifikationen von Ärzten und Personal und
der Personalschlüssel. Weiterhin gehören die Qualifikationsvoraussetzungen für
bestimmte Leistungen und die apparative und technische Mindestausstattung da-
zu.
14
2.3.2 Prozessqualität
Mit der Prozessqualität wird das gesamte Leistungsspektrum des Krankenhauses
und der Arztpraxis erfasst. Darunter fallen z. B. sachgerecht durchgeführte dia-
gnostische und therapeutische Maßnahmen am einzelnen Patienten, die Arzt-
Patienten-Beziehung, die Kommunikation mit anderen Ärzten und Leistungs-
erbringern, der interne Organisationsablauf, Wartezeiten.
15
Die Dokumentation
und Bewertung des Verlaufs der Heilbehandlung gehören auch dazu.
16
2.3.3 Ergebnisqualität
Das Resultat der medizinischen Behandlung orientiert sich primär am Ergebnis.
Dazu gehören besonders der Heilerfolg bzw. die Besserung des Gesundheitsscha-
dens, die Heilungsdauer, therapiebedingte bzw. vermeidbare Komplikationen,
mögliche Wiedererkrankungen, die Sterblichkeit, das subjektive Befinden des
Patienten und die Patientenzufriedenheit.
17
2.3.4 Qualitätsdimensionen in der Arbeit der Landesverbände der DGUV
Die soeben definierten ,,medizinischen" Dimensionen der Struktur- und Ergebnis-
qualität können auf die Arbeit der Landesverbände übertragen werden. So prüfen
beispielweise die Landesverbände die fachlichen, personellen und sächlichen
Voraussetzungen der Leistungserbringer. In Einzelfällen evaluieren die Landes-
13
Vgl. Jaster, H.-J., a. a. O., S. 25.
14
Vgl. Frank, M., a. a. O., S. 17.
15
Ebd.
16
BAR (Hrsg.), Gemeinsame Empfehlung Qualitätssicherung nach § 20 Abs. 1 SGB IX, http://www.bar-
frankfurt.de/Startseite.bar [06.02.2009]
17
Vgl. Frank, M., a. a. O., S. 17.
-6-
verbände zusammen mit den UV-Trägern die Heilverfahrensergebnisse. Die Pro-
zessqualität bezieht sich hier aber nicht nur auf die medizinischen Maßnahmen am
einzelnen Patient, sondern insbesondere auf den vertraglich vereinbarten Ablauf
des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens und auf das Zusammenspiel der
einzelnen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungserbringer.
18
2.4 Möglichkeiten der Qualitätsmessung
,,Qualität" kann man als solches nicht messen. Es ist jedoch möglich, prozess-,
struktur- und ergebnisbezogene Indikatoren zu definieren. Diese dienen als Hilfs-
größen zur Differenzierung der einzelnen Dimensionen der Qualität.
19
Qualität
kann somit indirekt durch die Zahlen und Zahlenverhältnisse der einzelnen Indi-
katoren abgebildet werden. Die Ausprägung eines Indikators kann auf Qualitäts-
probleme hinweisen.
20
Die drei Arten von Indikatoren sind eng miteinander ver-
knüpft und keiner sollte für sich alleine betrachtet werden, denn: ,,Strukturen be-
dingen Prozesse, Prozesse bedingen Ergebnisse."
21
Bei der Auswahl der Indikato-
ren ist darauf zu achten, dass diese hinsichtlich des Ergebnisses von Bedeutung
und hinreichend definierbar und messbar sind; sie müssen durch den Leistungs-
erbringer beeinflussbar sein.
22
Die Indikatoren können unterschiedlich bewertet
werden. Ersten: Es werden Messungen in zeitlichem Abstand durchgeführt und
die Veränderungen beurteilt.
23
Zweitens: Der Wert eines Indikators wird anhand
eines zuvor festgelegten Referenzwerts beurteilt. Drittens: Der Wert eines Indika-
tors eines einzelnen Leistungserbringers wird mit dem eines oder mehrerer
anderer Leistungserbringer verglichen (sog. Benchmarking, vom Englischen:
Benchmark = Maßstab, Benchmarking = Maßstäbe setzten). Im Bereich der Er-
gebnisqualität lassen sich nach Unfällen fünf ,,Outcome"-Indikatoren benennen:
Tod, Krankheit (Symptome, Funktionsparameter, Laborwerte), Diskomfort (z. B.
Schmerzen), Behinderung (eingeschränkte Fähigkeit, Dinge des täglichen Lebens
zu Hause, im Beruf oder in der Freizeit zu tun) und Unzufriedenheit (emotionale
Reaktionen auf den Unfall und die Behandlung).
24
Aus Patientensicht müssen
18
Vgl. Mehrhoff, F./Weber-Falkensammer, H., a. a. O., S. 104 (106 ff.).
19
Vgl. Simoes, E. et al., Qualitätsmessung im Gesundheitswesen Indikatoren und Outcome-Betrachtung, 2004, S. 86
(87).
20
Vgl. Plamper, E./Lünger, M., Die stationäre Versorgung, 2006, S. 167.
21
Bähr, K. et al., Qualität und Qualitätsmanagement eine Perspektive für das moderne Gesundheitswesen?, 2000, S. 500
(502).
22
Vgl. Gerlach, F., a. a. O., S. 20 f.
23
Vgl. Hopp, F.-P., Qualitätscontrolling im Krankenhaus, 2000, S. 27.
24
Vgl. Neugebauer, E./Tecic, T., Outcome-Beurteilung nach Polytrauma, 2008, S. 302 ff.
-7-
neue Outcome-Parameter wie z. B. emotionale Gesundheit, soziale Interaktion
und Grad der Zufriedenheit hinzukommen.
25
2.5 Maßstäbe für Qualität in der Heilbehandlung
Das wichtigste Instrument in der gesetzlichen Unfallversicherung, mit dem das
Heilverfahren gesteuert und gemessen werden kann, ist die sog. ,,Weller-Tabelle"
in Verbindung mit der Unfallversicherungs-Controlling-Datenbank (UVCD).
26
Urheber der Tabelle ist der gleichnamige ehemalige Ärztliche Direkter der Be-
rufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Tübingen, Professor Dr. med. Dr. h. c.
mult. Siegfried Weller. In der ,,Weller-Tabelle" werden fast alle möglichen Ver-
letzungsmuster nach dem sog. ,,Weller-Key" gegliedert. Zu jedem ,,Weller-Key"
wird das Heilverfahren unter Berücksichtigung der Behandlungsmethoden prog-
nostisch eingeschätzt (z. B. Arbeitsunfähigkeitszeiten, Komplikationsrisiken). Die
Laufzeitprognosen berücksichtigen ferner, ob der Verletzte konservativ oder
operativ behandelt wurde und ob er eine körperliche oder geistige Tätigkeit aus-
übt. Insbesondere die prognostische Dauer der Arbeitsunfähigkeit kann als ein
Maß-stab dienen.
Die UVCD ist eine zentrale Datenbank, in die zahlreiche UV-Träger Daten von
abgeschlossenen gesteuerten Behandlungsfällen liefern. Zu den Daten gehören
neben den speziellen Daten zur Verletzung insbesondere auch die Dauer der Ar-
beitsunfähigkeit, Rentenentschädigung und sämtliche angefallenen Kosten. Die
einzelnen teilnehmenden UV-Träger erhalten regelmäßig für jeden ,,Weller-Key"
einen Vergleich der eigenen Werte zu den Werten aller datenliefernden UV-
Träger. Die Durchschnittswerte bzw. der jeweils beste Wert können dann jeweils
als Maßstab definiert werden. Mit den Ergebnissen der UVCD wird die ,,Weller-
Tabelle" ständig weiterentwickelt. Es handelt sich um ein dynamisch, lernendes
System
27
. Dies bedeutet, dass ein Ergebnis immer nur so lange als ein Maßstab
dienen kann, bis durch neue Daten das bisherige Ergebnis validiert wurde.
2.6 Zyklus der Qualitätsverbesserung
W. Edward Deming formulierte 1950 ein Methode, wie ein IST-(Qualitäts)-Ziel
durch ein konsequentes wiederholen eines Vier-Phasen-Zyklus an einem zuvor
25
Vgl. Neugebauer, E./Tecic, T., Outcome-Beurteilung nach Polytrauma, 2008, S. 302 ff.
26
Vgl. FSA GmbH (Hrsg.), Steuerung des Heilverfahrens Weller-Datenbank, http://www.fsa.de [20.02.2009]
27
Vgl. Weller, S., Die ,,Steuerung des Heilverfahren der Berufsgenossenschaften" Gesetzliche Unfallversicherung, 2007,
S. 251 (254).
-8-
definierten SOLL-(Qualitäts)-Ziel gemessen und verbessert werden kann (sog.
Deming`scher PDCA-Zyklus). Hierzu wird ein Ziel geplant (Plan). Die erforderli-
chen Maßnahmen werden durchgeführt (Do). Anschließend wird der Erfolg über-
prüft (Check). Die Verbesserungen werden festgehalten (Act) und der Zyklus be-
ginnt erneut.
28
QS darf nicht ein einmaliger Vorgang sein, sondern muss ständig
wiederholt werden.
3. Das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren
Ein Versicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversicherung kann ein Arbeitsun-
fall oder eine Berufskrankheit sein (§ 7 Abs. 1 SGB VII). Ein Arbeitsunfall liegt
vor, wenn eine versicherte Person einen Unfall infolge einer versicherten Tätigkeit
erleidet (§ 8 Abs. 1 SGB VII). Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, welche die
Bundesregierung durch eine Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
als Berufskrankheit bezeichnet und die eine versicherte Person infolge einer versi-
cherten Tätigkeit erleidet (§ 9 Abs. 1 SGB VII).
3.1 Rechtliche und vertragliche Grundlagen
Die gesetzliche Unfallversicherung hat die Aufgabe, nach dem Eintritt eines Ar-
beitsunfalles oder einer Berufskrankheit mit ,,allen geeigneten Mitteln" die Ge-
sundheit und die Leistungsfähigkeit der Versicherten wiederherzustellen bzw. den
Gesundheitsschaden zu bessern, seine Verschlimmerung zu verhüten oder seine
Folgen zu mindern (§§ 1 Satz 1 Nr. 2, 26 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII). Durch die Worte
,,mit allen geeigneten Mitteln" werden den UV-Trägern ein sehr weitgehendes
Ermessen und ein weiter Gestaltungsspielraum eingeräumt.
29
Die Grenze ist allein
die Frage, ob das eingesetzte Mittel geeignet ist.
30
Im Gegensatz hierzu müssen
die Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung ausreichend, zweckmä-
ßig und wirtschaftlich sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überstei-
gen (§ 12 Abs. 1 S. 1 SGB V). Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung
sind wirtschaftlich und sparsam zu erbringen (§ 13 Abs. 1 S. 1 SGB VI). Die ge-
setzliche Unfallversicherung hat von allen Sozialversicherungszweigen den wei-
testgehenden Rehabilitationsumfang.
31
28
Vgl. Weidringer, J.W./Klünspies-Lutz, A., Status quo des Qualitätsmanagements im deutschen Gesundheitswesen, 2004,
S. 2.
29
Vgl. Bereither-Hahn, W./Mehrtens, G, Gesetzliche Unfallversicherung, Handkommentar, § 26 SGB VII, Rn. 6.
30
Vgl. Bereither-Hahn, W./Mehrtens, G, a. a. O., § 1 SGB VII, Rn. 4.
31
Vgl. Bereither-Hahn, W./Mehrtens, G, a. a. O., § 26 SGB VII, Rn. 6
-9-
Weiterhin haben die UV-Träger nach § 34 Abs. 1 SGB VII alle Maßnahmen zu
treffen, damit durch eine frühzeitige nach dem Versicherungsfall einsetzende und
sachgemäße vor allem eine besondere unfallmedizinische Heilbehandlung
gewährleistet wird. Sie dürfen hierzu die Voraussetzungen (fachliche Befähigung,
sächliche und personelle Ausstattung) und die Pflichten festlegen, die Ärzte und
Krankenhäuser zu erfüllen haben. Wegen Art und Schwere der Verletzung dürfen
sie besondere Verfahren für die Heilbehandlung vorsehen (z. B. das Durchgangs-
arzt- und Verletzungsartenverfahren); die Festlegung der Anforderungen für diese
Verfahren dienen der QS.
32
Die Verbände der Unfallversicherungsträger und die
Kassenärztliche Bundesvereinigung schließen auf der Basis der von den UV-
Trägern beschlossenen ,,Anforderungen" mit Wirkung für ihre Mitglieder Verträ-
ge über die Durchführung der Heilbehandlung ab (§ 34 Abs. 3 S. 1 SGB VII).
Dies ist mit dem ,,Vertrag gemäß § 34 Abs.3 SGB VII (...) über die Durchführung
der Heilbehandlung, die Vergütung der Ärzte sowie die Art und Weise der Ab-
rechnung ärztlicher Leistungen (Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger)" (ÄV)
geschehen.
Benötigt eine versicherte Person auf Grund von Art und Schwere des Gesund-
heitsschadens eine besondere unfallmedizinische Behandlung, wird diese als ,,be-
sondere Heilbehandlung" erbracht (§ 11 Abs. 3 ÄV); ansonsten wird eine ,,allge-
meine Heilbehandlung" durchgeführt (§ 10 Abs. 1 ÄV). Eine besondere Heilbe-
handlung ist die fachärztliche Behandlung eines Unfallverletzten, die wegen Art
oder Schwere eine besondere unfallmedizinische Qualifikation verlangt; sie darf
nur von bestimmten Ärzten und dem UV-Träger eingeleitet werden (§ 11 Abs. 1
und 3 ÄV). Entgegen dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 76
SGB V) ist in Fällen der ,,besonderen Heilbehandlung" die freie Arztwahl einge-
schränkt
33
(§ 28 Abs. 4 SGB VII). Damit soll die Qualität der Behandlung gesi-
chert werden.
34
Den UV-Trägern sind somit zwei wesentlichen Aufgaben übertra-
gen: zum einen die Verantwortung für die Organisation des Heilverfahrens und
zum anderen die Festlegung der von den Ärzten und Krankenhäusern zu erfüllen-
den Voraussetzungen (die sog. ,,Anforderungen").
32
Vgl. Bereither-Hahn, W./Mehrtens, G, a. a. O., § 34 SGB VII, Rn. 5.
33
Vgl. Gottschalk, F., Das berufsgenossenschaftliche Heilverfahren, 2004, S. 207 (207).
34
Vgl. Bereither-Hahn, W./Mehrtens, G, a. a. O., § 28 SGB VII, Rn. 13.
-10-
3.2 Ablauf
Der Ablauf des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens und die damit verbun-
denen Zuweisungsmechanismen sind im ÄV abschließend geregelt. An den ÄV
sind alle an der vertragsärztlichen Versorgung beteiligten Ärzte gebunden
(§ 4 Abs. 1 ÄV). Die Regelungen des ÄV gelten, sobald ein Arbeitsunfall ein-
getreten ist; sie gelten nicht, wenn der Verdacht auf eine Berufskrankheit besteht.
Im letzteren Fall hat der Arzt den Verdacht zunächst dem UV-Träger anzuzeigen
und dessen Entscheidung, ob eine berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung ein-
geleitet wird, abzuwarten (§ 202 S. 1 SGB VII, §§ 44, 45 ÄV).
3.2.1 Kassenarzt/Hausarzt
Stellt sich ein Arbeitsunfallverletzter primär nach dem Unfall seinem Hausarzt
vor, so hat dieser die notfallmäßige Erstbehandlung durchzuführen, die das Maß
des ,,sofort Notwendigen" nicht übersteigt (§ 9 ÄV). Diese soll den Verletzten in
die Lage versetzen, einen D-Arzt aufsuchen zu können.
35
Der Patient ist unver-
züglich einem D-Arzt vorzustellen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
vorliegt (§ 26 Abs. 1 ÄV):
Die Unfallverletzung bedingt eine Arbeitsunfähigkeit über den Unfalltag
hinaus.
Die Behandlungsbedürftigkeit beträgt voraussichtlich mehr als eine
Woche.
Eine Verordnung von Heil- oder Hilfsmitteln ist erforderlich.
Ein anderer Facharzt muss hinzugezogen werden.
Es liegt eine Wiedererkrankung vor.
Hat der Patient eine Verletzung, die im Verletzungsartenverzeichnis aufgeführt
ist, muss er einem D-Arzt an einem am Verletzungsartenverfahren zugelassenen
Krankenhaus überwiesen werden (§ 37 Abs. 1 ÄV). Bei isolierten Augen-
und/oder HNO-Verletzungen ist der Verletzte unmittelbar an den entsprechenden
Facharzt zu überweisen (§ 26 Abs. 2 ÄV).
Wenn eine Weiterleitung des Verunglückten nicht erforderlich ist, ist der Haus-
arzt/Kassenarzt der behandelnde Arzt und er kann die Behandlung durchführen.
35
Vgl. Spier, R./Wirthl, H.-J., Die Heilverfahren der Unfallversicherungsträger bei Arbeitsunfällen - Aufgaben des Kassen-
arztes/Hausarztes, 2008, S. 93.
-11-
Sollte erst nach dem Tag der Erstbehandlung einer der genannten Vorstellungs-
gründe beim D-Arzt eintreten (z. B. die Behandlung wird voraussichtlich doch
über eine Woche andauern), so ist spätestens dann eine Vorstellung erforderlich.
3.2.2 Durchgangsarztverfahren
Im Zentrum des berufsgenossenschaftlichen Heilverfahrens steht das Durch-
gangsarztverfahren. D-Ärzte sind in eigener Praxis niedergelassen oder an Kran-
kenhäusern als Chefärzte bzw. Leitende Ärzte tätig. Im letzteren Fall können
D-Ärzte sowohl an ,,nicht zugelassenen" als auch an ,,zugelassenen Krankenhäu-
sern" tätig sein. Ein ,,zugelassenes Krankenhaus" ist an der besonderen stationä-
ren Behandlung von Schwer-Unfallverletzten (sog. Verletzungsartenverfahren)
beteiligt. Dem D-Arzt werden Arbeitsunfallverletzte nach dem ÄV zugewiesen.
Aber auch Unternehmer sind nach der Unfallverhütungsvorschrift ihres jeweiligen
UV-Trägers angehalten, Unfallverletzte einem D-Arzt oder einem D-Arzt an ei-
nem ,,zugelassenen Krankenhaus" vorzustellen.
36
Der D-Arzt hat die Aufgabe,
den Verletzten zu untersuchen und die fachärztliche Erstversorgung (einschließ-
lich Tetanusprophylaxe)
37
vorzunehmen. Er entscheidet nach Art oder Schwere
der Verletzung, ob eine allgemeine oder besondere Heilbehandlung erforderlich
ist. Leitet der D-Arzt eine besondere Heilbehandlung ein, bleibt der Verletzte bei
ihm in Behandlung. In Fällen der allgemeinen Heilbehandlung überweist er den
Patienten an dessen Hausarzt/Kassenarzt zurück und überwacht das dort durchge-
führte Heilverfahren, in dem er einen Nachschautermin setzt (§§ 27 Abs. 1,
29 ÄV). Er darf dem Hausarzt/Kassenarzt auch einen Behandlungsvorschlag un-
terbreiten.
38
Die hervorgehobene Stellung des D-Arztes ergibt sich daraus, da er
die Funktion eines Lotsen übernimmt, der die Akut- und Nachbehandlung im be-
rufsgenossenschaftlichen Heilverfahren steuert.
39
Der niedergelassene oder am ,,nicht zugelassenen" Krankenhaus tätige D-Arzt
muss Schwer-Unfallverletzte jedoch beim D-Arzt am ,,zugelassenen" - also am
Verletzungsartenverfahren beteiligten - Krankenhaus vorstellen (§ 37 Abs. 1 ÄV).
Der D-Arzt am ,,nicht zugelassenen" Krankenhaus darf eine stationäre Behand-
lung im eigenen Haus einleiten, wenn kein Fall des Verletzungsartenverfahrens
vorliegen sollte.
36
Vgl. DGUV, BGV A1 - BG-Vorschrift - Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention, o. J., S. 11.
37
Vgl. Spier, R./Wirthl, H.-J., Durchgangsarztverfahren, 2008, S. 108.
38
Vgl. Noeske/Franz, Erläuterungen zum Vertrag Ärzte/Unfallversicherungsträger, 2008, § 29, Rn. 3.
39
Vgl. Ekkernkamp, A., Aufgaben der Traumatologie aus Sicht des SGB V und SGB VII, 2007, S. 225 (225).
-12-
Neben dem ,,normalen" Durchgangsarztverfahren hat die gesetzliche Unfallversi-
cherung ein Durchgangsarztverfahren speziell für arbeitsunfallverletzte Kinder
eingerichtet (sog. ,,Kinder"-D-Arzt-Verfahren).
3.2.3 Verletzungsartenverfahren
Schwer-Unfallverletzte müssen nach einem Unfall in Krankenhäuser überwiesen
werden, die am Verletzungsartenverfahren beteiligt sind. Im Anhang 1 zum ÄV
ist ein Verletzungsartenverzeichnis beigefügt (§ 37 Abs. 1 ÄV). Hier werden die
Körperschäden aufgezählt, die unter das Verletzungsartenverfahren fallen. Ergän-
zende Erläuterungen zum Verletzungsartenverzeichnis geben zusätzliche Hinwei-
se für die Zuordnung bestimmter Verletzungen. Der am ,,zugelassenen" Kranken-
haus tätige Arzt entscheidet auf Grund von Art oder Schwere der Verletzung, ob
eine stationäre oder ambulante Behandlung erforderlich ist. Eine ambulante Be-
handlung kann er selbst durchführen oder einen anderen Arzt damit beauftragen
(§ 37 Abs. 2 ÄV). Am Verletzungsartenverfahren sind insbesondere die Berufs-
genossenschaftlichen Unfallkliniken beteiligt. Diese nehmen eine europäische
Spitzenstellung im Polytrauma-Management und in den Standards für die optima-
le Abfolge von Untersuchungen und Maßnahmen bei Schwerverletzten ein.
40
Für
schwerstverletzte Kinder hat die gesetzliche Unfallversicherung ein spezielles
,,Kinder"-Verletzungsartenverfahren eingeführt.
3.2.4 Handchirurgen nach § 37 Abs. 3 ÄV
Die Landesverbände der DGUV können niedergelassene oder an Krankenhäusern
tätige Handchirurgen an der besonderen berufsgenossenschaftlichen Heilbehand-
lung gemäß § 37 Abs. 3 ÄV beteiligen. Damit sind diese Handchirurgen von der
Vorstellungspflicht bei schweren Verletzungen der Hand (Nr. 8 des Verletzungs-
artenverzeichnisses) im ,,zugelassenen" Krankenhaus befreit. Bei Verletzungen,
die nicht die Hand betreffen, gelten für den hier genannten Handchirurgen die
gleichen Vorstellungspflichten, wie für jeden anderen Arzt.
40
Vgl. Mehrtens, G./Erhard, H., Alles unter einem Dach die Bedeutung der berufsgenossenschaftlichen
Krankenhäuser, 2007, S. 214 (214).
-13-
3.2.5 H-Arzt-Verfahren
H-Arzt ist die Abkürzung für den an der berufsgenossenschaftlichen Heilbehand-
lung beteiligten Arzt.
41
Entgegen dem D-Arzt-Verfahren gibt es im H-Arzt-
Verfahren keine Vorstellungspflichten für Unternehmer und Ärzte.
42
Der H-Arzt
ist selbst von der Vorstellungspflicht beim D-Arzt befreit; die Vorstellungspflicht
von Schwer-Unfallverletzten im Rahmen des Verletzungsartenverfahrens muss er
jedoch beachten (§§ 33, 37 Abs. 1 ÄV). Der H-Arzt behandelt die Unfallverletz-
ten, die sich von sich aus bei ihm vorstellen. Aktiv darf ein Unfallverletzter nicht
bei einem H-Arzt vorgestellt werden (Umkehrschluss zu den Vorstellungspflich-
ten im D-Arzt-Verfahren). Der H-Arzt führt grundsätzlich eine allgemeine Heil-
behandlung durch. Eine Ausnahme bilden die in Anlage 2 zum ÄV genannten
Körperschäden; nur in diesen abschließend aufgezählten Fällen darf er eine be-
sondere Heilbehandlung einleiten (§ 35 ÄV). Der H-Arzt darf alle Unfallverletz-
ten behandeln, die auch der niedergelassene D-Arzt oder der am ,,nicht zugelasse-
nen" Krankenhaus tätige D-Arzt behandeln darf.
Abbildung 1 zeigt die bisher erläuterten Vorstellungspflichten im D-Arzt- und
Verletzungsartenverfahren:
Abbildung 2: Vorstellungspflichten im D-Arzt- und Verletzungsartenverfahren
Quelle: Eigene Darstellung.
41
Vgl. Noeske/Franz, a. a. O., § 30.
42
Vgl. Spier, R./Wirthl, H.-J., H-Arzt-Verfahren, 2008, S. 134.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836635042
- DOI
- 10.3239/9783836635042
- Dateigröße
- 22.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg – Social Security Management, Fachbereich Sozialversicherung
- Erscheinungsdatum
- 2009 (September)
- Note
- 2,7
- Schlagworte
- dguv patientenbefragung unfallversicherung qualitätssicherung heilbehandlung
- Produktsicherheit
- Diplom.de