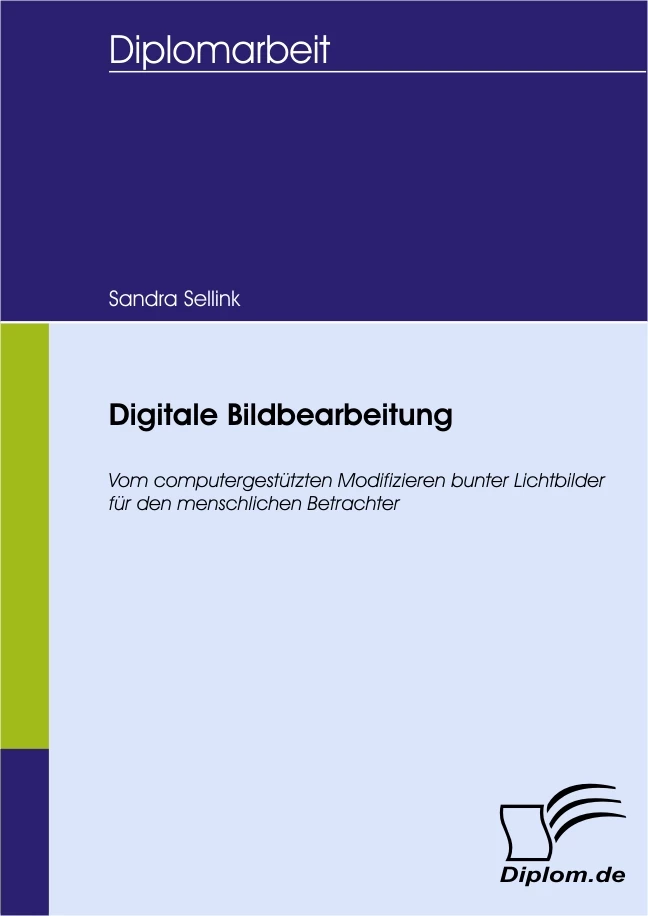Digitale Bildbearbeitung
Vom computergestützten Modifizieren bunter Lichtbilder für den menschlichen Betrachter
Zusammenfassung
Motivation und Zielsetzung:
Der Auslöser für das Thema dieser Arbeit waren unter Wasser fotografierte, digitale Lichtbilder, welche im Rahmen der ersten Taucherfahrungen entstanden sind. Die in Erinnerung so schillernd bunte, gestochen scharfe Unterwasserwelt hatte auf den Beweisfotos einige Schönheitsfehler: Viele dieser digitalen Lichtbilder waren grün- oder blaustichig statt bunt, unscharf, und störende Schwebeteilchen versperrten die Sicht auf das eigentliche Motiv. Erste Versuche, diese Schönheitsfehler mit digitalen Bildbearbeitungsprogrammen zu beseitigen, führten selten bis gar nicht zum Ziel. Diese Misserfolge hatten zwei Ursachen. Zum einen war bei manchen Funktionen und Werkzeugen die sachgemäße Bedienung unbekannt und ließ sich auch nicht intuitiv erarbeiten, oder es fehlte gar an der Kenntnis über den Nutzen, den eine bestimmte Funktion stiften kann. Zum anderen war die Zielsetzung oft unklar: Zwar sollte ein bestimmtes, digitales Lichtbild irgendwie verbessert werden, aber was genau und wie verändert werden sollte, konnte nicht konkretisiert werden.
Es ist Ziel dieser Arbeit, die Hintergründe, Ursprünge und Grundlagen der computergestützten Bildbearbeitung einem Leser näherzubringen, von dem unterstellt wird, dass er bereits über ein grundlegendes Verständnis für die digitale Fotografie verfügt. Gegenstand der Bearbeitung sind dabei ausschließlich digitale, bunte Lichtbilder und somit durch Fotografie mit Digitalkameras entstandene Bilder. Die Betrachtung der digitalen Bildbearbeitung erfolgt im Wesentlichen aus einer anwendungsorientierten Perspektive, denn der Leser soll in die Lage versetzt werden, genau die oben beschriebenen Misserfolge nicht erleiden zu müssen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die Funktionalitäten digitaler Bildbearbeitungsprogramme in Gänze zu erläutern. Hierzu scheint eine Konsultierung der Hilfe des jeweiligen Bildbearbeitungsprogramms oder eines entsprechenden Internetforums im konkreten Bedarfsfall völlig ausreichend. Die Ursprünge und Hintergründe der digitalen Bildbearbeitung stehen hingegen in einem besonderen Fokus, denn gerade weil im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Funktionalitäten der digitalen Bildbearbeitung in Gänze erläutert werden können, soll der Leser befähigt werden, sich Lösungen für konkrete Problemstellungen selbst zu erarbeiten. Ein detailiertes Verständnis des Phänomens Farbe ist dafür eine unerlässliche und faszinierende Grundvoraussetzung.
Diese […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Motivation und Zielsetzung
2 Farbaspekte
2.1 Physikalische und physiologische Grundlagen
2.1.1 Farben als Bestandteile sichtbaren, wahrgenommenen Lichts
2.1.2 Menschliche Farbwahrnehmung
2.2 Farbsynthese
2.3 Ordnung der Farben
2.4 Farbmodelle
2.4.1 RGB-Modell
2.4.2 CMYK-Modell
2.4.3 HSB-Modell
2.4.4 CIE-L*a*b*-Modell
3 Eigenschaften digitaler Lichtbilder
3.1 Bildgröße und Auflösung
3.2 Farbraum und Farbtiefe
3.3 Dateiformat
4 Digitale Bildbearbeitung
4.1 Vorbereitungen
4.1.1 Farbmanagement
4.1.2 Bildbewertung
4.2 Grundlegende Konzepte
4.2.1 Auswahlen
4.2.2 Kanäle
4.2.3 Ebenen
4.2.4 Farbanpassungen
4.2.5 Werkzeuge
4.2.6 Filter
4.3 Lichtbilder optimieren
4.3.1 Bildausschnitt
4.3.2 Belichtung und Kontraste
4.3.3 Fateiformat
4.3.4 Störende Elemente
4.3.5 Unschärfe
4.4 Kreatives
4.4.1 Abpudern der Haut
4.4.2 Kolorieren
4.4.3 Draganizen
4.4.4 Composings
4.5 Eigenschaften ändern
4.5.1 Bildgröße und Auflösung
4.5.2 Farbraum und Farbtiefe
4.5.3 Dp5 Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang A: Anwendungsbeispiele im Vorher-Nachher-Vergleich
1 Motivation und Zielsetzung
Der Auslöser für das Thema dieser Arbeit waren unter Wasser fotografierte, digitale Lichtbilder, welche im Rahmen der ersten Taucherfahrungen entstanden sind. Die in Erinnerung so schillernd bunte, gestochen scharfe Unterwasserwelt hatte auf den „Beweisfotos“ einige Schönheitsfehler: Viele dieser digitalen Lichtbilder waren grün- oder blaustichig statt „bunt“, unscharf, und störende Schwebeteilchen versperrten die Sicht auf das eigentliche Motiv. Erste Versuche, diese Schönheitsfehler mit digitalen Bildbearbeitungsprogrammen zu beseitigen, führten selten bis gar nicht zum Ziel. Diese Misserfolge hatten zwei Ursachen. Zum einen war bei manchen Funktionen und Werkzeugen die sachgemäße Bedienung unbekannt und ließ sich auch nicht intuitiv erarbeiten, oder es fehlte gar an der Kenntnis über den Nutzen, den eine bestimmte Funktion stiften kann. Zum anderen war die Zielsetzung oft unklar: Zwar sollte ein bestimmtes, digitales Lichtbild irgendwie verbessert werden, aber was genau und wie verändert werden sollte, konnte nicht konkretisiert werden.
Es ist Ziel dieser Arbeit, die Hintergründe, Ursprünge und Grundlagen der computergestützten Bildbearbeitung einem Leser näherzubringen, von dem unterstellt wird, dass er bereits über ein grundlegendes Verständnis für die digitale Fotografie verfügt[1]. Gegenstand der Bearbeitung sind dabei ausschließlich digitale, bunte Lichtbilder und somit durch Fotografie mit Digitalkameras entstandene Bilder. Die Betrachtung der digitalen Bildbearbeitung erfolgt im Wesentlichen aus einer anwendungsorientierten Perspektive, denn der Leser soll in die Lage versetzt werden, genau die oben beschriebenen Misserfolge nicht erleiden zu müssen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit, die Funktionalitäten digitaler Bildbearbeitungsprogramme in Gänze zu erläutern. Hierzu scheint eine Konsultierung der Hilfe des jeweiligen Bildbearbeitungsprogramms oder eines entsprechenden Internetforums im konkreten Bedarfsfall völlig ausreichend. Die Ursprünge und Hintergründe der digitalen Bildbearbeitung stehen hingegen in einem besonderen Fokus, denn gerade weil im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Funktionalitäten der digitalen Bildbearbeitung in Gänze erläutert werden können, soll der Leser befähigt werden, sich Lösungen für konkrete Problemstellungen selbst zu erarbeiten. Ein detailiertes Verständnis des Phänomens „Farbe“ ist dafür eine unerlässliche und faszinierende Grundvoraussetzung.
Diese Arbeit soll dem Leser genau die Inhalte vermitteln, die erforderlich sind, um selbstständig und erfolgreich digitale Lichtbilder nach eigenen Zielvorstellungen zu modifizieren, womit eine praktische Auseinandersetzung mit der Materie offensichtlich unumgänglich ist.
4.2 Grundlegende Konzepte
Die in diesem Kapitel beschriebenen Sachverhalte beruhen im Wesentlichen auf den praktischen Erfahrungen der Verfasserin. Bei Fragen und Unklarheiten im Rahmen dieser Recherchen wurde überwiegend die Hilfe der jeweiligen Bildbearbeitungsprogramme konsultiert, auf die im Einzelnen nicht referenziert wird. Die im Folgenden beschriebenen, grundlegenden Konzepte digitaler Bildbearbeitungsprogramme sollen insbesondere verdeutlichen, dass sich digitale Bildbearbeitung aus der Kombination vieler, möglicher Bearbeitungsdimensionen zusammensetzt. Es ist nicht Ziel dieses Kapitels, mittels konkreter Arbeitsanweisungen die Bedienung einzelner Bildbearbeitungsprogramme zu beschreiben, denn hierzu empfiehlt sich eine, dem konkreten Bedarf angepasste Recherche in der Hilfe des verwendeten Bildbearbeitungsprogramms.
4.2.1 Auswahlen
In der digitalen Bildbearbeitung ist es oft erforderlich, bestimmte Bereiche im zu bearbeitenden, digitalen Lichtbild auf unterschiedliche Art und Weise zu verändern. Für diesen Zweck steht in Bildbearbeitungsprogrammen eine Vielzahl unterschiedlicher Auswahlwerkzeuge zur Verfügung. Auswahlen dienen im Wesentlichen dazu, einen bestimmten Bildbereich festzulegen, der unabhängig vom Rest des Bildes bearbeitet werden soll. Ebenso können ausgewählte Pixel aber auch ausgeschnitten oder kopiert und an einer anderen Stelle im Bild eingefügt werden.
Auswahlen können entweder mittels einer bestimmbaren Teilfläche des Bildes oder mittels bestimmbarer Kriterien für zu erfüllende, farbliche Eigenschaften erstellt werden. Für die Auswahl über Teilflächen stehen Rechteck- und Elipsenformen zur Verfügung, deren Größe oder Seitenverhältnis bei Bedarf auch festgelegt werden kann. Des Weiteren können mit dem so genannten Polygon‑Lasso‑Werkzeug beziehungsweise mit dem so genannten Freihand‑Lasso‑Werkzeug beliebige Polygonflächen beziehungsweise freihändig festgelegte Flächen für die Erzeugung einer Auswahl definiert werden. Die Bildbearbeitungsprogramme PhotoShop und Gimp stellen zusätzlich ein Flächenauswahlwerkzeug zur Verfügung, welches Kanten automatisch detektiert, indem sich die mit der Maus getroffene Auswahlbegrenzung nachträglich an im Umfeld vorherrschende, kontrastreiche Pixelübergänge angleicht. Die Empfindlichkeit dieser Anpassung beziehungsweise die erforderliche Kontraststärke kann dabei variiert werden. Mit dem so genannten Zauberstab können benachbarte und auch nicht benachbarte Pixel ähnlicher Farben mit einem Mausklick ausgewählt werden, wobei die Toleranz der für ähnlich befundenen Farben reguliert werden kann.
Unabhängig von dem verwendeten Auswahlwerkzeug bestimmt der so genannte Auswahlmodus, wie sich eine neu getroffene Auswahl zu der bereits vorhandenen Auswahl verhält. So kann die neue Auswahl die vorhandene Auswahl ersetzen, sie kann der vorhandenen Auswahl hinzugefügt oder von ihr abgezogen werden, oder die resultierende Auswahl bildet die Schnittmenge aus der vorhandenen und der neuen Auswahl. Eine getroffene Auswahl kann umgekehrt werden, womit genau die Pixel zur Auswahl werden, die ursprünglich nicht ausgewählt waren. Eine Auswahl kann außerdem um eine konfigurierbare Pixelanzahl vergrößert oder verkleinert werden. Einige Auswahlwerkzeuge können mit der Option „Glätten“ benutzt werden, womit die Pixel an den Auswahlkanten mit den angrenzenden, nicht ausgewählten Pixeln angeglichen werden. Die Bildbearbeitungsprogramme PhotoShop und PaintShopPro stellen zusätzlich die Option einer weichen Auswahlkante zur Verfügung, womit die Schärfe beziehungsweise die Kantenkontraste in einem regulierbaren Bereich um die Auswahlkanten herum vermindert werden. Abbildung 13 veranschaulicht die Auswahloptionen „Glätten“ und weiche Auswahlkante anhand von Kopien eines ausgewählten Bildausschnitts im gleichen Bild.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 13: Optionen für Auswahlen
Das Gegenstück zur Auswahl, also die Summe aller nicht ausgewählten Pixel wird auch Maske genannt, denn die nicht ausgewählten Pixel werden „maskiert“ und sind somit vor der Bearbeitung geschützt.
4.2.2 Kanäle
Neben der Bearbeitung der Farben eines digitalen Lichtbildes können auch die einzelnen Farbbestandteile modifiziert werden. So können Farbkanäle gesondert betrachtet und unabhängig voneinander verändert werden. Die Farbkanäle stellen dabei die einzelnen Dimensionen des zugrunde liegenden Farbmodells dar (vgl. Kapitel 2.4). Ein einzelner Farbkanal wird als Graustufenbild dargestellt, wobei die maximale Intensität der jeweiligen Farbdimension durch weiße Pixel gekennzeichnet ist.
Zusätzlich zu den Farbkanälen können Auswahlen, die grundsätzlich nur temporär existieren, als sogenannte Alphakanäle im spezifischen Dateiformat der jeweiligen Bildbearbeitungssoftware dauerhaft gespeichert werden. Eine als Alphakanal gespeicherte Auswahl kann jederzeit wieder geladen und verändert werden. Die Modifikation eines Alphakanals kann dabei im Gegensatz zu den in Kapitel 4.2.1 vorgestellten Werkzeugen zusätzlich mit Malwerkzeugen wie beispielsweise Pinseln und Radierern erfolgen, denn auch ein Alphakanal wird als Graustufenbild dargestellt und kann entsprechend bearbeitet werden. Die schwarzen Pixel eines Alphakanals entsprechen der Maske, weiße Pixel bilden die Auswahl und alle dazwischenliegenden Grautöne kennzeichnen Bereiche, für die der anzuwendende Bearbeitungschritt mit einer, proportional zur Helligkeit des Grautons reduzierten Intensität beziehungsweise Deckkraft erfolgen soll. Abbildung 14 veranschaulicht die Verwendung eines Alphakanals am Beispiel einer Farbfüllung bezogen auf die aus einem Alphakanal geladene Auswahl.
[...]
[1] Begrifflichkeiten wie beispielsweise optische Achse, Bildweite, Belichtung, Blendenautomatik, Brennweite, Autofokus werden daher nicht weiter erläutert.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836634458
- DOI
- 10.3239/9783836634458
- Dateigröße
- 8.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FOM Essen, Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige GmbH, Hochschulleitung Essen früher Fachhochschule – Informatik, Studiengang Wirtschaftsinformatik
- Erscheinungsdatum
- 2009 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- farbe farbwahrnehmung farbmodelle farbsynthese kreativität
- Produktsicherheit
- Diplom.de