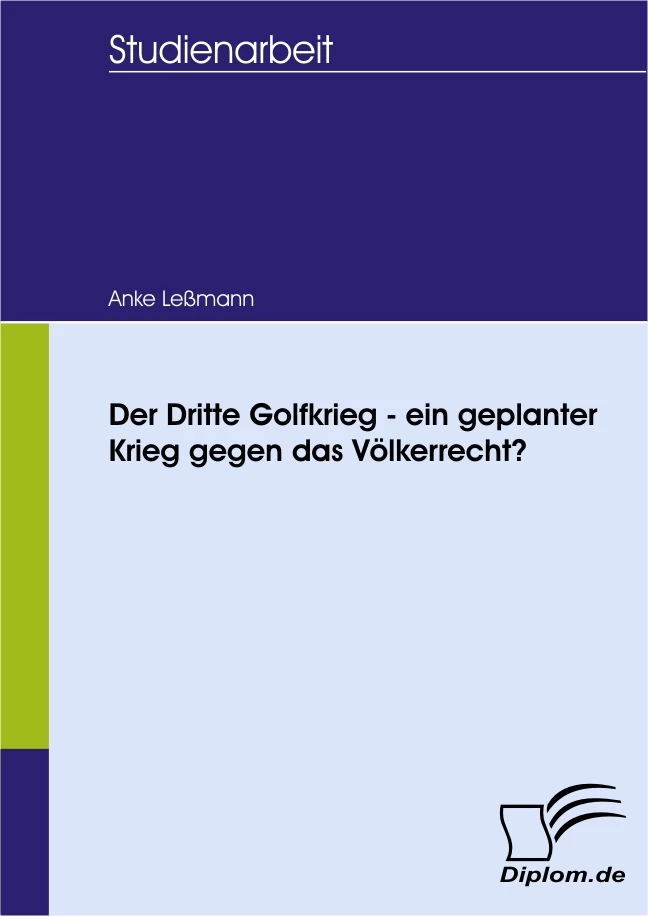Der Dritte Golfkrieg - ein geplanter Krieg gegen das Völkerrecht?
Zusammenfassung
Der Dritte Golfkrieg kann als ein Versuch der USA und ihren Verbündeten interpretiert werden, in der Golfregion eine politische Stabilität und damit einhergehend eine friedfertige Neuordnung im gesamten Vorderen Orient herzustellen. Dafür war die Zerschlagung des Hussein-Regimes im Irak die entscheidende Voraussetzung. Mit der Operation Wüstenfuchs im Dezember 1998 haben die USA den Startschuss für die Erreichung dieses Vorhabens gegeben. Historisch betrachtet gehen dem Dritten Golfkrieg zwei weitere Kriege in der Region voraus. Dies waren der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran in der Zeit von 1980 bis 1988 und der sechswöchige militärische Konflikt im Jahre 1991zwischen Kuwait und dem Irak.
Münkler bezeichnet diese Kriege als Konflikte mit einer völlig neuen politischen Bedeutung. Sie standen nach 1945 in einem weltpolitischen Fokus, wie es bis dato nur die Konflikte in Vietnam und Korea waren.
So lässt sich der Erste Golfkrieg als ein symmetrischer Krieg beschreiben, bei dem es dem Irak einzig um eine hegemoniale Vormacht in der Golfregion und kleinere Korrekturen in der Grenzziehung ging. In diesem Krieg trat letztlich der Irak durch die vordergründig militärische Unterstützung der Amerikaner als ein eindeutiger Sieger hervor.
Der Zweite Golfkrieg hingegen war durch Asymmetrie gekennzeichnet. Die Asymmetrie wurde in der Unterschiedlichkeit bezüglich der Bevölkerungszahl, des Bruttosozialproduktes, des Entwicklungsstandes und der militärischen Stärke beider beteiligter Länder, Irak und Kuwait, zur damaligen Zeit deutlich. So stellte das ölreiche jedoch militärisch schwache Kuwait eine nur allzu leichte Beute für den militärisch weit überlegenen Irak dar. Dieser Krieg lässt sich als ein einseitiger Vollzug eines politischen Willens mit gewaltsamen Mitteln beschreiben. Sein Ende fand er in einer weiteren Asymmetrie. Die Amerikaner befreiten mit ihren starken Luftstreitkräften Kuwait durch die Zerschlagung der stark unterlegenen Landstreitkräfte der Iraker.
Auf das Ende des Zweiten Golfkrieges folgte Anfang April die maßgebliche Resolution 687 des UN-Sicherheitsrates, welche dem besiegten Irak eine beispiellose Entwaffnung und umfassende Handels-, Finanz- und Wirtschaftsbeschränkung bis auf Weiteres auferlegte. Die wirtschaftlichen Sanktionen brachten die Stabilität des Hussein-Regimes zwar nicht ins Wanken, erhöhten jedoch die Unzufriedenheit Saddams über die eingeschränkte Souveränität. Seit dem Zweiten Golfkrieg […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Erste Golfkrieg
2.1 Geschichtlicher Hintergrund
2.1 Verlauf des Ersten Golfkrieges
2.2 Internationalisierung des Krieges
2.3 Interessen der USA
3. Der Zweite Golfkrieg
3.1 Verlauf des Zweiten Golfkrieges
3.2 Interessen der USA
4. Die Folgen der Wirtschaftssanktionen
4.1 Zwölf Jahre eines asymmetrischen Friedens
4.2 Das Programm Öl für Nahrungsmittel
5. Der Dritte Golfkrieg
5.1 Argumente für einen Krieg
5.2 Argumente gegen einen Krieg
5.2.1 Massenvernichtungswaffen
5.2.1.1 Aktivitäten im Atomwaffenbereich
5.2.1.2 Aktivitäten im Biowaffenbereich
5.2.1.3 Aktivitäten im Chemiewaffenbereich
5.2.1.4 Die Trägersysteme
5.2.1.5 Schlussfolgerung
5.2.2 Irak und die Verbindungen zum internationalen Terrornetz
5.3 Ökonomie des Krieges
5.4 Legitimität des Krieges durch die UN-Charta
5.5 Verlauf der Mission „Iraqi Freedom“ (Dritter Golfkrieg)
6. Fazit
7. Literatur
1. Einleitung
Der Dritte Golfkrieg kann als ein Versuch der USA und ihren Verbündeten interpretiert werden, in der Golfregion eine politische Stabilität und damit einhergehend eine friedfertige Neuordnung im gesamten Vorderen Orient herzustellen. Dafür war die Zerschlagung des Hussein-Regimes im Irak die entscheidende Voraussetzung. Mit der „Operation Wüstenfuchs“ im Dezember 1998 haben die USA den Startschuss für die Erreichung dieses Vorhabens gegeben (Kiechle 2003, 152). Historisch betrachtet gehen dem Dritten Golfkrieg zwei weitere Kriege in der Region voraus. Dies waren der Krieg zwischen dem Irak und dem Iran in der Zeit von 1980 bis 1988 und der sechswöchige militärische Konflikt im Jahre 1991zwischen Kuwait und dem Irak.
Münkler bezeichnet diese Kriege als Konflikte mit einer völlig neuen politischen Bedeutung. Sie standen nach 1945 in einem weltpolitischen Fokus, wie es bis dato nur die Konflikte in Vietnam und Korea waren. (Münkler 2003, 69)
So lässt sich der Erste Golfkrieg als ein symmetrischer Krieg beschreiben, bei dem es dem Irak einzig um eine hegemoniale Vormacht in der Golfregion und kleinere Korrekturen in der Grenzziehung ging. In diesem Krieg trat letztlich der Irak durch die vordergründig militärische Unterstützung der Amerikaner als ein eindeutiger Sieger hervor.
Der Zweite Golfkrieg hingegen war durch Asymmetrie gekennzeichnet. Die Asymmetrie wurde in der Unterschiedlichkeit bezüglich der Bevölkerungszahl, des Bruttosozialproduktes, des Entwicklungsstandes und der militärischen Stärke beider beteiligter Länder, Irak und Kuwait, zur damaligen Zeit deutlich. So stellte das ölreiche jedoch militärisch schwache Kuwait eine nur allzu leichte Beute für den militärisch weit überlegenen Irak dar. Dieser Krieg lässt sich als ein einseitiger Vollzug eines politischen Willens mit gewaltsamen Mitteln beschreiben. (Hellmann 1993, 234) Sein Ende fand er in einer weiteren Asymmetrie. Die Amerikaner befreiten mit ihren starken Luftstreitkräften Kuwait durch die Zerschlagung der stark unterlegenen Landstreitkräfte der Iraker.
Auf das Ende des Zweiten Golfkrieges folgte Anfang April die maßgebliche Resolution 687 des UN-Sicherheitsrates, welche dem besiegten Irak eine beispiellose Entwaffnung und umfassende Handels-, Finanz- und Wirtschaftsbeschränkung bis auf Weiteres auferlegte (Kubbig 2003, 11-12). Die wirtschaftlichen Sanktionen brachten die Stabilität des Hussein-Regimes zwar nicht ins Wanken, erhöhten jedoch die Unzufriedenheit Saddams über die eingeschränkte Souveränität. Seit dem Zweiten Golfkrieg führte dies zu immer stärker werdenden Spannungen zwischen der westlichen Welt und dem Irak. Folglich lässt die Situation, in der die USA und ihre Alliierten im März 2003 den Irak angriffen, sich kaum ohne einen Blick auf den Zweiten Golfkrieg verstehen. Auch die militärischen Auseinandersetzungen in den Jahren 1990 und 1991 gehen auf historische und gesellschaftliche Verhältnisse zurück. Diese Zusammenhänge sollen zu Beginn Gegenstand dieser Arbeit sein.
Im Focus jedoch steht hierbei der aus dem Zweiten Golfkrieg resultierende Dritte, welcher in seiner Notwendigkeit stets stark umstritten war und ist. Die Frage nach dem Sinn und dem Muss des Dritten Golfkrieges brachte die Idee für diese Arbeit, in der nach Fakten gesucht werden soll, die ein militärisches Vorgehen der Amerikaner gegen den Irak begründen.
War der Grund für einen militärischen Einsatz der Vorwurf, dass der Irak Massenvernichtungswaffen besitzt und somit eine Bedrohung für die Menschheit darstellt oder der, dass er mit diesen Massenvernichtungswaffen das internationale Terrornetz unterstützt und sogar hinter den Geschehnissen des 11. Septembers 2001 steckt?
Auch wurde gemutmaßt, dass diese Vorwürfe nur Vorwände seitens der Amerikaner waren, um die alleinige Macht über das Öl im Irak sowie die Kontrolle über die Fördermengen und den Verkauf zu erlangen. Immerhin verfügt der Irak nach heutigem Kenntnisstand über ca. 120 Milliarden Barrel Erdölreserven. Damit nimmt er nach Saudi-Arabien weltweit die zweite Position ein. (Kiechle 2006, 104) Als Einziger die Macht über solch ein Erdölvorkommen zu haben, stellt auf den ersten Blick zweifelsohne ein lohnendes Kriegsziel dar.
Zur Überprüfung dieser Thesen werden politisch aber auch wirtschaftlich strategische Argumentationslinien ins Feld geführt.
Daran anknüpfend wird mit Hilfe der UN-Charta die eingangs gestellte Frage beantwortet, ob der Dritte Golfkrieg ein gewollter Krieg war, welcher dem Völkerrecht entsprach oder es sich dabei um ein sich Hinwegsetzen über festgelegte rechtliche Bestimmungen handelte, die das Völkerrecht nicht zulässt.
2. Der Erste Golfkrieg
2.1 Geschichtlicher Hintergrund
Von 1980 bis 1988 kämpften der Iran und der Irak in einem der verlustreichsten und härtesten Kriege nach 1945 gegeneinander. Dieser Konflikt wird als I. Golfkrieg bezeichnet.
Bei diesem Krieg handelte es sich um einen „der wenigen bewaffneten Konflikte zwischen zwei Staaten der Dritten Welt, der nicht als „Stellvertreterkrieg“ ausbrach“. (Hellmann, Gunther 1993, 152) Der unmittelbare Auslöser des Krieges war ein Streit um die Schifffahrtsrechte im Persischen Golf, welcher eine erhebliche strategische Bedeutung für beide Staaten darstellt, da er der einzige Zugang zu den Weltmeeren ist. (von Sponeck, Hans 2003, 107-108)
Der Ursprung der Rivalität zwischen dem Iran und dem Irak lässt sich bereits im Mittelalter finden, wo religiöse und ethnische Konflikte, aber auch geopolitisches Vormachtstreben und territoriale Streitfragen eine Rolle spielten und für ständige Kollision zwischen den beiden Staaten sorgten. Für beide Seiten ging es dabei um wichtige wirtschaftliche und politische Interessen, die auf der Frage beruhten, ob die Grenze am Schatt el-Arab nach dem Thalweg-Prinzip in der Flussmitte oder am Ostufer verlaufen sollte. Erst im März 1975 kam es zu einem vertraglichen Aufeinanderzugehen beider Staaten. Beide Länder einigten sich im Abkommen von Algier auf die Festlegung der Grenzen im Schatt el-Arab in der Thalweg-Linie. (Hellmann 1993, 154) Somit stand der einzige Zugang für den Irak, Erdöl über die Weltmeere zu exportieren, unter der Aufsicht des Iran. (Münkler 2003, 11)
Diese Übereinkunft schien auch bis nach der iranischen Revolution 1979 anzuhalten, jedoch stellte die Unvereinbarkeit von beiden Regimen propagierten Ideologien ein wesentliches Hindernis für bestehende friedliche Beziehungen zwischen den beiden Völkern dar. Dabei stand der stark säkularen Orientierung der Baath Partei der ideologische Anspruch der iranischen Revolution diametral gegenüber. (Hellmann 1993, 155)
Bereits im Juni 1979 verschlechterten sich die iranisch-irakischen Beziehungen, indem sich beide Seiten vorwarfen, sich in die inneren Angelegenheiten des anderen einzumischen. So kam es im Irak durch irakische Schiiten zu wiederholten Demonstrationen gegen die Regierung, in denen eine Umwandlung des Irak in eine islamische Republik gefordert wurde. Des Weiteren führten Zusammenstöße zwischen Teilen der mehrheitlich sunnitischen arabischen Bevölkerung und Anhängern Khomeinis, aber auch militärische Manöver im Grenzbereich zwischen beiden Staaten sowie verstärkte militärische Aktionen des Irak gegenüber der kurdischen Bevölkerung innerhalb des Irak und auf iranischem Territorium zu stärkerem Unfrieden zwischen beiden Staaten. Neben diesen Auseinandersetzungen führten zwei primär innenpolitische Entwicklungen innerhalb des Iraks zu einem wachsenden schlechten Verhältnis zwischen dem Irak und dem Iran. Im Juli 1979 übernahm Saddam Hussein offiziell die höchsten Staatsämter und ungefähr zur gleichen Zeit unternahm eine angeblich von Syrien unterstützte Gruppe innerhalb der Baath-Partei einen letztlich erfolglosen Putschversuch. Dies hatte zur Folge, dass das Sicherheitsdenken des irakischen Regimes innen- aber auch außenpolitisch anstieg. Folglich wurde gegen die kleinsten Anzeichen einer Opposition vorgegangen. (Hellmann 1993, 157)
Nicht nur innere sondern auch äußere Einflüsse waren es, zu denen der Irak zwar nichts beitrug, welche die Ausrichtung der irakischen Politik jedoch mitbestimmten. Durch den Sturz des Schah-Regimes Anfang 1979 zerbrach die mühevoll aufgebaute Hegemonialmacht Iran in wenigen Monaten, was dem Irak unerwarteten und politischen Spielraum am Golf verschaffte. Ebenso führte das Camp-David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten dazu, dass Ägypten innerarabischer Ächtung verfiel, und die arabische Führungsmacht neu zu besetzen war, wofür letztendlich nur der Irak in Frage kam, da er die größeren Ressourcen besaß. Und Saddam Hussein war voller Ehrgeiz, sich an die Spitze der arabischen Welt zu setzen. (Münkler 2003, 12-13)
Im Oktober 1979 kündigte die iranische Seite an, sich gegen jegliche Bedrohung durch einen arabischen Staat militärisch zur Wehr zu setzen. Daraufhin gab der irakische Botschafter in einer Drei-Punkte-Erklärung öffentlich bekannt, dass 1. der Iran das Abkommen von Algier rückgängig machen, 2. die drei besetzten Inseln im Golf räumen und 3. den im Iran lebenden Minderheiten der Belutschen, Kurden und Araber ihre Autonomie zurückgeben solle. Diese Erklärung könnte als eine Kriegserklärung seitens der irakischen Regierung zu sehen sein, da sich daraufhin die militärischen Zusammenstöße beider Staaten zuspitzten. (Hellmann 1993, 158)
Von April bis September 1980 herrschten an den Grenzen ständige Kleinkriege, Verletzungen der Demarkationslinie, des Luftraumes, Beschießungen und Bombardements grenznaher Wohnsiedlungen. (Fürtig, Henner 1992, 59)
Nachdem es zu einem Putschversuch seitens von Angehörigen der iranischen Streitkräfte gegen das Khomeini-Regime kam, spitzten sich die Unruhen zwischen dem Iran und dem Irak dramatisch zu. Mehrere Anzeichen machten eine Eskalation der Situation zwischen beiden Staaten deutlich. In einem letzten Ultimatum seitens des Irak, wurde die iranische Regierung aufgefordert, das von dem Irak beanspruchte Gebiet von Zein el-Qoas zu räumen. Nur einen Tag später teilte das irakische Außenministerium dem Iran mit, dass es sich gezwungen sah, die iranische Besetzung in diesem Gebiet zu entfernen. Saddam Hussein gab am 17. September 1980 bekannt, dass er das Abkommen von Algier als aufgehoben betrachtet und der Schatt el-Arab irakisch und arabisch bleibe. Nur fünf Tage danach begannen die irakischen Streitkräfte mit massiven Luftangriffen auf iranische Flughäfen und Truppenstützpunkte sowie einer Landoffensive an vier Punkten entlang der iranisch-irakischen Grenze. (Hellmann 1993, 158-183)
2.2 Verlauf des Ersten Golfkrieges
Die bis Ende 1980 geführten Angriffe gegen den Iran und deren Ergebnisse entsprachen den Vorstellungen des Irak nicht im Geringsten. Geplant war ein „Blitzkrieg“ von 3 bis max. 14 Tagen Dauer, der als Ziel den Besitz der Provinz Chuzestan hatte und als Initialzündung für einen allgemeinen Volksaufstand gegen das Revolutionsregime wirken sollte. Diese Offensive seitens des Irak scheiterte. Angesichts dessen verkündete die irakische Regierung schon Ende September 1980, die territorialen Ziele erreicht zu haben. Saddam Hussein gab bekannt, dass es neben der endgültigen Rückgabe der Exklaven nur noch um eine „neutrale Zone“ zwischen beiden Ländern und um die Schaffung einer Militärgrenze bei Qoas-e Shirin gehe. Zum Jahreswechsel 1980/81 kam es zu einer Pattsituation. Weder die irakische Seite war in der Lage, ihren Vormarsch fortzusetzen noch die iranische Armee, der es an Mitteln fehlte, Erfolg versprechende Gegenschläge zu führen. (Fürtig 1992, 71-73)
Im Frühjahr 1982 erwies sich eine große Offensive des Iran als gelungen und die iranischen Truppen rückten im Juli 1982 grenzüberschreitend in den Irak vor. Die überlegene irakische Luftwaffe flog Bombenangriffe bis weit in das iranische Hinterland hinein, was hohe Verluste in der Zivilbevölkerung zur Folge hatte. Der iranische Ölterminal von Charg wurde so stark attackiert, dass Teheran einen Neubau eines Ölterminals im Osten plante. Bis 1984 zog sich dieser Kampf hin, der als Stellungskrieg zu bezeichnen und durch Artillerieduelle sowie Luftangriffe gekennzeichnet war. Erst im Frühjahr 1984 trat wieder Bewegung ein, als der Iran die strategisch wichtigen Madschnun-Inseln nordöstlich von Basra, die zweitgrößte am Zusammenfluss von Euphrat und Tigris gelegene irakische Stadt, eroberte und möglichen Angriffen des Iraks entgegenhielt. (Lerch, Wolfgang Günter 1988, 81-83)
Der so genannte „Tankerkrieg“ begann, als die weit überlegene irakische Luftwaffe ihre konzentrierten Angriffe auf den internationalen Tankverkehr im Golf konzentrierte. Ein großes Ziel seitens des Irak bestand darin, den Krieg zu internationalisieren und weitere direkte Verbündete gegen den Iran zu gewinnen (Fürtig 1992, 93). Erstmals ging im Verlaufe dieses Krieges ein Bombardement von Raketen und Granaten auf die Zivilbevölkerung in den Ballungszentren der befeindeten Länder nieder, was die erste Runde eines „Krieges der Städte“ einläutete, in der zehntausende unbeteiligte Opfer getötet wurden. Der Iran wurde in seinem Ölexport massiv eingeschränkt und bekam Schwierigkeiten, die direkten Kriegskosten von monatlich 1 Mrd. US-Dollar zu erwirtschaften. Die irakischen Angriffe auf die Tanker in den Golfgewässern nahmen im April/Mai 1984 weiter zu. Mitte Juni 1984 erzielten Initiativen der arabischen Golfanrainerstaaten und der UNO ein kurzzeitiges Abflauen des „Tankerkrieges“. Somit bestand für den Iran die Möglichkeit, seinen Export von Öl wieder zu stabilisieren und den Aufbau von Alternativ-Terminals voranzubringen. Durch die im Ergebnis erfolglos geführten Offensiven des Iran, kam es zum Jahreswechsel 1984/85 zu Auseinandersetzungen innerhalb der iranischen Führung über die weitere Vorgehensweise in dem Krieg. Es wurde beschlossen, dass in Zukunft wieder alle Formen der Streitkräfte im Verbund eingesetzt werden, so dass Ende Februar 1985 der Iran einen für den Irak völlig überraschenden Gegenangriff im Gebiet von Maimak startete. Diese Attacke erwies sich jedoch als Täuschungsmanöver, um die starken iranischen Verbände von der Südfront abzuziehen. Die Erfolge dieses Angriffes zeigten sich für die iranische Seite in der Besetzung der Magnun-Insel und einiger Dutzend Quadtratkilometer irakischen Territoriums. Die Taktik seitens des Iran, seine Streitkräfte als Ensemble zu belassen, setzte sich auch in den entscheidenden Situationen der Jahre 1986 und 1987 durch. (Fürtig 1992, 82-85)
2.2 Internationalisierung des Krieges
Der seit Sommer 1982 beiderseitig geführte Krieg ging 1987 in eine neue Etappe. Die Suche nach den bereits erwähnten Verbündeten gegen den Iran prägte die letzte Phase des Krieges. Somit ging die USA als erste ins Rennen, sich für eine „freie Schifffahrt im Golf“ zu engagieren. Dem folgten Kabinette Großbritanniens und Frankreichs, die das Ziel verfolgten, stetig wachsende Flottenverbände im Golf paradieren zu lassen, vorgeblich, um eigene Handelsschiffe zu schützen und Exportrouten von Mina al-Ahmadi bis in die Straße von Hormus zu sichern.
Bis 1988 bildete sich im Golf eine NATO-Flotte mit 90 Schiffen und 40 000 Mann an Bord. 50 Einheiten davon trugen allein die USA-Flagge am Heck. Das Konzept des Irak ging auf, weitere Kriegsteilnehmer für einen erfolgreichen Angriff gegen den Iran zu gewinnen. Mitte Oktober 1987 kam es somit zu einer ersten amerikanisch-iranischen Konfrontation, worauf eine zweite im April folgte. Schließlich wurden bei diesen Angriffen insgesamt 10 Schiffe, 2 Bohrtürme und 2 Bohrinseln stark beschädigt oder versenkt. (Fürtig 1992, 94)
Die Internationalisierung ging im Folgenden mit einer Verstärkung des Städte- und Tankerkrieges einher. Der Irak nahm an einem materialtechnischen Übergewicht zu. Der Iran hingegen litt unter der im Kriegsverlauf gewachsenen internationalen Isolierung, was ihm den Zugang zu großen Waffenlieferanten gravierend erschwerte. Einen entscheidenden Dämpfer erfuhr der Iran im März 1988, als die irakische Luftwaffe einen brutalen Giftgasangriff auf das Kurdendorf Halabga startete, bei dem Tausende Frauen, Kinder und alte Menschen ums Leben kamen und somit den Widerstandswillen des Iran entscheidend lähmte. (Fürtig 1992, 94-95)
Somit stand der Irak eindeutig auf der Sieger-Seite dieses Krieges und erlangte unter der Nutzung der äußeren Rahmenbedingungen Al-Faos zurück. Ende Mai gaben die Iranischen Truppen Salamcheh auf, und Ende Juni eroberte sich der Irak die Magnun-Inseln zurück und besetzte somit erstmals seit 1982 wieder iranisches Territorium. Das Tüpfelchen auf dem „I“ und somit der Zwang für die iranische Regierung, den Krieg auch aus Macht erhaltenden Gründen zu unterbrechen, brachte schließlich der Abschuss eines iranischen Linienflugzeuges durch den USA-Zerstörer „Vincennes“ Anfang Juli 1988 bei dem 290 Zivilisten ums Leben kamen. Am 20. August trat der offizielle Waffenstillstand zwischen Iran und Irak in Kraft. Der Krieg endete ohne auch nur einen Konflikt, welcher zu seinem Ausbruch führte, gelöst zu haben. (Fürtig 1992, 97)
Es gelang zwar, die iranischen Truppen wieder über den Euphrat auf iranisches Gebiet zurückzudrängen, was sich jedoch für den Irak als ein wirtschaftliches Eigentor erwies. Er war bankrott. (Münkler 2003, 90)
Neben dem unermesslichen Leid, welches sich beide Völker über die Jahre zugefügt haben, absorbierten die Kriegskosten 60 Prozent des iranischen und 112 Prozent des irakischen Bruttoinlandproduktes. Letzteres hielt Saddam Hussein nicht davon ab, sein Volk bereits im Sommer 1990 in einen weiteren Krieg zu führen. (Fürtig 1992, 97)
2.3 Interessen der USA
Die USA hielt sich in dem Konflikt zwischen dem Iran und dem Irak so lange wie möglich heraus, machte jedoch mit Nachdruck immer wieder deutlich, dass der freie Handel, insbesondere die Freiheit der Seewege von den Kriegsgegnern nicht gefährdet werden dürfe. Sollte dies der Fall sein, behielt sich die USA stets vor, dagegen vorzugehen.
Die politischen Interessen der Amerikaner in der Zeit des Konfliktes waren klar zu charakterisieren: Einerseits wollten die USA schon damals verhindern, dass einer der beiden Gegner, Iran oder Irak, die uneingeschränkte Hegemonialmacht in der Region erzielt, und andererseits ging es um die Sicherstellung, dass die Sowjetunion diesen Konflikt nicht ausnutzt, ihre politische wie auch militärische Präsenz am Golf auszuweiten.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die USA nach längerer Unentschlossenheit die ins Abseits geratene Seite, den Irak, unterstützten und somit eine militärische Entscheidung des Krieges verhinderten, da nur der Iran in der Lage war, erfolgreich vorzustoßen und das Land des Gegners zu besetzen. Es muss an dieser Stelle jedoch erwähnt sein, dass Saddam Hussein nicht die Sympathie der Amerikaner innehatte. Die den iranischen Mullahs gegenüber fiel allerdings noch geringer aus, was durch die große Demütigung der Amerikaner in der Teheraner Geiselaffäre unterstrichen wurde. So unterstützten die USA den Irak mit Informationen über Truppenbereitstellungen schwach besetzter Frontabschnitte sowie lohnenden Angriffszielen im iranischen Territorium. Damit stellten sie ein Gleichgewicht zwischen beiden Gegnern bis hin zu einer Informationsüberlegenheit seitens des Irak her, was ihm zu militärischen Erfolgen verhalf (Münkler 2003, 89).
Ein letzter nicht unwesentlicher Gewinn für die USA zur Zeit des ersten Golfkrieges bestand in der wachsenden militärischen Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion. Diese besaß mit ihrem Militärpotenzial bei weitem nicht mehr die Macht. Für die USA war dies die Chance, die Sowjetunion durch einen Rüstungswettlauf in die Knie zu zwingen. (Münkler 2003, 71-75)
3. Der Zweite Golfkrieg
3.1 Verlauf des Zweiten Golfkrieges
Lässt sich der Erste Golfkrieg als ein weitestgehend symmetrisch betriebener Krieg beschreiben, so entpuppte sich der Zweite Golfkrieg als ein Konflikt, der in seinem gesamten Verlauf durch Asymmetrie gekennzeichnet war. Eine Überlegenheit der USA in den Luftstreitkräften strotzte den motorisierten und gepanzerten Landstreitkräften der irakischen Truppen. (Münkler 2003, 75) Aus dieser Asymmetrie heraus und den damit überschaubaren Einbußen der Amerikaner im Zweiten Golfkrieg, stellt dieser Krieg für die USA erneut ein Mittel der Politik und somit einen Wendepunkt in der Militär- und vor allem Politikgeschichte dar. (Münkler 2003, 96)
Der Krieg zwischen Kuwait und Irak war eher ein einseitiger Vollzug eines politischen Willens mit gewaltsamen Mitteln, als ein krisenreicher Krieg mit unvorhergesehenen Ereignissen. Er dauerte von August 1990 bis März 1991. Zwar ging aus dem Ersten Golfkrieg der Irak als ein militärisch überlegener Gewinner dem Iran gegenüber hervor, die wirtschaftliche Stärke des Landes jedoch war extrem geschwächt. (Hellmann 1993, 234)
Eine erfolgreiche Annexion Kuwaits hätte also dem Irak entscheidende wirtschaftliche Erfolge gebracht. Neben der Erholung von dem teuren Krieg gegen den Iran, hätte der Irak durch die Eroberung Kuwaits rund 20 Prozent und damit das Doppelte des bisherigen weltweiten Erdölvorkommens erzielt. Somit wären Einnahmeerhöhnungen und die irakische Position in der Öl-Preisgestaltung im Rahmen der OPEC um das Doppelte gesichert gewesen. (Hippler 1992, 86)
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836632003
- Dateigröße
- 346 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Humboldt-Universität zu Berlin – Soziologie, Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- golfkrieg völkerrecht massenvernichtungswaffen ökonomie krieges asymmetrie
- Produktsicherheit
- Diplom.de