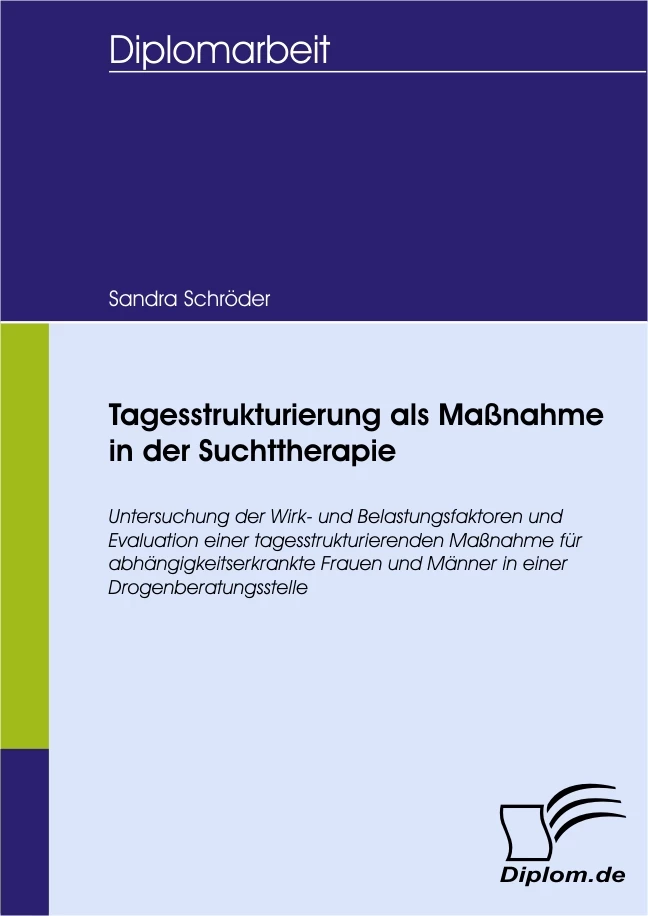Tagesstrukturierung als Maßnahme in der Suchttherapie
Untersuchung der Wirk- und Belastungsfaktoren und Evaluation einer tagesstrukturierenden Maßnahme für abhängigkeitserkrankte Frauen und Männer in einer Drogenberatungsstelle
©2009
Diplomarbeit
297 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ich hab´ mir oft gesagt: Hast Du ein Glück gehabt, dass Du den Weg hier her gefunden hast!.
So oder ähnlich äußerten sich die von mir befragten ehemaligen Teilnehmer einer Tagesstrukturierenden Maßnahme immer wieder. Sie hatten irgendwann den Entschluss gefasst, etwas gegen ihre Suchterkrankung zu unternehmen und den meisten gelang, worauf Millionen Betroffene hoffen: Sie leben heute ein zufriedenes, abstinentes Leben. Das erreichten sie nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an einem wunderbaren Projekt: Eine Tagesstrukturierende Maßnahme für Menschen mit Suchtproblematiken, die sich endlich aus ihrer Abhängigkeit befreien wollen. Hier finden sie tatkräftige Unterstützung, ein offenes Ohr und einen Ort, an dem sie ohne Scham über ihre Sorgen und Nöte sprechen können.
Das die Notwendigkeit des Ausbaus, vor allem ambulanter Therapieplätze im Bereich der Suchterkrankungen, besteht, ist ohne Zweifel. Meldungen, wie die des Online-Magazins Focus, Deutsche sind Schluckspechte! sollten uns aufhorchen lassen. Im Schnitt trinkt jeder Bundesbürger, nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), mehr als 10 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Deutschland nimmt damit einen traurigen Spitzenplatz innerhalb Europas ein. Und der Stoff fordert seinen Tribut: Jährlich sterben ca. 23.000 Deutsche zwischen 20 und 65 Jahren an den Folgen ihres hohen Alkoholkonsums. 2005 starben insgesamt mehr Menschen in Folge ihres Alkoholkonsums als durch Suizide und Verkehrsunfälle zusammen. Im Jahr 2006 forderten die Volksdrogen Alkohol, Tabak und Medikamente erstmals mehr Kranke und Tote als die illegalen Drogen.
Nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten 7 g reinen Alkohols pro Tag als unbedenklich. Bedenkt man allerdings, das 0,33 Liter Bier bereits 13 g, ein Glas Wein oder Sekt (0,2 l) sogar 16 g, ein Kräuterlikör (2,0 cl) 5,2 g, ein Whiskey (2,0 cl) 7 g und ein Korn (2,0 cl) 5 g reinen Alkohol enthalten, wird klar, wie schnell diese, als unbedenklich geltende Grenze überschritten ist. Hinzu kommt, dass an mindestens vier Tagen pro Woche laut WHO-Empfehlung kein Alkohol konsumiert werden sollte.
Geht man einmal mit offenen Augen zu etwas späterer Stunde über Stadtfeste, wird schnell klar, dass nicht viele Bundesbürger mit den Empfehlungen der WHO vertraut zu sein scheinen
So fehlt es unseren Kindern und Jugendlichen viel zu oft an konstruktiven Beispielen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge […]
Ich hab´ mir oft gesagt: Hast Du ein Glück gehabt, dass Du den Weg hier her gefunden hast!.
So oder ähnlich äußerten sich die von mir befragten ehemaligen Teilnehmer einer Tagesstrukturierenden Maßnahme immer wieder. Sie hatten irgendwann den Entschluss gefasst, etwas gegen ihre Suchterkrankung zu unternehmen und den meisten gelang, worauf Millionen Betroffene hoffen: Sie leben heute ein zufriedenes, abstinentes Leben. Das erreichten sie nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an einem wunderbaren Projekt: Eine Tagesstrukturierende Maßnahme für Menschen mit Suchtproblematiken, die sich endlich aus ihrer Abhängigkeit befreien wollen. Hier finden sie tatkräftige Unterstützung, ein offenes Ohr und einen Ort, an dem sie ohne Scham über ihre Sorgen und Nöte sprechen können.
Das die Notwendigkeit des Ausbaus, vor allem ambulanter Therapieplätze im Bereich der Suchterkrankungen, besteht, ist ohne Zweifel. Meldungen, wie die des Online-Magazins Focus, Deutsche sind Schluckspechte! sollten uns aufhorchen lassen. Im Schnitt trinkt jeder Bundesbürger, nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS), mehr als 10 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Deutschland nimmt damit einen traurigen Spitzenplatz innerhalb Europas ein. Und der Stoff fordert seinen Tribut: Jährlich sterben ca. 23.000 Deutsche zwischen 20 und 65 Jahren an den Folgen ihres hohen Alkoholkonsums. 2005 starben insgesamt mehr Menschen in Folge ihres Alkoholkonsums als durch Suizide und Verkehrsunfälle zusammen. Im Jahr 2006 forderten die Volksdrogen Alkohol, Tabak und Medikamente erstmals mehr Kranke und Tote als die illegalen Drogen.
Nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten 7 g reinen Alkohols pro Tag als unbedenklich. Bedenkt man allerdings, das 0,33 Liter Bier bereits 13 g, ein Glas Wein oder Sekt (0,2 l) sogar 16 g, ein Kräuterlikör (2,0 cl) 5,2 g, ein Whiskey (2,0 cl) 7 g und ein Korn (2,0 cl) 5 g reinen Alkohol enthalten, wird klar, wie schnell diese, als unbedenklich geltende Grenze überschritten ist. Hinzu kommt, dass an mindestens vier Tagen pro Woche laut WHO-Empfehlung kein Alkohol konsumiert werden sollte.
Geht man einmal mit offenen Augen zu etwas späterer Stunde über Stadtfeste, wird schnell klar, dass nicht viele Bundesbürger mit den Empfehlungen der WHO vertraut zu sein scheinen
So fehlt es unseren Kindern und Jugendlichen viel zu oft an konstruktiven Beispielen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sandra Schröder
Tagesstrukturierung als Maßnahme in der Suchttherapie
Untersuchung der Wirk- und Belastungsfaktoren und Evaluation einer
tagesstrukturierenden Maßnahme für abhängigkeitserkrankte Frauen und Männer in
einer Drogenberatungsstelle
ISBN: 978-3-8366-3469-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Oldenburg, Deutschland, Diplomarbeit,
2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
DANKSAGUNG
In erster Linie gilt mein Dank den befragten Teilnehmern dieser Studie.
Ich danke Euch, für Eure Offenheit und Ehrlichkeit. Ohne Euch hätte diese
Arbeit nie verfasst werden können. Vor Eurer Leistung, vor Eurem Mut und
vor Eurer Stärke verbeuge ich mich.
Und natürlich spreche ich auch der Institution, innerhalb derer die vorlie-
gende Untersuchung stattgefunden hat, meine Dankbarkeit aus. Ihr habt
diese Arbeit erst möglich gemacht. Ohne Eure Bereitschaft und euer Mit-
wirken hätte ich diese Arbeit nie schreiben können. Ich danke Euch für
diese Möglichkeit.
Mein ganzer Dank gilt auch Herrn Dr. rer. nat. Andreas Hellmann, der mich
und mein Wirken mit unerschütterlicher Geduld begleitet hat.
Ich danke Ihnen, dass Sie die Muße hatten, sich meiner Thematik anzuneh-
men und mir in dieser wichtigen Zeit zur Seite zu stehen. Ohne Ihre Bereit-
schaft mich zu unterstützen, hätte ich nicht dieses, mir am Herzen liegende
Thema behandeln können. Ich werde Sie wohl nie vergessen. Danke dafür.
Meiner Familie gebührt an dieser Stelle ein ganz besonderer Dank:
Meinem Mann Jörg, ohne dessen wunderbare Unterstützung und Geduld
weder mein Studium noch die hier vorliegende Arbeit möglich gewesen
wäre. Ohne Dich wäre ich nicht die, die ich bin und ohne Dich wäre mein
Leben leer und nicht mein Leben. Ich liebe Dich von ganzem Herzen.
Weißt du, dass du nun lange Zeit nicht mehr beim Abfragen einschlafen
musst?
Ein weiterer Dank gilt meinen Kinder Jonas, Kilian und Thalia, denen ich
diese Arbeit in tiefer Liebe widme. Ihr seid wundervolle Menschen - ohne
Euch wäre mein Leben einfach nicht vollständig. Ihr habt mir Flügel
verliehen und mich über mich selbst hinaus wachsen lassen!
Nicht zuletzt will ich auch meinen Eltern und Schwiegereltern danken:
Meinen Eltern Irmgard und Ferdinand, weil sie mir all die Fähigkeiten
verliehen haben, auch steinige Pfade zu bestreiten und doch immer den
richtigen Weg wiederzufinden. Ich liebe und ich danke Euch von ganzem
Herzen.
Meinen Schwiegereltern Henny und Walter, weil sie uns während der Zeit
meines Studiums mit all der ihnen zu Verfügung stehenden Kraft unterstütz-
ten. Auch Euch gilt meine Liebe und mein Dank.
Oldenburg, den 16.06.2009
Ich bin mächtiger als alle Armeen der Welt.
Ich habe mehr Menschen kaputtgemacht als alle Kriege.
Ich habe Millionen von Verkehrsunfällen verursacht und mehr Heime und Familien
zerstört
als alle Sturmfluten und Überschwemmungen zusammen.
Ich bin der gemeinste Dieb der Welt.
Ich stehle jedes Jahr Milliarden.
Ich finde meine Opfer sowohl unter den Reichen als auch unter den Armen,
unter Jungen
ebenso unter den Alten, unter Starken und Schwachen.
Ich bin ruhelos, heimtückisch und unvorhersehbar.
Ich bin überall Zuhause,
auf der Straße,
in der Fabrik,
im Büro,
auf der See und in der Luft.
Ich bringe Krankheit, Armut und Tod.
Ich gebe nichts und nehme alles.
Ich bin dein ärgster Feind.
Ich bin der Alkohol.
Quelle: Qua Tögti, Vol.9, No. 27
amedian Vol. 12, No. 4/84
Tagesstrukturierung als Maßnahme in der
Suchttherapie
- Untersuchung der Wirk- und Belastungsfaktoren und Evaluation einer
tagesstrukturierenden Maßnahme für abhängigkeitserkrankte Frauen und
Männer in einer Drogenberatungsstelle -
ZUSAMMENFASSUNG
1. EINLEITUNG 4
2. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM UNTER-
SUCHUNGSBEREICH 9
.1 Historischer Abriss
9
.2 Struktur der heutigen Arbeiterwohlfahrt (AWO)
11
.3 Kernpunkte des AWO´schen Handelns
12
.4 Skizzierung der Unternehmesgruppe AWO Trialog gGmbH
14
.1 Leitbild der AWO Trialog gGmbH 14
3. BESCHREIBUNG DER ANONYMEN DROGENBE-
RATUNG
18
.1 Zugrundeliegende Konzeption
18
.2 Klientenbezogene Angebote 20
.3 Statistik der Drogenberatung
aus den Jahren 2005/2006 25
4. DIE TAGESSTRUKTURIERENDE MASSNAH-
ME 34
.1 Tagesstrukturierung als Maßnahme in der Suchttherapie
Versuch einer Definition
34
.2 Detaillierte Darstellung der Tagesstrukturierenden Maß-
nahme
36
5. FRAGESTELLUNG 45
.1 Entwicklung der Fragestellung
46
.2 Konkretisierung der Fragestellung und kurze Vorstellung
der Erhebungs- und Auswertungsinstrumente
47
6. METHODIK 49
.1 Skizzierung der befragten Stichprobe
49
.1 Stichprobengewinnung 50
.2 Komplikationen bei der Stichprobengewinnung 51
.2 Entwicklung der Untersuchungsinstrumente 52
.1 Die Zielexplikation 53
.2 Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Untersuchungs-
instrumente 55
.3 Der Interview-Leitfaden 57
.1 Konstruktion des Interview-Leitfadens 58
.2 Konstruktion des Fragebogens 60
.3 Pretest 62
.1 Expertenprüfung der Erhebungsinstrumente 62
.2 Durchführung des konventionellen Pretests und daraus
resultierende Veränderungen am Interview-Leitfaden
und der Datenerhebung 63
.4 Forschungsdesign 64
.1 Ablauf der Datenerhebung 65
.2 Fixierung der Rohdaten 67
.5 Verfahren der Datenauswertung
68
.1 Prozess der induktiven Kategorienbildung 69
7. ERGEBNISDARSTELLUNG UND INTERPRE-
TATION 74
.1 Darstellung der gesammelten Fragestellung 75
.2 Kategoriensystem potentieller Wirkfaktoren einer Tages-
strukturierenden Maßnahme für abhängigkeitserkrankte
Frauen und Männer
77
.1 Häufigkeitsanalysen der Subkategorien potentieller Wirkfak-
toren 81
.1 Kategorie W1 Individuelle Unterstützung der Teilnehmer 83
.2 Kategorie W2 Zugang zur Maßnahme 84
.3 Kategorie W3 Förderung eigener Ressourcen 86
.4 Kategorie W4 Erlangung und Aufrechterhaltung der Absti-
nenz
90
.1 Exkurs 1: Beobachtung von Rückfällen: Belastende oder
lehrreiche Erfahrung? 96
.2 Exkurs 2: Neue Freunde für ein neues Leben?
Auflösung der sozialen Isolation und die Bedeutung
eines Wechsels des sozialen Umfeldes für die Abstinenz 100
.5 Kategorie W5 Soziale Interaktion innerhalb der Maßnahme 103
.1 Exkurs 3: ,,Der Nachwuchs muss lernen!"
Wie die Teilnehmer Praktikanten der Maßnahme bewerten 105
.6 Kategorie W6 Restkategorie 108
.7 Exkurs 4: Feststellung der Zufriedenheit der Teilnehmer
mit der Maßnahme 108
.3 Kategoriensystem potentieller Belastungsfaktoren einer
Tagesstrukturierenden Maßnahme für abhängigkeitser-
krankte Frauen und Männer
110
.1 Häufigkeitsanalysen der Subkategorien potentieller Belastungs-
faktoren 114
.1 Kategorie B1 Belastung zu Beginn der Teilnahme 115
.2 Kategorie B2 Belastende Aspekte während der Teilnahme 118
.3 Kategorie B3 Mangelndes Krankheitsverständnis vor bzw.
zu Beginn der Teilnahme
122
.4 Kategorie B4 Spezifische Maßnahmenaspekte 123
.5 Allgemeine Kritik/Restkategorie 131
.4 Ergebnisdarstellung der geschlossenen Fragen des Frage-
bogens
133
.5 Abschließende Schlussfolgerungen bezüglich der gefundenen
Ergebnisse
137
.6 Letzte Bemerkungen und erste Empfehlungen für die Insti.
tution auf Grundlage der Ergebnisse
140
8. DISKUSSION & AUSBLICK
145
.1 Beantwortung der Fragestellung anhand der Arbeit 145
.2 Kritische Betrachtung des Kategoriensystems
146
.3 Die extrahierten potentiellen Wirk- und Belastungsfaktoren
147
.4 Kritische Betrachtung des Vorgehens bei der formativen
Evaluation
153
.5 Die Gruppe der befragten Teilnehmer
154
.6 Letzter Ausblick
156
9. Literaturverzeichnis 157
Anhang
161
A____ Erhebungsinstrumente:
Interview-Leitfaden 163
Fragebogen und Rating-Skala 165
B____ Interviewprotokolle 169
C____ Kategoriensystem potentieller Wirkfaktoren 218
D____ Kategoriensystem potentieller Belastungsfaktoren 256
E____ Differente Kategorisierung des externen Raters 282
Tabellenverzeichnis: Seite
Tabelle 1 Verteilung der Gesamtanzahl der Klienten
2005/2006... 25
Tabelle 2 Verteilung der Klienten nach Geschlecht aus
2005/2006 in Prozent... 27
Tabelle 3 Hierarchie der Problembereiche der Direktbetrof-
fenen (ohne Angehörige) der Jahre 2005/2006... 28
Tabelle 4 Hierarchie der Problembereiche der Angehörigen
der Jahre 2005/2006... 29
Tabelle 5 Hierarchie der Problembereiche der direkt betrof-
fenen Personen und Angehörigen aus 2005/2006... 30
Tabelle 6 Statistik der Tagesstrukturierenden Maßnahme der
Jahre 2005/2006... 32
Tabelle 6.1 Beendigungsart der Tagesstrukturierenden Maßnahme
in den Jahren 2005/2006... 32
Tabelle 6.2 Weiterer Verlauf der Teilnehmer die die Maßnahme
planmäßig abschlossen aus den Jahren 2005/2006;
Alle Angaben in Prozent... 33
Tabelle 7 Demografische Daten der ermittelten Stichprobe... 50
Tabelle 8 Themenblöcke des Leitfaden-Interviews... 59
Tabelle 9 Ankerbeispiele der Kategorie W1 Individuelle Unter-
stützung der Teilnehmer
... 78
Tabelle 10 Ankerbeispiele der Kategorie W2 Zugang zur Maß-
nahme
... 78
Tabelle 11 Ankerbeispiele der Kategorie W3 Förderung eigener
Ressourcen
... 79
Tabelle 12 Ankerbeispiele der Kategorie W4 Erlangung und
Aufrechterhaltung der Abstinenz... 80
Tabelle 13 Ankerbeispiele der Kategorie W5 Soziale Interaktion
innerhalb der Maßnahme
... 81
Seite
Tabelle 14 inhaltlicher Überblick über die Aussagen der Teil-
nehmer bezüglich der Leitfrage 5: ,,Wie haben Sie
Rückfälle anderer Teilnehmer empfunden"? ... 97
Tabelle 15 inhaltlicher Überblick über die Aussagen der Teil-
nehmer bezüglich der Leitfrage 2: ,,Unterstützte die
Maßnahme Sie dabei, neue Kontakte zu knüpfen?"
und die Nachfrage: ,,Sind dabei Freundschaften ent-
standen?"... 101
Tabelle 16 Zusammenhang zwischen abstinenter Lebensweise und
sozialer Neuorientierung der Teilnehmer... 103
Tabelle 17 inhaltliche Wiedergabe der Äußerungen auf die Nach-
frage der Leitfrage 7: ,,Wie haben Sie die Anwesenheit
von Praktikanten erlebt?"... 106
Tabelle 18 Gründe der befragten Teilnehmer für einen eventuellen
Wiederbesuch der Tagesstrukturierenden Maßnahme... 109
Tabelle 19 Ankerbeispiele der Kategorie B1 Belastungen zu Be-
ginn der Teilnahme... 110
Tabelle 20 Ankerbeispiele der Kategorie B2 Belastende Aspekte
während der Teilnahme
... 111
Tabelle 21 Ankerbeispiele der Kategorie B3 Mangelndes Krank-
heitsverständnis vor bzw. zu Beginn der Maßnahme... 112
Tabelle 22 Ankerbeispiele der Kategorie B4 Spezifische Maß-
nahmenaspekte... 113
Tabelle 23 inhaltliche Wiedergabe der Aussagen zu den Fragen:
,,Wurden Sie auf weiterführende Hilfen aufmerksam
gemacht?" und ,,Wie wurde mit erneutem Konsum
der Teilnehmer umgegangen?"... 129
Tabelle 24 inhaltliche Wiedergabe der Äußerungen der Teilnehmer
der Kategorie B5 allgemeine Kritik/Restkategorie...132
Abbildungsverzeichnis: Seite
Abb. 1 Auszug aus dem klientenbezogenen Angebot der Dro-
genberatung... 21
Abb. 2 Schematische Darstellung verschiedener Interventionsform-
en der Anonymen Drogenberatung, deren Ziele, Module und
Zielgruppen... 26
Abb. 3 Rückfallmodell nach Marlatt & Gordon (1985)... 44
Abb. 4 schematische Darstellung der Leitfadenkonstruktion... 60
Abb. 5 verwendete 5-stufige Rating-Skala (nach Rohrmann 1978)... 60
Abb. 6 Prozess der induktiven Kategorienbildung in Anlehnung
an Mayring (2008)... 70
Abb. 7 Häufigkeitsverteilung der Oberkategorien potentieller Wirk-
faktoren W1 W6... 82
Abb. 8 Häufigkeitsverteilung aller Subkategorien der potentiellen
Wirkfaktoren W1.1 W5.3... 82
Abb. 9 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien W1.1 und W1.2... 84
Abb. 10 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien W2.1 und W2.2... 86
Abb. 11 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien W3.1 W3.4... 90
Abb. 12 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien W4.1 W4.5... 100
Abb. 13 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien W5.1 W5.3... 107
Abb. 14 Häufigkeitsverteilung der Oberkategorien potentieller
Belastungsfaktoren B1 B5... 114
Abb. 15 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien potentieller
Belastungsfaktoren B1.1 B4.5... 115
Abb. 16 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien B1.1 B1.4... 117
Abb. 17 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien B2.1 B2.4... 121
Abb. 18 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien B3.1 B3.2... 123
Abb. 19 Häufigkeitsverteilung der Subkategorien B4.1 B4.5... 131
Abb. 20 Mittelwerte der Fragebogen-Items... 133
Abb. 21 Am häufigsten benannte Subkategorien potentieller Wirk-
faktoren... 137
Abb. 22 Am häufigsten benannte Subkategorien potentieller Belast-
ungsfaktoren... 140
Abkürzungen
Abb. Abbildung
AWO Arbeiterwohlfahrt
Bsp. Beispiel
bzw. beziehungsweise
ca. circa
d.h. das heißt
et al. (et alii) und andere
etc. et cetera (und die übrigen)
evt. eventuell
ggf. gegebenenfalls
gGmbH gemeinnützige Gesellschaft mit begrenzter Haftung
i.d.R. in der Regel
o.Ä. oder Ähnliches
o.g. oben genannten
Tab. Tabelle
u.Ä. und Ähnliches
z.B. zum Beispiel
TN Teilnehmer
TNnr. Teilnehmer Nummer
Zusammenfassung 1
ZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Studie behandelt einerseits die Ermittlung potentieller
Wirk- und Belastungsfaktoren einer Tagesstrukturierenden Maßnahme für
alkoholabhängige Frauen und Männer sowie eine formative Evaluation
ebendieser Maßnahme.
Zur Erhebung der notwendigen Daten wurde mit 10 ehemaligen Teilneh-
mern
1
der Maßnahme ein Interview durchgeführt. Die vorrangig inhaltsana-
lytische Datenauswertung erfolgte gemäß der qualitativen Inhaltsanalyse
nach Mayring. Die Aussagen der Teilnehmer wurden zu einem Kategorien-
system potentieller Wirk- und Belastungsfaktoren zusammengefasst.
Insgesamt konnten 16 Kategorien potentieller Wirkfaktoren extrahiert wer-
den, die sich auf sechs Oberkategorien verteilen. Als besonders wirksam,
weil am häufigsten von den Befragten benannt, haben sich acht Subkate-
gorien erwiesen. Zu diesen gehören die individuelle Unterstützung der Teil-
nehmer durch die Mitarbeiter, die Vermittlung von Stabilitäts- und Sicher-
heitsempfinden sowie die Veränderung (suchtspezifischer) Denk- und Sicht-
weisen durch die Teilnahme am Projekt. Aber auch die Vermittlung von
Coping-Strategien zum Umgang mit Suchtdruck und zur Rückfallprophy-
laxe und die Verbesserung der Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und
Grenzen und die Schulung der Selbstsorge gehören zu den am häufigsten
angegebenen potentiellen Wirkfaktoren. Zusätzlich wurden die allgemeinen
Umgangsformen innerhalb der Maßnahme sowie das positive, vor allem
wertschätzende, Verhalten der Mitarbeiter gegenüber den Teilnehmern als
besonders unterstützend von den Befragten hervorgehoben.
1
Der besseren Lesbarkeit halber wird in der nachfolgenden Konzeption auf die Nennung beider Geschlechts-
formen verzichtet und grundsätzlich die männliche Form auch dann gewählt, wenn beide Geschlechter gemeint
sind. Wenn also von Teilnehmern gesprochen wird, sind damit i. d. R. Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeint.
Zusammenfassung 2
Als potentielle Belastungsfaktoren konnten 15 Kategorien, verteilt auf fünf
Oberkategorien, identifiziert werden. Am häufigsten wurden hier vier Fak-
toren benannt: Zum einen traten die Teilnehmer mit ausgeprägten Belast-
ungen in die Maßnahme ein, wobei hier besonders der Verlust der Fähig-
keit zur konstruktiven Tagesstrukturierung und die v.a. psychologischen
Folgen der Substanzabhängigkeit aufgeführt wurden. Innerhalb der Maß-
nahme wurde das Miterleben und Beobachten von anhaltendem Alkohol-
konsum anderer Teilnehmer als belastend beschrieben, wobei ebendieses
Miterleben durchaus auch zum Aufbau von Krankheitseinsicht und der
Festigung der Abstinenzmotivation einen wichtigen Beitrag leistete. Weiter-
hin kritisierten die Befragten auch die, ihrer Ansicht nach, zu ,,weiche"/ver-
ständnisvolle Reaktion der Mitarbeiter auf anhaltenden Alkoholkonsum der
Teilnehmer. Zum anderen berichteten viele der ehemaligen Teilnehmer über
eine empfundene Über- oder Unterforderung im Projekt.
In Bezug auf den Evaluationsaspekt konnte festgestellt werden, dass die an-
versierten Ziele der Maßnahem größtenteils erreicht werden. So berichteten
die befragten Teilnehmer mit Ausnahme einer Person, dass sie die Maßnah-
me bei Bedarf auf jeden Fall wieder besuchen würden. Auch bei der Über-
nahme sozialer Verantwortung und der Auflösung der sozialen Isolation, in
der sie in Folge ihrer Substanzabhängigkeit lebten, konnten sie unterstützt
werden.
Gleichzeitig konnten Kritikpunkte an der Tagesstrukturierenden Maßnahme
aufgedeckt werden. Angegeben wurden hier vor allem das mangelnde
Freizeit- und Beschäftigungsangebot des Projektes, der Zeitmangel der
Mitarbeiter sowie die generelle personelle Unterbesetzung der Maßnahme.
Anhand der konstatierten Belastungsfaktoren hat die Drogenberatung, deren
Bestandteil die Tagesstrukturierende Maßnahme ist, die Möglichkeit, spezi-
fische Maßnahmenaspekte anzupassen oder zu korrigieren, um ihren selbst-
gesetzten Qualitätsstandart weiterhin garantieren zu können.
Zusammenfassung 3
Schlüsselwörter: Tagesstrukturierende Maßnahme,
Tagesstrukturierung, Suchtstörung,
Suchterkrankung, Alkoholabhängigkeit,
Alkoholsucht, Suchtberatung,
Rückfallprophylaxe,
Arbeiterwohlfahrt(AWO), Fragebogen,
halb-strukturiertes Leitfadeninterview,
Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring,
anwendungsorientierte Evaluation,
formative Evaluation
Einleitung 4
1 EINLEITUNG
,,Ich hab´ mir oft gesagt: Hast Du ein Glück gehabt, dass Du den Weg hier
her gefunden hast
!".
So oder ähnlich äußerten sich die von mir befragten ehemaligen Teilnehmer
einer Tagesstrukturierenden Maßnahme immer wieder. Sie hatten irgend-
wann den Entschluss gefasst, etwas gegen ihre Suchterkrankung zu unter-
nehmen und den meisten gelang, worauf Millionen Betroffene hoffen: Sie
leben heute ein zufriedenes, abstinentes Leben. Das erreichten sie nicht zu-
letzt durch ihre Teilnahme an einem wunderbaren Projekt: Eine Tagesstruk-
turierende Maßnahme für Menschen mit Suchtproblematiken, die sich end-
lich aus ihrer Abhängigkeit befreien wollen. Hier finden sie tatkräftige Un-
terstützung, ein offenes Ohr und einen Ort, an dem sie ohne Scham über ihre
Sorgen und Nöte sprechen können.
Das die Notwendigkeit des Ausbaus, vor allem ambulanter Therapieplätze
im Bereich der Suchterkrankungen, besteht, ist ohne Zweifel. Meldungen,
wie die des Online-Magazins Focus, ,,Deutsche sind Schluckspechte!"
(www.focus.de) sollten uns aufhorchen lassen. Im Schnitt trinkt jeder Bun-
desbürger, nach Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS),
mehr als 10 Liter reinen Alkohol pro Jahr. Deutschland nimmt damit einen
traurigen Spitzenplatz innerhalb Europas ein. Und der Stoff fordert seinen
Tribut: Jährlich sterben ca. 23.000 Deutsche zwischen 20 und 65 Jahren an
den Folgen ihres hohen Alkoholkonsums. 2005 starben insgesamt mehr
Menschen in Folge ihres Alkoholkonsums als durch Suizide und Verkehrs-
unfälle zusammen (www.destatis.de). Im Jahr 2006 forderten die Volksdro-
gen Alkohol, Tabak und Medikamente erstmals mehr Kranke und Tote als
die illegalen Drogen (www.destatis.de).
Nach Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gelten 7 g
reinen Alkohols pro Tag als unbedenklich. Bedenkt man allerdings, das 0,33
Einleitung 5
Liter Bier bereits 13 g, ein Glas Wein oder Sekt (0,2 l) sogar 16 g, ein
Kräuterlikör (2,0 cl) 5,2 g, ein Whiskey (2,0 cl) 7 g und ein Korn (2,0 cl) 5 g
reinen Alkohol enthalten, wird klar, wie schnell diese, als unbedenklich gel-
tende Grenze überschritten ist. Hinzu kommt, dass an mindestens vier Ta-
gen pro Woche laut WHO-Empfehlung kein Alkohol konsumiert werden
sollte.
Geht man einmal mit offenen Augen zu etwas späterer Stunde über Stadt-
feste, wird schnell klar, dass nicht viele Bundesbürger mit den Empfehlung-
en der WHO vertraut zu sein scheinen...
So fehlt es unseren Kindern und Jugendlichen viel zu oft an konstruktiven
Beispielen, um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Droge Alkohol
zu erlernen. Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes vom 13.06.2007
müssen immer mehr Kinder und Jugendliche aufgrund akuten Alkoholmiss-
brauchs stationär in Krankenhäusern behandelt werden. Wurden im Jahr
2000 noch 9500 Kinder und Jugendliche (10 - unter 20 Jahre) mit einer aku-
ten Alkoholintoxikation in Krankenhäusern behandelt, wuchs deren Anzahl
innerhalb von nur fünf Jahren um 104% auf 19.400. Fast 3500 dieser Patien-
ten waren gerade einmal zwischen 10 und 15 Jahren jung!
Koma-Saufen und Flatrate-Trinken sind seit geraumer Zeit Begriffe, mit de-
nen Horrormeldungen überschrieben werden: 13-jährige werden mit mehr
als 3 Promille Alkoholkonzentration im Blut in Notaufnahmen eingeliefert,
ein 18-jähriger erfriert in der Silvesternacht, weil er im Vollrausch die Kälte
nicht mehr spürt (www.bild.de). Ein Mädchen, dass seinen 13. Geburtstag
beinahe nicht überlebt hätte, weil sein junger Körper den Wodka-Cola-Mix,
den es an seinem Kindergeburtstag mit anderen Kids in sich hinein schütte-
te, nicht verkraften konnte (www.bild.de). Seiten ließen sich mit diesen
Schreckensmeldungen füllen!
Gibt man bei google den zweifelhaften Begriff ,,Koma Saufen" ein, werden
207.000 Ergebnisse angezeigt. Auf verschiedenen Wegen versucht die Poli-
tik diesem Phänomen Einhalt zu gebieten. Und das sollte sie auch. Sicher
werden nicht alle jugendlichen ,,Alkoholsünder" eine Abhängigkeit von der
Droge entwickeln, sicher ist aber auch, dass die Zahl der Alkoholabhäng-
Einleitung 6
igen künftig nicht rückläufig sein wird. Der volkswirtschaftliche Schaden,
der durch diese Substanzabhängigkeit hervorgerufen wird, ist schon heute
enorm. Die DHS sprach 2004 von einem Gesamtschaden in Höhe von rund
20,6 Mrd. Euro (Bund gegen gesundheitsschädlichen Alkoholkonsum,
BggA). In einem Artikel über die neuen ärztlichen Aufgaben bei Patienten
mit Alkoholproblemen (Mann, 2002) wird von insgesamt ca. 9,3 Millionen
Deutschen mit behandlungsbedürftigen Alkoholproblemen ausgegangen.
Etwa 1,6 Millionen davon leiden unter ihrer Alkoholabhängigkeit. Ca. 2,7
Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in schädlicher
Weise, sie trinken also, obwohl der Alkohol ihrer Gesundheit schadet und
sie sich deshalb immer wieder mit ihrer Familie, ihrer Partnerin/ihrem Part-
ner oder Freunden streiten. Ungefähr 5 Millionen Menschen weisen hierzu-
lande einen riskanten Alkoholkonsum auf, was bedeutet, dass Männer täg-
lich mehr als 30 g, Frauen täglich mehr als 20 g reinen Alkohols konsumier-
en.
Diese Zahlen, die von anderen Stellen teilweise noch höher geschätzt
werden, sollten alarmieren und klar machen, wie wichtig Aufklärung und
Prävention und letztlich die Behandlung der Suchterkrankung ist. In ambu-
lanten oder stationären Rehabilitationen können die Alkoholabhängigen ler-
nen, ihre Erkrankung zum Stillstand zu bringen und konstruktiv mit dieser
zu leben. Tagesstrukturierende Maßnahmen, wie die, um die es zentral in
der vorliegenden Studie geht, stellen eine wichtige Unterstützung für die
Betroffenen auf ihrem Weg in ein abstinentes Leben dar.
Obwohl Tagesstrukturierende Maßnahmen als Soziotherapie weit verbreitet
sind, bleiben Recherchen nach Publikationen weitestgehend erfolglos. Es
ließ sich auch feststellen, dass kein offizieller Standard existiert, der eine
Qualitätssicherung und kontrolle der einzelnen Angebote erlaubt, obwohl
die Institutionen der ambulanten Drogenhilfe allgemein mit Qualitätssiegeln
werben. Folglich wurde bislang noch nicht geklärt, welche potentiellen
Wirk- und Belastungsfaktoren innerhalb dieser Maßnahme zum Tragen
kommen. Sind diese aber identifiziert, so kann auch geklärt werden, welche
Einleitung 7
Bestandteile diese Maßnahmen enthalten und unterstützen sollten, um eine
hohe Wirksamkeitswahrscheinlichkeit zu haben oder welche Faktoren als
potentielle Belastungsfaktoren der Klienten besonders beachtet werden müs-
sen, damit der Erfolg der Maßnahme nicht gemindert oder gefährdet wird.
Genau wie der fehlende Standard ist auch noch keine offizielle Definition
Tagesstrukturierender Maßnahmen existent.
Die vorliegende Arbeit soll einen ersten Schritt der Grundlagenforschung im
Bereich Tagesstrukturierender Maßnahmen in der Suchttherapie darstellen
und versucht einen Beitrag zu leisten, das bestehende Defizit zu beheben.
Die Arbeit beginnt mit allgemeinen Informationen zum Untersuchungsbe-
reich. Hier wird die Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Trägerin der
untersuchten Tagesstrukturierenden Maßnahme ist, mit ihrer Historie und
ihrem Leitbild vorgestellt.
In Kapitel 3 folgt die Beschreibung der anonymen Drogenberatung, an die
die Maßnahme angeschlossen ist. Betrachtet wird hier die zugrundeliegende
Konzeption der Drogenberatung, ihre klientenbezogenen Angebote sowie
die Statistik der Einrichtung aus den Jahren 2005 und 2006.
Kapitel 4 widmet sich der ausführlichen Betrachtung der Tagesstrukturier-
enden Maßnahme. Außerdem wird hier eine erste Definition für den Begriff
,,Tagesstrukturierende Maßnahme" vorgestellt.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der Fragestellung der vorliegenden Studie
und deren Entwicklung liefert Kapitel 5. Daran schließt sich die Beschrei-
bung des methodischen Vorgehens in Kapitel 6 an. Hier wird die befragte
Stichprobe skizziert, das Vorgehen ihrer Gewinnung sowie die Komplika-
tionen dabei beschrieben, die Entwicklungsschritte der Untersuchungsin-
strumente aufgezeigt und der Ablauf der Datenerhebung nachgezeichnet.
Kapitel 7 widmet sich dann der Darstellung und Interpretation der Ergeb-
nisse. Hier werden die festgestellten potentiellen Wirk- und Belastungsfak-
toren sowie die Ergebnisse der formativen Evaluation vorgestellt.
Einleitung 8
Kapitel 8 dient abschließend einem Resümee: Hier soll geklärt werden, in-
wieweit die Fragestellungen mit Hilfe der Studie geklärt werden konnten.
Außerdem werden das Kategoriensystem sowie die extrahierten potentiellen
Wirk- und Belastungsfaktoren kritisch beleuchtet. Außerdem werden Über-
einstimmungen zwischen den in der Literatur benannten Therapiezielen und
den hier extrahierten potentiellen Wirk- und Belastungsfaktoren aufgezeigt.
Ebenfalls soll die Effektivität der Vorgehensweise bei der formativen Eva-
luation betrachtet werden. Auch die Zusammensetzung der befragten Teil-
nehmer wird an dieser Stelle noch einmal kritisch betrachtet und eventuelle
Nachteile der Auswahl werden benannt. Letztlich sollen hier noch Vorschlä-
ge für Folgeuntersuchungen gemacht werden.
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 9
2 ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM
UNTERSUCHUNGSBEREICH
Im Folgenden soll der Gegendstandbereich der vorliegenden Untersuchung
genauer beleuchtet werden. Dazu erfolgt zunächst ein historischer Überblick
über die Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO), worauf eine Beschreib-
ung der Struktur der heutigen AWO folgt. Des Weiteren soll kurz der Leit-
gedanke des Verbandes dargestellt und die Unternehmensgruppe AWO
Trialog mit ihrem Leitbild skizziert werden.
Sämtliche hier benannten Daten sind der Internet-Homepage der AWO ent-
nommen.
2.1 Historischer Abriss der AWO
Die AWO wurde am 13.12.1919 von der Sozialdemokratin Marie Juchacz
als Element der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung gegründet. Beweg-
gründe dieses Aufbaus waren zum einen die Not und der Hunger, den Milli-
onen von Menschen nach dem ersten Weltkrieg erleiden mussten. Hinzu
kam, dass keinerlei soziale Hilfen existierten. Diese Massenverelendung
forderte Selbsthilfe und tatkräftige Solidarität von vielen freiwillig Helfen-
den. Zu dieser Zeit wurde diese Hilfe von verschiedenen Organisationen der
Arbeiterbewegung geleistet und so war es nahe liegend, aus diesen verschie-
denen eine einzige sozialdemokratische Wohlfahrtsorganisation aufzubauen.
Zum anderen verfolgte die neu gegründete AWO aber auch das politische
Ziel, die unterdrückte Armenpflege des alten Kaiserreiches, die den Gedan-
ken an Almosen in sich trug, durch eine moderne Wohlfahrtspflege abzulö-
sen.
In den 1920er Jahren entstanden im Namen der AWO vielzählige Dienst-
leistungen und Einrichtungen, wie Nähstuben, Werkstätten, Beratungsstel-
len und Mittagstische, außerdem wurden sozialdemokratische Frauen und
Männer in sozialen Berufen ausgebildet. Die Zielsetzung der AWO bestand
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 10
vor allem in der Linderung der vorherrschenden Not, der Verbesserung der
Wohlfahrtsleistungen und in der Anwendung moderner sozialpädagogischer
Methoden. Ihre soziale Hilfsarbeit war aufgrund der damaligen Notverord-
nungen, die die spärlichen sozialen Rechtsansprüche und leistungen der
Menschen noch weiter einschränkten, der Weltwirtschaftskrise und der in-
stabilen Sachlage innerhalb der Weimarer Demokratie unentbehrlich. Da die
AWO in dieser Zeit bereits die Hilfsorganisation für sämtliche bedürftigen
Menschen darstellte, wurde sie 1926 als Reichsspitzenverband der freien
Wohlfahrtspflege anerkannt. Im Jahr 1931 waren im Namen der AWO
135.000 Menschen ehrenamtlich innerhalb der Kindererholung und im Kin-
derschutz, in der Altenbetreuung, in Notstandsküchen, Werkstätten für Er-
werbslose und Behinderte und in Nähstuben tätig.
Kurze Zeit nach der Machtergreifung Hitlers 1933, wurde der Verband von
den Nationalsozialisten verboten und zwangsweise aufgelöst. Es wurde die
Order erlassen, die AWO im Sinne des nationalsozialistischen Denkens um-
zustrukturieren, damit diese folgenden Wohlfahrtseinrichtungen als Vorbild
diene. Allerdings weigerten sich die Mitglieder, Helfer und Funktionäre,
diesem Beschluss Folge zu leisten. So wurde sämtliches Vermögen sowie
die Einrichtungen und Heime der Organisation von den Nationalsozialisten
beschlagnahmt und die führenden Persönlichkeiten der AWO verfolgt. Die
Hilfe indes ging, solange dies irgend möglich war, in der Illegalität weiter.
Die Gründerin Marie Juchacz musste Deutschland verlassen und floh in die
USA.
Als 1945 das Ende des Zweiten Weltkrieges eintrat, begann bald darauf
auch ein Wiederaufbau der AWO. 1946 wurde diese dann allerdings als par-
teipolitisch unabhängige und selbstständige Organisation neu aufgebaut. In-
nerhalb der sowjetisch besetzten Ostzone jedoch blieb die AWO auch wie-
terhin verboten, so dass diese dort erst wieder ein Jahr nach dem Mauerfall
1989 ihre Arbeit aufnehmen konnte. 1949 bestand das Hilfswerk in den
Westzonen und Berlin bereits wieder aus 50.000 ehrenamtlich Helfenden
und 300.000 Anhängern und Mitgliedern. In diesem Jahr kehrte auch Marie
Juchacz aus den USA nach Deutschland zurück.
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 11
In den Nachkriegsjahren wurden unter der Schirmherrschaft und mit der tat-
kräftigen Unterstützung der bei der AWO Schaffenden Kindergärten und
Horte neu eingerichtet, Volksküchen aufgebaut, es erfolgte eine Betreuung
und Versorgung von Kriegsgefangenen und deren Angehörigen. Eine
Schwesternschule und eine AWO-Schwesternschaft wurden gegründet.
Nach und nach wurde die AWO in allen Bereichen der sozialen Arbeit tätig.
1959 zählte die AWO 300.000 Mitglieder und setzte sich aus 5000 Ortsver-
einen zusammen. Zu ihren Dienstleistungen gehörten 353 Heime und 250
Kindergärten. 4000 hauptberufliche Mitarbeiter und mehr als 70.000 ehren-
amtlich tätige Menschen führten die sozialen Tätigkeiten aus.
Heute ist die AWO flächendeckend in allen Bundesländern tätig. So wie
sich die Arbeits- und Berufswelt und die Technologie im vergangenen Jahr-
hundert gewandelt haben, haben sich auch die Aufgaben der AWO verän-
dert. Auch wenn der von der AWO angestrebte soziale Rechtsstaat grundle-
gend realisiert werden konnte, stellt der Verband noch immer die Forderung
nach Reformen und Verbesserungen innerhalb der Sozial-, Gesundheits-
und Familienpolitik sowie in der allgemeinen Fürsorge um den Menschen
und deren Sicherung. Im Wandel der Gesellschaft hat sie neue Aufgaben
übernommen, wie die Betreuung ausländischer Mitbürger, ambulante und
stationäre Altenpflege, Suchtberatung und sozialpsychologische Betreuung.
Der anfängliche Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe hat heute indessen nach
wie vor Gültigkeit. In der Gegenwart zeigt sich die AWO als moderner so-
zialpolitischer Interessenverband, der die Belange aller von der Gesellschaft
Benachteiligter vertritt und stellt gleichzeitig einen sozialen Dienstleister
dar, der eigene Einrichtungen in allen Bereichen der sozialen Arbeit unter-
hält (AWO, 2008).
2.2 Struktur der heutigen Arbeiterwohlfahrt
Heute gehört die AWO zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege in Deutschland. Dabei vertritt der Bundesverband die fachpoli-
tischen Interessen des Gesamtverbandes auf bundespolitischer und europä-
ischer Ebene. Des Weiteren nimmt dieser für die Organisation Aussenver-
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 12
tretungen in Stiftungen, Hilfswerken, anderen Fachverbänden und Netzwer-
ken auf nationaler und europäischer Ebene wahr (AWO, 2008).
Die AWO ist selbstständig, also föderal, organisiert und gliedert sich Be-
zirks- und Landesverbände, Kreisverbände und Ortsvereine. Bundesweit
zählt der Verband 430.000 Mitglieder, 100.000 ehrenamtliche und 146.000
hauptamtlich Tätige sowie 4500 Zivildienstleistende. In allen Bundeslän-
dern unterhält die AWO mehr als 14.000 Einrichtungen und Dienstleist-
ungen. Zu diesen gehören u.a. Tagesstätten für Kinder, Jugendliche, Ar-
beitslose sowie alte Menschen, Beratungsstellen für die unterschiedlichsten
Bereiche, zahlreiche ambulante und sozialpflegerische Dienste und diverse
Werkstätten.
Ferner sind im Namen der AWO eine beträchtliche Anzahl von Selbsthilfe-,
Helfer- und anderen Gruppen bürgerschaftlichen Engagements tätig. Diese
erbringen ihren Dienst u.a. innerhalb der Jugendhilfe und arbeit, sie stellen
Selbsthilfe- und Kontaktgruppen für die verschiedensten Gebiete, bilden
Freiwilligenargenturen und büros, unterstützen Menschen in besonderen
Notlagen und engagieren sich in der Familienhilfe.
Hinzu kommt, dass sich mehr als 800 selbstständige Einrichtungen, Initiati-
ven und Organisationen der AWO auf allen Ebenen als kooperative Mitglie-
der angeschlossen haben (AWO, 2008).
Diese Dienstleistungen und Aufgaben des AWO Bundesverbandes resultier-
en aus seinem Statut, der Satzung und den Leitsätzen.
2.3 Kernpunkte des AWO´schen Handelns
Als Wohlfahrtsverband mit besonderer Prägung ist die AWO bestrebt, bei
der Bewältigung gesellschaftlicher sozialer Probleme und Aufgaben mitzu-
wirken und ihren Beitrag zu leisten zur Verwirklichung und Aufrechterhal-
tung eines demokratischen, sozialen Rechtsstaates. Die weltweiten politi-
schen Veränderungen, allen voran die Öffnung der Grenzen nach Osteuropa,
der europäische Einigungsprozess sowie die Wiedervereinigung Deutsch-
lands gaben Anlass, das Grundsatzprogramm der AWO den neuen Gege-
benheiten entsprechend anzupassen. Dem Verständnis des Verbandes nach
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 13
,,nimmt der sozialpolitische Veränderungsprozess gravierende unsolidari-
sche Formen an" (AWO, 2008), welchen aktiv entgegengewirkt werden
soll, so dass ,,soziale Gerechtigkeit und Solidarität Kernpunkte des Han-
delns im Sozialstaat sind" (AWO, 2008). Außerdem soll das neue Grund-
satzprogramm den kritischen Dialog in Staat und Gesellschaft fördern. Als
weiteres Ziel benennt die Organisation das Abwenden von sozialer Kälte
und kommerziellem Konkurrenzkampf innerhalb der sozialen Arbeit. So hat
das Hilfswerk zwar hohen fachlichen Qualitätsstandards zu genügen, darf
aber seine eigenen Wertmaßstäbe gegenüber hilfe- und unterstützungssuch-
enden Menschen nicht aus den Augen verlieren. Durch eine Modifizierung
und Modernisierung der Verbandsstrukturen sollen das soziale Engagement
und das solidarische Miteinander belebt und die sozialen Dienstleistungen
qualitätsbewusst weiterentwickelt werden. Dabei soll das erneuerte Grund-
satzprogramm als Richtlinie dienen. Gleichlaufend veranschaulicht dieses
die gesellschaftsgestaltenden Intentionen der Wohlfahrtseinrichtung. Die
Leitsätze bilden dabei die Kernthesen des Leitbildes. Beide ergeben die Ba-
sis des Handelns der AWO und kennzeichnen ihre Zielsetzung, ihr Aufga-
benverständnis und die Arbeitsmethoden. Den Leitsätzen zufolge soll mit
ehrenamtlichen Engagement und professionellen Dienstleistungen für eine
sozial gerechte Gesellschaft eingestanden werden. Das Handeln innerhalb
der AWO wird demnach durch die Werte des freiheitlich-demokratischen
Sozialismus, Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit,
bestimmt, und erfolgt in sozialer, ökologischer, wirtschaftlicher und inter-
nationaler Verantwortung.
Dabei versteht sich die Organisation als Mitgliederverband, der auch poli-
tisch Einfluss nimmt. Demokratisches und soziales Denken und Handeln
sollen gefördert werden, um die gesellschaftliche Vision zu verwirklichen.
Die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Verbandes soll gewahrt und
eine Transparenz und Kontrolle der Arbeit soll gewährleistet werden. Durch
die Arbeit der Einrichtung sollen Menschen darin unterstützt werden, ihr
Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten. Daneben sollen alterna-
tive Lebenskonzepte unterstützt werden. Die Verantwortung des einzelnen
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 14
für die Gemeinschaft soll gestärkt und ein Zusammengehörigkeitsgefühl
vermittelt und aufgebaut werden. Bei allem stellt die qualitative Hochwer-
tigkeit der Dienstleistung, die allen Menschen zugänglich sein soll, ein zen-
trales Ziel dar (AWO, 2008).
2.4 Skizzierung der Unternehmensgruppe AWO Trialog gGmbH
Die AWO Trialog gGmbH Sozialpsychiatrie bietet verschiedene Hilfe-
leistungen im gesamten Bundesgebiet an. Zielgruppe stellen Menschen mit
psychischen Erkrankungen und deren Angehörige dar. Zentrale Zielsetzung
ist die Stärkung und Unterstützung des Selbsthilfepotentials dieser Perso-
nen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen dabei die individuellen Le-
benslagen, Bedürfnisse, Erwartungen und Möglichkeiten der Hilfesuchen-
den (AWO Trialog, 2008).
Zum Leistungskatalog der AWO Trialog gehören:
-
Rehabilitation und Eingliederungshilfe
-
Beratung und unterstützende Begleitung und Betreuung im Arbeitsleben
-
ambulante und stationäre Rehabilitation, Beratung und Betreuung,
Behandlung und Gesundheitsförderung bei Suchterkrankungen
Der Terminus ,,Trialog" beschreibt hierbei die zentrale Vorgehensweise der
dort Tätigen: Professionell Helfende, psychisch Erkrankte und deren Ange-
hörige arbeiten als Team miteinander, innerhalb dessen jeder vom anderen
lernen soll. Die starke Einbindung der Angehörigen der direkt Betroffenen
resultiert aus der Überzeugung des Unternehmens, dass ein stützendes so-
ziales Netzwerk den wichtigsten Tatbestand für die Prävention, die Morbidi-
tätsminderung und die Förderung der Rehabilitation psychischer und physi-
scher Störungen darstellt (AWO Trialog, 2008).
2.4.1 Leitbild der AWO Trialog gGmbH
Das Leitbild der AWO Trialog soll hier ausführlicher dargestellt werden, da
dieses von den dort tätigen professionellen und ehrenamtlichen Helfern als
Arbeitskonzept verstanden wird und deren fachliche Grundposition be-
stimmt. Die Präambel betont die Verbundenheit mit der geschichtlichen
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 15
Tradition der AWO. Auch hier wird auf den freiheitlich-demokratischen So-
zialismus als wichtige Orientierung und die damit verbundenen grundlegen-
den Handlungswerte Solidarität, Toleranz, Freiheit und Gleichheit verwie-
sen. Die AWO definiert diese grundlegenden Werte folgendermaßen:
,,Solidarität bedeutet, über Rechtsverpflichtungen hinaus durch praktisches
Handeln füreinander einzustehen. Wir können nur dann menschlich und in
Frieden miteinander leben, wenn das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes
von der Politik umgesetzt wird, wenn wir für einander einstehen und die
Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal anderer überwinden. Wer in Not
gerät, kann sich auf die Solidarität der Arbeiterwohlfahrt verlassen. Solidari-
tät ist auch Stärke im Kampf um das Recht.
Toleranz
bedeutet nicht nur, andere Denk- und Verhaltensweisen zu dul-
den, sondern sich dafür einzusetzen, daß [sic] jedermann und besonders
Minderheiten sich frei äußern können, in ihrer Religion und Weltanschau-
ung nicht eingeschränkt werden und so leben können, wie sie es für ange-
messen halten. Toleranz endet dort, wo sie Gefahr läuft, mißachtet [sic] und
mißbraucht [sic] zu werden. Solchen Gefahren stellt sich die Arbeiterwohl-
fahrt entgegen. Freiheit ist die Freiheit eines jeden, auch des Andersdenken-
den.
Freiheit
bedeutet, frei zu sein von entwürdigenden Abhängigkeiten, von
Not und Furcht. Freiheit bedeutet, die Möglichkeit zu haben, individuelle
Fähigkeiten zu entfalten und an der Entwicklung eines demokratischen, so-
zial gerechten Gemeinwesens mitzuwirken. Nur wer sich sozial gesichert
weiß, kann die Chancen der Freiheit nutzen.
Gleichheit
gründet in der gleichen Würde aller Menschen. Sie verlangt glei-
che Rechte vor dem Gesetz, gleiche Chancen, am politischen und sozialen
Geschehen teilzunehmen, das Recht auf soziale Sicherung und die gesell-
schaftliche Gleichstellung von Frau und Mann.
Gerechtigkeit
fordert einen Ausgleich in der Verteilung von Arbeit und
Einkommen, Eigentum und Macht, aber auch im Zugang zu Bildung,
Ausbildung und Kultur" (AWO, 2008).
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 16
Als Leitbild benennt die AWO Trialog gGmbH folgende Leitsätze:
1.
,,Unser Handeln ist darauf gerichtet die Lebensqualität unserer Kli-
enten zu bewahren und zu verbessern:
Wir begegnen unseren Klienten respektvoll und wertschätzend.
Wir orientieren uns an den Fähigkeiten unserer Klienten und Klien-
tinnen.
Wir begleiten den Prozess zur Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft als verlässlicher Partner.
2.
Kommunikation, Kooperation und Transparenz sind handlungslei-
tend für die Kultur und Organisation unseres Unternehmens:
Wir orientieren uns konsequent am Prinzip der dezentralen Verant-
wortung.
Wir nutzen auch die Vorteile zentraler Steuerung.
Wir sind aktive Mitgestalter regionaler Netzwerke.
3.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als Beteiligte an der Gestal-
tung der Arbeitsprozesse, sind in die Entwicklung des Unternehmens
eingebunden:
Wir prägen die Qualität unserer Dienstleistungen durch die Übernah-
me von Verantwortung auf allen Ebenen.
Wir schätzend das Wissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.
Wir fördern den Wissensaustausch und die Erweiterung von Kompe-
tenzen.
4.
Unsere Dienstleistungen sind innovativ und von hoher Qualität:
Wir gestalten zukunftsweisende Angebote bei sich verändernden ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Wir prüfen und verbessern die Qualität unserer Dienstleistungen
kontinuierlich.
5.
Unweltbewusstes Denken und Handeln ist eine Grundhaltung in un-
serer Arbeit:
Allgemeine Informationen zum Untersuchungsbereich 17
Wir tragen dazu bei, die Umwelt zu schützen, die Ressourcen zu
schonen und somit die Grundlage für unsere Lebensqualität zu ver-
bessern.
6.
Unser Ziel ist es, mit dem einzelnen Menschen sein Höchstmaß an
selbstbestimmter Lebensführung zu erreichen und zu erhalten.
Unsere Vision ist eine Gesellschaft in der vielfältige Lebenskonzepte
und Lebensräume ihren Platz haben und unterstützt werden:
Wir setzen uns ein für Teilhabe und Diskriminierungsverbot, Wahl-
freiheit und Normalitätsgebot, Selbstbestimmung und Teilhabe ohne
Ausgrenzung.
Wir sind überzeugt, dass diese Ziele in unserer Gesellschaft erreich-
bar sind" (AWO Trialog, 2008).
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 18
3 BESCHREIBUNG DER ANONYMEN DROGENBERATUNG
Es folgt eine kurze Darstellung der Stadt, in der die Drogenberatung ansäs-
sig ist, um dem Leser einen Eindruck der Lebensverhältnisse des Klientels
zu ermöglichen. Zum Schutz und zur Wahrung der Anonymität der befrag-
ten Personengruppe wird auf eine Angabe der Quellen verzichtet.
Die Anonyme Drogenberatung ist ansässig in einer Stadt mit ca. 80.000 Ein-
wohnern. 2007 lag die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt bei 11,8%.
Im Juni 2007 waren in der Stadt 17 verarbeitende Gewerbebetriebe (ab 20
Beschäftigte) gemeldet, die insgesamt mehr als 2000 Personen beschäftig-
ten. Etwa 15% der Einwohner waren im Jahr 2007 Leistungsempfänger
nach SGB II, davon waren etwa 70% Empfänger von Arbeitslosengeld II
und ca. 30% Empfänger von Sozialgeld.
Die Anonyme Drogenberatung ist hier zentral gelegen und kann sowohl aus
dem Stadtgebiet wie auch von Personen aus dem Umland problemlos mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.
3.1 Zugrundeliegende Konzeption
Die Drogenberatung richtet sich mit ihren Angeboten an alle, die mit stoff
gebundenen und ungebundenen Suchterkrankungen konfrontiert sind und
Hilfe suchen. Der Schweregrad der eventuell bestehenden Abhängigkeit so-
wie das konsumierte Suchtmittel sind dabei unerheblich. Die angebotene
Hilfe ist unbürokratisch und sofort möglich. So werden Erstgespräche inner-
halb von 48 Stunden nach der Kontaktaufnahme durch die hilfesuchende
Person von den Therapeuten angeboten.
Die Genese süchtigen Verhaltens wird hier aus der Trias der Wechselwir-
kung von Substanzeffekten, Persönlichkeits- und Umweltfaktoren verstan-
den. Ziele des therapeutischen Handelns lassen sich aus den Kernpunkten
der AWO sowie aus dem Leitbild der AWO Trialog gGmbH ableiten und
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 19
setzen sich zusammen aus der Förderung einer größeren gesellschaftlichen
Akzeptanz von Abhängigkeitserkrankten sowie Reduktion ihrer Diskrimi-
nierung, Stigmatisierung und Ausgrenzung. Des Weiteren soll demokra-
tisches und soziales Handeln unterstützt und größtmögliche Autonomie für
den Einzelnen hergestellt werden. Menschen werden dabei unterstützt, ihr
Leben und ihr Lebenskonzept entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten
eigenständig und verantwortlich zu gestalten. Das individuelle Hilfsangebot
wird dabei beständig und flexibel den sich verändernden Bedarfslagen ange-
passt. Der Veränderungsprozess des Klienten wird begleitet nach dem
Grundsatz ,,Hilfe zur Selbsthilfe". Damit folgt die Intervention dem sozial-
psychiatrischen Grundsatz, die Betreuung nur solange wie nötig durchzu-
führen. Insgesamt erfüllen die Hilfsangebote der Institution die Kriterien der
Gemeinde- und Sozialpsychiatrischen Versorgung. Nach Peukert (vgl.
www.ibrp-online.de) soll Gemeindepsychiatrie ihre Hilfsangebote zu den
Menschen in die Gemeinden bringen, ohne dass diese zentrale Hilfsinstitu-
tionen aufsuchen müssen. Zentrales Ziel hier ist, dass chronisch oder schwer
Erkrankte, trotz und gegebenenfalls mit ihrer Krankheit in ihrem gewohnten
Lebensumfeld verbleiben können, indem dieses, gemeinsam mit dem sozia-
len Netzwerk der erkrankten Person, entsprechend modifiziert wird. Seeli-
sche Schwierigkeiten und Krankheiten sollen demnach dort bearbeitet wer-
den, wo sie entstehen und gelebt werden, nämlich im sozialen Umfeld, dem
Arbeitsplatz, der Familie etc. Allerdings wird die Zielerfüllung nach wie vor
durch sozialadministrative und sozialrechtliche Regelungen erschwert. Nach
Dörner (1970) stellt Sozialpsychiatrie eine empirische Wissenschaft dar, die
,,als therapeutische Praxis und als soziale Bewegung den Versuch der Rück-
beziehung auf und die Integration der psychischen Leiden in ihre soziale
Realität" zum Ziel hat (vgl. www.ibrp-online.de). Die Schweizerische Ge-
sellschaft für Sozialpsychiatrie definiert Sozialpsychiatrie als denjenigen
Bereich der Psychiatrie, ,,der psychisch kranke Menschen in und mit ihrem
sozialen Umfeld zu verstehen und zu behandeln sucht. Sie studiert die
Wechselwirkungen zwischen sozialen, psychologischen und biologischen
Faktoren und bezieht Familie, Wohn- oder Arbeitssituation gezielt in die
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 20
Prävention und Behandlung psychischer Störungen mit ein" (vgl.
www.ibrp-online.de).
Innerhalb der Anonymen Drogenberatung gilt der Grundsatz, den Menschen
ganzheitlich, vor dem Hintergrund seiner Biografie und seiner aktuellen Le-
benslage, zu betrachten. Das zentrale Gebot bei der Kontaktaufnahme mit
dem Klienten besteht im Anbieten und Herstellen einer Beziehung ohne all-
zu große Forderungen an die hilfesuchende Person zu stellen. Die Angestell-
ten der Drogenberatung bemühen sich stets um ein höchstes Maß an Freund-
lichkeit, allein schon weil es sich bei den Klienten aus ihrer Sicht um Kun-
den handelt. Die Behandlung basiert auf Freiwilligkeit und ist langfristig
bestrebt, eine Krankheitseinsicht bei der abhängigkeitserkrankten Person
aufzubauen, um so die notwendige Compliance herzustellen. Zweifel und
Bedenken der Klienten werden ernst genommen und thematisiert, mit Rück-
fällen wird konstruktiv gearbeitet.
Das interdisziplinäre Team setzt sich zusammen aus Diplom-Sozialpädago-
gen und Diplom-Psychologen, einer Ärztin, spezifischen Fachkräften wie
Lehrern, Sozialwirten und ehrenamtlichen Helfern.
3.2 Klientenbezogene Angebote
Die Hilfsangebote der Anonymen Drogenberatung lassen sich in drei zentra-
le Bereiche einteilen. Zum einen in den klientenbezogenen Bereich, der im
Folgenden näher erläutert werden soll, die Kooperation mit anderen Institu-
tionen und Berufsgruppen, die sich ebenfalls mit Suchterkrankten beschäf-
tigen und zum anderen die Öffentlichkeitsarbeit und Prävention.
Die klientenbezogenen Hilfsangebote sind breit gefächert und beziehen sich
sowohl auf stoffgebundene wie auch stoffungebundene Abhängigkeitssyn-
drome. Sie erstrecken sich über die Suchtbegleitung, das Betreute Wohnen,
die Psychosoziale Begleitung und Substitution, die ambulante Rehabilita-
tion, die Tagesstrukturierende Maßnahme und vieles mehr, um nur einen
Auszug aus dem Leistungskatalog der Drogenberatung zu nennen. Die auf-
gezählten Angebote sollen nachfolgend näher skizziert werden. Eine Über-
sicht über verschiedene Interventionsformen gibt Abbildung 1.
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 21
Abb. 1
. Auszug aus dem klientenbezogenen Angebot der Drogenberatung
Die Suchtbegleitung hat stützende und betreuende Funktion und soll eine
weitere Verschlechterung des körperlichen und psychosozialen Status der
Person verhindern. Bestandteile der Betreuung sind lebenspraktische Hilfen,
Krisenintervention und Gespräche. Die Arbeit findet vorwiegend in auf-
suchender Form Anwendung, womit ein wesentliches Ziel von Gemeinde-
psychiatrie erfüllt wird, nämlich die Hilfe zu chronisch Erkrankten nach
Hause zu bringen. Das ,,Familiensystem" findet hier besondere Aufmerk-
samkeit. Mittels lösungsorientierter Intervention soll die Familie gestärkt
werden. Auch das weitere soziale Umfeld der Erkrankten Person, wie Be-
währungs- oder Jugendhilfe, Hausarzt, etc. kann in die Behandlung mit ein-
bezogen werden, um das Umfeld gemeinsam mit dem sozialen Netzwerk so
zu gestalten, dass die betroffene Person dort trotz ihrer Erkrankung verblei-
ben kann. Auch dies entspricht den Merkmalen von Gemeindepsychiatrie
nach Peukert (vgl. www.ibrp-online.de).
Zentral beim Angebot des Betreuten Wohnens im eigenen Wohnraum sind
die individuelle Suchthilfe und die Begleitung im Alltag. Als Zugangsvor-
aussetzungen gelten ein gewisses Ausmaß an psychischer Stabilität und die
allgemeine Fähigkeit zur individuellen Alltagsbewältigung. Auch die Moti-
vation zur Abstinenz und eine Gesprächsbereitschaft sind Grundvoraussetz-
ungen, um dieses Angebot nutzen zu können. Außerdem muss eine gültige
Kostenübernahme durch den zuständigen Sozialhilfeträger nach §39/40
BSHG (SGB II) gewährleistet sein. Psychiatrische, neurologische oder hirn-
Drogenberatung
Klientenbezogenes Angebot:
·
Suchtbegleitung
·
Betreutes Wohnen
·
Psychosoziale Begleitung
& Substitution
·
Ambulante Rehabilitation
·
Tagesstrukturierende
Maßnahme
·
etc.
Zielgruppe:
stoffgebundene und
ungebundene
Abhängigkeitserkrankte
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 22
organische Erkrankungen, eine ausgeprägte antisoziale Persönlichkeitsstör-
ung und deutlich fehlende Krankheitseinsicht stellen hingegen Ausschluss-
kriterien dar. Frauen mit Kindern, Familien und Einzelpersonen können die-
se Form der Unterstützung bei Bedarf und bei Erfüllung der Aufnahmekri-
terien in Anspruch nehmen. Ziele des Betreuten Wohnens bestehen in der
Förderung sozialer Integration von Suchterkrankten und der Verringerung
von Krankenhausaufenthalten. Auch hier findet die Arbeit vorwiegend in
aufsuchender Form Zuhause, am Arbeitsplatz oder anderen Orten des so-
zialen Umfeldes des oder der Klienten statt, womit wiederum ein zentrales
Kriterium der Gemeindepsychiatrie nach Peukert erfüllt wird. Die zeitliche
Spanne der Betreuung kann von sechs Monaten bis hin zu mehreren Jahren
reichen. Häufig wird dieses Angebot von substituierten Klienten in An-
spruch genommen, die innerhalb der Drogenberatung auch psychosozial be-
treut werden.
Die Psychosoziale Begleitung und Substitution kann erfolgen, wenn eine
Abstinenztherapie aktuell nicht durchführbar erscheint, jedoch eine dring-
ende Behandlungsbedürftigkeit aufgrund der chronischen Suchterkrankung
mit kritischen körperlichen, seelischen oder sozialen Folgen vorliegt. Mo-
dule der Psychosozialen Betreuung sind u.a. Hausbesuche, Freizeitveran-
staltungen, Paar- und Angehörigenarbeit, sozialarbeiterische Unterstützung
hinsichtlich sozialer und beruflicher Rehabilitation, Arbeitsplatz- und Woh-
nungssuche und Schuldenregulation. Die Ziele des Angebotes setzen sich
zusammen aus der Wiederherstellung physischer Gesundheit, psycho-
logischer Stabilisierung, Monotoxikomanie, beruflicher Rehabilitation und
letztlich Abstinenz. Ebenso im Vordergrund stehen Gemeindeintegration
und die Vermeidung von Hospitalisierung auch für schwer Erkrankte, in-
dem die Substitution als solche durch niedergelassene Hausärzte erfolgt, die
mit der Drogenberatungsstelle kooperieren.
Für Personen, die noch nicht auf dem freien Arbeitsmarkt vermittelt werden
können oder eine Phase der psychischen und physischen Stabilisierung be-
nötigen, hält die Drogenberatung ein weiteres Angebot bereit, das gemein-
sam mit der zuständigen ARGE entwickelt und von dieser auch finanziert
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 23
wird. Ziel des Projektes ist, Menschen mit Suchtproblematiken mittels An-
leitung durch eine fachliche Betreuung verbesserte Perspektiven zur gesell-
schaftlichen Teilhabe zu ermöglichen. Belastbarkeit, Ausdauer und Konzen-
tration sollen durch die Arbeitserprobung trainiert und gestärkt werden. Da-
zu müssen die Teilnehmer definierte Leistungsanforderungen erfüllen, wo-
bei stets die individuellen Ressourcen der Person Berücksichtigung finden.
Eine Alltagsbewältigung ohne problematischen Substanzkonsum soll durch
die Steigerung des Selbstwertes und durch eine Stabilisierung der Gesund-
heit erreicht werden.
Ein weiteres Hilfsangebot besteht in der ambulanten Rehabilitation Abhäng-
igkeitserkrankter. Diese fördert den Realitätsbezug, in dem die Klienten be-
ständig neue Verhaltensweisen in ihrem Alltag erproben und erfordert so
selbstverantwortliches Handeln und Eigeninitiative der betroffenen Perso-
nen. Ein weiterer Vorteil ambulanter Rehabilitation besteht darin, dass
Rückfallstrategien unter Alltagsbedingungen trainiert werden können und
das soziale Umfeld stark mit eingebunden werden kann. So kann, gemein-
sam mit dem sozialen Umfeld, das Umfeld derart modifiziert werden, dass
der Klient in diesem verbleiben kann und unnötige Klinikaufenthalte ver-
mieden werden. Reicht eine ambulante Intervention nicht aus, erfolgt
durch die Anonyme Drogenberatung eine Vermittlung in stationäre Thera-
pie und Entgiftung. Dazu erfolgt eine Zusammenarbeit mit Fachkliniken im
gesamten Bundesgebiet.
Innerhalb der Institution ist eine Ärztin beschäftigt, die Beratung und Be-
treuung bei körperlichen Symptomen und Fragestellungen anbietet. Sie führt
die Diagnostik aus, fordert Berichte und Gutachten an, die für die Anforder-
ung einer Rehabilitation erforderlich sind, und vermittelt die Klienten an
weiterführende medizinische Einrichtungen. Außerdem werden von ihr eine
Diagnostik und begleitende Therapie bei psychiatrischen Zweiterkrankung-
en durchgeführt, da bei längerem Suchtmittelkonsum oft psychische Ko-
morbiditäten, wie Depression, Angst- und Panikstörungen, Traumatisierung
oder Persönlichkeitsstörungen, vorliegen. Des Weiteren begleitet die Ärztin
ambulante Entgiftungen von Alkohol, Medikamenten und illegalen Drogen,
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 24
führt Einzel- und Gruppenpsychotherapien durch und ist verantwortlich für
Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen innerhalb der Einrichtung.
Die Tagesstrukturierende Maßnahme als ambulante Soforthilfe richtet sich
an Personen, die über ein ausreichendes Maß an Motivation zur Abstinenz
verfügen und sich darin erproben wollen, ihren weiteren Alltag suchtmittel-
frei zu gestalten. Auch Personen, die sich von ihrem süchtigen Umfeld ab-
grenzen wollen und einen Einstieg ins Arbeitsleben anstreben, finden hier
anonym und unbürokratisch Unterstützung. Die Maßnahme richtet sich
ebenfalls an Personen, die auf einen Therapieplatz warten oder die nach ein-
er Therapie weitere Unterstützung suchen. Auch in Kombination mit einer
ambulanten Rehabilitation kann die Tagesstrukturierung zusätzliche Unter-
stützung bieten. Von Seiten der Teilnehmer muss die Bereitschaft zu täg-
lichen Alkohol- und Drogenkontrollen vorliegen. Konsequenz eines positi-
ven Befundes ist das sofortige Verlassen der Maßnahme für 48 Stunden. Die
Tagesstrukturierende Maßnahme zielt darauf ab, dass suchtkranke Men-
schen in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben, sich im Alltag erproben und
in einem ,,trockenen" bzw. ,,cleanen" Rahmen ihre Abstinenz festigen kön-
nen. Sie soll den Menschen aus der, häufig mit Sucht einhergehenden, so-
zialen Isolation verhelfen und die Übernahem sozialer Verantwortung unter-
stützen. Zentrales Konzept ist das Alltagstraining, das durch die Selbstver-
sorgung der Teilnehmer realisiert wird, die eigenständig den Lebensmittel-
einkauf erledigen, die Mahlzeiten planen und zubereiten und für die Rein-
lichkeit der Räume verantwortlich sind. Zur Finanzierung der Maßnahme
zahlen die Teilnehmer täglich 1,50 für die Verpflegung. Die Mitarbeiter
der Drogenberatung können außerdem täglich ein von den Teilnehmern zu-
bereitetes Mittagessen zum Preis von 2,00 erwerben. Des Weiteren wird
das Projekt von der Stadt bezuschusst. Zugangsvoraussetzungen zur Maß-
nahme sind Suchtmittelfreiheit seit mindestens 48 Stunden vor der ersten
Teilnahme, ein fester Wohnsitz, Motivation zum regelmäßigen Erscheinen
und das Einverständnis zu regelmäßigen Alkohol- und Drogenkontrollen.
Ausschlusskriterien stellen andauernder Suchtmittelkonsum, Unzuverlässig-
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 25
keit des Teilnehmers, Androhung oder Anwendung von Gewalt oder andere
Regelverletzungen dar.
Abbildung 2 gibt einen Überblick über die beschriebenen Interventionsfor-
men, deren Ziele, Module und die anvisierte Zielgruppen. Eine detaillierte
Beschreibung der Tagesstrukturierenden Maßnahme, die den Untersuch-
ungsgegenstand der vorliegenden Arbeit darstellt, erfolgt unter Punkt 4.2.
Die hier aufgeführte Liste der Projekte und Hilfsangebote der Drogenbera-
tungsstelle ist keineswegs vollständig, sondern stellt lediglich eine Auswahl
der Angebote dar. Die beschriebenen Hilfen charakterisieren allerdings die
Arbeits- und Sichtweise der Institution im Besonderen.
3.3 Statistik der Drogenberatung aus den Jahren 2005 und 2006
In der Darstellung der Statistik der Drogenberatung gelten ebenfalls der
Schutz und die Wahrung der Anonymität der in der Untersuchung befragten
Personen. Aus diesen Gründen werden sämtliche Zahlen derart dargestellt,
dass ein Rückschluss auf die entsprechende Institution nicht möglich ist.
Die folgende Tabelle 1 soll eine Übersicht über die Gesamtzahl der Klienten
geben, die die Drogenberatung in den Jahren 2005 und 2006 aufsuchten. Es
handelt sich dabei um Personen, die erstmalig die Beratung in Anspruch
nahmen, die vom Vorjahr übernommen wurden und Angehörige oder nahe-
stehende Personen von suchterkrankten Personen.
Tab. 1:
Verteilung der Gesamtanzahl der Klienten 2005/2006
Gesamtzahl = gerundet aus Gründen der Anonymität
Neue = Klienten, die die Beratung erstmalig aufsuchten in Prozent
Übernommene = aus dem Vorjahr übernommen Klienten in Prozent
Jahr
2005
2006
Gesamtzahl
ca. 900
ca. 900
Neue (in %)
56,6
52,4
Übernommene (in %)
20,3
25,3
Angehörige (in %)
23,1
22,3
Die Gesamtanzahl der Personen, die im Jahr 2006 die Beratung der Drogen-
beratung aufsuchten, liegt etwas über der des Vorjahres 2005. Der Anteil
der Personen, die die Beratungsstelle erstmalig aufsuchten hingegen ist
2006 um mehr als 4% geringer ausgefallen als noch 2005. Der Anteil der -
Abb. 2
: Schematische Darstellung verschiedener Interventionsformen der Anonymen Drogenberatung, deren Ziele, Module und Zielgruppen
26
ANONYME DROGENBERATUNG
Suchtbegleitung
Betreutes Wohnen
Psychosoziale Begleitung
& Substitution
Ziele:
Prophylaxe einer
Verschlechterung des
körperlichen und psy-
chischen Zustandes
Module:
- lösungsorientierte
Intervention
- Krisenintervention
- Gespräche
- lebenspraktische
Hilfen
Zielgruppe:
Abhängige Personen, die
(noch) nicht abstinent
leben können;
findet vorwiegend in
aufsuchender Form statt;
Ziele:
Förderung sozialer
Integration und Ver-
hinderung von Hospi-
talisierung
Module:
- lebens- und alltags-
praktische Unter-
stützung
- Krisenintervention
- Gespräche
Zielgruppe:
Abhängige Personen mit
Abstinenzwillen, Frauen
mit Kindern, Familien,
Einzelpersonen;
findet vorwiegend in
aufsuchender Form statt;
Ziele:
- Wiederherstellung der
physischen Gesund-
heit und psycholo-
gische Stabilisierung
- Monotoxikomanie
- berufl. Rehabilitation
- Vermeidung von
Hospitalisierung
- Abstinenz
Die Vergabe des Substi-
tuts erfolgt durch den
Hausarzt;
Module:
-Hausbesuche
-Freizeitveranstaltungen
-Unterstützung bei der
Arbeitsplatz- und
Wohnungssuche sowie
Schuldenregulation
Zielgruppe:
Personen, bei denen Absti-
nenztherapie derzeit noch
nicht möglich erscheint, bei
denen jedoch eine dringen-
de Behandlungsbedürftig-
keit aufgrund der chro-
nischen Suchterkrankung
mit kritischen somatischen,
psychischen od. sozialen
Folgen vorliegt;
Arbeitsplatzerprobung
Ziele:
- Suchterkrankten mittels
fachl. Anleitung und
Betreuung verbesserte
Perspektiven zur gesell-
schaftlichen Teilhabe er-
möglichen
- Training und Stärkung
der Belastbarkeit, Aus-
dauer und Konzentra-
tionsfähigkeit
- durch das Erleben von
Kompetenz soll eine All-
tagsbewältigung ohne
problematischen Konsum
des Suchtmittels erreicht
werden
Module:
- fachl. angeleitetes Prakti-
kum in einer Arbeits-
gruppe
Zielgruppe:
Personen, die ggf. aufgrund
ihrer Sucht ihren Arbeits-
platz verloren haben und
sich im Rahmen der Gene-
sung auch berufl. wieder
rehabilitieren wollen oder
die schon länger erwerbs-
los sind und wieder berufl.
tätig sein wollen
Ambulante Rehabilitation
Ziele:
- Förderung des Realitäts-
bezuges durch Erlernen
und Erproben neuer
Coping-Strategien
- Förderung der Selbstver-
antwortung und Eigen-
initiative
Module:
- psychotherapeutische
Intervention zur Rehabili-
tation gemäß §15 SGB VI
-verhaltenstherapeutische,
analytische und syste-
mische Elemente
Zielgruppe:
Personen, die über die
Fähigkeit der länger-
fristigen Abstinenz verfü-
gen und trotz Intervention
in ihrem sozialen Umfeld
verbleiben wollen/können
Tagesstrukturierende Maßnahme
Ziele:
Durch Bereitstellen eines suchtmittel-
freien Kontextes soll die Abstinenz der
Teilnehmer stabilisiert und ihre soziale
Isolation aufgehoben werden
Module:
- Alltagstraining durch Selbstversorgung
der Teilnehmer
- verhaltenstherapeutische Elemente
- Krisen- und lösungsorientierte Interven-
tion
- Gespräche
- Beratung
- lebens- und alltagspraktische Unterstütz-
ung
- Freizeitveranstaltungen
- bei Bedarf auch Hausbesuche
Zielgruppe:
Personen, die:
- ihren Alltag suchtmittelfrei gestalten
wollen, dabei aber noch Unterstützung
bedürfen
- sich von ihrem süchtigen Umfeld
abgrenzen wollen
- einen Einstieg ins Arbeitsleben an-
streben
- auf einen Therapieplatz warten od.
nach einer Therapie weitere Unterstütz-
ung suchen
- sich in ambulanter Rehabilitation befin-
den und zusätzliche Unterstützung zur
Alltagsbewältigung und -strukturierung
suchen
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 27
jenigen Personen, die sich aus dem Vorjahr weiter in Behandlung befanden,
lag 2007 um 5% höher als 2006. Der Anteil der Angehörigen blieb in beiden
Jahren weitgehend gleich und zeigte 2006 einen geringen Rückgang um
0,8% auf 22,3%.
Das Geschlechterverhältnis blieb, bezogen auf die Gesamtzahl aller Klien-
ten in beiden Jahren, nahezu gleich. 2006 lag der Anteil männlicher Klien-
ten bei 58,2%, im Jahr 2005 bei 57,3%. Der Anteil weiblicher Klientinnen
betrug 2005 42,7% und blieb mit 41,8% im Jahr 2006 nahezu unverändert.
Tabelle 2 liefert eine entsprechende Übersicht.
Tab. 2:
Verteilung der Klienten nach Geschlecht aus 2005/2006 in Prozent
Jahr
2005
2006
Frauen (in %)
42,7
41,8
Männer (in %)
57,3
58,2
Die konsumierten Suchtmittel der Klienten lassen sich in eine hierarchische
Ordnung bringen, die sich aus dem prozentualen Anteil der jeweiligen Pro-
blembereiche ergeben. Je höher der prozentuale Anteil des jeweiligen Pro-
blembereichs war, desto höher war der Rang des entsprechenden Bereiches.
Es wird aus den bereits erwähnten Gründen der Anonymisierung auf eine
genaue Aufschlüsselung der prozentualen Verteilung verzichtet.
Der hauptsächliche Problembereich ,,Alkohol" blieb in beiden Jahren nahe-
zu identisch. Lediglich ein zu vernachlässigender Rückgang im Jahr 2006
war zu verzeichnen, womit die Substanz Alkohol in beiden Jahren an der
Spitze der Hierarchie stand. Im Jahr 2005 stand an zweiter Stelle noch Me-
thadon, was sich 2006 änderte. Die Substanz Cannabis tauschte in diesem
Jahr Platz zwei mit Methadon und verdrängte diesen Bereich auf den drit-
ten Rang. Der Problembereich Heroin nahm in beiden Jahren unverändert
Platz 4 in Anspruch. Auch Kokain veränderte seine Stellung innerhalb der
Hierarchie nicht und verweilte in beiden Jahren auf Rang 5. Das gleiche ließ
sich ebenfalls für den Problembereich Medikamente feststellen, die in bei-
den Jahren Platz 6 der Hierarchie bekleideten. Im Jahr 2006 tauschten die
Bereiche Ecstasy und pathologisches Glückspiel ihre Ränge: Lag der pro-
blematische Ecstasykonsum im Jahr 2005 noch auf Platz 7 der Hierarchie,
rutschte er im Folgejahr auf Platz 8. Glücksspiel als Störung nahm somit
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 28
2006 Rang 7 ein und verließ den achten Platz aus dem Jahr 2005. Der ab-
hängige Tabakkonsum rangierte 2005, genau wie im darauf folgenden Jahr,
auf Platz 9, gefolgt von problematischem Essverhalten. Im Jahr darauf be-
legten beide Bereiche mit gleichen prozentualen Anteilen den Rang 9. Als
tabellarischer Überblick ergibt sich folgende Hierarchie der Problemberei-
che.
Tab. 3: Hierarchie der Problembereiche der direkt Betroffenen (ohne Angehörige) der Jahre 2005/2006
Die prozentualen Anteile der Angehörigenarbeit können ebenso wie die
Klientenprobleme in eine Hierarchie gebracht werden. Wie sich feststellen
ließ, zeigte sich hier eine starke Veränderung der Ränge. Zwar sank der Be-
reich Alkohol im Jahr 2006, dennoch stand dieser mit deutlichem Abstand
an erster Stelle der Hierarchie. Gefolgt wurde dieser in beiden Jahren vom
Bereich Cannabis. Beide Substanzen nahmen bei den Angehörigen, genau
wie bei den Klienten, den größten prozentualen Anteil der Problembereiche
ein. Mit großem prozentualem Abstand folgte im Jahr 2005 der Bereich He-
roin, der hier Platz 3, und ein Jahr später Platz 4, belegte. Methadon als pro-
blematisch konsumierte Substanz bekleidete im Jahr 2005 Rang 4 und
rutschte ein Jahr später auf den siebten Rang. Pathologisches Glücksspiel
rangierte 2005 auf Platz 5 und ein Jahr darauf auf Platz 6. Auf Rang 5 des
Jahres 2006 lagen sowohl Medikamente wie auch Tabak, da beide Bereiche
die gleichen prozentualen Anteile aufwiesen. Kokain lag im Jahr 2005 noch
auf dem sechsten Rang. 2006 stieg die Nachfrage der Angehörigen aller-
dings signifikant an, so dass diese Substanz dann bereits den dritten Rang
belegte. Der Bereich problematisches Essverhalten rangierte 2005 auf Platz
Problembereich
Rang
2005
Rang
2006
Alkohol
1
1
Methadon
2
3
Cannabis
3
2
Heroin
4
4
Kokain
5
5
Medikamente
6
6
Ecstasy
7
8
Pathologisches Glücksspiel
8
7
Tabak
9
9
Nahrungsmittel
10
9
Beschreibung der Anonymen Drogenberatung 29
7 und rutschte im Folgejahr auf Platz 8, womit im Jahr 2006 aufgrund der
gleichen prozentualen Anteile die Bereiche problematisches Essverhalten
und Ecstasy auf Platz 8 rangierten. Nachfragen im Bereich Medikamenten-
missbrauch von Angehörigen oder Freunden lagen 2005 auf dem achten,
2006, wie bereits erwähnt, auf dem fünften Rang. Die Angehörigenarbeit im
Bereich Ecstasy bekleidete im Jahr 2005 Platz 9, im Bereich Tabak den
zehnten Platz. Die nachfolgende Tabelle 4 liefert einen entsprechenden
Überblick über die Veränderung der Hierarchie der Problembereiche der
Angehörigen in beiden Jahren.
Tab. 4:
Hierarchie der Problembereiche der Angehörigen der Jahre 2005/2006
In der Zusammenlegung der Bereiche Angehörigennachfragen und Pro-
blembereiche der direkt Betroffenen zeigte sich, dass die Bereiche Alkohol,
Cannabis, Methadon, Heroin, Kokain, Ecstasy und Pathologisches Glücks-
spiel in beiden Jahren die gleichen Ränge, nämlich die von 1 7, belegten.
Der Bereich Medikamente lag im Jahr 2005 noch auf Platz 8, bekleidete
2006 dann Platz 9, Platz 8 wurde im Jahr 2006 von dem Problembereich
Tabak eingenommen, der ein Jahr zuvor noch auf Platz 10 rangierte. Pro-
blematisches Essverhalten nahm 2005 noch Platz 9 ein, im folgenden Jahr
Platz 10. Die nachstehende Tabelle 5 gibt einen entsprechenden Eindruck
über die Veränderungen innerhalb der Anteile der Problembereiche.
Problembereich
Rang
2005
Rang
2006
Alkohol
1
1
Cannabis
2
2
Heroin
3
4
Methadon
4
7
Pathologisches Glücksspiel
5
6
Kokain
6
3
Nahrungsmittel
7
8
Medikamente
8
5
Ecstasy
9
8
Tabak
10
5
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836634694
- DOI
- 10.3239/9783836634694
- Dateigröße
- 2.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Human- und Geisteswissenschaften, Studiengang Psychologie
- Erscheinungsdatum
- 2009 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- tagesstrukturierung suchtstörung alkoholabhängigkeit suchttherapie maßnahmen
- Produktsicherheit
- Diplom.de