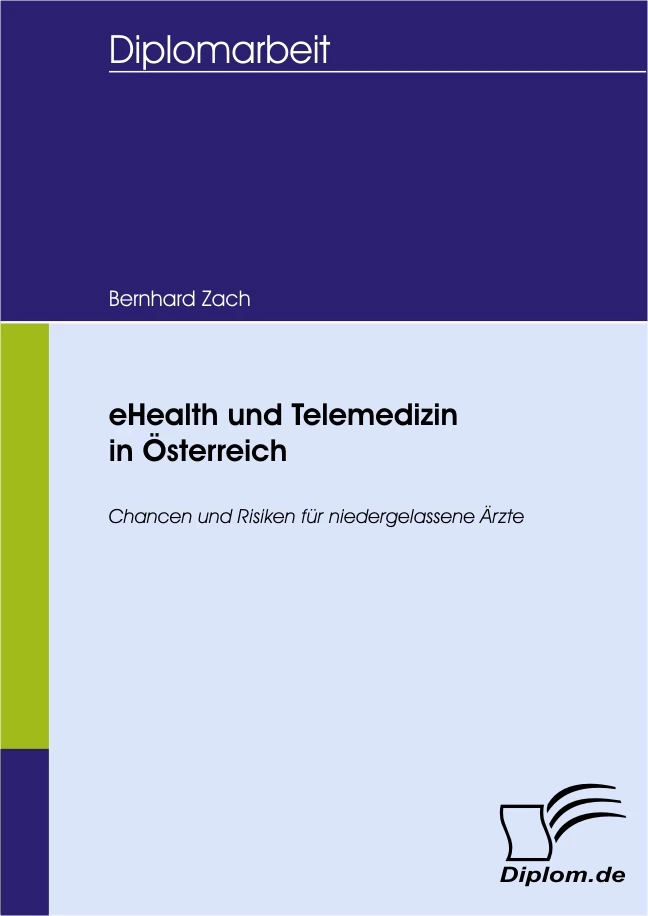eHealth und Telemedizin in Österreich
Chancen und Risiken für niedergelassene Ärzte
©2004
Diplomarbeit
173 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Motivation für das Thema:
Die Kombination von Informationsmanagement und Medizin ist die Grundlage dieser Diplomarbeit. Bei e-Health handelt sich um ein innovatives Thema, das in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Der Trend zur Vernetzung im Gesundheitswesen und somit der Einsatz neuer Technologien bei Diagnose, Behandlung und Verwaltung wird immer deutlicher. Mit dem Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wird diese Arbeit von einem kompetenten Partner betreut.
Vorstellung des Institutes:
Das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wurde 1989 an der Karl-Franzens-Universität Graz gegründet. Mittlerweile ist das Institut Teil der neu gegründeten Medizinischen Universität Graz.
Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Medizinischen Informatik sind beispielsweise:
- Elektronische multimediale Krankenakte.
- Wissenserschließung in medizinischen Datenbanken.
- Bildinformations- und Kommunikationssysteme (PACS).
- Aus- bzw. Weiterbildung von StudentInnen und MedizinerInnen.
Forschungsgebiete und Aufgaben im Bereich der Medizinischen Statistik und Biometrie umfassen unter anderem:
- Entwicklung und Evaluierung von statistischen Methoden.
- Überlebensanalysen.
- Statistische Beratung (Statistische Ambulanz) bei medizinischen Forschungsprojekten Aufgaben in der Lehre.
Themenabgrenzung:
Was wird behandelt:
Der zentrale Punkt dieser Arbeit ist der niedergelassene Arzt und seine Position im immer aktueller werdenden Themengebiet e-Health. Als Ausgangspunkt dient der Allgemeinmediziner, da dieser den Eintrittspunkt des Patienten in die Behandlungskette darstellt. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie über die Grenzen der Praxissoftware hinaus ist der zentrale Punkt dieser Diplomarbeit. Hierbei wird vor allem auf die Bedürfnisse und Wünsche der Ärzte eingegangen.
Als Folge der äußerst interessanten Kombination von Informationstechnologie und Medizin, sowie dem hohen Innovationsgrad der Disziplin kommt es jedoch auf dem Gebiet der Medizinischen Informatik zu Produktentwicklungen, für die kein Verwendungszweck bzw. keine Nachfrage gegeben ist. Man sollte sich vor der Entwicklung einer neuen Applikation auf die Frage konzentrieren, ob für diese überhaupt ein Bedarf gegeben ist, ob die gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind und ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Einführung überhaupt zulassen. Es sollte nicht mit der Suche nach einem […]
Motivation für das Thema:
Die Kombination von Informationsmanagement und Medizin ist die Grundlage dieser Diplomarbeit. Bei e-Health handelt sich um ein innovatives Thema, das in Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Der Trend zur Vernetzung im Gesundheitswesen und somit der Einsatz neuer Technologien bei Diagnose, Behandlung und Verwaltung wird immer deutlicher. Mit dem Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wird diese Arbeit von einem kompetenten Partner betreut.
Vorstellung des Institutes:
Das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wurde 1989 an der Karl-Franzens-Universität Graz gegründet. Mittlerweile ist das Institut Teil der neu gegründeten Medizinischen Universität Graz.
Arbeitsschwerpunkte im Bereich der Medizinischen Informatik sind beispielsweise:
- Elektronische multimediale Krankenakte.
- Wissenserschließung in medizinischen Datenbanken.
- Bildinformations- und Kommunikationssysteme (PACS).
- Aus- bzw. Weiterbildung von StudentInnen und MedizinerInnen.
Forschungsgebiete und Aufgaben im Bereich der Medizinischen Statistik und Biometrie umfassen unter anderem:
- Entwicklung und Evaluierung von statistischen Methoden.
- Überlebensanalysen.
- Statistische Beratung (Statistische Ambulanz) bei medizinischen Forschungsprojekten Aufgaben in der Lehre.
Themenabgrenzung:
Was wird behandelt:
Der zentrale Punkt dieser Arbeit ist der niedergelassene Arzt und seine Position im immer aktueller werdenden Themengebiet e-Health. Als Ausgangspunkt dient der Allgemeinmediziner, da dieser den Eintrittspunkt des Patienten in die Behandlungskette darstellt. Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie über die Grenzen der Praxissoftware hinaus ist der zentrale Punkt dieser Diplomarbeit. Hierbei wird vor allem auf die Bedürfnisse und Wünsche der Ärzte eingegangen.
Als Folge der äußerst interessanten Kombination von Informationstechnologie und Medizin, sowie dem hohen Innovationsgrad der Disziplin kommt es jedoch auf dem Gebiet der Medizinischen Informatik zu Produktentwicklungen, für die kein Verwendungszweck bzw. keine Nachfrage gegeben ist. Man sollte sich vor der Entwicklung einer neuen Applikation auf die Frage konzentrieren, ob für diese überhaupt ein Bedarf gegeben ist, ob die gesellschaftlichen Voraussetzungen gegeben sind und ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Einführung überhaupt zulassen. Es sollte nicht mit der Suche nach einem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Bernhard Zach
eHealth und Telemedizin in Österreich
Chancen und Risiken für niedergelassene Ärzte
ISBN: 978-3-8366-3123-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Technikum Joanneum GmbH, Graz, Österreich, Diplomarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
e-Health und Telemedizin in Österreich
Inhaltsverzeichnis
Seite 3 von 172
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... 3
Abbildungsverzeichnis ... 6
Abkürzungsverzeichnis ... 7
Danksagung ... 9
Abstract ... 10
Kurzfassung ... 12
1
Einleitung ... 15
1.2
Vorstellung des Institutes ... 15
1.3
Themenabgrenzung ... 16
1.3.1
Was wird behandelt ... 16
1.3.2
Was wird nicht behandelt ... 17
2
Grundlagen von e-Health ... 18
2.1
Begriffsbestimmung: Medizinische Informatik, Gesundheitstelematik,
Telemedizin, e-Health ... 20
2.1.1
Medizinische Informatik ... 21
2.1.2
Gesundheitstelematik ... 22
2.1.3
Telemedizin ... 22
2.1.4
e-Health ... 23
2.1.5
Schlussfolgerung ... 24
2.2
Medizin ... 25
2.2.1
Allgemeinmedizin ... 25
2.2.2
Chirurgie ... 25
2.2.3
Dermatologie ... 26
2.2.4
Innere Medizin ... 26
2.2.5
Kardiologie ... 26
2.2.6
Ophthalmologie ... 27
2.2.7
Onkologie ... 27
2.2.8
Pathologie ... 27
2.2.9
Radiologie ... 27
2.3
Informationsmanagement in der Medizin ... 28
2.3.1
Aufgaben des Informationsmanagements ... 28
2.3.2
Ein konkretes Beispiel ... 29
2.4
Das Gesundheitswesen in Österreich und seine Akteure ... 31
2.4.1
Statistische Grundlagen ... 31
e-Health und Telemedizin in Österreich
Inhaltsverzeichnis
Seite 4 von 172
2.4.2
Struktur des österreichischen Gesundheitswesens und die
Interessen der Akteure ... 32
3
e-Health und niedergelassene Ärzte ... 39
3.1
Das System Arztpraxis ... 39
3.1.1
Grundlagen ... 40
3.1.2
Wirtschaftsfaktor Arzt ... 41
3.1.3
Ziele des niedergelassenen Arztes ... 41
3.1.4
Praxisinterne Arbeitsprozesse ... 42
3.1.5
Externe Informations- und Kommunikationsprozesse ... 45
3.1.6
Technologisierungsgrad ... 51
3.2
Stärken- / Schwächenanalyse ... 54
3.2.1
Stärken der Praxis ... 54
3.2.2
Schwächen der Praxis ... 55
3.2.3
Schlussfolgerung / Nutzenpotentiale ... 59
3.2.4
Schlussfolgerung / Risiken ... 61
3.3
e-Health Angebote, Dienstleistungen und Initiativen im
niedergelassenen Bereich ... 62
3.3.1
WHO ... 63
3.3.2
EU Richtlinien ... 63
3.3.3
Bundespolitik ... 67
3.3.4
Landespolitik ... 71
3.3.5
Sozialversicherung ... 72
3.3.6
Ärztekammer ... 74
3.3.7
Koordinationsstellen und telemedizinische Zentren ... 77
3.3.8
Angebote von Bildungseinrichtungen, Forschungsinstitutionen ...
und Privatunternehmen ... 78
3.3.9
Schlussfolgerung ... 85
3.4
Einflussfaktoren ... 86
3.4.1
Akzeptanz ... 87
3.4.2
e-Health Politik... 89
3.4.3
Ausbildung der Ärzte ... 94
3.4.4
Wirtschaft / Industrie ... 97
3.4.5
Gesellschaft ... 98
3.4.6
Schlussfolgerung ... 100
3.5
Beeinflussung und Relevanz der Einflussfaktoren ... 100
3.6
Zukunftsszenario 2020 ... 104
3.6.1
Technologiefeindliches Extremszenario ... 105
3.6.2
Normalentwicklung ... 105
3.6.3
Technologiefreundliches Extremszenario ... 106
3.6.4
Schlussfolgerung ... 107
4
Produkt- und Dienstleistungsentwicklung... 109
4.1
PC ... 110
e-Health und Telemedizin in Österreich
Inhaltsverzeichnis
Seite 5 von 172
4.1.1
Elektronische Patientenakte ... 110
4.1.2
Elektronisches Rezept mit integrierter Interaktionsüberprüfung 112
4.1.3
Elektronische Überweisung ... 113
4.1.4
Elektronische Terminvergabe ... 114
4.1.5
Elektronische Krankschreibung und Gesundmeldung ... 117
4.1.6
System zu automatischen Patientenregistrierung ... 118
4.1.7
Online Fortbildungsangebot ... 119
4.1.8
Datensicherung ... 120
4.1.9
Erinnerungsdienste für Patienten ... 121
4.1.10
Tägliche Abrechnung ... 122
4.1.11
Informationsangebot im Internet Evidence Based Medicine ... 123
4.1.12
Patientenportal... 125
4.1.13
Web Basierte Praxissoftware ... 128
4.1.14
Vertretungsbörse ... 129
4.1.15
System
für
die
elektronische Einholung der Chefarztbewilligung 130
4.2
Mobile Anwendungsgebiete ... 130
4.2.1
PDA System zur Übermittlung von Krankenhausbefunden ... 130
4.2.2
Schnittstelle Praxissoftware / PDA ... 131
4.2.3
Einsatz des ,,Global Positioning Systems" (GPS) ... 132
4.2.4
Wartezeit - SMS Informationssystem ... 134
4.2.5
Notfall-Informationssystem der lokalen Einsatzzentrale des
Rettungsdienstes ... 135
4.3
Zusammenfassung ... 137
5
Die Sicht der Ärzte eine empirische Studie ... 139
5.1
Hypothesen ... 139
5.2
Umfragemethode ... 140
5.3
Konzeption des Fragebogens ... 141
5.4
Ergebnisse / Datenanalyse ... 142
5.4.1
Überprüfung der Hypothesen... 143
5.4.2
Informationsbedarf im Internet ... 154
5.4.3
Wünsche, Ängste und Ideen der Ärzte ... 155
6
Schlussfolgerung ... 157
Anhang: Fragebogen ... 159
Literaturverzeichnis ... 163
Online ... 165
Zeitschriften ... 170
Interviews ... 171
Sonstiges ... 171
Kontaktdaten ... 172
e-Health und Telemedizin in Österreich
Abbildungsverzeichnis
Seite 6 von 172
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Potential von e-Health ... 19
Abbildung 2: Einordnung von e-Health und Telemedizin ... 24
Abbildung 3: Aufgaben des IM bezogen auf das Gesundheitswesen ... 29
Abbildung 4: Organisationsstruktur des Gesundheitswesens und Beziehungen
zwischen den Elementen des Systems ... 33
Abbildung 5: Versicherungsleistungen der Krankenversicherung 2001 ... 37
Abbildung 6: Das Versorgungskontinuum ... 37
Abbildung 7: Arbeitsprozessmodell eines Arztes ... 42
Abbildung 8: Externe Kommunikationsprozesse des Arztes ... 46
Abbildung 9: PC- und Internetnutzung sowie elektronischer Austausch von
Patientendaten durch europäische Ärzte ... 51
Abbildung 10: Initiatoren von IuKT Einsatz in der ärztlichen Praxis ... 62
Abbildung 11: Potentielle Nutzer telematischer Anwendungen und
Dienstleistungen nach der Einführung der e-Card ... 92
Abbildung 12: Durchschnittliches Patientenalter ... 99
Abbildung 13: Einflussmatrix ... 102
Abbildung 14: Der Szenario Trichter ... 104
Abbildung 15: Wahrscheinlichste Ausprägung im Jahr 2020 ... 107
Abbildung 16: Bevorzugte Quellen von Gesundheitsinformationen ... 126
Abbildung 17: Alarmierung durch das Notfallinformationssystem ... 136
Abbildung 18: Vergleich Allgemeinmediziner / Facharzt ... 145
Abbildung 19: Verhältnis von Alter zu Akzeptanz ... 146
Abbildung 20: Korrelation Geschlecht / Akzeptanz ... 147
Abbildung 21: Vergleich Benotung Wahlärzte / Kassenvertragsärzte ... 148
Abbildung 22: Vergleich der Durchschnittsbenotungen von Wahlärzten und
Kassenvertragsärzten... 149
Abbildung 23: Von den Ärzten vergebene Durchschnittsnoten ... 151
Abbildung 24: Auswertung der benoteten Anwendungen / Dienstleistungen .. 152
e-Health und Telemedizin in Österreich
Abkürzungsverzeichnis
Seite 7 von 172
Abkürzungsverzeichnis
AKH
Allgemeines Krankenhaus
ARCS
Austrian Research Centers
ASVG
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
B-KAG
Bundes-Krankenanstaltengesetz
BMSG
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen
CEN
European Commitee For Standardization
CT
Computertomographie
EBM
Evidence Based Medicine
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
EEG
Elektroenzephalogramm
EFTA
European Free Trade Association
EKG
Elektrokardiogramm
ENV
Europäischer Normenvorschlag
FH
Fachhochschule
GNV
Gesundheitsnetz Vorarlberg
GPS
Global Positioning System
IEEE
Institute Of Electrical And Electronics Engineers
IM
Informationsmanagement
IuKT
Informations- und Kommunikationstechnologie
ISM
Institute Of Applied Sciences In Medicine
ISO
International Organisation for Standardization
KABEG
Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft Kärnten
KAGES
Steirische Krankenanstaltengesellschaft mit beschränkter
Haftung
KB
Kilobyte
L-KAG
Landes-Krankenanstaltengesetz
e-Health und Telemedizin in Österreich
Abkürzungsverzeichnis
Seite 8 von 172
MAGDA-LENA
Medizinisch-Administrativer Gesundheitsdatenaustausch
Logisches und Elektronisches Netzwerk Austria)
MRT
Magnetresonanztomographie
MSc
Master of Science
PC
Personal Computer
PDA
Personal Digital Assistent
ÖÄK
Österreichische Ärztekammer
ÖBIG
Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen
SMS
Short Message Service
STEWEAG
Steirische Wasserkraft- und Elektrizitäts-Aktiengesellschaft
UMIT
Universität für Medizinische Informatik und Technik Tirol
USB
Universal Serial Bus
VPN
Virtuelles Privates Netzwerk
WHO
World Health Organisation
XML
Extensible Markup Language
e-Health und Telemedizin in Österreich
Danksagung
Seite 9 von 172
Danksagung
,,Leider lässt sich wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken"
Goethe
e-Health und Telemedizin in Österreich
Abstract
Seite 10 von 172
Abstract
The positive effects and possibilities that information and communication
technologies offer to health care are increasingly identified as major factors by
all persons involved. Therefore a new term, that represents the use of these
technologies in health care, has been established in the last few years: e-Health.
The use of PCs in hospitals is essential nowadays. This applies to their use in
administration as well as in diagnosis and therapy. Digital radiologic image data
is made accessible for hospitals and findings are exchanged between hospitals
electronically. An increasing number of patients use the internet to inform
themselves about diseases, drugs, therapy and doctors. Anonymity and
independence are the magic words. Health insurance funds make forms online
accessible and allow patients to report their health status over the internet.
The focus in this diploma thesis is not laid upon hospitals, patients or health
insurance funds. Instead it is the practitioners and specialists in internal
medicine, because their acceptance of modern technology is crucial for a
successful development of e-Health.
So far, the use of modern information and communication technologies in the
medical practice is dominated by the use of software for the administration of
patient data. The step over the boarders of the medical practice to patients,
hospitals, colleagues or even the health insurances fund has not been taken
although the technological requirements do already allow it. On the one hand
problems like financing, responsibility and data security, which is very important
in medicine, are unsolved. On the other hand there is a kind of ,,Technological
Push" going on, which means, that companies are researching and developing,
without having enough demand for their products. Hence, many projects fail.
This thesis has the aim of answering the therefore most important question in
e-Health und Telemedizin in Österreich
Abstract
Seite 11 von 172
this context: What are the requirements that, according to the doctors, have to
be fulfilled?
Chapter one informs the reader about the client of this thesis, the "Institute of
Medical Informatics, University of Graz". In this chapter the delimitation of the
content, this thesis covers, is done.
Chapter two describes the basics of e-Health, telemedicine and, consequently,
the information this thesis builds upon. It is all about definitions, description of
medical faculties, basics of the Austrian health care system and the challenge of
Information Management in medicine. In chapter three the determination of the
potential e-Health has in the area of settled down medical practitioners. In a
process analysis the processes of doctors are inspected for room for
improvement. A market analysis will give information about the range of
products different enterprises offer the target group. In a review of the situation,
experts are questioned about the actual and planned services and products
offered to doctors. Challenges for Information Management in this sector are
analyzed, boundaries highlighted and scenarios for the future developed.
Using the results of these analyses, products and services are developed in
chapter four. This products and services build the basis for chapter five, where a
empiric survey is done. The data analysis of this empiric survey will give
information about the attitude of medical practitioners concerning e-Health,
telemedicine and the proposed products and services. In the last chapter a
summary of the insights gained and the conclusion can be found.
The technical possibilities are boundless but the sense of many applications is
limited. Therefore this thesis will give the answer to the question, if and how
modern information and communication technologies can support the medical
practitioner in the best way possible. The question, which applications and
services have the capability to be used and honoured by medical practitioners,
is also answered here.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Kurzfassung
Seite 12 von 172
Kurzfassung
Im Gesundheitswesen werden zunehmend die Möglichkeiten erkannt, die der
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie allen Beteiligten
eröffnet. In der Gesellschaft wurde in den letzten Jahren ein übergeordneter
Begriff für den Einsatz dieser Technologien im Gesundheitswesen entwickelt: e-
Health.
Der Einsatz des PCs ist aus dem Krankenhaus nicht mehr wegzudenken. Dies
gilt sowohl für den Einsatz in der Administration als auch für die Diagnose und
Therapie. Es werden digitale radiologische Bilddaten zugänglich gemacht und
Befunde elektronisch übermittelt. Patienten nutzen das Internet zunehmend als
Medium, um sich über Krankheiten, Medikamente, Therapien und Ärzte zu
informieren. Anonymität und Selbstständigkeit sind die Zauberworte.
Krankenkassen bieten online Formulare an und ermöglichen dem Patienten eine
Gesundmeldung über das Internet.
Der Fokus ist in dieser Diplomarbeit aber nicht auf Krankenhäuser, Patienten
oder Krankenkassen gerichtet sondern auf niedergelassene Ärzte, Allgemein-
mediziner und Internisten, da deren Akzeptanz moderner IuKT eine zwingende
Vorraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung von e-Health ist.
Bei der Verwendung moderner IuKT in der ärztlichen Praxis handelt es sich
bisher vor allem um den Einsatz von Praxissoftware. Der Schritt über die
Grenzen der Arztpraxis hinaus zu Patient, Krankenhaus, vorhergegangenen
bzw. nachfolgenden behandelndem Arzt oder beispielsweise Krankenkasse ist
bisher den technologischen Möglichkeiten zum Trotz noch unzureichend oder
gar nicht vollzogen worden. Einerseits sind Fragen der Finanzierung, der
Haftung und die des Datenschutzes, der besonders in der Medizin eine große
Rolle spielt, nach wie vor ungeklärt. Andererseits kann von einem
e-Health und Telemedizin in Österreich
Kurzfassung
Seite 13 von 172
,,Technological Push" gesprochen werden, was bedeutet, dass in zahlreichen
Projekten geforscht und entwickelt wird, ohne das für diese Produkte eine
ausreichende Nachfrage besteht. Viele Projekte verlassen das Pilotstadium
nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Diese Diplomarbeit wird dem auf den
Grund gehen.
In Kapitel 1 wird das Institut für Medizinische Informatik der Universität Graz, für
das die Diplomarbeit verfasst wird, vorgestellt und abgegrenzt was behandelt
bzw. nicht behandelt wird. Kapitel 2 stellt die Grundlagen von e-Health,
Telemedizin und somit dieser Diplomarbeit dar. Dabei handelt es sich um
Begriffsbestimmungen,
Beschreibungen
medizinischer
Fachbereiche,
Grundlagen des österreichischen Gesundheitssystems und die Aufgabe des
Informationsmanagements in der Medizin. In Kapitel 3 wird untersucht, welches
Potential e-Health im niedergelassenen Bereich besitzt. In einer Prozessanalyse
werden
die
Arbeitsprozesse
der
Ärzte
genau
betrachtet
und
auf
Verbesserungspotential untersucht. Eine Marktanalyse wird Aufschluss darüber
geben, welche Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen Produkte
für die genannte Zielgruppe anbieten. In einer Bestandsaufnahme werden
Experten zum gegenwärtigen und geplanten IuKT Angebot für niedergelassene
Ärzte befragt. Es werden die Möglichkeiten des Informationsmanagements in
diesem Bereich erarbeitet, Grenzen aufgezeigt und Szenarien entwickelt, die
beleuchten, wie die Technologisierung der Arztpraxis in einigen Jahren
aussehen wird. Aufbauend auf die Ergebnisse dieser Analysen werden in
Kapitel 4 Produkt- und Dienstleistungsideen entwickelt, die in Kapitel 5 die Basis
für eine empirische Befragung bei niedergelassenen Ärzten bilden wird. Die
Datenanalyse dieser Befragung wird Aufschluss darüber geben, wie Ärzte zu e-
Health, Telemedizin und vorgeschlagenen Anwendungen und Dienstleistungen
gegenüberstehen. Im sechsten und letzten Kapitel folgen die Zusammenfassung
und die Schlussfolgerung.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Kurzfassung
Seite 14 von 172
Die technischen Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos, die Sinnhaftigkeit vieler
Anwendungen ist jedoch stark begrenzt. Daher wird diese Diplomarbeit die
Antwort darauf liefern, ob, und wenn ja, wie moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien den niedergelassenen Arzt wirklich sinnvoll
unterstützen können. Beantwortet wird auch die Frage, welche Anwendungen
und Dienstleistungen konkret das Potential besitzen, von niedergelassenen
Ärzten eingesetzt und honoriert zu werden.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Einleitung
Seite 15 von 172
1 Einleitung
1.1 Motivation für das Thema
Die Kombination von Informationsmanagement und Medizin ist die Grundlage
dieser Diplomarbeit. Bei e-Health handelt sich um ein innovatives Thema, das in
Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Der Trend zur Vernetzung im
Gesundheitswesen und somit der Einsatz neuer Technologien bei Diagnose,
Behandlung und Verwaltung wird immer deutlicher. Mit dem Institut für
Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wird diese Arbeit von
einem kompetenten Partner betreut.
1.2 Vorstellung des Institutes
Das Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation wurde
1989 an der Karl-Franzens-Universität Graz gegründet. Mittlerweile ist das
Institut Teil der neu gegründeten Medizinischen Universität Graz.
Arbeitsschwerpunkte
im
Bereich
der
Medizinischen
Informatik
sind
beispielsweise:
·
Elektronische multimediale Krankenakte
·
Wissenserschließung in medizinischen Datenbanken
·
Bildinformations- und Kommunikationssysteme (PACS)
·
Aus- bzw. Weiterbildung von StudentInnen und MedizinerInnen
Forschungsgebiete und Aufgaben im Bereich der Medizinischen Statistik und
Biometrie umfassen unter anderem
·
Entwicklung und Evaluierung von statistischen Methoden
·
Überlebensanalysen
e-Health und Telemedizin in Österreich
Einleitung
Seite 16 von 172
·
Statistische Beratung ("Statistische Ambulanz") bei medizinischen
Forschungsprojekten Aufgaben in der Lehre (vgl.
http://medinfo.uni-
graz.at
[1])
1.3 Themenabgrenzung
1.3.1 Was wird behandelt
Der zentrale Punkt dieser Arbeit ist der niedergelassene Arzt und seine Position
im immer aktueller werdenden Themengebiet e-Health. Als Ausgangspunkt
dient der Allgemeinmediziner, da dieser den Eintrittspunkt des Patienten in die
Behandlungskette darstellt. Der Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologie über die Grenzen der Praxissoftware hinaus ist der zentrale Punkt
dieser Diplomarbeit. Hierbei wird vor allem auf die Bedürfnisse und Wünsche
der Ärzte eingegangen.
Als Folge der äußerst interessanten Kombination von Informationstechnologie
und Medizin, sowie dem hohen Innovationsgrad der Disziplin kommt es jedoch
auf dem Gebiet der Medizinischen Informatik zu Produktentwicklungen, für die
kein Verwendungszweck bzw. keine Nachfrage gegeben ist. Man sollte sich vor
der Entwicklung einer neuen Applikation auf die Frage konzentrieren, ob für
diese überhaupt ein Bedarf gegeben ist, ob die gesellschaftlichen
Voraussetzungen gegeben sind und ob die gesetzlichen Rahmenbedingungen
eine Einführung überhaupt zulassen. Es sollte nicht mit der Suche nach einem
Verwendungszweck für eine schon entwickelte Technologie begonnen werden.
(vgl. Jähn, Nagel 2004, 344).
Die Sicht der Ärzte wird somit als eigener großer Punkt in Form einer Umfrage
behandelt.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Einleitung
Seite 17 von 172
1.3.2 Was wird nicht behandelt
e-Health bezieht sich laut Definition auf alle Bereiche und Beteiligte im
Gesundheitswesen. Vielfach wird auf die wichtige Rolle des Patienten beim
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie hingewiesen. Er ist
bisher auch der größte Nutznießer des Informationszeitalters. Es gibt bereits
zahlreiche Studien bzw. Publikationen über die Akzeptanz und die Rolle des
Patienten beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im
Gesundheitswesen. Der Patient wird nur am Rande, als Kunde und
Kommunikationspartner des niedergelassenen Arztes, behandelt.
Der Markt an Praxissoftware ist gesättigt. An die 90 % der Ärzte verwenden den
PC für die Verwaltung von Patientendaten. Diese Software in Ihren Grund-
funktionen wird in dieser Diplomarbeit nicht gesondert behandelt.
Das Krankenhaus bietet die größten Einsatzmöglichkeiten für moderne
Technologien. Es gibt zahlreiche Projekte die sich mit Einsatzmöglichkeiten von
Informations- und Kommunikationstechnologie im Krankenhaus befassen. Die
Krankenanstalten werden in dieser Diplomarbeit aber nicht den Schwerpunkt
bilden, sondern nur als Kommunikationspartner der niedergelassenen Ärzte
behandelt.
Des Weiteren muss erwähnt werden, dass nicht auf alle Initiativen und Projekte
in Österreich eingegangen werden kann. Viele Bildungseinrichtungen und
Privatunternehmen forschen und entwickeln derzeit auf dem Gebiet e-Health.
Alle gesondert aufzulisten würde den Rahmen dieser Diplomarbeit sprengen.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 18 von 172
2 Grundlagen von e-Health
Der Begriff e-Health bezieht sich auf Bereiche und Prozesse im Gesundheits-
wesen und in der Medizin, die auf moderne Informations- und Kommunikations-
technologie zurückgreifen. e-Health ist die Anwendung von Internettechnologien
im Gesundheitswesen mit folgenden beispielhaften Teilen
·
Patienteninformation
·
elektronische Patientenakte
·
Bereitstellung von medizinischem Wissen in Diagnostik und Therapie
·
Gesundheitsnetze für die integrierte Versorgung
·
Home Care
Es ermöglicht systemübergreifende Arbeitsprozesse und senkt somit die
Transaktionskosten. Idealerweise macht es e-Health möglich, dass alle Daten
eines Patienten jederzeit für alle Leistungserbringer verfügbar und kontrollierbar
sind.
e-Health
ermöglicht somit
Effizienzsteigerungen
und Qualitäts-
verbesserung in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung sowie Kosten-
einsparungen im gesamten Gesundheitswesen. (vgl. Bear, Aeppli, 2002, S9)
Zwar ist die Bezeichnung neu, die Idee zur elektronischen Übermittlung von
medizinischen Daten gibt es jedoch schon seit über 90 Jahren. Schon damals
wurden
an
der
Universität
Lund
Elektrokardiogramme
über
Telekommunikationsnetze gesendet. Bereits in der 60er Jahren begann man mit
der elektronischen Übermittlung von Röntgenbildern. (vgl. ISM, 2001, S10)
Durch den Eintritt unserer Gesellschaft in das Informationszeitalter haben sich
die Möglichkeiten der Medizin in den letzten Jahren enorm erweitert. Durch
Biosensoren und moderne Telekommunikation können Herzschrittmacher
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 19 von 172
eigenständig mit einer Überwachungszentrale kommunizieren. Ärzte können bei
Hausbesuchen aktuelle Medikamenteninformationen am mobilen Computer
abrufen und einen automatischen Risikocheck durchführen. Diese Beispiele
zeigen das hohe Potential, das moderne Informations- und Kommunikations-
technologie mit sich bringt. (vgl. Ärztemagazin [3], 2004, S35)
e-Health kann sämtlichen Beteiligten, vom Bürger bis zum Staat, Nutzen bieten.
Nachfolgend werden die Potentiale von e-Health aufgezeigt. Diese reichen von
besserer Information für den Bürger über Krankheiten, Diagnose und Therapie
über Zugriff auf Behandlungsleitlinien für Ärzte bis hin zu Informationen über
den Gesundheitszustand der Bevölkerung für die Verantwortlichen in der
Gesundheitspolitik.
Abbildung 1: Das Potential von e-Health
(vgl.
http://www.e-europeawards.org
[1])
eHealth empowers citizens:
· to be better informed about disease prevention and alternative lifestyle strategies for self-help
· to have confidence in an informed service delivering care according to a model more closely
related to their needs and perceptions
· to exercise reasonable levels of choice, which will help them to take a more active role in
managing their own health
eHealth empowers the patient:
· to gain access to information about diagnosis, treatment and best practice so they can be better
informed about their responsibilities
· to be more informed in their interactions with clinical professionals so they can be more aware of
actions they can take in self-help
eHealth empowers the clinicians and healthcare professionals:
· to gain access to information on patients, treatment and diagnosis from other parts of the care process
· to access information (about best practice..) to support their clinical activity
· to ensure that other institutions are able to share information and gain access to it at the point of care
· to develop new clinical applications to improve their workflow and clinical business processes
eHealth enables managers and regulators
· to make better use of available resources through more efficient context-sensitive scheduling and
ordering
· to work more effectively with supporting businesses utilising cost-efficient supply chain support
· to understand current societal changes in terms that are actually relevant to deliverers of care
The citizen becomes a patient
The managers collect data from the professionals
The patient goes to the health professional
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 20 von 172
Im Gesundheitswesen muss stets zwischen betriebswirtschaftlichem und
volkswirtschaftlichem Nutzen unterschieden werden. Innovationen, die
volkswirtschaftlich sinnvoll sind, können bei Ärzten zusätzliche Kosten und
Aufwand verursachen. Da der Arzt betriebswirtschaftlich denken muss, kann es
durchaus zu Interessenskonflikten kommen. In dieser Diplomarbeit wird e-
Health vor allem von der betriebswirtschaftlichen Seite betrachtet.
2.1 Begriffsbestimmung: Medizinische Informatik,
Gesundheitstelematik, Telemedizin, e-Health
Die
Kombination
von
Informations-/Kommunikationstechnologie
mit
Gesundheitswesen / Medizin erzeugt ein breites interdisziplinäres Themen-
gebiet mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Für dieses interdisziplinäre
Themengebiet sind in der Literatur zahlreiche unterschiedliche Begriffe zu
finden. Beispiele für diese unterschiedliche Namensgebung sind:
·
e-disease management
·
e-Health, e-Healthcare
·
e-medicine
·
Gesundheitstelematik, Health Telematics
·
Medizinische Informatik; Medical Informatics
·
Telehealth
·
Telemedizin
·
Telecare
Die folgende Tabelle zeigt die Häufigkeit von Literaturzitaten in der
medizinischen Literaturdatanbenk ,,PubMed" zu den Begriffen e-Health, e-
medicine, e-Healthcare, Telehealth und Telemedicine.
Jahr
e-Health
e-medicine e-Healthcare
telehealth
telemedicine
e
1990
-
-
-
-
6
1991
-
-
-
1
3
1992
-
-
-
1
46
1993
-
-
-
-
74
1994
-
-
-
-
120
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 21 von 172
1995
-
-
-
2
354
1996
-
-
-
4
466
1997
-
-
-
23
650
1998
-
-
-
32
772
1999
-
2
-
33
776
2000
52
-
3
43
657
Tabelle 1: Häufigkeit der Literaturzitate zu verschiedenen Schlüsselbegriffen in
medizinischer Literatur seit 1990 (vgl.
http://www.ism-austria.at
[1])
Suchte man im Juli 2004 nach den Begriffen e-Health und Telemedicine bzw.
Telemedizin in der Suchmaschine Google, so kommt man zu dem Ergebnis,
dass e-Health mit 753.000 Treffern bereits an erster Stelle liegt. Die anderen
beiden Begriffe kommen auf insgesamt 736.000 Treffer. Um sich mit e-Health
genauer auseinandersetzen zu können ist es erforderlich, die Unterschiede und
die Zusammenhänge dieser Begriffe zu verstehen. Um Unklarheiten zu
vermeiden und einen allgemeinen Überblick über die medizinischen
Fachgebiete zu geben, wird auch kurz auf die medizinischen Aspekte
eingegangen.
2.1.1 Medizinische Informatik
Laut Seelos ist die Medizinische Informatik ,,die Wissenschaft von der
Informationsverarbeitung und der Gestaltung informationsverarbeitender
Systeme in der Medizin und im Gesundheitswesen". (Seelos, 1997)
Die Medizinische Informatik ist eine anwendungsbereichspezifische Informatik,
die durch die besonderen Charakteristiken der Medizin begründet wird. Ziel ist
es, durch den Einsatz zeitgemäßer Informations- und Kommunikations-
technologien Struktur, Prozess und Ergebnis der Gesundheitsversorgung zu
unterstützen. (Seelos, 1997, S5)
Klassische Themen der Medizinischen Informatik sind Klassifikationssysteme,
Krankenhausinformationssysteme und Medizinische Bildverarbeitung. Jedoch
beschäftigt sich auch die Medizinische Informatik, der vorangegangenen
Definition nach, mit Telekommunikationstechnologien. Die Abgrenzung zur
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 22 von 172
Gesundheitstelematik ist schwierig, da sich beispielsweise viele Einrichtungen
für Medizinische Informatik auch mit Telekommunikation und in weiterer Folge
mit Telemedizin beschäftigen. Beispiele hierfür sind etwa das Institut für
Medizinische Informatik der Uni Lübeck (
http://www.medinf.mu-luebeck.de/
)
oder auch die Private Universität für Medizinische Informatik und Technik Tirol.
(UMIT,
www.umit.at
)
2.1.2 Gesundheitstelematik
Gesundheitstelematik bezeichnet Anwendungen von Telekommunikation und
Informatik im Gesundheitswesen. (vgl.
http://www.dimdi.de
[1])
Es umfasst sowohl administrative Prozesse als auch Verfahren der Behandlung
und Wissensvermittlung. Die Bandbreite der Telematik im Gesundheitswesen
reicht von informationstechnischen Lösungen, die in medizintechnischen
Anlagen implementiert sind wie Signalverarbeitung (z. B. bei der Elektro-
kardiographie), Bildverarbeitung (z. B. bei der nuklearmagnetischen Resonanz)
oder Mustererkennung (z. B. in Ultraschall), von Rekonstruktionsalgorithmen (z.
B. in der Computertomographie) bis zu Systemsteuerungen, aber auch von der
Patientendatenverwaltung bis zu wissensbasierten Systemen in Daten- und
Informationsbanken. (vgl.
http://www.agc.fhg.de
[1])
Die Disziplin erweitert somit die Medizinische Informatik um den Bereich der
Telekommunikation. Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt, sind die Grenzen
zur Medizinischen Informatik fließend.
2.1.3 Telemedizin
Dieser Diplomarbeit liegt folgende Telemedizin-Definition von M.J. Field zu
Grunde: Telemedicine is the use of information and telecommunication
technologies to provide and support healthcare when distance separates the
participants. (vgl.
http://www.agc.fhg.de
[1])
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 23 von 172
Die Telemedizin ist daher der Einsatz von Gesundheitstelematik zur
Überwindung einer räumlichen Trennung zwischen Patient und Arzt oder
zwischen mehreren behandelnden Ärzten. Beispiele hierfür sind:
·
Telekonsultation: Bei einer Telekonsultation wird die Zweitmeinung eines
Spezialisten mittels Videokonferenz eingeholt, gleichzeitig werden
multimediale Behandlungsdaten übertragen, um dem Spezialisten eine
qualifizierte Diagnose zu ermöglichen.
·
Tele-Monitoring: Hierbei werden permanent Biosignale wie Puls,
Blutdruck, EKG, Temperatur oder EEG mittels Handy oder anderen
Übertragungstechniken zu einer Überwachungszentrale gesendet,
welche die Vitalfunktionen des Patienten überwacht.
Vor allem Flächenstaaten wie Kanada, Australien und Norwegen, militärische
Einheiten oder Forscherteams an entlegenen Stellen, ziehen enormen Nutzen
aus der Telemedizin und treiben diese Entwicklung voran.
2.1.4 e-Health
Die WHO definiert e-Health folgendermaßen: "e-Health is a new term used to
describe the combined use of electronic communication and information
technology in the health sector. (vgl.
http://www.who.int
, [1])
Der Schweizer Professor A. Geissbühler definiert e-Healt folgendermaßen: ,, e-
Health is the use of Web-enabled systems and processes to accomplish some
combination of the following objectives:
·
Cut costs or increase revenues
·
Improve patient satisfaction
·
Contribute to enhancement of medical care"
·
Steamline operations (vgl. Baer, Aeppli, 2002, S11)
Eine weitere Definition ist folgende: ,,e-Health ist die Wahrnehmung von
Kommunikations- und Behandlungschancen, die sich aus der Digitalisierung von
gesundheitsbezogenen Informationen ergeben, sowohl seitens behandelnder
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 24 von 172
Ärzte als auch seitens Internet nutzender Patienten und Bürger". (vgl. Jäckel,
2000, S14) Der Begriff ist im Jahr 2000 erstmals in der Literatur aufgetreten.
2.1.5 Schlussfolgerung
e-Health ist ein sich international für ,,Gesundheitstelematik" einbürgernder
Begriff, der den Nutzen von IuK-Technologien für eine patientenorientierte und
gesundheitliche Versorgung umfassend beschreibt. Die Medizinische Informatik
ist eng mit der Gesundheitstelematik verwandt. Als enger gefasster Begriff
bezeichnet dagegen Telemedizin konkret den Einsatz von Telematik-
anwendungen, bei denen die Überwindung einer räumlichen Trennung von
Patient und Arzt oder zwischen mehreren Ärzten im Vordergrund steht. (vgl.
http://www.dimdi.de
[1]) Diese begriffliche Abgrenzung wird dieser Diplomarbeit
zugrunde gelegt.
Abbildung 2: Einordnung von e-Health und Telemedizin
(vgl.
http://www.agc.fhg.de
[1]; Jäckel, 2000, S14)
Telekommunikation
Informations-
technologie
Gesundheitswesen
und Medizin
Gesundheitstelematik
~ e-Health
Telemedizin
e-learning
EBM
Multimediale Krankenakte
Expertensysteme
...
...
e-Disease Management
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 25 von 172
2.2 Medizin
Die Medizin befasst sich mit der Gesundheit, sowie mit der Vorbeugung,
Erkennung und Behandlung von körperlichen uns seelischen Erkrankungen.
Teilbereiche der Medizin sind die Humanmedizin, Veterinärmedizin (Tier-
heilkunde)
und
Phytomedizin
(Pflanzenkrankheiten
und
Schädlinge).
Grundlagen sind die Naturwissenschaften Biologie, Chemie und Physik, im
speziellen Anatomie, Biochemie und Physiologie, ergänzt durch Psychologie
und Sozialwissenschaften. Die Vielfalt der Krankheiten, ihrer Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten hat zu einer Aufgliederung der Humanmedizin in
eine große Anzahl von Fachgebieten geführt. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[1])
Wichtige Fachgebiete werden nachfolgend kurz beschrieben und hinsichtlich
Ihrer Digitalisierbarkeit kommentiert.
2.2.1 Allgemeinmedizin
Die Allgemeinmedizin beinhaltet die Grundversorgung aller Patienten mit
körperlichen und seelischen Gesundheitsstörungen in der Notfall-, Akut- und
Langzeitversorgung. Allgemeinmediziner sind darauf spezialisiert, als erste
ärztliche Ansprechpartner bei allen Gesundheitsproblemen zu helfen. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[2]) Wissensmanagement, Digitalisierung von Patienten-
daten und Leitlinien in medizinischen Datenbanken sind nur einige
Möglichkeiten die sich in diesem medizinischen Fachgebiet anbieten.
2.2.2 Chirurgie
Die Chirurgie (altgriechisch ,,Handwerk") ist jenes medizinische Fachgebiet, das
sich mit der Behandlung von Krankheiten und Verletzungen durch direkte,
manuelle oder instrumentelle Einwirkung auf den Körper befasst. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[3]) Bezogen auf medizinische Technologien werden
immer häufiger Begriffe wie beispielsweise ,,Computer assistierte Chirurgie"
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 26 von 172
genannt, was die Unterstützung eines Chirurgen durch einen Computer vor oder
während (3D Visualisierung) einer Operation beschreibt.
2.2.3 Dermatologie
Die Dermatologie ist ein Teilgebiet der Medizin. Es befasst sich mit der
Abklärung, Behandlung und Betreuung von Patienten mit nichtinfektiösen und
infektiösen Erkrankungen der Haut sowie mit gut- und bösartigen Hauttumoren.
(vgl.
http://de.wikipedia.org
[4]) Dieses Teilgebiet der Medizin ist für die
Digitalisierung gut geeignet, da Veränderungen der Haut gut sichtbar sind und
sich somit für eine digitale Analyse und Übertragung in bildlicher Form eignen.
2.2.4 Innere Medizin
Die Innere Medizin beschäftigt sich mit der Diagnostik und nichtoperativen
Behandlung der Krankheiten innerer Organe. Dieses Fachgebiet der Medizin ist
in zahlreiche Teilgebiete untergliedert, welche wiederum jeweils ein eigenes
Fachgebiet darstellen. Beispiele hierfür sind etwa die Onkologie und die
Kardiologie. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[5]). Die Medizinische Informatik
beschäftigt sich auf dem Gebiet der Medizinischen Bildverarbeitung stark mit der
Inneren Medizin, da sich durch die Verarbeitung der Daten aus CT oder MRT
der menschliche Körper sehr gut dreidimensional darstellen lässt. Jedes
Teilgebiet der Inneren Medizin eröffnet weitere spezielle Möglichkeiten für die
Medizinische Informatik.
2.2.5 Kardiologie
Die Kardiologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin, welches sich mit
Herzerkrankungen und teilweise auch mit Gefäßerkrankungen beschäftigt. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[6]) Die Kardiologie ist durch die Fülle von Biosignalen die
sich messen und übertragen lassen wie EKG oder Blutdruck gut für
telemedizinische Anwendungen geeignet.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 27 von 172
2.2.6 Ophthalmologie
Die Augenheilkunde, Ophthalmologie, befasst sich mit den Erkrankungen am
Auge. Auch hier sind, wie bei der Dermatologie oder der Pathologie visuelle
Informationen von Bedeutung. Somit sind unter anderem Aspekte der
Medizinischen
Bildverarbeitung
in
diesem
Teilgebiet
relevant.
(vgl.
http://de.wikipedia.org
[7])
2.2.7 Onkologie
Onkologie bedeutet ,,die Wissenschaft von Krebs". Die Onkologie beschäftigt
sich
mit
sämtlichen
Aspekten
bösartiger
Tumorerkrankungen.
(vgl.
http://de.wikipedia.org
[8]) In der Krebsforschung ist Wissensmanagement von
großer Bedeutung, digitale Bildverarbeitung und Online-Selbsthilfegruppen
können einiges zur besseren Diagnose bzw. zur seelischen Unterstützung von
Krebs Patienten beitragen.
2.2.8 Pathologie
Die Pathologie (,,pathos" = Leiden) bezeichnet die Lehre von abnormen,
krankhaften Vorgängen und Zuständen von Lebewesen und deren Ursachen.
Die Pathologie ist somit die Krankheitslehre. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[9])
Auch in der Pathologie fallen visuelle Informationen an. Histologische Schnitte
eignen sich beispielsweise gut für eine elektronische Übertragung.
Wissensmanagement spielt aufgrund der Fülle an weltweitem Wissen, wie in
allen anderen Fachgebieten eine große Rolle.
2.2.9 Radiologie
Die Radiologie befasst sich mit der Anwendung von Strahlen zu diagnostischen,
therapeutischen und wissenschaftlichen Zwecken. Ein Teilgebiet davon ist die
Nuklearmedizin. (vgl.
http://de.wikipedia.org
[10]) Die Radiologie ist heute das
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 28 von 172
Gebiet, in dem bisher am meisten in telemedizinische Anwendungen investiert
wurde, da das Ergebnis einer radiologischen Untersuchung immer visuelle
Informationen (Ultraschall, Szintigraphie, CT) sind. Die rasche Übertragung von
radiologischen Bilddaten ermöglicht beispielsweise die Befundung durch einen
Spezialisten von einem entfernten Ort.
2.3 Informationsmanagement in der Medizin
Informationsmanagement umfasst nach Schwarze ,,alle Aufgaben der
Beschaffung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung und Bereitstellung von
Informationen in einer Organisation". (Schwarze, 1998, S45)
Informationen über den Patienten und über Behandlungsmöglichkeiten am
richtigen Ort zur richtigen Zeit und der besten Qualität sind besonders in der
Medizin ein kritischer Erfolgsfaktor und können lebensrettend sein. Aufgrund der
sektoralen Trennung der Leistungserbringung, kommt es im Gesundheitswesen
zu einer komplexen Situation im Bezug auf Informations- und Kommunikations-
prozesse. Informationsmanagement kann hier Abhilfe schaffen.
Christian Baer und Rahel Aeppli gehen sogar so weit und setzen e-Health mit
Informationsmanagement gleich. (vgl. Baer, Aeppli, 2002, S109)
2.3.1 Aufgaben des Informationsmanagements
Die nachfolgende Grafik verdeutlicht, wo Informationsmanagement in der
Medizin und im Gesundheitswesen angewendet werden kann. Diese werden
anhand des ,,zweidimensionalen Aufgabenmodells des IM" nach Schwarze
verdeutlicht.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 29 von 172
Abbildung 3: Aufgaben des IM bezogen auf das Gesundheitswesen (vgl.
Schwarze, 1998, S72)
2.3.2 Ein konkretes Beispiel
Da es in der Gesundheitsversorgung viele getrennte Leistungserbringer gibt,
wäre ein durchgehender Informations- und Kommunikationsfluss wünschens-
wert.
Man stelle sich einen älteren Herrn mit Übergewicht und Herz-
rhythmusstörungen vor. Dieser Herr hat mehrere Tage hintereinander Blut im
Stuhl festgestellt und sucht daher seinen langjährigen Hausarzt auf. Die
folgende Tabelle bezieht sich auf Leistungserbringer, die in direktem Kontakt mit
Informations- und Kommunikationsbedarfanalysen bei Ärzten,
Informationstechnologische Strategieentwicklung für das gesamte
Gesundheitswesen, elektronische Patientenakte, Visualisierung
medizinischer Daten
Schulung der Ärzte
Entwicklung von online-Datensicherungssystemen für die
Praxissoftware, Sicherheitskonzept für den Austausch medizinischer
Daten, Schulung der PraxisassistentInnen
Rechtliche Aspekte beim übertragen von medizinischen Daten
Schaffung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Vernetzung
im Gesundheitswesen durch Beratung
Z.B. Online Benchmarking für Ärzte, e-Rezept, medizinische
Wissensdatenbanken, Evidenz basierte Medizin (EBM) und
Telekonsultation heben die Prozessqualität der Arbeit eines Arztes
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 30 von 172
dem Patienten stehen. Auf weitere Leistungserbringer wie z.B. das Labor wird
der Einfachheit halber verzichtet.
Leistungserbringer
(direkter Kontakt)
Durchgeführte Tätigkeiten
Output (u.a.)
Hausarzt
Untersuchung, verschiedene
Laboruntersuchungen
Lokale persönliche Krankengeschichte
Laborresultate
Überweisung, Befund für den Facharzt
Abrechnung mit Krankenkasse
Facharzt
Darmspiegelung
Befund: Darmkrebs
Überweisung, Befund für das Krankenhaus
Abrechnung mit der Krankenkasse
Krankenhaus
Weitere Untersuchungen:
Blutbild, Tumormarker, EKG,
Thoraxröntgen, Ultraschall,
Computertomographie)
Lokale persönliche Krankengeschichte
Laborresultate
Radiologischer Befund
Abrechnung mit der Krankenkasse
Entfernung des befallenen
Darmstückes
Pathologischer Bericht
Anästhesieprotokoll
Operationsbericht
Austrittsbericht für den zuweisenden Arzt
Abrechnung mit der Krankenkasse
Rahabilitationsklinik
Längerer Aufenthalt, permanente
Untersuchungen
Lokale persönliche Krankengeschichte
Überweisungsbericht für den Kurarzt
Verlaufsbericht an das Krankenhaus
Abrechnung mit der Krankenkasse
Hausarzt
Überwachung des
Gesundheitszustand
Lokale persönliche Krankengeschichte
Laborresultate
Überweisung, Befund für den Facharzt
Abrechnung mit Krankenkasse
Tabelle 2: Anfallender Output bei verschiedenen Leistungserbringern
Durch die mangelnde Vernetzung der Leistungserbringer bzw. das Fehlen einer
einheitlichen Patientenakte ist es schwer möglich, eine Übersicht über die
Krankengeschichte des Patienten zu erhalten. Die Transaktionskosten für
Befundübermittlung und Datennacherhebung sind hoch und Medienbrüche
verzögern den Diagnose-, Behandlungs- und Rehabilitationsprozess. Weiters
sind vermeidbare Doppeluntersuchungen unangenehm für den Patienten. Das
es hier großes Verbesserungspotential gibt, ist offensichtlich. Zusätzlich zu den
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 31 von 172
Prozessverbesserungen
könnten
anonymisierte
Behandlungsdaten
zur
medizinischen Forschung großen Beitrag leisten. Durch eine zentral verfügbare
Krankengeschichte, mit entsprechenden Zugriffsrechten für alle Beteiligten
könnte die Situation erheblich verbessert werden. (vgl. Baer, Aeppli, 2002, S10)
2.4 Das Gesundheitswesen in Österreich und
seine Akteure
Die Republik Österreich liegt in Zentraleuropa und hat gegenwärtig auf einer
Fläche von 83855 km² 8,11 Millionen Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte
von 97 Einwohnern pro Quadratkilometer entspricht.
2.4.1 Statistische Grundlagen
Die folgende Tabelle beinhaltet wichtige statistische Daten, die Grundlegend für
einige Ausführungen in dieser Diplomarbeit sein werden. Die letzte Volks-
zählung ergab eine Einwohnerzahl von 8,11 Millionen, was einen starken
Anstieg in den letzten Jahrzehnten bedeutet. Die Lebenserwartung der
Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten stark erhöht. So wird die durch-
schnittliche Österreicherin mit 81,2 Jahren um 7,8 Jahre, der durchschnittliche
Österreicher mit 75,4 um 8,9 Jahre älter als noch vor 30 Jahren. Einen starken
Anstieg an Ärzten konnte man in den letzten 30 Jahren verzeichnen.
1970
Heute
2030
Bevölkerung
7,4 Mio.
8,11 Mio.
-
Lebenserwartung Frau
73,4
81,2
85,5
Lebenserwartung Mann
66,5
75,4
80
Über 60 jährige
-
20,7 %
32,2 %
Haushalte mit Computer
-
49,3 %
-
Haushalte mit Internetanschluss
Davon Breitbandverbindungen
-
-
36,2 %
27,4 %-
-
Haushalte mit Mobiltelefon
-
74,7%
-
Allgemeinmediziner
4244
5794
-
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 32 von 172
Fachärzte
4923
10491
-
Durchschnittlicher
Patientenkontakt pro Tag
-
48
-
Tabelle 3: Statistische Daten in der Übersicht
(vgl. ISM, 2001, S146; BMSG, 2001 S11 ff,
http://www.statistik.at
[1])
Bereits in jedem zweiten Haushalt ist ein Computer vorhanden, mehr als ein
drittel der Haushalte besitzen einen Internetzugang. Am weitesten verbreitet
sind Mobiltelefone. In 3 von 4 Haushalten ist mindestens ein Mobiltelefon
vorhanden. Die Zahl der niedergelassenen Ärzte ist in den letzten 30 Jahren im
Vergleich zur Bevölkerungszahl überproportional gestiegen. Der Anstieg ist bei
Fachärzten ist dabei besonders stark. Diese demographische Entwicklung hat
besonders auf das Gesundheitswesen große Auswirkungen. Der große
Zuwachs alter und hochbetagter Menschen bringt Herausforderungen für die
Gesundheitspolitik und besonders für die Telemedizin mit sich.
2.4.2 Struktur des österreichischen Gesundheitswesens und
die Interessen der Akteure
Die Struktur des Gesundheitswesens in Österreich ist durch die Interaktion
öffentlicher, privat-gemeinnütziger und privater Akteure bestimmt.
Im National- und Bundesrat werden von den Ministerien eingebrachte
Gesetzesvorschläge parlamentarische behandelt. Das BMSG überwacht als
Aufsichtsbehörde die Einhaltung der Gesetze, die von der Standesvertretung
der Ärzte (Ärztekammer) und den Trägern der sozialen Krankenversicherung
zur Sicherstellung der ambulanten Versorgung umgesetzt werden. Durch die
Bezahlung des verpflichtenden Krankenversicherungsbeitrages erhalten die
Patienten einen Rechtsanspruch auf Behandlung durch einen Leistungs-
erbringer. Der Arzt kann von den Patienten frei gewählt werden. Zwischen den
Standesvertretungen der Ärzte und der sozialen Krankenversicherung werden
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 33 von 172
3
Bundesregierung
Parlament
Ministerien
National-/Bundesrat
Landesregierung
Landesrat
Landtag
Strukturfond
Strukturkommission
Landesfond
Landeskommission
Hauptverband der
Sozialversicherung
Krankenkassen
Ärztekammer
Ärzte
Patient
Krankenanstalten
2
1
3
5
3
3
5
2
1
4
3
7
6
8
8
periodisch Verhandlungen geführt, in der die Anzahl der Vertragspartner, das
Honorierungsschema und die Menge der verfügbaren Leistungen vertraglich
festgelegt werden.
Die Beziehungen zwischen den Krankenanstalten und den Kranken-
versicherungen sind im B-KAG, L-KAG und im ASVG geregelt. Die soziale
Krankenversicherung finanziert mehr als die Hälfte der Kosten der Spitäler. Der
Versorgungsauftrag obliegt den Ländern, der von den Spitalserhaltern
umgesetzt wird. Investitions-, Erhaltungs- und Teile der Betriebskosten werden
von Bund, Ländern und Spitalserhaltern bezahlt. Im Jahr 1997 wurden neun
Landesfonds zur Finanzierung der Krankenanstalten eingerichtet, welche mit
budgetierten Mitteln der sozialen Krankenversicherung und steuerlichen Mitteln
gespeist werden. (vgl. Hofmarcher et al., 2001, S11f) Die folgende Grafik
verdeutlicht die Organisationsstruktur des österreichischen Gesundheitswesens.
Abbildung 4: Organisationsstruktur des Gesundheitswesens und Beziehungen
zwischen den Elementen des Systems
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 34 von 172
1:
Gesetzesvorschläge der Bundesregierung bzw. Landesregierung an das
Parlament bzw. den Landtag. Die Gesetzgebung über die Grundsätze im
Gesundheitswesen ist Bundessache, die Vollziehung ist Landessache.
2:
Die Gesundheitsverwaltung obliegt dem Bund (Gesundheitspolizei, Sanitäre
Aufsicht
über
Krankenanstalten,
Aufsicht
über
Ärztekammer
und
Sozialversicherungsträger) sowie dem Land (Investitionsfinanzierung im Bereich
der Krankenanstalten, Umsetzung der Planung, Errichtungs- und Betriebs-
bewilligungen)
3:
Bestellung der Mitglieder der Struktur- und der Landeskommission. Die
Bundesstrukturkommission beobachtet die Entwicklung im Gesundheitswesen.
Die Landesstrukturkommissionen übernehmen ebenso wie die Bundesstruktur-
kommissionen Steuerungs- und Abstimmungsaufgaben. Ziel ist es, eine
verstärkte Kooperation und Integration zwischen den verschiedenen
Gesundheitsbereichen zu erreichen und Maßnahmen zur strukturellen
Veränderung des Gesundheitswesens zu fördern. Um finanzielle Folgen von
Strukturveränderungen zu bewältigen, wurden Konsultations- und Sanktions-
mechanismen festgelegt. Mitglieder dieser Kommission sind Vertreter des
Bundes, der Sozialversicherungsträger, der Länder, des Städtebundes und der
konfessionellen Krankenhäuser.
4.
Aufgrund des Konsultationsmechanismuses ist eine Abstimmung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden hinsichtlich Gesetzen und Verordnungen, die
zusätzliche Kosten verursachen vorgesehen. Zwischen Ländern und
Sozialversicherung gibt des diesen Konsultationsmechanismus, wenn es sich
um Leistungsverschiebungen im Gesundheitswesen handelt.
5.
Der Bund kann bei Verstößen gegen verbindliche Planung und
vorgeschriebene Dokumentation Geld für den jeweiligen Landesfonds zurück-
halten.
6.
Verhandlungen zwischen Hauptverband und Ärztekammer über Markteintritt,
Leistungen und Tarife.
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 35 von 172
7.
Es besteht die obligatorische Mitgliedschaft bei einem Sozialversicherungs-
träger. Es besteht des Weiteren ein Kontrahierungszwang (Verpflichtung zum
Vertragsabschluss) seitens der Sozialversicherungsträger.
8.
Der Patient kann seinen Arzt frei wählen. Für Krankenanstalten und Ärzte
besteht ein Behandlungsgebot. (vgl. Hofmarcher et al., 2001, S11f)
2.4.2.1 Entscheidungsträger
Die zwei Ministerien, deren Handlungen unmittelbare Auswirkungen auf das
österreichische Gesundheitswesen haben, sind das Bundesministerium für
Gesundheit und Frauen sowie das Bundesministerium für Soziale Sicherheit,
Generationen und Konsumentenschutz, wobei das BMGF seit 2003 in einigen
Bereichen der Rechtsnachfolger des BMSG ist. Aus allen Teilzielen, die auf den
offiziellen Seiten der Parteien und Ministerien zu finden sind ergeben sich drei
übergeordnete Ziele. Dies sind, bezogen auf die Gesundheitspolitik, die Kosten-
senkung bei der Leistungserbringung, die optimale medizinische Versorgung für
alle Bevölkerungsschichten und die Verbesserung des Gesundheitszustandes
der
österreichischen
Bevölkerung
durch
Präventionsmaßnahmen
und
professionelle medizinische Forschung. (vgl.
http://bmgf.cms.apa.at
[2]) Diese
Interessen ergeben ein Spannungsfeld, da beispielsweise die optimale
medizinische Versorgung ebenso wie professionelle medizinische Forschung zu
einer Steigerung der Investitionskosten führen. Andererseits senken diese
Ausgaben die langfristigen Kosten für die Behandlung erkrankter Menschen.
2.4.2.2 Kostenträger
Es gibt in Österreich 28 Sozialversicherungsträger welche im Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger zusammengefasst sind. Der Haupt-
verband nimmt die Interessen der Sozialversicherung wahr und vertritt sie nach
außen. Die österreichische Sozialversicherung hat einen wichtigen Einfluss auf
sozialen Frieden, Wohlstand und das demokratische Gefüge in Österreich. Sie
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 36 von 172
ist eine Pflichtversicherung, die dem Versicherten das Recht auf Leistung bei
Krankheit, Unfall und Alter sichert. Mehr als 98% der österreichischen
Bevölkerung sind durch sie versichert. Die Beiträge sind nicht nach Risiko
sonder nach Einkommen gestaffelt. Die Verwaltung obliegt Vertretern, die von
den Interessensvertetungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer entsendet
werden
(,,Selbstverwaltung").
Diese
Organisationsform
garantiert
Unabhängigkeit vom Staat und größtmögliche Nähe zu den Versicherten.
Die Sozialversicherung legt großen Wert auf die Gesundheitsvorsorge und das
Verständnis der Versicherten für eine gesunde Lebensweise. Die finanzielle
Stabilität ist ein wichtiges Ziel der Sozialversicherung. Dies liegt auf der Hand,
da jeglicher Behandlungsfall und jede Inanspruchnahme medizinischer Leistung
der Sozialversicherung Kosten verursacht.
2.4.2.3 Leistungserbringer
Jene Einrichtungen, die die unmittelbare Leistung am oder für den Patienten
erbringen werden als Leistungserbringer bezeichnet. Dies sind niedergelassene
Ärzte, Krankenanstalten und ihre Ambulanzen, Rettungsdienste sowie der
Pflege- und Rehabilitationsbereich. Die jeweiligen Versorgungsleistungen
werden von diesen unterschiedlichen Stufen des Gesundheitssystems erbracht.
Dabei ist wichtig, dass Leistungen der nächsthöheren Stufe erst dann erbracht
werden sollte, wenn diese auf der vorgelagerten Stufe nicht mehr erbracht
werden können.
Die
unterste
Stufe
der
Versorgung
ist
der
Hausarzt,
der
auch
Allgemeinmediziner oder praktischer Arzt genannt wird. Teuerste und oberste
Stufe, wie auch aus Abbildung 5 ersichtlich ist das Krankenhaus. (vgl.
Astleithner, 2000, S99).
e-Health und Telemedizin in Österreich
Grundlagen von e-Health
Seite 37 von 172
Versicherungsleistungen der Krankenversicherung 2001
31%
26%
23%
7%
4%
4%
2% 2% 1%
Krankenanstalten
Ärztliche Hilfe
Heilmittel, Heilbehelf e,
Hilfsmittel
Zahnbehandlung und -
ersatz
Mutterschaftsleistungen
Krankengeld
Rehabilitation und
Hauskrankenpflege
Sonstige Leistungen
Gesundheitsvorsorge
Abbildung 5: Versicherungsleistungen der Krankenversicherung 2001 (vgl.
http://bmgf.cms.apa.at
[2]
Abbildung 6 verdeutlicht das Versorgungskontinuum durch Leistungserbringer
im Gesundheitswesen. (vgl. Jähn, Nagel, 2004, 148) Dies ist durchaus noch
weiter unterteilbar, z.B. in ambulante und stationäre Versorgung.
Abbildung 6: Das Versorgungskontinuum (vgl. Jähn, Nagel, 2004, 148)
Der Patient muss schlimmstenfalls die gesamte Versorgungskette des
Gesundheitssystems durchlaufen.
Das oberste Ziel der niedergelassenen Ärzte ist die kompetente, medizinische
Versorgung der Bevölkerung entsprechend ihrer medizinischen, therapeutischen
und technischen Ressourcen. Die Praxis betriebswirtschaftlich zu führen und
möglichst ungestresst nach Hause zu gehen ist ein weiteres wichtiges Ziel. Die
Patienten und der Arzt sollten die Praxis zufrieden verlassen. Ein weiteres Ziel
Hausarzt
(5794)
Facharzt
(10491)
Krankenhaus
(216)
Rehabilitation
(105*)
Pflege
(105*)
Weitere
Leistungs-
erbringer
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783836631235
- DOI
- 10.3239/9783836631235
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FH Joanneum Graz – Informationsmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Juni)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- telemedizin arzt informatik medizin
- Produktsicherheit
- Diplom.de