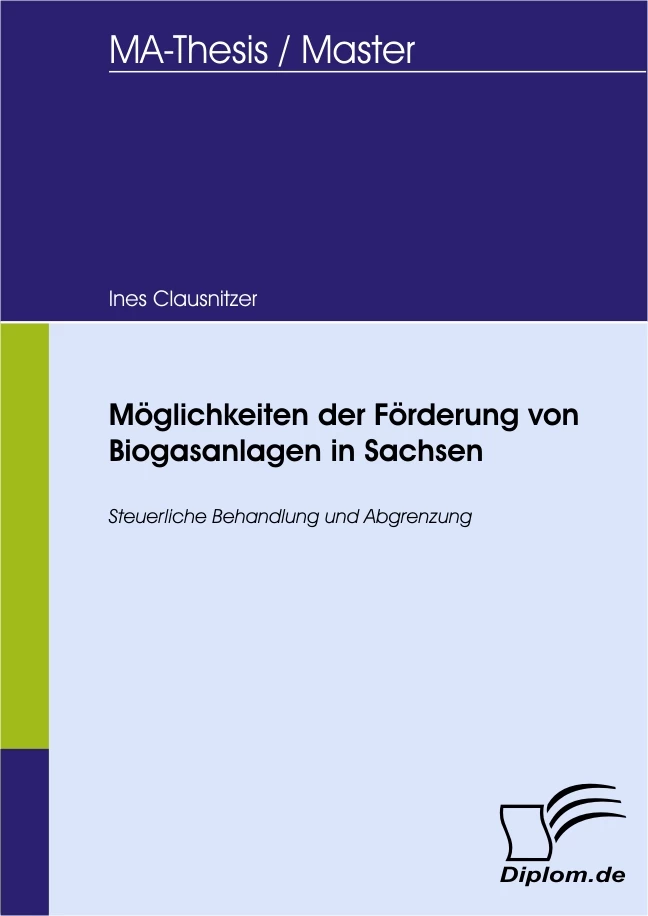Möglichkeiten der Förderung von Biogasanlagen in Sachsen
Steuerliche Behandlung und Abgrenzung
Zusammenfassung
In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise für Energieträger fossiler Herkunft weltweit nahezu verdoppelt und Deutschland ist von den natürlichen Voraussetzungen her stark auf deren Importe angewiesen. Die einzig verfügbare Kohle kann aus ökologischen und ökonomischen Gründen nur begrenzt Ersatz bieten oder den Mehrbedarf decken.
Das führte zwangsläufig zur Erhöhung der Energiekosten in allen Wirtschaftszweigen und in den privaten Haushalten unseres Landes. Diese anhaltende Situation zwang zum Nachdenken über den sparsamen Umgang mit Energieträgern, vor allem aber auch nach alternativen Wegen der eigenen Energieerzeugung zu suchen.
Mit selbsterzeugter Energie Kosten zu sparen oder gar damit noch Geld zu verdienen, stellte den Idealfall dar. Dies veranlasste die Bundesrepublik Deutschlandund den Freistaat Sachsen dafür mit bestimmten Fördermodellen Anreize für Erzeuger wie Verbraucher zu schaffen. Solche staatlichen Angebote werden schnell angenommen, sie ziehen aber genau so schnell wieder Korrekturen nach sich, weil sie Eingriffe in die Wirtschaftskreisläufe darstellen. Dieser Unsicherheitsfaktor erforderte Garantien für die Investoren, wie zum Beispiel mit Preisstützungen (Biodiesel), Förderprogrammen (KfW) oder steuerlichen Vergünstigungen und besonders mit dem Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG), welches die Netzbetreiber zu langfristiger Einspeisegenehmigung verpflichtet.
Während die alternativen natürlichen Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme, schon lange eine standortbedingte Abschöpfung erfuhren und weiter nach dem wissenschaftlichen Stand entwickelt werden, ist die Nutzung biologischer Ressourcen relativ jung. Dazu zählen pflanzliche Erzeugnisse, Pflanzen und ihre Rückstände, Holz und seine Abfälle, Dung aus der Tierhaltung sowie nahezu alle biologischen Abfälle. Auf dieser Basis entstand die Idee Biomassen bakteriell abbauen zu lassen und das dadurch freigesetzte Gas (Methan) energetisch zu nutzen.Mehrere Einsatzmöglichkeiten entwickelten sich für die primäre und sekundäre Energieerzeugungund -nutzung daraus.
Mit diesem natürlichen Angebot an Biomaterial erlangt die Land- und Forstwirtschaft durch Landbesitz oder Bodenbewirtschaftung wieder eine höhere Bedeutung und sicherere Stellung in der Volkswirtschaft. Von den 12 Mio. ha Ackerland in Deutschland stellten im Jahr 2007 die Landwirte auf ca. 400.000 ha Energiepflanzen für die Biogaserzeugung zur Verfügung. Steigerungen für die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise für Energieträger fossiler Herkunft weltweit nahezu verdoppelt und Deutschland ist von den natürlichen Voraussetzungen her stark auf deren Importe angewiesen. Die einzig verfügbare Kohle kann aus ökologischen und ökonomischen Gründen nur begrenzt Ersatz bieten oder den Mehrbedarf decken.
Das führte zwangsläufig zur Erhöhung der Energiekosten in allen Wirtschaftszweigen und in den privaten Haushalten unseres Landes. Diese anhaltende Situation zwang zum Nachdenken über den sparsamen Umgang mit Energieträgern, vor allem aber auch nach alternativen Wegen der eigenen Energieerzeugung zu suchen.
Mit selbsterzeugter Energie Kosten zu sparen oder gar damit noch Geld zu verdienen, stellte den Idealfall dar. Dies veranlasste die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Sachsen dafür mit bestimmten Fördermodellen Anreize für Erzeuger wie Verbraucher zu schaffen. Solche staatlichen Angebote werden schnell angenommen, sie ziehen aber genau so schnell wieder Korrekturen nach sich, weil sie Eingriffe in die Wirtschaftskreisläufe darstellen. Dieser Unsicherheitsfaktor erforderte Garantien für die Investoren, wie zum Beispiel mit Preisstützungen (Biodiesel), Förderprogrammen (KfW) oder steuerlichen Vergünstigungen und besonders mit dem Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG), welches die Netzbetreiber zu langfristiger Einspeisegenehmigung verpflichtet.
Während die alternativen natürlichen Energiequellen wie Sonne, Wind, Wasser und Erdwärme, schon lange eine standortbedingte Abschöpfung erfuhren und weiter nach dem wissenschaftlichen Stand entwickelt werden, ist die Nutzung biologischer Ressourcen relativ jung. Dazu zählen pflanzliche Erzeugnisse, Pflanzen und ihre Rückstände, Holz und seine Abfälle, Dung aus der Tierhaltung sowie nahezu alle biologischen Abfälle. Auf dieser Basis entstand die Idee Biomassen bakteriell abbauen zu lassen und das dadurch freigesetzte Gas (Methan) energetisch zu nutzen. Mehrere Einsatzmöglichkeiten entwickelten sich für die primäre und sekundäre Energieerzeugung und -nutzung daraus.
Mit diesem natürlichen Angebot an Biomaterial erlangt die Land- und Forstwirtschaft durch Landbesitz oder Bodenbewirtschaftung wieder eine höhere Bedeutung und sicherere Stellung in der Volkswirtschaft. Von den 12 Mio. ha Ackerland in Deutschland stellten im Jahr 2007 die Landwirte auf ca. 400.000 ha Energiepflanzen für die Biogaserzeugung zur Verfügung. Steigerungen für die nächsten Jahre werden auf 4 Mio. ha geschätzt.
Die besondere Stellung der Landwirtschaft im Verbund der Volkswirtschaft, bedingt durch natürliche Standortunterschiede und Besonderheiten, führte im Geschichtsverlauf schon immer zu differenzierten staatlichen Unterstützungen. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union hat sich diese differenzierte Stellung noch verschärft. Geologische und klimatische Vor- und Nachteile wirken drastischer und ganze Regionen sind Länder übergreifend bedroht.
Aus diesem Gesichtspunkt heraus wurde die Landwirtschaft zum höchsten Nehmer an Fördermitteln aus dem EU – Haushalt, was perspektivisch gesehen aber einen Unsicherheitsfaktor für künftige Zahlungsansprüche der Landwirte im Vergleich mit reinen Gewerbebetrieben darstellt, welche sich der alternativen Energieerzeugung widmen.
Das Angebot an verschiedenen Förderinstrumenten und eine abweichende steuerliche Gesetzgebung zwischen Landwirtschaft und Gewerbe sowie verschiedene Modelle an Eigentums- und Rechtsformen der Betriebe, die wiederum Betriebsteilverflechtungen heraufbeschwören, erschweren die Abgrenzung, Einordnung und den Vergleich von Betrieben mit unterschiedlichen Einkunftsarten. Diese Schwierigkeiten resultieren in der heutigen modernen Betriebsführung aus einer Verwischung von Tätigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft (LuF) und in gewerblichen Tätigkeiten. Erschwert wird die Problematik zusätzlich dadurch, dass es in den Steuergesetzen selbst an der Abgrenzung der Begriffe - Betrieb der LuF - und dem - Gewerbebetrieb - fehlt. Die Landwirtschaft ist zwar noch immer ein stark spezialisierter Produktionszweig, aber zunehmende Erschließungsmöglichkeiten durch die Eröffnung neuer Einkommensquellen führen zu gemischten Tätigkeiten, die zu Überschneidungen und damit zu Abgrenzungsproblemen, wie z.B. in der Biogasproduktion, führen.
1.2 Ziel und Vorgehensweise
Das Hauptziel der vorliegenden Masterarbeit ist:
- Das Aufzeigen von rechtlichen Rahmenbedingungen und vorhandenen Förderinstrumenten in Sachsen
- Einflüsse ertrags- und umsatzsteuerrechtlicher Fragen auf eine effiziente Biogasproduktion im landwirtschaftlichen und gewerblichen Einzelunternehmen herauszustellen
- Anhand gewonnener Erkenntnisse sollen Beratungsempfehlungen ableitbar sein, um potentielle Interessenten in der Planungs- und Vorbereitungsphase informieren zu können
Um die Ziele der vorliegenden Masterarbeit zu erreichen wurde methodisch differenziert vorgegangen. Die Fragestellungen an die Literatur zeigten bald die Grenzen an auswertbaren Daten. Biogasbetreiber unterliegen keiner gesetzlichen Anmeldungspflicht, so dass die Beschaffung von Daten über zentrale Institute[1] sich ebenfalls als wenig hilfreich erwies.
So wurden zwei Betriebe, ein landwirtschaftlicher Biogasbetreiber und ein Gewerbebetrieb hinsichtlich Problemstellungen bei der Betriebsgründung, der Förderung, steuerlichen Einordnung und den sich daraus ergebenden Konsequenzen aufgesucht und evaluiert.
Weiterhin wurden durch Telefonate und persönliche Gespräche mit der Landesanstalt für Umwelt und Geologie, verschiedenen Steuerbüros, Banken und der Industrie- und Handelskammer (IHK) umfangreiche Recherchen betrieben.
Im Punkt 2 der Arbeit wird zunächst ein allgemeiner Überblick zu aktuellen Förderinstrumenten im Zeitraum 2007 - 2012 gegeben.
Da bei den Landwirten und auch Investitionsberatern immer wieder Fragen aufkommen, warum die strikte Trennung der Förderung im Landwirtschaftsbereich und Gewerbebereich besteht, werden rechtliche Grundlagen zur Abgrenzung der Förderverfahren (gewerblich und landwirtschaftlich) dargestellt.
Im Punkt 3 werden steuerliche Besonderheiten eines landwirtschaftlichen Biogasbetreibers und Stromerzeugers als Einzelunternehmen herausgearbeitet.
Der Punkt 4 beinhaltet die steuerlichen Auswirkungen für den Unternehmer, welcher sich für die Produktion von Biogas und Strom als gewerblicher Einzelunternehmer entscheidet.
Das Ergebnis der Arbeit soll dazu führen, dass Investitionsberater und Betreiber von Biogasanlagen mit Netzeinspeisung zur Gesamtthematik einen kompensierten Leitfaden erhalten.
1.3 Stand der Entwicklung der Biogasanlagen in Sachsen
Im Jahr 2000 trat das Erneuerbare-Energien-Gesetz, im folgenden EEG genannt, in Kraft. Durch seine Novellierung im Jahr 2004 hat sich die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen in Deutschland und damit auch in Sachsen zu einem festen Bestandteil der Energiepolitik entwickelt. Deutschland rückt damit seinen übernommenen Verpflichtungen zur Klimakonferenz in Kyoto (Japan), die Treibhausgase in der Atmosphäre zielstrebig zu verringern, deutlich näher.
Der variable finanzielle Bonus zur Einspeisung von Elektroenergie, welche aus der Verbrennung von Biogasen erzeugt wird, schaffte schnellwirkende Anreize für die Unternehmen. Seitdem ist, wie die nachfolgende Grafik darstellt, ein enormer Anstieg der Anzahl von Biogasanlagen in Sachsen, besonders in landwirtschaftlichen Betrieben, zu verzeichnen.
Tabelle 1: Entwicklung der Anzahl der Biogasanlagen in Sachsen[2]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das erste Pilotprojekt in Sachsen wurde 1994 gebaut. Konnten die Verbände im Jahr 2003 in Sachsen 29 Biogasanlagen zählen, so stieg die Anzahl landwirtschaftlicher und industrieller Biogasanlagen im Jahr 2007 bereits auf 148 Objekte. Von den genannten 148 Anlagen waren bei der Landesanstalt für Landwirtschaft 138 landwirtschaftliche Biogasanlagen registriert. Der Anteil landwirtschaftlicher Biogasanlagen beträgt somit 93 %.
Laut einer vorgenommenen Analyse der von der Sächsischen Energieagentur GmbH (SAENA) bereitgestellten Daten wurden bis Mai 2008 insgesamt 149 Anlagen mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 59.968 kW im Landwirtschafts- und Gewerbebereich gefördert (Tabelle 2). In der Planung befinden sich derzeit 57 Neuanlagen. Im Jahr 2007, bedingt durch einen Preisschock bei nachwachsenden Rohstoffen, der auch in Sachsen zu Verunsicherungen am Markt führte, erfolgte der Neubau von Anlagen verhaltener und verdeutlicht Markteinflüsse auch in dieser Branche.
Laut Expertenmeinung wird aber erwartet, dass sich aufgrund einer erneuten Novellierung des EEG im Jahr 2009 der Bau von Biogasanlagen wieder entfalten wird. Dies verdeutlicht erneut die Fördernotwendigkeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Geförderte Biogasanlagen im Freistaat Sachsen Stand Mai 2008, gegliedert nach Regierungsbezirken
Die Anlagengrößen (Tabelle 3) in Sachsen konzentrieren sich laut der vorgenommenen Evaluierung auf den Bau von Anlagen mit mehr als 500 kW elektrischer Leistung und nehmen damit einen Anteil von 69 % ein. Auffallend ist, dass Anlagen mit <150 kW in Sachsen relativ wenig gebaut wurden. Hierfür scheint die Flächenstruktur für den Rohstoffeinsatz bedeutend zu sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 3: Anlagendimensionierung in Sachsen
Geplant und konzipiert werden die Biogasanlagen dort, wo neben im Betrieb anfallenden Dung (Gülle) auch nachwachsende Rohstoffe wie Silomais, Ganzpflanzensilage, Grassilage und Getreide als Substrat zur Verfügung stehen, ohne den Marktfruchtbau des Betriebes zu gefährden. Sie verfügen über eine große Flexibilität im Materialeinsatz. Anlagen unter 100 kW werden laut Angaben der Betreiber fasst nur mit Gülle ihrer vorhandenen Tierbestände betrieben.
Eine statistische Analyse, wie viele Unternehmen als Landwirtschaftsbetriebe oder als gewerbliche Betreiber auf dem Markt fungieren, konnte weder beim Statistischen Landesamt Sachsen noch bei der Handwerkskammer bzw. Industrie- und Handelskammer aussagefähig erfragt werden, weil die Anlagenbetreiber keiner gesetzlichen Meldepflicht unterliegen, die sie zum Anmelden Ihrer Biogasanlagen verpflichten. Ausgenommen sind Gewerbetreibende, welche mit einer Biogasanlage eine Existenz gründeten und dies entsprechend § 138 Abgabenordnung (AO) ihrer zuständigen Gemeinde zu melden haben.
2. Förderung von Biogasanlagen
2.1 Förderrechtliche Rahmenbedingungen in Sachsen
Der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) ist das neue zentrale Finanzierungsinstrument der EU in den Bereichen Landwirtschaft und ländlicher Raum. Er erstreckt sich auf einen Zeitraum von 2007 - 2013. Der ELER soll zur Förderung nachhaltiger Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Gemeinschaft in Ergänzung zu den Markt- und Einkommensstützungsmaßnahmen der gemeinsamen Agrarpolitik beitragen. Er wirkt in den Mitgliedstaaten in Form eines Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum. Die Beihilfen umfassen vier Schwerpunkte, die im Kapitel II, Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 aufgeführt sind:
- „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft durch Förderung der Umstrukturierung, der Entwicklung und der Innovation
- Verbesserung der Umwelt und der Landschaft durch Förderung der Landbewirtschaftung
- Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Förderung der Diversifizierung der Wirtschaft„
- Ein weiteres Element ist die Förderung gebietsbezogener lokaler Strategien, wie das Leader-Konzept
Die Bundesländer stellen Entwicklungskonzepte für den ländlichen Raum (EPLR) auf, die aus dem europäischen Landwirtschaftsfond für ländliche Entwicklung ELER finanziert werden. Das EPLR beschreibt die Umsetzung der Förderung auf strategischer Ebene.
Insgesamt stehen für Sachsen 9,27 Mio. EU Mittel aus einem Fond von 8 Mrd. € für die Entwicklung des ländlichen Raumes in Deutschland zur Verfügung.
Für die gewerbliche Wirtschaft ist das wichtigste Instrument zur Förderung von Investitionen die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“(GA). Sie setzt den Rahmen für die nationale Regionalpolitik und stellt die innerstaatliche Umsetzung des europäischen Rechts, insbesondere beihilferechtliche Bestimmungen, sicher. Verfassungsrechtlich ist die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Artikel 91 a Grundgesetz verankert. Finanziert wird die Gemeinschaftsaufgabe zu je 50 % von Bund und Land. Im Freistaat Sachsen (Förderkulisse Sachsen) fließen zusätzlich Gelder der europäischen Union über den Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) in die GA ein. Die Richtlinie (RL) des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Tourismuswirtschaft im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe (genannt RIGA in der Fassung der RL vom 23.11.2007) stellt die sächsische Landesregelung zur Rahmengesetzgebung durch Bund und Land dar. Deren Zielstellung, beschrieben in Artikel 1.5. der RL, konzentriert sich vorrangig auf Investitionsanreize zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen und zur Verbesserung der Einkommenssituation sowie der Stärkung regionaler Wirtschaftsstrukturen. Bund und Länder beschließen jährlich einen Rahmenplan, der insbesondere die Förderregeln, die Fördersätze, die Fördergebiete und die regionalen Förderprogramme der Länder enthält. In einer Förderkulisse ausgewiesene strukturschwache Regionen werden gezielt durch Zuschüsse zu einer verstärkten Investitionstätigkeit angeregt. Sachsen zählt zu den A-Fördergebieten mit den höchst möglichen Fördersätzen. Hier gelten maximale Bruttohöchstfördersätze je nach Größenordnung der Betriebsstätte zwischen 30 und 50 % der Investitionssumme. Gefördert werden allerdings nur so genannte kleine bis mittelständige Unternehmen (KMU) laut einer Empfehlung der EU-Kommission vom 06.05.2003. Anhand von vorgegebenen unterschiedlichen Kriterien (Mitarbeiteranzahl, Jahresumsatz usw.) wird eingeschätzt, ob es sich um Unternehmen im Sinne der KMU-Regelung handelt. Förderrechtlich gesehen erfolgt eine Abgrenzung der Förderprogramme in Sachsen hinsichtlich eines Landwirtschafts- oder Gewerbebetriebes analog den Vorschriften im EG-Vertrag.
Generell ausschlaggebend finden die Vorschriften des EG-Vertrages Artikel 87 für die Errichtung eines gemeinsamen Marktes Anwendung. Eine Ausnahme stellt hier die Produktion landwirtschaftlicher Produkte dar. Der Landwirtschaft wird im EG-Vertrag ein eigener Teil (Titel II) mit den Artikeln 32 - 38 zugestanden.
Artikel 32 EG-Vertrag geht von dem Grundsatz aus, dass ein gemeinsamer Markt auch die Landwirtschaft und den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen umfasst. Der Begriff Landwirtschaft wurde hier nicht explizit definiert, nur der Begriff landwirtschaftliche Erzeugnisse. Eine Definition des Begriffes Landwirtschaft ist aufgrund der unterschiedlichen Betriebsgrößen in den einzelnen Mitgliedstaaten kaum möglich. Die nicht explizit getroffene Definition führt in der Praxis häufig zu Schwierigkeiten bei Abgrenzungsfragen. Deshalb wird die Abgrenzung anhand der landwirtschaftlichen Erzeugnisse vorgenommen. Darunter sind dann folgend: „...die Erzeugnisse des Bodens (z.B. Getreide), der Viehzucht (z.B. Milch) und der Fischerei sowie mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehender Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu verstehen.“[3] Biomassen und das daraus erzeugte Biogas sind demnach Erzeugnisse des Bodens, also landwirtschaftliche Erzeugnisse. Diese Produkte unterliegen den besonderen Vorschriften der Artikel 33 - 38 EG-Vertrag und sind in der Liste im Anhang I zu Artikel 32 des Vertrages aufgeführt. Ein Landwirtschaftsbetrieb nach der Definition der EU ist ein Unternehmen, dass Waren nach Anhang I des Artikels 32 produziert.
In den im Landwirtschaftbereich zur Verfügung stehenden Förderprogrammen wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass, wer die in der Liste aufgeführten Waren des Anhanges I produziert, der Landwirtschaft zuzuordnen ist.
Im gewerblichen Bereich wurden in der Rahmengesetzgebung eindeutigere Begriffsbestimmungen vorgenommen. Im Teil II der GA wurden Regelungen über Voraussetzungen, der Art und der Intensität der Förderung aufgestellt. Unter dem Punkt 2.8.1 der GA wird eine genaue Aussage zum Begriff gewerblich getroffen: „Der Begriff - gewerblich - richtet sich nach den Bestimmungen des Gewerbesteuergesetzes.“ Der § 2 des Gewerbesteuergesetzes sagt aus, dass unter einem Gewerbebetrieb ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes (EStG) zu verstehen ist. Es wird also auf das Einkommensteuergesetz § 15 (2) abgestellt mit den Tatbestandsmerkmalen eines Gewerbebetriebes. Diese sind die selbständige nachhaltige Betätigung, die Gewinnerzielungsabsicht und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr. Die Betätigung darf weder als Ausübung von Land- und Forstwirtschaft, noch als freier Beruf bzw. als andere selbständige Arbeit erfolgen. In den gewerblichen Förderprogrammen wird die Landwirtschaft meist durch die Formulierung „nicht förderfähig sind Unternehmen, die Produkte des genannten Anhanges I des EG-Vertrages produzieren“, abgegrenzt.
Die folgende Übersicht veranschaulicht die genannten Ausführungen, wobei angemerkt wird, dass für die Landwirtschaft die De-minimis Verordnung Nr. 1998/2006 nicht angewendet wird bzw. nur wenn eine Ausrichtung der Produktion in die gewerbliche Branche (Einkommensdiversifizierung) erfolgt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Übersicht bestehender Gesetzesgrundlagen
2.2 Bundesprogramme
Auf der 3. Klimakonferenz in Kyoto 1997 wurde durch die Vertragstaaten das Protokoll von Kyoto verabschiedet. In Deutschland gesetzlich verankert wurde dies im Jahr 2002 durch den Bundestag. Es setzt einen wichtigen Meilenstein in der internationalen Klimapolitik, da es die Industriestaaten verbindlich verpflichtet, die Emission von Treibhausgasen im Zeitraum 2008 - 2012 um 5 % unter das Niveau von 1990 zu senken.
Die EU verabschiedete dazu am 05.04.2006 die EU-Richtlinie 2006/32/EG zur Energieeffizienz und zu Energiedienstleistungen (EDL-RL).
Nach deren Vorgaben sollen die Mitgliedstaaten über einen Zeitraum von neun Jahren den Energieverbrauch um insgesamt 9 % im Vergleich zu einer Referenzperiode reduzieren.
Die EDL-RL lässt den Mitgliedstaaten im Maßnahmebereich die Wahl zwischen verschiedenen Instrumenten zur Steigerung der Energieeffizienz und Förderung der Energiedienstleistungsmärkte.
Um die Strategie und die Anstrengungen der einzelnen Länder frühzeitig beurteilen zu können, verlangt die Richtlinie die Aufstellung von drei nationalen Aktionsplänen (2007, 2011 und 2014) mit zunehmender statistischer Konkretisierung.
Dieser nationale Energieeffizienz-Aktionsplan (EEAP) ist ein wichtiger Baustein und Leitfaden für die Initiativen der Energiepolitik in den kommenden Jahren. Die dort aufgeführten Programme, Maßnahmen und Instrumente orientieren sich dabei an der Liste laut Anhang III der EDL-RL.
Die nachfolgend aufgeführten überregionalen Fördermöglichkeiten sind im EEAP verankert.
2.2.1 Erneuerbare-Energien-Gesetz
Von besonderer Bedeutung ist hier das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 21.07.2004. Das EEG regelt die Abnahme und Vergütung von ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen Strom durch Versorgungsunternehmen, die Netze für die allgemeine Stromversorgung betreiben (Netzbetreiber). Unerheblich ist dabei, ob es sich um einen landwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieb handelt. Verschiedene Arten der erneuerbaren Energien (z. B. Solarstrom, Windkraft, Geothermie, Bioenergie, Deponie-, Klär- und Grubengas sowie Wasserkraft) erhalten Vergütungen in unterschiedlicher Höhe je nach den Herstellungskosten des Stroms. Im Jahr 2008 wurde das bestehende Gesetz wiederholt überarbeitet und befindet sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung. Die Notwendigkeit ergab sich vor allem aus der im Jahr 2007 eingetretenen drastischen Preiserhöhung bei den Rohstoffen Mais und Getreide.
Die Wirtschaftlichkeit bestehender Anlagen und geplanter Neuanlagen war aufgrund der geringen Einspeisevergütung gefährdet und bedurfte einer neuen Gestaltung. Die Grundvergütungssätze wurden im Bereich der Anlagen bis 500 kW deutlich erhöht. Die Boni für die ausschließliche Verwertung von nachwachsenden Rohstoffen und der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) wurden ebenfalls angehoben. Vollkommen neu ist die Einführung eines sogenannten Güllebonus. Mit ihm eröffnen sich für Vieh haltende Landwirtschaftsbetriebe verstärkt Einkommensalternativen im Bioenergiesektor. Angepasst an die vorhandenen Tierbestände der Landwirtschaftsbetriebe werden sich vermutlich durch diese Neuregelung Anlagen mit einer Kapazität zwischen 100 – 250 kW verstärkt am Markt in den nächsten Jahren etablieren.
In der folgenden Tabelle sind die Grundvergütung und die verschiedenen Zusatzvergütungen ohne Umsatzsteuer für Biogasanlagen aufgeführt[4]. Die Vergütungssätze und Boni gelten nur für ab 2009 in Betrieb genommene Anlagen.
Folgeseite:
Tabelle 5: Vergütungssätze für Strom aus Biogasanlagen bei Inbetriebnahme im Jahr 2009 in Ct/kWh (nach Novellierung EEG 2008)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1) BIMSchG-Anlagen
2) Bei Einsatz von 30 % Massenprozent Wirtschaftsdünger
3) Für die in Strom umgerechnete und abgegebene Wärmemenge
4) 2 Cent für die Aufbereitung von Biogas zu Erdgas bis zu einer Aufbereitungskapazität von 350 m³/Std Rohbiogas 1 Cent bei Kapazität 351 bis 700 m³/Std
Für die Anlagenleistung bis 150 KW beträgt die Grundvergütung ab 2009 Cent 11,67 je eingespeister Kilowattstunde. Unter der Annahme, dass nachwachsende Rohstoffe und Gülle verwertet werden, erhöht sich der Betrag auf 22,67 Cent/kWh.
In der Praxis[5] stellt sich ein Vertragshandling folgend dar: Der Anlagenbetreiber schließt mit dem Energieunternehmen einen Einspeisevertrag ab. Es entsteht aufgrund der in den §§ 4 und 5 EEG geregelten Abnahme- und Vergütungspflicht ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber. Der Stromlieferer erhält am Ende des Monats eine Abrechnung in Form einer Abschlagszahlung auf die zu erwartende Ausgleichsvergütung. Die Vergütungssätze entsprechend des EEG-Aufschlages werden hier zeitnah berücksichtigt. Die Abschlagszahlungen erfolgen in der Regel bis zum 15. des Folgemonates. Am Jahresende wird eine abschließende Jahresabrechnung vorgenommen, in der die Verrechnung von positiven bzw. negativen Differenzkosten geschieht.
Kontrollmechanismen sind z. B. zum Erhalt des NaWaRo-Bonus durch Führen eines Rohstoffeinsatzbuches gegeben. Laut den Angaben von Betreibern wird derzeit nur in bestimmten Einzelfällen bei Verdachtsmomenten, z. B. durch den Wirtschaftsprüfer anhand von Hochrechnungen vorhandener Lagerkapazitäten, Kontrolle ausgeübt.
2.2.2 KfW-Programme
Bei einer Investitionsentscheidung im Unternehmen sollte immer eine Energieberatung vorausgehen. Der Mittelstand kommt dabei oft nicht ohne externe Unterstützung aus. Marktanalysen, durchgeführt von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, ergaben, dass Gewerbebetriebe mit bis zu neun Mitarbeitern jährliche Energiekosten zwischen 3.000 und 9.000 Euro aufweisen. Firmen mit bis zu 19 Beschäftigten erreichen bis 24.000 Euro und Unternehmen mit maximal 49 Angestellten in Extremfällen 240.000 Euro.[6]
Diese Unternehmen beschäftigen aber oft keine eigenen Fachleute für Energiefragen. Genau an diesem Punkt setzt das bei der KfW-Bank aufgelegte Förderprogramm Energieeffizienzberatung, ERP (European Reovery Programm) an.
Bestandteile des Sonderfonds sind die beiden Förderbausteine
a) Zuschüsse für Energieberatungen (Initial- und Detailberatung) und
b) die finanzielle Unterstützung der Investition zur Erschließung aufgedeckter
Potenziale durch zinsgünstige Darlehen.
Anträge auf Zuschüsse sowohl für eine Initial- als auch eine Detailberatung werden direkt bei der KfW gestellt.
Dafür qualifizierte Berater sind in einer Beraterbörse gelistet und können unter der Internetadresse www.kfw-beraterboerse.de eingesehen werden. Die zuständigen Regionalpartner in Sachsen, die die Vermittlung von Beratern und die fachliche Betreuung und Begleitung von Projekten übernehmen, sind die SAENA (Sächsische Energieagentur GmbH), ansässig bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB), und die Handwerkskammern. Die Förderung in Form von maximalen förderfähigen Zuschüssen für Tageshonorare der Berater sowie den zweiten Förderbaustein erhalten jedoch nur kleinere und mittlere gewerbliche Unternehmen. Landwirtschaftsbetriebe sind hier ausgenommen.
Für den zweiten Förderbaustein der Richtlinie sollte beachtet werden, dass die Antragstellung über die zuständige Hausbank bei der KfW erfolgt. Gefördert werden können hier bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten mit einem festen Zinssatz bis zu 10 Jahren. Nicht gefördert werden Biogasanlagen, die ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt werden.
Als weitere vom Bund bereitgestellte Förderinstrumente können die Marktanreizprogramme der KfW Erneuerbare Energien (Nr. 128) und das ERP Umwelt- und Energiesparprogramm (Nr. 225 oder 226) durch kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen in Anspruch genommen werden. Im KfW-Programm Erneuerbare Energien explizit mit aufgeführt ist, dass Land- und Forstwirte nur Anträge stellen können, wenn die geplante Biogasanlage in Zukunft Einkünfte aus § 15 EStG erzielt. Das heißt, der Landwirt muss sich im Vorhinein entscheiden, wie er die ertragssteuerliche Ausgestaltung seiner Biogasanlage vornimmt. Für das ERP Umwelt- und Energiesparprogramm und KfW-Umweltprogramm gilt wiederum der Ausschluss einer Förderung im LuF-Unternehmen, wenn Einkünfte aus § 13 EStG aufgrund der vorgenommen eindeutigen Aufführung der antragsberechtigten Personen und Unternehmen erzielt werden.
Während im KfW Programm Erneuerbare Energie allerdings nur Anlagen für die Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität Fördergegenstand sind[7], werden im ERP-Umwelt- und Energiesparprogramm alle klassischen Biogasanlagen mit einem zinsgünstigen Darlehen bezuschusst.
Der Vollständigkeit halber soll erwähnt sein, dass eine Förderung nach dem Investitionszulagengesetz (InvZulG) für Biogasanlagen weder für die landwirtschaftliche noch für die gewerbliche Biogasanlage möglich ist. Im genannten Fördergesetz sind die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes oder der produktionsnahen Dienstleistung als Begünstigte genannt. Die Klassifikation der Wirtschaftszweige erfolgt auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt[8] herausgegebenen Verzeichnisse der Wirtschaftszweige, in denen die Einschätzung der Wirtschaft über die Zuordnung von Tätigkeiten zu den Wirtschaftszweigen dokumentiert ist. Die Energieerzeugung Abschnitt D erfährt hier eine eigene Klassifikation und wird nicht dem verarbeitenden Gewerbe zugeordnet.
Der Landwirtschaftssektor wird als sensibler Bereich in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 Satz 9 InvZulG bereits ausgeschlossen.
2.3 Landesprogramme Sachsen
2.3.1 Landwirtschaft
Für den landwirtschaftlichen Bereich steht die Richtlinie Förderung der Land- und Ernährungswirtschaft, Teil A (LuE/2007) zur Verfügung.
Zuwendungsfähig sind hier alle Landwirtschaftsbetriebe, gleich in welcher Rechtsform diese tätig sind. Kriterien sind grundsätzlich die Produktion von Waren im Anhang I EG-Vertrag und das Vorliegen einer geforderten Mindestflächengröße entsprechend dem Gesetz über die Altersicherung der Landwirte § 1 Abs. 2. In Sachsen beträgt diese Größe mindestens 4 ha reine Landwirtschaftsfläche. Kontrolliert wird die vorhandene Flächengröße über das Einfordern des aktuellen Bescheides der Berufsgenossenschaft.
Gefördert werden hier ebenfalls Betriebe, deren Tierbestände den in § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG angegebenen Umfang übersteigen, also gewerbliche Tierhalter, die in die Tierproduktion investieren.
Förderfähig sind auch Investitionen zur Nutzung und Erzeugung regenerativer Energien, also Biogasanlagen, wenn die Rohstoffproduktion der Energieträger überwiegend im eigenen Unternehmen erfolgt oder die erzeugte Energie überwiegend im eigenen Unternehmen genutzt wird. Mit dieser Definition wird auf die steuerliche Definition eines landwirtschaftlichen Nebenbetriebes laut Einkommensteuerrichtlinie EStR 2005 § 15.5 (3) EStG abgestellt. Es wird die Biogasanlage mit dem zugehörigen BHKW gefördert, wobei es zwingend erforderlich ist[9], dass die Fortführung der Anlage durch die antragstellende Person gewährleistet bleibt (sogenannte Unternehmeridentität) und keine direkte Ausgliederung des BHKW eintritt. Eine direkte Ausgliederung eines Unternehmens wäre gegeben, wenn das BHKW durch die Ehefrau gewerblich betrieben würde und diese Anzeige vor Bewilligung oder nach der Endfestsetzung der Fördermittel erfolgt. Dementsprechend käme eine Förderung im landwirtschaftlichen Bereich nur bis zur Schnittstelle Rohgaserzeugung in Betracht.
In reinen Ackerbaubetrieben ist keine Förderung einer Biogasanlage vorgesehen, nur in Futterbau-, Veredlungs- oder Verbundbetrieben. Begründet wird dies durch die bewilligende Behörde mit dem Argument, dass Ackerbaubetriebe über eine bessere Ertragslage verfügen und damit nicht Ziel der Förderpolitik sind. Außerdem soll bereits im Vorfeld vermieden werden, dass ein ausschließlicher Anbau von Rohstoffen zur Energieerzeugung erfolgt.[10]
Die Förderrichtlinie erfährt hier eine eindeutige Abgrenzung zum gewerblichen Biogasanlagenbetreiber durch die Aufstellung der vorgenannten Kriterien, wie die Produktion von Waren Anhang I EG-Vertrag, die Benennung von Mindestgrößen und die Abstellung auf das EStG.
Gefördert werden Biogasanlagen mit Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung in Höhe von 15 % der Investition. Besondere Modell- und Demonstrationsvorhaben, wie eine Gastankstelle oder Wärmetrassen (Gewächshaus, Trockenanlagen) für den Eigenverbrauch, mit einem Zuschuss bis 30 % der Investitionssumme. Wird z.B. eine Biogasanlage mit ausschließlichem Verkauf der Wärmeenergie errichtet, die erzeugte Energie wird also nicht wie oben genannt, nur im eigenen Unternehmen verwendet, dann kann eine Förderung nur nach Punkt 2.10 der Richtlinie „Investitionen zur Schaffung zusätzlicher Einkommen“ (Diversifizierung) erfolgen. Für Biogasanlagen werden außerdem folgende weitere Voraussetzungen gefordert:[11]
- „Vorlage eines Konzeptes zur Nutzung der im Prozess Kraft-Wärme-Kopplung anfallenden Wärme
- Mindestens 55 % des Primärenergiegehaltes im erzeugten Biogas müssen außerhalb des Fermentationsprozesses energetisch genutzt werden“
- Entsprechende Verträge über Wärmeabnahme oder Stromlieferungen sind beizubringen
Differenziert hinsichtlich der Beibringung von Unterlagen wird in der Richtlinie nach der Höhe des förderfähigen Investitionsvolumens. Die Grenze liegt hier bei 100.000 €. Wird diese überstiegen, sind durch den Zuwendungsempfänger zusätzliche Unterlagen, wie z.B. eine Vorwegbuchführung für die letzten zwei Wirtschaftsjahre, Wirtschaftlichkeitsnachweise, Stärken-Schwächen-Analyse, zu erbringen. Bei derzeit, laut dem Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL), angenommenen überschlägigen Investitionskosten zur Errichtung einer Biogasanlage in Höhe von 4.000 bis 4.500 € je kWh wird diese genannte 100.000-€-Grenze in jedem Fall überschritten.
Laut Aussagen der Sächsischen Landesanstalt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) ist gegenwärtig ein Anstieg bei Anträgen für Biogasanlagen mit einer Kapazität von 150 kW zu verzeichnen. Mit der Einführung des neuen EEG wird davon ausgegangen, dass sich dieser Trend wohl noch verstärken wird.
Die Zweckbindung für geförderte Gegenstände/Anlagen beträgt derzeit fünf Jahre.
[...]
[1] Statistisches Landesamt Sachsen, Industrie- und Handelskammer Sachsen: Abfragen zur Erfassung gemeldeter Biogasbetreiber, 28.07.08 und 31.07.08.
[2] Landesamt für Umwelt und Geologie Sachsen, Schlegel (2008).
[3] Europa-Recht (2005), S.47.
[4] Fachzeitschrift Top-agrar: August 2008, S. 23.
[5] Hofgut Raitzen: Aussage des Geschäftsführers Dr. Kübler im Rahmen eines Betriebsbesuches am 12.08.08.
[6] Vgl. KfW Impuls Spezial: Energieeffizienzberatung, November 2007.
[7] KfW-Mittelstandsbank Infocenter: Telefonische Auskunft Herr Dung, Stephan, 29.09.09.
[8] Statistisches Bundesamt Deutschland: www.destatis, Button Klassifikation.2008.
[9] LfULG Sachsen Bewilligungsstelle: Telefonische Auskunft, 03.06.2008.
[10] LfULG Sachsen Bewilligungsstelle: Telefonische Auskunft, 03.06.2008.
[11] SMUL: Merkblatt für Investitionen zur Erzeugung und Nutzung regenerativer Energien zur RL LuE (2007).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836631211
- Dateigröße
- 894 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Dresden International University – Wirtschaft & Recht
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- landwirtschaft besteuerung erneuerbare-energien-gesetz biogas landesprogramm
- Produktsicherheit
- Diplom.de