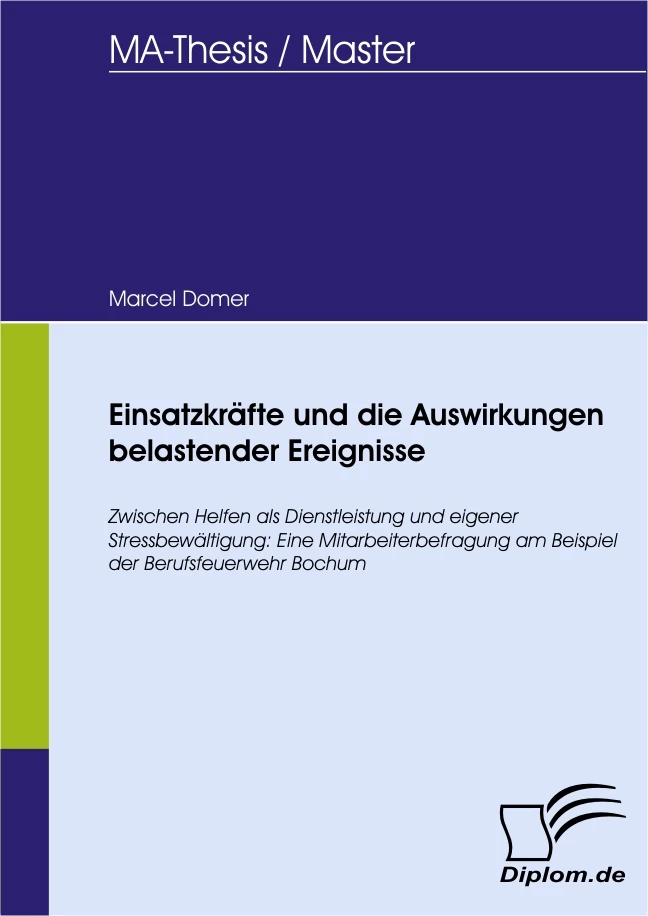Einsatzkräfte und die Auswirkungen belastender Ereignisse
Zwischen Helfen als Dienstleistung und eigener Stressbewältigung: Eine Mitarbeiterbefragung am Beispiel der Berufsfeuerwehr Bochum
Zusammenfassung
Wir schreiben das Jahr 1988. Eine Flugstaffel der italienischen Luftwaffe rast nach einer Kollision mit mehreren Luftfahrzeugen in die völlig überraschte Zuschauermenge. 3. Juni 1998, der ICE Conrad Röntgen der Deutschen Bahn AG entgleist unterhalb einer Brücke in der Nähe der Ortschaft Eschede. Am 11. September 2001 stürzen insgesamt 3 Passagiermaschinen in verschiedene Gebäude in New York und in Washington. Zusammen haben diese Unglücke mehreren tausend Menschen das Leben gekostet. Aber nicht nur die primären Opfer dieser Katastrophen waren betroffen, sondern auch die als sekundär traumatisiert bezeichneten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste traten in den Fokus einer weiteren Betrachtung.
Galten gerade die primären Opfer verschiedenster Katastrophen der ersten beiden Drittel des vergangenen Jahrhunderts bzw. der beiden Weltkriege als Klienten einer psychosozialen Betreuung, so fand im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts eine weitreichende, aber bei weitem nicht ausreichende Betrachtung der Einsatzkräfte statt. Und nicht erst die Geschehnisse um das Zugunglück in Eschede ließen den Ruf der Einsatzkräfte um eine adäquate psychosoziale Betreuung lauter werden. Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um die Bewältigung des alltäglichen Stressaufkommens, sondern eher um die Bewältigung belastender Ereignisse, welche sich nachträglich negativ auf die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte auswirken können. Reaktionen wie z.B. akute Belastungsreaktionen, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, geben Aufschluss darüber, dass Einsatzkräfte tagtäglich einer besonderen Belastung ausgesetzt sind.
Generalisieren Teegen, Domnick und Herdegen die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung dieser Berufsgruppe mit einem traumatischen Ereignis mit nahezu 100 %, so gehen Bengel, Bordel und Carl davon aus, dass 3-7 % der Mitarbeiter des Rettungsdienstes an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Das zu Beginn der Masterarbeit veröffentlichte Zitat eines New Yorker Fire Department Chiefs, welches eindrucksvoll darauf hindeutet, welche Auswirkungen die Ereignisse des 11. September 2001 haben werden, scheint diese Ergebnisse zu bestätigen.
Wie reagieren nun aber die Kommunen und die Branddirektionen auf solche Ereignisse bzw. auf deren Auswirkungen in Bezug auf die Betreuung ihrer Mitarbeiter? Welche Maßnahmen ergreifen sie im Rahmen der Prävention, Intervention und Nachsorge in […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Gliederung und Inhalte
0. Danksagung
1. Einleitung und Orientierung
2. Stress und der menschliche Organismus - konzeptioneller Rahmen und Definition
2.1. Konzeptionelle Einordnung des Stresskonstruktes
2.2. Stressoren und Stressreaktionen
2.2.1. Stressauslösende Ereignisse als Grundlage einer Reaktion - Eine qualitative Unterscheidung in berufs- und einsatzbedingte Stressoren
2.2.2. Reaktionen des Individuums auf Stressoren: Physische, kognitive, emotionale und verhaltensbedingte Stressreaktionen
2.2.3. Stress als Reaktion auf aversiv empfundene Situationen - Abgrenzung des Stresskonstruktes für den Gegenstandsbereich dieser Masterarbeit
3. Belastende Ereignisse - Von der Betreuung der Opfer zur Unterstützung der Einsatzkräfte
3.1. Orientierung
3.2. Sind Einsatzkräfte versteckte Opfer? Chronologie der personenzentrierten Betreuung nach belastenden Ereignissen
3.3. Gesellschaftstheoretische Einordnung von belastenden Ereignissen, akuten Belastungsreaktionen und von posttraumatischen Belastungsstörungen
3.4. Das Critical Incident Stress Management (CISM) als ein qualitatives Konzept der Prävention, Intervention und Nachsorge - Maßnahmen und Methoden
3.5. Die Zugkatastrophe von Eschede - Maßnahmen und Forderungen für eine qualifizierte Betreuung von Einsatzkräften
4. Umgang mit Stress und belastenden Ereignissen bei der Berufsfeuerwehr zu Bochum
4.1. Organisationsstruktur und Aufgabenbereiche
4.2. Die Pflicht zur Fürsorge - Die personenzentrierte Qualifizierung für den Umgang mit Stress im Rahmen der Aus- und Fortbildung
4.2.1. Allgemeines
4.2.2. Prävention und Vorbereitung auf den Einsatzdienst - das Phänomen Stress als Baustein in der Ausbildung zum Brandmeister, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
4.2.3. Fortbildungsmaßnahmen und weitere personenzentrierte Schlüsselqualifikationen als Hilfe für Kollegen
4.2.4. Intervention und Nachsorge
4.3. Zukunftsvisionen
5. Projektpräsentation
5.1. Ausgangslage
5.2. Forschungsfrage - Konkretisierung
5.3. Eine Mitarbeiterbefragung bei der Berufsfeuerwehr zu Bochum zur Erfassung eines Meinungsbildes
5.3.1. Der Fragebogen als quantitatives Erhebungsinstrument - Entwicklung, Struktur und Inhalte
5.3.2. Grundgesamtheit
5.3.3. Einsatz des Erhebungsinstrumentes - Vorgehensweise und Umsetzung
5.4. Statistische Auswertung, Datenpräsentation und Interpretation
5.4.1. Allgemeines
5.4.2. Fragenbereich VI
5.4.3. Fragenbereich I
5.4.4. Fragenbereich II
5.4.5. Fragenbereich III
5.4.6. Fragenbereich IV
5.4.7. Fragenbereich V
5.4.8. Interpretation
6. Schlussbetrachtung
7.
Literaturverzeichnis
8. Anhang
9. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
10. Erklärung
0. Danksagung
Bereits an dieser Stelle möchte ich mich bei einigen wenigen Personen bedanken, die maßgeblich an der Vorbereitung und Umsetzung dieser Masterarbeit beteiligt waren.
Mein Dank gilt Herrn Pfarrer Hajo Witte, der mir im Rahmen eines freiwilligen Praktikums in der Notfallseelsorge/ Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr zu Bochum die Möglichkeit gab, die verschiedenen Aufgaben- und Wirkungsbereiche einer Feuerwehr kennen lernen zu dürfen. Ferner möchte ich mich bei ihm für die Unterstützung und das Vertrauen bedanken, welches er mir insbesondere bei der Durchführung der Mitarbeiterbefragung hat zu teil werden lassen.
Mein Dank gilt den Freunden, die mich bei der Entwicklung der Mitarbeiterbefragung und bei der Korrektur der Masterarbeit tatkräftig mit Offenheit, Anregungen und Hinweisen unterstützt haben. Ihnen gilt mein Dank für den Zuspruch und die Transparenz sowie für den helfenden und motivierenden Beistand.
Mein Dank gilt den Kollegen der Berufsfeuerwehr zu Bochum, die mich offen in ihren Kreis aufgenommen haben und dazu beigetragen haben, meinen Erfahrungshorizont erweitern zu dürfen. Ich danke ihnen ganz besonders für die Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung und für die Darlegung ihrer Erlebnisse im Feuerwehr- und Rettungsdienst.
1. Einleitung und Orientierung
Wir schreiben das Jahr 1988. Eine Flugstaffel der italienischen Luftwaffe rast nach einer Kollision mit mehreren Luftfahrzeugen in die völlig überraschte Zuschauermenge. 3. Juni 1998, der ICE Conrad Röntgen der Deutschen Bahn AG entgleist unterhalb einer Brücke in der Nähe der Ortschaft Eschede. Am 11. September 2001 stürzen insgesamt 3 Passagiermaschinen in verschiedene Gebäude in New York und in Washington. Zusammen haben diese Unglücke mehreren tausend Menschen das Leben gekostet. Aber nicht nur die primären Opfer dieser Katastrophen waren betroffen, sondern auch die als sekundär traumatisiert bezeichneten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienste traten in den Fokus einer weiteren Betrachtung (Hausmann, 2003).
Galten gerade die primären Opfer verschiedenster Katastrophen der ersten beiden Drittel des vergangenen Jahrhunderts bzw. der beiden Weltkriege als Klienten einer psychosozialen Betreuung, so fand im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts eine weitreichende, aber bei weitem nicht ausreichende Betrachtung der Einsatzkräfte statt (Teegen, 2003). Und nicht erst die Geschehnisse um das Zugunglück in Eschede ließen den Ruf der Einsatzkräfte um eine adäquate psychosoziale Betreuung lauter werden (Buchmann, 2004). Hierbei handelt es sich allerdings nicht nur um die Bewältigung des alltäglichen Stressaufkommens, sondern eher um die Bewältigung belastender Ereignisse, welche sich nachträglich negativ auf die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte auswirken können. Reaktionen wie z.B. akute Belastungsreaktionen, die zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen können, geben Aufschluss darüber, dass Einsatzkräfte tagtäglich einer besonderen Belastung ausgesetzt sind.
Generalisieren Teegen, Domnick und Herdegen (1997) die Wahrscheinlichkeit einer Begegnung dieser Berufsgruppe mit einem traumatischen Ereignis mit nahezu 100 %, so gehen Bengel, Bordel und Carl (1998) davon aus, dass 3-7 % der Mitarbeiter des Rettungsdienstes an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Das zu Beginn der Masterarbeit veröffentlichte Zitat eines New Yorker Fire Department Chiefs, welches eindrucksvoll darauf hindeutet, welche Auswirkungen die Ereignisse des 11. September 2001 haben werden, scheint diese Ergebnisse zu bestätigen (Picciotto & Paisner, 2003).
Wie reagieren nun aber die Kommunen und die Branddirektionen auf solche Ereignisse bzw. auf deren Auswirkungen in Bezug auf die Betreuung ihrer Mitarbeiter? Welche Maßnahmen ergreifen sie im Rahmen der Prävention, Intervention und Nachsorge in Hinblick auf Ereignisse, die außerhalb der Erfahrungen eines normalen Einsatzspektrums liegen? Welche Maßnahmen sehen sie für ihre Einsatzkräfte vor, die u.U. eine posttraumatische Belastungsstörung erleiden könnten.
Und welche Strategien verfolgt die als Einsatzkräfte bezeichnete Risikogruppe, um akuten Belastungsreaktionen und posttraumatischen Belastungsreaktionen zu begegnen (Bengel, 2001)? Oder implizieren gar Großschadensereignisse bzw. belastende Ereignisse, wie sie anfangs angeführt wurden, keine Belastungen für die Einsatzkräfte?
Diese Masterarbeit orientiert sich an einem Praxisbeispiel und unternimmt anhand einer theoretischen und praktischen Separation den Versuch darzustellen, welche Merkmale dem Stressphänomen und der daraus u.U. entstehenden akuten Belastungsreaktion respektive einer möglichen posttraumatischen Belastungsstörung zu Grunde liegen und wie die Bochumer Berufsfeuerwehr und deren Mitarbeiter darauf präventiv, intervenierend und post festum reagieren.
Der theoretische und erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich demzufolge mit der Darstellung verschiedener Stresstheorien und Stressoren, die sich hinsichtlich der qualitativen Einordnung in Ihrer Ausprägung unterscheiden. Sich daran anschließend sollen die historische Entwicklung und die Verlagerung der opferzentrierten Betreuung zur helferzentrierten Fokussierung den Grundstein zur Verdeutlichung der möglichen psychosozialen Betreuungsmaßnahmen legen. Beide sollen am Konzept des Critical Incident Stress Managementes und anhand der dokumentierten Auswirkungen des ICE-Unglückes von Eschede exemplarisch dargestellt werden.
In einer weiteren theoretischen Betrachtung sollen anhand der Organisations- und Ausbildungsstruktur der Bochumer Berufsfeuerwehr deren Anstrengungen visualisiert werden, mit denen gegen die Auswirkungen von berufs- und einsatzbedingtem Stress vorgegangen wird, damit der eingangs gestellten Forderung nach einer psychosozialen Betreuung für Einsatzkräfte von Buchmann (2004) Rechnung getragen werden kann.
Die Mitarbeiterbefragung des praktischen Teiles dieser Arbeit wird der Frage nachgehen, ob qualitative Maßnahmen, zu denen die einzelnen Komponenten des Critical Incident Stress Management Konzeptes (CISM) zu zählen sind, akute Belastungsreaktionen vorbeugen können bzw. ob es einen Zusammenhang zwischen diesen Maßnahmen und einer akuten Belastungsreaktion gibt (Igl & Müller-Lange, 1998). Die hier gewonnenen Daten erstrecken sich ausschließlich auf den operativen Bereich der Berufsfeuerwehr Bochum und werden mit bereits durchgeführten Untersuchungen in der wissenschaftlichen Literatur verglichen und interpretiert. Somit sollen die Ergebnisse der Auswertung und der Interpretation, aber auch die Kombination aus Theorie und Praxis Aufschluss darüber geben, ob die bis dato eingesetzten Maßnahmen im Umgang mit Stress genügen, oder ob es einer weiteren Reformierung/ Innovation des bestehenden Systems aus Sicht der Einsatzkräfte dieser Berufsfeuerwehr bedarf.
2. Stress und der menschliche Organismus - konzeptioneller Rahmen und Definition
2.1. Konzeptionelle Einordnung des Stresskonstruktes
Setzt man sich mit den Auswirkungen belastender Ereignisse auseinander, dann gehört neben der einheitlichen Definition dieses Begriffes auch die konzeptionelle Einordnung und die Definition von Stress und seinen Auslösern dazu. Beide sollen helfen, einen Brückenschlag zu den belastenden Ereignissen und den daraus u.U. resultierenden akuten Belastungsreaktionen bzw. den posttraumatischen Belastungsstörungen zu ermöglichen.
Doch nicht immer war eine einheitliche Definition des Stressbegriffes möglich. Nicht selten wurde Stress als „Modewort“ (v. Rosenstiel, 1992, S. 99) bezeichnet, der weniger durch seine Eindeutigkeit als durch seine Unschärfe bestach. Umgangssprachlich fühlt man sich sogar gestresst oder es wird über Stress in der Familie, Schule und Arbeit geklagt (Hansen, 2001).
Eine allgemeine Verwirrung und fehlende Grenzen sind auch heute noch nicht überwunden. Wesentlich dazu beigetragen haben die unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die das Phänomen Stress jeweils aus einer anderen Perspektive betrachtet haben (Cooper, Dewe & O´Driscoll, 2001). So z.B. auch die Arbeitspsychologie, welche mit den Begriffen „Belastung“ und „Beanspruchung“ einen Versuch unternahm, das Stressphänomen zu erklären (Richter, 2000, S. 9). In ihren Ausführungen deutet Richter unter Zuhilfenahme der DIN 33 405 darauf hin, dass die psychische Belastung als Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse verstanden wird, welche von außen auf das Individuum zukommen und auf dasselbe psychisch einwirken. Psychische Beanspruchungen hingegen kennzeichnen die zeitlich unmittelbare und nicht langfristige Auswirkung der Belastung im Menschen, welche in Abhängigkeit von seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Zustand zu sehen ist. V. Rosenstiel (1992) fügte eine wesentliche Komponente hinzu. Er verwies darauf, dass, sofern die Beanspruchung negativ erlebt wird und zudem eine aversive Attribuierung stattfindet, diese in aller Regel als Stress definiert wird.
Aber was verbirgt sich genau hinter dem Stressphänomen und was sind seine Bestandteile? Legt man die Erkenntnisse der DIN 33 405 und die negative Konnotation des Stressbegriffes von Rosenstiel zu Grunde, so erkennt man zwei wesentliche Momente, die das Stressphänomen in einer ersten Betrachtung präzisieren: Etwas Außenstehendes beansprucht das Individuum, wobei der Grad der Belastung von der Definition desselben und von seinen persönlichen Voraussetzungen bedingt wird.
Grundlegend für diese Annahmen sind 3 Stresskonzepte, welche im weiteren Verlauf kurz angerissen werden (Hacker & Richter, 1984). Hierbei handelt es sich einerseits um die reizorientierten Modelle, die den Stress als Gesamtheit belastender Einwirkungen sehen. Eine weitere Konzeption versteht Stress als organismische Reaktion auf unspezifische Verursachungen, also eine reaktionsorientierte Sichtweise. Einer der wesentlichen Begründer dieses Modelles war Hans Selye. Die wohl komplexeste Darstellung eines allumfassenden Erklärungsansatzes lässt sich allerdings mit dem Transaktionsmodell von Lazarus verbinden, dessen Ansatz davon ausgeht, das Stress ein Prozess der Auseinandersetzung der Person mit Belastungen ist.
Gemäß den Ausführungen von Hacker et al. (1984) versteht man unter reizorientierten Stressmodellen solche Erklärungsansätze, die den Stress als unabhängige Variable definieren. Stress wird hierbei mit Belastung gleichgesetzt und bezieht sich auf Belastungsfaktoren aus der Lebenssituation, aus den Aufgaben und den Umweltfaktoren, die auf den arbeitenden Menschen einwirken. Diese Belastungsfaktoren werden als Stressoren bezeichnet. Unglücklicherweise negieren diese Ansätze allerdings die subjektiven Wahrnehmungen und Bewertungen dieser Stressoren. Ferner berücksichtigen sie in keiner Weise die individuell verschiedenen Bewältigungsstrategien der Individuen, die sich mit ihren Ressourcen und Kapazitäten diesen Herausforderungen stellen (Wiendieck, 1994).
Eine etwas andere Betrachtungsweise von Stress wird hingegen mit dem reaktionsorientierten Modell beschrieben. Das mit diesem Modell verbundene allgemeine Adaptionssyndrom von Selye definiert Stress als komplexes, aber einheitliches physiologisches Reaktionsmuster, wobei Stress als unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung, die an ihn gestellt wird, gilt (Selye, 1974). Somit wird Stress in diesem Sinne als eine abhängige Variable verstanden. Selye interessierte sich allerdings mit seinem Ansatz mehr für Stressoren, die die Körperfunktionen bedrohten und weniger für solche, die eine Verhaltensreaktion hätten erforderlich machen müssen (Zimbardo, 1992). Das aus 3 nacheinander ablaufenden Stufen bestehende physiologische allgemeine Adaptionssyndrom trat immer dann in Aktion, sofern eine Anpassung des Organismusses notwendig war, um das Gleichgewicht des Individuums und dessen Gesundheit wiederherzustellen.
Zwar gilt Selye auch heute noch als der Forscher und Wissenschaftler, der den Begriff Stress in der wissenschaftlichen Diskussion formbar und bedeutsam gemacht hat, jedoch blieb dieses Modell nicht ohne eine wissenschaftlich fundierte Kritik, die darauf abzielte, dass das Konzept inter- und intraindividuell zu starr sei und keine gezielten Präventionsmaßnahmen auf Grund seiner Globalität zuließe (Hacker et al. 1984).
Ein anderer Weg zur Erklärung des Stressphänomens wurde durch Lazarus initiiert, der mit seinem Transaktionsmodell die kognitiven Prozesse eines Individuums in Verbindung mit der entsprechenden Situation in den Vordergrund schob. So formulierte er, dass sich der psychologische Stress auf eine Beziehung mit der Umwelt bezieht, die vom Individuum in Hinblick auf sein Wohlergehen als bedeutsam bewertet wird, aber zugleich Anforderungen an dasselbe stellt, die dessen Bewältigungsmöglichkeiten beanspruchen oder überfordern können (Krohne, 1997). Hierin lässt sich erkennen, dass das transaktionale Stressmodell von Lazarus mehrere bedeutsame Komponenten zur Verfügung stellt, die Aufschluss darüber geben, ob eine Stressreaktion erfolgt oder nicht, und die das Individuum, seine Umwelt und dessen Bewältigungsressourcen fokussierend in den Mittelpunkt setzen. Was aber sind die wesentlichen Merkmale dieses Konzeptes? Wie und mit wem interagiert das Individuum? Und wie geht es gegen eine als unangenehm empfundene Situation vor? Dazu unterteilte Lazarus sein Modell in drei Teile: Primäre Bewertung, sekundäre Bewertung und Neubewertung (Rüger, Blomert & Förster, 1990). Es sei angemerkt, dass diese 3 Elemente einen kontinuierlichen Prozess darstellen, der nicht statisch verweilt, sondern dynamisch agiert und somit eine ständige Rotation impliziert.
Die primäre Bewertung bezieht sich auf die Einschätzung einer vorhandenen, einer imaginären oder antizipierten Situation, wobei diese Situation als irrelevant, angenehm-positiv oder stressbezogen klassifiziert werden kann. Letztere Klassifizierung umfasst die Merkmale Bedrohung, Schaden/ Verlust und Herausforderung. In dieser Phase stellt sich die Frage, ob potentielle Stressoren vorliegen oder nicht.
Bezieht sich die primäre Bewertung noch auf eine Situationsbewertung, so stellt die sekundäre Bewertung eine Beziehung zur Auswahl einer oder mehrerer geeigneter Bewältigungsstrategien her. An dieser Stelle sei nur kurz darauf verwiesen, dass Lazarus zwei verschiedene Bewältigungsstrategien vorsieht. Zum Einen handelt es sich hierbei um instrumentelle Bewältigungsstrategien, deren Inhalte darin liegen, dass problemlösende kognitive Prozesse in Gang gesetzt werden, die sich unmittelbar mit der Bedrohung, der Schädigung/ dem Verlust oder der Herausforderung auseinandersetzen. Unter einer emotionsbezogenen Stressbewältigung hingegen, die auch als palliative Stressbewältigung verstanden wird, werden solche Mechanismen aufgeführt, die eine Veränderung der durch den Stress hervorgerufenen Emotionen herbeiführen sollen. Allerdings verändern die palliativen Strategien die Ursachen für den Stress nicht (Lazarus, 1995).
Das transaktionale Stressmodell vermag in seiner Komplexität alle wesentlichen Elemente einer Stressreaktion, die den reizorientierten und reaktionsorientierten Modellen fehlen, zu vereinen: Eine genaue Betrachtung des Individuums und seiner Ressourcen, eine Fokussierung auf die Situation und auf die daraus resultierenden Stressoren, der ständige Prozess einer Bewertung und das Gefühl des Individuums, dass dessen Ressourcen nicht genügen könnten, um dieser als Stress empfundenen Situation adäquat zu begegnen. Letztlich sei festgehalten, dass auch Lazarus Modell nicht frei von Kritik war und ist. Greif und Cox (1997) weisen z.B. darauf hin, dass es unmöglich sei, dass transaktionale Stressmodell empirisch zu bestätigen bzw. zu falsifizieren. Die Gründe für diese Einschätzung liegen gerade und vermeintlich in der Komplexität und Dynamik der Situation-Individuum-Interaktion, die scheinbar jedes Ergebnis eben wegen dieser Interaktion, aber auch wegen der Individualität eines jeden Einzelnen, nachträglich und beliebig rechtfertigen ließe. Im weiteren Verlauf dieser Masterarbeit soll gerade bei der Diskussion um belastende Ereignisse und deren Auswirkungen auf das Individuum immer wieder auf das transaktionale Modell zurückgegriffen werden, da es, zumindest was seine Komplexität und seine Inhalte anbelangt, als eine Handlungsorientierung eines sich in einer Situation-Individuum-Interaktion befindlichen Individuums herangezogen werden kann.
2.2. Stressoren und Stressreaktionen
„Wer einmal in seinem Leben ein sterbendes Kind gesehen hat und es nicht verhindern konnte, wird dieses nie vergessen“ (Müller, 1994, S. 36). Dieses Zitat beschreibt die Eindrücke eines Feuerwehrmannes, der in seinen Schilderungen darüber reflektiert, welchen Versuch er unternahm ein sterbendes Kind zu retten, jedoch feststellen musste, dass er dessen Tod nicht verhindern konnte. Dieses Ereignis hinterließ eine Wirkung, welche nicht alltäglich ist.
Worin unterscheidet sich jedoch dieses spezifische Ereignis von einer eher als alltäglich definierten Stresssituation einer Einsatzkraft? Was hätte der eben zitierte Feuerwehrmann gesagt, wenn ihn z.B. auf Grund der Einsatzhäufigkeit der fehlende Schlaf, die Hitze bei einem Einsatz oder sogenannte Blaulichtfahrten, welche auch schon dazu führen können, dass der Pulsschlag eine Erhöhung erfährt, zu irgendeiner Reaktion veranlasst hätten (Stephan, 1999)? Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass es sich hierbei um stressauslösende Faktoren handelt, welche auf die Person einwirken und zu einer Anpassungs- und/ oder Bewältigungsleistung führen. Im Allgemeinen spricht man bei diesen stressauslösenden Faktoren von Stressoren (Hausmann, 2003).
Greift man zur erweiterten Verdeutlichung dieser eben geschilderten äußeren Einflüsse wiederum auf das transaktionale Stressmodell von Lazarus zurück (Zapf & Dormann, 2001), dann beschreiben das tote Kind oder die erwähnte Blaulichtfahrt eines Einsatzfahrzeuges einen unangenehmen Spannungszustand, der dann zur Geltung kommt, wenn eine vom Individuum eingeschätzte bedeutsame Situation als aversiv eingeschätzt wird. Diese wiederum als Stressoren bezeichneten Belastungen führen u.U. gemäß der Stufen des Stressmodelles zu einer Stressreaktion.
Für die Einleitung dieses Bearbeitungspunktes wurde bewusst ein Beispiel aus der Berufsgruppe der professionellen Helfer herangezogen. Die hier beschriebene Einsatzkraft und die darauffolgenden Beispiele sollten zunächst darauf hindeuten, dass neben den eher berufsbedingten Stressoren weitere, einsatzbedingte Stressoren existieren. Mit Blick auf das Thema dieser Masterarbeit wird jedoch eine Einschränkung auf gerade diese berufs- und einsatzbedingten stressauslösenden Faktoren vorgenommen, um eine erste Überleitung zu den belastenden Ereignissen zu ermöglichen.
Stressoren, die auf jeden Beruf übertragbar wären und solche, die in den Bereich der außerberuflichen Stresszuordnung fielen, finden derweil keine Betrachtung, obwohl auch hierbei eine kategorische Trennung nicht immer möglich ist.
2.2.1. Stressauslösende Ereignisse als Grundlage einer Reaktion - Eine qualitative Unterscheidung in berufs- und einsatzbedingte Stressoren
Ebenso wie die von Cooper et al. (2001) zitierten, unterschiedlichen Betrachtungsweisen und Forschungstendenzen in der Stressdiskussion erfahren die Stressoren ebenfalls eine nicht einheitliche Zuordnung. So spricht z.B. v. Wietersheim (1995) bei berufsbedingten Stressoren von solchen Einflüssen, die bei den Helfern zwangsläufig oder gelegentlich zu Belastungen führen können. Hingegen gibt es für ihn besonders belastende Einsätze, die für alle Einsatzkräfte gleich sind. Nicht selten haben diese besonderen Einsätze Nachwirkungen für die jeweilige Einsatzkraft. Lasogga und Gasch (2002) sprechen indessen von äußeren Bedingungen, wie z.B. Hitze, Kälte, Nässe oder Lärm und von sogenannten Mikrostressoren, zu denen der Zeitplan, die Nacht- und Schichtarbeit, die Verhaltensweisen von Kollegen etc. zu zählen sind. Besondere Einsatzvorkommnisse werden von Müller (1994) als solche Situationen definiert, bei denen die Feuerwehrleute anders als bei Routineeinsätzen reagieren.
Um eine einheitliche Fokussierung gewährleisten zu können, wird an dieser Stelle seitens des Autors eine Unterteilung in berufsbedingte und einsatzbedingte Stressoren vorgenommen, da diese Termini Bestandteil der Mitarbeiterbefragung bei der Berufsfeuerwehr in Bochum waren, auf welche im empirischen Teil en detail eingegangen wird.
Berufsbedingte Stressoren werden als solche Belastungen verstanden, die das tägliche Berufsbild der Einsatzkräfte im Feuerwehr-/ Rettungsdienst prägen, wohingegen unter einsatzbedingten Stressoren diejenigen Belastungen verstanden werden, die nicht alltäglich sind und als traumatisches Ereignis definiert werden können (Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003). Eine Zuordnung der jeweiligen Stressoren ist aus Sicht des Autors schließlich möglich, da sich die Stressoren der eben genannten Autoren in ihrer Intensität, aber auch in ihrer Definition ähneln. Zu den berufsbedingten Stressoren sind demzufolge u.a. folgende Faktoren zu zählen (Waterstraat, 2003):
- Nächtliche Einsätze ohne Aufwärmzeit
- Schlechte Sichtverhältnisse durch Rauch, Nebel, Dunkelheit
- Extreme äußere Bedingungen: Hitze oder Kälte, Nässe, Schnee, Eis, Sturm
- Probleme durch ein hohes Verkehrsaufkommen, generelle Unzugänglichkeit der Unfallstelle
- Kommunikationsprobleme, wie z.B. Funkdisziplin, Funklöcher etc.
Weitere berufsbedingte Stressoren sind nach Bengel und Heinrichs (2004):
- Arbeitsumgebung am Einsatzort
- Technische Anforderungen
Besonders belastende Einsätze, die in diesem Zusammenhang als einsatzbedingte Stressoren definiert werden, sind u.a. die hier folgenden Elemente (Lasogga et al. 2002):
- Schwerverletztes oder totes Kind bzw. verletzter oder toter Jugendlicher
- Sterbende
- Massenunfälle
- Patient ist ein Bekannter oder ein Arbeitskollege
- Direkte Gefährdung der Helfer
- Anblick von Leichenteilen
Eine Bestätigung dieser einsatzbedingten Stressoren erfolgt ebenso von v. Wietersheim (1995), der die Einsätze mit geschädigten Kindern und Jugendlichen, schwersten Verletzungen und den Tod eines Kollegen als besonders belastend erachtet.
Stressoren haben in Abhängigkeit einer individuellen Bewertung und den zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen unterschiedlichste Konsequenzen für die betreffende Einsatzkraft (Bengel & Riedl, 2004). So stellen gerade die einsatzbedingten Stressoren eine besondere Gefahr dar, da sie den professionellen Helfer psychisch leiden lassen können.
2.2.2. Reaktionen des Individuums auf Stressoren: Physische, kognitive, emotionale und verhaltensbedingte Stressreaktionen
Drei Kinder aus brennender Wohnung gerettet. Bergung eines 11 Monate alten Kindes - verbrannt im Kinderbett. Habe geheult wie ein Schlosshund. War nicht ansprechbar für andere; hab nicht darüber gesprochen. Meine Frau war zu der Zeit schwanger und unser Sohn war 1,5 Jahre alt (Teegen, 2003, S. 126).
Immer wieder sehen sich Einsatzkräfte solchen Situationen ausgesetzt, die bestimmte Reaktionen bei ihnen hervorrufen können. Doch welche Reaktionen wurden durch dieses geschilderte Erlebnis initiiert? Welche Reaktionen offenbarte der Feuerwehrmann des o.g. Zitates? 3 wesentliche Reaktionen lassen sich schnell ausfindig machen:
- Weinen
- Rückzug
- Sprachlosigkeit
Folgt man abermals dem Stressmodell von Lazarus, so lässt sich anhand der Kombination aus primärer, sekundärer Bewertung und einer abschließenden Neubewertung erkennen, dass, sofern die Evaluation der Situation und der Ressourcen nicht den gewünschten Erfolg verbuchen konnte, eine triadische Reaktion des Individuums möglich ist (Zapf et al. 2001). Demgemäß kann Stress eine unmittelbare, kurzfristige und langfristige Ausprägung zeigen, die sich auf der physiologischen, der psychischen und der verhaltensbedingten Ebene bemerkbar machen kann. Hiernach lassen sich in einer ersten Betrachtung der Rückzug und die Sprachlosigkeit den verhaltensbedingten und psychischen Reaktionen attachieren (Lasogga et al. 2002). Andere Autoren wie Waterstraat (2003) und Müller (1994) fügen diesen Stressreaktionen eine weitere, emotionale Komponente hinzu, so dass das Weinen ebenfalls ins Kalkül einer Reaktion gezogen werden kann und infolgedessen 4 Reaktionsarten betrachtet werden müssen.
In diesem Zusammenhang muss jedoch auf eine Feinheit hingewiesen werden, um nicht selbst der Gefahr zu erliegen, ebenfalls zur Verwirrung und einer fehlenden Kontinuität beizutragen. In der wissenschaftlichen Literatur werden diese Stressreaktionen oftmals auf die Berufsgruppe der Einsatzkräfte übertragen, zu denen neben der Feuerwehr auch die Angehörigen der Polizei und die Rettungsdienstmitarbeiter der verschiedenen gemeinnützigen Anbieter zu zählen sind, welche in eine Beziehung zu akuten Belastungsreaktionen und posttraumatischen Belastungsstörungen gesetzt werden (Waterstraat, 2003). Das ist insofern richtig, da die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Amerikanische Psychiatrische Gesellschaft (APA) mit ihren Klassifizierungen gerade bei der Typisierung von Belastungen auf diese Reaktionen zurückgreifen (Teegen, 2003). Jedoch sei angemerkt, dass diese Reaktionen natürlich auch als Resultat belastender Arbeits- und Lebensbedingungen angesehen werden können (Krohne, 1997).
Mitchell und Everly sprechen bei der Kategorisierung von möglichen Reaktionen, die von außergewöhnlichen Belastungen und exzessivem Stress abhängen, ebenfalls von kognitiven, körperlichen, emotionalen und verhaltensbedingten Reaktionen ( Igl et al. 1998). Greift man zusätzlich auf die Belastungs-Beanspruchungs-Diskussion zurück, dann findet man erneut eine Klassifizierung in physiologische, psychische und verhaltensmäßige Reaktionsarten (Kaufmann, Pornschlegel & Udris, 1982).
Zimbardo (1992) zählt zu den physiologischen Reaktionen folgende Merkmale: gesteigerte Alarmbereitschaft, Krankheitsanfälligkeit, Erkrankung der Herzkranzgefäße, Erschöpfung, vorzeitiger Tod. Igl et al. (1998) fügen ein starkes Schwitzen, Sprachstörungen, Herzrasen etc. hinzu. Verhaltensbedingte Reaktionen sind u.a. selbstzerstörerische Tendenzen, rigide/ stereotype Verhaltensweisen, Vermeidung von Kontakten und ein gesteigertes Aktivitätsniveau. Emotionale Reaktionen werden als Furcht, Angst, Wut und als Abwehrmechanismen des Ichs bezeichnet. Die kognitiven Stressreaktionen beziehen sich auf die Planung, dass kreative Denken, die kognitive Neubewertung, die Einschränkung der Wahrnehmung und auf die Selbstbewertung (Zimbardo, 1992). Zur Verdeutlichung dieser kognitiven Mechanismen seien nochmals weitere Kriterien nach Igl et al. (1998) angefügt: gedankliche Verwirrung, Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten.
Die dezidierte Darstellung könnte vermuten lassen, dass diese Reaktionen auf jedes Individuum in gleicher Weise übertragbar wären. Zimbardo (1992) und Waterstraat (2003) verweisen indes in ihren Ausführungen, dass im Erleben von stressreichen Ereignissen inter- aber auch intraindividuelle Unterschiede existieren. Nicht jeder Mensch nimmt jede stressreiche Situation aversiv wahr. Nicht immer versagen die vorhandenen Bewältigungsmechanismen. Oftmals spielen auch bereits gewonnene Erfahrungen eine besondere Rolle im Umgang mit Stress. Auf diese Erkenntnisse soll in den folgenden Kapiteln erneut eingegangen werden.
2.2.3. Stress als Reaktion auf aversiv empfundene Situationen - Abgrenzung des Stresskonstruktes für den Gegenstandsbereich dieser Masterarbeit
Stress, Stressoren, Belastungen, Beanspruchungen, Reaktionen etc. Man könnte die Aufzählung der Elemente, welche sich um den Stressbegriff sammeln, unendlich weiterführen. Ob reiz- oder reizorientiert, ob kognitiv oder als Anpassungsreaktion des Organismusses, Stress kann sich negativ auf das Individuum auswirken und zu Beeinträchtigungen im Sinne von Störungen oder Krankheiten führen (Gusy, 1995). Was aber verbirgt sich genau hinter dem Konstrukt Stress und wie lässt sich dieses auf den Gegenstandsbereich dieser Masterarbeit transferieren?
Bedient man sich des lateinischen Wortes „strictus“ und seiner Übersetzung „eng“, dann lässt auch dieser Versuch einer Annäherung viel Platz für Diffusität (Fröhlich, 1993). Sein altfranzösisches Pendant „estrece“ hingegen bezeichnet Stress als Enge, Bedrückung und Not. Und nicht erst der aus der Physik des 18. Jahrhunderts stammende Spannungszustand, der durch Druck oder Zug ausgelöst wurde, leisten Zeugnis darüber, dass Stress vielseitig sein kann, aber zugleich einheitliche Merkmale umfasst. Eine wohl annähernd allumfassende Definition von Stress vermögen Greif et al. (1997) bereitzustellen, die vielmehr als alle anderen Definitionen gerade den Aspekt der Aversion in den Vordergrund stellen. Sie unterscheiden 6 theoretisch bedeutsame Aspekte, die scheinbar allumfassend sind:
Auf dieser Grundlage kann die <Stressreaktion> als subjektiver Zustand definiert werden, der aus der Befürchtung (englisch <threat>) entsteht, dass eine starke aversive, zeitlich nahe und subjektiv lang andauernde Situation wahrscheinlich nicht vermieden werden kann. Dabei erwartet die Person, dass sie nicht in der Lage ist (oder sein wird), die Situation zu beeinflussen oder durch Einsatz von Ressourcen zu bewältigen (S. 435).
Semmer (1984, S. 27) greift ebenfalls auf den Terminus „Aversion“ in seinem Definitionsversuch zurück und stellt fest: „Unter Stress verstehe ich daher im folgenden einen unangenehmen Spannungszustand, der entsteht, wenn eine Situation als aversiv eingeschätzt wird. Stressoren sind Ereignisse, die die Auftretenswahrscheinlichkeit von Stresszuständen in einer gegebenen Population erhöhen“.
Diese beiden Definitionen lassen unschwer eine Verbindung zum transaktionalen Stressmodell von Lazarus erkennen. Alle drei haben die situationsbezogene, individuelle Divergenz, die Bewertung der Situation und dessen aversive Charakterisierung gemeinsam. Sie haben insbesondere für die Einsatzkräfte einen bedeutsamen Charakter, da davon auszugehen ist, dass diese öfter mit Leid und Elend akut konfrontiert werden und somit solchen berufs- und einsatzbedingten Belastungen ausgesetzt sind, welche ab einem gewissen Grad auch traumatisierend sein können (Lasogga et al. 2002).
Die Definition von Greif und das transaktionale Stressmodell von Lazarus sollen gleichsam für die weiteren Bearbeitungspunkte gelten.
3. Belastende Ereignisse - Von der Betreuung der Opfer zur Unterstützung von Einsatzkräften
3.1. Orientierung
Legt man die Erkenntnisse der vorangegangen Kapitel zu Grunde, so erscheint der folgende Weg einer umfassenden Auseinandersetzung mit belastenden Ereignissen und deren Auswirkungen sinnvoll. Zwar ist es die Absicht des Autors, einen Überblick über den geschichtlichen Entwicklungsprozess der Betreuung von Opfern und Einsatzkräften zu ermöglichen, jedoch werden die Entwicklungstendenzen der Bemühungen der WHO und der APA um eine Klassifizierung von belastenden Ereignissen bewusst nur in Kürze besprochen, da in diesem Zusammenhang lediglich die aktuelle Definition und die aktuelle Klassifizierung von Bedeutung sind.
Die Maßnahmen und Methoden des CISM-Konzeptes und das Zugunglück von Eschede sollen die Bemühungen und die Konsequenzen um eine helferzentrierte psychosoziale Betreuung exemplarisch verdeutlichen.
3.2. Sind Einsatzkräfte versteckte Opfer? Chronologie der personenzentrierten Betreuung nach belastenden Ereignissen
Ich wünschte, Du könntest Dir die physische, emotionale und mentale Belastung von stehengelassenem Essen, verlorenem Schlaf und verpasster Freizeit vorstellen, zusammen mit all den Tragödien, die meine Augen gesehen haben. Solange Du dieses Leben nicht durchgemacht hast, wirst Du niemals wirklich verstehen oder einschätzen können, wer ich bin, was wir sind oder was uns unsere Arbeit wirklich bedeutet (Gedanken eines Feuerwehrmanns, 2003).
Eindrucksvoll beschreiben diese Gedanken eines Feuerwehrmannes, mit welchen besonderen Belastungen dieser konfrontiert wird. Er stellt darüber hinaus kritisch fest, dass das, was ihn bewegt und berührt, von Außenstehenden nicht als Belastung wahrgenommen wird.
Lange Zeit wurde es als Selbstverständlichkeit angesehen, dass Einsatzkräfte die grausamen Erfahrungen, welche sie im Umgang mit ihrer helfenden Tätigkeit erleben, ohne seelische Beeinträchtigungen verarbeiten würden (Teegen, 2003). So erzeugt das Statement von Petzold, dass bis Mitte der 90er Jahre wenig wissenschaftliche Grundlagen und Überblicke in Bezug auf Katastrophen, posttraumatischen Belastungsstörungen etc. vorlagen, kaum eine Überraschung (Liebermann, Wöller & Siol, 2001). Hermanutz und Buchmann (1994, S. 295) weisen auf eine gleiche Problematik hin: „Diejenigen Personen, die bei solchen Einsätzen mit den schlimmsten Situationen als Rettungspersonal konfrontiert werden, wurden bisher kaum untersucht“. Kritisch fragen sie, ob die Helfer eventuell als versteckte Opfer bezeichnet werden können. Opfer, denen in Hinblick auf deren Belastungen nicht viel Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Trotz allem gibt es seit Mitte der 90er Jahre eine Tendenz in Deutschland, die darauf hindeutet, dass es eine Veränderung im Fokus der Betrachtung gibt (Siol, Flatten & Wöller, 2001). Leider ist diese Verschiebung des Interesses mit vielen Katastrophen und belastenden Ereignissen eng verwoben. Die von Hermanutz et al. (1994) durchgeführte und bis dahin einzige deutsche Studie über die psychischen Auswirkungen eines extrem belastenden Einsatzes am Beispiel des Busunglückes in Donaueschingen und das Zugunglück von Eschede, welches viele Organisationen dazu bewegte, eine psychologische Betreuung für Einsatzkräfte anzubieten, sind ein trauriger Beweis dafür, dass eine psychologische Betreuung von Einsatzkräften, vor allen Dingen in Deutschland, viele Jahrzehnte unberücksichtigt blieb (Bengel, 2001).
Immer wieder standen kriegerische Auseinandersetzungen und Katastrophen der vergangenen Jahrhunderte im Fokus der Betrachtung, wenn über die Folgen von Traumatisierungen auf die menschliche Psyche diskutiert wurde (Sonneck, 2000). Wurden die Beschwerden der Soldaten des 1. Weltkrieges noch mit Hysterie, Frontneurose, Granatschock, Kriegszittern und mit einem Vorwurf nach mangelnder Tapferkeit und konstitutioneller Minderwertigkeit diagnostiziert, so bemühten sich Militärpsychiater im Laufe des 2. Weltkrieges um eine genaue Beschreibung der Symptome der Belastungsstörungen und eine alsbaldige Rückführung an die Front (Teegen, 2003). Während man die Symptome des 1. Weltkrieges mit Bestrafung, Drohung und Elektroschockeinsätzen zu therapieren versuchte, wurden im 2. Weltkrieg Einzelgespräche und Hypnose zur Intervention herangezogen. Weitere Großschadenslagen und Katastrophen führten später zu einer Betrachtung der Überlebenden und zu der Erkenntnis eines Bedarfes an psychosozialer Betreuung. Die Helfer derselben wurden bei dieser Betrachtung allerdings weitestgehend vernachlässigt. Erst der 1983 in Südaustralien als „Ash Wednesday Bushfire“ (Unfallkasse Hessen, 1999, S. 37) in die Geschichte eingegangene Buschbrand und die daraus resultierende Langzeitstudie ließen deutlich werden, dass auch Einsatzkräfte durch ihre helfende Tätigkeit der Gefahr ausgesetzt sind, akute und chronische Belastungsstörungen zu entwickeln.
Obgleich die Lücke zwischen internationalen und nationalen Interessen in Bezug auf eine psychosoziale Betreuung der Einatzkräfte erst Mitte der 90er Jahre annähernd geschlossen wurde, sind weitere Studien und Bemühungen von Nöten, um diese Lücke vollständig zu schließen (Siol et al. 2001).
3.3. Gesellschaftstheoretische Einordnung von belastenden Ereignissen, akuten Belastungsreaktionen und von posttraumatischen Belastungsstörungen
In der Auseinandersetzung um die Klassifizierung von Störungen, welche durch belastende Ereignisse hervorgerufen werden können wird deutlich, dass wiederholt unterschiedliche Interpretationen und Ansätze existieren, die nicht minder zur Verwirrung im gesamten Spektrum von Stress, Stressoren und den daraus resultierenden Störungen beitragen (Liebermann et al. 2001).
Die WHO und die APA geben mit ihren Kriterien annähernd gleiche, aber doch in Nuancen differente Leitlinien einer möglichen Klassifizierung vor. Eine erste Unterscheidung findet sich bereits beim Versuch der Definition eines belastenden Ereignisses. Spricht die WHO in der International Classification of Diseases (ICD-10) F43.0 (akute Belastungsreaktion) und F43.1 (posttraumatische Belastungsstörung) von solchen überwältigenden traumatisierenden Ereignissen (z.B. Krieg, Unfall, Naturkatastrophe, Verbrechen, Vergewaltigung), die eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit der Person bedeuten respektive von solchen Situationen mit einer außergewöhnlichen Bedrohung oder mit einem katastrophalen Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würden (Dilling, Mombour & Schmidt, 1993), so stellt die APA mit ihren Diagnostischen Kriterien des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-IV) 308.3 (F43.0) bzw. mit den DSM-IV 309.81 (F43.1) eine präzisere Traumadefinition zur Verfügung, die für beide Klassifizierungen gilt: Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die entweder den tatsächlichen oder drohenden Tod oder eine schwerwiegende Verletzung oder eine Gefahr des eigenen Lebens oder anderer Personen implizierte. Kommt es bei dieser Person zusätzlich zu einer Reaktion aus intensiver Flucht, Hilflosigkeit und Entsetzen, dann spricht man von einem traumatischen Erlebnis (Saß et al. 2003). Zwar geht diese Klassifizierung explizit nicht auf ein Stressmodell ein, jedoch ist eine Parallele zum transaktionalen Stressmodel von Lazarus erkennbar (Rüger et al. 1990). Ausgehend vom definitorischen Dreiklang der Situations-, Ressourcen- und der Neubewertung ist ein Transfer zur Klassifizierung der DSM-IV 309.81 und DSM-IV 308.3 möglich. In einem kontinuierlichen Bewertungsprozess wird eine Situation als unangenehm eingeschätzt, vorhandene Ressourcen werden hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, ihrer Umsetzbarkeit und ihres Erfolges bewertet und führen zu einer Neubewertung. Erfährt dieser Prozess einen negativen Ausgang, dann kommt es zu einer spezifischen Reaktion des Individuums, die gemäß der oben genannten Klassifizierung zu einer Belastungsreaktion respektive einer Belastungsstörung führen kann. Anzumerken gilt es, dass die akute Belastungsreaktion der WHO gemäß der Definition der APA mit annähernd gleichen Inhalten als akute Belastungsstörung bezeichnet und definiert wird (Langkafel, 2000).
Als Vorstufe der posttraumatischen Belastungsstörung gelten für die akute Belastungsreaktion bzw. für die akute Belastungsstörung ähnliche Symptome. Neben z.B. wiederkehrenden Gedanken in Bezug auf das belastende Ereignis sind Verhaltensweisen, die eine Vermeidung von Reizen implizieren sowie ein erhöhtes Erregungsmaß Kennzeichen dieser Vorstufe. Auch wenn die Einsatzkräfte prozentual gesehen einem höheren Risiko ausgesetzt sind eine Belastungsstörung zu erleiden, so impliziert ein belastendes Ereignis nicht zwangsläufig eine in diesem Sinne nachfolgende Reaktion (Bengel, 2001). Die Gründe hierfür liegen im Umfeld und in der Persönlichkeit des Individuums. Treten die Symptome dennoch auf, so stellen sie nach Müller-Cyran (2004) eine zunächst schützende Funktion dar, die als angemessene Reaktion eines gesunden und normalen Menschen auf ein nicht normales Ereignis antizipiert wird. Akute Belastungsreaktionen bzw. akute Belastungsstörungen können eine Dauer von bis zu 4 Wochen haben.
Weisen diese Symptome nunmehr auf eine Dauer von mehr als 4 Wochen hin, dann sollte überprüft werden, ob die Indikation einer posttraumatischen Belastungsstörung vorliegt oder diese ausgeschlossen werden kann (Teegen, 2003). Man spricht immer dann von einer posttraumatischen Belastungsstörung, sofern 3 Symptomgruppen vorliegen. Hierbei werden zwischen einem intrusiven Wiedererleben, der Vermeidung traumarelevanter Reize bzw. der reduzierten emotionalen Reagibilität und einer Übererregtheit unterschieden. Die Symptome des ICD-10 und der DSM-IV zur Klassifizierung der posttraumatischen Belastungsstörung sind abermals ähnlich, unterscheiden sich lediglich in der Definition, in welcher quantitativen Ausprägung eine Symptomgruppe mindestens vorliegen muss, um von einer Störung sprechen zu können (Steil & Ehlers, 2003). Das Störungsbild einer posttraumatischen Belastungsstörung kann qua Klassifizierung länger als einen Monat und bis zu 6 Monate währen.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Erkenntnisse der DSM-IV 308.3 und 309.81, insbesondere die Definition eines belastenden Ereignisses, ihre Umsetzung in der Mitarbeiterbefragung des Kapitels 5 erfahren haben.
3.4. Das Critical Incident Stress Management (CISM) als ein qualitatives Konzept der Prävention, Intervention und Nachsorge - Maßnahmen und Methoden
„Der Forschungsstand zu den psychischen Belastungen und Störungen bei Einsatzkräften belegt, dass diese zu einer Risikogruppe für Burnout und Posttraumatische Belastungsstörungen gerechnet werden müssen und psychologischer Versorgung bedürfen“ (Bengel, 2001, S. 186).
Immer wieder stößt man auf die Forderung, dass gerade die als Risikogruppe geltenden Einsatzkräfte einer besonderen Betreuung auf Grund der Spezifika ihres Berufes bedürfen. Was aber sind die Grundlagen solcher Betreuungsmaßnahmen und wie sind sie einzusetzen? Stepan und Wessels (1996) weisen darauf hin, dass eine Bewältigung traumatischer Ereignisse nur dann möglich ist, sofern eine aktive Auseinandersetzung und Bearbeitung stattfinden kann. Dieses sei nur dadurch zu erreichen, wenn das Personal auf derartige Einsätze vorbereitet wird und ferner die Möglichkeit hat, die erlebten Einsätze nachzuarbeiten. Neben Ungerer (1999), der allgemein festhält, dass, je gründlicher eine Einsatzkraft vorbereitet ist, sie weniger dysfunktionalen Stress unter hohen Einsatzanforderungen ausbildet, fügen Lasogga und Gasch (2004) einen Weg der Betreuung an, der über die Prävention und Intervention zur Nachsorge führt. Sie unterscheiden im Sinne der Nachsorge zudem zwischen Alltagsmethoden und professionellen Angeboten.
An dieser Stelle soll ein qualitatives Konzept vorgestellt werden, in welchem die Aspekte Prävention, Intervention und Nachsorge ihre sinnvolle Vereinigung finden. Im Bewusstsein, dass weitere Konzepte existent sind, greift der Autor zur Erklärung dennoch nur auf dieses Konzept zurück, da es einerseits das bekannteste Konzept ist und die zugleich am weitesteten verbreitete und eingesetzte psychologische Hilfe erklärt.
Das von Mitchell und Everly in den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte mehrstufige und integrative, ständig erweiterte CISM-Modell feierte nach einem Flugzeugabsturz im Jahre 1982 in den USA in Form eines Debriefings eine traurige Premiere (Hausmann, 2003). Seine Ziele sind u.a. die Linderung der akuten Stressbelastung, die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit und die Prävention psychischer Störungen. Diese Ziele sollen durch verschiedenste Methoden und Maßnahmen, die einerseits der primären Prävention zuzuordnen sind, also vorbeugende Unterrichts- und Trainingsmaßnahmen implizieren, erreicht werden und anderseits durch sekundärpräventive Maßnahmen ihre Vollendung finden (Willkomm, 2001). Neben den bereits erwähnten vorbeugenden Unterrichts- und Trainingsmaßnahmen gehören die individuelle Krisenintervention, das Defusing, das Debriefing und die Demobilisierung zum Critical Incident Stress Management-Angebot.
Nach Mitchell und Everly (Igl et al. 1998) ist die individuelle Krisenintervention ein Synonym für deren SAFE-R-Modell. Es umfasst insgesamt 5 Stufen:
1. Stufe: Stimulanzvermeidung
2. Stufe: Akzeptanz der Krise
3. Stufe: Förderung des Verstehens und der Normalisierung von Symptomen/ Reaktionen
4. Stufe: Entwicklung wirksamer Bewältigungsstrategien
5. Stufe: Rückführung zur Eigenständigkeit oder Unterstützung durch weitere Begleitung/ Beratung
Das Defusing, auch Kurzbesprechung genannt, richtet sich nunmehr nicht mehr an das Einzelindividuum, sondern macht die Gruppe zu seiner Klientel. Es beinhaltet insgesamt 3 Phasen (Einführungs-/ Austausch-/ Informationsphase) und dauert zwischen 10 und 20 Minuten an. Ein wesentliches Ziel dieser Kurzbesprechung ist die Feststellung, ob ein Debriefing notwendig ist oder nicht.
Kommt es zu einem Debriefing, dann werden in einem zwei- bis dreistündigen Prozess insgesamt 7 Phasen durchlaufen (Einführung, Tatsachen, Gedanken, Reaktionen, Auswirkungen, Informationen und Abschluss). Dabei stehen 2 Ziele im Vordergrund: Die Reduktion der Auswirkungen eines belastenden Ereignisses und die Beschleunigung des Gesundungsprozesses des Individuums.
Die Demobilisierung, auch Einsatzabschluss genannt, ist in erster Linie eine primäre Stresspräventions- und Interventionsmaßnahme, die immer dann angewandt wird, sofern die Einsatzkräfte den Ort der Großschadenslage verlassen. Vornehmlichstes Ziel ist die Klärung eines weiteren psychosozialen Unterstützungsbedarfes und die Vermittlung von Informationen über mögliche Stresssymptome und praktische Informationen über die Stressbearbeitung. Dieser Einsatzabschluss besteht aus 2 Teilen. Ein erster Abschnitt, die Dauer beträgt ca. 15 Minuten, soll über mögliche Stressreaktionen und über deren Handhabung informieren. Der zweite Abschnitt, dessen Dauer ca. 20 Minuten umfassen, ist ein Forum der Pause, in dem die Einsatzkräfte einen Imbiss zu sich nehmen und sich ausruhen können, bevor man zu seinen Alltagspflichten zurückkehrt.
Einige Untersuchungsergebnisse unterstreichen neben kritischen Stimmen die Wirksamkeit von CISM-Maßnahmen. So bewirken dieselben demnach eine deutliche Linderung der akuten Stress- und Belastungssymptome und reduzieren die Langzeitbelastung, welche durch verschiedene Stresssymptome und unangemessene Verhaltensweisen verstärkt werden, effektiv (Hausmann, 2003).
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das oberste Ziel dieser Maßnahmen die Vermeidung von akuten Belastungsreaktionen respektive von posttraumatischen Belastungsstörungen ist. Treten allerdings akute Belastungsreaktionen auf, dann sollen Informationen über mögliche Stressreaktionen und die Vermittlung von Methoden zur Stressbearbeitung zu einer Linderung führen. Die wohl wichtigste Information in diesem Zusammenhang ist die Kenntnis darüber, dass man als Einsatzkraft nicht krank ist, sondern eine normale Reaktion auf ein ungewöhnliches Ereignis zeigt. Daher stellen die Reaktionen auf ein belastendes Ereignis eine natürliche Warn- und Bewältigungsreaktion dar (Sonneck, 2003).
3.5. Die Zugkatastrophe von Eschede - Maßnahmen und Forderungen für eine qualifizierte Betreuung von Einsatzkräften
Professionelle Helfer haben ein enormes Maß an psychischen Belastungen zu bewältigen. Großschadensereignisse, wie zuletzt das ICE-Unglück in Eschede, haben nicht nur für die unmittelbar Betroffenen und deren Angehörigen weitreichende psychische Folgen. Die ca. 1200 beteiligten Helfer werden die Bilder des Schreckens ebenfalls nie wieder vergessen können (Herz, 1998, S. 15).
Das Unglück von Eschede liegt nun mehr als 6 Jahre zurück. Die von Teegen (2003) angeführte Kritik, dass eine helferzentrierte Fokussierung erst im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts erfolgte, zeigt deutlich, wie viel Zeit der Prozess eines Umdenkens in der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen hat und weiterhin nehmen wird.
Einzelne Institutionen trugen im Wesentlichen dazu bei, dass eine Neuorientierung in Richtung psychosoziale Betreuung für Einsatzkräfte stattgefunden hat. Eine Vorreiterfunktion übernahm hierbei die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Hamburg, die sich bereits seit dem Jahre 1988 mit dieser Problematik auseinandergesetzt hat (Müller, 1994). Aber erst das Zugunglück von Eschede ließ auch auf Seiten der Einsatzkräfte die Forderung nach einer Betreuung lauter werden. So offenbarte sich den Einsatzkräften, dass der Bedarf einer psychosozialen Betreuung während und nach einem Einsatz vorhanden war (Hüls, 1999). Allerdings ist nicht außer Acht zu lassen, dass dieses Unglück nicht nur eine außerordentlich hohe psychische Belastung bei den Einsatzkräften hervorgerufen hat, sondern auch einen bedeutenden Einfluss auf die primären Opfer ausübte.
In diesem Zusammenhang wies Helmerichs (1999) darauf hin, dass es bis zu diesem Zeitpunkt keine strukturierte Form einer Einsatznachsorge im Katastrophenfall gab, so dass erst innerhalb der ersten Tage eine geordnete Struktur implementiert werden musste. Organisationen, wie das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst, die Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen (SbE e.V.), das EinsatzNachsorgeTeam der Berliner Feuerwehr, die Universität Freiburg, die Bundeswehr und der Bundesgrenzschutz wurden durch eine Koordinierungsstelle Einsatznachsorge in ihren Einsätzen koordiniert und begleitet. Die von diesen Institutionen angebotenen Maßnahmen bestanden vornehmlich in der Durchführung von Debriefings und von Einzelberatungen. Rückmeldungen der Teilnehmer dieser qualitativen Maßnahmen gaben Aufschluss darüber, dass dieselben als hilfreich und wichtig bewertet wurden (Uhlmann, 2001). Einige Einsatzkräfte sprachen sogar von einer spürbaren Entlastung (Stephan, 1999).
Unglücklicherweise treten Innovationen und Veränderungen scheinbar immer nur dann in den Mittelpunkt, sofern sich aktuell ein besonderes Ereignis zugetragen hat. Viele Verfahren, Anweisungen, Vorschriften und Regelwerke werden bis zu einem gewissen Punkt als Selbstverständlichkeit betrachtet. Tritt ein besonderes Ereignis zu Tage, dann erscheint die Öffentlichkeit nicht selten überrascht und vollkommen überfordert.
Warum sich die Entwicklung solcher Instrumentarien, die sich sowohl auf die Einsatznachsorge als auch auf die Prävention und Intervention beziehen nur eher schleppend als kontinuierlich fortbewegt, verbleibt im Verborgenen. Nach Einschätzung des Autors liegen 3 wesentliche Ansätze als mögliche Erklärung zu Grunde. Zum Einen hat die nicht immer einheitlich verlaufende Diskussion um das Stresskonstrukt ihren Beitrag zur Diffusität geleistet. Zum Anderen werden solche Auffassungen dazu beigetragen haben, die die Einsatzkräfte als stressresistent und somit als nicht betrachtungswürdig erachteten. Stereotype wie z.B. die Bezeichnung als sogenanntes Weichei, das Verhalten der Vorgesetzten, aber auch ein Verleugnen der Belastungen der Einsatzkräfte selbst werden ihren Beitrag geleistet haben (Lasogga et al. 2004).
Was aber waren die wesentlichen Konsequenzen nach dem Zugunglück von Eschede, um den Aufwärtstrend im Sinne einer helferzentrierten Fokussierung beizubehalten? Neben der Forderung, übergreifende Organisationsstrukturen der Einsatznachsorge zu entwickeln, bestand eine weitere Forderung darin, diese in die Katastrophenschutzpläne einzubinden. Darüber hinaus sollte die Einsatznachsorge in die Aus- und Fortbildung von Einsatzkräften integriert werden. Die Entwicklung von Qualitätsstandards und eine wissenschaftliche Begleitung der Einsatznachsorge bildeten den Abschluss dieser Forderungen (Helmerichs, 1999).
Sich bei diesen Konsequenzen als besonders bedeutsam hervorhebend, treten die Forderungen nach einer Implementierung der möglichen Maßnahmen einer Einsatznachsorge in die Aus- und Fortbildung in den Vordergrund. Diese Forderungen richten sich im Besonderen an die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Diese Fürsorgepflicht kann und darf sich nicht mehr nur ausschließlich auf die technische Ausstattung und fachliche Kompetenz reduzieren, sondern muss sich auch auf die psychische Situation der Mitarbeiter konzentrieren. Eine Integration dieser psychosozialen Fürsorgepflicht in die Aus- und Fortbildung vor dem Hintergrund der Prävention, Intervention und Nachsorge ist somit erforderlich (Bengel, 2001).
Die Organisationsstruktur der Bochumer Berufsfeuerwehr und deren Maßnahmen im Umgang mit Stress sollen mit Blick auf die eben genannten Konsequenzen und Forderungen im nächsten Kapitel herausgestellt werden.
4. Umgang mit Stress und belastenden Ereignissen bei der Berufsfeuerwehr zu Bochum
4.1. Organisationsstruktur und Aufgabenbereiche
Die Berufsfeuerwehr zu Bochum wurde im Jahre 1901 gegründet und kann somit auf eine mehr als 104-jährige Geschichte zurückblicken. Im Laufe dieser Zeit hat diese Institution verständlicherweise verschiedenste Veränderungen über sich ergehen lassen müssen. Heute präsentiert sich die Berufsfeuerwehr Bochum mit einer Personalstärke von 352 Feuerwehrbeamten und Angestellten im feuerwehrtechnischen Dienst, von denen zur Zeit 237 Feuerwehrmänner (Bremer Dienst und Zugführer) im 24-Stunden-Wachdienst eingesetzt werden. Zur Administration gehören 22 Verwaltungsbeamte und Angestellte im Verwaltungsdienst. 7 weitere Arbeitnehmer gehören zum sonstigen Personal und versehen ihren Dienst in den Werkstätten der Berufsfeuerwehr (Stadt Bochum, Jahresbericht 2003).
Das Amt 37, so die offizielle Bezeichnung, verfügt neben einem Direktionsstab über insgesamt 4 Abteilungen, denen differenzierte Funktionen obliegen. Neben der Abteilung 37 1 Verwaltung existieren die Abteilungen 37 2 Qualifizierung, Betriebsunterhaltung und Betriebsausstattung, 37 3 Operativer Dienst und die Abteilung 37 4 Prävention. Die allgemeinen Aufgaben ergeben sich aus der jeweiligen Abteilungszugehörigkeit. So ist die Verwaltung u.a. für die Personalverwaltung und für die Budgetierung zuständig. Die Abteilung 37 2 subsumiert die Bereiche Aus- und Fortbildung, technische Dienste und EDV/ E-Technik zu Ihrem Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Zum Bereich der operativen, also den ausführenden Diensten, zählen die taktische Einsatzplanung und die Organisation des Einsatzdienstes. Ferner gehören die Feuer- und Rettungswachen I-III und die Rettungswachen IV-VII zu dieser Abteilung, auf welche im weiteren Verlauf noch en detail eingegangen wird. Im Rahmen der Prävention befasst sich die Abteilung 37 4 u.a. mit der Brandschutzerziehung/-unterweisung und der Betreuung von brandschutzrelevanten Objekten sowie der Erstellung von Stellungnahmen und Gutachten im behördlichen Genehmigungsverfahren (Anhang 1, Organigramm Amt 37, S. 75).
Die für den Gegenstandsbereich dieser finalen Arbeit wichtigsten Organisationseinheiten sind neben den Rettungswachen die Feuer- und Rettungswachen I-III, die mit insgesamt 237 Einsatzkräften für eine Fläche von 145,40 km2 und rund 390.000 Einwohnern in den Aufgabenfeldern Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Rettungsdienst tätig sind. Dabei sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass jeder Feuerwehrmann in Nebenfunktion entweder Rettungssanitäter oder -assistent ist.
Alle Wachen sind auf das gesamte Bochumer Stadtgebiet verteilt. Den einzelnen Feuer- und Rettungswachen fallen neben den oben genannten Aufgabenfeldern besondere Aufgaben zu. Zum erweiterten Aufgabenbereich der Feuer- und Rettungswache I, Bochum West, gehört z.B. die Atemschutzwerkstatt, in der alle Atemschutzgeräte aller Feuer- und Rettungswachen gewartet und instandgehalten werden. Zudem werden hier die Einsatzkräfte im Rahmen des Atemschutzes aus- und fortgebildet. Auf der Feuer- und Rettungswache II, Bochum Mitte, werden alle Rettungssanitäter und Rettungsassistenten in der dort ansässigen Rettungsdienstschule ausgebildet. Ferner werden hier größere Mengen an Arzneien, Verbandsmaterial etc. bevorratet. Die jüngste Feuer- und Rettungswache befindet sich im Bochumer Nordosten und ist auf technische Hilfeleistungen spezialisiert. In ihr befinden sich zudem die Branddirektion, die allgemeine Verwaltung, die Feuerwehrschule, die Fahrzeugwerkstätten sowie ein Material- und Logistiklager. Die Rettungswachen, die übrigens nicht ausschließlich durch die Berufsfeuerwehr betrieben werden, halten Rettungswagen bzw. Notarzteinsatzfahrzeuge bereit und sind entweder im Stadtgebiet disloziert oder den verschiedenen Krankenhäusern unmittelbar zugeordnet.
4.2. Die Pflicht zur Fürsorge - Die personenzentrierte Qualifizierung für den Umgang mit Stress im Rahmen der Aus- und Fortbildung
4.2.1. Allgemeines
Die notwendig gewordene Interessenverlagerung von der opferzentrierten zur helferzentrierten psychosozialen Betreuung impliziert Forderungen an die Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, die unweigerlich mit der Prävention, der Intervention und der Nachsorge im Sinne einer aktiven Stressbewältigung verbunden sind. Diese Forderungen, die einerseits durch die Unfallkassen gestellt werden, finden andererseits eine Unterstützung durch Studien und durch die wissenschaftliche Diskussion in der stress- und traumabezogenen Fachliteratur. Sie richten sich in erster Linie an die Organisationen, die die Einsatzkräfte beschäftigen, aber auch an die Einsatzkräfte selbst.
Im Rahmen der Stressprophylaxe fordert z.B. die Unfallkasse Niedersachsen eine Ausbildung und Training in geistiger und körperlicher Hinsicht und richtet sich damit an die Träger des Brandschutzes und der Feuerwehr (Waterstraat, 2003). Von Seiten der wissenschaftlichen Diskussion ergeht die Aufforderung, dass im Zuge der primären Prävention, hiernach ist die psychologische Vorbereitung auf traumatische Ereignisse gemeint, bereits in der Ausbildung eine kognitive Vorbereitung auf bestimmte Einsätze und eine Vermittlung von Stressbewältigungsmaßnahmen erfolgen kann (Bengel, 2003). Mit der von Hermanutz et al. (1994) nach einem Busunfall in Donaueschingen mit insgesamt 71 Personen durchgeführten Untersuchung wurden 4 wesentliche Maßnahmen anhand der Ergebnisse formuliert: Einstellung auf die katastrophale Lage, Nachsorge, modellhafte Führung und Förderung der psychosozialen Kompetenzen.
Die Organisationen, wie z.B. die Bochumer Berufsfeuerwehr, sehen sich hierbei in der Verantwortung zwischen Fürsorge und initiativen Angeboten gebunden. So weist die Feuerwehrdienstvorschrift FwDv 2/2 bereits 1994 darauf hin, dass vom ausgebildeten Helfer erwartet werden kann, dass er auch in extremen Situationen geordnet denkt und die Nerven behält. Diese als Selbstbeherrschung bezeichnete Eigenschaft kann in einem gewissen Umfange durch ein Training erworben werden (Schott & Ritter, 1994). Die FwDv 2/2 lässt somit in Grundzügen erkennen, worauf es in der Ausbildung zum Brandmeister, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten neben den feuerwehrtechnischen Themenfeldern ankommt.
4.2.2. Prävention und Vorbereitung auf den Einsatzdienst - das Phänomen Stress als Baustein in der Ausbildung zum Brandmeister, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten
Nicht immer wurden bei der Bochumer Berufsfeuerwehr die Themen Stress, einsatzbedingte Stressoren und deren Auswirkungen als Teil der Aus- und Fortbildung betrachtet. Erste Anfänge lassen sich auf das Jahr 1993 zurückführen, wo der derzeit amtierende Notfallseelsorger/ Seelsorger in Feuerwehr und Rettungsdienst in Weiterbildungen im Zuge der Rettungsassistentenausbildung zusammen mit den Einsatzkräften die Frage erörterte, was prinzipiell im Rettungsdienst verändert werden müsste bzw. welche Unterstützung die Einsatzkräfte erfahren sollten. In einer Initiative aus Branddirektion und Kirchenkreis wurde der Berufsfeuerwehr das Angebot unterbreitet, den Einsatzkräften einen evangelischen Pfarrer im Rahmen der Notfallseelsorge/ Seelsorge in Feuerwehr und Rettungsdienst zur Seite zu stellen. Diese Initiative wurde 1994 in die Tat umgesetzt. Allerdings mussten die Einsatzkräfte zunächst über das Thema Stress und seine Auswirkungen ausgiebig informiert werden, ehe 1995 erste stressgebundene Ausbildungsabschnitte in die Ausbildung zum Rettungssanitäter und Rettungsassistenten übernommen wurden. Zu diesen Ausbildungsgängen gesellte sich später der Grundlehrgang Brandmeister.
Im Grundlehrgang Brandmeister stehen insgesamt 8 Ausbildungsstunden in den Themenfeldern Traumastress, Stressbewältigung und Einführung in das autogene Training zur Verfügung. In der Relation zur Ausbildungsdauer von 18 Monaten erscheint dieser Stundenansatz eher gering als ausreichend. Da aber die Rettungssanitäterausbildung ein integrativer Bestandteil der Ausbildung zum Brandmeister ist, kommen 3 weitere Ausbildungsstunden mit den Themen Umgang mit Patienten, Angehörigen und Dritten im Rettungsdienst hinzu. Mit diesen 11 Stunden wird das Thema Stress zunächst abgeschlossen.
Nicht jeder Feuerwehrmann wird allerdings zum Rettungsassistenten ausgebildet. Ist die Ausbildung zum Rettungsassistenten jedoch vorgesehen, dann beginnt diese u.U. erst einige Zeit später. Dieses hängt mit der zur Verfügung stehenden Ausbildungskapazität und den zu erwerbenden Erfahrungen im Rettungsdienst als Voraussetzung zur Teilnahme zusammen. Die im Curriculum der Rettungsassistentenausbildung vorgesehene Vermittlung der psychosozialen Grundlagen haben zum Ziel, dass der Lehrgangsteilnehmer im Anschluss an die Ausbildung über die hohen psychischen Belastungen in der rettungsdienstlichen Tätigkeit informiert ist und Verfahren zur Stressvermeidung/-bewältigung anwenden kann. Ferner kennt er die Möglichkeiten zur Behandlung traumatischer Belastungsstörungen. Um diesen Zielen zu genügen, werden jeweils 2 Unterrichtseinheiten à 3 Stunden durch den Seelsorger der Bochumer Feuerwehr durchgeführt. Die zu vermittelnden Themen umfassen Schwerpunkte wie z.B. Ethik im Rettungsdienst und die Betreuung Sterbender. Ein weiterer, flexibler Themenkomplex richtet sich nach dem Bedarf der Lernzielgruppe.
Ob dieser Stundenansatz mit den dabei vermittelten Inhalten allumfassend und ausreichend ist, vermag der Autor an dieser Stelle nicht zu kommentieren. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Auswertung der Mitarbeiterbefragung und die Interpretation der Ergebnisse, da sich ein wesentlicher Bestandteil derselben mit der Ausbildung zum Brandmeister, Rettungssanitäter und Rettungsassistenten befasst.
4.2.3. Fortbildungsmaßnahmen und weitere personenzentrierte Schlüsselqualifikationen als Hilfe für Kollegen
Im Rahmen der Fortbildung der Rettungsassistenten, auch Rettungsdienstfortbildung genannt, werden jährlich 7 Ausbildungsstunden für das Themenfeld Stress bereitgehalten. 4 Ausbildungsstunden beschäftigen sich dabei mit dem Thema Suizid und 3 Ausbildungsstunden werden mit dem Thema Traumastress belegt. Damit reihen sich diese 7 Ausbildungsstunden in das Gesamtkonzept der Rettungsdienstfortbildung ein, deren Dauer eine Woche beträgt und die weitere, den Rettungsdienst betreffende, aktuelle Themen vermittelt. Auch im Falle der 7 Ausbildungsstunden ist der Seelsorger in Feuerwehr und Rettungsdienst für deren Umsetzung zuständig.
Besonders interessierte Feuerwehrmänner, die, wie bereits erwähnt, in Nebenfunktion Rettungsassistent sind, nehmen an weiteren Fortbildungsveranstaltungen teil, welche auf Freiwilligkeit basieren. 6 Feuerwehrmänner ließen sich bereits bei der Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen e.V. in den Bausteinen I und II zum kollegialen Berater, auch Peer genannt, ausbilden. Dieses auch als deutsche Version des CISM-Konzeptes geltende Modell vermittelt mit seinen Bausteinen I und II folgende Themenschwerpunkte: Stress und Belastung, Grundlagen der Psychotraumatologie, Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung, Einzelgespräche nach belastenden Ereignissen und Nachbesprechungen (Müller-Lange, 2001).
Neben diesen Bausteinen I und II richteten sich 2 Kurse zum Thema Basiskrisenintervention im Rettungsdienst an die Notarztwagenfahrer, Notärzte und an die Lehrrettungsassistenten sowie an freiwillig interessierte Rettungsassistenten. Die Inhalte orientierten sich an den Themenfeldern Stressbewältigung, Gesprächsführung und Umgang mit ausländischen Mitbürgern.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783836630900
- DOI
- 10.3239/9783836630900
- Dateigröße
- 940 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- FernUniversität Hagen – Arbeits- und Organisationspychologie
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Juni)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- posttraumatische belastungsstörungen ptbs ptsd cism einsatzkraft
- Produktsicherheit
- Diplom.de