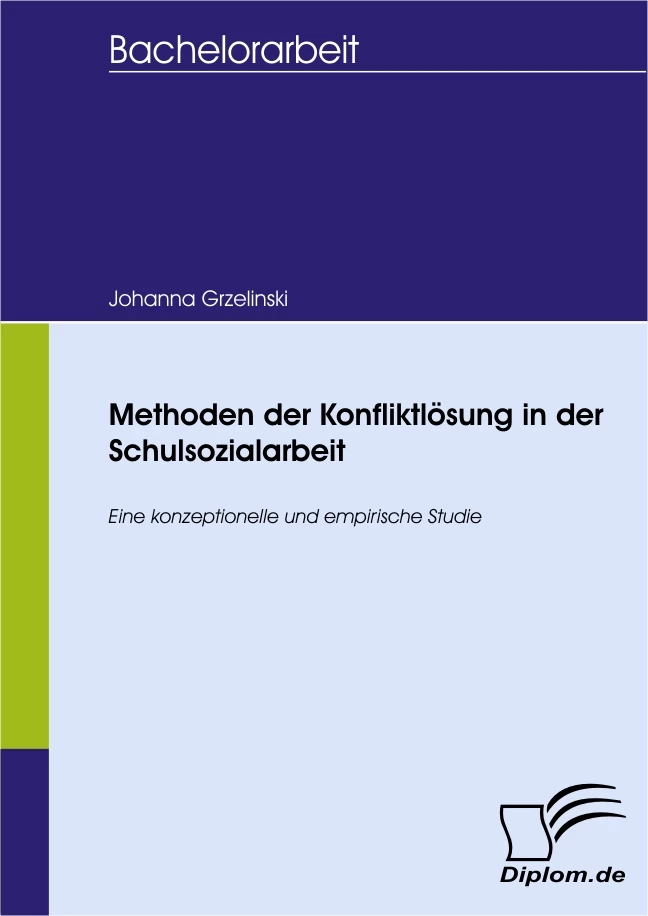Methoden der Konfliktlösung in der Schulsozialarbeit
Eine konzeptionelle und empirische Studie
Zusammenfassung
Schulsozialarbeit wird in unserer Gesellschaft zu einem immer wichtigeren Aufgabenbereich, da das Erwachsenwerden in der heutigen Zeit vielen Jugendlichen immer schwerer fällt. Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist von Brüchen und Konflikten gekennzeichnet. Da die Institution Schule neben der Gesellschaft, Familie, Freizeit und Berufswelt zur Sozialisation gehört und ein Kind einen großen Teil seines Lebens in der Schule verbringt, sollte sich mehr und vor allem intensiver mit den Schülern und deren Problemen und Konflikten in der Schule auseinandergesetzt werden.
Gang der Untersuchung:
Diese Ausarbeitung wird sich diesbezüglich mit dem Thema Methoden der Konfliktlösung in der Schulsozialarbeit beschäftigen. Ich werde die Aufgabenbereiche von Schulsozialarbeitern darstellen, um einen Einblick in die Soziale Arbeit an Schulen zu zeigen. Des Weiteren werde ich mich mit häufig auftretenden Konflikten an Schulen, zu denen vor allem Gewalt, Mobbing und Schulverweigerung gehören, auseinandersetzen.
Im Kernstück meiner Arbeit werde ich mich dann mit verschiedenen Anti-Gewalt-Methoden, der Mediation und den Problemen bei der Umsetzung an Schulen genauer befassen und die Vorgehensweise und Umsetzung meiner empirischen Arbeit schildern, sowie meine Ergebnisse anhand ausgewählter Diagramme auswerten.
Um meine Ergebnisse dann empirisch belegen zu können, werde ich an einer Gesamt- und Hauptschule in einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein- Westfalen eine Umfrage zum Thema Methoden der Konfliktlösung durchführen und diese dann qualitativ auswerten. Mein Anliegen in dieser konzeptionellen und empirischen Studie wird darin bestehen, anhand meiner qualitativen Ergebnisse die verschiedenen Konflikte und Methoden der Konfliktlösung an einer ausgewählten Gesamt- und Hauptschule in Nordrhein-Westfalen aufzeigen und zu vergleichen. Somit wird der letzte Teil meiner Arbeit eine kurze Zusammenfassung, meine eigene Meinung und eventuell offene Fragen beinhalten.
Ich habe mich für das Themenfeld Schulsozialarbeit entschieden, da ich im letzten Semester meines Studiums der Sozialen Arbeit die Vorlesung Schulsozialarbeit - Ein facettenreiches Arbeitsfeld stellt sich vor besucht habe, und sich dadurch Interesse entwickelt hat, mich mit dieser für mich neuen Art von Sozialarbeit genauer zu befassen und eventuell in dieser Richtung später auch beruflich tätig zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Aufgabenbereiche eines Schulsozialarbeiters
3. Konflikte an Schulen
3.1 Definition und Ursachen von Konflikten
3.2 Gewalt
3.3 Mobbing
3.4 Schulverweigerung
4. Methoden der Konfliktlösung
4.1 Methoden zur Gewaltprävention und Intervention
4.2 Schulmediation
5. Empirischer Teil/ Auswertung der Umfrageergebnisse an Gesamt und Hauptschulen
5.1 Gesamtschule X
5.2 Hauptschule XY
6. Zusammenfassung und eigene Meinung
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Schulsozialarbeit wird in unserer Gesellschaft zu einem immer wichtigeren Aufgabenbereich, da das Erwachsenwerden in der heutigen Zeit vielen Jugendlichen immer schwerer fällt. Der Übergang von der Schule in die Berufswelt ist von Brüchen und Konflikten gekennzeichnet. Da die Institution Schule neben der Gesellschaft, Familie, Freizeit und Berufswelt zur Sozialisation gehört und ein Kind einen großen Teil seines Lebens in der Schule verbringt, sollte sich mehr und vor allem intensiver mit den Schülern und deren Problemen und Konflikten in der Schule auseinandergesetzt werden. Diese Ausarbeitung wird sich diesbezüglich mit dem Thema „Methoden der Konfliktlösung in der Schulsozialarbeit“ beschäftigen. Ich werde die Aufgabenbereiche von Schulsozialarbeitern darstellen, um einen Einblick in die Soziale Arbeit an Schulen zu zeigen. Des Weiteren werde ich mich mit häufig auftretenden Konflikten an Schulen, zu denen vor allem Gewalt, Mobbing und Schulverweigerung gehören auseinandersetzen. Im Kernstück meiner Arbeit werde ich mich dann mit verschiedenen Anti-Gewalt-Methoden, der Mediation und den Problemen bei der Umsetzung an Schulen genauer befassen und die Vorgehensweise und Umsetzung meiner empirischen Arbeit schildern, sowie meine Ergebnisse anhand ausgewählter Diagramme auswerten. Um meine Ergebnisse dann empirisch belegen zu können, werde ich an einer Gesamt- und Hauptschule in einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein- Westfalen eine Umfrage zum Thema Methoden der Konfliktlösung durchführen und diese dann qualitativ auswerten. Mein Anliegen in dieser konzeptionellen und empirischen Studie wird darin bestehen, anhand meiner qualitativen Ergebnisse die verschiedenen Konflikte und Methoden der Konfliktlösung an einer ausgewählten Gesamt- und Hauptschule in Nordrhein-Westfalen aufzeigen und zu vergleichen. Somit wird der letzte Teil meiner Arbeit eine kurze Zusammenfassung, meine eigene Meinung und eventuell offene Fragen beinhalten. Ich habe mich für das Themenfeld Schulsozialarbeit entschieden, da ich im letzten Semester meines Studiums der Sozialen Arbeit die Vorlesung „Schulsozialarbeit - Ein facettenreiches Arbeitsfeld stellt sich vor“ besucht habe, und sich dadurch Interesse entwickelt hat, mich mit dieser für mich neuen Art von Sozialarbeit genauer zu befassen und eventuell in dieser Richtung später auch beruflich tätig zu sein.
2. Aufgabenbereiche eines Schulsozialarbeiters
Schulsozialarbeit etablierte sich seit Anfang 1970 in Deutschland. Beeinflusst wurde sie durch die amerikanische „School Social Work“.[1] Nicht in jedem Bundesland sind Schulsozialarbeiter an allen Schulen tätig. Vergleichsweise arbeiten in Berlin Schulsozialarbeiter nur an Haupt- und Sonderschulen. In Niedersachsen werden nur an berufsbildenden Schulen sozialpädagogische Fachkräfte angeboten. In Nordreinwestfalen hingegen sind Sozialarbeiter an Ganztags- Haupt, Grund, Real, Gesamt und Förderschulen beschäftigt. Da Schulsozialarbeit mit der Jugendhilfe am stärksten kooperiert, möchte ich im Folgenden genauer auf die Arbeit und somit die Aufgaben zwischen diesen beiden Institutionen eingehen. Zur Zielgruppe der Jugendhilfe gehören alle Kinder und Jugendlichen, Lehrer/innen und Eltern. Der folgende Paragraph aus dem SGB (Sozialgesetzbuch) VIII und dem KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 1. Abs. 3 beinhaltet folgende Funktionen der Jugendhilfe. „1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, 4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“. Schulsozialarbeiter geraten dadurch oft in einen Zwiespalt, da Hilfe und Kontrolle miteinander kollidieren. Diese Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung und Durchsetzung der Normen, kommt von der Gesellschaft.[2]
Die Arbeit eines Schulsozialarbeiters ist sehr komplex und variiert von Schule zu Schule. Die Aufgabenbereiche eines Schulsozialarbeiters lassen sich jedoch grob unterteilen in:
- Beratung und Einzelfallhilfe
- Sozialpädagogische Gruppenarbeit
- Offene Gesprächs-, Kontakt- und Freizeitangebote
- Teilnahme und Mitwirkung in Unterrichtsprojekten und schulischen Gremien
- Zusammenarbeit mit und Beratung der Lehrer/innen und Erziehungsberechtigten
- Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen[3]
Schulsozialarbeiter/innen sehen ihre Aufgabe darin, Kinder und Jugendliche in ihren Systemen anhand dieser sechs Arbeitsfelder zu unterstützen und während der Schulzeit zu begleiten. Gründe der Schüler/innen die Beratung aufzusuchen sind unterschiedlich. So können zum einen soziale und persönliche Probleme, zum anderen aber auch schulische und berufliche Probleme ausschlaggebend sein. Schulsozialarbeiter haben feste Sprechstunden zu denen sich Schüler beraten lassen können. Einige Schulsozialarbeiter benutzen während der Beratung Fallstrukturierungshilfen. Sie helfen dem Berater den Fall zu konkretisieren und für mehr Klarheit zu sorgen. Zunächst einmal wird die jeweilige Situation des betroffenen Schülers betrachtet. Danach wird hinterfragt, ob ein primär schulisches Problem vorliegt, oder es sich um ein familiäres Problem handelt. Und falls gegeben, inwieweit ein familiäres Problem die schulischen Aktivitäten beeinflusst. Im nächsten Schritt überlegt man sich gemeinsam geeignete Vorgehensweisen, um an das Problem heranzugehen. Hierbei kommt auf der einen Seite Einzelfallhilfe oder auf der anderen Seite spezielle Kompetenz- oder Lerntrainings zum Tragen. Handelt es sich jedoch um einen schwerwiegenderen Fall, wie z.B. die Kindeswohlgefährdung, muss der Berater eventuell das Jugendamt benachrichtigen.
Hierzu gehören u.a. körperliche Schädigungen, wie z.B. Blutergüsse, Knochenbrüche, sexueller Missbrauch oder psychische Probleme, wie z.B. depressives Verhalten oder Kontaktstörungen. Schüler/innen suchen oft den Rat einer/eines Schulsozialarbeiters/in, wenn es sich um Probleme mit den Eltern, Mitschülern oder sich selbst handelt. Zum Teil der sozialpädagogischen Arbeit gehören berufsorientierte Angebote wie z.B. das Bewerbungstraining aber auch die Elternarbeit oder soziale Trainings. Des Weiteren werden erlebnispädagogische Maßnahmen angeboten, wie das Klettern oder Theater spielen, soziale Kompetenztrainings, außerschulische Projekte und ein offenes Förderangebot. Soziale Kompetenztrainings sind z.B. ein Selbstsicherheits-, Coolness- oder Antiaggressionstraining. Sie sollen Schülern einerseits zu einem besseren und stärkeren Selbstbewusstsein verhelfen und andererseits helfen anderen gegenüber Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen.[4] Zusammengefasst sollen angemessene Kommunikationsformen und gemeinsame Ziele gefunden werden, die Schülern helfen: „Einsichten und Fähigkeiten zu vermitteln, die ihnen und anderen das gewaltfreie überleben und den friedlichen Umgang miteinander ermöglichen.“[5] Weiterhin sollen die an Schulen angebotenen Trainings den Schülern beibringen, sich Gruppendruck zu widersetzen und Konflikte gewaltfrei auszutragen.
An manchen Schulen werden auch sogenannte Lerntrainings angeboten, zu welchen das Kompetenztraining, die Hausaufgabenhilfe oder ein Training der Arbeitstechniken bzw. des Arbeitsverhaltens gehören. Hierbei können Schüler lernen, wie z.B. die Schultasche richtig gepackt wird, oder wie sie der Bearbeitung der Hausaufgaben richtig vorgehen können. Bei der nächsten Arbeitsleistung handelt es sich um die offenen Gesprächs-, Kontakt – und Freizeitangebote. Hierunter fallen offene Angebote, wie z.B. Schülerclubs, Schülertreffs oder allgemeine Freizeitangebote, aber auch die Gestaltung von Mittagspausen oder Arbeitsgemeinschaften. Die Arbeit des/der Schulsozialarbeiters/in setzt sich jedoch nicht nur aus Beratung, Angeboten und Trainings für die Schüler zusammen, sondern beinhaltet auch die Mitwirkung in Unterrichtsprojekten, schulischen Gremien, wie z.B. Gesamtkonferenzen, Klassenkonferenzen und Schulprogrammarbeit. Bei den Klassen- oder Gesamtkonferenzen werden auch oft bestimmte „Problemschüler“ oder besondere Vorfälle besprochen, an denen sich die/der Schulsozialarbeiter/in beteiligt, und oft mit ihrem/seinem Informationen und Wissen über die Schüler weiterhelfen kann. Der vorletzte Arbeitsbereich setzt sich aus der Zusammenarbeit mit und Beratung der Lehrer/innen sowie Erziehungsberechtigten zusammen. Dazu gehören die Teilnahme an Elternabenden, Elternbesuchen und Elterngesprächen. Im Rahmen seines Besuchs bei den Erziehungsberechtigten des jeweiligen Schülers macht sich der/die Schulsozialarbeiter/in ein Bild über die Situation. Die weitere Zusammenarbeit setzt sich zusammen aus Beratungsgesprächen und der Fortbildung für Lehrer/innen. Nun komme ich zum sechsten und somit letzten Arbeitsbereich, der Kooperation und Vernetzung mit dem Gemeinwesen. Die Hauptkooperation findet mit dem Jugendamt statt, wobei es sich hauptsächlich um Fälle, wie der Kindeswohlgefährdung handelt. Weitere Kooperationen finden zwischen Schule und der Arbeitsverwaltung, Ämtern, freien Trägern der Jugendhilfe, wie z.B. den Jugendhäusern der AWO, und anderen Unternehmen wie Institutionen aus dem Gemeinwesen statt. Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass sich die Schulsozialarbeit mit der Förderung der schulischen und außerschulischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beschäftigt, und dadurch versucht Benachteiligungen zu verringern, das Wohl der Kinder und Jugendlichen zu schützen und zu einer angenehmen Umwelt in der Schule beizutragen, in der sich Schüler wohlfühlen können.
3.1 Definition und Ursachen von Konflikten
Konflikte entstehen zwischen zwei oder mehreren Individuen, wenn sich deren Handlungstendenzen nicht vereinbaren können, oder gegensätzlich zu einander stehen. Konflikte können aber auch „das Gegeneinaderstehen oder Gegeneinanderwirken von mehreren Trieben, Strebungen, Wünschen, Willensregungen usw.“ sein.[6] Neben den verschiedenen Konfliktarten, wie z.B. Arbeitskonflikte, Normenkonflikte, Interessenkonflikte oder Zielkonflikte, begegnet man oft der Einteilung der intra- und interpersonellen Konflikte. Bei den intrapersonellen Konflikten handelt es sich um seelische Probleme, die in der eigenen Person stattfinden. Interpersonelle Konflikte hingegen, basieren auf der zwischenmenschlichen Ebene, d.h. zwischen zwei oder mehreren Personen.[7] Der folgende Teil wird sich jedoch hauptsächlich mit interpersonellen Konflikten, wie Mobbing, Streit und anderen Formen von Gewalt auseinandersetzen. Warum und wodurch Konflikte entstehen, werde ich im Folgenden klären. Konflikte können aus den unterschiedlichsten Gründen entstehen. Der Grund, der unvereinbaren Handlungstendenzen muss jedoch nicht immer der Auslöser für Konflikte sein. Bei Konflikten zwischen Schülern ist eine fehlende positive Einstellung zum anderen Schüler oder eine Abweichung vom Ideal eines allgemein beliebten Schülers oft ausreichend. Dieses Verhalten der unterschiedlichen Wahrnehmung, zeigt eine mögliche Ursache für die Entstehung von Konflikten. Becker und Becker listen einige Konfliktursachen, welche vielfältig untersucht worden sind, in folgender Reihenfolge auf:
- „unzureichende Kommunikation
- gegenseitige Abhängigkeit
- das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden
- Verantwortungsüberschneidung
- Wenig Gebrauch von Kritik
- Misstrauen
- unvereinbare Persönlichkeiten und deren Einstellungen
- Kämpfe um Macht und Einfluss
- Groll, Ärger, Empfindlichkeit
- Gruppenmitgliedschaft (Cliquen)
- Auseinandersetzung über die Zuständigkeiten
- Belohnungssysteme
- Gesichtsverlust
- Wettbewerb bei knappen Ressourcen[8]
Abschließend möchte ich hinzufügen, dass Konflikte, auf die im nächsten Kapitel genauer eingehen wird, nicht naturgegeben sind und vor allem an Schulen unvermeidbar. Hunderte von Schülen, mit verschiedenen Interessen, Normen, Werten und Meinungen, treffen jeden Tag aufeinander. Das Problem liegt hier nicht bei den Konflikten selbst, sondern beim Umgang mit ihnen.
3.2 Gewalt
Gewalt gehört neben dem Problem der Sucht zu den größten Problemen an Schulen und sorgt immer wieder für neue Schlagzeilen. Tag für Tag, sei es in den Nachrichten, in der Musik oder im Fernsehen, werden wir mit Gewalt konfrontiert. Auch die Vorfälle an Schulen, wie z.B. die Amokläufe von Schülern, zeigen wie aktuell das Problem Gewalt vor allem an Schulen ist. Deutlich wird auch, dass nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer betroffen sind.
Vielen ist nicht bewusst, dass ihre Verhaltensweisen schon Ansätze von Gewalt beinhalten. Im Rahmen der Vorlesung von Frau Laupichler[9] wurde erläutert, dass schon allein die Bezeichnung „Rollmops“, als Gewaltanwendung angesehen werden kann, da man unter dem Begriff Gewalt alle gerichteten oder intentionalen Verhaltensweisen zusammenfasst, die andere körperlich oder psychisch schädigen. Somit kann das Zeigen des Mittelfingers zu einem anderen Schüler, aber auch das gesagte Wort „Rollmops“ schädigen. Natürlich kommt er darauf an, wie der Empfänger (eventuell das Opfer) diese Verhaltensweise aufnimmt, oder versteht. Rollmops ist vielleicht für einige keine beleidigende oder verletzende Bezeichnung, kann jedoch in einem durch sein äußeres geprägtes Kind, Trauer oder Wut auslösen, und ist somit eine psychische Schädigung verursachen. Ein anderes Beispiel zum Thema Gewalt, was an allen Schulen zu finden ist, sind Prügeleien zwischen Schülern. Die einen bewerten sie beispielsweise als normal und gerechtfertigt, da Jungen lernen müssen sich durchzusetzen und Probleme untereinander zu klären. Die meisten Eltern hingegen werde aufgebracht reagieren und diese Verhaltensweisen mit Sanktionen bestrafen wollen. Somit wird deutlich das Verhaltensweisen unterschiedlich bewertet und eingestuft werden. Es stellt sich die Frage, ob Gewalt und Aggression vergleichbar sind und sich vor Allem in der Anwendung ähneln. In der Gewaltdiskussion ist die Trennung von den beiden Begriffen noch nicht geklärt. Man kann Gewalt als eine Teilmenge von Aggression sehen. Bei gerichtetem Austeilen schädigender Reize spricht man von Aggression.[10] Friedrich Lösel beschreibt Gewalt mit folgenden Worten: „Gewalt wird auf ausgeübte oder glaubwürdig angedrohte psychische Aggression eingeschränkt, mit denen einem angezielten Objekt etwas gegen dessen Bedürfnisse, gegen dessen Willen geschieht, und nur jene Aggression, die mit relativem Machteinhergehen, sollen als Gewalt gelten“.[11] Weißmann erweitert den Begriff Gewalt mit folgender Einteilung:
- „psychische Gewalt“, z.B. durch abwerten, auslachen oder demütigen.
- „verbale Gewalt“, wie verletzende, beleidigende oder schädigende Worte
- „sexuelle Gewalt“, wie intime, erzwungene Handlungen, mit dem Ziel der Befriedigung des Täters
- „frauenfeindliche, fremdenfeindliche bzw. rassistische Gewalt“, durch physische, psychische, verbale oder sexuelle Übergriffe
- „Bullying bzw. mobben“[12]
Der Begriff Gewalt kann jedoch auch positiv besetzt sein, wenn die Person, die Gewalt anwendet, das Gewaltmonopol zusteht. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn man sich wehren oder andere verteidigen muss. Der Polizei und dem Staat steht dieses Monopol zu, da es auf den Schutz von Bürgerinnen und Bürgern zielt und somit legitim ist.[13]
Auslöser von Gewalt können sich aus vielen Faktoren zusammensetzen. Schüler können gewalttätig werden, wenn sie Angst haben, Wut spüren, oder sich einfach nur langweilen und jemanden schädigen wollen. Die meisten Gewalttäter haben jedoch ein mangelndes Selbstwertgefühl und ein negatives Selbstbild. Durch Gewalt versuchen sie anderen oder sich selbst etwas zu beweisen, und ihr Selbstwertgefühl durch die körperliche oder psychische Schädigung des Gegenübers zu stärken. An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig Aufklärung zum Thema Gewalt, Beratung und soziale Gruppenarbeiten sind. Das Ziel sollte sein, Schülern zu helfen ihre Haltung zu überdenken und im besten Falle zu ändern. Mit den folgenden Zahlen möchte ich darstellen, wie stark Gewalt in der heutigen Zeit an Schulen verbreitet ist:
- Jeder dritte Schüler hat Angst vor Gewalt an der Schule
- Jeder fünfte wurde dort schon einmal angegriffen
- Circa 13 Prozent der Opfer beklagten sich, dass die Lehrer bei gewalttätigen Auseinandersetzungen einfach wegschauen würden
- 500.000 Kinder und Jugendliche erleiden pro Woche einen Angriff oder eine Demütigung- neueste Schätzungen[14]
Es ist vor allem erschreckend zu sehen, dass Gewalt und Brutalität an Schulen stetig wächst. Sei es wegen unterschiedlichen Lebenseinstellungen, dem Gegensatz von Arm und Reich, oder den Medien, die unsere Jugend in eine unrealistische und gewalttätige Welt eintauchen lässt.[15]
3.3 Mobbing
Im vorherigen Abschnitt wurden die Begriffe der verschiedenen Formen und Ursachen von Gewalt erläutert. An dieser Stelle wird etwas genauer auf das Problem Mobbing, der häufigsten Gewaltform an Schulen eingegangen. Mobbing repräsentiert ein sehr aktuelles und brisantes gesellschaftliches Thema, das an vielen Schulen leider oft verbreitet ist. Wie schon erwähnt handelt es sich um eine Form von Gewalt. Schüler, die andere Schüler ``mobben``, d.h. durch negative, kommunikative Handlungen, oft über einen längeren Zeitraum hinaus schädigen, üben somit Gewalt aus.[16] Mobbing richtet sich nicht gegen den Körper, sondern gegen die Seele. Andere Personen werden niedergemacht durch Sticheleien, Vorurteile oder Intrigen, um Ansehen der Gleichaltrigen zu erlangen. Über den allgemeinen Begriff Mobbing schreibt Gollni name="_ftnref17" title="">[17] Zu den häufigsten Erscheinungsformen von Mobbing gehören:
- Erpressen und Abziehen
- Verbreiten von Gerüchten
- Sexuelle Anmache
- Telefonterror
- Direktes Verächtlichmachen mit Worten, Hohn und Spott
- Ausgrenzen von skurrilen Persönlichkeiten
- Demütigendes Kommentieren äußerlicher Besonderheiten (z.B. rote Haare, Sommersprossen, Übergröße usw.)
- Diskriminierung von Minderheiten (z.B. andere Religion oder Hautfarbe)[18]
Interessant sind auch die weiteren Begriffe für Mobbing. Bullying, bossing, oder der eher unbekannte Begriff staffing gehören auch zum Phänomen des Mobbings. Unter Bullying versteht man meist die Gewalt unter Schülern, womit der bully ein brutaler Mensch oder Tyrann ist. Am Arbeitsplatz, an dem Mobbing neben dem System Schule auch stark verbreitet ist, wird im Zusammenhang mit Mobbing oft der Begriff Bossing in Verbindung gebracht. Hierunter versteht man Attacken, welche vom Chef ausgehend sin. Des Weiteren findet man z.B. in Betrieben den „Staffer“. Ein „Staffer“ ist ein Mitglied einer Betriebsmannschaft, der Untergebene angreift.[19] Der Prozess einer typischen Mobbingsituation kann in vier Gruppierungen aufgeteilt werden. Es gibt das Opfer, welches immer eine einzelne Person ist, den Täter bzw. Mobber, der Gewalt ausübt und andere attackiert, die Mitläufer und die restliche Gruppe. Die Mitläufer, welche früher eventuell selbst Mobbingopfer waren, beteiligen sich auch am Prozess. Die restliche Lerngruppe versucht entweder einzugreifen, was jedoch meistens nichts bewirkt, oder hält sich aus der Situation raus, aus Angst selbst Opfer zu werden.[20] Mögliche Gründe für das Verhalten der Mobbingtäter, können aggressive Vorbilder, z.B. aus den Medien, oder eine Weitergabe machtbetonter Erziehungsmethoden der Eltern, sowie Gewalt zwischen den Eltern sein. Die Persönlichkeitsmerkmale sind gekennzeichnet durch Überlegenheit dem Opfer gegenüber. Diese Überlegenheit setzt sich u.a. zusammen aus körperlicher Stärke, geringer Selbstkontrolle und der Machtausübung. Des Weiteren haben Mobbing- Täter ein Problem Menschen, die anders sind, zu akzeptieren oder zu verstehen. Dieses „Anders“ sein kann sich als andere Meinung, anderes Hobby, andere Kleidung (z.B. Grufti-Kleidung), oder eine andere Hautfarbe äußern. Dieses „Anders- sein“ empfinden „Mobber“ als fremd, ungewohnt und „uncool“, weshalb sie diese bestimmten Personen als Zielscheibe zur Diskriminierung suchen. Leider nimmt die seelische Gewalt im Vergleich zur „zuschlagenden Gewalt“ zu.[21] Eine interessante Erkenntnis ist, dass Mädchen und Gymnasiasten mehr zu Mobbing neigen als Jungen und Hauptschüler, da Mobbing ihrer Meinung nach kultivierter und intelligenter ist, als das Zuschlagen oder Waffen benutzen.[22] Den meisten Schülern ist nicht bewusst, dass Mobbing Traumata auslöst und Menschen sogar bis zum Selbstmord treiben kann. Um Täter gewaltfreies Handeln beizubringen und Alternativen zur Konfliktlösung zu finden, sollte darauf geachtet werden, das Selbstwertgefühl zu stärken und die Selbstkontrolle der Täter zu verbessern. In der Schulsozialarbeit wird versucht mit Hilfe von sozialen Kompetenztrainings und präventiven Maßnahmen, Mobbing an Schulen zu mindern, und den Tätern bewusst zu machen, was sie mit ihrem Verhalten anderen antun. Diese Fragestellung wird im Rahmen der Besprechung der Methoden einer Konfliktlösung genauer erläutert.
3.4 Schulverweigerung
Das System Schule dient nicht nur dem Zweck in Zukunft einen Beruf zu finden, sondern auch um an der Gesellschaft teilzunehmen. Wenn Schüler/innen schon auf dem Schulweg scheitern, wird es für die Zukunft oft nicht einfach. Gesellschaftliche Ausgrenzung wird vor allem sichtbar bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Aufgrund der während meiner zweijährigen Tätigkeit in einem Jugendzentrum in Essen gesammelten Erfahrungen bin ich der Meinung, dass es äußerst schwer ist, mit einem schlechten Abschluss, aber vor allem ohne jeglichen Abschluss, sich an der Gesellschaft zu etablieren und einen Ausbildungsplatz zu finden. Somit möchte ich im folgenden Kapitel herausstellen, was gegen Schulverweigerung getan werden kann und vor allem Möglichkeiten aufzeigen um das Problem mit Hilfe von Schulsozialarbeit, aber auch anderen Möglichkeiten zu mindern und präventiv vorzugehen.
Bei dem Problem der Schulverweigerung handelt es sich um eine „prozesshafte Entwicklung“.[23] Jeder Mensch hat in der Schulzeit schon mal einen Tag ``blau`` gemacht, sei es um mal auszuschlafen, Freunde zu treffen, oder einfach mal um am PC zu sitzen. Gehört man mit solch einem Verhalten zu einem ``Schulschwänzer``? Theoretisch ja, jedoch meint der Begriff der Schulverweigerung etwas anderes. Es kommt auf die Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit des Fehlens an. Außerdem liegen die Gründe bei dauerhaften Schulverweigerern oft bei familiären, oder sozialen Problemen.
[...]
[1] Vgl. Speck, S.7
[2] Speck, S. 31
[3] Speck, S. 62 ff.
[4] Vgl. Benner, S. 7ff.
[5] Hurrelmann, Rixius, Schirp, S. 231
[6] Crisand E., S. 13
[7] Vgl. Crisand E, S. 14ff.
[8] Becker und Becker, S. 112
[9] Schulsozialarbeit: ein facettenreiches Arbeitsfeld stellt sich vor (BA: Modul 15)
[10] Vgl. Drilling, S. 123
[11] Drilling, S. 123
[12] Weißmann, S. 8,9
[13] Vgl. Weißmann, S. 9ff
[14] Erb S. 16 ff.
[15] Vgl. Erb, S. 16,17
[16] Vgl. Becker und Becker, S. 139
[17] Gollnick, S. 35, 36
[18] Struck, S. 74
[19] Vgl. Gollnick, S. 37
[20] Vgl. Jannan, S. 31 ff.
[21] Vgl. Struck, S. 74
[22] Vgl. Struck, S. 73ff.
[23] Vgl. Engel, S. 71 ff.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836630658
- DOI
- 10.3239/9783836630658
- Dateigröße
- 453 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Mai)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- schulsozialarbeit mediation streitschlichter konfliktlösung sozialarbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de