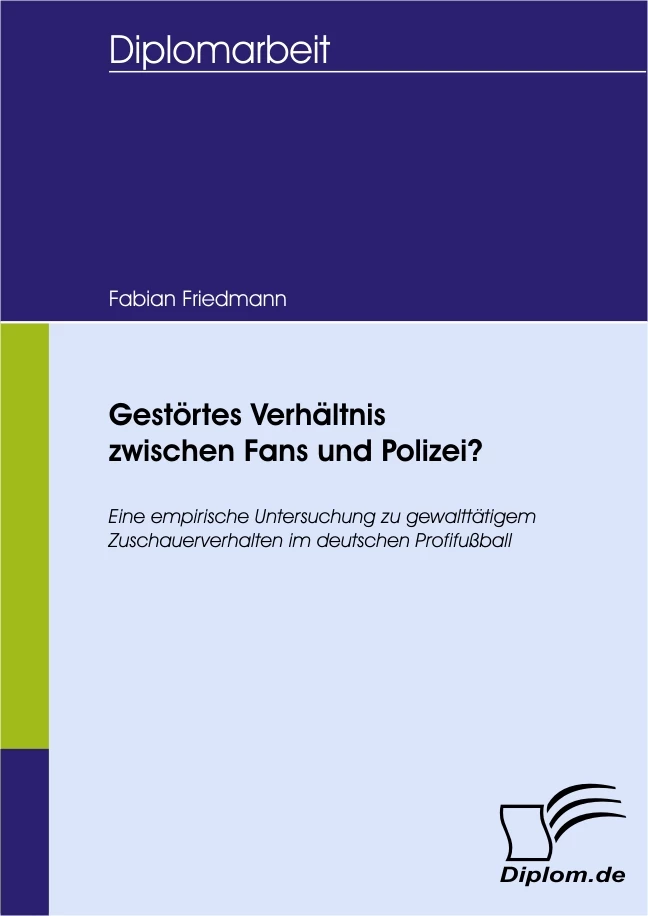Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
Eine empirische Untersuchung zu gewalttätigem Zuschauerverhalten im deutschen Profifußball
©2009
Diplomarbeit
150 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zuschauergewalt gilt seit den 70er und 80er Jahren als großes Problem im deutschen Profifußball. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien wurden in den letzten Jahrzehnten drastisch verstärkt und weiterentwickelt: Große Polizeipräsenz, Kameraüberwachung in den Stadien, szenekundige Beamte, Polizisten in Zivil, Blocktrennung zwischen den Fanlagern, Fanprojekte und Sicherheitsbeauftragte der Vereine sollen dafür sorgen, dass der mittlerweile zum gesellschaftlichen Event stilisierte Profifußball nicht durch gewalttätige Exzesse einzelner instrumentalisiert wird.
Doch gerade aktive Fußballfans in der Kurve, die ihre Mannschaft bedingungslos anfeuern und fast zu jedem Spiel ins Stadion gehen, kritisieren den enormen Sicherheitsapparat und hinterfragen Verhältnis- und Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen. Zusehends häufen sich Berichte von Fanvereinigungen und Faninitiativen über ungerechtfertigte Stadionverbote, repressive Kontrollen, Speicherung von persönlichen Daten und mitunter über die Kriminalisierung von friedlichen Fans. Offenbar fühlen sich viele Fußballzuschauer in der Freiheit ihre Fankultur auszuleben gestört.
Die vorliegende Diplomarbeit soll das Verhältnis zwischen Fans und Polizei eingehender beleuchten. Sie will hinterfragen, ob die massive Präsenz und das Vorgehen der Polizei im Rahmen von Profifußballspielen teilweise für Aggressionen und Fangewalt in und um die deutschen Stadien mitverantwortlich sind. Sie will verstehen, wie es zu einer Eskalation zwischen Fans und Ordnungskräften kommen kann.
Dabei wird zunächst eine Definition der verschiedenen Zuschauergruppen im Fußballstadion gegeben. Es soll aufgezeigt werden, welche Arten von Fans mittlerweile Gewalt verüben. Da in den letzten Jahren eine Änderung in der Fankultur zu beobachten ist, soll besonders auf die neue Fansubkultur der Ultras eingegangen werden. Im Anschluss werden einzelne traditionelle Theorien zur Zuschauergewalt behandelt und mit ihnen die Einflussfaktoren und Ursachen aufgezeigt, die aggressive Handlungen bei Fußballspielen bedingen können.
Schlussendlich soll eine Analyse von qualitativer Feldforschung und Interviews Aufschluss geben, inwieweit das Verhältnis zwischen Fans und Polizei als gestört bezeichnet werden kann oder ob die Kritik am polizeilichen Vorgehen als unberechtigt anzusehen ist und die Maßnahmen angebracht sind, um Gewalttäter im Stadion abzuschrecken und einen friedlichen Verlauf von […]
Zuschauergewalt gilt seit den 70er und 80er Jahren als großes Problem im deutschen Profifußball. Die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien wurden in den letzten Jahrzehnten drastisch verstärkt und weiterentwickelt: Große Polizeipräsenz, Kameraüberwachung in den Stadien, szenekundige Beamte, Polizisten in Zivil, Blocktrennung zwischen den Fanlagern, Fanprojekte und Sicherheitsbeauftragte der Vereine sollen dafür sorgen, dass der mittlerweile zum gesellschaftlichen Event stilisierte Profifußball nicht durch gewalttätige Exzesse einzelner instrumentalisiert wird.
Doch gerade aktive Fußballfans in der Kurve, die ihre Mannschaft bedingungslos anfeuern und fast zu jedem Spiel ins Stadion gehen, kritisieren den enormen Sicherheitsapparat und hinterfragen Verhältnis- und Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen. Zusehends häufen sich Berichte von Fanvereinigungen und Faninitiativen über ungerechtfertigte Stadionverbote, repressive Kontrollen, Speicherung von persönlichen Daten und mitunter über die Kriminalisierung von friedlichen Fans. Offenbar fühlen sich viele Fußballzuschauer in der Freiheit ihre Fankultur auszuleben gestört.
Die vorliegende Diplomarbeit soll das Verhältnis zwischen Fans und Polizei eingehender beleuchten. Sie will hinterfragen, ob die massive Präsenz und das Vorgehen der Polizei im Rahmen von Profifußballspielen teilweise für Aggressionen und Fangewalt in und um die deutschen Stadien mitverantwortlich sind. Sie will verstehen, wie es zu einer Eskalation zwischen Fans und Ordnungskräften kommen kann.
Dabei wird zunächst eine Definition der verschiedenen Zuschauergruppen im Fußballstadion gegeben. Es soll aufgezeigt werden, welche Arten von Fans mittlerweile Gewalt verüben. Da in den letzten Jahren eine Änderung in der Fankultur zu beobachten ist, soll besonders auf die neue Fansubkultur der Ultras eingegangen werden. Im Anschluss werden einzelne traditionelle Theorien zur Zuschauergewalt behandelt und mit ihnen die Einflussfaktoren und Ursachen aufgezeigt, die aggressive Handlungen bei Fußballspielen bedingen können.
Schlussendlich soll eine Analyse von qualitativer Feldforschung und Interviews Aufschluss geben, inwieweit das Verhältnis zwischen Fans und Polizei als gestört bezeichnet werden kann oder ob die Kritik am polizeilichen Vorgehen als unberechtigt anzusehen ist und die Maßnahmen angebracht sind, um Gewalttäter im Stadion abzuschrecken und einen friedlichen Verlauf von […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Fabian Friedmann
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
Eine empirische Untersuchung zu gewalttätigem Zuschauerverhalten im deutschen
Profifußball
ISBN: 978-3-8366-3007-8
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland,
Diplomarbeit, 2009
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
2
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung ... 5
2. Theoretischer Hintergrund ... 6
2.1 Fußball: Von den Wurzeln zum Zuschauersport... 6
2.2 Zuschauer: Individuen und dynamische Kollektive ... 8
2.3 Gewalttätiges Zuschauerverhalten: Kampf- und Konflikterfahrungen ... 10
3. Die verschiedenen Zuschauergruppen im Fußballstadion ... 12
3.1 Der Zuschauer als Kunde und Konsument... 12
3.2 Der Fan innerhalb einer jugendlichen Subkultur ... 14
3.3 Die Ultras ... 15
3.3.1 Motivation, Organisation und Gewaltbereitschaft ... 16
3.4 Die Hooligans... 19
3.4.1 Tradition, Motivation und Veränderungen... 20
3.4.2 Ost-West-Vergleich und neuere Entwicklungen... 24
4. Zuschauergewalt im sozialen System Fußball ... 28
4.1 Das Interesse der Medien ... 29
4.1.1 Die Rolle der Berichterstattung... 29
4.2 Die Maßnahmen der Vereine und Verbände... 32
4.2.1 Aufgaben von Ordnungs- und Sicherheitsdiensten ... 33
4.2.2 Stadionordnung und Stadionarchitektur... 37
4.2.3 Stadionverbote: Entstehung und Umsetzung ... 37
4.3 Die Organisation und Vorgehensweise der Polizei ... 40
4.3.1 Polizeiliche Gewaltprävention und Intervention... 41
4.3.2 Analyse von Verhältnis- und Rechtmäßigkeit ... 45
4.3.3 Zusammenfassung unter Berücksichtigung der ZIS Datei ,,Gewalttäter Sport"... 49
4.4 Zusätzliche Präventivmaßnahmen und Publikumszusammenschlüsse ... 52
4.4.1 Sozialarbeit und Fanprojekte... 53
4.4.2 Faninitiativen und Fanrechtefonds ... 54
5. Forschungsstand zu den Ursachen von Zuschauergewalt ... 55
5.1 Grundlagen, Theorien, phänomenologische Erklärungsansätze ... 55
5.1.1 Aggressionstheorien ... 58
5.1.2 Massenpsychologische Ansätze ... 59
5.1.3 Schichtbezogene Ansätze und Subkultur-Theorien ... 60
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
3
5.1.4 Entwertungsthese ... 61
5.1.5 Zivilisationstheoretischer Ansatz ... 62
5.1.6 Theorie zum polizeilichen Aggressor ... 63
5.2 Empirische Untersuchungen ... 66
5.3 Kritik und Stellungnahme ... 70
6. Grundlagen und Methodologie der Datenerhebung ... 72
6.1 Ansatz des methodologischen Individualismus ... 73
6.2 Strukturell-individualistischer Ansatz... 74
6.3 Makro-, Meso-, Mikroebene ... 77
7. Methodisches Vorgehen ... 77
7.1 Untersuchungsraum und Auswahl der Untersuchungseinheit ... 79
7.2 Teilnehmende Beobachtungen im Feld... 80
7.3 Leitfadengestützte Experteninterviews ... 82
7.4 Narrative Interviews ... 83
8. Auswertung und Theoriebildung... 84
8.1 Teilnehmende Zuschauer- und Polizeibeobachtungen... 85
8.1.1 Deskriptive Beobachtung Zuschauer (Frankfurt)... 86
8.1.2 Fokussierte Beobachtung Zuschauer (Kaiserslautern) ... 87
8.1.3 Selektive Beobachtung Polizei (Nürnberg)... 89
8.1.4 Interpretation und Fazit ... 94
8.2 Qualitative Inhaltsanalyse zur Zuschauergewalt... 96
8.2.1 Aufgaben der Polizei und umgesetzte taktische Maßnahmen... 98
8.2.2 Zuschauer als vorsätzliche, situative und medial inszenierte Gewalttäter ... 102
8.2.3 Formen der Zuschauergewalt und ihre situationsbedingten Ursachen... 107
8.2.4 Trends: Gesteigertes Gewaltpotential bei Ostvereinen und in Amateurklassen ... 112
8.2.5 Einzelfallanalyse zu den Ausschreitungen in Regensburg im Jahr 2004... 115
8.2.6 Verhältnis zwischen einzelnen Zuschauergruppen und der Polizei ... 120
8.2.7 Präventions- und Lösungsansätze zur Zuschauergewalt ... 125
9. Diskussion ... 134
10. Zusammenfassung ... 138
Literaturverzeichnis... 140
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
4
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis:
Tabelle 1: Die verschiedenen Zuschauergruppen im Stadion ... 20
Tabelle 2: Überblick der polizeilichen Maßnahmen zur Eindämmung von Zuschauergewalt 44
Tabelle 3: 12-Jahres Bericht der ZIS Datei ,,Gewalttäter Sport" zur 1. und 2. Bundesliga ... 50
Tabelle 4: 7-Jahres Bericht der ZIS Datei ,,Gewalttäter Sport" zu den Regionalligen ... 51
Grafik 1: Das Modell der Wechselbeziehungen im sozialen System Fußball ... 28
Grafik 2: Entwicklung der bundesweiten Stadionverbote... 38
Grafik 3: Entwicklung der von Polizei geschätzten Anzahl gewaltbereiter Fans ... 39
Grafik 4: Bedingungsgefüge für Zuschaueraggressionen ... 56
Grafik 5: Zirkuläres Modell des Forschungsprozesses ... 78
Grafik 6: Untersuchungsgegenstand und angewandte qualitative Forschungsmethoden ... 80
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
5
1. Einleitung
Zuschauergewalt wurde seit den 70er und 80er Jahren vermehrt im deutschen Profifußball
beobachtet. Seitdem haben sich die Sicherheitsvorkehrungen in den Stadien drastisch
verstärkt und weiterentwickelt: Große Polizeipräsenz, Kameraüberwachung in den Stadien,
szenekundige Beamte, Polizisten in Zivil, Blocktrennung zwischen den Fanlagern,
Fanprojekte und Sicherheitsbeauftragte der Vereine sollen dafür sorgen, dass der mittlerweile
zum gesellschaftlichen Event stilisierte Profifußball nicht durch gewalttätige Exzesse
einzelner instrumentalisiert wird.
Doch gerade aktive Fußballfans in der Kurve, die ihre Mannschaft bedingungslos anfeuern
und fast zu jedem Spiel ins Stadion gehen, kritisieren den enormen Sicherheitsapparat und
hinterfragen Verhältnis- und Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen. Zusehends
häufen sich Berichte von Fanvereinigungen und Faninitiativen über ungerechtfertigte
Stadionverbote, repressive Kontrollen, Speicherung von persönlichen Daten und zum Teil
über die Kriminalisierung von friedlichen Fans. Offenbar fühlen sich einige Fußballzuschauer
gestört ihre Fankultur frei auszuleben.
Die vorliegende Diplomarbeit soll das Verhältnis zwischen Fans und Polizei eingehender
beleuchten. Sie will hinterfragen, ob die massive Präsenz und das Vorgehen der Polizei im
Rahmen von Profifußballspielen teilweise für Aggressionen und Fangewalt in und um die
deutschen Stadien mitverantwortlich sind. Sie will verstehen, wie es zu einer Eskalation
zwischen Fans und Ordnungskräften kommen kann.
Dabei wird zunächst eine Definition der verschiedenen Zuschauergruppen im Fußballstadion
gegeben. Es soll aufgezeigt werden, welche Arten von Fans mittlerweile Gewalt verüben. Da
in den letzten Jahren eine Änderung in der Fankultur zu beobachten ist, soll besonders auf die
neue Fansubkultur der ,,Ultras" eingegangen werden. Im Anschluss werden Theorien und
phänomenologische Erklärungsansätze zur Zuschauergewalt behandelt und mit ihnen die
Einflussfaktoren und Ursachen aufgezeigt, die aggressive Handlungen bei Fußballspielen
bedingen können. Daneben werden einige empirische Untersuchungen zur Thematik
vorgestellt und analysiert, um den Stand der Forschung deutlich zu machen.
Eine Analyse von Feldforschung und qualitativer Experteninterviews soll letztlich Aufschluss
geben, inwieweit das Verhältnis zwischen Fans und Polizei als ,,gestört" bezeichnet werden
kann, oder ob die Kritik am Vorgehen der Beamten als unberechtigt gilt und deren
Maßnahmen angebracht sind, um Gewalttäter im Stadion abzuschrecken und damit einen
friedlichen Verlauf von Fußballgroßveranstaltungen zu gewährleisten.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
6
2. Theoretischer Hintergrund
Fußball ist die meist gespielte Sportart der Welt. Um überhaupt einen Zugang zu
Gewalttätigkeit beim Fußball zu bekommen und nachvollziehen zu können, muss zuerst das
Spiel selbst in seiner Entwicklung vorgestellt werden. Im Anschluss daran soll beleuchtet
werden, wie Fußball zum Zuschauersport wurde und dass das Publikumsspiel in seiner
Geschichte schon fast traditionell von gewalttätigen Auseinandersetzungen betroffen war und
ist, aber auch wie sich im Laufe der Zeit eine Fankultur entwickeln konnte. Dabei wird die
Zusammensetzung des Publikums aus Individuen zu dynamischen Kollektiven verdeutlichen,
wie es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen im Stadion kommen kann.
2.1 Fußball: Von den Wurzeln zum Zuschauersport
Grundformen des heutigen Fußballs existieren seit Jahrtausenden. Bereits im Jahre 2967 vor
Christus soll es in China ein verbreitetes Spiel mit Namen ,,Ts'u-Küh" (übersetzt: ,,mit dem
Fuß Stoßen") gegeben haben, welches sich bis zum 8. Jahrhundert als Kreisfußball (das sog.
,,Kemari") in ganz Asien verbreitete. In Südamerika spielten vor mehr als Tausend Jahren die
Mayas ein ähnliches Spiel, um ihren Göttern zu huldigen. In Europa liegt die Wiege des
Fußballs bekanntlich in England. Bis zurück ins 10. Jahrhundert finden sich dort Hinweise auf
diese Sportart (König, 2002: 8).
Aus dem Jahr 1314 ist in London ein Spiel belegt, bei dem das ,,niedere" Volk zu Fuß um
einen großen unelastischen mit Stroh und Kork gefüllten Ball kämpfte, was mit derartigen
Gewalttätigkeiten und Unruhen verbunden war, dass sich die Obrigkeit zu einem Verbot
gezwungen sah (Bausenwein, 1995: 99). Fußball war zu dieser Zeit mehr ein Volkssport, an
dem ganze Viertel, Dörfer und sogar Städte teilnahmen. Eine Unterscheidung zwischen
Zuschauern und Spielern, geschweige denn ein festes Spielfeld oder ein striktes Regelwerk
gab es nicht. Ziel war es wie heute ein Tor zu erzielen, die aber damals noch von Marksteinen
oder Stadttoren dargestellt wurden und zum Teil kilometerweit auseinander lagen
(Bausenwein, 1995: 100).
Derart große ,,Ballschlachten" fanden in der Regel im Rahmen der großen kirchlichen Feste
wie zum Beispiel Weihnachten oder Fastnacht statt. Sie bildeten einen festen Bestandteil im
Jahresablauf der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft. Auch die Rugby-
ähnliche italienische Version des ,,Calcio" (übersetzt: Fußtritt) war im venezianischen
Pontespiel zusammen mit anderen volkstümlichen Kriegsspielen nachweisbarer Teil
christlicher Festtage. Das französische Ballspiel ,,Soule" etwa hatte den Spielzweck darin, im
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
7
Sieg über den Gegner Kraft und Fruchtbarkeit für die eigene Gemeinschaft zu sichern. Das
Dorf der Gewinner, so der Glaube, sollte im nächsten Herbst eine bessere Ernte haben
(Bausenwein, 1995: 102, 114, 140).
In dieser Phase seiner Entwicklung wurde der Fußball zumeist von Bauern und Gesellen
praktiziert, während sich die Oberschicht von dem bunten Treiben fernhielt. Ein wesentlicher
Grund für die Popularität und die Verbreitung des Fußballs war der ,,Derbycharakter" der
jeweiligen Begegnungen: Lokale Identität wurde gestiftet und demonstriert sowie
nachbarschaftliche Rivalität ausgetragen. Die Wurzeln des Begriffs ,,Derby" liegen in dem
Aufeinandertreffen zwischen den lokalen Pfarrbezirken All Saints und St. Peter im englischen
Kleinstädtchen ,,Derby". Ende des 18. Jahrhunderts trafen sich dort zwischen 500 bis 1000
Spieler beider Seiten. Die Spieldauer einer solchen Fußballbegegnung betrug knappe sechs
Stunden. Spielfläche waren Sümpfe, Flüsse, Felder und Straßenzüge auf denen ein großes
Durcheinander herrschte. Verletzungen und Knochenbrüche im Spielverlauf waren an der
Tagesordnung (König, 2002: 8).
Ab dem Jahr 1830 kam es zu einer Zivilisierung des Fußballs und einem engeren Regelwerk.
Das erste seiner Art entstand 1845: ,The Law of Football as played in Rugby School'. Darin
wurde im Gegensatz zum Rugby das Spiel mit der Hand untersagt ebenso wie das Treten,
Schubsen oder Stoßen. Andere englische Schulen zogen nach und so kam es im Jahre 1863
mit Gründung der Football Association (FA) in London zu einer endgültigen Abgrenzung
gegenüber Rugby und anderen Sportarten. Das damalige Regelwerk dient noch immer den
heutigen Spielregeln als Basis (König, 2002: 9).
Die nächste Entwicklungsphase des Fußballs ist geprägt von der Aufnahme ins tägliche Leben
der Arbeiterschaft, vor allem als körperlicher Bewegungsausgleich zum monotonen
Fabrikleben Ende des 19. Jahrhunderts. 1883 gewann mit den Blackburn Olympics eine
Arbeitermannschaft den FA-Cup
1
und brach damit erstmals die Vorherrschaft der Klubs aus
der Oberschicht. Im Zuge dessen wurde Fußball ein Ereignis für breite Zuschauermassen.
Verfolgten 1872 gerade einmal 2.000 Besucher das Finale des FA-Cups, so kamen 1901
bereits 111.000 Zuschauer in das 1894 erbaute Crystal Palace Stadion in London (König,
2002: 9). Beim ersten Cup-Final im neu eröffneten Wembley-Stadion drängten gar weit mehr
Zuschauer ins Stadion, als darin Platz hatte. 200.000 sollen es gewesen sein, die die so
genannte ,,White-Horse Partie"
2
zwischen West Ham United und den Bolton Wanderers im
April 1923 sahen (Bausenwein, 1995: 8f).
1
Der FA-Cup ist der älteste und traditionsreichste Fußballpokal der Welt an dem ausschließlich englische
Mannschaften teilnehmen.
2
Die Zuschauer wurden damals von einem Polizeibeamten auf einem Schimmel sitzend vom Spielfeld gedrängt.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
8
In Deutschland kam es nur zu einer schleppenden Verbreitung. Englische Kaufleute und
Studenten brachten den Fußball nach Deutschland, die auf der Suche nach Mitspielern und
Gegnern das Spiel populär machten. Sie gründeten auch die ersten Fußballclubs. Der älteste
Fußballverein auf deutschem Boden ist der 1888 gegründete SC Germania Berlin
(Bausenwein, 1995: 88). Im Jahr 1900 wurde der DFB gegründet und in seinem Fahrwasser
entstanden Fußballvereine in allen großen deutschen Städten.
Das Zuschauerinteresse war zu Beginn recht zurückhaltend. Dem ersten deutschen
Meisterschaftsendspiel zwischen dem VfB Leipzig und DFC Prag wohnten 1903 gerade
einmal 1.500 Zuschauer bei. Die Endspielbegegnung von 1922 zwischen dem Hamburger SV
und dem 1.FC Nürnberg sahen dagegen schon 58.000 Zuschauer. Ende der 20er Jahre gab es
bereits 129 Stadien in Deutschland (Aschenbeck, 1998: 10f).
Doch erst mit der 1963 gegründeten Fußball-Bundesliga wurde der Fußball in Deutschland
professionalisiert. Die Begeisterung für die höchste deutsche Spielklasse ist bis heute
ungebrochen. In der Spielzeit 2007/2008 sahen über 12 Millionen Stadionbesucher die 306
Partien der 18 Bundesligaclubs. Das bedeutet einen Schnitt pro Spiel von fast 40.000
Zuschauern. Der ,,Deutsche Fußball Bund" ist mit über sechs Millionen Mitgliedern
mittlerweile der größte Einzelsportverband der Welt (Dertmann, 2008).
2.2 Zuschauer: Individuen als dynamische Kollektive
Das Fußballspiel ist zunächst einmal körperliche Betüchtigung. Erst durch das Publikum wird
der Fußballsport zum gesellschaftlichen Ereignis. Die Zuschauer werden zumeist als Fans
bezeichnet. Der Begriff geht etymologisch auf ,fanum' zurück, was wörtlich mit Tempel
übersetzt wird. Es impliziert, dass der Fan eine irdische Größe zu einem Heiligtum erklärt
(Aschenbeck, 1998: 89). Bei Fußballfans handelt es sich keineswegs um eine homogene
Gruppe. Vielmehr stellen sie ein breites Spektrum an Individuen dar, die laut Aschenbeck
(1998) wenigstens durch eine der folgenden Definitionen zu erkennen sind:
-
Stehen in Fankurven,
-
Anfeuerungsrufe und Mitleiden bei Spielen der eigenen Mannschaft,
-
Solidaritäts- und Gemeinschaftsgefühl,
-
prinzipielle Vereinstreue,
-
äußere Zeichen der Zugehörigkeit (wie Schals, Mützen etc.),
-
Männlichkeitsnormen
In den Stadien bilden die so genannten Fans ,,meistens eine räumlich und visuell von den
übrigen habituellen Zuschauern unterscheidbare relativ kohärente Subgruppe, die sich durch
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
9
stark affektive Bindungen an das jeweilige Bezugsobjekt in relativ unveränderter
Zusammensetzung von Heimspiel zu Heimspiel wiederholt" (Herrmann, 1977: 11)
Allerdings findet man Fans nicht nur am Spielort. Es gibt unterschiedliche Formen der
Partizipation des Publikums an der ,,Veröffentlichung" des Fußballs und des Spitzensports
generell. Es gibt die traditionelle, direkte authentische Form, die etwa durch das Stehen in
Fankurven gekennzeichnet ist. Hier wird der Wettkampf in einer Art Face-to-Face Beziehung
konsumiert, wobei die Live-Veranstaltung gewissermaßen die Form der Publikation darstellt.
Daneben gibt es die andere Form, in der der Fußball in seiner medialen Darstellung im
Fernsehen, Radio, Printmedien oder neuerdings im Internet konsumiert wird (Cachay und
Thiel, 2000: 146).
Durch die direkte Form des Konsums von Fußball erfolgt auch eine Abgrenzung von
verschiedenen Zuschauern. Neben dem eigentlichen Fan gibt es auch den Zuschauer, der ein
Spiel distanzierter konsumiert und dessen Interesse vermehrt im Unterhaltungswert der
sportlichen Veranstaltung liegt. Der subjektiv-vereinstreue Fan hingegen bewegt sich in einer
so genannten Fanszene. Darunter gibt es organisierte Fangruppen, denen das Fußballspiel als
Rahmen für ihre Gruppenaktivität dient. Die Identifikation mit dem Verein wirkt als
gemeinsamer Nenner, was die Mitglieder zu einer dauerhaften Gruppe zusammenschließt.
Darüber hinaus vermischen sich dort sportliche mit sozialen Aspekten. Es gibt aber auch lose
informelle Gruppen von Fußballfans, die nach Spielschluss wieder getrennte Wege bis zum
nächsten Spieltag gehen (König, 2002: 45).
Elias & Dunning (1984) analysieren solche Sportgruppen. Sie gehen davon aus, dass beide
Formen der Fußballgruppen durch sich fortlaufende verändernde Figuration beeinflusst
werden, hervorgerufen durch das Treiben beider Teams auf dem Spielfeld. Dadurch wird
Spannung erzeugt und damit entsteht eine Dynamik innerhalb solcher Gruppen (Elias und
Dunning, 1984: 109). Herkömmliche Modelle der Kleingruppentheorie reichen zur Erklärung
eines solchen Kollektivs nicht aus. Denn im Gegensatz zur ,,Theorie der sozialen Gruppe"
von Homans (1978), in der Konflikte und Spannungen höchstens eine marginale und damit
untergeordnete Rolle spielen, sprechen Elias und Dunning (1984) im Zusammenhang von
Zuschauern bei Sportspielen bewusst von ,,Gruppen in kontrollierter Spannung" (Elias und
Dunning, 1984: 111). Den Hauptmotor der Gruppendynamik bilden dabei eine Reihe von
,,Polaritäten", die im Spielprozess des Fußballs eingebaut sind, wie etwa die Polarität von
Angriff und Verteidigung eines Teams oder die Polarität zwischen freundlicher Identifikation
und feindlicher Rivalität mit den gegnerischen Mannschaften (Elias und Dunning, 1984: 118).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
10
2.3 Gewalttätiges Zuschauerverhalten: Kampf- und Konflikterfahrungen
Das körperliche Ausleben von Rivalität und Gewaltanwendung bei sportlichen Wettkämpfen
geht nicht traditionell auf den Fußball zurück. ,,Bereits 450 Jahre vor Christus sollen
betrunkene Zuschauer im Stadion von Delphi randaliert haben. In Olympia, dem
Austragungsort der antiken Spiele gab es Stock und Peitschenträger. In Pompeji schloss
Kaiser Nero das Amphitheater, nachdem Krawalle Überhand genommen hatten. Und von den
Massenaufständen bei Wettkämpfen im Mittelalter ganz zu Schweigen. Ausschreitungen,
Pöbeleien und Vandalismus: Es verging keine Phase der Geschichte, in der Sportstätten nicht
auch Schauplätze von Gewalt waren" (Blaschke, 2007: 143).
Nicht nur die sportlichen Konkurrenten auf dem Rasen eines Fußballstadions befinden sich im
Wettkampf. Die Zuschauer-Parteien auf den Rängen, die mit ihrer Mannschaft bangen und
hoffen, kämpfen im Geiste mit. Fans kommen mitunter als Kämpfer ins Stadion, die ihre
Mannschaft zum Sieg treiben wollen. Die Aggression auf dem Rasen sorgt dabei zusätzlich
für Spannungen und Dynamik auf den Rängen. Jedoch ist es für ein Fußballspiel genauso
typisch, dass eine mit Gewalt aufgeladene Atmosphäre nachhaltig das Spielgeschehen
beeinflussen kann. Diese Atmosphäre wird von manchen Zuschauern bewusst oder gar
gewollt inszeniert bzw. aufgesucht. Ins Stadion geht man auch nicht weil man sich
entspannen will. Der Zuschauer will Erregung. So kann am Ende eines Spiels, falls das
Ergebnis unbefriedigend ausfällt, die Stimmung aggressiver sein als zuvor (Bausenwein,
1995: 314).
Zuschauerausschreitungen im engeren Sinn gibt es beim Fußball seit Ende des 19.
Jahrhunderts. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts und in der Zwischenkriegszeit gehören sie in
den Stadien zum Alltag. Allerdings gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Institution, die ohne
direkte Beziehung zum Spiel versucht gegen die Zuschauergewalt vorzugehen. Zudem fehlt
jede Form einer durch Massenmedien hervorgerufenen bzw. verstärkten ,,moralischen
Entrüstung" (Dunning, 1984: 125).
Ende der 50er Jahre erlebt der englische Fußballsport eine vielschichtige Zuschauerkrise. Die
Gründe liegen vor allem in der Professionalisierung des Fußballsports. Dieser besteht nicht
nur darin, dass ein Transfermarkt eröffnet und umfangreiche Ablösesummen gezahlt werden,
was zur Folge hat, dass die Spieler als Figuren ,,greifbarer subkultureller Repräsentanten"
(Critcher, 1979: 152) mit kultureller und ökonomischer Nähe zu ihren Anhängern ausgedient
haben. Sondern auch, dass durch Entwicklungsprozesse in der Gesamtgesellschaft die
Arbeiterklasse durch ihre vergrößerten Freizeitmöglichkeiten sich zusehends heterogener
entwickelt hatte und dadurch das Interesse am Fußball verloren ging. Seitdem wirbt der
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
11
Fußball um Kunden oberhalb und jenseits der traditionellen Fußballsubkultur. Die folgenden
Jahre sind geprägt durch die Entfremdung zwischen Aktiven und den ehemals ,,treuen"
Zuschauern (König, 2002: 18). Denn einst war der stereotype Anhänger ein Mann aus der
Arbeiterklasse, der für den Samstag lebte und seiner Ansicht nach für das Glück des
Vereins nicht wegzudenken war. Nun wandelte sich der Fußballfan zu einem Zuschauer von
unbestimmter Klassenzugehörigkeit, der den Ausbruch aus dem Alltag und die Aussicht auf
Spektakel genießen wollte. Dieser ,,Anhänger" erwartete die Erfüllung jener Bedürfnisse von
einem Team professioneller Unterhalter. Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die
Formen der auftretenden Gewalt.
Waren es früher zumeist situationsspezifische Bedingungen der Zuschauergewalt, so sind
diese Veränderungen grundlegend für eine Form der Anhängerrevolte: das Absinken in
gewohnheitsmäßige Gewalttätigkeit. Enttäuschungen über Niederlagen werden etwa an den
Sonderzügen ausgelassen mit denen beispielsweise Liverpool oder Everton-Fans nach Hause
fuhren. Bereits im Jahr 1968 wird der Fußballvandalismus als eine der offensichtlichsten
Bedrohungen der sozialen Ordnung in England angesehen (Critcher, 1979: 152f).
In den 80er Jahren nimmt die Gewalt durch das Aufkommen der so genannten Hooligans
extreme Formen an. Sie gehen nicht zu einem Spiel, um das sportlich Dargebotene zu
konsumieren, sondern suchen sie gezielt die Konfrontation mit gegnerischen Fans oder
Polizisten (Merkl, 2006: 122). Trauriger Höhepunkt ist das von Gebauer und Hortleder (1986)
als ,,Fan-Massaker" bezeichnete Ereignis beim Endspiel um den Europacup der
Landesmeister zwischen Juventus Turin und dem FC Liverpool im Brüsseler Heysel-Stadion
am 29. Mai 1985. Vor Spielbeginn fühlen sich englische Fans provoziert und reißen einen
Zaun des baufälligen Stadions zum benachbarten Fanblock nieder, wo sich vor allem Juventus
Anhänger befinden. In mehreren Wellen rennen Gruppen von englischen Hooligans Flaschen
werfend und mit abgebrochenen Zaunpfählen um sich schlagend in die Gruppe der
italienischen Fans hinein. In Panik weicht alles zurück, die italienischen Zuschauer werden
gegen die seitliche Begrenzungsmauer und gegen die Gitterabsperrungen gedrückt: 39
Personen ersticken oder stürzen zu Tode (Schmalzl, Renner und Hieber, 1988: 23).
Was haben diese tragischen Ereignisse von Brüssel bewirkt? ,,Sie haben die Angst vor den
Fans verstärkt, (...) und polizeilichen Maßnahmen bei der Organisation großer Sportereignisse
einen noch größeren Platz als bisher eingeräumt" (Gebauer und Hortleder, 1986: 260).
Zu den Maßnahmen, die in Zukunft Katastrophen verhindern sollen, zählen eine starke
Polizeipräsenz, strenger Arrest, Isolierung und Trennung der Fans in umzäunte und
überwachte Blöcke (Blaschke, 2007: 230f).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
12
3. Die verschiedenen Zuschauergruppen im Fußballstadion
Die Definition, wodurch sich ein Fußballfan im Allgemeinen auszeichnet wurde bereits in
Kapitel 2.2 vorgenommen. Nun geht es darum verschiedene Zuschauergruppen im Stadion zu
unterteilen und spezifischer voneinander abzugrenzen.
Die soziologische Literatur bietet vielfache Unterscheidungen von Fußballzuschauern.
Zumeist geht sie von einer klassischen Dreiteilung nach Heitmeyer und Peter (1992) aus. Sie
unterteilen in konsumorientierte, fußballzentrierte und erlebnisorientierte Zuschauer
(Heitmeyer und Peter, 1992: 32). Allerdings reicht diese Unterteilung mittlerweile nicht mehr
aus, um die immer komplexer werdenden Gruppen im Stadion zu beschreiben. Denn viele
Besucher bilden eine Schnittmenge dieser drei Unterteilungen oder sind nur schwer in eine
der drei Gruppen von Heitmeyer und Peter (1992) zu kategorisieren. Deshalb soll an dieser
Stelle versucht werden in vier Grundformen des Publikums zu unterteilen. Bisherige
wissenschaftliche Definitionen werden aufgegriffen und in diese Aufteilung übernommen.
3.1 Der Zuschauer als Kunde und Konsument
Der typische Zuschauer der Gegenwart kommt weniger aus dem Interesse, seine Mannschaft
zu unterstützen, sondern in erster Linie um gute Unterhaltung zu konsumieren. Im Zuge der
Kommerzialisierung des Sports und der gleichzeitigen Ablösung der Arbeiterklasse als
traditionelle Anhänger hat der Fußball als Unterhaltungsereignis mittlerweile die besser
verdienenden Konsumentenkreise erschlossen. ,,Die Armen und deren Kinder können sich gar
keine Karten mehr leisten, ihre Plätze hat der gut verdienende Mittelstand eingenommen"
(SPIEGEL, 1995: 161; zitiert nach Bausenwein, 1995: 237).
Der moderne Zuschauer ist also heutzutage mehr denn je Kunde und Konsument, wenn er das
Stadion betritt. Die Vereine haben sich mit ihrem Angebot natürlich auf dieses
zahlungskräftigere Mittelstandspublikum eingestellt: mehr Sitzplätze, Fanartikelstände,
Stadionhefte, VIP-Logen, Vereinsmaskottchen, multifunktionale Videoleinwände mit ,,Fan-
TV" und Rahmenprogramm der Sponsoren in der Halbzeitpause. Kurzum, der Zuschauer
bekommt im Stadion neben der sportlichen Unterhaltung zusätzliches Entertainment für sein
Eintrittsgeld geboten (Ehlers, 2004: 50f).
Da schmerzt es viele Besucher nur im geringen Maß, wenn der sympathisierte Verein an
diesem Tage nicht als Sieger vom Platz geht. Immerhin hatte der Zuschauer einen
unterhaltsamen Nachmittag, oftmals im Beisein der ganzen Familie. Denn diese suchen
mittlerweile vermehrt den Weg in die deutschen Stadien, auch wegen erhöhter Sicherheit.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
13
Rottmann und Seitz (2006) untersuchen Determinanten, die die mikroökonomische
Zuschauernachfrage in der Fußballbundesliga beeinflussen. Neben den persönlichen
Präferenzen der potentiellen Nachfrager, wie etwa der Vereinstreue oder der Unsicherheit wie
das Spiel ausgeht, spielen vor allem äußere und ökonomische Faktoren eine wichtige Rolle
für den Stadionbesuch. Dazu gehören Faktoren, die vor allem auf den Erfolg (Qualität und
Reputation der beiden beteiligten Mannschaften), die Attraktivität des Spiels (Derby,
Entfernung, Spieltag) sowie auf die Stadiongröße abzielen. Zudem gehen auch relativ viele
Zuschauer zu den Heimspielen schlechterer Mannschaften, falls es sich beim gegnerischen
Team um eine renommierte und gut platzierte Mannschaft handelt (Rottmann und Seitz,
2006: 12).
Diese Analyse der Zuschauernachfrage lässt den Schluss zu, dass heutzutage bei vielen
Besuchern eine geringe Identifikation mit Spielern, Vereinen und dem Umfeld der Klubs
vorherrscht. Emotionalität und Frustrationspotential bei Misserfolg sind bei dieser Gruppe
geringer und gleichzeitig die Gründe, weshalb der konsumorientierte Fan (Heitmeyer, 1988:
31f) grundsätzlich nicht zur Gewalt neigt und sich zumeist von jeglichen aggressiven
Handlungen in und um das Stadion distanziert.
Hüther (1994) klassifiziert diese Publikumsgruppe dementsprechend als distanziert-passive
Zuschauer, die sich durch folgende Merkmale auszeichnen: keine oder gering ausgeprägte
Vereinspräferenz; wenig Identifikationsbereitschaft mit Mannschaft und Spielern, beherrschte
und betont neutrale Reaktion auf das Spielgeschehen; Erwartung: interessantes Fußballspiel
(Hüther, 1994: 9).
Diese konsumorientierten Zuschauer fahren selten zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaft und
begeben sich nicht bei jedem Heimspiel ins Stadion. Trotzdem kann man auch bei ihnen eine
gewisse emotionale Anteilnahme am Fußballspiel entdecken. Nach Heitmeyer (1992) stehen
für diese Fans ,,das Erleben von Spannungssituationen, die von anderen dargeboten werden,
im engen Zusammenhang mit Leistungsgesichtspunkten, während die soziale Relevanz
weitgehend unbedeutend ist (Heitmeyer, 1992: 33). D.h. die Leistung der Spieler steht für den
Kunden im Mittelpunkt. Fußball ist für diesen Fan-Typ nur eine mögliche
Freizeitbeschäftigung, aber nicht die einzige. Deshalb kommt der ,,normale" Fan auch oft
allein oder mit wechselnden Personen ins Stadion, hat zumeist einen Sitzplatz und ist nicht in
Fanklubs aktiv (Weigelt, 2004: 30).
Die deutsche Polizei unterteilt Zuschauer in den Fußballstadien seit 1993 grundsätzlich über
ihr gewalttätiges Potential. Die hier definierte distanziert-passive Zuschauergruppe fällt
demnach in die Kategorie A: ,,der friedliche Fan" (ZIS Jahresbericht, 2007: 5).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
14
3.2 Der Fan innerhalb einer Subkultur
Fußballfans, die sich in Gruppen innerhalb einer Fußballfanszene zusammenschließen,
unterscheiden sich von den distanziert-passiven Zuschauern der zahlungskräftigen
Mittelklasse. Durch die zunehmende Bedeutung von Beziehungen in altershomogenen
Gruppen (sekundäre Sozialisation) treten Peer groups zunehmend in den Fokus bei der
Analyse von Zuschauergruppen in Stadien (König, 2002: 46).
Die Peer group ist eine Bezeichnung für einen Zusammenschluss einer informellen Spiel- und
Freizeitgruppe von etwa gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen. Sie bietet dem Individuum
beim Übergang von der familienbezogenen und geprägten Kindheit (primäre Sozialisation)
zum vollen Erwachsenensein eine bedeutungsvolle soziale Orientierung und übt oft eine
starke soziale Kontrolle aus. In der Peer group äußert sich in besonderer Weise eine
jugendliche Subkultur, d.h. eine starke Neigung zu Unabhängigkeit hinsichtlich bestimmter
Wertvorstellungen, Erwartungen und Empfindlichkeit gegenüber sozialer Kontrolle durch
Erwachsene sowie eine vorherrschende Konformität und Loyalität gegenüber den
Verhaltensnormen der eigenen Gruppe (Heilmann, 1994: 659).
Hahn et al. (1988) sehen als Hintergrund der Bildung solcher Subkulturen die Probleme der
Identitätsstiftung Jugendlicher in der heutigen Zeit. Vielfältige soziale Prozesse sind zu
beobachten, welche Jugendliche mit hohen Anforderungen konfrontieren und die
Entwicklung ihrer persönlichen Identität erschweren, wie etwa die zeitliche Ausdehnung der
Jugendphase durch Hinausschieben der Erwerbstätigkeit, gleichbedeutend mit einer
Verlängerung der ökonomischen Abhängigkeit (Kübert und Neumann, 1994: 22f).
Die Fußballszene bietet Jugendlichen eine Möglichkeit diese Widersprüche aufzulösen, zu
kompensieren, eine eigene Identität zu bilden und eine Subkultur nach ihren eigenen
Vorstellungen und Verhaltensweisen zu definieren. Bei dieser Szene handelt es sich
keineswegs um eine ungeordnete chaotische Masse, sondern um ein ausgeklügeltes
reglementiertes System aus bestimmten Werten, Normen und Tabus. Die Zusammenschlüsse
von Peer groups innerhalb dieser Subkultur der Fußballfans können dabei die verschiedensten
Ausprägungen annehmen. Diese bewegen sich zwischen lockerer bis hin zu hoch
strukturierter Gruppenbildung, vom losen Zusammenschluss von Individualisten bis hin zu
streng organisierten Fanklubs (König, 2002: 47).
Innerhalb dieser jugendlichen Subkultur befinden sich nach der Definition von Heitmeyer
(1988) sowohl konsumorientierte Fans, die individualistischer in ihren Zusammenschlüssen
geprägt sind als auch fußballzentrierte Fans. Bei ihnen ist der Zusammenschluss durch ein
fußballsportlich vereinsorientiertes Antriebsfeld gekennzeichnet. Die absolute Treue zum
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
15
Verein, auch in sportlich schlechteren Zeiten hat für diese Gruppe Priorität. Für sie besitzt der
Fußball eine hohe soziale Relevanz. Diese Fans suchen Anerkennung in einer Clique von
Gleichgesinnten und demzufolge haben sie eine stark ausgeprägte Gruppenorientierung.
Damit und zusätzlich durch die Präsenz im Fanblock schaffen sie sich ein Territorium, um
dort ihre Bedürfnisse in der Gemeinschaft zu befriedigen (Heitmeyer, 1988: 31f).
Hüther (1994) bezeichnet jene Gruppe als engagiert-kontrollierte Zuschauer, die sich durch
folgende Merkmale definieren: deutliche Vereinspräferenz und Identifikation mit der
Mannschaft (auch durch Tragen von Vereinsfarben), kritische Solidarität mit Spielern;
emphatisches Erleben des Spielgeschehens; vorwiegend verbaler Ausdruck der
Vereinsfixiertheit; Erwartung: gutes Spiel der eigenen Mannschaft, wenn möglich Sieg
(Hüther, 1994: 9).
In Bezug auf die potentielle Gewalttätigkeit klassifiziert die deutsche Polizei diese engagiert-
kontrollierte Zuschauergruppe grundsätzlich als ,,friedliche Fans" und damit ebenfalls in die
Kategorie A. Allerdings ist der Übergang zur Kategorie B, ,,latent gewaltbereit", fließend, da
in bestimmten Situationen auch Mitglieder dieser Zuschauergruppe zur Gewalt neigen können
(ZIS, 2007: 6).
Dabei sind die Grundlagen für den Zusammenschluss dieser Fans mehr geprägt durch eine
erlebnisorientierte
Motivation
bei
einer
gleichzeitig
auftretenden
fanatischen
Grundeinstellung. Waren es in vielen deutschen Fankurven Ende der 80er noch lose
Zusammenschlüsse von kleineren Fanklubs und ,,Kuttenfans"
3
, die in einer Art Konsens
zusammen ihre Mannschaft anfeuerten (Gabriel, 2004: 179), so gewinnt seit Mitte der 90er
Jahre eine breit angelegte und straff organisierte Form der jugendlichen Fußballfan-Subkultur
immer mehr Einfluss in den Kurven der Stadien: die Ultras.
3.3 Die Ultras
Das Adjektiv ultra definiert sich synonym als ,,extrem" oder ,,übermäßig". Also etwas, das
über gemäßigte Normen hinausgeht. Deshalb wird das Nomen des Ultras mit Extremist
gleichgesetzt. Zumeist ist damit ein ,,politischer Extremist" gemeint, nach neuerer Definition
aber auch ein ,,extremistischer Fan".
Die so genannte Ultrabewegung hat ihre Wurzeln im Italien der 60er Jahre. Dort hatten sich
Jugendliche zusammengeschlossen, um ihre Mannschaften organisiert zu unterstützen. Die
Entstehungsgeschichte ist eng mit der politischen Protestbewegung im Italien der 60er Jahre
3
Anhänger, die ihre Jeans- oder Lederjacken (,,Kutten") mit vereinsspezifischen Aufnähern verzieren, um ihre
Zugehörigkeit zur Fanszene zu demonstrieren.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
16
verknüpft. Ausdrucksformen des Straßenprotests wie Spruchbanner, Doppelhalter oder
Megaphone halten deshalb zuerst Einzug in italienische Fankurven (Gabriel, 2004: 183).
Grundlegend geht der Begriff auf eine italienische Zeitung zurück. Sie soll Ultras einst
benutzt haben, um besonders leidenschaftliche Fans des AC Turin zu beschreiben; diese
hatten nach Spielende einen Schiedsrichter bis zum Flughafen verfolgt (Blaschke, 2007).
Als grundlegendes Vorbild für die deutschen Ultras dient mit Sicherheit die italienische
Bewegung, vor allem was die Ausdrucksformen durch pyrotechnische Mittel (Rauch und
Bengalfeuerwerk), sowie Spruchbanner und übergroße Fahnen angeht. Während aber ,,in
Italien die politische Orientierung und deren Artikulation im Stadion eine große Rolle spielen,
steht bei den deutschen Ultras die Anfeuerung der eigenen Mannschaft im Vordergrund
(Gabriel, 2004: 183).
Die deutsche Ultrabewegung ist also grundsätzlich nicht politisch. Sie formiert sich erstmals
Anfang der 90er Jahre mit dem Zusammenschluss einiger Fancliquen innerhalb der Fanblöcke
einzelner Bundesligavereine. Im Jahr 2008 hat fast jeder Klub der 1., 2. oder 3. Liga eine
eigene Ultragruppierung. Dieser Fakt ist gleichbedeutend mit einem rasanten Umsturz der
deutschen Fankultur in den letzten Jahren (Gabriel, 2004: 183).
Allerdings muss festgehalten werden, dass es ,,die" eine deutsche Ultraszene nicht gibt.
Vielmehr existieren unterschiedliche Gruppierungen, die jeweils gruppenintern über
verschiedene Strukturen, Regeln, Schwerpunkte und Vorstellungen verfügen, auch was für
diejenigen Ultra sein bedeutet. Selbst innerhalb einzelner Gruppen können verschiedene
Ansichten und Einstellungen herrschen, auch in Bezug auf Gewalt. (Pilz et al, 2006: 12)
3.3.1 Motivation, Organisation und Gewaltbereitschaft
,,Die Subkultur verleiht dem einzelnen ein höheres Maß an Identifikationsmöglichkeiten, weil
sie zumeist die spezifischen Lebensprobleme und sozialen Daseinsbedingungen besser
berücksichtigt. Sie schafft dadurch höhere Verhaltenssicherheit als die abstrakten, anonymen
Verhaltensmuster der Gesamtkultur. Das verstärkt die Solidarität zur Eigengruppe, impliziert
jedoch die Gefahr von Konflikten zwischen den Gruppen. (...) Subkulturen können sich unter
bestimmten Umständen zu Gegenkulturen ausprägen und soziale Bewegungen hervorbringen"
(Downes, 1966; zitiert nach Heilmann, 1994: 851).
Die Ausführungen von Downes (1966) zum Begriff der ,,Subkultur" stehen sinnbildlich für
die Formierung und den Charakter der deutschen Ultrabewegung. Bis heute sieht sie sich in
ihrer Gesamtheit als Gegenbewegung zur Zuschauergruppe der Kunden und Konsumenten.
Sie etablierte sich in Deutschland genau zu jenem Zeitpunkt, als die Vermarktung des
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
17
Fußballs und die ökonomischen Interessen der Vereine deutlich zunahmen (Gabriel, 2004:
185).
Im Kern versuchen sich die Ultras gegen die ,,moderne Gesamtkultur des Fußballs"
abzugrenzen. Sie verurteilen etwa die Versitzplatzung in den Arenen, da sie die Stehplätze als
kulturell wertvoll ansehen, speziell für das Anfeuern der eigenen Mannschaft und die
visuellen Ausdrucksformen der Fankultur (Aschenbeck, 1998: 142f). ,,Wo bleibt die Lust und
Leidenschaft fragen sich zu Recht viele Fans. Vor allem die jüngeren schließen sich Ultra-
Bewegungen an, da Fangruppen mittlerweile identitätsstiftender sind als die Liebe zum
Verein" (Ehlers, 2004: 51).
Trotz dieser Kritik und ihres Engagements in Faninitiativen abseits des Spielgeschehens,
bleiben die Ultras in ihrem Kern fußballzentrierte Fans, die großen Fokus auf die sportliche
Tradition ihres Vereins legen. Sie zeigen es in speziellen Sprechchören und Fangesängen in
vielen Fankurven der Bundesliga, wo sie mittlerweile fast gänzlich den Ton angeben. Sie
koordinieren mit Hilfe von Megaphonen die Klatschbewegungen und Anfeuerungsrufe von
mehreren tausend Fans. Darüber hinaus investieren sie einen hohen zeitlichen, logistischen
und finanziellen Aufwand um Choreographien, Doppelhalter oder eigene Großfahnen
herzustellen (Gabriel, 2004: 183).
In den etwa 50 deutschen Ultragruppen sind mehr als 1500 Fans aktiv, dazu kommen
unzählige Sympathisanten und Mitläufer. Ihre Aktivitäten erfordern von den jeweiligen
Gruppen einen hohen Organisationsgrad, wobei sich viele Ultragruppen in Aufbau und
Organisation unterscheiden. Die Leitung übernimmt zumeist die so genannte Direktive, eine
Art Vorstand von 10 bis 15 Personen. An seiner Spitze steht der ,,Capo" (italienisch für
,,Kopf"). Oftmals ist er der ,,Einpeitscher"
4
in der Fankurve. Er lebt die Werte, Normen und
Rituale der Gruppe vor und hat sich seine Position, das Vertrauen und den Rückhalt über
jahrelangen Einsatz erworben. Daneben gibt es einen Ältestenrat, der dem Vorstand beratend
zur Seite steht. Zusätzlich gibt es einen Sprecher und einen Kassenprüfer, der für die
Mitgliedsbeiträge verantwortlich ist. Dazu wird in aktive und passive Mitglieder unterteilt.
Wichtige Maßnahmen und Aktionen der gesamten Gruppe werden basisdemokratisch mit der
Direktive diskutiert und mit Konsens beschlossen, wie etwa die Inhalte von Stadion-
Choreographien oder sonstigen Aktionen (Blaschke, 2007: 85f).
In dem Selbstverständnis aller Ultras sind zwei zentrale Merkmale festzustellen: Erstens die
Unabhängigkeit vom Verein und zweitens die unbedingte Präsenz und Aktivität als Ultra,
was oftmals als bedingungslose und fanatische Unterstützung des eigenen Vereins bezeichnet
4
Mit Hilfe eines Megaphone stimmt er die Fangesänge an, die die Gruppe dann respondiert.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
18
wird (Gabriel, 2004: 189). Denn trotz der Solidarisierung der gesamten Ultraszene für
gewisse Initiativen darf nicht vergessen werden, dass viele Gruppen untereinander verfeindet
sind und dass gewalttätige Auseinandersetzungen durchaus passieren können, treffen diese
Lager an Spieltagen aufeinander. Zudem geht es um einen ,,Kampf auf den Rängen" und um
die Frage: Wer liefert die bessere Performance ab? Denn etwa bedonders gelungene
Choreographien oder kreative Anfeuerungsrufe steigern das Ansehen der Gruppe und
verschafft eine bestimmte Stellung und Respekt in der Szene. Der Wettstreit kann jedoch auch
über körperliche Auseinandersetzungen oder Randale passieren.
Dementsprechend können Ultras in die von Hüther (1994) definierte fanatisch-parteiliche
Zuschauergruppe klassifiziert werden. Diese zeichnen sich durch einseitiges Miterleben und
parteiliches Beurteilen des Spielgeschehens aus; Demonstration der Vereinsfixiertheit durch
Tragen der Vereinsfarben und Symbole; gezielte Diskriminierung des Gegners mit der
Erwartung: Sieg der eigenen Mannschaft, wie auch immer (Hüther, 1994: 8). Entgegen der
Darstellung von Hüther (1994) herrscht generelle bei den Ultras jedoch keine totale
Identifikation mit dem der Mannschaft und kein aktives Eintreten für Vereinsinteressen.
Viele Vereine und der DFB haben es bisher nicht verstanden mit diesem neuen Fan-
Phänomen richtig umzugehen. Einerseits bedienen die Ultras durch ihr an die Eventkultur
erinnerndes Auftreten potenziell das Verwertungsinteresse der Vereine (etwa durch
Choreographien), andererseits stört das selbstbewusste Eintreten der Ultras für ihre
ureigensten Interessen den Geschäftsablauf. Denn eine Kontrolle oder gezielte Steuerung
dieser Gruppen von Vereins- oder Verbandsseite ist nicht möglich (Gabriel, 2004: 192).
Ähnlich verhält sich der Umgang der Polizei mit der ,,neuen Fanszene", die mit ihrer
Kategorisierung hier an eine Grenze stößt. Die Ordnungshüter haben beobachtet, dass ,,der
überwiegende Mehrzahl der Angehörigen der Ultra-Gruppierungen zwischen 16 und 23
Jahren alt ist und mehrheitlich (noch) in die Kategorie A eingestuft" werden kann. ,,Jedoch
wird zunehmend eine Steigerung der Aggressivität von Angehörigen der Ultra-Gruppierungen
sowie eine Solidarisierung gegenüber Mitarbeitern der Ordnungsdienste und Einsatzkräften
der Polizei berichtet, wenn diese gegenüber Mitgliedern der jeweiligen Gruppe einschreiten.
Teile der Ultra-Gruppierungen sind daher ohne Einschränkung in die Kategorie B und C
einzustufen" (ZIS, 2007: 6).
Es zeigt, dass selbst die Beamten Probleme haben, das Gewaltpotential der Ultras generell als
Gruppe zu kategorisieren und einzuordnen. Die angeführte Kategorie C, ,,der Gewalt
suchende Fan", war nämlich bislang nur für eine Zuschauergruppe vorgesehen: Hooligans.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
19
3.4 Die Hooligans
Der Begriff Hooligan wird erstmals im Jahr 1898 in einer englischen Tageszeitung gebraucht,
aber der Ursprung des Begriffes lässt sich nicht genau festlegen (Meier, 2001: 9).
Nach Ek (1996) gibt zwei Möglichkeiten der Abstammung: Zum einen könnte sich der
Begriff auf eine irisch-stämmige Familie namens ,,Houlihan" beziehen, deren gewalttätige
Mitglieder bekannt waren für wüste Schlägereien und in Liedern als Helden besungen
wurden. Zum anderen könnte Hooligan aus einer missverständlichen Übernahme von
,,Hooley's gang" entstanden sein, einer Bande jugendlicher Straßenkrimineller (Ek, 1996: 31).
Zunächst werden Rowdys und Straßenkriminelle als Hooligans bezeichnet. Seit ca. 1970 in
England und 1985 in Deutschland kam es jedoch zu einer Begriffseingrenzung, welche sich
auf Gewalttaten im Umfeld von Fußballspielen bezieht (König, 2002: 69).
In Deutschland verdrängt der Begriff des Hooligans, den des Fußballrowdys. Als Fußball-
Hooligan wird also jeder bezeichnet, der sich anlässlich von Fußballspielen an gewalttätigen
Ausschreitungen beteiligt. Diese Personen bezeichnen sich selbst als ,,Hools". Einerseits, um
sich gegenüber den normalen Fans abzugrenzen, andererseits auch als Bekenntnis zur Gewalt
(Gehrmann und Schneider, 1998: 99).
Heitmeyer und Peter (1988) bezeichnen sie als erlebnisorientierte Fans, sie wollen selbst
Situationen erzeugen ,,wo was los ist" (Heitmeyer und Peter, 1988: 31f). Deutlich
gewaltbezogener spricht Hüthers (1994) Klassifizierung von einer konfliktsuchend-
aggressiven Zuschauergruppe. Ihre Vereinsfixierung ist unterschiedlich ausgeprägt, nicht die
Gastmannschaften sondern ihre Fans sind die Gegner. Das Fußballspiel und dessen Umfeld
dienen als Aggressionsstimulans. Die Teilnahme am Spielgeschehen passiert stets in Gruppen
mit der Erwartung eigener Aktionsmöglichkeit (Hüther, 1994: 9).
Gemäß der polizeilichen Kategorisierung fallen Hooligans vorwiegend unter die so genannten
C-Fans (,,Gewalt suchend"). Ihre Anzahl beläuft sich in Deutschland nach Polizeischätzungen
in der 1., 2. und 3. Liga aktuell auf etwa 3200 Personen mit einem Umfeld von etwa 8500
Kategorie B-Zuschauern (,,latent gewaltbereit") (ZIS, 2007: 7f).
Eine Zusammenfassung und Veranschaulichung der bisher besprochenen Definitionen und
Klassifizierungen der vier verschiedenen Zuschauergruppen liefert Tabelle 1.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
20
Tabelle 1.: Die verschiedenen Zuschauergruppen im Stadion
Zuschauergruppen
im Fußballstadion
Klassifizierung
Verhalten, Erwartungen
Polizeikategorie,
Gewaltpotential
Die Kunden und
Konsumenten
Distanziert-passiv (Hüther,
1994), konsumorientiert
(Heitmeyer, 1988),
unauffällig (Ek, 1996),
eventorientiert (Ehlers,
2004)
Geringe Identifikation mit Verein
und Spielern, beherrschte Reaktion
auf Spielgeschehen,
Erwartung: interessantes Spiel.
Kategorie A
(friedliche Fans)
Die Fans innerhalb
einer Subkultur
Engagiert-kontrolliert
(Hüther, 1994),
konsumorientiert,
fußballzentriert,
(Heitmeyer, 1988),
situativ zügellos,
überschwänglich (Pilz,
1979)
Deutliche Identifikation mit Verein
und Spielern, emphatisches
Erleben des Spielgeschehens,
Gruppenorientierung,
Erwartung: Sieg der eigenen
Mannschaft
Kategorie A und B
(friedliche Fans und
latent gewaltbereit)
Die Ultras
Fanatisch-parteilich
(Hüther, 1994),
fußballzentriert,
erlebnisorientiert
(Heitmeyer 1988),
kritisch (König, 2002),
unabhängig, wettstreitend
(Gabriel, 2004)
Vereinsfixiertheit, einseitiges
Beurteilen des Spielgeschehens,
kritische Beurteilung von Spielern,
Vereinen, Medien und Polizei,
gezielte Diskriminierung des
Gegners, hochgradige
Gruppenorientierung, gegen
Kommerzialisierung des Sports
Erwartung: Sieg der eigenen
Mannschaft, egal wie
Kategorie A, B und C
(friedliche Fans,
latent gewaltbereit
und Gewalt suchend)
Die Hooligans
Konfliktsuchend-aggressiv
(Hüther, 1994),
erlebnisorientiert
(Heitmeyer, 1988),
gewohnheitsmäßig
gewalttätig (Ek, 1996),
(Gehrmann, 1998), (Meier,
2001), (Weigelt, 2004)
Empfindung Gästefans als Gegner,
Umfeld des Fußballs dient als
Stimulans für Aggressionen,
Teilnahme stets in Gruppen, darin
Vorherrschen von Ritualen und
Profilierungsdruck, Erwartung:
eigene Aktionsmöglichkeit,
Gewaltausübung
Kategorie C
(Gewalt suchend)
Quelle: eigene Darstellung
3.4.1 Tradition, Entwicklung und Veränderung
Als Vorbilder für die deutsche Hooliganszene dienen mit Sicherheit gewaltbereite
Zuschauergruppen in England, wo die Wiege dieser gewaltbereiten Subkultur zu finden ist. In
Großbritannien haben Ausschreitungen bei Fußballspielen eine lange Tradition und begleiten
den Zuschauersport Fußball seit seiner Entstehung in Form von Platzstürmungen,
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
21
Schlägereien und Angriffen auf die Akteure auf dem Spielfeld (Dunning, Murphy und
Williams, 1988: 32).
Die Forcierung der Gewalt erfolgt dort bereits in den 60er Jahren durch erhöhtes Aufkommen
von jugendlichen Gästefans in den Stadien und bekommt durch die in den 70er Jahren
aufkommenden ,,Skinheads"
5
eine neue Qualität. Provokationen und Politisierung lassen die
Gewalt in und um die englischen Stadien deutlich zunehmen, was auch zu sinkenden
Zuschauerzahlen führt. In den 80er Jahren kommt es zu einer Verschärfung durch so genannte
,,Casuals", die sich durch grundsätzliche Bereitschaft und Bekenntnis zu körperlicher Gewalt
kennzeichnen, häufig in größeren Gruppen auftreten und besonders an öffentlicher
Berichterstattung ihrer Aktionen Interesse zeigen. Diese sind auch für die schlimmsten
Ausschreitungen mit hunderten Toten und Verletzten im ,,englischen Krisenjahr 1985"
mitverantwortlich. Seitdem haben massive Sicherheitsmaßnahmen und eine Veränderung der
Polizeitaktik in England Einzug gehalten, um dieses Gewaltphänomen zu bekämpfen (Ek,
1996: 34f).
In Deutschland wird der Hooliganismus seit den 70er Jahren für die Gesellschaft zu einem
zunehmend beachteten Problem. Zu diesem Zeitpunkt sondern sich jugendliche Fußballfans
nach außen hin deutlich erkennbar in Stadionblöcken von anderen Stadionbesuchern ab und
fallen durch Krawalle auf. Von der Entwicklung in Großbritannien vorangetrieben, die als
Vorbild für das eigene Auftreten dient, identifizieren sich viele Jugendliche mit ihrem
Ortsverein und zeigen ihre Gefolgschaft mit dem Tragen von Schals und mit Emblemen
bestickten Jeansjacken (,,Kutten"), die oftmals den Schriftzug eines Fanklubs tragen. Die
Mitgliedschaft in einem Fanklub ist für die Jugendlichen besonders mit Halt und
Geborgenheit innerhalb einer Gemeinschaft von Gleichaltrigen zu begründen. Der
Vereinsbezug gibt Möglichkeit zur Identifikation. Vermehrtes Begleiten der Auswärtsspiele
favorisierter Mannschaften ist an der Tagesordnung und im gleichen Zuge eine erhöhte
Auseinandersetzung mit Fans der Heimmannschaften, die sich in ihrem Territorium durch
Schmähgesänge etc. provoziert fühlen (Becker und Pilz, 1988: 92).
Ende der 70er Jahre nimmt die Gewalt deutlich zu. Bei den von Hooligans begangenen
Straftaten handelt es sich zumeist um Körperverletzungen, Widerstand gegen die
Staatsgewalt, Sachbeschädigung, Beleidigung und Diebstahl. Die deutsche Polizei bedient
sich ähnlich wie in Großbritannien repressiver Gegenmaßnahmen wie strikter Blocktrennung,
Videoüberwachung, Einsatz von Zivilbeamten und verstärkter Einlasskontrollen sowie die
Möglichkeit von Stadionverboten. Was folgt ist ein Rückgang der Gewalt in den Stadien und
5
Glatzköpfige jugendliche Mitglieder aus einer zumeist traditionellen Arbeiterschaft einer bestimmten Stadt, die
den Fußball zu ihrer bevorzugten Darstellungsbühne machten, zumeist an Kleidung und Auftreten erkennbar.
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
22
eine Verlagerung der Randale in die Innenstädte. Bei ihren Ermittlungsverfahren werden die
Beamten mit dem Problem konfrontiert, dass selten mit Anzeigen oder Hilfsbereitschaft von
Seiten der Fangruppierungen zu rechnen ist, vielmehr versuchen sich die Fans beim nächsten
Aufeinandertreffen der beiden Vereine selbst zu rächen (Ek, 1996: 64f).
Ähnlich wie in England geht die Zeit der rockerartigen Fanklubs auch in Deutschland zu
Ende, und an ihre Stelle treten mit einiger Verzögerung die Skinheads und
,,Bomberjackenträger". Dabei muss festgehalten werden, dass die rechtsradikalen Tendenzen
innerhalb dieser Fanszene Anfang der 80er Jahre bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich
der Provokation dienen, und keine Hinweise auf organisierte rechtsextreme Gruppen
innerhalb der Hooliganszene bzw. tief verwurzeltes rechtsradikales Gedankengut vorhanden
ist (König, 2002: 80f).
Ab etwa 1982 kommt es zu einer für die weitere Entwicklung entscheidenden Trennung der
Fanszene in ,,friedliche" und sich zur Gewalt bekennenden Fans. ,,Zu diesem Zeitpunkt
spalten sich die gewaltbereiten Fans aus dem Kreis der fußballzentrierten Fans, den sog.
Kuttenträgern ab" (Buderus, 2001: 181). Die einstellungsbedingte Trennung ist auf das
ausdrückliche Bekenntnis zur Gewalt bei den Hooligans zurückzuführen. Schlägereien
zwischen den Hooligangruppen sind nicht mehr Begleiterscheinung des Fußballwochenendes
mit Spiel- und Stadionbezug, sondern stellen nun das zentrale anzustrebende Ziel des
Spielbesuchs dar (Ek, 1996: 70).
Daneben entledigen sich die Hooligans ihrer Fanutensilien, da sie einerseits als quasi zivile
Zuschauer vor der Polizei unerkannt bleiben wollen, und andererseits um sich von den
Kuttenträgern mit ihrem Image als ,,Asoziale" zu distanzieren. Zudem ziehen sich die ,,Hools"
aus den Fankurven zurück und bevorzugten Sitzplätze als eigenen Treffpunkt, auch um sich
der Ausgrenzungs- und Überwachungstaktik der Polizei zu entziehen (König, 2002: 82).
Zudem schließen sich die deutschen Hooligans vermehrt zu eigenen Gruppen, auch ,,Firms"
oder ,,Crews" genannt, zusammen, und geben sich teils martialische Namen
6
(Wiedemann,
1986: 19). Die beteiligten Mitglieder sollen sich mit dem Gruppennamen identifizieren und
die Gruppe zur Erhöhung des Rufes bei Schlägereien mit anderen Jugendlichen ehrenvoll
repräsentieren. Denn die Verbesserung des Rufes kann ein Aufsteigen in den Hooligan
internen Ranglisten
7
bewirken (Pilz und Becker, 1988: 90). Für Neueinsteiger gilt, sich durch
6
Namen wie ,,Destroyers" aus Karlsruhe, ,,Sturmtruppe" aus Mönchengladbach oder ,,Red Devils" aus Nürnberg
(Gehrmann, 1998: 99).
7
Zumeist wurden die Ranglisten von Hooligans aus Nürnberg oder Schalke angeführt. Auch Gruppen aus
Düsseldorf, Essen, Karlsruhe, München, Köln, Berlin und Hamburg verfügten in den 80er Jahren ebenfalls über
ein hohes Ansehen in der Hooliganszene (Gehrmann, 1998: 99).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
23
Taten und das Beweisen von Zuverlässigkeit in heiklen Situationen einen Namen in der
Gruppe zu machen und dadurch Prestige zu erwerben (Ek, 1996: 72f).
Einzelne Hooligangruppen bestehen zumeist aus 10-15 Personen, die sich am Spieltag zu
einem wesentlich größeren Mob zusammenschließen können. Die Zusammensetzung der
Mobs ist, wenn überhaupt nach dem ,,beduin syndrom" (Dunning, 1999: 150) geordnet, d.h.
ein Freund eines Freundes ist ein Freund und der Feind eines Freundes ist auch mein Feind.
Es existieren freundschaftliche Verbindungen zwischen einzelnen Hooligan-Gruppen, so dass
bei Ausschreitungen Mobs bis zu über hundert Mann aufeinander treffen können. Auf
internationaler Ebene schließen sich bei Länderspielen nationale Mobs zusammen, auch wenn
sie sich Wochen zuvor, etwa bei einem Bundesligaspiel, noch kämpfend gegenüberstanden
(Meier, 2001: 61).
Die Gruppen selbst sind nicht streng hierarchisch strukturiert, vielmehr ist der Zeitaufwand,
der für die Gruppe geleistet wird von Bedeutung. Allerdings kann festgehalten werden, dass
die ,,Alten", den Neueinsteigern den Wertekatalog der Gruppe vorgeben. Das Wertesystem
hält sich im besonderen Maße an Normen der Männlichkeit (Kraft, Mut, Härte,
Durchsetzungsvermögen) (Buderus, 2001: 181). Die Gruppenstruktur von Hooligans ist mit
denen von Straßengangs vergleichbar. In beiden Fällen vermittelt die Mitgliedschaft einen
Sinn, der anderswo (Schule, Familie etc.) versagt wird. Beide bieten die Möglichkeit soziale
Anerkennung zu erreichen, beide Erlauben ein Abenteuererlebnis (Bausenwein, 1995: 317).
Das Gewalterlebnis soll jedoch nicht ungehemmt stattfinden, vielmehr gibt es von den
deutschen
Hooligans
selbst
entworfene
Verhaltensregeln
für
die
gewalttätigen
Auseinandersetzungen. Dieser so genannte Ehrenkodex beinhaltet:
-
den Verzicht und den Einsatz von Waffen, Schlägereien sollen nur mit Faustschlägen
und Fußtritten geführt werden,
-
das Nichtangreifen gegnerischer Hooligans, sofern diese entweder besiegt am Boden
liegen oder klar in Unterzahl sind,
-
Schlägereien werden zwischen zahlenmäßig gleichstarken Gruppen angestrebt,
-
Verzicht auf Anzeigen und auf Kooperation mit der Polizei,
-
Nichtbeeinträchtigung Unbeteiligter (Ek, 1996: 74f).
Der selbst gesetzte Ehrenkodex wird aber in der Realität oftmals nicht befolgt. So lassen sich
gerade in der Selbstdarstellung der Hooligans in ihren eigenen Publikationen
8
und
Mitschnitten, schwere Verstöße gegen den Kodex aufzeigen. Häufig ist der Einsatz von
8
Die Selbstdarstellung in eigenen Szenezeitschriften war für die Hooligans, genauso wie das Sammeln von
Zeitungsausschnitten und Videoaufzeichnungen über Ausschreitungen von großer Wichtigkeit, zum einen als
Beweis, zum anderen als erneutes ,,Miterleben".
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
24
Leuchtkugeln, Steinen, Gürteln, Zaunlatten, Baseballschlägern, Billardkugeln und Messern
beschrieben (Ek, 1996: 75). In anderen Ländern, wie etwa in England oder Italien scheint
dieser Kodex ohnehin nicht zu existieren, auch nicht bei Hooligans aus den Neuen
Bundesländern.
3.4.2 Ost-West-Vergleich und neuere Entwicklungen
Parallel zur westdeutschen Hooliganszene entwickelt sich in der DDR Oberliga eine rege
Subkultur der Gewalt. Die Spitzenklubs des Ostens kommen meistens von der Polizei oder
Armee, d.h. sportliche Karrieren sind oft mit der Zusammenarbeit mit den Staatsorganen
verknüpft. Solche Vereine sind etwa der BFC Dynamo Berlin, Lokomotive Leipzig oder die
SG Dynamo Dresden. In der Bevölkerung sind allerdings die Arbeiter und Traditionsvereine
(BSG-Clubs), die sich rund um Großbetriebe bilden (Chemie Leipzig, Wismut Aue,
Sachsenring Zwickau) weitaus beliebter als die ,,zusammengestellten" oftmals übermächtigen
Mannschaften der Staatsorgane (Weigelt, 2004: 34).
So bekommt der Fußball in der DDR früh eine politische Komponente und wird zum
symbolischen Machtkampf zwischen ,,oben" und ,,unten". Unter dem Denkmantel des Sports
und aus der sicheren Masse heraus können auch politische Meinungen geäußert werden. So
versammelt sich um die BSG Vereine ein spezielles Protestpotential, das zwangsweise auch
gewollt zur Konfrontation gegen staatliche Organe und ihre repräsentierten Fußballklubs ins
Felde zieht. Gleichzeitig entwickelt sich in der DDR Ende der 70er Jahre eine Jugendkultur,
die sich von der staatlichen Jugendpolitik nichts mehr vormachen lassen will. Subkulturen
wie ,,Skinheads" und ,,Punks" entstehen ebenso wie im Westen Deutschlands. Viele dieser
Jugendlichen schließen sich BSG-Fanclubs an, da sie im Schutz der Masse ihren Protest
äußern können. Jedoch bleibt es nicht beim verbalen Protest. Es kommt zu Ausschreitungen
in den Stadien und gewalttätige Flügel einzelner Fanclubs prügeln sich untereinander,
besonders BSG-Vereinsanhänger gegen Anhänger von den ,,staatlichen" Klubs.
Der Staat selbst reagiert mit steigenden Sicherheitsvorkehrungen, was zur Folge hat, dass sich
Randale immer mehr auf dem Weg zum Stadion ereignen. Dabei gibt es bei
Auseinandersetzungen mit der Polizei auch Todesfälle, die vom Staatsapparat verschwiegen
werden. Die Stasi schaltet sich ein und Spitzel werden unter die Fans geschleust. Die
Zersetzung der BSG-Fanklubs gelingt jedoch nicht. Ab Mitte der 80er Jahre setzt ein
Deeskalationskurs der Polizei ein. Man ignoriert Schlägereien, Provokation etc. und kümmert
sich mehr um den reibungslosen An- und Abtransport der Fans. Dadurch entsteht ein
Freiraum für Fußballfans, der Neueinsteiger anzieht und dazu motiviert die Toleranzgrenze
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
25
der Behörden weiter auszureizen. Hooligans von SED-nahen Vereinen sehen sich ohnehin nur
wenig Repressionen ausgesetzt, was dazu führt, ,,dass sich in den Stasi-Clubs in aller Ruhe
rechtsextremistische und militaristische Züge entfalten können, die sich bald beim BFC
Dynamo (...) zu einer gut organisierten Elite unter den Hooligans entwickelte" (Weigelt,
2004: 37).
Ende der 80er Jahre geraten die militanten Subkulturen, wie die Skinhead-Kultur, völlig außer
Kontrolle. Der sich auflösende DDR-Staatsapparat kann die verschiedenen Subkulturen weder
identifizieren noch einordnen. Bei Konfrontation wird vom Staat mit Gewalt geantwortet.
Politische, rassistische und neofaschistische Straftaten werden unter Rowdytum verbucht. Das
Skinoutfit wird im Osten zur Jugendmode und bei vielen Fans verfestigen sich neonazistische
Symboliken und Gedanken (Pilz et al, 2006: 21).
Anfang der 90er Jahre im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands treffen Hooligans aus
Ost- und Westdeutschland aufeinander. Alte Feindschaften im Osten bleiben weiterhin
bestehen. Viele Ost-Klubs verschwinden wegen finanzieller Probleme und daraus
resultierenden Spielerabwanderungen in die 3. und 4. Liga des Amateurfußballs. Einzig der
harte Kern der Fans von einst bleibt diesen Vereinen erhalten. Daher sind manche dieser Ost-
Vereine heute noch besonders berüchtigt, weil nach wie vor ein hoher prozentualer Anteil an
gewaltbereiten Fans vorhanden ist. So gibt es Schätzungen, dass der BFC Dynamo Berlin
insgesamt über eine feste Fangemeinde von ca. 600 Fans verfügt, davon werden ca. 500 als
Kategorie C-Fans eingestuft (Weigelt, 2004: 37f).
Kurz nach der Wende im Herbst 1990 kommt es zum Höhepunkt des Hooliganismus in den
Neuen Bundesländern. Im Anschluss an das Freundschaftsspiel VfB Leipzig (ehemals Lok
Leipzig) gegen Bayern München werden in der Innenstadt Leipzigs Polizeibeamte von
Hooligans angegriffen. Ein ziviler Beamter sieht die Notwendigkeit von der Schusswaffe
Gebrauch zu machen und verletzt einen Angreifer aus kurzer Distanz mit einem
Oberschenkeldurchschuss. Der Hooliganismus hatte mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht,
dass Beamte erstmals von der Schusswaffe Gebrauch machten. Zwei Monate später am 3.
November kommt es anlässlich des Spiels FC Sachsen Leipzig (ehemals BSG Chemie
Leipzig) gegen den FC Berlin (ehemals BFC Dynamo Berlin, der Name wurde später wieder
aufgegriffen) erneut zu Krawallen. Polizisten eröffneten das Feuer auf angreifende Berliner
Hooligans. 15 Angreifer werden verletzt, während der 18-jährige Berliner Mike Polley noch
am Ort seinen Verletzungen erliegt. Er ist der erste von der Polizei Getötete im Rahmen eines
Fußballspiels in Deutschland (Ek, 1996: 110).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
26
Kurz nach der Wiedervereinigung wird westdeutschen Hooligans schnell klar, wie viel
Hasspotential bei ostdeutschen Hooligans vorhanden ist. Jahrelang hatten die Jugendlichen
versucht, gegen das System zu opponieren und waren drakonischen Strafen, Denunzianten
und Ausweisungen durch die Stasi ausgesetzt (Weigelt, 2004: 38). Die Übergriffe gegen
Ausländer und der vermehrte Gebrauch von Waffen führen daneben zu kritischen Reaktionen
von Hooligans in den Alten Bundesländern. Denn die gewachsene unpolitische Einstellung
und die Mitgliedschaft von Ausländern in westlichen Gruppen stehen im Gegensatz zu den
Verhaltensweisen vieler Hooligans in den neuen Ländern (Ek, 1996:115).
Nach und nach findet jedoch eine Angleichung der beiden Szenen statt und es entstehen gar
Freundschaften unter gewaltbereiten Gruppen. Allerdings sind besonders viele ostdeutsche
Hooligangruppen nach wie vor für ihre extreme Brutalität bekannt (Gehrmann und Schneider,
1998: 251f). Die grundlegenden Unterschiede zwischen Ost und West, die nach wie vor
bestehen, seien hier kurz angesprochen:
- Der Zusammenhalt der ostdeutschen Hooligangruppen ist stärker als im Westen.
Reliquien aus DDR Zeiten, denn damals achtete man sehr auf Zuverlässigkeit der
Mitglieder, war man doch ständigen Bespitzelungen und Infiltrationen durch die Stasi
ausgesetzt.
-
Jugendliche in der DDR werden früh mit Kampftechniken vertraut gemacht. In
Schulen gibt es wehrkundliche Gruppen und in den Betrieben Kampfgruppen zur
Steigerung der Wehrfähigkeit. Es entwickelt sich bei den Ost-Hools schnell eine
paramilitärische Intelligenz, die sich bei Fußballauseinandersetzungen nutzen lässt.
-
Die Disziplinierung ist höher als im Westen. Seltener kommt es vor, dass bei
Ausschreitungen zunächst ein großer Mob loszieht und später wenn es ernst wird nur
noch die wenigsten da sind (wie etwa bei West-Gruppen).
-
Bei Ost-Hools herrscht ein viel stärkeres Aggressionsverhältnis gegenüber der Polizei
durch die starken Repressionen zu Ost-Zeiten. Sehr kritisch geht man im Osten auch
mit szenekundigen Polizeibeamten in Zivil um, die die Fans in die Fanblöcke
begleiten, da diese Beamten Erinnerungen an ehemalige Stasi-Spitzel hervorrufen
(Weigelt, 2004: 39).
Trotz dieser Unterschiede kann man mittlerweile von einer gesamtdeutschen Szene der
Hooligans sprechen. Hooliganmobs, also Zusammenschlüsse von Gewalt suchenden
Zuschauern, sind in Ost und West heterogene Gruppen. Darin finden sich Arbeitslose,
Lehrlinge, Angestellte oder Studenten, sowie Jugendliche von 14 Jahren oder berufstätige
Familienväter mit 30 Jahren (Meier, 2001: 59f).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
27
Die Gewaltbereitschaft von Hooligans ist seit Mitte der 90er Jahre noch angestiegen. So
beschreibt Pilz (1993) einen Trend, dass die neueren Hooligans (,,Jung-Hools") das
fußballzentrierte Fandasein überspringen und sich direkt bei den Hooligans eingliedern.
Dementsprechend entwickelt sich zuletzt eine zunehmend jüngere Hooligan-Szene, die auch
weniger Beziehungen zum Fußball hat (Pilz, 1993: 71f).
Jüngere Hooligans gehen auch eher zu einem Spiel, wo sie wissen, dass es ,,Action" gibt,
auch wenn nicht der Heimatverein spielt. Experten schätzen die Jung-Hools am gefährlichsten
und unberechenbarsten ein, da sie sich nicht an den Ehrenkodex halten. Sie benutzen Waffen
und schlagen auf beteiligte Personen ein, die schon am Boden liegen. Ein genereller Verfall
des Ehrenkodex ist die Folge und schwere Verletzungen, gar Todesfälle gehören immer mehr
zur Tagesordnung. Zudem spüren die Jungen innerhalb der Gruppe einen Profilierungsdruck,
weshalb sie besonders skrupellos sind und bei gewalttätigen Auseinandersetzungen häufig in
der ersten Reihe stehen.
Allerdings stagniert mittlerweile die Quantität der Auseinandersetzungen in und um das
Stadion am Spieltag. Denn wegen der engeren Überwachung der Polizei kommt es anstelle
von spontanen ,,Fights" immer mehr zu abgesprochen Auseinandersetzungen (Lösel et al,
2001: 147). Bei diesen so genannten ,,Drittortauseinandersetzungen" von Hooligans spielt
immer häufiger die Nutzung von elektronischen Kommunikationsmitteln eine entscheidende
Rolle, wie etwa Handy oder Internet um Treffpunkte zu vereinbaren. Dieser
,,Gewalttourismus" wird völlig unabhängig von Spieltagen oder fußballerischen Ereignissen
veranschlagt. Außerdem entwickeln sich die Ausschreitungen immer mehr zu den weniger
gesicherten Stadien der 3. und 4. Liga. Hier suchen die ,,Hools" vermehrt die Konfrontation
mit der Polizei, aber meist nur dort, wo die Ordnungshüter ihnen zahlenmäßig nicht überlegen
sind (Weigelt, 2004: 41). Dazu verbünden sich speziell im Osten gar verfeindete
Hooligangruppen, um gemeinsam die Polizei zu attackieren.
Vermehrt wird neben dem Einsatz von ,,üblichen" Drogen, wie Amphetamine und Kokain,
auch das rezeptpflichtige Medikament ,,Tilidin" unter Hooligans verwendet. Tilidin
euphorisiert, nimmt die Angst und den Schmerz nach körperlichen Auseinandersetzungen.
Polizeibeamte, die mit Tilidin-Konsumenten zu tun hatten, berichten: ,,Wer Tilidin geschluckt
hat, wehrt sich bei der Festnahme wie ein Berserker er tritt, beißt, spuckt und reagiert nicht
mal auf Pfefferspray" (Kaspar, 2008).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
28
4. Zuschauergewalt im sozialen System Fußball
Um Zuschauergewalt verstehen zu können, muss sie in einen Gesamtzusammenhang
eingeordnet werden. Nach Kübert und Neumann (1994) herrschen die verschiedensten
Wechselbeziehungen und Interaktionen im so genannten ,,sozialen System Fußball" (siehe
Grafik 1). Ein soziales System mit vier Subsystemen liegt vor, die nicht isoliert voneinander
betrachtet werden können, sondern interagieren und in gegenseitigen Abhängigkeiten
zueinander stehen. Arten und Formen der Interaktion und die aus ihnen erwachsenen
Erwartungen werden dabei in Bezug auf das Verhalten mit beeinflusst (Fröhlich, 1987: 314;
zitiert nach Kübert und Neumann, 1994: 45).
Grafik1: Das Modell der Wechselbeziehungen im sozialen System Fußball
Demnach ist das Verhalten der Zuschauer nicht autark, sondern vielmehr spielen
Wechselbeziehungen mit Medien, Vereinen, Verbänden und mit präventiven Maßnahmen der
Ordnungskräfte eine Rolle bei der Analyse von Gewalt. Diese Wechselbeziehungen haben
mitunter zur Folge, dass sich Fans in Initiativen und Fan-Projekten neu organisieren, auch um
Repressionen in diesem sozialen System entgegenzuwirken und um mehr Lobby und
Mitspracherecht gegenüber den anderen Subsystemen zu erlangen.
Fußballpublikum
(Kunden, Konsumenten,
Fans, Ultras, Hooligans)
Medien
(Fernsehen, Hörfunk,
Print, Internet)
Ordnungskräfte
(Polizei, Ordner- und
Sicherheitsdienste)
Vereine
(Spieler, Trainer,
Funktionäre, Führung)
6.
5.
1.
2.
3.
4.
Quelle: Kübert & Neumann, 1994: 45
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
29
4.1 Das Interesse der Medien
Das Verhältnis von Publikum und Medien im Bereich des kommerzialisierten, professionellen
Fußballsports ist eingebettet in ein komplexes Beziehungsgeflecht. Das Subsystem Medien
umfasst im Zusammenhang mit dieser Untersuchung vor allem die Massenmedien, wie etwa
das Fernsehen, Hörfunk, Print, und seit einigen Jahren das Internet.
Die Beziehungen der Medien auf das Publikum lassen sich anhand von Beispielen aufzeigen.
Das Fußballpublikum wirkt etwa auf die Medien (Pfeil Nummer 1. in Grafik 1) indem es im
Stadion für Stimmung sorgt, die eigene Mannschaft unterstützt, mit ihr jubelt und trauert. Es
trägt auch durch bestimmte Handlungen dazu bei, das Interesse der Medien zu wecken und
bietet ihnen damit Inhalte für die Berichterstattung. Dazu zählen neben dem zur Schau stellen
von Fahnen, Choreographien und Gesängen in den Fanblöcken, auch Aggressionen und
gewalttätiges Verhalten der Zuschauer (Kübert und Neumann, 1994: 48).
4.1.1 Die Rolle der Berichterstattung
Der Rolle der Massenmedien in Bezug auf aggressives Verhalten der Zuschauer wird in der
sozialwissenschaftlichen Literatur mittlerweile zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet, so
auch in den Versuchen der Beschreibung und Analyse des Publikumsverhaltens. Natürlich
können Medien nicht generell für Zuschauerausschreitungen verantwortlich gemacht werden.
So analysiert Pilz (1994): ,,Die Medien sind nicht die Ursache für Gewalt in unserer
Gesellschaft, sie liefern aber sehr wohl das Schmieröl im (Eskalations-) Prozess der
Entwicklung von Gewalt" (Pilz, 1994: 76).
Schon in den 60er Jahren in England hatten spezielle ,,Randale-Reporter" dafür gesorgt, dass
in der Öffentlichkeit ein Bild der permanenten Gewaltbereitschaft im Umfeld von
Fußballspielen entstehen konnte. Viele Zeitungen in England druckten neben der normalen
Tabelle die Rangfolge in der ,,Gewaltliga" ab, in der Punkte für die Gewalttätigkeit der
jeweiligen Fangruppen der Vereine verteilt wurden. ,,Vieles spricht dafür, dass sich im
aufkeimenden Hooliganismus das Interesse der Medien an einer sensationsheischenden
Berichterstattung und der Wunsch gewaltbereiter Gruppen nach einem Forum der
Selbstdarstellung, in dem sie sich öffentlich mit einem gewissen Stolz präsentieren konnten,
wechselseitig ergänzten" (Bausenwein, 1995: 316).
Die Interdependenz zwischen Publikum und Medien bezieht sich somit allzu häufig auf
Gewalt, denn Fans informieren sich natürlich aus den Massenmedien (siehe Pfeil Nummer 2
in Grafik 1) über Spiele, den Verein, das Umfeld und damit letztlich auch über sich selbst
bzw. das von ihnen in der Öffentlichkeit verbreitete Bild (Kübert und Neumann, 1994: 48).
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
30
Hinzu kommt, dass das Fernsehen radikal das Wesen der unmittelbaren Fußballsubkultur
veränderte, indem es deren Bedeutung auf ein Massenpublikum ausweitete und verwässerte.
Die generelle Rechtfertigung, dass sich durch so viele Fußballübertragungen viel mehr
Menschen für Fußball interessieren würden, ist nicht von der Hand zu weisen. Dennoch
ähnelt es weniger einer aktiven Teilnahme an der Schaffung und Ausformung von
Bedeutungen des Fußballs, sondern weit eher dem Konsum einer Ware in Medienverpackung.
Denn das Fernsehen präsentiert ein Spiel nie so, wie es der Zuschauer im Stadion gesehen
hätte (Critcher, 1979: 158f). Die mediale Inszenierung des professionellen Sports lehnt sich
also immer enger an den Modus der Unterhaltung an und stimuliert eine fortlaufende Suche
nach noch attraktiveren Präsentationsformen, noch heldenhafteren Protagonisten sowie noch
nie gesendeten Bildern (Schwier und Schauerte, 2008: 112). Randnotizen wie Gewalttätigkeit
einiger Zuschauer werden oftmals in den Mittelpunkt der Berichterstattung gestellt, für ein
Massenpublikum aufbereitet und den Rezipienten damit oftmals ein falsches Bild der Realität
vermittelt.
Die deutschen Medien nehmen sich des Phänomens der Zuschauerausschreitungen verstärkt
Anfang der 80er Jahre an. Besonders der gewaltsame Tod des Bremer Fans Adrian Maleika
bei einer Steinschlacht mit Hamburger Fußballrowdys im Jahre 1982 erfährt große
Aufmerksamkeit. Hintergrundberichte über Gewalt in deutschen Fußballstadien werden
vermehrt ausgestrahlt, meist unter Berücksichtigung der Gruppe ,Hamburger Löwen', die
offenkundig für die damalige Massenschlägerei mit Todesfolge verantwortlich war. Dies führt
zu einem bestimmten Ruf und einem Ansehen in der entsprechenden Fanklubszene, in der
unbekanntere Gruppen versuchen, ähnlich ,,öffentlichkeitswirksame" Gewaltauftritte zu
inszenieren, um dadurch ihre Bekanntheit und das Ansehen in der Hooliganszene zu steigern
(König, 2002: 80). ,,Durch diese Inszenierung der Massenmedien der Fußballgewalt als
skandalträchtige Medienereignisse wird den prügelnden Hooligans gerade die Identifikation
und Aufmerksamkeit vermittelt, die sie suchen, auf die sie in der Szene stolz verweisen
können und die ihnen anderswo versagt bleibt. Dadurch spielt die Berichterstattung auch ein
wesentliche Rolle in der Gewalteskalation" (Esser und Dominikowski, 1993: 17).
Doch nicht nur die Berichterstattung über Fangewalt sondern auch die Einstellung der
Massenmedien zum Spielgeschehen, schaffen die Bedingungen für aggressives Verhalten von
,,normalen" Zuschauern durch das Hochstilisieren von Wettkämpfen zu wichtigen
Ereignissen, wie etwa ein Derby von benachbarten Mannschaften. Dadurch fördern sie die
Bereitschaft der Zuschauer zu Identifikation, schaffen aber gleichzeitig die Voraussetzung
dafür, ,,dass Niederlagen als schwerwiegende Frustrationen erlebt, aggressive Reaktionen
Gestörtes Verhältnis zwischen Fans und Polizei?
31
provoziert und Spielgegner als tatsächliche Feinde erlebt werden" (Volkamer, 1975; zitiert
nach Pilz, 1979: 178).
Kommt es dann zu auftretender Gewalttätigkeit wird diese von den Medien im Nachhinein in
einer Form von moralischer Entrüstung aufgearbeitet. Einige Vorfälle Mitte der 90er Jahre
verstärken die Berichterstattung über so genannte ,,Störenfriede" in den deutschen Stadien.
Dabei existieren die Fans in dieser mitunter eindimensionalen Wahrnehmung für die Medien
häufig nicht als eigenständige Subkultur, sondern vielmehr als Randalierer, Säufer oder zum
Teil als Neonazis eben schlichtweg als Problemgruppe. Denn in erster Linie gehören Fans
im Spektakel Fußball zum Mittel der medialen Vermarktung: Lautstarke Stimmungskulissen
im Hintergrund sollen dem Fernsehzuschauer auf dem Sofa suggerieren, wie viel Emotionen
und Aggression in dem jeweiligen Spiel stecken. In dieser Gestalt sind Bilder der Fans
verwertbar und die Zuschauer im Stadion bekommen auf jene Weise Sendeminuten
eingeräumt. Aktionen, Initiativen oder Vorfälle, die nicht in dieses Schema passen, finden in
den seltensten Fällen statt (BAFF, 2004: 174).
Ein prägnantes Beispiel veranschaulicht die belastete Wechselbeziehung zwischen Fans und
Medien: Bilder von brennenden Bengalfackeln in den Fanblöcken lassen viele Fernseh- und
Radioreporter von ,,südländischer Begeisterung" schwärmen, und dies hat man es ins
Fernsehen geschafft animiert natürlich viele Fangruppen, es ebenso zu versuchen sich
öffentlich mit solchen Mitteln zu positionieren. Jedoch verstoßen diese Bengalfackeln in
Deutschland gegen die Stadionordnung. Holt dann die Polizei denjenigen aus dem Block, der
diesen Feuerwerkskörper zündete, mutiert dieser gerade noch südländischen Esprit
verströmende Fan für die Medien zu einem ,,gefährlichen Krawallmacher, der unseren Sport
kaputt macht" (BAFF, 2004: 176).
Die Massenmedien kreieren also ein Konstrukt des ,,gefährlichen Fans" in der Öffentlichkeit.
Eventuelle Kritik an unverhältnismäßigem Einschreiten der Polizei findet in der breiten
Medienlandschaft so gut wie nicht statt. Aggressionen werden fast einzig von Fanseite
dokumentiert. Darüber hinaus führt der gesellschaftliche Stellenwert des Fußballs als
Massenware durch die Vermarktung der Vereine und Verbände zu einer Ökonomisierung und
Spektakulisierung in seiner Berichterstattung: Werbung auf Trikots und Banden, eingespielte
Verkaufsangebote via Leinwände alles zusammen mit ,,Traumtoren" vom Fernsehen in
Szene gesetzt verstört mittlerweile viele fußballzentrierte Anhänger, die entgegen dem
Interesse weiter Teile der Medienlandschaft, die Vereinstradition und das Spiel selbst wieder
stärker in den Mittelpunkt stellen wollen, und dabei weniger das inszenierte Event abseits des
Spielgeschehens (Stauff, 2007: 299).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2009
- ISBN (eBook)
- 9783836630078
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- fußball zuschauergewalt hooligans gewaltbereitschaft polizei
- Produktsicherheit
- Diplom.de