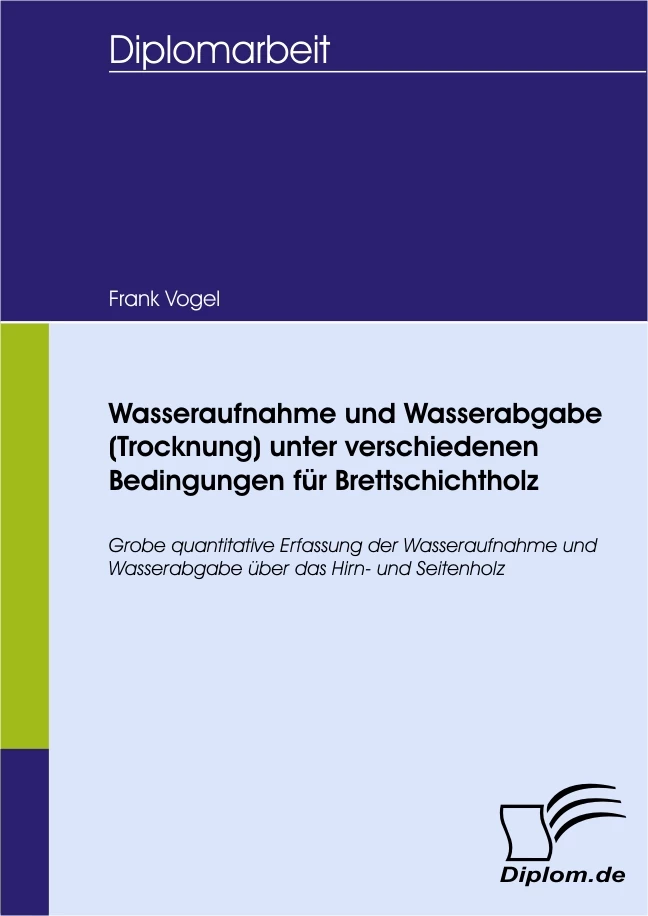Wasseraufnahme und Wasserabgabe (Trocknung) unter verschiedenen Bedingungen für Brettschichtholz
Grobe quantitative Erfassung der Wasseraufnahme und Wasserabgabe über das Hirn- und Seitenholz
©2008
Diplomarbeit
218 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist zu klären, ob die nach VOB § 4 #5 verlangten Schutzmaßnahmen gegen Niederschlagswasser ausreichend sind.
Des weiteren soll diese Arbeit die Frage beantworten, ob große Holzquerschnitte in Konstruktionen, die der Nutzungsklasse 2 zuzuordnen sind mit einem geeigneten Hirnholz- und Seitenholzschutz gegen eine übermäßige Feuchteauf- und Feuchteabgabe geschützt werden können.
Dazu wurden 17 Versuche durchgeführt. Dabei wurden Leimhölzer mit den Abmessungen 0,30 x 0,32 x 1,50 m als Probekörper verwendet. Die Versuche unterteilten sich in 3 große Serien. Der erste Teilbereich war eine einseitige Wassereinwirkung des Hirnholzes (mit und entgegen der Schwerkraft) oder des Seitenholzes. Im zweiten Abschnitt wurden die Probekörper vollständig (sechsseitig) befeuchtet. Im dritten Bereich wurden die Probekörper bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt über 23 Massenprozent gewässert, teilweise mit Imprägnierungen behandelt oder mit Klemmungen versehen und anschließend in einer Trockenkammer in einem Zeitraum von vier Tagen getrocknet.
Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass auf einen wirksamen Holzschutz bei einer Wassereinwirkung oder bei der Trocknung nicht verzichtet werden darf. Die Wasseraufnahmekoeffizienten der imprägnierten Prüfkörper lagen teilweise sogar sehr deutlich unter den Wasseraufnahmekoeffizienten der ungeschützten Prüfkörper.
Weiterhin konnte mit den Versuchen aufgezeigt werden, dass rund 25 % des Feuchtigkeitshaushaltes des Holzes über das Seitenholz getätigt wird. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes7
1.1Erläuterung der relevanten Begriffe7
1.1.1Holzfeuchtigkeit7
1.1.2Wassereindringkoeffizient8
1.1.3Wasseraufnahmekoeffizient10
1.1.4Sorption11
1.1.5Trocknung14
1.2Berechnungsmethoden15
1.2.1Wassereindringkoeffizient15
1.2.2Wasseraufnahmekoeffizient17
2.Versuche19
2.1Vorversuche22
2.1.1Vorversuch mit Imprägnierung23
2.1.2Vorversuch ohne Imprägnierung24
2.1.3Auswertung26
2.2Versuche mit stehenden Prüfkörpern27
2.2.1Versuch 1, Wasseraufnahme über unteres ungeschütztes Hirnholz27
2.2.2Versuch 2, Wasseraufnahme über oberes ungeschütztes Hirnholz35
2.2.3Versuch 3, Wasseraufnahme über unteres geschütztes Hirnholz41
2.2.4Versuch 4, Wasseraufnahme über unteres geklemmtes Hirnholz45
2.2.5Auswertung50
2.3Versuche mit liegend angeordneten Prüfkörpern und einseitiger Wasseraufnahme54
2.3.1Versuch 5, einseitige Wasseraufnahme über […]
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist zu klären, ob die nach VOB § 4 #5 verlangten Schutzmaßnahmen gegen Niederschlagswasser ausreichend sind.
Des weiteren soll diese Arbeit die Frage beantworten, ob große Holzquerschnitte in Konstruktionen, die der Nutzungsklasse 2 zuzuordnen sind mit einem geeigneten Hirnholz- und Seitenholzschutz gegen eine übermäßige Feuchteauf- und Feuchteabgabe geschützt werden können.
Dazu wurden 17 Versuche durchgeführt. Dabei wurden Leimhölzer mit den Abmessungen 0,30 x 0,32 x 1,50 m als Probekörper verwendet. Die Versuche unterteilten sich in 3 große Serien. Der erste Teilbereich war eine einseitige Wassereinwirkung des Hirnholzes (mit und entgegen der Schwerkraft) oder des Seitenholzes. Im zweiten Abschnitt wurden die Probekörper vollständig (sechsseitig) befeuchtet. Im dritten Bereich wurden die Probekörper bis auf einen Feuchtigkeitsgehalt über 23 Massenprozent gewässert, teilweise mit Imprägnierungen behandelt oder mit Klemmungen versehen und anschließend in einer Trockenkammer in einem Zeitraum von vier Tagen getrocknet.
Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass auf einen wirksamen Holzschutz bei einer Wassereinwirkung oder bei der Trocknung nicht verzichtet werden darf. Die Wasseraufnahmekoeffizienten der imprägnierten Prüfkörper lagen teilweise sogar sehr deutlich unter den Wasseraufnahmekoeffizienten der ungeschützten Prüfkörper.
Weiterhin konnte mit den Versuchen aufgezeigt werden, dass rund 25 % des Feuchtigkeitshaushaltes des Holzes über das Seitenholz getätigt wird. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes7
1.1Erläuterung der relevanten Begriffe7
1.1.1Holzfeuchtigkeit7
1.1.2Wassereindringkoeffizient8
1.1.3Wasseraufnahmekoeffizient10
1.1.4Sorption11
1.1.5Trocknung14
1.2Berechnungsmethoden15
1.2.1Wassereindringkoeffizient15
1.2.2Wasseraufnahmekoeffizient17
2.Versuche19
2.1Vorversuche22
2.1.1Vorversuch mit Imprägnierung23
2.1.2Vorversuch ohne Imprägnierung24
2.1.3Auswertung26
2.2Versuche mit stehenden Prüfkörpern27
2.2.1Versuch 1, Wasseraufnahme über unteres ungeschütztes Hirnholz27
2.2.2Versuch 2, Wasseraufnahme über oberes ungeschütztes Hirnholz35
2.2.3Versuch 3, Wasseraufnahme über unteres geschütztes Hirnholz41
2.2.4Versuch 4, Wasseraufnahme über unteres geklemmtes Hirnholz45
2.2.5Auswertung50
2.3Versuche mit liegend angeordneten Prüfkörpern und einseitiger Wasseraufnahme54
2.3.1Versuch 5, einseitige Wasseraufnahme über […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Frank Vogel
Wasseraufnahme und Wasserabgabe (Trocknung) unter verschiedenen Bedingungen für
Brettschichtholz
Grobe quantitative Erfassung der Wasseraufnahme und Wasserabgabe über das Hirn-
und Seitenholz
ISBN: 978-3-8366-3005-4
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Fachhochschule Deggendorf, Deggendorf, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
II
Vorwort
Als mir die Diplomarbeit angeboten wurde, war ich sofort bereit,
diese zu bearbeiten. Dieses Thema finde ich sehr interessant. Be-
sonders reizte mich, dass dieses Thema noch nicht genau in der
Fachliteratur beschrieben ist. Daher war es schwierig, die nötige Li-
teratur zu bekommen. Alle Bücher oder Skripten schreiben zwar ü-
ber dieses Thema, geben aber keine ausreichenden Aussagen über
die Geschwindigkeit und die genauen Mechanismen der Wasserauf-
nahme in Hölzern und besonders in Brettschichtholz.
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei den Mitarbeitern des
Labors des Fachbereiches bedanken, die mir immer bei Problemen
schnell und unkompliziert geholfen haben. Weiter möchte ich mich
bei den Mitarbeitern des Sägewerkes Ebner in Achslach für das zur
Verfügung stellen der Trockenkammer bedanken. Ohne die Trocken-
kammer hätten die Trocknungsversuche sicher sehr viel mehr Zeit in
Anspruch genommen. Besonders möchte ich mich aber bei Herrn
Dipl. Ing. Peter Bertsche für die hervorragende Betreuung der Dip-
lomarbeit bedanken.
Als letztes möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, die mich
während meines Studiums immer unterstützt hat.
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
III
Zusammenfassung
Das Ziel dieser Diplomarbeit ist zu klären, ob die nach VOB § 4 #5
verlangten Schutzmaßnahmen gegen Niederschlagswasser ausrei-
chend sind.
Des weiteren soll diese Arbeit die Frage beantworten, ob große
Holzquerschnitte in Konstruktionen, die der Nutzungsklasse 2 zuzu-
ordnen sind mit einem geeigneten Hirnholz- und Seitenholzschutz
gegen eine übermäßige Feuchteauf- und Feuchteabgabe geschützt
werden können.
Dazu wurden 17 Versuche durchgeführt. Dabei wurden Leimhölzer
mit den Abmessungen 0,30 x 0,32 x 1,50 m als Probekörper ver-
wendet. Die Versuche unterteilten sich in 3 große Serien. Der erste
Teilbereich war eine einseitige Wassereinwirkung des Hirnholzes
(mit und entgegen der Schwerkraft) oder des Seitenholzes. Im zwei-
ten Abschnitt wurden die Probekörper vollständig (sechsseitig) be-
feuchtet. Im dritten Bereich wurden die Probekörper bis auf einen
Feuchtigkeitsgehalt über 23 Massenprozent gewässert, teilweise mit
Imprägnierungen behandelt oder mit Klemmungen versehen und
anschließend in einer Trockenkammer in einem Zeitraum von vier
Tagen getrocknet.
Die Ergebnisse der Versuche zeigen, dass auf einen wirksamen
Holzschutz bei einer Wassereinwirkung oder bei der Trocknung nicht
verzichtet werden darf. Die Wasseraufnahmekoeffizienten der im-
prägnierten Prüfkörper lagen teilweise sogar sehr deutlich unter den
Wasseraufnahmekoeffizienten der ungeschützten Prüfkörper.
Weiterhin konnte mit den Versuchen aufgezeigt werden, dass rund
25 % des Feuchtigkeitshaushaltes des Holzes über das Seitenholz
getätigt wird.
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
IV
Inhaltsverzeichnis
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes ...7
1.1
Erläuterung der relevanten Begriffe ... 7
1.1.1 Holzfeuchtigkeit ... 7
1.1.2
Wassereindringkoeffizient ... 8
1.1.3 Wasseraufnahmekoeffizient... 10
1.1.4
Sorption ... 11
1.1.5
Trocknung ... 14
1.2
Berechnungsmethoden ... 15
1.2.1
Wassereindringkoeffizient ... 15
1.2.2
Wasseraufnahmekoeffizient... 17
2 Versuche... 19
2.1
Vorversuche... 22
2.1.1
Vorversuch
mit Imprägnierung ... 23
2.1.2
Vorversuch ohne Imprägnierung ... 24
2.1.3
Auswertung ... 26
2.2
Versuche mit stehenden Prüfkörpern ... 27
2.2.1
Versuch 1, Wasseraufnahme über unteres ungeschütztes
Hirnholz ... 27
2.2.2
Versuch 2, Wasseraufnahme über oberes ungeschütztes Hirnholz ... 35
2.2.3
Versuch 3, Wasseraufnahme über unteres geschütztes Hirnholz ... 41
2.2.4
Versuch 4, Wasseraufnahme über unteres geklemmtes Hirnholz ... 45
2.2.5
Auswertung ... 50
2.3
Versuche mit liegend angeordneten Prüfkörpern und einseitiger
Wasseraufnahme... 54
2.3.1
Versuch 5, einseitige Wasseraufnahme über Seitenholz,
Seitenholz nicht imprägniert... 54
2.3.2
Versuch 6, einseitige Wasseraufnahme über Seitenholz,
Seitenholz und Hirnholz geschützt... 60
2.3.3 Auswertung... 66
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
V
2.4
Versuche liegend mit sechsseitiger Wasseraufnahme ... 71
2.4.1
Versuch 7, Holz nicht imprägniert... 71
2.4.2 Versuch 8, Seitenholz und Hirnholz imprägniert ... 76
2.4.3
Versuch 9, Hirnholz geklemmt, Seitenholz imprägniert ... 81
2.4.4
Versuch 10, Hirnholz geschützt, Seitenholz unbehandelt... 86
2.4.5 Auswertung... 90
2.5
Trocknungsversuche... 93
2.5.1
Versuch 11, unbehandeltes Holz ... 94
2.5.2
Versuch 12, Holz nach dem Wässern mit kompletter
Imprägnierung ... 100
2.5.3
Versuch 13, Hirnolz geklemmt, Seitenholz imprägniert ... 105
2.5.4
Versuch 14, mit Seitenholzimprägnierung... 111
2.5.5
Versuch 15, einseitig gewässert, komplett imprägniert ... 117
2.5.6
Auswertung ... 123
3 Fazit der Diplomarbeit ... 127
3.1
Auswertung der kompletten Versuche ... 127
3.1.1 Hirnholz... 127
3.1.2 Seitenholz... 128
3.1.3 komplett befeuchteter Holzquerschnitt ... 129
3.2
Feuchtigkeitshaushalt des Holzes ... 129
3.2.1
Hirnholz ... 130
3.2.2
Seitenholz ... 130
3.2.3
Vergleich ... 130
4 Anhang ... 131
4.1
Verzeichnis der Bilder... 131
4.2
Verzeichnis der Tabellen... 133
4.3
Ergebnisse zur Versuche in tabellarischer Form ... 137
4.1.1 Vorversuche ... 137
4.1.2 Versuch 1 ... 144
4.1.3 Versuch 2 ... 149
4.1.4 Versuch 3 ... 153
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
VI
4.1.5 Versuch 4 ... 157
4.1.6 Auswertung... 159
4.1.7 Versuch 5 ... 161
4.1.8 Versuch 6 ... 168
4.1.9 Auswertung... 175
4.1.10 Versuch 7 ... 179
4.1.11 Versuch 8 ... 182
4.1.12 Versuch 9 ... 185
4.1.13 Versuch 10 ... 188
4.1.14 Auswertung... 191
4.1.15 Versuch 11... 193
4.1.16 Versuch 12... 196
4.1.17 Versuch 13... 199
4.1.18 Versuch 14... 202
4.1.19 Versuch 15... 205
4.1.20 Auswertung... 208
4.4
Zeichnungen zur Anordnung der Messpunkte ... 210
4.5
Literaturverzeichnis... 216
7
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
Im ersten Kapitel sollen die wichtigsten Begriffe, die für dieses Thema rele-
vant sind, erläutert werden. Des weiteren soll die Berechnung beziehungs-
weise die Bestimmung dieser Begriffe dargestellt werden.
1.1 Erläuterung der relevanten Begriffe
1.1.1 Holzfeuchtigkeit
Der Werkstoff Holz besitzt aufgrund seiner makroskopischen Kapillarporosi-
tät eine sehr große innere Oberfläche. Er kann durch diese Eigenschaft
Feuchtigkeit aus seiner Umgebung aufnehmen beziehungsweise an sie ab-
geben. Die Holzfeuchte wird in Bezug auf das darrtrockene (wasserfreie)
Holz angegeben und besitzt als Einheit Massenprozent (als Abkürzung
M.-%). Die Feuchtigkeit des frisch geschlagenen Holzes beträgt je nach Art,
Fällzeit und Standort 50 bis 150 M.-%, wobei aufgrund des Aufbaues des
Holzes die Feuchtigkeit im Kern bei Kernholzbäumen geringer als im Splint-
holz ist.
Bild 1.1: Querschnitt durch einen Nadelholzstamm [10]
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
8
Beim Austrocknen frisch geschlagenen Holzes mit oben genannten Feuchte-
gehalten diffundiert zuerst nur das freie Wasser aus dem makrokapillaren
Hohlraumsystem. Erst wenn das gesamte freie Wasser an die Umgebung
abgegeben wurde, kann das gebundene Wasser aus den feinen Poren der
wassergesättigten Fasern der Zellwände verdunsten. Den Punkt ab dem das
Holz kein freies, sondern nur noch gebundenes Wasser enthält, nennt man
Fasersättigungspunkt oder Fasersättigungsfeuchtigkeit. Bei den europäi-
schen Holzarten kann man von Fasersättigungsfeuchtigkeiten von 22 35
M.-% ausgehen. Im Mittel wird mit einer Fasersättigung bei 30 M.-% ge-
rechnet. An der unteren Grenze liegen Nadelhölzer mit einem hohen Harz-
gehalt (Kiefer, Lärche) und ringporige Laubhölzer (Eiche). An der oberen
Grenze liegen Nadelhölzer ohne Kern (Fichte, Tanne) und zerstreutporige
Laubhölzer (Buche).
Vom Fasersättigungspunkt bis zu einer Feuchtigkeit von etwa 15 M.-% wird
das Wasser in den Kapillaren angelagert. Von 15 6 M.-% wird es durch
van der - Waalssche Kräfte und unterhalb von 6 M.-% durch chemische
Reaktionen an die Zellulosefasern gebunden.
1.1.2 Wassereindringkoeffizient
Der Wassereindringkoeffizient wird auch als Sauggeschwindigkeit bezeich-
net und wird nach folgender Formel berechnet:
Er gibt an, wie weit Wasser in der ersten Saugstunde im Baustoff kapillar
befördert wird. Nach DIN 52183 erfolgt die Ermittlung des Wassereindring-
koeffizienten durch Wasseraufsaugen an lotrechten, vierseitig abgedichteten
Baustoffproben.
Die Kraft, die zur Meniskusbildung der benetzenden Flüssigkeit führt und
damit zum Aufsteigen in die Kapillarporen, bestimmt das Wasseraufsaug-
vermögen und damit auch die Sauggeschwindigkeit. Diesen Vorgang nennt
man Kapillarzug. Er ist von der Porengröße und dem Randwinkel der benet-
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
9
zenden Flüssigkeit auf den Feststoff abhängig. Je kleiner der Porenradius,
umso größer ist der Kapillarzug. Der Benetzungswinkel ist von der Oberflä-
chenspannung der Flüssigkeit abhängig. Das heißt, je kleiner der Randwin-
kel ist (je stärker eine Flüssigkeit benetzt), umso größer wird der Kapillar-
zug.
Bild 1.2: kapillare Steighöhe in Abhängigkeit des Benetzungswinkels und des Ka-
pillardurchmessers [12]
Tabelle 1.1: Zusammenhang zwischen Kapillardurchmesser und der maximalen
Steighöhe max h
Kapillar-
durchmes-
ser
1 mm
0,1 mm
0,01 mm
1 µm
0,1 µm
maximale
Steighöhe
3 cm
30 cm
3 m
30 m
300 m
Die Tatsache, dass je kleiner der Porenradius ist, umso größer der Kapillar-
zug, trifft aber nur für senkrechte Kapillaren zu. Staufenbiel hat in seinem
Buch Bauphysik und Baustofflehre in Versuch 1.15 gezeigt, dass Wasser in
waagerechten, größeren Kapillaren schneller befördert wird als in engeren.
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse seiner Versuche und damit den
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
10
Zusammenhang zwischen dem Porendurchmesser und der Saug-
geschwindigkeit.
Tabelle 1.2: Zusammenhang zwischen Kapillardurchmesser und der Saugeschwin-
digkeit in waagerechten Kapillaren
Kapillardurchmesser
1 mm
0,1 mm
0,01 mm
1 µm 0,1
µm
Geschwindigkeit v
50 m/min
5 m/min 50 cm/min 5 cm/min 5 mm/min
1.1.3 Wasseraufnahmekoeffizient
Der Wasseraufnahmekoeffizient wird im Allgemeinen auch als Saugfähigkeit
bezeichnet und mit der folgenden Formel berechnet:
Die Saugfähigkeit ist die Eigenschaft feinporiger Baukörper Wasser in die
Feinporen zu saugen. Sie gibt an, wie viel Wasser in einer bestimmten Zeit
durch eine Bauteiloberfläche hindurch aufgenommen wird. Der Wasserauf-
nahmekoeffizient trägt die Einheit kg/(m²*h). Somit wird mit dem Was-
seraufnahmekoeffizienten angegeben, wie viel Wasser durch einen Quad-
ratmeter Bauteiloberfläche hindurch in der ersten Stunde eingesaugt wird.
Kommen porige, wasserbenetzbare Baustoffe mit Wasser in Kontakt, zieht
der an den Menisken erzeugte Kapillardruck das Wasser in die Poren hinein.
Die Wasserspeicherung im Bereich der sogenannten Kapillarkondensation
wird durch die Füllung von Porenbereichen, beginnend bei den kleinsten Po-
renweiten und ansteigend zu immer größeren Porenweiten, erreicht.
Mit zunehmender Eindringtiefe wird der viskose Fließwiderstand des Was-
sers immer größer. Die Folge davon ist, dass die Eindringtiefe nur mit der
Wurzel der Zeit linear zunimmt.
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
11
Bild 1.3: links: Wasseraufnahme nach der Zeit t rechts: Wasseraufnahme nach der
Wurzelzeit h [2]
1.1.4 Sorption
Unter dem Begriff Sorption versteht man die Wasserdampfaufnahme und
Wasserdampfabgabe eines porösen Baustoffes. Die Feuchte eines Baustof-
fes wird von den Sorptionseigenschaften bestimmt, wenn sich kein Kon-
denswasser bildet oder von außen kein Wasser in den Baustoff eindringen
kann. Die Sorptionsfeuchte, auch Gleichgewichtsfeuchte genannt, stellt sich,
wie der Name schon sagt, im Gleichgewicht mit der Luftfeuchtigkeit ein.
In diesem Zusammenhang wird zwischen der Adsorption, als Wasserdampf-
aufnahme bei der Zunahme der reinen Luftfeuchtigkeit, und Desorption als
Wasserdampfabgabe bei Abnahme der relativen Luftfeuchte unterschieden.
Die Sorption wird in 3 verschiedene Phänomene unterteilt, die Chemisorpti-
on, die Physisorption und die Kapillarkondensation.
Die Chemisorption ist eine starke chemische Bindung von Molekülen an der
Porenoberfläche. Sie ist nicht reversibel.
Die Physisorption ist eine schwache physikalische Bindung, ähnlich den van
der Waalsschen Bindung, von Molekülen an der Porenoberfläche. Dieser
Prozess ist prinzipiell reversibel, weil sich die Chemie des Stoffes durch die-
sen Vorgang nicht ändert.
Die Kapillarkondensation findet in kleinen Poren statt, da hier durch Ober-
flächenkräfte der Sättigungsdampfdruck des Wassers heruntergesetzt ist.
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
12
Dieser Vorgang ist verzögert reversibel, in Abhängigkeit von der Luftfeuch-
tigkeit.
Der Anteil der Chemisorption ist in den meisten Fällen vernachlässigbar. In
der Regel wird der wesentliche Anteil der Sorption von der Physisorption
und der Kapillarkondensation übernommen.
Die Porenstruktur eines Baustoffes bestimmt im Wesentlichen das Sorpti-
onsverhalten. Die Größe der inneren Oberfläche beeinflusst direkt den Anteil
der Physisorption. Der Anteil der Kapillarkondensation findet nur in Poren
mit einem Durchmesser <100 nm statt. Damit ist der Anteil der Kapillar-
kondensation fest mit dem Volumenanteil dieser Porengröße verbunden. Da
die Kapillarkondensation nur verzögert reversibel ist, ist in Trocknungsver-
suchen (Desorption) mit zu kurzer Dauer eine höhere Sorptionsfeuchte zu
beobachten als beim Befeuchten (Adsorption). Dieses Phänomen kann man
als Hysterese bezeichnen. Die genaue Definition der Hysterese lautet: Das
Zurückbleiben einer Wirkung hinter der sie verursachenden veränderlichen
physikalischen Größe.
In Fällen, die keine Hysterese aufzeigen ist anzunehmen, dass die Kapillar-
kondensation keinen oder nur einen sehr geringen Anteil an der Sorption
darstellt. Der Einfluss der Kapillarkondensation und damit der Hysterese ist
in der Regel auf den Bereich hoher Luftfeuchten beschränkt.
Bild 1.4: Effekt der Hysterese [12]
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
13
Graphisch trägt man die Sorption als Sorptionsisotherme auf. Sie zeigt den
Zusammenhang zwischen der Stofffeuchte, der Luftfeuchtigkeit und einer
bestimmten Temperatur an. Mit Hilfe der Isotherme kann man die Stoff-
feuchte in Abhängigkeit von der Luftfeuchte bestimmen. Bei besonders po-
rösen Baustoffen ist der Einfluss der Temperatur verhältnismäßig klein und
kann damit vernachlässigt werden.
Bild 1.5: Sorptionsisotherme verschiedener Baustoffe [12]
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
14
Bild 1.6: Sorptionsisotherme von Holz in Abhängigkeit der Luftfeuchte und der
Temperatur [10]
1.1.5 Trocknung
Die Trocknung von porösen Baustoffen und somit auch von Holz, geschieht
in 2 Abschnitten.
Im ersten Abschnitt bildet das Porenwasser Menisken am äußeren Rand der
Kapillaren. Durch die Trocknung schwindet der Körper. An der Oberfläche
verdunstet mindestens soviel Wasser, dass diese Menge der Volumenminde-
rung des Körpers entspricht. Die Verdunstungsgeschwindigkeit bleibt über
lange Zeit konstant, denn sie ist nicht von der Stoffart, sondern von äuße-
ren Faktoren, wie der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit, der Bewegung
der Luft und der Wärmestrahlung abhängig.
Im zweiten Abschnitt fällt die Verdunstungsgeschwindigkeit steil ab. Die
Trocknung geschieht jetzt nicht nur an der Oberfläche, auch im Inneren des
Körpers beginnt nun der Trocknungsprozess. Der dabei entstehende Was-
serdampf muss erst einmal zur Bauteiloberfläche hin diffundieren um aus-
treten zu können. Diesen Vorgang beeinflusst das Porengefüge sehr stark,
denn der Wasserdampf kann nur durch die Poren an die Oberfläche des
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
15
Bauteiles gelangen. Der zweite Abschnitt endet mit der Gleichgewichts-
feuchte, die in Kapitel 1.1.4 erklärt wurde.
1.2 Berechnungsmethoden
Die Viskosität der Flüssigkeit und die Stärke des Kapillarzuges bestimmen
die Geschwindigkeit des Transportes innerhalb der Kapillaren. Wenn man
empirische Untersuchungen und theoretische Modelle vergleicht, kommt
man zum übereinstimmenden Ergebnis, dass die kapillar aufgenommene
Flüssigkeitsmenge pro Flächeneinheit und die Steighöhe proportional zur
Wurzel aus der Zeit verlaufen. Aus diesem Grund wird das Saugverhalten
poröser Baustoffe mit den Transportkoeffizienten angegeben.
Leider gilt dies nur für die Wasseraufnahme. Für die Feuchtigkeitsabgabe
gibt es keine Koeffizienten. Dieser Prozess ist von zu vielen Bedingungen
abhängig, um eine allgemein gültige Formel nach dem Vorbild der Wasser-
aufnahme zu entwickeln. Eines kann man allerdings sagen. Der Prozess der
Wasserabgabe dauert länger als die Wasseraufnahme.
1.2.1 Wassereindringkoeffizient
Um den Wassereindringkoeffizienten ausrechnen zu können, muss man zu-
erst die Länge des Saugweges kennen. Diese Länge kann man nur in Versu-
chen bestimmen, denn man benötigt die dazugehörige Zeit.
Wenn der Durchmesser der Poren bekannt ist, kann man die maximale
Steighöhe nach folgenden Berechnungsschema errechnen:
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
16
Beispiel:
angenommener Kapillardurchmesser d = 0,01mm d = 0,00001m
A = Querschnitt der Kapillarröhre
m²
d = innerer Kapillardurchmesser
m
U = Umfang der Kapillare
m
g = Erdbeschleunigung
9,81 m²/s
G
=
Gewichtskraft
N
h = kapillare Steighöhe
m
p = Kapillardruck (-unterdruck)
N/m²
F
=
Kapillarkraft
N
= Dichte des Wassers
1000 kg/m³
= Oberflächenspannung des Wassers 0,075 N/m
0,075 (kg*m)
(m*s²)
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
17
Tabelle 1.3: Oberflächenspannung des Wassers infolge der Temperatur
Temperatur
Oberflächen-
spannung
Wasser
(kg*m/m*s²)
0 °C
0,0756
10 °C
0,0741
20 °C
0,0726
Die allgemeine Formel für den Wassereindringkoeffizienten lautet:
Beispiel: Länge des Saugweges : 3,0 m
Saugzeit: 10 Stunden
1.2.2 Wasseraufnahmekoeffizient
Die allgemeine Formel für den Wasseraufnahmekoeffizienten lautet:
Als Zahlenbeispiel möchte ich ein Ergebnis der nachfolgend beschriebenen
Versuche benutzen.
Im Versuch 1 betrug die benetzte Fläche 0,1022 m². Das in der Versuchs-
zeit von 278,5 Stunden aufgenommene Wasser wurde anhand einer Ge-
1 Feuchtigkeitshaushalt des Bauholzes
18
wichtsmessung mit 1,2 Liter bestimmt. Diese Menge Wasser entspricht ei-
ner Masse von 1,2 kg. So ergibt sich folgender Berechnungsgang:
Es ergibt sich somit ein Wasseraufnahmekoeffizient von 0,7036 kg/(m²*
h)
2 Versuche
19
2 Versuche
Bei den Probekörpern handelt es sich um Leimholzstücke (GL 24 c Nadel-
holz) mit den Abmessungen 30 x 32 x 152 cm.
Es wurden 2 Vorversuche und 15 Versuche durchgeführt. Dabei wurden an
insgesamt 2180 Messpunkten die Holzfeuchtigkeiten in 1,0 cm, 2,5 cm und
5,0 cm Tiefe gemessen. Dies ergab 6540 einzelne Messergebnisse.
Die Feuchtenmessungen wurden mit dem Gerät Hygromette HT 65 der
Firma Gann gemessen. Vor jeder Messung wurde das Feuchtenmessgerät
mit einem geeichten Messkörper kalibriert.
Bild 2.1: Feuchtenmessgerät
Bild 2.2: geeichter Messkörper zum kalibrieren
2 Versuche
20
Zur Feuchtenmessung in den drei Tiefen wurden die in Bild 2.3 gezeigten
Messelektroden verwendet. Die Elektroden für die Messungen in 2,5 cm be-
ziehungsweise 5,0 cm Tiefe sind am Schaft isoliert, sodass nur an der Spitze
gemessen werden kann und damit das Ergebnis nicht verfälscht wird.
Bild 2.3: verwendete Messelektroden
Bei den Messungen in 2,5 bzw. 5,0 cm wurde mit einem Bohrer (Ø 3,2 mm)
vorgebohrt, um das Einschlagen und Herausziehen der Messelektroden zu
erleichtern.
2 Versuche
21
Bild 2.4: Versuchskörper mit Messelektroden
Die bei den Versuchen verwendeten Imprägnierungen waren Cetol Aktiva
für die Seitenholzimprägnierung und Kodrin WV 456 für die Hirnholzimpräg-
nierung. Beide Imprägnierungen sind von der Firma Sikkens. Sie wurden
nach den Herstellerangaben auf die Versuchskörper aufgetragen und die
Trocknungszeiten wurden eingehalten.
Bild 2.5: Seitenholzimprägnierung
Bild 2.6: Hirnholzimprägnierung
2 Versuche
22
2.1 Vorversuche
Die Vorversuche wurden durchgeführt, um ein geeignetes Raster der Mess-
punkte festzulegen und eine angemessene Versuchsdauer zu bestimmen.
Bei den Versuchskörpern wurden nur die Holzfeuchtigkeit und der Umfang
gemessen.
Dabei wurde zu Beginn der Vorversuche ein engeres Raster mit 72 Mess-
stellen pro Versuchskörper verwendet. Dies wurde aber bei der 3. Messung
auf 28 Messstellen reduziert. Die Auswertung der 3. Messung ergab, dass
bei dem Raster mit 28 Messstellen eine ausreichende Genauigkeit erreicht
wird.
Die Rasteraufteilung der beiden Raster ist den Bildern 2.7 und 2.8 als Sys-
temskizze dargestellt.
Bild 2.7: Aufteilung Versuchskörper in 12 Achsen
Bild 2.8: Aufteilung Versuchskörper in 7 Achsen
2 Versuche
23
2.1.1 Vorversuch mit Imprägnierung
Bei diesem Versuch wurde der Probekörper mit Seitenholzimprägnierung
und Hirnholzimprägnierung behandelt und anschließend komplett unter
Wasser getaucht.
Der Versuch begann am 18.08. 2008 um 18:30 Uhr. Am 21.08. und
23.08.2008 wurden wieder Messungen durchgeführt, wobei am 23.08. die
Reduzierung von 72 auf 28 Messstellen pro Versuchskörper wie oben erläu-
tert stattfand. Der Versuch wurde am 27.08.2008 um 14:10 Uhr beendet.
Daraus lässt sich eine Wassereinwirkungsdauer der Wassereinwirkung von
212 Stunden errechnen.
Aufgrund der unterschiedlichen Raster habe ich die Mittelwerte der einzel-
nen Seiten in den 3 verschiedenen Tiefen miteinander verglichen. Dabei er-
gaben sich folgende in den Tabellen 2.1 und 2.2 zusammengefassten
Feuchtenwerte für den Beginn und die Beendigung des Versuches.
Tabelle 2.1: Mittelwerte der Holzfeuchte in M.-% zu Beginn des Versuches
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite
1
15,7 14,7 15,3
Seite
2
16,0 15,2 15,2
Seite
3
13,9 13,4 13,7
Seite
4
17,7 17,6 17,6
Tabelle 2.2: Mittelwerte der Holzfeuchte in M.-% nach Beendigung des Versuches
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite
1
34,7 24,9 23,6
Seite
2
37,3 28,2 28,9
Seite
3
33,5 23,6 23,6
Seite
4
36,0 26,8 27,0
Aus diesen Werten ergeben sich die in Tabelle 2.3 dargestellten Feuchtig-
keitsänderungen.
2 Versuche
24
Tabelle 2.3: Änderung der Holzfeuchtigkeit in M.-%
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite 1
19,0
10,1
8,3
Seite
2
21,2 13,0 13,7
Seite 3
19,6
10,2
9,9
Seite 4
18,3
9,3
9,4
Die dabei aufgetretenen Änderungen des Umfanges sind in Tabelle 2.4 zu-
sammengefasst.
Tabelle 2.4: Änderung des Umfanges in cm
18.08.2008
27.08.2008
Änderung
Achse 1
122,5
124,0
1,5
Achse 2
122,5
123,9
1,4
Achse 3
122,5
124,0
1,5
Achse 4
122,5
124,2
1,7
Achse 5
122,5
123,8
1,3
Achse 6
122,5
124,2
1,7
2.1.2 Vorversuch ohne Imprägnierung
Auch bei diesem Vorversuch wurde der Probekörper vollkommen unter
Wasser getaucht, jedoch blieb das Holz gänzlich unbehandelt.
Begonnen wurde der Versuch am 21.08.2008 um 18:00 Uhr. Der Versuch
wurde am 27.08.2008 um 12:00 Uhr beendet. Daraus ergibt sich eine Was-
sereinwirkungsdauer der Wassereinwirkung von 138 Stunden. Die Werte der
Holzfeuchte zu Beginn und am Ende des Versuches sind in den Tabellen 2.5
und 2.6 zusammengefasst.
2 Versuche
25
Tabelle 2.5: Mittelwerte der Holzfeuchte in M.-% zu Beginn des Versuches
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite
1
16,0 15,2 15,0
Seite
2
15,8 15,9 16,4
Seite
3
14,3 14,0 14,0
Seite
4
17,9 17,3 17,2
Tabelle 2.6: Mittelwerte der Holzfeuchte in M.-% nach Beendigung des Versuches
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite
1
33,4 24,7 25,8
Seite
2
32,3 23,4 25,2
Seite
3
34,8 23,6 25,9
Seite
4
40,4 29,4 29,0
Aus diesen Werten ergeben sich die in Tabelle 2.7 dargestellten Feuchtig-
keitsänderungen.
Tabelle 2.7: Änderung der Holzfeuchtigkeit in M.-%
Messtiefe
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
Seite
1
17,4 9,6 10,8
Seite 2
16,5
7,4
8,7
Seite
3
20,5 9,6 11,9
Seite
4
22,5 12,1 11,9
Die dabei aufgetretenen Änderungen des Umfanges sind in Tabelle 2.8 zu-
sammengefasst.
Tabelle 2.8: Änderung des Umfanges in cm
18.08.2008
27.08.2008
Änderung
Achse 1
122,5
124,3
1,8
Achse 2
122,5
123,8
1,3
Achse 3
122,5
123,8
1,3
Achse 4
122,5
123,8
1,3
Achse 5
122,5
124,0
1,5
Achse 6
122,5
124,3
1,8
2 Versuche
26
2.1.3 Auswertung
Die Vorversuche zeigten, dass eine Zeit von 138 Stunden (rund 6 Tage)
vollkommen ausreichend ist, um Holzfeuchtigkeiten über 23 M.-% bei Ver-
suchskörpern ohne Imprägnierung zu erreichen.
Weiterhin war bei den Vorversuchen zu beobachten, dass das Holz mit Sei-
ten- und Hirnholzimprägnierung nach 212 Stunden an 3 Seiten noch nicht
so viel Wasser aufgenommen hatte, wie das Holz ohne Imprägnierung. Dies
zeigt die Tabelle 2.9, in der die Ergebnisse gegenübergestellt sind.
Tabelle 2.9: Gegenüberstellung der Ergebnisse der Vorversuche in M.-%
mit Imprägnierung
ohne Imprägnierung
Vergleich
1,0 cm 2,5 cm 5,0 cm 1,0 cm 2,5 cm 5,0 cm 1,0 cm 2,5 cm 5,0 cm
18,8 18,1 14,5 17,4 9,6 10,8 -1,4 -8,6 -3,7
14,6 7,9 7,5 16,5 7,4 8,7 1,9 -0,5 1,2
15,3 9,4 7,6 20,5 9,6 11,9 5,2 0,1 4,4
17,2 12,0 9,6 22,5 12,1 11,9 5,3 0,0 2,2
In der Tabelle wurden die Feuchtigkeitsänderungen der Versuche voneinan-
der subtrahiert (Vergleich = ohne Imprägnierung mit Imprägnierung).
Diese Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass die Imprägnierung die
Wasseraufnahme mindestens um den Faktor 1,5 verzögert. Ob dies so ist
sollen die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Versuche zeigen.
Diese Vermutung wird durch die Gegenüberstellung der Umfangsverände-
rung der beiden Versuche bestätigt. Der Umfang veränderte sich nahezu in
der gleichen Größenordnung, wie in Tabelle 2.10 dargestellt.
2 Versuche
27
Tabelle 2.10: Gegenüberstellung der Änderung des Umfanges der Vorversuche
mit Imprägnierung
ohne Imprägnierung
Vergleich
Achse Änderung Achse Änderung Achse Vergleich
1 1,5
cm 1 1,8
cm 1 0,3
cm
2 1,4
cm 2 1,3
cm 2 -0,1
cm
3 1,5
cm 3 1,3
cm 3 -0,2
cm
4 1,7
cm 4 1,3
cm 4 -0,4
cm
5 1,3
cm 5 1,5
cm 5 0,2
cm
6 1,7
cm 6 1,8
cm 6 0,1
cm
2.2 Versuche mit stehenden Prüfkörpern
Die stehenden Versuche waren dazu gedacht, um den zeitlichen Ablauf der
Wasseraufnahme in axialer Richtung des Holzes zu untersuchen. Dabei wur-
den Versuche mit und entgegen der Schwerkraft, mit Hirnholzschutz und
mit einer Klemmung im unmittelbaren Hirnholzbereich durchgeführt.
2.2.1 Versuch 1, Wasseraufnahme über unteres ungeschütztes
Hirnholz
Bei diesem Versuch handelt es sich um eine kapillare Wasseraufnahme in
axialer Richtung entgegen der Schwerkraft. Der Versuchskörper wurde nicht
imprägniert.
Die Wasseraufnahme erfolgte über die untere Hirnholzfläche, wobei das
Holz 0,5 cm im Wasser stand. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von benetz-
ter Hirnholz- zu benetzter Seitenholzfläche von 15,5 zu 1.
2 Versuche
28
Bild 2.9: Versuchskörper im Labor
Der Versuch begann am 03.09.2008 um 20:00 Uhr und endete am
15.09.2008 um 10:30 Uhr. Dies ergibt eine Wassereinwirkungsdauer von
278,5 Stunden. Der Versuchskörper wurde in 12 Achsen unterteilt. Da die
Ergebnisse der zwischenzeitlichen Messungen am 05.09., 08.09. und
10.09.2008 ergaben, dass keine großen Steighöhen zu beobachten sind,
habe ich die Anzahl der Achsen am 10.09.2008 halbiert und nur noch die
ersten 6 Achsen gemessen. Die Aufteilung ist in den Bildern 2.10 und 2.11
ersichtlich.
Bild 2.10: Aufteilung mit 12 Achsen
2 Versuche
29
Bild 2.11: Aufteilung mit 6 Achsen
Der Probekörper wog zu Versuchsbeginn 61,2 kg und wies die in Tabelle
2.11 dargestellten Holzfeuchtigkeiten, sowie die in Tabelle 2.12 eingetrage-
nen Abmessungen auf.
2 Versuche
30
Tabelle 2.11: Holzfeuchtigkeiten in M.-% zu Beginn des Versuches
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
15,9 14,7 15,5
2
15,6 14,7 14,7
3
15,6 14,9 14,5
4
15,2 14,1 14,7
5
15,6 14,7 15,6
6
15,9 14,7 14,9
Seite
2
Achse
1
15,5 14,3 15,0
2
15,1 14,5 15,0
3
14,9 14,0 14,7
4
15,4 14,1 15,3
5
14,6 14,8 14,8
6
15,4 14,9 14,6
Seite
3
Achse
1
17,2 14,8 14,9
2
16,3 14,0 14,4
3
16,6 14,6 15,2
4
16,7 14,7 14,0
5
16,2 14,1 14,9
6
16,5 13,7 14,5
Seite
4
Achse
1
16,0 15,1 15,2
2
16,3 15,4 15,2
3
16,2 15,2 15,0
4
15,8 15,8 15,2
5
16,4 15,4 14,8
6
16,3 15,2 14,8
Tabelle 2.12: Abmessungen zu Beginn des Versuches in cm
Achse
Seite a
Seite b
1 30,10
32,00
2 30,00
31,90
3 30,00
31,90
4 30,00
31,90
5 30,00
31,90
2 Versuche
31
6 30,00
31,90
Bei der Beendigung des Versuches war das Wasser sichtbar circa 4 cm in
den Holzquerschnitt eingedrungen. Dies ist in Bild 2.12 dargestellt.
Bild 2.12: sichtbarer Feuchtigkeitshorizont
Dass der Feuchtigkeitshorizont nicht in einer größeren Höhe sichtbar ist,
hängt vermutlich mit der Diffusion über das nicht imprägnierte Seitenholz
zusammen. Nach meiner Auffassung wird ein nicht unerheblicher Anteil des
Feuchtigkeitshaushaltes über das Seitenholz getätigt. Anders sind die Er-
gebnisse nach Beendigung des Versuches am 15.09.2008 um 10:30 Uhr,
also nach einer Wassereinwirkungsdauer von 278,5 Stunden, nicht zu erklä-
ren.
Der Versuchskörper wog bei dieser Messung 62,4 kg. Dies ergibt eine Ge-
wichtszunahme von 1,2 kg. Daraus lässt sich schließen, dass er 1,2 Liter
Wasser aufgenommen hat. In Tabelle 2.13 sind die Holzfeuchtigkeiten und
in Tabelle 2.14 die Abmessungen nach Beendigung des Versuches eingetra-
gen.
2 Versuche
32
Tabelle 2.13: Holzfeuchtigkeiten in M.-% nach Beendigung des Versuches
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
29,4
30,6
25,8
2
18,3 18,4 18,2
3
16,9 16,7 16,6
4
16,0 15,1 15,7
5
15,9 14,8 15,8
6
15,5 14,5 15,6
Seite 2
Achse
1
32,8 38,0 28,7
2
19,4 18,1 18,4
3
16,4 15,8 16,5
4
16,0 15,4 15,6
5
15,4 14,8 14,9
6
15,7 15,0 15,7
Seite 3
Achse
1
30,9 31,7 27,2
2
18,2 17,6 17,7
3
16,8 16,6 16,9
4
16,8 15,5 15,2
5
16,8 14,7 16,0
6
16,7 15,0 15,2
Seite 4
Achse
1
44,0 44,4 34,0
2
18,9 18,5 17,6
3
17,0 16,2 15,8
4
16,3 16,7 15,2
5
17,2 15,1 14,7
6
16,9 14,6 14,8
Tabelle 2.14: Abmessungen nach Beendigung des Versuches in cm
Achse
Seite a
Seite b
0 30,50
32,38
1 30,27
32,15
2 30,20
32,06
3 30,13
32,02
4 30,07
31,97
5 30,06
31,94
2 Versuche
33
6 30,05
31,93
Aus diesen Werten ergaben sich die in den Tabellen 2.15 und 2.16 darge-
stellten Änderungen des Feuchtigkeitsgehaltes und der Abmessungen der
Prüfkörper.
Tabelle 2.15: Änderung der Holzfeuchtigkeiten in M.-%
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
13,5
15,9
10,3
2
2,7 3,7 3,5
3
1,3 1,8 2,1
4
0,8 1,0 1,0
5
0,3 0,1 0,2
6
-0,4
-0,2
0,7
Seite 2
Achse
1
17,3 23,7 13,7
2
4,3 3,6 3,4
3
1,5 1,8 1,8
4
0,6 1,3 0,3
5
0,8 0,0 0,1
6
0,3 0,1 1,1
Seite 3
Achse
1
13,7 16,9 12,3
2
1,9 3,6 3,3
3
0,2 2,0 1,7
4
0,1 0,8 1,2
5
0,6 0,6 1,1
6
0,2 1,3 0,7
Seite 4
Achse
1
28,0 29,3 18,8
2
2,6 3,1 2,4
3
0,8 1,0 0,8
4
0,5 0,9 0,0
5
0,8
-0,3
-0,1
6
0,6 -0,6 0,0
Tabelle 2.16: Änderung der Abmessungen in cm
Achse
Seite a
Seite b
0 0,40
0,38
2 Versuche
34
1 0,17
0,15
2 0,20
0,16
3 0,13
0,12
4 0,07
0,07
5 0,06
0,04
6 0,05
0,03
Auffällig ist die bereits nach 15 cm in axialer Richtung nur noch geringe Zu-
nahme der Holzfeuchtigkeit. Darauf möchte ich aber im Unterkapitel 2.2.5
Auswertung eingehen und damit auch Bezug nehmen auf meine oben ge-
nannte Vermutung.
Wie im Kapitel 1.2.2 erläutert kann man mit der aufgenommenen Wasser-
menge, der Versuchsdauer und der benetzten Fläche den Wasseraufnahme-
koeffizienten errechnen.
Bei diesem Versuch errechnet sich der Wasseraufnahmekoeffizient zu
w=0,7036 kg/(m²*
h).
Um die Ergebnisse zu überprüfen, wurde ein Balken aus Fichtenholz mit den
Abmessungen 200/80 mm und einer Länge von 130 cm ebenfalls unter den
gleichen Bedingungen wie bei Versuch 1 fünf Tage lang gewässert. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 2.17 zusammengefasst.
Tabelle 2.17: Ergebnisse Kontrollversuch in M.-%
Achse 10.9.2008
15.09.2008
Änderung
1 20,9 48,7 27,8
2 21
22,1
1,1
3 20,9
20,4
-0,5
4 20,9
20,2
-0,7
2 Versuche
35
Bild 2.13: Kontrollversuch
Dieser Versuch zeigte, dass die Ergebnisse plausibel sind. Die Änderungen
der Holzfeuchtigkeit sind vergleichbar mit denen aus Versuch 1.
2.2.2 Versuch 2, Wasseraufnahme über oberes ungeschütztes Hirn-
holz
Bei diesem Versuch handelt es sich um eine kapillare Wasseraufnahme in
axialer Richtung mit der Schwerkraft. Der Versuchskörper wurde wie bei
Versuch 1 nicht imprägniert.
Der Versuchskörper wurde an der oberen Seite so abgedichtet, dass keine
Benetzung des Seitenholzes möglich war.
2 Versuche
36
Bild 2.14: Versuch 2 mit Abdichtung
Der Versuch begann am 10.09.2008 um 16.30 Uhr und endete am
22.09.2008 um 16:30 Uhr. Daraus lässt sich eine Wassereinwirkungsdauer
von 288 Stunden errechnen.
Die Aufteilung erfolgte, wie bei Versuch 1 in Bild 2.11 dargestellt in 6 Ach-
sen.
Der Versuchskörper wog bei Versuchsbeginn 60,3 kg und wies die in den
Tabellen 2.18 und 2.19 zusammengefassten Holzfeuchtigkeiten und Abmes-
sungen auf.
Tabelle 2.18: Holzfeuchtigkeiten in M.-% zu Beginn des Versuches
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
15,5
15,0
15,5
2
15,6 15,2 15,8
3
15,6 15,4 15,7
4
15,7 15,1 15,5
5
15,5 15,1 15,2
6
15,4 15,2 15,6
Seite 2
Achse
1
16,4 16,1 15,1
2
15,6 15,1 15,0
3
15,3 15,8 15,8
2 Versuche
37
4
14,5 14,5 13,6
5
14,0 13,8 13,0
6
14,0 13,7 12,9
Seite 3
Achse
1
14,7 14,1 15,0
2
14,2 15,0 14,6
3
14,4 14,5 14,3
4
14,4 14,6 14,5
5
14,4 14,5 14,8
6
14,4 14,4 14,4
Seite 4
Achse
1
15,5 14,7 14,4
2
14,3 14,8 14,5
3
14,9 13,9 14,3
4
15,1 14,8 14,9
5
15,0 13,7 12,2
6
14,8 14,4 14,2
Tabelle 2.19: Abmessungen in cm zu Beginn des Versuches
Achse
Seite a
Seite b
1 29,95
31,80
2 29,95
31,80
3 29,95
31,80
4 29,95
31,80
5 29,95
31,80
6 29,95
31,80
Auffällig war bei den Messungen dieses Versuches, dass er bereits nach 10
cm in axialer Richtung nur geringe Änderungen der Holzfeuchte in den 3
Messtiefen zu beobachten waren. Die Holzfeuchtigkeiten nahmen allerdings
mit steigender Messtiefe zu. Die Ergebnisse nach Beendigung des Versuches
sind in den Tabellen 2.20 und 2.21 dargestellt.
Tabelle 2.20: Holzfeuchtigkeiten in M.-% nach Beendigung des Versuches
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
39,1
49,7
52,1
2
16,6 19,0 18,6
2 Versuche
38
3
14,9 16,9 15,6
4
14,6 16,2 15,1
5
14,8 16,0 15,7
6
13,7 15,6 14,8
Seite 2
Achse
1
19,1 21,5 22,7
2
15,2 16,7 16,1
3
13,6 15,3 16,2
4
13,2 14,0 13,2
5
13,0 13,5 14,0
6
12,8 13,7 13,6
Seite 3
Achse
1
16,0 18,7 21,1
2
14,4 16,3 16,7
3
13,3 14,9 15,2
4
13,3 14,7 15,0
5
13,1 14,1 14,4
6
13,6 14,7 14,8
Seite 4
Achse
1
21,1 19,4 32,2
2
16,1 18,1 19,6
3
13,9 14,7 15,4
4
14,0 14,7 15,5
5
13,5 14,3 14,0
6
13,2 13,8 13,5
Tabelle 2.21: Abmessungen in cm nach Beendigung des Versuches
Achse
Seite a
Seite b
0 30,43
32,42
1 30,14
32,06
2 30,06
31,93
3 30,00
31,87
4 29,97
31,83
5 29,95
31,80
6 29,95
31,80
2 Versuche
39
Die Achse 0 in der Tabelle 2.21 beinhaltet die Maße des Probekörpers direkt
am Hirnholz, um die Änderung des Querschnitts besser beurteilen zu kön-
nen.
Der Probekörper wog bei der Beendigung des Versuches 62,1 kg. Dies er-
gibt eine Gewichtszunahme von 1,8 kg, also eine Wasseraufnahme von 1,8
Liter. Um die geringe Änderung der Holzfeuchtigkeiten, wie in der Tabelle
2.22 erklären zu können, habe ich Messungen direkt im Hirnholz durchge-
führt. Die Anordnung der Messstellen ist in Bild 2.14 dargestellt.
Bild 2.15: Messgellen im Hirnholz
Tabelle 2.22: Änderung der Holzfeuchtigkeiten in M.-%
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
23,6
34,7
36,6
2
1,0 3,8 2,8
3
-0,7
1,5
0,1
4
-1,1 1,1 -0,4
5
-0,7
0,9
0,5
6
-1,7 0,4 -0,8
Seite 2
Achse
1
2,7 5,9 7,6
2
-0,4
1,6
1,9
2 Versuche
40
3
-1,7
-0,5
0,4
4
-1,3
-0,5
0,8
5
-1,0
-0,3
1,0
6
-1,2
0,0
0,7
Seite 3
Achse
1
1,3 4,6 6,7
2
0,2 1,3 2,1
3
-1,1
0,4
0,9
4
-1,1
0,1
0,5
5
-1,3
-0,4
-0,4
6
-0,8
0,3
0,4
Seite 4
Achse
1
5,6
7,3
17,8
2
1,8 3,3 5,1
3
-1,0
0,8
1,2
4
-1,1
-0,1
0,6
5
-1,5
0,6
2,3
6
-1,6
-0,6
0,0
Tabelle 2.23: Änderung der Abmessungen in cm
Achse
Seite a
Seite b
0 0,48
0,62
1 0,19
0,26
2 0,11
0,13
3 0,05
0,07
4 0,02
0,03
5 0,00
0,00
6 0,00
0,00
Die Messungen im Hirnholz wurden in einer Tiefe von 5,0 cm durchgeführt.
Sie ergaben die in Tabelle 2.24 dargestellten Holzfeuchtigkeiten.
Tabelle 2.24: Holzfeuchtigkeiten im Hirnholz in M.-%
Achse Ergebnisse in 5 cm Tiefe
1 49,5 50,3 43,3
2 59,7 60,0 54,7
3 54,6 57,0 59,5
4 55,5 55,4 48,8
Mitte 56,6 56,6 56
2 Versuche
41
Aus den ermittelten Werten lässt sich ein Wasseraufnahmekoeffizient von
1,1049 kg/(m²*
h) errechnen.
2.2.3 Versuch 3, Wasseraufnahme über unteres geschütztes Hirn-
holz
Bei diesem Versuch handelt es sich, wie bei Versuch 1, um eine kapillare
Wasseraufnahme in axialer Richtung entgegen der Schwerkraft. Bei diesem
Versuchskörper wurden die Hirnholzfläche und ca. 1,0 cm der Seitenholzflä-
chen mit der oben beschriebenen Hirnholzimprägnierung behandelt.
Die Wasseraufnahme erfolgte über die untere Hirnholzfläche, wobei das
Holz 0,5 cm im Wasser stand. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von benetz-
ter Hirnholz- zu benetzter Seitenholzfläche von 15,5 zu 1.
Der Versuch begann am 03.09.2008 um 20:00 Uhr und endete am
15.09.2008 um 08:30 Uhr. Daraus ergibt sich eine Wassereinwirkungsdauer
der Wassereinwirkung von 276,5 Stunden.
Die Aufteilung erfolgte, wie bei Versuch 1 in Bild 2.10 dargestellt zunächst
in 12 Achsen, wobei auch hier eine Reduzierung auf 6 Achsen (Bild 2.11)
am 10.09.2008 aus den in Kapitel 2.2.1 genannten Gründen stattfand.
Der Versuchskörper wog bei Versuchsbeginn 63,0 kg und wies die in den
Tabellen 2.25 und 2.26 zusammengefassten Holzfeuchtigkeiten und Abmes-
sungen auf.
Tabelle 2.25: Holzfeuchtigkeiten in M.-% zu Beginn des Versuches
Messtiefe
Seite 1
Achse
1,0 cm
2,5 cm
5,0 cm
1
15,6
15,3
15,0
2
14,8 15,4 14,4
3
14,7 15,4 14,7
4
15,4 15,4 14,8
5
15,6 15,3 13,2
6
15,0 15,4 13,7
Seite 2
Achse
1
16,2 15,6 14,5
2
16,1 16,3 13,8
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836630054
- DOI
- 10.3239/9783836630054
- Dateigröße
- 4.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Deggendorf – Bauingenieurwesen
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Mai)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- holz feuchtigkeit wasseraufnahme trocknung brettschichtholz
- Produktsicherheit
- Diplom.de