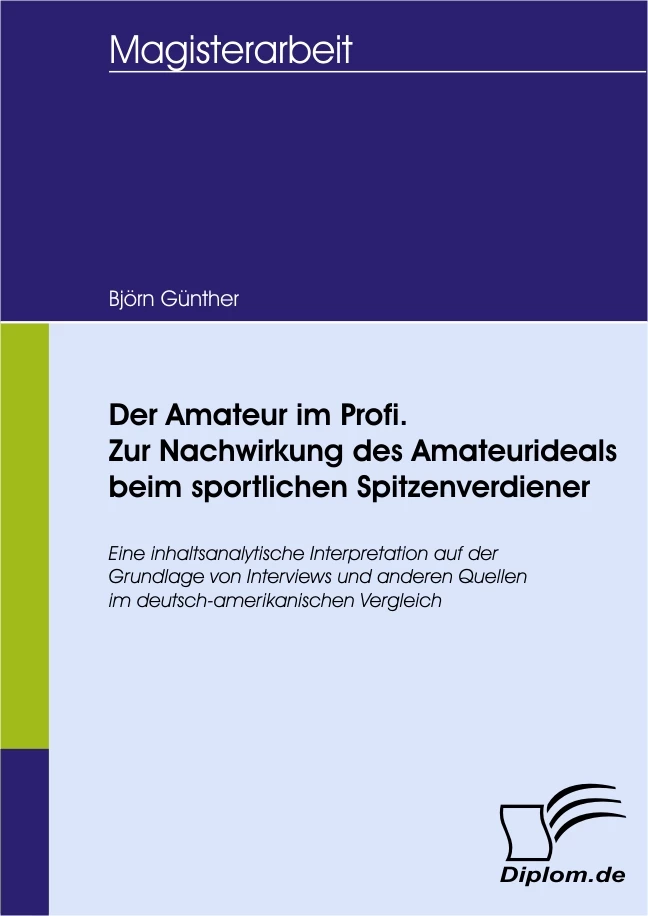Der Amateur im Profi. Zur Nachwirkung des Amateurideals beim sportlichen Spitzenverdiener
Eine inhaltsanalytische Interpretation auf der Grundlage von Interviews und anderen Quellen im deutsch-amerikanischen Vergleich
©2008
Magisterarbeit
164 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Angenommen, ein Fußballverein steigt in die 1. Bundesliga auf und erreicht in der ersten Saison einen sensationellen sechsten Platz, dann kann dies nur zustande kommen mit einer hohen Qualität an fußballerischen Fähigkeiten seitens der Spieler. Die Stimmung der Fans ist blendend und die Mannschaft soll in der folgenden Spielzeit noch besser abschneiden. Doch es ist Mai der wichtige Monat für Vertragsverhandlungen , und plötzlich erhalten Verein und Fans die Kunde, dass drei ihrer wichtigsten Spieler zu finanziell deutlich verbesserten Bezügen den Klub in Richtung anderer Vereine verlassen werden, die demnächst in internationalen Wettbewerben mitspielen. Das Umfeld ist nicht nur enttäuscht sondern auch empört, beteuerten doch alle drei noch vor wenigen Tagen öffentlich, dem Verein treu zu bleiben und sich nicht vom großen Geld ködern zu lassen. Nun führen diese Spieler als entscheidenden Grund für den Wechsel an, die sportliche Perspektive sei ungemein reizvoll, eine Chance, die nicht ungenutzt bleiben darf. Aus der Sicht der Fans sind aus den einstigen Identifikationsfiguren Sport-Söldner geworden, gehasst für ihre angebliche Unehrlichkeit und Charakterschwäche.
Ein derartiges Szenario wiederholt sich, stellvertretend für die gesamten professionellen Mannschaftssportarten regelmäßig, insbesondere während der spielfreien Saisonpausen.
Hochleistungssport zu betreiben bedeutet nicht automatisch, seinen Sport professionell auszuüben. Was kennzeichnet einen Profi, und was unterscheidet ihn von einem Amateur? An welchem Punkt tritt eigentlich ein Spitzensportler in den Status eines Profisportlers über? Hier scheinen die inhaltlichen Grenzen zu verwischen, sodass klare Begriffsdefinitionen gefunden werden müssen.
Nutzen Profisportler bewusst oder unbewusst den Deckmantel Amateurstatus, um von ihren finanziellen Interessen abzulenken?
Ebenso wichtig ist die Beschäftigung mit dem Aspekt der Motivationsgrundlage von Profisportlern. Welche Gründe führen Profisportler an, mit denen sie ihren Sport betreiben? Sind Profisportler extrinsisch motiviert? Das bedeutet, sie üben ihren Sport aus Gründen des Geldverdienens aus, um beispielsweise sozial aufzusteigen, Wohlstand zu erreichen und finanziell abgesichert zu sein. Oder sind Profisportler intrinsisch motiviert? Dabei drehen sich ihre Aktivitäten zumeist um die vielzitierte Liebe zum Sport, ein Ausdruck, stellvertretend für die Freude am Wettkampf, die Siege […]
Angenommen, ein Fußballverein steigt in die 1. Bundesliga auf und erreicht in der ersten Saison einen sensationellen sechsten Platz, dann kann dies nur zustande kommen mit einer hohen Qualität an fußballerischen Fähigkeiten seitens der Spieler. Die Stimmung der Fans ist blendend und die Mannschaft soll in der folgenden Spielzeit noch besser abschneiden. Doch es ist Mai der wichtige Monat für Vertragsverhandlungen , und plötzlich erhalten Verein und Fans die Kunde, dass drei ihrer wichtigsten Spieler zu finanziell deutlich verbesserten Bezügen den Klub in Richtung anderer Vereine verlassen werden, die demnächst in internationalen Wettbewerben mitspielen. Das Umfeld ist nicht nur enttäuscht sondern auch empört, beteuerten doch alle drei noch vor wenigen Tagen öffentlich, dem Verein treu zu bleiben und sich nicht vom großen Geld ködern zu lassen. Nun führen diese Spieler als entscheidenden Grund für den Wechsel an, die sportliche Perspektive sei ungemein reizvoll, eine Chance, die nicht ungenutzt bleiben darf. Aus der Sicht der Fans sind aus den einstigen Identifikationsfiguren Sport-Söldner geworden, gehasst für ihre angebliche Unehrlichkeit und Charakterschwäche.
Ein derartiges Szenario wiederholt sich, stellvertretend für die gesamten professionellen Mannschaftssportarten regelmäßig, insbesondere während der spielfreien Saisonpausen.
Hochleistungssport zu betreiben bedeutet nicht automatisch, seinen Sport professionell auszuüben. Was kennzeichnet einen Profi, und was unterscheidet ihn von einem Amateur? An welchem Punkt tritt eigentlich ein Spitzensportler in den Status eines Profisportlers über? Hier scheinen die inhaltlichen Grenzen zu verwischen, sodass klare Begriffsdefinitionen gefunden werden müssen.
Nutzen Profisportler bewusst oder unbewusst den Deckmantel Amateurstatus, um von ihren finanziellen Interessen abzulenken?
Ebenso wichtig ist die Beschäftigung mit dem Aspekt der Motivationsgrundlage von Profisportlern. Welche Gründe führen Profisportler an, mit denen sie ihren Sport betreiben? Sind Profisportler extrinsisch motiviert? Das bedeutet, sie üben ihren Sport aus Gründen des Geldverdienens aus, um beispielsweise sozial aufzusteigen, Wohlstand zu erreichen und finanziell abgesichert zu sein. Oder sind Profisportler intrinsisch motiviert? Dabei drehen sich ihre Aktivitäten zumeist um die vielzitierte Liebe zum Sport, ein Ausdruck, stellvertretend für die Freude am Wettkampf, die Siege […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Björn Günther
Der Amateur im Profi. Zur Nachwirkung des Amateurideals beim sportlichen
Spitzenverdiener
Eine inhaltsanalytische Interpretation auf der Grundlage von Interviews und anderen
Quellen im deutsch-amerikanischen Vergleich
ISBN: 978-3-8366-2981-2
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Mainz, Deutschland, Magisterarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung ... 1
2 Methodik ... 9
3 Quellenanalyse: Interpretation, Typologisierung und Auswertung 14
4 Diskussion ... 72
4.1 Die ,,Sportbewegung" ... 72
4.1.1 Die Entwicklung des modernen Sports
Amateursport, Professionalisierung und
Kommerzialisierung ... 73
4.1.2 Die Amateurregelung Auslegung nach Coubertin
und kontinuierliche Modifikation ... 81
4.1.3 Neuorientierung oder Rückbesinnung?
Das Berufsbild des Profisportlers vor dem
Hintergrund gesellschaftlicher Erwartungen ... 87
4.2 Deutschland und Amerika im kulturellen Wertevergleich ... 98
4.2.1 Max Weber: Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus ... 98
4.2.2 Der amerikanische Sport im Fokus oder:
Was ist amerikanisch? ... 109
4.3 Die Sportsysteme von Deutschland und Amerika
im Vergleich ... 115
4.4 Der Neid... 132
4.5 Das Phänomen der Ehre in der modernen Gesellschaft ... 139
5 Schlussbetrachtung ... 148
Literatur- und Quellenverzeichnis ... 152
Schaubild: Erwartetes Antwortschema ... 160
1
1 Einleitung
Angenommen, ein Fußballverein steigt in die 1. Bundesliga auf und
erreicht in der ersten Saison einen sensationellen sechsten Platz, dann
kann dies nur zustande kommen mit einer hohen Qualität an
fußballerischen Fähigkeiten seitens der Spieler. Die Stimmung der Fans
ist blendend und die Mannschaft soll in der folgenden Spielzeit noch
besser abschneiden. Doch es ist Mai der wichtige Monat für
Vertragsverhandlungen , und plötzlich erhalten Verein und Fans die
Kunde, dass drei ihrer wichtigsten Spieler zu finanziell deutlich
verbesserten Bezügen den Klub in Richtung anderer Vereine verlassen
werden, die demnächst in internationalen Wettbewerben mitspielen.
Das Umfeld ist nicht nur enttäuscht sondern auch empört, beteuerten
doch alle drei noch vor wenigen Tagen öffentlich, ,,dem Verein treu zu
bleiben" und sich ,,nicht vom großen Geld ködern zu lassen". Nun
führen diese Spieler als entscheidenden Grund für den Wechsel an,
,,die sportliche Perspektive sei ungemein reizvoll, eine Chance, die
nicht ungenutzt bleiben darf". Aus der Sicht der Fans sind aus den
einstigen Identifikationsfiguren ,,Sport-Söldner" geworden, gehasst für
ihre angebliche Unehrlichkeit und Charakterschwäche.
Ein derartiges Szenario wiederholt sich, stellvertretend für die
gesamten professionellen Mannschaftssportarten regelmäßig, insbe-
sondere während der spielfreien Saisonpausen.
Hochleistungssport zu betreiben bedeutet nicht automatisch, seinen
Sport professionell auszuüben. Was kennzeichnet einen Profi, und was
unterscheidet ihn von einem Amateur? An welchem Punkt tritt
eigentlich ein Spitzensportler in den Status eines Profisportlers über?
Hier scheinen die inhaltlichen Grenzen zu verwischen, sodass klare
Begriffsdefinitionen gefunden werden müssen.
Nutzen Profisportler bewusst oder unbewusst den ,,Deckmantel
Amateurstatus", um von ihren finanziellen Interessen abzulenken?
2
Ebenso wichtig ist die Beschäftigung mit dem Aspekt der
Motivationsgrundlage von Profisportlern. Welche Gründe führen
Profisportler an, mit denen sie ihren Sport betreiben? Sind Profisportler
extrinsisch motiviert? Das bedeutet, sie üben ihren Sport aus Gründen
des Geldverdienens aus, um beispielsweise sozial aufzusteigen,
Wohlstand zu erreichen und finanziell abgesichert zu sein. Oder sind
Profisportler intrinsisch motiviert? Dabei drehen sich ihre Aktivitäten
zumeist um die vielzitierte ,,Liebe zum Sport", ein Ausdruck, stellver-
tretend für die Freude am Wettkampf, die Siege und Emotionen, das
Reisen und damit verbunden das Kennenlernen von Menschen und
Kulturen oder die Chance, Freunde zu gewinnen.
Sport hat in Deutschland einen hohen Stellenwert, und Sportler
genießen hohes Ansehen in der Bevölkerung. Immer mehr Menschen
besuchen Sportveranstaltungen, eine Multifunktionsarena nach der
anderen sprießt aus dem Boden in denen die Mannschaften lautstark
unterstützt werden, die Fanartikelindustrie erzielt hohe Umsätze, und
deutsche Spitzensportler sind gefragte Personen des öffentlichen
Lebens. Doch dieses positive Erscheinungsbild wird u. a. an einer Stelle
getrübt: Scheinbar variiert die Wertschätzung für Spitzensportler in
Deutschland je nach Blickwinkel. Der deutsche Sportfan ebenso wie
die interessierte Öffentlichkeit erfreut sich an den Spitzenleistungen
deutscher Sportler und den damit verbundenen Überraschungs-
momenten, Titeln und Rekorden. Der Sportliebhaber gönnt den
siegreichen Athleten Freude und partizipiert selbst an diesen Erfolgen,
indem er die sportlichen Höhepunkte zelebriert, d. h. sich gut
unterhalten fühlt, amüsiert und zerstreut man denke nur an das
massenwirksame
,,Public
Viewing"
während
der
Fußball-
Weltmeisterschaft 2006. Ebenso schätzt er den Prestigegewinn, den
Deutschland durch sportliche Erfolge erhält.
Gleichzeitig scheint sich eine Mehrzahl der sportbegeisterten
Deutschen jedoch über einige Begleiterscheinungen der Erfolge
3
deutscher Sportler zu mokieren. Die deutsche Öffentlichkeit scheint
kontinuierlich Kritikpunkte an ihren Sporthelden suchen zu wollen und
auch zu finden. Beispielsweise findet sich das sprichwörtliche ,,Haar in
der Suppe", wenn ,,Kaiser" Franz Beckenbauer in unzähligen Fernseh-
werbespots nervt, die Stars des FC Bayern mal wieder in ihrer
Lieblingsdiskothek fotografiert werden oder Boris Becker in kurzen
Abständen eine neue Frau an seiner Seite präsentiert.
Bei derartigen Vorkommnissen handelt es sich vorzugsweise um die
persönlichen Wertvorstellungen des einzelnen Betrachters. Sammelt
man jedoch viele solcher Kritikpunkte, drängt sich die Vermutung auf,
es entspräche der allgemeinen Ansicht, dass Spitzensportler zu viel
Geld verdienen im Verhältnis zu ihren erbrachten Leistungen. Hier
muss man nicht lange nach plakativen Äußerungen suchen, denn
folgende ,,Stammtischparolen" scheinen in Deutschland weit verbreitet,
werden aber ebenfalls in seriösen Fernseh-, Hörfunk-, und Printmedien
gepflegt, sodass der Schluss naheliegt, es handle sich um ein
gesellschaftsübergreifendes Phänomen:
,,Diese Sportstars sind doch total überbezahlt, fahren ein wenig im
Kreis herum (Formel 1) oder schwingen mal eine Stunde den Schläger
(Tennis)", ,,die haben ein so lockeres Leben, trainieren selten, jetten
immer um den Globus und wandern dann auch noch aus, um ein
bisschen Steuern zu sparen".
Das ,,Geschrei" in der deutschen Fußball-Öffentlichkeit war groß, als
sich Michael Ballack im Sommer 2006 nach einem neuen Verein
umschaute und dabei in den Medien v. a. sein zukünftiges Gehalt eine
Rolle spielte:
,,Ballacks Vertrag in London soll über vier Jahre laufen und pro Woche
soll der 29-jährige sagenhafte 177 500 Euro verdienen, was einem
Jahresgehalt von 9,23 Millionen Euro entspricht. [...] Damit wäre er
4
Spitzenverdiener in Chelseas Star-Ensemble und zugleich, so die
Zeitung [Daily Mail], der bestbezahlte Fußballer der Welt"
(http://www.bild.t-online.de/BTO/sport/aktuell/2006/02/28/
ballack-chelsea/ballack-wechsel-chelsea-bericht.html,
Stand: 24.10.2007).
Gleiches gilt für die kritische Sicht der Motorsportgemeinde Michael
Schumacher gegenüber:
,,Michael Schumacher konnte sich am Ende des Jahres 2005 über
Gesamteinnahmen von 58 Millionen Euro aus Gehaltsbezügen, Prämien
und Werbeeinnahmen freuen"
(http://sport.ard.de/sp/weitere/news200512/15/bg_Topverdiener_051
215.jhtml;jsessionid=HKCCSFPFAQCV4CQKYRSUTIQ?seite=9, Stand:
29.10.2007).
Es gibt vermutlich typische Situationen im Profisport, in denen Geld
thematisiert wird. Sicherlich zählen hierzu: Vereinswechsel, Vertrags-
verhandlungen, Leistungskrisen von Sportlern oder finanzielle
Probleme des Vereins.
Die Diskussionen drehen sich oft um das Phänomen der Ehre.
Auffallend oft wird an das Ehrgefühl von Sportlern appelliert, wie es
sonst vermutlich nur bei Künstlern der Fall ist.
Gilt es heutzutage als unehrenhaft zu behaupten, man sei in erster
Linie durch das Geld zum Sport motiviert? Um diese Frage zu
beantworten, ist zu klären, welche Rolle das Phänomen der Ehre in der
heutigen Zeit spielt und inwiefern sich dessen inhaltliche Bedeutung
innerhalb bestimmter Gesellschaften im Laufe der Zeit entwickelt bzw.
modifiziert hat.
5
Anscheinend laufen Profisportler, wie auch professionelle Künstler,
Gefahr, in der Öffentlichkeit als verdächtig zu gelten, wenn sie sich
nicht umgehend gegen den Anreiz des Geldverdienens stellen. Ihnen
wird weitläufig eine hohe finanzielle Entlohnung ihrer fachspezifischen
Leistungen aufgrund moralischer Bedenken abgesprochen. Welche
Argumentationslinie steckt dahinter, und weshalb kennzeichnen
Sportler und Künstler ihre Leistungen nicht als Spitzenleistungen und
fordern dafür eine hohe Bezahlung?
Während in jeder Berufssparte Einkommensdiskussionen genauso
regelmäßig wie selbstverständlich geführt werden, scheint die
Öffentlichkeit nicht bereit, diese Thematik zum Gegenstand im
Sportsektor zu machen. Was ist demnach das Besondere am Sport in
der öffentlichen Wahrnehmung?
Eine Reihe soziologischer Ansätze sollen beleuchtet werden, um diesem
und anderen Phänomenen auf die Spur zu kommen. Die Berück-
sichtigung gesellschafts-kultureller Erkenntnisse hilft, die Menschen
und ihr Verhalten besser zu verstehen.
Ebenso wie die Ehre spielt das Phänomen des Neids, mit dem sich z. B.
der Soziologe Helmut Schoeck intensiv befasst hat, innerhalb von
Gesellschaften eine wichtige Rolle.
Das Verhältnis von Leistung zu Lohn ist in Deutschland offenbar ein
Reizthema, das sicherlich nicht nur das Feld des Sports betrifft. Hierfür
ist die aktuelle Diskussion um Managergehälter in der Wirtschaft ein
gutes Beispiel.
Die Begeisterungsfähigkeit der deutschen Sportanhänger gegenüber
ihren Helden ist groß. Die Stars werden leidenschaftlich verehrt, jedoch
reicht diese Bewunderung nicht bis zum Status einer Vergötterung, wie
es beispielsweise im europäischen Mittelmeerraum und in Südamerika
häufig der Fall ist. Für die Argentinier ist Diego Maradonna ein
unantastbarer Sport-Gott. Kritik verbittet sich die Fangemeinde und
6
trotz einer mit diversen negativen Schlagzeilen versehenen
Vergangenheit (u. a. Drogen- und Fettsucht, Steuerhinterziehung,
Verbindungen zur italienischen ,,Mafia", freundschaftliche Beziehungen
zum kubanischen Staatsoberhaupt Fidel Castro) liegt ein ganzes Land
Maradonna zu Füßen und das noch 22 Jahre nach dem
argentinischen Fußball-Weltmeistertitel 1986.
Das Kritikpotenzial der Deutschen gegenüber den einheimischen
Sportstars scheint dagegen mindestens so hoch zu sein wie deren
Bewunderung.
An dieser Stelle ergibt sich die Frage, welche Gründe für diese
Annahme in Erwägung gezogen werden. Ist es nur die vielzitierte
deutsche ,,Neidgesellschaft", eine Kultur der Missgunst, falls diese
überhaupt existiert, oder finden sich noch andere Aspekte, die als
Erklärung dieses Phänomens dienen können?
Bewunderung erfahren Superstars der Sportszene für ihre
außergewöhnlichen Fähigkeiten, geneidet wird ihnen zumeist ihr
Lebensstandard. Hier gilt es herauszufinden, welcher Stellenwert dem
Sport in Deutschland zukommt, welche gesellschaftliche Funktion er
erfüllt und welche Rolle die Spitzensportler dabei spielen?
Wird die sportliche Betätigung innerhalb der deutschen Gesellschaft als
rein ideeller Wert angesehen, bei der ausschließlich nicht-monetäre
Motive gepflegt werden? Sollte dem so sein, dann ist Geld, als Inbegriff
des Materiellen und Triebfeder jedes Profisportlers, mit dieser
Sportauffassung nicht in Einklang zu bringen. Dazu muss geklärt
werden, welche Ideen gesellschaftlich tradiert und in der deutschen
Kultur verwurzelt sind?
Es stellt sich auch die Frage, ob diese Beobachtung ein typisch
deutsches Phänomen ist oder ebenso in anderen Gesellschaften
angetroffen werden kann? Bei diesem kulturellen Vergleich lässt sich
7
mit einem Blick nach Nordamerika
1
erahnen, dass dort professionell
betriebener Sport mit anderen Augen gesehen wird als in Deutschland
von Sportlern selbst wie auch von den Zuschauern.
Bei der Siegerehrung der ,,US-Open" (Tennis) im August 2007 wurde
dem Gewinner der Männerkonkurrenz, Roger Federer, ein Scheck über
die Rekordsumme von 1,4 Millionen US-Dollar überreicht. Anstatt dies,
wie es in Deutschland üblich ist, mit höflichem Beifall zu bedenken,
brandete ein begeisternder Jubel im ,,Arthur-Ashe-Stadion" auf
(Übertragung der Siegerehrung im Anschluss an das Einzelfinale der
Männer auf EUROSPORT am 09.08.2007).
Scheinbar ist der öffentliche Umgang mit dem Phänomen Geld in
Amerika ein anderer als in Deutschland. Welche Hinweise finden sich
dafür? Täuscht die Annahme, dass Amerika, als eine der größten
Sportnationen, anders mit Sportstars umgeht, als es in Deutschland
der Fall ist?
Zumindest in einem Punkt ist der Unterschied zwischen Deutschland
und Amerika eine Tatsache: Die reinen Spitzengehälter, ganz
abgesehen von den Werbeeinnahmen, liegen im amerikanischen
Profisport auf einem deutlich höheren Niveau. Einer der besten
Basketballspieler Amerikas, Kevin Garnett, verdiente nach seinem
Wechsel
2
23.750.000 US-Dollar pro Jahr und ist damit der zurzeit
höchstbezahlte Spieler in der NBA
3
(http://www.hoopshype.com/
salaries.htm, Stand: 24.10.2007).
Der mit 31 Jahren bereits heute zur Legende des Golfsports gewordene
Amerikaner ,,Tiger" Woods verdiente im Jahr 2005 mit Golfspielen
sowie durch Werbeeinnahmen 77 Millionen Euro. Woods belegte damit
1
Im Folgenden wird aus Gründen der Verständlichkeit ausschließlich von ,,Amerika",
,,Amerikanern" und ,,amerikanisch" die Rede sein. Damit sind die Vereinigten Staaten
von Amerika, deren Staatsbürger sowie deren Nationalität gemeint. Der Ausdruck
,,USA" wird weiterhin verwendet.
2
Garnett wechselte von den Minnesota Timberwolves zu den Boston Celtics.
3
,,NBA" steht für National Basketball Association, die Basketball-Profiliga in
Nordamerika (USA und Kanada).
8
den ersten Platz in der Geldrangliste der Sportler weltweit noch vor
dem
deutschen
Formel-1-Piloten
Michael
Schumacher
(http://sport.ard.de/sp/weitere/news200512/ 15/bg_Topverdiener_
051215.jhtml;jsessionid=HKCCSFPFAQCV4CQKYRSUTIQ?seite=9,
Stand: 29.10.2007).
Ein vielversprechender Ansatz zur Erhellung der Frage nach den
kontinentalen Differenzen ist die Beschäftigung mit dem jeweiligen
kulturellen Wertekanon beider Länder. Kann wirklich eine markante
Verschiedenartigkeit der Normen- und Moralvorstellungen beobachtet
werden und wenn ja, üben die gesellschaftlichen Werte tatsächlich
einen Einfluss auf das Verhältnis von Sportfan und Profisportler aus?
Die vom Soziologen Max Weber in ihrer Urfassung von 1904 verfasste
Schrift ,,Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus"
befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen der Entwicklung des
Kapitalismus und dem Moralbegriff der calvinisch-geprägten
puritanischen Einwanderer nach Amerika einerseits und der
überwiegend katholisch geprägten Gesellschaft Mittel-, West- und
Südeuropas andererseits.
Ebenso differenziert verhält es sich vermutlich mit der Mentalität,
bedingt durch eine unterschiedliche gesellschaftsgeschichtliche
Entwicklung. Es ist in diesem Zusammenhang sehr hilfreich zu
erfahren, welche Ursachen für diese sozio-kulturellen Unterschiede
ausschlaggebend sind. Die gefilterten Gründe liefern die Vorlage für ein
Verständnis der ebenfalls abweichenden Entwicklungen im Sport.
Jede Gesellschaft zeichnet eine individuelle (Sport-)Berichterstattung in
den Medien aus. Welche Rolle spielen hierbei die gesellschaftlichen
Wertvorstellungen und wie gestaltet sich auf dieser Basis eine mediale
Inszenierung von Sportveranstaltungen?
Eine weitere interessante Frage: Gibt es heutzutage noch aktive
deutsche Sportstars von internationalem Format, wie es z. B. Boris
9
Becker, Steffi Graf, Michael Schumacher oder Oliver Kahn bis vor nicht
allzu langer Zeit waren?
Erst eine Beschäftigung mit diesen Fragestellungen ermöglicht den
Einblick in die Art und Weise der medialen Fremd- und
Selbstdarstellung von Sportlern und lässt deren Handlungsweise sowie
die der Medienmacher verständlich werden.
2 Methodik
Diese Arbeit orientiert sich inhaltlich an der Seminararbeit von AXEL
KÄMMERER (WS
4
2003/2004) mit dem Titel: ,,Zur Selbstinszenierung
von Profisportlern zwischen intrinsischer (amateurhafter) und
extrinsischer Motivation". KÄMMERER untersucht den Zusammenhang
zwischen den Motiven eines Profisportlers, seinen Sport auszuüben und
den daraus resultierenden Reaktionen der Gesellschaft. Dabei steht für
ihn folgende Fragestellung im Mittelpunkt: ,,Begründet er [der
Profisportler] sein Sporttreiben nur aus der reinen Freude am Sport,
der damit verbundenen Ehre oder gibt er an, durch Geld oder andere
materielle Anreize zum Sporttreiben bewegt zu werden?" (KÄMMERER,
WS 2003/2004, 1).
Als zentrale Erkenntnis ermittelt er, dass sich die Erwartungshaltung
der Gesellschaft hinsichtlich eines moralischen Verhaltens gegenüber
verschiedenen
Berufsgruppen
unterscheidet.
Der
öffentliche
Stellenwert der Ehre spielt hierbei eine entscheidende Rolle, und es
sind die Sportler, an die moralisch höhere Maßstäbe angelegt werden.
4
Wintersemester
10
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die folgende Hypothese auf ihre Gültigkeit
zu überprüfen:
,,Profisportler äußern sich öffentlich nur ungern zum Thema Geld. Sie
fühlen sich nachweislich unwohl und antworten auf Fragen
diesbezüglich auffallend ausweichend. Dies gilt ausdrücklich nicht für
Profisportler aus Amerika, die in dieser Hinsicht wesentlich offener sind
und einen auffälligen Kontrast zu deutschen Profis bilden. Diese neigen
auch eher dazu, einseitig ihre Liebe zum Sport zu betonen und sich
damit als Amateure zu maskieren, um damit ihre monetären
Interessen zu verschleiern."
Sollten diese Behauptungen auf eine signifikante Mehrheit der zu
untersuchenden Aussagen zutreffen, können sie als richtig
angenommen werden.
Aufgrund der Tatsache, dass der Forschungsstand zu diesem Thema
nur sehr gering ausgeprägt ist und sich themenspezifische Literatur
nicht finden lässt, gestaltet sich das Forschungsdesign wie folgt:
Die Untersuchungsobjekte sind Profis, die mit Sport ihren
Lebensunterhalt bestreiten.
Die Summe aller potenziellen Analysekandidaten, die dieses Kriterium
erfüllen, stellt die Grundgesamtheit der Untersuchung dar.
Eine Totalerhebung kommt bei der Untersuchung nicht zur Anwendung,
erweist sich doch die Grundgesamtheit aller Untersuchungsobjekte als
zu groß. Vielmehr erfolgt eine themenspezifische Vorauswahl, wobei
das Suchkriterium die Frage darstellt, ob ein Profisportler in einem
Interview zu seiner Sportmotivation sowie zur Höhe seines
Einkommens befragt wird, bzw. ob er sich in irgendeiner Form dazu
äußert.
Zu den untersuchten Medien zählen: Printmedien (Tageszeitungen,
Sportzeitschriften
und
Magazine,
das
Internet
(speziell
in
Suchmaschinen zu diversen Stichwörtern, z. B. ,,Profisportler",
11
,,Interviews", ,,Amateur", ,,Preisgeld"; aber auch die Online-Portale der
Printmedien und von einzelnen Sportlern), (Auto-)Biografien von
Profisportlern sowie die Interviewsammlung von KÄMMERER (WS
2003/2004). Die gefundenen Quellen werden anschließend vom
Verfasser
auf
ihre
Tauglichkeit
überprüft,
bevor
er
die
repräsentativsten auswählt.
Bei den analysierten Personen handelt es sich um noch aktive
beziehungsweise ehemalige Sportler sowie um ehemalige Profis, die
zur Zeit ihrer Aussagen noch aktiv waren. Jede Person wird als
Spitzenverdiener angesehen. Aufgrund der Hypothese wird darauf
geachtet, dass das Verhältnis von deutschen und amerikanischen
Sportlern in etwa gleich gewichtet ist.
Es wird vom Autor zwecks Datengewinnung keine Primärerhebung
durchgeführt. Daten aus selbst geführten Interviews zu gewinnen,
hätte die Aufgabenstellung ausgeschlossen, Massenmedien als
Analysequelle zu nutzen. Stattdessen wird auf eine Sekundäranalyse
der bereits vorliegenden Daten der ausgewählten Quellen aus den
Massenmedien zurückgegriffen.
Als Technik des Auswertungsverfahrens bedient sich der Autor der
,,Qualitativen Inhaltsanalyse", wobei die jeweilige Analyseeinheit, d. h.
der auf die Fragestellung zutreffende Textabschnitt, verstanden und
gedeutet werden muss.
Zuerst wird jedoch festgehalten, was objektiv ausgesagt wird. Über
diese reine Deskription hinaus wird eine Inhaltsinterpretation
angestrebt, die Auslegung dessen, wie und weshalb etwas gesagt oder
nicht gesagt wird. SPÖHRING weist auf die Wichtigkeit dieses Schritts
hin: ,,Mit einer Beschränkung auf die Deskription von ,,manifesten"
Inhalten wäre auch der Anspruch auf mögliche Schlußfolgerungen
bezüglich der außertextlichen sozialen Wirklichkeit definitorisch
ausgegrenzt"
(SPÖHRING
1989,
193).
Die
aus
dem
Textzusammenhang zu erschließenden latenten Inhalte bedingen
12
subjektive Interpretationen, d. h. einen gewissen Grad an begründeter
Spekulation, um etwaigen hintergründigen Sinngehalten gerecht zu
werden.
Dabei hilft die Technik der Hermeneutik, die Kunst des Verstehens und
Interpretierens, denn eine lediglich auf quantitativen Gesichtspunkten
(v. a. zähl- und messbare Inhaltsmerkmale) beruhende Inhaltsanalyse
kann oft weder den Kontext noch die auf der Einzigartigkeit einer
Aussage beruhende Intention des zu Vermittelnden erhellen.
SPÖHRING gibt zu bedenken: ,,Als schöpferisches, konstruktives oder
rekonstruktives Moment ist ein Verstehen häufig auf flexible,
situationsangepaßte, kontextnahe und herantastende eben
qualitative Vorgehensweisen angewiesen" (SPÖHRING 1989, 57).
Wichtige Kriterien bei der Bewertung sind die Argumentationsweise
und die damit verbundene Glaubwürdigkeit des Profisportlers
gegenüber der öffentlichen Meinung.
Qualitative Sozialforschung, wie sie in dieser Arbeit zu finden ist,
beschäftigt sich mit verbalem Datenmaterial, das mit Hilfe der
Qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wird. Es werden Antworten auf
die sich während der Analyse ergebenden Fragen hinsichtlich der
Überprüfung der Ausgangshypothese gesucht. Dabei ,,kann man nicht
einfach", wie MAYRING sagt, ,,ein paar Kennwerte errechnen, man muß
mehr argumentativ vorgehen. Es müssen Belege angeführt und
diskutiert werden, die die Qualität der Forschung erweisen können".
Dabei rückt ,,der Prozeß der Begründbarkeit und Verallgemeinerbarkeit
der Ergebnisse in den Vordergrund" (MAYRING 1996³, 115).
Der Autor hält sich an die von MAYRING vorgeschlagenen sechs
allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung: Verfahrens-
dokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, Regel-
geleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validierung sowie
Triangulation (vgl. MAYRING 1996³, 115 ff).
13
,,Die explorative Aufgabe der qualitativen inhaltsanalytischen
Auswertung besteht in der Suche und Formulierung von
Analysekategorien, welche die inhaltlich wesentlichen Untersuchungs-
dimensionen der ausgewerteten Materialien festlegen sollen"
(SPÖHRING 1989, 191). Zu diesem Zweck werden die Antworten der
Sportler typologisiert, d. h. sie werden einem Antwortschema,
bestehend aus den Variablen ,,Motivation" (A) und ,,Bezahlung" (B)
zugeordnet. Für die ,,Motivation" gelten die Ausprägungen ,,intrinsisch"
(A1), ,,intrinsisch/extrinsisch" (A2) und ,,extrinsisch" (A3) und für die
,,Bezahlung" wird unterschieden in ,,keine Angabe" (B1), ,,überbezahlt"
(B2), ,,angemessen" (B3) und ,,unterbezahlt" (B4).
5
Dieses Antwortschema (s. S. 160) basiert auf den vom Autor
vermuteten
Angaben
der
Profisportler,
die
einer
hohen
Erwartungshaltung der Gesellschaft, z. B. durch Fans, Sponsoren,
Politikern, Medienvertretern u. a. unterliegen. Die beiden roten Kreise
sowie der blaue Kreis stellen die drei Idealtypen dar, die aufgrund der
Antwortkombinationen erwartet werden. Die analysierten und
bewerteten
Antworten
der
Profisportler
werden
auf
die
Ausgangshypothese hin überprüft: Sie wird angenommen, sollten sich
die ergebenden Antwortprofile der einzelnen Sportler nicht signifikant
unterscheiden.
Einerseits wird davon ausgegangen, dass deutsche Spitzenverdiener
(rote Kreise) eine intrinsische Motivation angeben und gleichzeitig
keine Angaben bezüglich der Bewertung ihrer Bezahlung machen
(A1/B1) oder diese für angemessen halten (A1/B3).
Im Gegensatz zu den deutschen Profis wird bei amerikanischen
Sportlern (blauer Kreis) ein differierendes Antwortbild in Form von
lediglich einer Kombination vermutet, A2/B3. Die eigene Bezahlung
wird vermutlich als angemessen empfunden und die Motivation zum
Sport von beiden Seiten her betont. Der Autor geht davon aus, dass
5
In der Auswertung am Ende dieses Kapitels werden A und B als Kategorien, A1, A2,
A3 sowie B1, B2, B3 und B4 als Antwortkategorien bezeichnet.
14
amerikanische Sportler gleichzeitig intrinsische als auch extrinsische
Motive kommunizieren, da Diskussionen über Geld in der
amerikanischen Gesellschaft im Vergleich zur deutschen wesentlich
offener geführt werden. Explizit wird nicht damit gerechnet, dass
amerikanische Profis ,,keine Angaben" (B1) machen, sondern sich offen
zum Thema ,,Bezahlung" äußern.
3
Quellenanalyse: Interpretation,
Typologi-
sierung und Auswertung
Zunächst werden Aussagen von Protagonisten des Profisports
angeführt, in denen sie Stellung zu ihrer Karriere als Ausnahmesportler
und ,,Medienmenschen" nehmen. Die Äußerungen behandeln inhaltlich
sehr unterschiedliche Themen: Die eigene sportliche Leistung und
deren Bezahlung sowie die persönliche Haltung zu den im Sport
gezahlten Gehältern, Motivation zum Sport, allgemeine Einstellung zum
Sponsoring und eigene Werbeaktivitäten, das Verhältnis zu den Medien
und das selbst- und fremdgeleitete Image, Glaubwürdigkeit innerhalb
der Öffentlichkeit, Beurteilung der Mechanismen des Profisports und
die Reflektion der eigenen Karriere.
In Hinblick auf die Interpretation, Bewertung und Einordnung der
getroffenen Aussagen, immer auf dem Hintergrund der Überprüfung
der Ausgangshypothese, dient dieses breite Spektrum einer qualitativ
besseren Auswertung.
Zuerst werden Aussagen deutscher Sportler untersucht, im Anschluss
folgen die Aussagen amerikanischer Sportler.
15
Deutsche Sportler:
Regina Halmich (ehemalige Profiboxerin; zum Zeitpunkt des
Interviews im Herbst 2006 war sie amtierende Weltmeisterin):
Frage: Und doch brauchen Sie die Aufmerksamkeit der Medien, ohne
die Ihre Karriere nicht möglich gewesen wäre.
Regina Halmich (RH): [...]. Denn es wäre in jedem Fall die falsche
Reaktion, sich einfach wieder ganz abzukapseln oder aber sich zu
verstellen. Die Leute wollen nicht irgendein Image vorgeführt
bekommen, sondern sie wollen einen echten Menschen vor sich haben,
der ehrlich und sympathisch wirkt.
Zu ihrem Privatleben befragt antwortet sie:
RH: Man muss ja nicht aus allem ein Geheimnis machen, sondern es
geht darum, eine gute Balance zu schaffen zwischen dem, was man
preisgibt, und dem, was man unbedingt und unter allen Umständen
verschweigt.
Auf ihren unter enormem Show-Charakter ausgetragenen Boxkampf
mit dem deutschen Entertainer Stefan Raab angesprochen, und
aufgrund des zu befürchtenden Verlustes an Seriosität, sagt sie:
RH: Stimmt, das war ein gewaltiges Risiko, ein Experiment, das aber
zum Glück funktioniert hat. [...] das war schon ein Durchbruch, eine
ganz neue Dimension. [...] Und plötzlich kannte mich jeder. [...] Man
kann so etwas in seiner Karriere nur ein einziges Mal machen, sonst
wird aus einer Boxerin eine Entertainerin, der es nicht mehr um die
eigene Leistung geht, nicht mehr um den Sport, sondern vor allem um
die Show. Trotzdem möchte ich den Kampf mit Stefan Raab nicht
missen, denn ich habe auf diese Weise gelernt, was den Leuten gefällt:
16
Sie wollen immer auch unterhalten werden, eine Lasershow und einige
Prominente geboten bekommen. Und man muss dieses Entertainment
liefern, auch wenn für mich persönlich der Sport im Vordergrund steht.
Frage: Sie haben sich dann aber doch dafür entschieden, als Trainerin
beim so genannten Promi-Boxen von RTL mitzumachen eine
Sendung, die man als reine Klamauk-Show kritisiert hat.
RH: Sehen Sie, das war reine Schadensbegrenzung, auch Fritz Sdunek,
der bekannteste und beste Trainer Deutschlands, hat aus diesen
Gründen mitgemacht. Wenn wir nicht geholfen hätten, die
Prominenten, die da in den Ring steigen wollten, wenigstens
einigermaßen vorzubereiten und zu coachen, dann wäre die Show noch
sehr viel schlimmer geworden. Die Promis hätten dann allesamt ohne
professionelle Betreuung gekämpft. Nach unserem Training konnte
man das, was sie da vorführten, immer noch nicht wirklich boxen
nennen, aber es hat zumindest ein bisschen so ausgesehen.
Diese Passage soll nun einer kurzen Analyse unterzogen werden
(ebenso wie die folgenden Interviewpassagen; kurz mit ,,Analyse"
gekennzeichnet):
Regina Halmich macht den Medien gegenüber Zugeständnisse, um
dem öffentlichen Interesse an ihrer Person gerecht zu werden. Dabei
spricht sie sich dafür aus, als Sportler klare Trennlinien zwischen
geduldeten und unerwünschten Auftritten zu ziehen.
Sie kritisiert eine selbst gemachte Imagebildung, propagiert
gleichzeitig Natürlichkeit und Authentizität als beste Mittel der
Außendarstellung und stellt ihren Sport eindeutig über das
Entertainment. Damit unterstreicht sie ihre intrinsische Motivation, gibt
jedoch zu bedenken, dass die Unterhaltung ebenso zum Geschäft
gehört und der Zuschauer diese einfordert.
17
Dem Vorsatz, einen Show-Kampf nur ein einziges Mal auszutragen, ist
sie nicht treu geblieben, denn nach 2001 boxte sie im Frühjahr 2007
nur wenige Monate nach dem hier zitierten Interview nochmals
gegen Stefan Raab. Eine hohe Antrittsgage dürfte die Boxerin
überzeugt haben, ,,eine Million Euro Schmerzensgeld kassiert er dafür
angeblich. Sie auch"
(http://www.stern.de/unterhaltung/tv/:Raab-Halmich-Er-Eier/
586050.html, Stand: 26.06.2008).
Ihre Aktivität als Trainerin beim RTL-Promi-Boxen verteidigt sie als
gütigen Akt der Hilfestellung und ,,Schadensbegrenzung". Es gibt
sicherlich in Deutschland noch andere hoch qualifizierte Boxer bzw.
Box-Trainer, die genauso gut zur Vorbereitung der Prominenten hätten
engagiert werden können. Die Entscheidung seitens RTL für Halmich
und Sdunek kam nicht von ungefähr, garantierte doch deren
Einbindung in die Sendung Popularität und weckte das Interesse der
TV-Zuschauer. Halmich verschweigt abermals ihre finanzielle
Beteiligung an der Veranstaltung. Diese dürfte der ausschlaggebende
Punkt bei ihren Überlegungen gewesen sein, bei dieser ,,Klamauk-
Show" mitzuwirken führt sie doch ihre Ernsthaftigkeit gegenüber
dem Boxsport ins Feld.
Frage: Wenn man Ihren Namen bei Google eingibt, stößt man auf der
Suche nach Fotos bei den ersten 20 Treffern auf fünf Bilder vom
Boxen, bei dem Rest handelt es sich um erotische Aufnahmen oder
solche für Werbezwecke. Stört Sie das?
RH: Das muss man in Kauf nehmen. Auch wenn es mir selbst vor allem
um das Boxen geht, gibt es doch ein Interesse der Menschen, mich
einmal anders zu sehen als in einem Kampf. Vermutlich ist es
überhaupt diese Mischung aus Weiblichkeit und hartem Sport, die
einen Teil der Faszination ausmacht. Ich wäre mit Sicherheit als ein
ganz burschikoser, maskuliner Typ, der sich nicht für Schmuck und
18
Kosmetik interessiert, nicht so erfolgreich geworden. Auch hätte mich
der Playboy nie um eine Fotostrecke gebeten, sondern man hätte
gesagt: ,,Nun, die sieht ja schon aus wie eine Boxerin!"
Analyse: Sehr geschickt begründet Halmich ihre Präsenz in der
Werbung und auf anderen außer-boxerischen Gebieten mit dem
,,Interesse der Menschen, [sie] einmal anders zu sehen als in einem
Kampf". Es ist demnach ausschließlich das Bedürfnis der Öffentlichkeit
an der Teilhabe an ihrem Leben, dem sie nachgibt. Halmich nimmt ihre
Präsenz in der Öffentlichkeit scheinbar nur missbilligend ,,in Kauf", lässt
aber unausgesprochen, dass sie einige finanziell-lukrative Angebote
annimmt.
Immerhin liefert sie plausible Gründe, wie ihre ,,Mischung aus
Weiblichkeit und hartem Sport" sowie ihr Interesse für ,,Schmuck und
Kosmetik", die ihre Popularität in der Öffentlichkeit erklären und
nachvollziehen helfen, weshalb sie für Medien und Sponsoren eine
attraktive Figur darstellt. Tatsächlich ist sie eine sehr erfolgreiche
Sportlerin (bis zu ihrem Karriereende im November 2007 blieb sie
zwölf Jahre ungeschlagene Weltmeisterin), der man nachsagt, neben
gutem Aussehen ebenfalls intelligent und sympathisch zu sein. Diese
Eigenschaften sind geradezu ideal, um in vielen Bereichen des Lebens
Erfolg zu haben.
Frage: Sie haben bereits mit 27 Jahren Ihre Autobiographie
veröffentlicht. Ist das nicht etwas früh?
RH: Nein, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Jahre 2003
hatte ich bereits 40 Kämpfe durchgestanden, und mich haben immer
wieder junge Boxerinnen ausgefragt und um Rat gebeten. Überhaupt
ist dieses Buch eine Antwort auf immer wiederkehrende Fragen, die ich
seitdem es auf dem Markt ist nun ganz einfach beantworten kann:
,,Lesen Sie mein Buch!"
19
Analyse: Wieder lässt Halmich ihre Beweggründe eindeutig erscheinen,
weshalb sie ihre Autobiographie noch während ihrer aktiven Boxzeit
veröffentlicht: Sie möchte damit anderen, speziell jüngeren Menschen,
die sich für Halmichs Lebensweg interessieren, aufgrund ihrer
gesammelten Erfahrungen Orientierung geben und Wege aufzeigen,
wie man Entscheidungen treffen bzw. Probleme lösen kann.
Diese Gründe sind durchaus glaubwürdig und ehrenwert. Es soll an
dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen werden, dass eine
veröffentlichte Autobiographie speziell im Falle einer am Problem der
Vergänglichkeit von sportlichem Ruhm leidenden Boxerin höchst
wahrscheinlich dann eine weitaus höhere Nachfrage erreicht, wenn
der/die Protagonist(in) noch aktiv in seinem/ihrem Metier tätig ist und
im Rampenlicht steht. Es ist nicht zu erwarten, dass Halmich nach ihrer
aktiven Boxkarriere eine vergleichbare Medienpräsenz aufrechterhalten
kann.
Ein aktuelles Beispiel liefert Oliver Kahn. Der ,,Titan" beendete nach der
Fußballsaison 2007/08 seine Laufbahn als Torhüter und veröffentlichte
punktgenau zu diesem Zeitpunkt, nachdem er bereits 2004 seine
Autobiographie ,,Nummer eins" der Öffentlichkeit angeboten hatte, sein
zweites Buch: ,,Ich. Erfolg kommt von innen." Er ging davon aus, dass
die Nachfrage, aufgrund seiner Popularität zu diesem Zeitpunkt, sehr
hoch war.
(Quelle: BERGMANN/PÖRKSEN 2007, 97-104).
Innerhalb der schematischen Einordnung ist Regina Halmich dem Typ
A1/B1 zuzuordnen.
Mehrfach stellt sie klar heraus, es ginge ihr ,,vor allem um das Boxen"
und dass für sie ,,der Sport im Vordergrund steht". Sie macht deutlich,
ihren steinigen Weg ohne große Leidenschaft niemals hätte gehen zu
20
können und verweist auf ihre langjährige, erfolgreiche Karriere sowie
ihr Dasein als Pionier auf dem Gebiet des Frauen-Boxens.
Etwas anders verhält es sich mit ihrer Darstellungsweise zum Thema
finanzielle Einkünfte. Wie wir bereits erfuhren, ist Halmich maßgeblich
durch ihren ersten Show-Kampf mit Stefan Raab bekannt und auch
durch ihre einnehmende Art populär geworden. Zu keinem Zeitpunkt
lässt sie Zweifel daran aufkommen, ihre außer-sportlichen öffentlichen
Auftritte dienten allein dazu, ihren Geldbeutel zu füllen. Sie zeichnet
vielmehr aus, dass sie diese Aktivitäten gut begründet, und zwar für
sie sehr schmeichelhaft mit der reinen Bedürfnisbefriedigung der
Massen.
Halmich gibt durch ihre cleveren und charmanten Antworten kaum
Anlass zur Kritik. Auch wenn sie zu keinem Zeitpunkt zugibt, mit ihren
Fernsehauftritten Geld verdienen zu wollen, soll ihr positiv attestiert
werden, einen erfolgreichen Umgang mit Fragen zu ihrem Beruf
gefunden zu haben.
Boris Becker (Tennislegende; im Gespräch mit dem Journalisten Arno
Luik; zum Zeitpunkt des Interviews 1990 war Becker 22 Jahre alt):
Arno Luik (AL): Was bedeutet Ihnen Geld?
Boris Becker (BB): Geld hat mir noch nie viel bedeutet.
AL: Ihnen ist wohl klar, dass wir nun lächeln. Eric Jelen, Ihr
Doppelpartner, hat mal gesagt: Der Becker spricht wie ein halber
Kommunist.
BB: Stimmt.
AL: Aber es ist in der Tat einfach zu sagen: Aus Geld mache ich mir
nichts, wenn man Millionen im Rücken hat.
21
BB: Richtig. Und deswegen ist es für mich eigentlich unmöglich, dazu
etwas Glaubhaftes zu sagen. Aber die Sache ist doch die: Es ist immer
relativ, was viel Geld ist. Ich kenne Leute, die haben Millionen und sind
totunglücklich, wenn sie nicht noch mehr Millionen machen. Sie
machen Dinge, die sie nur des Geldes wegen tun. Und da mache ich
nicht mit.
AL: Ein Gedankenspiel: Ich biete ihnen an, in Las Vegas ein Mixed mit
Steffi Graf gegen Lendl/Navratilova zu machen. Eine Million Dollar cash
auf die Hand.
BB: Das reizt mich überhaupt nicht. Genau dieses Angebot gab es im
Frühjahr. Ich habe es abgelehnt.
AL: Warum?
BB: Weil ich für Geld nicht alles mache. Mir geht es um Sport, nicht um
Clownerie. Ich will noch in den Spiegel schauen können.
AL: Becker ist keine Hure des Geldes?
BB: Dieses Wissen ist mir sehr wichtig. Ich habe Verträge gemacht und
dann bereut, dass ich sie abgeschlossen habe. Ich habe schon oft
Verträge gekündigt.
AL: Zum Beispiel?
BB: Dazu will ich nichts sagen, weil ich den Firmen nicht schaden will.
AL: Waren es ethische Gründe?
BB: Ich muss zu den Produkten stehen können, für die ich werbe. Ich
könnte, wenn ich wollte, zehnmal mehr Geld haben. Der Ion
6
wird oft
6
Ion Tiriac, Beckers damaliger Manager.
22
verrückt, wenn ich sage: ,,Ich kann nicht. Ich kann einfach nicht." Ich
will ich sein das ist meine ,,guide-line". Ich bin kein Produkt von
irgend etwas.
Auf seinen Reiz für die Werbewirtschaft angesprochen meint Becker:
BB: [...] Und plötzlich war ich das Idol der Nation, der Deutschen, das
Vorbild, eine Marktmacht.
AL: Tolles Gefühl, oder?
BB: Ich hatte keine Ahnung von Geld. Geld war mir nie wichtig. Und
plötzlich sagt zu mir einer: ,,Du kriegst, wenn du das tust, eine Million
Mark." Wieviel ist das überhaupt: eine Million! Und dann sagten meine
Eltern: Das ist ungefähr soviel, wie dein Vater in zehn Jahren verdient.
Und alle Erwachsenen sagen: ,,Das musst du machen." Und das glaubst
du dann auch du bist ja noch ein Kind. Dann machst du einen
Dreijahresvertrag. Und plötzlich, bevor du anfängst zu denken, bist du
an eine Firma gebunden. Plötzlich kommst du aus diesen Verträgen
nicht mehr raus. Aber nach zwei Jahren...
AL: ...begann Boris Becker zu denken?
BB: Genau. Ich versuchte, mit dem Kopf etwas zu machen. Ich habe
entschieden, mit wem ich was machen wollte."
Analyse: Becker beteuert, es ginge ihm vornehmlich ,,um den Sport,
nicht um Clownerie". Gleichzeitig betont er, Geld habe ihm ,,noch nie
viel bedeutet", er sei sich jedoch, aufgrund seiner Lage als
Großverdiener, bewusst, dies nicht glaubhaft vertreten zu können.
Becker stellt explizit heraus, ,,für Geld nicht alles machen" zu wollen
und stützt diese These mit dem Verweis darauf, bereits des Öfteren
gültige Verträge aufgelöst zu haben, wobei er allerdings keine
Firmennamen nennt. Es sei eine Entscheidung für sein eigenes
23
Wohlbefinden und gegen das Geld gewesen, schließlich hätte er
erheblich mehr Werbung machen können. Nach seiner Zeit als ,,Kind",
in der er unwissend, naiv und fremdbestimmt gewesen sei, versuche er
nun, reflektierter und selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen.
Becker vermittelt glaubwürdig, dass Geld für ihn keinen existenziellen
Wert besitzt. Er ist bereits durch Preis- und Werbegelder sehr
vermögend und verfügte 1990, als 22-Jähriger, über eine glänzende
sportliche wie finanzielle Perspektive. Seine Einschätzung, betreffend
der eigenen Glaubhaftigkeit, spricht für ein gutes Urteilsvermögen.
Sein finanzieller Hintergrund erlaubt es ihm oder nötigt ihn ,
intrinsische Motive zu formulieren. Dieser Frage soll nun nachgegangen
werden.
AL: Konkret: Warum sind Sie so vehement gegen den Cup in
Frankfurt
7
?
BB: Es ist schlecht fürs Tennis. Das sind Ego-Trips von den Chiefs, die
zeigen wollen, wer die Macht hat. Dann diese Höhe des Preisgelds,
zwei Millionen, das schadet dem Tennis. Die schmeißen mit dem Geld
nur so um sich.
AL: Das ist doch toll für die Spieler!
BB: Lendl spielt ja auch. Er findet das ja auch geil, daß er in einer
Woche zwei Millionen Dollar verdienen kann. Was ja für Spieler im
Normalfall auch okay ist. Sie spielen, um Geld zu verdienen. Die
meisten Spieler müssen in acht, neun Jahren das verdienen, was ein
Normalbürger in 30 Jahren verdient. Und wenn jetzt irgendein Idiot so
ein Turnier veranstaltet, dann müssen die mitspielen. Nur die Spieler,
7
Gemeint ist der ,,Grand Slam Cup", der von 1990 bis 1999 in Deutschland
ausgetragen wurde und zu dem die besten 16 Spieler der jährlichen vier Grand-Slam-
Turniere eingeladen waren. Der sportliche Wert, der tatsächlich in München
ausgetragenen
Veranstaltung,
war
umstritten,
denn
es
gab
keine
Weltranglistenpunkte zu vergeben. Ebenfalls in der Kritik stand das extrem hohe
Preisgeld von zwischenzeitlich bis zu zwei Millionen Dollar.
24
die nicht mehr so abhängig sind vom Geld und eigentlich die
Geschichte im Tennis bewegen könnten, das heißt: wie Tennis in der
Öffentlichkeit dasteht, die dürfen da nicht spielen. Und dazu gehören
Lendl, McEnroe und ich.
AL: Aber was ist denn nun das Schlechte an diesem Cup?
BB: Er bringt das Tennis in Verruf.
AL: Wieso?
BB: Dieser Cup ist ein Retortenprodukt. Er hat nichts mit der
Vergangenheit und auch nichts mit der Zukunft des Tennis zu tun. Da
wird schamlos versucht, beim momentanen Tennisboom abzusahnen.
Es kann ja nicht nur Turniere geben, bei denen es um nichts anderes
als ums Geld geht. Ich will nicht zum Clown werden, der hin- und
hergeschoben wird, weil jemand mit Geld winkt. Die würden mich jetzt
auch gerne im Kaufhaus sehen, Autogrammstunden gebend. Es geht
um mehr.
Analyse: Autoritäten tritt Becker selbstbewusst entgegen. Er nutzt
seinen Status, um eigene, oft unbequeme, Meinungen zu äußern. In
der Tat vertritt er eine in Tennisspielerkreisen unpopuläre Meinung,
Preisgelder seien zu hoch und deshalb dem Tennis nicht förderlich.
Becker übt heftige Kritik an Ivan Lendl
8
, der ,,geil" darauf sei, in
kürzester Zeit Unmengen Geld zu verdienen. Dabei schränkt er die
Rolle des ,,normalen" Tennisspielers ein, dessen Verpflichtung es sei, in
nur wenigen Jahren Profisport möglichst viel Geld verdienen zu
müssen. Als ,,Idioten" bezeichnet er Funktionäre und Sponsoren, die
für Becker unverständlich, da kontraproduktiv für die Entwicklung des
Tennissports ,,Retortenprodukte" schaffen würden, die ,,nichts mit der
8
Ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste.
25
Vergangenheit und auch nichts mit der Zukunft des Tennis zu tun"
hätten.
Becker macht sich offenbar hintergründige Gedanken zum
momentanen Zustand, der Historie sowie der Zukunft seines Sports.
Im Verlauf des Interviews gesteht er des Öfteren, Meinungs-
verschiedenheiten mit Tiriac auszutragen. Er selbst stehe dem
marktorientierten Denken nicht so nahe wie Tiriac, und daraus
entstehen Spannungen. Das folgende Zitat TIRIACS aus dem
Sportmanagementmagazin ,,Sponsors" verdeutlicht, dass Tiriac, heute
wie damals, eher als Becker bereit ist im Sinne einer ökonomischen
Marktverwertbarkeit mit Traditionen zu brechen: ,,Tennis ist eine
Industrie. Die Leute können von Tradition reden, aber heute ist eine
andere Zeit. Rom war im Altertum die wichtigste Stadt der Welt
heute nicht mehr" (TIRIAC zitiert in SPONSORS 13/2008, 9).
Weiterhin kritisiert Becker eine in seinen Augen stattfindende Über-
Kommerzialisierung im Tennis und fordert eine Reaktion. Diese könne
nur von denjenigen wenigen Protagonisten kommen, ,,die nicht mehr
so abhängig sind vom Geld und eigentlich die Geschichte im Tennis
bewegen könnten", und dazu zählt er u. a. sich selbst. Er wolle mit
gutem Beispiel vorangehen und derartige Kommerzveranstaltungen
boykottieren, um sich nicht wie ein ,,Clown" fühlen zu müssen.
Becker ist in der glücklichen Lage, als Hauptfigur im ,,Tennis-Zirkus"
eine Meinung offen vertreten zu können, ohne direkt nachhaltigen
Schaden davonzutragen. Diese privilegierte Situation nutzt er, um die
angeblichen kommerziellen Auswüchse im Tennis anzuprangern. Als
Aufhänger seiner Kritik wählt Becker den Grand-Slam-Cup in München,
der 1990 zum ersten Mal und fortan jährlich im Dezember ausgetragen
wurde und an dem Becker tatsächlich bis 1993 nicht teilnahm. Die
BERLINER ZEITUNG schrieb am 08. Dezember 1994 zu den großen
Startschwierigkeiten des Münchner Turniers: ,,Die Vereinigung der
26
Berufsspieler, die ATP
9
, empfand die Veranstaltung als Konkurrenz mit
der Konsequenz, daß einige der prominentesten Spieler, unter ihnen
auch Becker, München und seinem Millionenspiel den Rücken kehrten"
(http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/
dump.fcgi/1994/1208/sport/0010/index.html, Stand: 03.07.2008).
Die ATP richtete ihrerseits bereits ein sog. Jahresabschlussturnier aus,
die ATP-Weltmeisterschaft. Es kann deswegen nicht vollständig geklärt
werden, ob Beckers Argumente allein seiner freien Meinung
entsprechen oder ob möglicherweise das Ansinnen der ATP eine Rolle
spielt. Es soll Becker jedoch unterstellt werden, den Grand-Slam-Cup
aus sportlichen Gründen abzulehnen. Seine Entscheidung, ab 1993 in
München zu starten, dürfte nicht unwesentlich von folgender
Entwicklung abhängig gewesen sein: ,,Seit 1990 sind zehn Millionen
Dollar von dem Veranstalter und "seinen Partnern" gestiftet worden,
teils zugunsten der Förderung des Tennissports in der Dritten Welt,
teils zugunsten krebskranker sowie von dem Bosnien-Krieg in
Mitleidenschaft gezogener Kinder" (ebd.).
Einen wichtigen Faktor spielte sicherlich das freundschaftliche
Verhältnis Beckers zum Turnierorganisator Axel Meyer-Wölden, das
beide im Laufe der Jahre aufbauten.
Im Jahr 2000 wurde die ATP-WM gemeinsam mit dem konkurrie-
renden Münchner Grand-Slam-Cup vom neuen Tennis-Masters-Cup
abgelöst.
Auf sein politisches Engagement angesprochen meint Becker:
BB: In unserer kapitalistischen westlichen Welt dominieren die völlig
falschen Werte, und das ist, finde ich, das Hauptproblem. Da hoffe ich,
irgendwann mal, etwas tun zu können.
9
Association of Tennis Professionals
27
AL: Da habe ich schon wieder ihren Partner Eric Jelen im Ohr, der sagt:
,,Er spricht wie ein halber Kommunist, aber das ist einfach mit soviel
Geld im Rücken."
BB: Okay. Gegen diesen Vorwurf kann ich mich schlecht wehren. Geld
ist wichtig, wenn man Hunger leidet. Aber in unserer Gesellschaft gibt
es soviel Geld, da dürfte niemand hungern, niemand ohne eine
Wohnung sein. Das ist doch schizophren, daß es so was gibt. Was ich
mit den falschen Werten meine, ist einfach, daß jeder guckt, daß er ein
bißchen mehr als sein Nachbar hat. Daß Geld einfach das Hauptziel in
unserer Gesellschaft ist das goldene Kalb, um das alle tanzen.
AL: Wissen Sie, was die Bundesbürger im Durchschnitt verdienen?
BB: Ich glaube 2500 Mark.
AL: Es sind die neuesten Zahlen brutto 3372 Mark im Monat. Gibt
es Ihnen manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie an die
Diskrepanz denken zwischen Ihrem Einkommen und dem Ihrer Fans?
BB: Es ist ein Witz, was sie mir bezahlen. Aber bin ich deswegen
überbezahlt? Die Firma Fila hat, seitdem ich für sie werbe, einen
Umsatz wie noch nie. Ich werde also marktgerecht bezahlt. Aber das,
und das ist ja das Schizophrene, ändert nichts an der Tatsache, daß ich
dennoch zuviel verdiene. Das ist ein Witz, wenn ich bedenke, was ich
dafür leiste: Einen Tennisball rüberzuschunckeln übers Netz. Mal ein As
mehr zu schlagen als jemand anders. Also, das habe ich noch nie
verstanden. Noch so ein Witz: Was ich für einen Schaukampf
bekomme! Die Leute kommen, sie zahlen, und die Sponsoren haben
mehr Umsätze. Und da sage ich: Wenn's keinem schadet, mir schadet
es auch nicht also nehme ich das Geld.
[...]
28
AL: Eine Nachrichtenagentur hat Ihren Jahresverdienst mit 15 Millionen
Mark veranschlagt.
BB: Ich mag nicht darüber reden, wie viel ich im Jahr verdiene, es ist
klar: Ich verdiene mehr als genug. Aber Geld war für mich nie und wird
hoffentlich nie das Wichtigste in meinem Leben sein. [...] Ich habe in
meinem ersten Profijahr Wimbledon gewonnen, und hatte somit immer
mehr Geld, als ich ausgeben konnte. Für die meisten Tennisspieler ist
es ganz anders: Sie spielen wegen des Geldes, ich spiele, weil es mir
Spaß macht.
Im Gesprächsverlauf möchte der Interviewer von Becker wissen, wie er
sein Geld anlegt und fragt ihn nach seinem Haus in Kalifornien?
BB: Nein, das habe ich geschenkt bekommen.
AL: Wie bitte?
BB: Das ist ja auch wieder das Schizophrene in unserer Gesellschaft,
daß die Reichen immer reicher werden und dazu noch vieles geschenkt
bekommen.
Analyse: Becker kritisiert die ,,kapitalistische westliche Welt" für ihre
,,völlig falschen Werte". Er wendet sich gegen die Einstellung, Geld als
das höchste Gut einer Gesellschaft anzusehen und dabei nur noch
danach zu streben, mehr Geld als das Umfeld zu erlangen. Mehrfach
fällt der Begriff ,,schizophren", mit dem Becker den für ihn
unerklärbaren Zustand beschreibt, dass eine Gesellschaft aus vielen
reichen und armen Menschen bestünde und es natürliche Mechanismen
gebe, die diesen Zustand nicht nur bedingen, sondern diesem zugleich
förderlich sind. Er sieht sich selbst auf der Seite der Spitzenverdiener,
räumt jedoch ein, dass er ,,dennoch zuviel verdiene", trotz der hohen
Geldsummen, die er mit seinem Namen bewegt. Dabei beleuchtet er
29
das Zustandekommen seines Marktwerts sowie seine sportliche
Leistungen und setzt beide in Beziehung. Dieses Abwiegen und noch
mehr die Tatsache, dass er sich für überbezahlt hält, zeugen von der
Fähigkeit Beckers, Situationen differenziert betrachten zu können.
Seine Argumentation, auch wenn er sich damit der Kritik aussetzt,
klingt deshalb nicht gekünstelt und aufgesetzt. Er habe ,,noch nie
verstanden", wie die Leistung eines Tennisspielers und sei es der
Extraklasse diesen so reich machen könne. Dennoch hat er kein
schlechtes Gewissen, glaubt er doch daran, niemandem zu schaden.
Becker lenkt den Blick darauf, dass es für ihn wichtigere Dinge im
Leben gebe als Geld, betont er doch, ,,mehr als genug zu verdienen".
Er ,,spiele, weil es [ihm] Spaß macht", im Gegensatz zum Großteil
seiner Kollegen, die ,,wegen des Geldes [spielen]". Deutlich tritt hier
seine intrinsische Motivation zum Sport hervor, die durch die
angeführten Motive glaubwürdig erscheinen.
Becker macht sich Gedanken um soziale Fragen. Damit steigt er in die
vermutlich endlose Debatte um die Vermögensverteilung einer
Gesellschaft ein. Heute, im Jahre 2008, wird diese Arm-Reich-
Diskussion aktueller denn je geführt, in Hinblick auf eine ,,gerechte"
Verteilung des Volksvermögens. Bemerkenswert ist, dass Becker an
dieser Thematik ernsthaft interessiert zu sein scheint. Für einen
Superstar, der zudem erst 22 Jahre alt ist, keine gewöhnliche
Verhaltensweise, zeigt sie neben einer manchmal naiv wirkenden
Ehrlichkeit eine gewisse charismatische Reife.
(Quelle: LUIK 1991, 10-51).
Beckers Ausführungen, überprüft anhand des ,,Antwortschemas",
ordnen ihn dem Typ A1/B2 zu. Eindeutig verkündet er: ,,Mir geht es um
Sport", ,,ich bin kein Produkt" und ,,ich spiele, weil es mir Spaß macht".
30
Seine Motivation, trotz hoher Einnahmen weiter Tennis zu spielen, ist
rein intrinsischer Art.
Interessanterweise hält sich Becker für überbezahlt. Er bewertet zwar
seine Aktivitäten als ökonomisch positiv für alle Seiten, interpretiert
jedoch seine eigene Bezahlung, im Verhältnis zu seiner sportlichen
Leistung, als wesentlich zu hoch.
Katarina Witt (ehemalige Weltklasse-Eiskunstläuferin; zum Zeitpunkt
des Interviews mit dem Journalisten Arno Luik 1990 war Witt 24 Jahre
alt)
Arno Luik (AL): Was haben Sie eigentlich für Ihren Olympiasieg in
Calgary bekommen?
Katarina Witt (KW): 25 000 Ostmark ein Witz zu dem, was im
Westen üblich ist, Micky-Maus-Geld, entwürdigend.
AL: Aber das war doch wohl nicht alles?
KW: Es gab noch ein paar Forum-Schecks (DDR-Zahlungsmittel für
Intershops). Ein Witz, wie schon gesagt, zu dem, was ein
Olympiasieger im Westen mit ein paar Werbeverträgen verdienen
kann.
AL: Verbittert?
KW: Nee, für mich war das damals schon viel Geld. Ich konnte mir ein
Auto kaufen. Aber in gewisser Weise bin ich einfach sauer, daß ich
Angebote, die ich damals hatte, nicht annehmen durfte. Aus
moralischen Gründen sei das nicht möglich, wurde mir eingeredet. Die
Angebote bewegten sich immerhin in Millionenhöhe. Mir fiel es
allerdings auch nicht schwer, die Offerten auszuschlagen. Ich war
31
damals ja noch der Meinung, daß es richtig ist, sich nicht kaufen zu
lassen.
AL: Aber heute denken Sie: Hätte ich doch bloß...
KW: Nee, es tut mir einfach leid, weil ich jetzt erfahre, wie dieser Staat
der von mir diese hehre Moral verlangte sich selbst Geld
verschaffte mit Waffenhandel und allen möglichen Deals. Für mich ist
das nur noch eine schreckliche Heuchelei, wie die damals sagten: Wir
verkaufen unseren Sport nicht. Wir sind auf ganz üble Weise verkauft
worden.
AL: Und wie bitte?
KW: Indem wir als Aushängeschild missbraucht worden sind für
unmoralische Politiker.
AL: Was meinen Sie, wie viele Millionen Sie verloren haben, weil Sie
nach Calgary keine Verträge abschließen durften?
KW: Das interessiert mich nicht mehr. Dieses Kapitel ist für mich
abgeschlossen. Es sind sicherlich einige Millionen. Aber ich bin jung.
Ich stehe am Anfang einer neuen Karriere, und ich kann
glücklicherweise auch sagen: Geld ist nicht das Wichtigste in meinem
Leben. Ich weiß natürlich, daß Geld wichtig ist auch in meiner
Gesellschaft wird es immer wichtiger. Ich merke plötzlich und das
macht mich richtig traurig , wie hier der Run auf das Materielle
losgeht: Man muß nun mehr haben als der Nachbar.
AL: Aber Sie sagten einmal, Luxus ist wichtig für Sie.
KW: Was heißt Luxus? Ich brauche keine goldenen Wasserhähne. Ich
brauche eine warme Wohnung, etwas zu essen...
AL: Sie haben ein Grundstück bei Berlin, eine Wohnung in Berlin und...
32
KW: ...für die DDR ist das schon ein Luxus. Aber...
AL: ...Sie sind nun nicht auf der Jagd nach den Millionen?
KW: Bin ich sicherlich nicht. Ich brauch das nicht für mein persönliches
Glück.
AL: Aber wenn jetzt Werbeangebote kämen, die...
KW: ...würde ich die annehmen ohne moralische Skrupel.
AL: Schamgrenzen gibt es in der neuen Zeit nicht mehr?
KW: Doch, doch. Es gibt schon noch ethische Grenzen für mich. Ich
hatte ein Angebot vom ,,Playboy", und die hätten mir alles Geld der
Welt bieten können. Da habe ich nur gelacht.
AL: Aber für Coca-Cola, Symbol des American way of life, könnten Sie
ohne Skrupel werben?
KW: May be, wenn es für Diät-Cola wäre warum nicht? Aber okay: Es
gibt für mich schon noch Grenzen, die ich nicht überschreiten werde.
Im Gesprächsverlauf kommen die Beiden auf Witts Zukunftspläne zu
sprechen, Projekte, wie z. B. den Film ,,Carmen auf dem Eis", in den
nächsten Jahren realisieren zu wollen.
AL: Es macht sich ja auch nicht gut, wenn sich die marxistische
Musterathletin im kapitalistischen Ausland verwirklicht und den real
existierenden Verlockungen des Dollarsegens erliegt.
KW: Warum soll ich mit meinem Können und auch als etwas
großspurig ausgedrückt Kommunistin nicht mein Geld im Ausland
verdienen? Ich habe mich dafür auf die Hinterbeine gestellt. Ich sehe
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836629812
- Dateigröße
- 887 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Sozialwissenschaften, Medien und Sport
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- amateur profisport sportsystem wertevergleich neid ehre
- Produktsicherheit
- Diplom.de