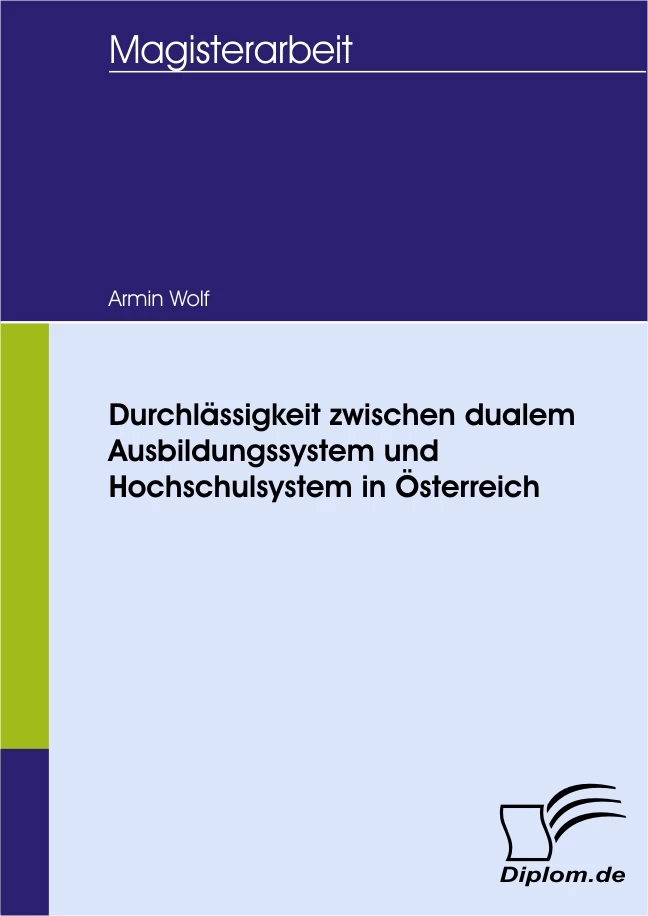Durchlässigkeit zwischen dualem Ausbildungssystem und Hochschulsystem in Österreich
©2008
Magisterarbeit
110 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Abschluss einer Lehre soll gleichwertig sein wie der einer höheren Schule argumentierte der österreichische Wirtschaftskammerpräsident, Christoph Leitl, in einem Interview mit dem Kurier. Der Ruf nach einer Aufwertung dualer Berufsausbildung und einer erhöhten Durchlässigkeit für Lehrlinge in Richtung Hochschulzugang wird immer lauter. Seit dem letzten großen Schritt zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Lehrausbildung und Hochschulzugang mit Einführung der Berufsreifeprüfung (BRP) im Jahr 1997 sind nunmehr zehn Jahre vergangen. Aus einem aktuellen Anlass entstand die Idee für das Thema dieser Arbeit.
Im Mai 2007 erschien eine Forschungsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, welche in die Zukunft gerichtete Modellvorschläge zur Kombination einer Lehrausbildung mit einer Hochschulzugangsberechtigung vorstellt. Als weitere Möglichkeit für Lehrlinge, eine Lehre mit einer Hochschulreife zu verbinden, könnte die Umsetzung eines dieser neu entwickelten Modelle ein weiterer Meilenstein nach Einführung der BRP für die duale Berufsausbildung in Österreich sein. Was genau dieses neue Modell zu leisten vermag, soll an dieser Stelle nicht vorweg genommen werden.
Diese Diplomarbeit verfolgt zweierlei Ziele. Zum Einen wird der Status quo der vertikalen Durchlässigkeit zwischen Berufsschulausbildung und Hochschulsystem in Österreich erfasst und mittels emanzipatorischer Kriterien analysiert. Zum Anderen wird die Institutionalisierung eines sogenannten integrativen Modells diskutiert und einer empirischen Untersuchung unterzogen. Anhand einer qualitativen Erhebung sollen Informationen darüber gewonnen werden, welche möglichen Auswirkungen mit der Institutionalisierung eines integrativen Modells einhergehen würden. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
Teil I: Theorie4
2.Emanzipatorische Sichtweise der Berufsausbildung4
2.1Begriffsabgrenzung Emanzipation4
2.2Kriterien emanzipatorischer Betrachtung5
3.Duale Berufsausbildung in Österreich8
3.1Begriffsabgrenzungen8
3.2Grundlagen des Österreichischen Berufsausbildungssystems10
3.2.1Lernort Betrieb10
3.2.2Lernort Berufsschule12
3.4Vertikale Durchlässigkeit als wirtschaftspolitische Herausforderung14
3.5Stellenwert und Image dualer Ausbildung17
3.6Ausbildungstrend im Zeitablauf18
4.Vertikale Durchlässigkeit dualer Berufsausbildung22
4.1Begriffsabgrenzungen22
4.2Studienberechtigungsprüfung22
4.3Berufsreifeprüfung23
4.4Reifeprüfung an […]
Der Abschluss einer Lehre soll gleichwertig sein wie der einer höheren Schule argumentierte der österreichische Wirtschaftskammerpräsident, Christoph Leitl, in einem Interview mit dem Kurier. Der Ruf nach einer Aufwertung dualer Berufsausbildung und einer erhöhten Durchlässigkeit für Lehrlinge in Richtung Hochschulzugang wird immer lauter. Seit dem letzten großen Schritt zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Lehrausbildung und Hochschulzugang mit Einführung der Berufsreifeprüfung (BRP) im Jahr 1997 sind nunmehr zehn Jahre vergangen. Aus einem aktuellen Anlass entstand die Idee für das Thema dieser Arbeit.
Im Mai 2007 erschien eine Forschungsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, welche in die Zukunft gerichtete Modellvorschläge zur Kombination einer Lehrausbildung mit einer Hochschulzugangsberechtigung vorstellt. Als weitere Möglichkeit für Lehrlinge, eine Lehre mit einer Hochschulreife zu verbinden, könnte die Umsetzung eines dieser neu entwickelten Modelle ein weiterer Meilenstein nach Einführung der BRP für die duale Berufsausbildung in Österreich sein. Was genau dieses neue Modell zu leisten vermag, soll an dieser Stelle nicht vorweg genommen werden.
Diese Diplomarbeit verfolgt zweierlei Ziele. Zum Einen wird der Status quo der vertikalen Durchlässigkeit zwischen Berufsschulausbildung und Hochschulsystem in Österreich erfasst und mittels emanzipatorischer Kriterien analysiert. Zum Anderen wird die Institutionalisierung eines sogenannten integrativen Modells diskutiert und einer empirischen Untersuchung unterzogen. Anhand einer qualitativen Erhebung sollen Informationen darüber gewonnen werden, welche möglichen Auswirkungen mit der Institutionalisierung eines integrativen Modells einhergehen würden. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
Teil I: Theorie4
2.Emanzipatorische Sichtweise der Berufsausbildung4
2.1Begriffsabgrenzung Emanzipation4
2.2Kriterien emanzipatorischer Betrachtung5
3.Duale Berufsausbildung in Österreich8
3.1Begriffsabgrenzungen8
3.2Grundlagen des Österreichischen Berufsausbildungssystems10
3.2.1Lernort Betrieb10
3.2.2Lernort Berufsschule12
3.4Vertikale Durchlässigkeit als wirtschaftspolitische Herausforderung14
3.5Stellenwert und Image dualer Ausbildung17
3.6Ausbildungstrend im Zeitablauf18
4.Vertikale Durchlässigkeit dualer Berufsausbildung22
4.1Begriffsabgrenzungen22
4.2Studienberechtigungsprüfung22
4.3Berufsreifeprüfung23
4.4Reifeprüfung an […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Armin Wolf
Durchlässigkeit zwischen dualem Ausbildungssystem und Hochschulsystem in
Österreich
ISBN: 978-3-8366-2917-1
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich, Magisterarbeit,
2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
I
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung ... 1
Teil I: Theorie ... 4
2. Emanzipatorische Sichtweise der Berufsausbildung ... 4
2.1 Begriffsabgrenzung Emanzipation
...4
2.2 Kriterien emanzipatorischer Betrachtung
...5
3. Duale Berufsausbildung in Österreich ... 8
3.1 Begriffsabgrenzungen
...8
3.2 Grundlagen des Österreichischen Berufsausbildungssystems
... 10
3.2.1 Lernort Betrieb ... 10
3.2.2 Lernort Berufsschule ... 12
3.4 Vertikale Durchlässigkeit als wirtschaftspolitische Herausforderung
... 14
3.5 Stellenwert und Image dualer Ausbildung
... 17
3.6 Ausbildungstrend im Zeitablauf
... 18
4. Vertikale Durchlässigkeit dualer Berufsausbildung ...22
4.1 Begriffsabgrenzungen
... 22
4.2 Studienberechtigungsprüfung
... 22
4.3 Berufsreifeprüfung
... 23
4.4 Reifeprüfung an Schulen für Berufstätige
... 26
4.5 Status quo vertikaler Durchlässigkeit in Österreich
... 27
4.6 Kritisch emanzipat. Betrachtung der Instrumente vertikaler Durchlässigkeit
... 28
4.7 Höhere vertikale Durchlässigkeit durch bessere Anrechnungsmöglichkeiten
... 30
5. Modellbeispiele zur Lehre mit Matura ...32
5.1 Praktizierte Modellkombinationen
... 32
5.1.1 Teilintegration der BRP in die Lehrausbildung ... 32
5.1.2 Lehre mit Matura bei SPAR ... 34
5.2 Neues Modell der Lehre mit Matura in Tirol
... 35
5.3 Kritische emanzipatorische Betrachtung praktizierter Modelle
... 38
II
6. Institutionalisierung eines integrativen Lehre-mit-Matura-Modells ...40
6.1 Begriffsabgrenzungen
... 40
6.2 Integrative Modellvorschläge des BMWA
... 42
6.2.1 Trialität mit einer höheren berufsbildenden Schule ... 42
6.2.2 Trialität mit Tertiäreinrichtung oder Weiterbildungseinrichtung ... 43
6.2.3 Duale berufsbildende Schule ... 44
6.3 Kritisch emanzipatorische Analyse integrativer Modellvorschläge
... 45
6.4 Argumentationslinien für die Institutionalisierung eines integrativen Modells
... 49
Teil II: Empirie ...54
7. Mögliche Auswirkungen der Institutionalisierung eines integrativen Lehre-
mit-Matura-Modells ...54
7.1 Qualitatives Denken als Grundvoraussetzung empirischer Sozialforschung
... 54
7.2 Methode des problemzentrierten Interviews
... 55
7.3 Forschungsaufbau
... 56
7.3.1 Bestimmung der Stichprobe ... 57
7.3.2 Gestaltung der Interviews ... 58
7.4 Qualitative Inhaltsanalyse in neun Stufen nach Phillip Mayring
... 59
8. Auswertung der problemzentrierten Interviews ...66
8.1 Auswertung Interview 1
... 66
8.2 Auswertung Interview 2
... 67
8.3 Auswertung Interview 3
... 68
8.4 Auswertung Interview 4
... 68
8.5 Auswertung Interview 5
... 69
8.6 Vergleichende Interpretation der Ergebnisse
... 70
Teil III: Zusammenführung Theorie und Empirie ...74
9. Parallelen zwischen Theorie und Forschungsergebnissen ...74
10. Handlungsvorschläge ...78
11. Fazit & emanzipatorische Schlussbetrachtung ...80
Literaturverzeichnis ...82
Internetverzeichnis ...86
Verzeichnis der Gesetze & Rechtsverordnungen ...91
Anhang ...92
III
Abkürzungsverzeichnis
AHS
= Allgemein bildende höhere Schule
bfi
= Berufsförderungsinstitut
BAG
= Berufsausbildungsgesetz
BIBB
= Bundesinstitut für Berufsbildung
BHS
= Berufsbildende höhere Schule
BMS
= Berufsbildende mittlere Schule
BMBWK
= Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
BMWA
= Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
BRP
= Berufsreifeprüfung
B-VG
= Bundes-Verfassungsgesetz
FBP
= Fachbereichsprüfung innerhalb der Berufsreifeprüfung
FH
= Fachhochschule
FH-Stg
= Fachhochschulstudiengesetz
HAK
= Handelsakademie
HTL
= Höhere technische Lehranstalt
LAP
= Lehrabschlussprüfung
SBP
= Studienberechtigungsprüfung
SchuOG
= Schulorganisationsgesetz
WIFI
= Wirtschaftsförderungsinstitut
IV
Abbildungs- & Tabellenverzeichnis
Abbildung 1: Ausbildungstrend, Quelle: Blum E. 2006, S. 20 ... 19
Abbildung 2: Aufnahmeverfahren, Quelle: Cernin W. 2007, S. 9 ... 36
Abbildung 3: Phasen der Implementation. Quelle: Sloane P. 2005. ... 40
Abbildung 4: Trialität mit einer höheren Schule, Quelle: Schlögl P. 2007, S. 47 ... 42
Abbildung 5: Trialität mit einer Weiterbildungseinrichtung,
Quelle: Schlögl P. 2007, S. 48 ... 43
Abbildung 6: Trialität mit einer Hochschule, Quelle: Schlögl P. 2007, S. 49 ... 44
Abbildung 7: Duale berufsbildende Schule, Quelle: Schlögl P. 2007, S. 50 ... 45
Abbildung 8: Fachkräftemangel, Quelle: Blum E. 2006, S 12 ... 92
Tabelle 1: Vorbereitungseinheiten für die BRP an der Fachberufsschule für Büro ...
in Innsbruck: Quelle: www.kbibk2.ac.at/kbibk2/index.htm
[Stand 10.12.2007] ... 33
Tabelle 2: Ausbildungsverlauf der Lehre mit Matura bei SPAR,
Quelle: http://www.lehremitmatura.at/downloads/spar_broschuere.pdf
[Stand 12.12.2007] ... 34
Tabelle 3 Ausbildungsfahrplan "Tiroler Modell"
Quelle: Cernin W. 2007, S. 17 ... 37
Tabelle 4: Vorteile praktizierter Lehre-mit-Matura-Modellen, Quelle:
http://www.lehremitmatura.at/index.php?navmode=lmm_vorteile&kat=
0&lang=_ger [Zugriff: 23.01.2008] ... 51
Tabelle 5: Gegenüberstellung SBP & BRP, Quelle: Birke B. 2001, S. 37 ... 93
1
1. Einleitung
,,Der Abschluss einer Lehre soll gleichwertig sein wie der einer höheren Schule"
1
argumen-
tierte der österreichische Wirtschaftskammerpräsident, Christoph Leitl, in einem Interview
mit dem Kurier. Der Ruf nach einer Aufwertung dualer Berufsausbildung und einer erhöhten
Durchlässigkeit für Lehrlinge in Richtung Hochschulzugang wird immer lauter. Seit dem
letzten großen Schritt zur Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen Lehrausbildung und
Hochschulzugang mit Einführung der Berufsreifeprüfung (BRP) im Jahr 1997 sind nunmehr
zehn Jahre vergangen. Aus einem aktuellen Anlass entstand die Idee für das Thema dieser
Arbeit.
Im Mai 2007 erschien eine Forschungsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Arbeit, welche in die Zukunft gerichtete Modellvorschläge zur Kombination einer Lehraus-
bildung mit einer Hochschulzugangsberechtigung vorstellt. Als weitere Möglichkeit für Lehr-
linge, eine Lehre mit einer Hochschulreife zu verbinden, könnte die Umsetzung eines dieser
neu entwickelten Modelle ein weiterer Meilenstein nach Einführung der BRP für die duale
Berufsausbildung in Österreich sein. Was genau dieses neue Modell zu leisten vermag, soll
an dieser Stelle nicht vorweg genommen werden.
Zielsetzung
Diese Diplomarbeit verfolgt zweierlei Ziele. Zum Einen wird der Status quo der vertikalen
Durchlässigkeit zwischen Berufsschulausbildung und Hochschulsystem in Österreich er-
fasst und mittels emanzipatorischer Kriterien analysiert. Zum Anderen wird die Institutionali-
sierung eines sogenannten integrativen Modells diskutiert und einer empirischen Untersu-
chung unterzogen. Anhand einer qualitativen Erhebung sollen Informationen darüber ge-
wonnen werden, welche möglichen Auswirkungen mit der Institutionalisierung eines integra-
tiven Modells einhergehen würden.
1
Leitl C. 2008, In: Hodoschek A.: Turboschub für die Lehrausbildung, Online-Kurier vom 18.01.2008
2
Aufbau der Arbeit
Teil I: Theorie
Der Einstieg in die Theorie erfolgt in Kapitel 2, in dem zunächst emanzipatorische Kriterien
eines optimalen Berufsausbildungssystems definiert werden. Diese dienen im späteren
Verlauf der Arbeit dazu, die vorgestellten Instrumente und Modelle vertikaler Durchlässig-
keit einer kritisch emanzipatorischen Analyse zu unterziehen. Anhand dieser Kriterien wird
werden die im Folgenden dargestellten Instrumente vertikaler Durchlässigkeit analysiert.
In Kapitel 3 wird ein kurzer Einblick in das österreichische Berufsausbildungssystem gege-
ben, um ein Grundverständnis beim LeserIn für die weiterführende Diskussion über die
Durchlässigkeit des dualen Systems zu gewährleisten. Zudem wird eine Argumentationsli-
nie aufgebaut, anhand der die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der vertikalen Durch-
lässigkeit zwischen dualer Berufsausbildung und Hochschulbereich aufgezeigt wird.
Kapitel 4 stellt die für Lehrlinge vorhandenen Instrumente und Möglichkeiten zum Erwerb
einer Hochschulreife vor. Darauf aufbauend erfolgt die Erfassung des Status quo der verti-
kalen Durchlässigkeit für Lehrlinge und eine kritisch emanzipatorische Betrachtung der
Instrumente. Weiters wird die Möglichkeit zur Erhöhung der vertikalen Durchlässigkeit durch
verbesserte Anrechnungsmöglichkeiten zwischen Lehre und Hochschulbereich thematisiert.
In Kapitel 5 werden bereits länger praktizierte und neu eingeführte Modellkombinationen
der Lehre mit Matura vorgestellt und wiederum einer kritisch emanzipatorischen Analyse
unterzogen.
Kapitel 6 stellt drei neu konzipierte Modellvorschläge der Lehre mit Matura, sogenannte
integrative Modelle vor. In einer kritischen Stellungnahme wird das Grundkonzept eines
integrativen Modells unter emanzipatorischen Gesichtspunkten diskutiert. Im Anschluss
werden Gründe, die für die Einführung eines integrativen Modells sprechen, erörtert.
3
Teil II: Empirie
Der empirische Teil dieser Arbeit untersucht mögliche Auswirkungen, die mit der Institu-
tionalisierung eines integrativen Modells einhergehen würden. In Kapitel 7 werden zunächst
die Grundprinzipien qualitativen Forschens angeführt und die Methode des problemzent-
rierten Interview beschrieben. Im Anschluss werden der Forschungsaufbau sowie das Vor-
gehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse in neun Stufen nach Mayring dargestellt. Die
Trennung zwischen Theorie und Praxis erfolgt dadurch, dass die empirischen Teile durch
Kursivschrift hervor gehoben werden.
Die Darstellung und Interpretation der Ergebnisse aus den problemzentrierten Interviews
erfolgt in Kapitel 8. Dabei werden die wesentlichen Ergebnisse für jedes Interview getrennt
interpretiert und Informationen über die Erhebungssituation aus den Postskripten angeführt.
Anschließend werden die Ergebnisse miteinander verglichen, interpretiert und einer Gene-
ralisierung zugeführt. Die vollständigen Ergebnisse der Interviews aus den Auswertungsta-
bellen werden in den Anhang gestellt.
Teil III: Zusammenführung Theorie und Empirie
Im dritten und letzten Teil dieser Arbeit kommt es zu einer Zusammenführung vorhandener
Theorie und den Ergebnissen der qualitativen Forschung. In Kapitel 9 werden vorhandene
Parallelen zwischen Theorie und Empirie aufgezeigt. Unter Verwendung weiterführender
Literatur wird zusätzlich zu bestimmten Ergebnissen der Untersuchung ein theoretischer
Bezug geschaffen.
In Kapitel 10 werden aus den empirischen Ergebnissen Handlungsvorschläge formuliert,
die als Grundlage für Entscheidungen der Bildungspolitik oder für weitere Forschungsvor-
haben der Berufsbildungsforschung dienen können. Abschließend wird in Kapitel 11 aus
emanzipatorischem Blickwinkel ein Fazit über die vertikale Durchlässigkeit zwischen dualer
Berufsausbildung und Hochschulbereich in Österreich gezogen.
Geschlechtsspezifische Bezeichnungen und Formulierungen innerhalb der Arbeit gelten
sinngemäß für beide Geschlechter.
4
Teil I: Theorie
2. Emanzipatorische Sichtweise der Berufsausbildung
2.1 Begriffsabgrenzung Emanzipation
Die im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Modelle der Berufsausbildung werden aus einer
emanzipatorischen Sichtweise betrachtet. Der Begriff der Emanzipation wird sowohl in der
Kritischen Theorie als auch in der Kritischen Erziehungswissenschaft in zweierlei Hinsicht
bestimmt.
2
Verstanden als die Befreiung aus einer Herrschaft definiert Mollenhauer Eman-
zipation als
,,...die Befreiung der Subjekte in unserem Fall der Heranwachsenden in dieser Gesell-
schaft aus Bedingungen, die ihre Rationalität und das mit ihr verbundene gesellschaft-
liche Handeln beschränkt."
3
Als Synonym für die ,,Heranwachsenden" und Bezug herstellend zu dieser Arbeit sind Lehr-
linge zu verstehen, die eine Aufwertung dualer Berufsausbildung durch die Kombination der
Lehre mit einer Reifeprüfung anstreben. Das emanzipatorische Interesse zielt auf die Be-
freiung von Zwängen aller Art ab
4
und wird in dieser Arbeit in Form emanzipatorischer Kritik
verwirklicht. Die zweite, als positiv bezeichnete Sichtweise der Emanzipatorik wird von
Lempert beschrieben als ,,...emanzipatorische Forderungen der substanziellen Vernunft,
die über längere Epochen hinweg gültig bleiben sollen, lassen sich nur auf der Allgemein-
heitsstufe von Grundrechtskatalogen formulieren."
5
Dieses Zitat beschreibt die emanzipatorische Forderung nach Grundrechten, die für alle
Mitglieder einer Gesellschaft gleichermaßen gültig sein müssen. Diesbezüglich ist die von
Mollenhauer genannte Forderung nach Chancengleichheit im Bildungswesen
6
ein Grund-
recht, das in emanzipatorischen Betrachtungen innerhalb dieser Arbeit verfolgt wird. Chan-
cengleichheit wird dabei abgegrenzt als gleiche ,,...Aussichten verschiedener Individuen,
ihre Kräfte zu entwickeln und ihre parallel dazu sich entfaltenden Bedürfnisse zu stil-
len."
7
2
König 2007, S. 128
3
Mollenhauer K. 1977, S. 11
4
Vgl.: Lempert W. 1974, S. 483
5
Lempert W. 1974, S. 489
6
Vgl.: Mollenhauer K. 1977, S 15
7
Lempert W. 1975, S. 80
5
Nachdem das emanzipatorische Grundprinzip der Chancengleichheit angeführt wurde, stellt
sich die Frage, wie der Bildungsbegriff in der Emanzipatorik zu verstehen ist. In emanzipa-
torischem Sinn ist es die Aufgabe der Bildung ..."über die Bedingungen der jeweiligen indi-
viduellen Existenz, über Chancen der Selbstverwirklichung, aber auch über gesamtgesell-
schaftliche Konstellationen und Möglichkeiten zur Gestaltung dieser beizutragen."
8
Die Bil-
dung verlangt dabei nach einer Orientierung im Denken und Handeln. Dem liegt das Prinzip
der Entwicklung und Förderung einer eigenständigen Urteilsfähigkeit zugrunde. Zur
Erlan-
gung dieser Urteilsfähigkeit bedarf es der Aneignung von Wissen, Fähigkeiten und des
Umgangs mit Emotionen.
9
Um einen Bezugspunkt für eine kritische Auseinandersetzung
mit den innerhalb dieser Arbeit vorgestellten Modellen und Instrumenten österreichischer
Berufsausbildung zu schaffen, werden im folgenden Abschnitt emanzipatorische Kriterien
für ein optimales Berufsausbildungssystem in Österreich festgelegt.
2.2 Kriterien emanzipatorischer Betrachtung
Innerhalb dieses Abschnitts angeführte emanzipatorische Kriterien optimaler Berufsausbil-
dung zielen nicht darauf ab, Berufsausbildung bis ins Detail in emanzipatorische Kriterien
zu fassen. Im Sinne einer Leitbildfunktion für die Betrachtung verschiedener Instrumente
österreichischer Berufsausbildung werden jene emanzipatorischen Kriterien der Berufsaus-
bildung angeführt, die Relevanz für nachfolgende Diskussion besitzen.
Das innerhalb dieser Arbeit maßgeblichste Kriterium für ein optimales Berufsausbildungs-
system ist das emanzipatorische Grundprinzip der Chancengleichheit. Innerhalb dieses
Grundprinzips vereinen sich mehrere emanzipatorische Forderungen an ein Berufsausbil-
dungssystem. Ein Berufsausbildungssystem muss dem Anspruch gleicher Rechte und der
Chancengleichheit für alle Lehrlinge entsprechen. Diese Leitidee der Chancengleichheit im
Berufsausbildungssystem lässt sich auf das statistische Proporzmodell und das meritokrati-
sche Modell konzentrieren. Nach dem Proporzmodell wird die Chancengleichheit durch die
Anteile gesellschaftlicher Gruppen (Herkunft, Geschlecht, Ethnie,...) auf den unterschiedli-
chen Ebenen des Bildungssystems gemessen.
10
Innerhalb dieser Arbeit wird die Chancen-
gleichheit anhand des meritokratische Modells bewertet. In diesem Modell wird unter der
Annahme ,,...allen nach ihren Fähigkeiten und Leistungen..."
11
die Chancengleichheit nach
dem Leistungsprinzip bewertet. Alle Jugendlichen sollen nach diesem Prinzip die gleichen
8
Lenz W. 1989, S. 19
9
Vgl.: Lenz W. 1989, S. 19
10
Vgl.: Geißler R. 2005, S. 72
11
Geißler R. 2005, S. 72
6
Möglichkeiten für eine Bildungskarriere haben, die deren individuellen Leistungen sowie
Fähigkeiten entspricht. Gruppenspezifische Merkmale wie Herkunft, Geschlecht oder Ethnie
dürfen dabei keinerlei Rolle spielen.
12
Dieser Anspruch ist auch in der österreichischen
Bundesverfassung verankert:
,,Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz
gegenüber Menschen sind Grundwerte der österreichischen Schule, auf deren
Grundlage
sie der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem
Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein
höchstmögliches Bildungsniveau sichert...".
13
Aus diesem Zitat ist auch der emanzipatorische Anspruch einer stetigen Sicherung und
Weiterentwicklung der Qualität der Berufsausbildung ersichtlich. Im Sinne dieser Qualitäts-
sicherung der Berufsausbildung wurde im Schuljahr 2005/06 mit der Umsetzung der
Qualitätsinitiative Berufsbildung (QIBB) in Österreich begonnen.
14
Ein weiterer emanzipato-
rischer Anspruch innerhalb der Chancengleichheit in der Berufsausbildung bezieht sich auf
die im folgenden Verlauf dieser Arbeit dargestellte Durchlässigkeit des Be-
rufsausbildungssystems. Trifft ein Jugendlicher nach absolvierter Sekundarstufe I eine fal-
sche Weiterbildungsentscheidung, darf diese falsche Entscheidung nicht in eine Sackgasse
für den Jugendlichen führen. Aus diesem Grund muss das Berufsausbildungssystem in
Österreich die Existenz vertikaler Durchlässigkeit zwischen Berufsausbildung und Hoch-
schulzugang für Lehrlinge gewährleisten. Die sogenannte zweite Chance im Bildungssys-
tem stellt die Möglichkeit dar, eine falsche Berufs- oder Schulwahl im weiteren Bildungsweg
wieder zu korrigieren.
15
Eine detaillierte Abgrenzung des Begriffs Durchlässigkeit ist unter
3.1. an späterer Stelle angeführt.
Ein gutes Berufsausbildungssystem muss zudem einem breiten Spektrum an Jugendlichen
offen bzw. zur Verfügung stehen. Angesprochen wird damit nicht nur das grundsätzliche
Recht zur Berufsausbildung, sondern auch die breite Ausrichtung der Ausbildungsmöglich-
keiten in Bezug auf die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen. Stellt ein Ausbildungsmodell
für das Gros der Jugendlichen eine Überforderung dar, wird nur eine schmale Schicht an
leistungsstarken Jugendlichen innerhalb dieses Modells bestehen können. Konzipiert für
ein großes Spektrum ausbildungswilliger Jugendlicher, dürfen leistungsstärkere Jugendli-
12
Vgl.: Geißler R. 2005, S. 72
13
B-VG 2008, Artikel 14 Abs. 5a
14
Timischl W. 2006, S. 6
15
Vgl.: Hillmert S. 2005, S. 155
7
che auch nicht unterfordert werden. ,,Das heißt: Überall, wo unterrichtet, ausgebildet, ge-
lehrt beziehungsweise gelernt oder studiert wird, ist dem Rechnung zu tragen, dass es
nach Wollen und Können den Durchschnitt weit Überragende geben kann."
16
Für diese leis-
tungsstarken bzw. hochbegabten Jugendlichen muss es innerhalb eines Berufsausbil-
dungssystems entsprechende Förderungsmöglichkeiten geben.
17
Neben der breiten Konzipierung der Berufsausbildung stellt auch die Möglichkeit zum
gleichzeitigen Erwerb einer Lehrausbildung und Hochschulreife einen Anspruch dar, den
ein emanzipatorisches Berufsausbildungssystem erfüllen soll. Begründet wird dieser An-
spruch einer stärkeren Verknüpfung von Lehrausbildung und Hochschulreife durch schwin-
dende Lehrlingszahlen, den vorherrschenden Fachkräftemangel, als auch durch den star-
ken Konkurrenzdruck für die duale Ausbildung seitens berufsbildender Schulen.
18
Ein opti-
males Berufsausbildungssystem muss für die Wirtschaft ausreichend qualifizierte Fachkräf-
te ausbilden und für Jugendliche eine attraktive Variante zu einer berufsbildenden höheren
Schule darstellen.
Das derzeit schlechte Image dualer Ausbildung in Österreich als auch der vorherrschende
Fachkräftemangel verlangen diesbezüglich nach einer Aufwertung dualer Ausbildung in
Österreich. Die Möglichkeit zum gleichzeitigen Erwerb der Lehrabschlussprüfung (LAP)
sowie der Reifeprüfung würde dieser Forderung gerecht werden. Experten gaben innerhalb
einer Studie des BMWA mit einer Mehrheit von 68 Prozent an, dass ein Bedarf an einer
Möglichkeit zum parallelen Erwerb von Lehre und Matura besteht.
19
In den Begründungen
wurde dabei vor allem auf den Attraktivitätsgewinn und ein Ansteigen des Stellenwertes
sowie des Images verwiesen.
20
Eine weiters wichtiges Kriterium für die Gestaltung eines Berufsausbildungssystems stellt
die einheitliche Struktur bzw. Transparenz dar. Für Jugendliche als auch für Ausbildungsbe-
triebe erwächst daraus der Vorteil, dass Sie sich innerhalb eines einheitlichen Berufsausbil-
dungssystems leichter zurecht finden und dementsprechend leichter Entscheidungen tref-
fen können.
Das letzte Kriterium für eine emanzipatorische Betrachtung österreichischer Berufsausbil-
dung innerhalb dieser Arbeit betrifft die Finanzierung der Berufsausbildung. Bei der Lehr-
16
Fischer W. 1988, S. 10
17
Vgl.: Fischer W. 1988, S. 10
18
Vgl.: Archan S. 2006, S. 54
19
Vgl.: Schlögl P. 2007, S. 55
20
Vgl. Schlögl P. 2007, S. 56
8
ausbildung sollen die innerhalb der betrieblichen Ausbildung anfallenden Kosten vom Aus-
bildungsbetrieb und die Kosten für die schulische Ausbildung von der öffentlichen Hand
(Bund, Länder) getragen werden.
21
Der Erwerb einer Hochschulreife im Rahmen einer
Berufsausbildung sollte gleichfalls von der Öffentlichkeit getragen werden. Damit werden im
Sinne der Chancengleichheit allen Jugendlichen der Weg einer Berufsausbildung sowie die
Möglichkeit zum Erwerb einer Hochschulreife, unabhängig von der eigenen finanziellen
Situation, sichergestellt. Nachdem in diesem Teil die emanzipatorische Vorstellung optima-
ler Bedingungen für ein Berufsausbildungssystem dargestellt wurde, erhält der LeserIn im
nächsten Abschnitt eine Einführung in das System österreichischer Berufsausbildung.
3. Duale Berufsausbildung in Österreich
3.1 Begriffsabgrenzungen
Duales Ausbildungssystem
In einem Interview bezeichnete der Regierungsbeauftragte für die Lehrlingsausbildung,
Egon Blum, das duale System als ,,...das Herzstück der Berufsausbildung..."
22
in Öster-
reich. Die Berufsausbildung in Österreich findet wie in den Nachbarländern Deutschland
und der Schweiz an zwei Orten (dual), der Berufsschule und im Lehrbetrieb statt. Um mit
einer Lehrausbildung beginnen zu können, müssen Jugendliche die allgemeine Schulpflicht
von neun Jahren absolviert haben.
Jugendliche, die nach der allgemeinen Schulpflicht einen Beruf erlernen wollen, nutzen das
neunte Schuljahr primär durch den Besuch eines polytechnischen Lehrgangs. Dort werden
die SchülerInnen auf den Einstieg in die duale Ausbildung vorbereitet.
23
Nach absolvierter
Pflichtschulzeit beginnen die Lehrlinge zwischen dem 15. und 19. Lebensjahr ihre Lehraus-
bildung. Während der Lehrzeit stehen die Auszubildenden in einem Ausbildungsverhältnis
zu ihrem Lehrbetrieb und sind gleichzeitig SchülerInnen an der Berufsschule. Die Lehr-
lingsausbildung dauert abhäng vom jeweiligen Lehrberuf zwei bis vier Jahre, zumeist je-
doch drei Jahre.
24
21
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 63
22
Blum E. 2005, S. 12
23
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 28
24
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 34
9
Vertikale Durchlässigkeit
Neben einer klaren Strukturierung und Differenzierung gehört die Durchlässigkeit zu den
Prinzipien für die Gestaltung eines Bildungssystems. Die vertikale Durchlässigkeit eines
Bildungssystems bezeichnet die Anschlussfähigkeit zweier Bildungsgänge. Eine hohe
Durchlässigkeit des Ausbildungssystems soll verhindern, dass individuelle Bildungsent-
scheidungen von Jugendlichen in eine Bildungssackgasse führen und nicht mehr korrigiert
werden können.
25
Gäbe es beispielsweise für Lehrlinge keine Möglichkeit zum Erwerb einer
Hochschulreife und damit in weiterer Folge nicht die Option zum Erwerb eines Hochschul-
studiums, wäre die vertikale Durchlässigkeit nicht gegeben. Der Fokus dieser Arbeit liegt in
der Betrachtung der vertikalen Durchlässigkeit zwischen dualem Berufsausbildungssystem
und Hochschulzugang in Österreich.
Horizontale Durchlässigkeit
Im Rahmen der horizontalen Durchlässigkeit wird sichergestellt, dass bei vorliegenden Leis-
tungsvoraussetzungen ein Wechsel der Schulform möglich ist.
26
Ein Beispiel für einen in
Österreich zulässigen horizontalen Wechsel der Schulform ist der ..."Wechsel zwischen
zweitem Lehrjahr und zweitem Jahr einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schu-
le..."
27
. Bei einem horizontalen Wechsel kommt es zu einer Einzelfallprüfung, in der die bei-
den Ausbildungen gegenübergestellt und anhand bestimmter Kriterien (Lehrpläne, Stun-
denzahl, Prüfungsmodus, Qualifikation der Lehrkräfte) miteinander verglichen werden. Auf-
grund des zumeist komplexen und lange dauernden Anrechnungsverfahrens werden derar-
tige Wechsel nur selten durchgeführt.
28
Die Möglichkeiten zur Umsetzung einer besseren Durchlässigkeit liegen in der ,,Öffnung
und Flexibilisierung des Bildungssystems auf vertikaler wie auf horizontaler Ebene"
29
. Die
horizontale Durchlässigkeit wurde der Vollständigkeit halber angeführt und erfährt im weite-
ren Verlauf dieser Arbeit keine weitere Betrachtung.
25
Vgl.: O.V., Bildungskommission NRW 1995, S. 225
26
Vgl.: Kraus J. 2005
27
Schlögl. P. 2007, S. 23
28
Vgl.: Schlögl. P. 2007, S. 23
29
Prager 2007, S. 13
10
3.2 Grundlagen des Österreichischen Berufsausbildungssystems
Um ein Grundverständnis für die weiterführende Diskussion der Durchlässigkeit zwischen
Berufsschule und Hochschulzugang zu gewähren, wird im Folgenden ein kurzer Einblick in
das österreichische Berufsausbildungssystem gegeben.
Die vierjährige Sekundarstufe I (10 - 14 Jahre) endet in Österreich mit der achten Schulstu-
fe. Mit dem neunten und letzten Pflichtschuljahr beginnt die Sekundarstufe II (14 - 18 Jah-
re). Entscheiden sich Jugendliche im Alter von 14 Jahren für einen beruflichen Weiterbil-
dungsweg, stehen ihnen folgende Möglichkeiten einer Berufsausbildung offen:
·
Berufsbildende mittlere Schulen (BMS),
·
Berufsbildende höhere Schulen (BHS),
·
Schulen für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege oder
·
Duale Lehrausbildung.
30
Haben sich die Jugendlichen für den Weg einer Lehrausbildung entschieden und einen
passenden Ausbildungsbetrieb gefunden, schließen sie mit diesem einen schriftlichen
Lehrvertrag ab. Sofern der Lehrling minderjährig ist, bedarf es für den Abschluss eines
Lehrvertrages der Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters.
31
Beendet wird das Lehrver-
hältnis in der Regel nach Ablauf der im Lehrvertrag vereinbarten Lehrzeit.
32
3.2.1 Lernort Betrieb
Rund 80 % der dualen Ausbildung findet in den Lehrbetrieben statt. Dort sollen die Lehrlin-
ge durch ,,learning by doing" die notwendigen praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
langen. Von Beginn an ist der Lehrling in den betrieblichen Arbeitsprozess eingebunden
und erwirbt seine Fähigkeiten unter realen Bedingungen des Arbeitslebens.
33
Darin besteht
zugleich der große Vorteil dualer Ausbildung. Während Ausbildungen an berufsbildenden
mittleren oder höheren Schulen großteils keine verpflichtende praktische Ausbildung vorse-
hen, erwerben Lehrlinge einen vergleichsweise immensen Vorsprung an praktischen Erfah-
rungen in der Arbeitswelt. Innerhalb der betrieblichen Ausbildung gehört es zu den Pflichten
des Lehrlings sich zu bemühen, ..."die für die Erlernung des Lehrberufes erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse zu erwerben; er hat die ihm im Rahmen der Ausbildung über-
30
Vgl.: Mayr T.. 2006, S. 26
31
Vgl.: BAG 2006 § 12 Abs. 1
32
Vgl.: BAG 2006 § 14 Abs. 1
33
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 35
11
tragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen und durch sein Verhalten im Betrieb der
Eigenart des Betriebes Rechnung zu tragen."
34
Genauen Richtlinien unterliegen auch die Ausbildungsbetriebe. So dürfen nur jene Inhaber
eines Gewerbes Lehrlinge ausbilden, die nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung zu
jener Tätigkeit befugt sind, in welcher der Lehrling ausgebildet werden soll. Zudem muss
der Ausbilder über die erforderlichen Fachkenntnisse nach BAG § 3 verfügen, oder diese
anhand einer erfolgreich abgelegten Ausbilderprüfung oder eines Ausbilderkurses nachwei-
sen können.
35
Neben diesen personenbezogenen Voraussetzungen muss auch die betrieb-
liche Infrastruktur entsprechende Voraussetzungen erfüllen. ,,Die Ausbildung von Lehrlingen
ist nur zulässig, wenn der Betrieb oder die Werkstätte, allenfalls unter Berücksichtigung
einer ergänzenden Ausbildung im Rahmen eines Ausbildungsverbundes, so eingerichtet ist
und so geführt wird, dass den Lehrlingen die für die praktische Erlernung im betreffenden
Lehrberuf notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse vermittelt werden können."
36
Zu den Pflichten des Lehrberechtigten gehört auch die Zahlung einer Lehrlingsentschädi-
gung an den Lehrling. Liegen keine kollektivvertragliche Regelungen bezüglich der Höhe
Lehrlingsentschädigung vor, gebührt dem Lehrling jedenfalls die für gleiche, verwandte
oder ähnliche Lehrberufe geltende Entschädigung.
37
Neben diesen grundsätzlichen Ausbildungsvoraussetzungen müssen sich Ausbildungsbe-
triebe an Mindestanforderungen für die zu vermittelnden Lehrinhalte halten um ein Min-
destmaß an betrieblicher Ausbildungsqualität gewährleisten zu können. Diese Mindestan-
forderungen sind in den Ausbildungsordnungen festgelegt. Bezüglich der Dauer der Lehr-
zeit gilt, dass diese in der Regel drei Jahre zu betragen hat und sie nur innerhalb eines Zeit-
raumes von zwei bis maximal vier Jahren festgesetzt werden darf.
38
Maßgebend für die
Festsetzung der Lehrzeit sind ..."die in diesem zu erlernenden Fertigkeiten und Kenntnisse,
der Schwierigkeitsgrad der Ausbildung in dem betreffenden Lehrberuf sowie die Anford-
erungen, die die Berufsausübung stellt..."
39
.
Für die Lehrausbildung anfallende Kosten innerhalb der betrieblichen Ausbildung werden
vom Ausbildungsbetrieb getragen.
34
BAG 2006, § 10 Abs. 1
35
Vgl.: BAG 2006, § 2 Abs. 2
36
BAG 2006, § 2 Abs. 6
37
Vgl.: BAG 2006, § 17 Abs. 1
38
Vgl.: BAG 2006, § 6 Abs. 1
39
BAG 2006, § 6 Abs. 1
12
3.2.2 Lernort Berufsschule
In Österreich gibt es derzeit 172 Berufsschulen, in denen im Schuljahr 2005 / 2006 insge-
samt 128.287 Lehrlinge ausgebildet wurden.
40
Innerhalb berufsbildender Schulen verteilte
sich im Schuljahr 2006/2007 die Schülerzahl folgendermaßen:
-Berufsschulen
38 %
-Berufsbildende mittlere Schulen
16 %
-Berufsbildende höhere Schulen
26 %.
41
Nach Abschluss eines Lehrvertrages mit dem Ausbildungsbetrieb sind die Lehrlinge zum
Besuch der Berufsschule verpflichtet. Aufgabe der Berufsschule ist es, die Lehrlinge in ei-
nem ,,...berufsbegleitenden fachlich einschlägigen Unterricht den berufsschulpflichtigen
Personen die grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu vermitteln, ihre betriebliche Aus-
bildung zu fördern und zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu erweitern."
42
Für den
Besuch der Berufsschule gibt es unterschiedliche Formen:
·
ganzjährig jeweils an einem Tag pro Woche (ca. neun Stunden)
·
geblockt in Form von acht- bis zehnwöchigen Lehrgängen pro Jahr
·
saisonmäßige Berufsschule (geblockter Unterricht zu bestimmter Jahreszeit).
43
Nachdem der Lehrling zum Besuch der Berufsschule verpflichtet ist, hat der Ausbildungs-
betrieb bzw. Lehrberechtigte ,,...die zum Schulbesuch erforderliche Zeit freizugeben und ihn
zum regelmäßigen Schulbesuch anzuhalten sowie auf den Stand der Ausbildung in der Be-
rufsschule nach Möglichkeit Bedacht zu nehmen."
44
Am Ende der Lehrausbildung steht die sogenannte Lehrabschlussprüfung (LAP), die aus
einem praktischen sowie einem theoretischen Teil besteht. Zweck der LAP ist es festzu-
stellen, ,,...ob sich der Lehrling die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten
und Kenntnisse angeeignet hat und in der Lage ist, die dem erlernten Lehrberuf eigentüm-
lichen Tätigkeiten selbst fachgerecht auszuführen."
45
Die während der Berufsausbildung
anfallenden Kosten werden von der öffentlichen Hand getragen.
46
40
Vgl.: O.V., BMBWK 2006
41
Vgl.: Gintensdorfer A. 2007, S. 13
42
SchuOG 2008, § 46 Abs. 1
43
Vgl.: SchuOG 2008, § 49 Abs. 2
44
BAG 2006, § 9 Abs. 5
45
BAG 2006, § 21 Abs. 1
46
Vgl: O.V., BMBWK 2007, S. 11
13
Lehrplan
Die Festlegung der Lehrpläne erfolgt durch die Verordnung des zuständigen Bundesminis-
ters. Die einzelnen Berufsschulen sind innerhalb eines vorgegebenen Rahmens dazu be-
rechtigt, eigene Lehrplanbestimmungen umzusetzen. Nach Bedarf kann der Bundesminis-
ter bestimmen, dass die Lehrplanbestimmungen nicht von den einzelnen Schulen, sonder
von den zuständigen Landesschulräten erlassen werden
.
47
Der Lehrplan aller Berufsschu-
len umfasst sowohl fachspezifische als auch allgemeine Unterrichtsgegenstände. Zu den
allgemeinen Gegenständen gehören beispielsweise Deutsch und Kommunikation, Polit-
ische Bildung, betriebswirtschaftliche Fächer und Berufsbezogene Fremdsprache.
48
Inner-
halb der einzelnen Unterrichtsfächer enthält der Lehrplan die Bildungs- und Lehraufgabe,
den zu unterrichtenden Lehrstoff sowie didaktische Grundsätze für die Lehrkräfte.
49
Rechtliche Zuständigkeiten / Regelungen
Die Verantwortung für Ausbildung in den Berufsschulen fällt auf das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur (BMWK). Die rechtliche Zuständigkeit für die betriebliche
Lehrlingsausbildung sowie die Ausarbeitung des Berufsausbildungsgesetz (BAG).
50
fällt auf
das Wirtschaftsministerium (BMWA). Zusätzlich gibt es auf Landes- sowie auf Bundes-
ebene den sogenannten Bundes-Berufsausbildungsbeirat (BBAB), in dem die Sozialpartner
tätig sind. Die Sozialpartner verhandeln sowohl untereinander als auch mit Vertretern der
Regierung. Die Ausgestaltung neuer Lehrberufe sowie neuer Ausbildungsformen ist der
Konsenskultur der Sozialpartner zu verdanken.
51
FachlehrerInnen
Die FachlehrerInnen der Berufsschulen werden in dreijährigen Lehrgängen an der Berufs-
pädagogischen Akademie ausgebildet.
52
Als Zulassungsvoraussetzung für allgemeinbil-
dende, betriebswirtschaftliche Fächer und für die Fachtheorie gelten eine Reifeprüfung so-
wie eine Wirtschaftspraxis. Für den praktischen Fachunterricht benötigen die KandidatInnen
eine Berufsabschluss mit einer Reife- und Diplomprüfung und eine mehrjährige fachein-
47
Vgl.: SchuOG 2008, § 6 Abs. 1
48
Vgl.: Tajalli 2004, S. 45
49
Vgl.: Gintenstorfer A. 2007, S. 16
50
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 20
51
Vgl.: Schneeberger A. 2007, S. 91
52
Vgl.: O.V., (B) BMWA 2006, S. 10
14
schlägige Praxis. Bezüglich des weiteren Wissenserwerbs sind die Berufsschullehrer ge-
setzlich zu Weiterbildungsmaßnahmen im Ausmaß von 15 Stunden pro Jahr verpflichtet.
53
3.4 Vertikale Durchlässigkeit als wirtschaftspolitische Herausforderung
Obwohl sich Österreich im internationalen Wettbewerb als Exportweltmeister kürt, steht die
österreichische Wirtschaftspolitik schwierigen Rahmenbedingungen gegenüber. Österreichs
Wirtschaft kennzeichnet sich durch eine starke Außenhandelsverflechtung ab. Als Mitglied
der Europäischen Union ist die wirtschaftliche Situation Österreichs unmittelbar von der
Integration östlicher und südöstlicher Nachbarstaaten betroffen. Zudem ändern die Globali-
sierung der Wirtschaftsmärkte sowie die Entwicklung neuer Technologien die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen.
54
Aufgrund der hohen Personalkosten ist es langfristig nicht möglich, Low-Tech-Produkte in
Österreich wirtschaftlich herzustellen. Die personalintensive Produktion von Low-Tech-Pro-
dukten erfolgt bereits in Billiglohnländern wie China oder Taiwan. In der Sachgütererzeu-
gung kann Österreich langfristig gesehen nur durch die Produktion wissensintensiver Er-
zeugnisse, sogenannter High-Tech-Produkte, international wettbewerbsfähig bleiben.
Pfuhlmann verdeutlicht dies mit den Worten: ,,Wir haben keine anderen Rohstoffe als unse-
ren Geist."
55
Die in Österreich dominierenden Wirtschaftsbereiche der Güterherstellung und der Dienst-
leistungen verzeichneten in den letzten Jahren Steigerungen in ihrer Bruttowertschöpfung.
Das in diesen beiden Bereichen geforderte Qualifikationsniveau gilt es auf einem wettbe-
werbsfähigen Level zu halten oder neu zu schaffen.
56
Aus dem ungleichen Beschäftigten-
verhältnis zwischen Dienstleistungsbereich und Güterherstellung erwächst die Forderung
nach einer durchlässigeren Gestaltung dualer Ausbildung in Österreich. Im Jahr 2005 war-
en im 63,5 Prozent der Österreicher im Dienstleistungsbereich und vergleichsweise nur
36,5 Prozent in der Güterherstellung beschäftigt.
57
Für die Zukunft wird allgemein ein weite-
res Wachstum des Dienstleistungsbereiches erwartet.
58
Die daraus folgernden Verände-
53
Vgl.: Mayr T. 2006, S. 48 f.
54
Vgl.: Aiginger K. 2006, S. 2
55
Pfuhlmann H. 1996, S42
56
Vgl.: Blum E. 2006, S. 7
57
Vgl.: O.V., Statistik Austria 2005
58
Vgl.: Walden G. 2007, S. 43
15
rungen in der Beschäftigtenstruktur einer wachsenden Dienstleistungsgesellschaft bleiben
für die Zukunft der Berufsausbildung nicht ohne Auswirkungen.
Durch die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungsbereiches lässt sich nach Baethge
ein ,,...Wandel von Erfahrungswissen zu systematischen (theoretischem) Wissen beschrei-
ben."
59
Das Erfahrungswissen soll dieser Aussage nach zufolge gegenüber der Allgemein-
und wissenschaftlichen Bildung ins Hintertreffen gelangen. Als Auswirkung der abnehmen-
den Bedeutung impliziten Wissens sollen bereits heute zunehmend Hoch- und Fachhoch-
schulabgänger für Arbeitsplätze rekrutiert werden, die früher von Lehrlingen eingenommen
wurden.
60
Damit sich Lehrlinge im Bedeutung gewinnenden Dienstleistungsbereich das not-
wendige systematisch theoretische Wissen aneignen können, ist eine Weiterentwicklung
von Modellen der Verzahnung der Lehrlingsausbildung mit dem Hochschulbereich (=Lehre-
mit-Matura-Modelle) sowie eine verbesserte Durchlässigkeit zwischen dualer Berufsausbild-
ung und Hochschulbereich notwendig.
61
Fachkräftemangel
Die österreichische Wirtschaft klagt schon seit geraumer Zeit über den vorherrschenden
Fachkräftemangel. Als Ursachen für diesen Zustand führt Tessaring an:
·
Verlagerung zu wissensintensiven Dienstleistungen
·
High-Tech-Manufacturing
·
Globalisierung
·
Technologische Entwicklungen.
62
Besonders betroffene Bereiche des Facharbeitermangels in Österreich sind derzeit die Me-
tallindustrie, der Bau- und Elektrobereich sowie der Tourismus.
63
Im Anhang findet sich ein
Beispiel, das die Auswirkungen der Facharbeitermangels für ein Unternehmen darstellt.
Für die Deckung des derzeitigen Arbeitskräftemangels reicht der heimische Fachkräftepool
nicht mehr aus. Deshalb wird als kurzfristige Lösung die Beschäftigung von ausländischen
Fachkräften per 1. 1. 2008 aus den neuen EU-Mitgliedstaaten erleichtert.
64
Langfristig sinn-
voll ist es, dem Fachkräftemangel durch eine Qualifizierungsintensive innerhalb Österreichs
entgegenzuwirken.
59
Baethge M. 2007, S. 74
60
Vgl.: Baethge M. 2007, S. 75
61
Vgl.: Walden G. 2007, S. 46
62
Tessaring M. 2007, S. 61
63
Haberson R. 2007
64
Vgl.: O.V., Sozialpartner 2007, S.13
16
Wirtschaftspolitische Bedeutung der Bildungsentwicklung
Eine weitere wirtschaftspolitische Herausforderung stellt die Arbeitslosigkeit dar. Die Wei-
terentwicklung unseres Ausbildungssystems leistet dabei einen Beitrag zur Senkung der
Arbeitslosenrate.
Die Arbeitslosigkeit betrug in Österreich im Jänner diesen Jahres 5,1 %.
65
und liegt damit
im europäischen Vergleich in der besseren Hälfte. Das derzeitige Wirtschaftswachstum der
Wirtschaft reicht laut Experten nicht aus, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Zur Anhebung
der Beschäftigungszahlen ist die Erhöhung des Wirtschaftswachstums das wichtigste In-
strument.
66
Das österreichische Institut für Wirtschaftsforschung entwickelte elf Strategieli-
nien für die Hebung von Wachstum und Beschäftigung. Eine dieser Strategielinien umfasst
die Weiterentwicklung des österreichischen Aus- und Weiterbildungssystems.
Diese Strategielinie sieht vor, dass die soziale Selektion im Bildungssystem reduziert wer-
den soll. Weiters verfolgt sie den Anspruch, das Ausbildungssystem sowohl vertikal als
auch horizontal durchlässiger werden zu lassen. Innerhalb beruflicher Ausbildung sollen
insbesondere moderne Berufe eine stärkere Zuwendung erfahren und die Möglichkeit zur
Erreichung einer Hochschulzugangsberechtigung offen gehalten werden.
67
Die Entwicklung
einer verbesserten Durchlässigkeit trägt damit bei, den Hebel zur Erhöhung des Wirt-
schaftswachstums zu stärken und in weiterer Folge die Arbeitslosenquote zu senken.
Demographische Entwicklung
Die Betrachtung der Bevölkerungszahlen zeigt, dass es derzeit in Österreich über 95.000
Jugendliche im Alter von 15 Jahren gibt. Während es im Jahr 1980 über 135.000 15-jährige
in Österreich gab, veranschaulichen die Geburtenraten ein stetes Sinken der Zahl 15-jähri-
ger. Im Schuljahr 2016/2017 wird es mit 85.000 Jugendlichen ein vorhersehbares Höchst-
tief an Jugendlichen geben.
68
Eine weitere demografische Entwicklung in Österreich ist die zunehmend alternde Gesell-
schaft. Mit dem Jahr 2009 steigt die Zahl der Ruhestände.
69
Die durch Ruhestände freiwer-
denden Facharbeitsplätze und die abnehmende Zahl Jugendlicher bilden eine wachsende
Kluft. In Anbetracht des aktuellen Facharbeitermangels sind dies höchst alarmierende Fak-
65
Vgl.: O.V., (A) BMWA 2006
66
Vgl.: Aiginger K. 2006, S. 3
67
Vgl.: Aiginger K. 2006, S. 6
68
Vgl.: Blum E. 2006, S. 22
69
Vgl.: Blum E. 2006, S. 23
17
ten, aus denen die Herausforderung für die duale Berufsausbildung der nächsten Jahre
abzulesen ist. Diese besteht der darin, aus der geringer werdenden Zahl an Jugendlichen
wieder eine größere werdende Zahl an Fachkräften zu gewinnen. Gelingt dies nicht, wird
die Sicherung Österreichs als Wirtschaftsstandort von der Zuwanderung ausländischer
Fachkräfte abhängen.
3.5 Stellenwert und Image dualer Ausbildung
In der heutigen Wettbewerbsgesellschaft läuft die Allokation der Jugendlichen zu einem
großen Teil über Schulabschlüsse. In dem daraus resultierenden Selektionsprozess wird
die Wertigkeit der verschiedenen Abschlüsse gegenüber gestellt. Die Frage nach der
grundsätzlichen Gleichwertigkeit von Lehrabschluss und Matura führte innerhalb einer Stu-
die des BMWA zu einem eindeutigen Ergebnis. Eine Mehrheit von 85 % der befragten Ex-
perten bewerteten diese Abschlüsse als nicht ebenbürtig und sehen in der Matura einen
höherwertigen Abschluss.
70
Zum Großteil wird dieser Wertigkeitsunterschied durch mehr vermitteltes Allgemeinwissen
innerhalb einer Maturaschule begründet. Neben einer höheren Leistungsanforderung bei
der Matura wird auch darauf verwiesen, dass die theoriebezogene Matura mit einer praxis-
orientierten Lehrausbildung grundverschieden und damit nicht vergleichbar ist. Zudem be-
rechtigt die Matura vergleichsweise zur Lehre zum Besuch einer Hochschule. Acht Prozent
der befragten Experten betrachteten den Lehrabschluss und die Matura als gleichwertig.
Dies gelte insbesondere für die Lehrausbildungen in High-Tech-Berufen oder Lehrberufen
wie beispielsweise MechatronikerIn.
71
Trend zu höherer Schulausbildung
In der heutigen Wettbewerbsgesellschaft läuft die Allokation der Jugendlichen zu einem
großen Teil über Schulabschlüsse. In dem daraus resultierenden Selektionsprozess wird
die Wertigkeit der verschiedenen Abschlüsse gegenüber gestellt. Ein Lehrabschluss wird in
Österreich in der Regel mit einem Maturaabschluss verglichen (siehe 3.5). Trifft ein Ju-
gendlicher im Alter von 14 Jahren die Entscheidung zwischen einer praxisorientierten Lehr-
ausbildung oder einer theorieorientierten Maturaschule, sind zumeist die Eltern mit an der
Entscheidung beteiligt. Den Eltern ist es ein ,,natürliches" Interesse, ihrem Kind einen mög-
70
Vgl.: Schlögl. P. 2007, S. 59
71
Schlögl P. 2007, S. 60
18
lichst hohen Schulabschluss zu ermöglichen.
72
Das schlechte Image der Lehre sowie eine
irreführende Interpretation von Schulstatistiken verunsichern viele Jugendliche und deren
Eltern. Viele Jugendliche und Eltern lassen sich durch das schlechte Image der Lehre so-
wie irreführende Interpretationen von Schulstatistiken verunsichern. Als Folge wird in vielen
Fällen eine Entscheidung gegen eine Lehrausbildung getroffen, ..."die weder der Eignung
noch der Neigung entspricht, und auch nicht auf die Jobchancen des heimischen Wirt-
schaftsraumes Rücksicht nimmt."
73
Der Trend zu ,,höherwertigen" Abschlüssen stellt eine bedrohliche Konkurrenz für das der-
zeitige Lehrausbildungssystem dar. Die Orientierung an allgemeinbildenden und akademi-
schen Ausbildungen setzt das duale System der Berufsausbildung einem zunehmenden
Druck aus. Die daraus entstehenden Erwartungen an das duale System machen eine
Kombination der Lehrausbildung mit einer Hochschulzugangsberechtigung (Matura) zu-
nehmend attraktiver.
74
Damit Jugendliche ihre Berufs- oder Schulwahl nach persönlicher
Eignung und Neigung treffen können, sollte die duale Berufsausbildung den schulisch
orientierten Berufsausbildungswegen gleichwertig gestellt werden. Die Ausbildungsent-
scheidungen würden sich dann nach den jeweils unterschiedlichen Qualifikationsschwer-
punkten, und nicht nach verfälschten Imagewerten richten.
75
3.6 Ausbildungstrend im Zeitablauf
Während sich im Jahr 1975 noch rund die Hälfte aller Jugendlichen für den Weg einer
Lehrausbildung entschieden hat, werden es bis im Jahr 2015 es nur mehr 25 35 % sein.
Abbildung 2 veranschaulicht die Entwicklung der Ausbildungsentscheidung von Jugendli-
chen im Alter von 15 Jahren. Aus der Grafik geht in erster Linie der Trend zu höheren all-
gemein- oder berufsbildenden Schulen hervor. Im Vergleich steht die duale Ausbildung vor
einer drastischen Entwicklung. Mit dem Jahr 2009 wird die Anzahl der 15-jährigen stark
abnehmen. Daraus resultiert eine starke Abnahme der Zugänge einer dualen Berufsausbil-
dung. Im Jahr 2015 werden um geschätzte 18.000 junge Österreicher weniger der Ent-
scheidung einer dualen oder schulischen Ausbildung gegenüber stehen. Um dieser Ent-
wicklung entgegen zu steuern, bedarf es einer attraktiveren Gestaltung dualer Ausbildung
sowie einer Revitalisierung des Images der Lehrausbildung.
72
Vgl.: Däschler-Seiler 2004, S. 126
73
Blum E. 2006, S. 15
74
Vgl.: O.V., Bildungskommision NRW 2005, S. 260
75
Vgl.: Blum E. 2006, S. 21
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836629171
- DOI
- 10.3239/9783836629171
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leopold-Franzens-Universität Innsbruck – Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2009 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- berufsausbildung durchlässigkeit berufsreifeprüfung matura hochschulzugang
- Produktsicherheit
- Diplom.de