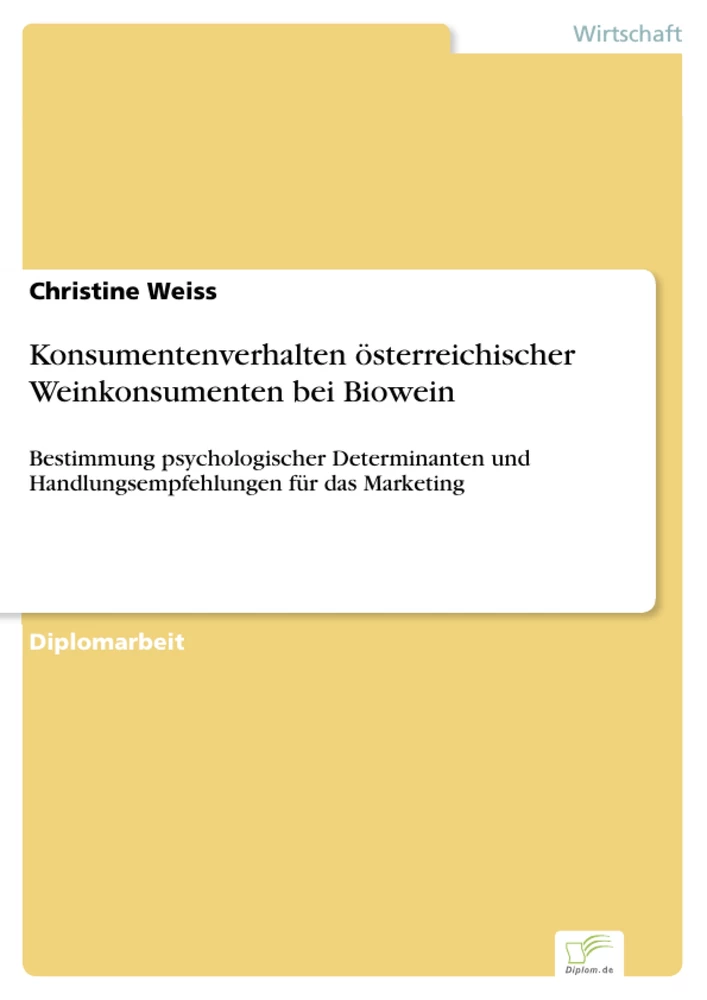Konsumentenverhalten österreichischer Weinkonsumenten bei Biowein
Bestimmung psychologischer Determinanten und Handlungsempfehlungen für das Marketing
Zusammenfassung
Bio bei Wein ist noch immer weit davon entfernt, wie bei Lebensmitteln als Kaufargument zu dienen, (...). Während bei Lebensmitteln wie Gemüse, Milchprodukten oder Fleisch das Bio-Logo an der Verpackung beim Konsumenten einen eindeutigen Nutzen und Mehrwert erkennen lässt, dient bio beim Genussmittel Wein höchstens als Zusatznutzen, der das Gewissen beruhigt. Anders als bei Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs, bei denen mit dem Begriff bio ein höherer Geschmacksstandard und unbedenklicher Genuss assoziiert wird, hat ein Biolabel am Weinetikett weder eine Auswirkung auf oflaktorische Eindrücke noch auf die Gesamtwahrnehmung des Weins.
Noch vor wenigen Jahren gab es nur wenige Winzer, die ihre Weingärten biologisch bewirtschafteten. Inzwischen steigt die Anzahl der Betriebe, die Wein aus biologischem Anbau produzieren von Jahr zu Jahr. Dennoch ist das Image von Biowein nicht zufrieden stellend. Konsumenten assoziieren mit Wein aus biologischem Anbau nach wie vor Eigenschaften wie sauer oder weniger fruchtig. Aus diesem Grund bewirtschaftet so mancher Winzer seine Rebflächen nach ökologischen Richtlinien, ohne den Wein aber auch als solchen zu vermarkten.
Das noch immer nachhinkende Image von Biowein und die geringe Akzeptanz seitens der österreichischen Konsumenten macht es sowohl Dachverbänden wie Bio-Austria, als auch den Winzern selbst sehr schwer, entsprechendes Marketing zu betreiben. Es gibt keine bzw. nur unzureichende Informationen über das Kaufverhalten der Weinkonsumenten. Psychologische Faktoren, wie Einstellung und Emotionen der Konsumenten sowie der Wissensstand über das Produkt sind weitestgehend unbekannt. Ebenso wenig gibt es Informationen über die Erwartungen der Konsumenten an Biowein, die Erwartungen an das Produkt und die entsprechende Vermarktung und Kommunikation. Weiters sind die Erwartungen an die Aufmachung und den Preis nicht bekannt. Dieses Defizit an Informationen über die Konsumenten erschwert es allen Beteiligten der Branche, gezielte Marketingmaßnahmen zu setzen. Für den Erfolg eines Produktes sind diese jedoch Grundvoraussetzung, daher besteht ein großer Forschungsbedarf.
Ziel dieser Arbeit ist es, das Konsumentenverhalten der österreichischen Weinkonsumenten zu untersuchen und dabei festzustellen, welchen Einfluss psychologische Determinanten auf das Verhalten der Konsumenten beim Kauf von Biowein haben. Zusätzlich soll die Studie Aufschluss geben, ob es Unterschiede im […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1. EINFÜHRUNG
1.1. PROBLEMSTELLUNG
1.2. ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN
1.3. WISSENSCHAFTLICHE METHODIK
1.4. AUFBAU DER ARBEIT
2. WEIN AUS BIOLOGISCHEM ANBAU
2.1. BEGRIFFSDEFINITIONEN UND GRUNDLAGEN
2.1.1. Biologischer Anbau
2.1.2. Biologischer Weinbau
2.1.2.1. Organisch-biologischer Weinbau
2.1.2.2. Biologisch-dynamischer Weinbau
2.1.3. Dachorganisationen und Verbände für biologischen Landbau
2.2. DER MARKT VON BIOWEIN
2.2.1. Österreichischer Weinmarkt
2.2.2. Österreichischer Markt von Biowein
2.2.3. Produktion von biologisch erzeugten Produkten
2.2.4. Internationaler Markt von Biowein
2.3. ZIELGRUPPENDEFINITION
2.3.1. Konsumenten von Bioprodukten
2.3.2. Weinkonsumenten in Österreich
2.3.3. Konsumenten von Biowein
3. KONSUMENTENVERHALTEN
3.1. ALLGEMEINES ZUM KONSUMENTENVERHALTEN
3.2. PSYCHOLOGISCHE DETERMINANTEN
3.2.1. Grundlagen psychologischer Faktoren
3.2.2. Aktivierende Prozesse
3.2.2.1. Einstellung und Konsumentenverhalten
3.2.2.2. Motivation und Konsumentenverhalten
3.2.2.3. Emotionen und Konsumentenverhalten
3.2.3. Kognitive Prozesse
3.2.3.1. Konsumentenwissen und Kaufverhalten
3.2.3.2. Informationserwerb und –verarbeitung
3.2.4. Image und Kaufverhalten
4. MARKETING VON WEIN
4.1. MARKETING GRUNDLAGEN
4.1.1. Marketingziele
4.1.2. Marketing-Mix
4.2. DER MARKETING-MIX FÜR WEIN
4.2.1. Die Produktpolitik von Wein
4.2.2. Der Preis als Marketinginstrument
4.2.3. Die Absatzkanäle von österreichischem Wein
4.2.4. Die Kommunikationsinstrumente für Wein
4.2.4.1. Persönlicher Verkauf
4.2.4.2. Werbung
4.2.4.3. Verkaufsförderung
4.2.4.3. Messen und Ausstellungen
4.2.4.4. Direktmarketing
4.2.4.5. Online-Marketing
4.2.4.6. Public Relations
5. EMPIRISCHE STUDIE
5.1. GRUNDLAGEN ZUR EMPIRISCHEN STUDIE
5.1.1. Untersuchungsziele und Hypothesen
5.1.2. Methodik und Stichprobe
5.1.3. Struktur und Design des Fragebogens
5.2. ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG
5.2.1. Beschreibung der Stichprobe
5.2.2. Konsum von konventionellem Wein
5.2.3. Konsum von Biowein
5.2.4. Psychologische Determinanten von Biowein
5.2.4.1. Konsumentenwissen über Biowein
5.2.4.2. Kaufmotive für Biowein
5.2.4.3. Einstellung der Konsumenten zu Biowein
5.2.5. Marketing von Biowein
5.2.5.1. Absatzkanäle und deren Bedeutung
5.2.5.2. Informationen zur Preisakzeptanz von Biowein
5.2.5.3. Einflussfaktoren beim Kauf von Biowein
5.2.5.4. Präferenzen zur Marktkommunikation von Biowein
5.2.6. Prüfung der Hypothesen
6. EMPFEHLUNGEN FÜR DAS MARKETING VON BIOWEIN
6.1. EMPFEHLUNGEN ZUR PRODUKTPOLITIK
6.2. EMPFEHLUNGEN ZUR PREISPOLITIK
6.3. EMPFEHLUNGEN ZUR DISTRIBUTIONSPOLITIK
6.4. EMPFEHLUNGEN ZUR KOMMUNIKATIONSPOLITIK
7. CONCLUSIO
ANLAGENVERZEICHNIS
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Die vier Grundsätze des biologischen Weinbaus
Abbildung 2: Bio Austria Netzwerk
Abbildung 3: Aufteilung der Weinproduktion nach Bundesländern 2006
Abbildung 4: Anteil von Biowein am österreichischen Weinmarkt 2006
Abbildung 5: Entwicklung Bioweinbau in Österreich 1993 – 2005
Abbildung 6: Produktionsentwicklung Biowein in Österreich 2002 – 2006 in hl
Abbildung 7: Die 20 wichtigsten Länder in Bezug auf biologischen Anbau
Abbildung 8: Länder mit dem höchsten %-Anteil an biologischem Anbau
Abbildung 9: Bioweinbaufläche weltweit
Abbildung 10: ISOE-Lebensphasenmodell - Zielgruppen für Bio-Lebensmittel
Abbildung 11: Sinus-Milieus in Deutschland 2006 – Einkauf von Bioprodukten
Abbildung 12: Kauffrequenz und Kaufort von Wein in %
Abbildung 13: Soziodemographische Struktur Heavy vs. Little Buyer in %
Abbildung 14: Komponenten von Einstellungen
Abbildung 15: Drei Effekthierarchien
Abbildung 16: Beispiele zur eindimensionalen Einstellungsmessung
Abbildung 17: Variableninteraktion zur Erklärung des Motivationsbegriffes
Abbildung 18: Maslow´sche Bedürfnispyramide
Abbildung 19: Aktivitäten bei der Informationsverarbeitung
Abbildung 20: Auszug aus einem Semantischen Differenzial für Biowein
Abbildung 21: Die „vier P´s“ des Marketing-Mix
Abbildung 22: Preisklassen für Wein in der Bouteille – Menge in %
Abbildung 23: Absatz Wein gesamt nach Handelskanälen – Menge in %
Abbildung 24: Anteile der Werbeträger
Abbildung 25: Überblick Verkaufsförderungsinstrumente
Abbildung 26: Medien des Direktmarketing
Abbildung 27: Operationalisierung der Variablen der Hypothesen
Abbildung 28: Methodischer Steckbrief der Befragung
Abbildung 29: Struktur des Fragebogens
Abbildung 30: Altersverteilung der Stichprobe in %
Abbildung 31: Herkunft nach Bundesländern in %
Abbildung 32: Monatliches Nettohaushaltseinkommen
Abbildung 33: Konsumintensität konventioneller Wein allgemein
Abbildung 34: Weininteresse der Befragten in %
Abbildung 35: Kaufintensität Biolebensmittel in %
Abbildung 36: Konsumverhalten und Bekanntheitsgrad von Biowein in %
Abbildung 37: Kaufintensität von Biowein in %
Abbildung 38: Produktkenntnis der Konsumenten über Biowein
Abbildung 39: Kaufgründe für Biowein
Abbildung 40: Nichtkaufgründe für Biowein
Abbildung 41: Einstellung der Konsumenten zu Biowein im Vergleich zu konventionellem Wein
Abbildung 42: Bevorzugte Kauforte für konventionellen Wein in %
Abbildung 43: Bevorzugte Kauforte für Biowein in %
Abbildung 44: Preisempfinden für konventionellen Wein bei Grünem Veltliner
Abbildung 45: Preisempfinden für Biowein bei Grünem Veltliner
Abbildung 46: Preisempfinden für konventionellen Wein bei Zweigelt
Abbildung 47: Preisempfinden für Biowein bei Zweigelt
Abbildung 48: Einflussfaktoren beim Kauf von konventionellem Wein
Abbildung 49: Einflussfaktoren beim Kauf von Biowein
Abbildung 50: Bevorzugte Kommunikationskanäle für konventionellen Wein
Abbildung 51: Bevorzugte Kommunikationskanäle für Biowein
Abbildung 52: Bedeutung von persönlichem Verkauf bei konventionellem Wein
Abbildung 53: Bedeutung von persönlichem Verkauf bei Biowein
Abbildung 54: Kreuztabelle zu Hypothese
Abbildung 55: Chi-Quadrat-Test zu Hypothese
Abbildung 56: Kreuztabelle zu Hypothese
Abbildung 57: Kreuztabelle zu Hypothese
Abbildung 58: Kreuztabelle zu Hypothese
Abbildung 59: Kreuztabelle zu Hypothese
1. EINFÜHRUNG
1.1. PROBLEMSTELLUNG
„Bio bei Wein ist noch immer weit davon entfernt, wie bei Lebensmitteln als Kaufargument zu dienen, [...]“ (Schrampf 2006, o. S.). Während bei Lebensmitteln wie Gemüse, Milchprodukten oder Fleisch das Bio-Logo an der Verpackung beim Konsumenten einen eindeutigen Nutzen und Mehrwert erkennen lässt, dient „bio“ beim Genussmittel Wein höchstens als Zusatznutzen, der das Gewissen beruhigt (vgl. Schrampf 2004, o. S.). Anders als bei Lebensmitteln des täglichen Gebrauchs, bei denen mit dem Begriff „bio“ ein höherer Geschmacksstandard und unbedenklicher Genuss assoziiert wird, hat ein Biolabel am Weinetikett weder eine Auswirkung auf oflaktorische Eindrücke noch auf die Gesamtwahrnehmung des Weins (vgl. Vortrag Ebster, 2007).
Noch vor wenigen Jahren gab es nur wenige Winzer, die ihre Weingärten biologisch bewirtschafteten. Inzwischen steigt die Anzahl der Betriebe, die Wein aus biologischem Anbau produzieren von Jahr zu Jahr (vgl. Vortrag Zind-Humbrecht, 2007). Dennoch ist das Image von Biowein nicht zufrieden stellend. Konsumenten assoziieren mit Wein aus biologischem Anbau nach wie vor Eigenschaften wie „sauer“ oder „weniger fruchtig“ (vgl. Vortrag Stöckl , 2007). Aus diesem Grund bewirtschaftet so mancher Winzer seine Rebflächen nach ökologischen Richtlinien, ohne den Wein aber auch als solchen zu vermarkten (vgl. Schrampf 2004, o. S.).
Das noch immer nachhinkende Image von Biowein und die geringe Akzeptanz seitens der österreichischen Konsumenten macht es sowohl Dachverbänden wie Bio-Austria, als auch den Winzern selbst sehr schwer, entsprechendes Marketing zu betreiben. Es gibt keine bzw. nur unzureichende Informationen über das Kaufverhalten der Weinkonsumenten. Psychologische Faktoren, wie Einstellung und Emotionen der Konsumenten sowie der Wissensstand über das Produkt sind weitestgehend unbekannt. Ebenso wenig gibt es Informationen über die Erwartungen der Konsumenten an Biowein, die Erwartungen an das Produkt und die entsprechende Vermarktung und Kommunikation. Weiters sind die Erwartungen an die Aufmachung und den Preis nicht bekannt. Dieses Defizit an Informationen über die Konsumenten erschwert es allen Beteiligten der Branche, gezielte Marketingmaßnahmen zu setzen (vgl. Expertengespräch Weiss, 2007). Für den Erfolg eines Produktes sind diese jedoch Grundvoraussetzung, daher besteht ein großer Forschungsbedarf.
1.2. ZIELSETZUNG UND FORSCHUNGSFRAGEN
Ziel dieser Arbeit ist es, das Konsumentenverhalten der österreichischen Weinkonsumenten zu untersuchen und dabei festzustellen, welchen Einfluss psychologische Determinanten auf das Verhalten der Konsumenten beim Kauf von Biowein haben. Zusätzlich soll die Studie Aufschluss geben, ob es Unterschiede im Kaufverhalten zwischen Biowein und konventionellem Wein gibt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden Empfehlungen für die Vermarktung von Biowein abgeleitet.
In dieser Arbeit wird ausschließlich der B2C-Markt, also der Endverbrauchermarkt, von österreichischem Biowein untersucht. Die Konzentration fällt dabei auf die Zielgruppe der weininteressierten Personen in Österreich. Keine Relevanz in dieser Arbeit hat der B2B-Markt, wie Großhandel, Zwischenhandel oder Einzelhandel.
Abgeleitet aus der Zielsetzung dieser Arbeit ergeben sich folgende Forschungsfragestellungen:
- Welchen Einfluss haben psychologische Determinanten wie Einstellung, Motivation, Wissen und Informationserwerb auf das Kaufverhalten der Weinkonsumenten in Österreich?
- Welche Meinung haben Konsumenten über Biowein?
- Aus welchen Gründen wird Biowein gekauft bzw. nicht gekauft?
- Was weiß der Konsument über Biowein? Ist er ausreichend informiert?
- Wie informiert sich der Konsument über Biowein? Welche Kommunikationskanäle sind von Relevanz?
- Welche Empfehlungen können für das Marketing von Biowein aufgrund der aus der empirischen Studie gewonnenen Erkenntnisse abgeleitet werden?
1.3. WISSENSCHAFTLICHE METHODIK
Der theoretische Teil dieser Arbeit basiert auf den Erkenntnissen aus einschlägiger Fachliteratur. Neben Büchern und Fachzeitschriften über Konsumentenverhalten, Marketing und Wein liegt dieser Arbeit eine Analyse des Ist-Zustandes des Biowein-Marktes in Österreich zu Grunde. Die Daten stammen aus Studien und Erhebungen von Bio Austria und der Österreichischen Weinmarketing Service GmbH (ÖWM) sowie aus Gesetzestexten, Expertengesprächen und Vorträgen.
Der empirische Teil dieser Arbeit stützt sich auf eine quantitative Befragung mittels Onlinebefragung. Diese Art der Befragung wird gewählt, da durch den webbasierten Zugriff auf den Onlinefragebogen, innerhalb kurzer Zeit, eine große Anzahl an Weinkonsumenten in ganz Österreich in allen soziodemographischen Schichten erreicht werden kann. Darüber hinaus kann aufgrund der Flexibilität beim Ausfüllen des Fragebogens sowie aufgrund der zeitlichen Unabhängigkeit der Probanden mit einer hohen Rücklaufquote gerechnet werden.
Als Erhebungsinstrument wird eine internetgestützte Befragung gewählt, die auf einem standardisierten Fragebogen mit geschlossenen Fragen basiert. Der Fragebogen wird über das Weinforum www.weinpanorama.at im Internet und über E-Mails an weininteressierte Freunde bzw. Bekannte verteilt. Zusätzlich erfolgt die Distribution in Kooperation mit Winzern, die den Link an ihre Weinkunden weiterleiten. Die Onlinebefragung richtet sich dadurch gezielt an Weinkonsumenten und weininteressierte Personen in ganz Österreich.
Als Einschränkung der Onlinebefragung ist anzuführen, dass nicht alle Bevölkerungsschichten und Altersgruppen gleich gut erreicht werden können. Schwankungen bestehen vor allem bei den verschiedenen Altersklassen. Laut einer Studie von ARD/ZDF im Jahr 2004 verfügen bis zu 90 % aller Schüler und Studenten über einen Internetanschluss, bei der Altersklasse 60+ sind es nur noch 13 % (vgl. o. V. 2005, S. 40). Weinkonsumenten aus höheren Altersschichten können daher durch diese Methode eher schlecht erreicht werden.
1.4. AUFBAU DER ARBEIT
Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird neben der Problemstellung, die die Relevanz des Themas beschreibt, auf die Zielsetzung der Arbeit und die Forschungsfragestellung eingegangen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die wissenschaftliche Methodik und der Aufbau der Arbeit erläutert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Überbegriff „Wein aus biologischem Anbau“ und gibt einen Überblick über die Grundbegriffe und die Marktsituation von Biowein in Österreich. Neben Erklärungen von Fachbegriffen gibt dieses Kapitel einen Einblick in die Welt des Bioweins sowie einen Überblick über die gegenwärtige Marktsituation.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die möglichen psychologischen und aktivierenden Determinanten, die das Kaufverhalten der Konsumenten beeinflussen können. Es wird erläutert, in wie weit Faktoren wie Einstellung, Emotion und Motivation sowie Wissen, Image und Informationserwerb im Zusammenhang mit dem Kaufhalten der Konsumenten stehen.
Im vierten Kapitel wird die Vermarktung von Wein dargestellt. Dabei werden zunächst Marketinggrundlagen und Marketingziele sowie der Marketing-Mix erläutert. Kapitel vier gibt außerdem einen Überblick über die wichtigsten Instrumente im Marketing-Mix sowie deren Relevanz für das Weinmarketing.
Im fünften Kapitel wird das Konsumentenverhalten der Weinkonsumenten in Österreich anhand einer empirischen Studie analysiert. Dabei wird mittels Onlinefragebogen eine quantitative Befragung durchgeführt. Diese gibt Aufschluss über die Konsumenten, deren Einstellung und jeweiligen Wissensstand über Biowein sowie deren Kaufmotive und Erwartungen. Es werden im fünften Kapitel die Ergebnisse der Befragung aufbereitet und dargestellt.
Das sechste und letzte Kapitel gibt, basierend auf den Erkenntnissen der empirischen Studie, eine Handlungsempfehlung für das Marketing von Biowein. Dabei werden die jeweiligen Instrumente des Marketing-Mix erläutert und deren Einsatz begründet. Ein Überblick über die wichtigsten Voraussetzungen und Anforderungen an das Produkt „Biowein“, dessen Aufmachung und die Preisgestaltung soll eine Hilfestellung zur effektiven Vermarktung geben.
In der Conclusio werden schließlich die wichtigsten Erkenntnisse und Eckpunkte der Arbeit noch einmal zusammengefasst. Außerdem werden die Forschungsfragen anhand der Ergebnisse der empirischen Studie beantwortet.
2. WEIN AUS BIOLOGISCHEM ANBAU
2.1. BEGRIFFSDEFINITIONEN UND GRUNDLAGEN
2.1.1. Biologischer Anbau
Ökologischer Anbau oder biologische Landwirtschaft – im Volksmund als „bio“ bezeichnet – ist die Erzeugung von Agrarprodukten ohne Verwendung chemisch-synthetischer Mittel. Ökologischer Anbau bedeutet den Verzicht auf Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmittel, die sich ungünstig auf die Umwelt auswirken oder zu Rückständen in den Agrarerzeugnissen führen. Der ökologische Landbau arbeitet mit vielseitigen Anbauverfahren und entsprechenden Erzeugungsvorschriften, deren Einhaltung auf allen Stufen der Erzeugung und Vermarktung kontrolliert wird. Alle Betriebe, die Produkte erzeugen, aufbereiten oder vermarkten, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet sind, müssen sich einem regelmäßigen Kontrollverfahren unterziehen, das von den zuständigen Kontrollgremien oder zugelassenen privaten Stellen durchgeführt wird (vgl. EU – Verordnung 2092/91 über den ökologischen Landbau).
Erzeugnisse aus ökologischer Landwirtschaft müssen eine rechtlich definierte Bezeichnung enthalten, die dem Konsumenten klar und unmissverständlich zu verstehen gibt, dass es sich um echte Bioprodukte handelt. Diese für Österreich vorgeschriebenen Bezeichnungen lauten (vgl. Eis 2007, S. 4):
- „aus biologischer Landwirtschaft“
- „aus biologischem Anbau“
Das Wort „biologisch“ kann dabei durch „ökologisch“ ersetzt werden. Ebenso können anstatt von „Landwirtschaft“ die Begriffe „Anbau“ oder „Landbau“ verwendet werden. Abkürzungen, wie „kbA“ oder „kbL“ für „kontrolliert biologische Landwirtschaft“ bzw. „Anbau“ sind ebenfalls erlaubt und oft zu finden. Bezeichnungen wie „naturnah“, „umweltfreundlich“ oder „aus integrierter Landwirtschaft“ stiften beim Konsumenten oft Verwirrung und haben nichts mit biologischer Landwirtschaft zu tun. Sie müssen daher klar von der Bezeichnung „bio“ abgegrenzt werden (vgl. Eis 2007, S. 4).
Bioprodukte können mit folgenden Biozeichen (Labels) gekennzeichnet werden (vgl. www.abg.at 2007):
Staatliche Biozeichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Biozeichen der EU
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Staatliches Biozeichen der AMA (Agrarmarkt Austria)
Biozeichen eines Bioverbandes, z.B.:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bio Austria – österreichischer Bio-Dachverband
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Demeter-Bund – Verband für biologisch-dynamischen Landbau
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
ORBI – Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum
Markenzeichen von Großerzeugern oder Handelsketten, z.B.:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Ja Natürlich“ – Bio-Handelsmarke der REWE Group Austria
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
„Natur pur“ – Bio-Handelsmarke von SPAR
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Austria Bio Garantie Kontrollstelle
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
BIOS – Biokontrollservice Österreich
Die Bezeichnungen für Produkte aus ökologischem Anbau dürfen in Österreich ausschließlich von zertifizierten Kontrollstellen vergeben werden, die auch die regelmäßigen Kontrollen durchführen. Jeder biologisch wirtschaftende Betrieb muss sich mindestens einmal pro Jahr einem derartigen unangekündigten Kontrollverfahren unterziehen. Zur Kennzeichnung muss die Nummer (vierstellige Angabe, z.B. AT – N – 01 – BIO) oder der Name der jeweiligen Kontrollstelle auf den Produkten angeführt sein (vgl. Maier 2005, S. 19).
Lt. dem Umweltbundesamt (vgl. www.umweltbundesamt.at 2007a) sind folgende Bio-Kontrollstellen in Österreich zugelassen:
- ABG – Austria Bio Garantie (www.abg.at)
- BIKO Tirol – Verband Kontrollservice Tirol (www.kontrollservice-tirol.at)
- BIOS – Biokontrollservice Österreich (www.bios-kontrolle.at)
- LACON GmbH (www.lacon-institut.com)
- LVA – Lebensmittelversuchsanstalt (www.lva.co.at)
- SGS – Austria Controll-Co GmbH (www.sgsaustria.at)
- SLK – Salzburger Landwirtschaftliche Kontrolle GesmbH (www.slk.at)
2.1.2. Biologischer Weinbau
Zu den wichtigsten Grundsätzen des biologischen Weinbaus zählen die Bereiche Bodenbewirtschaftung, Begrünung, Düngung und Pflanzenschutz. Das Zusammenwirken dieser vier Elemente, die in Abbildung 1 dargestellt sind, sowie der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und leichtlösliche Mineraldünger, schaffen die Basis für eine ökologische Wirtschaftsweise (vgl. Tomic 2006, S. 4).
Abbildung 1: Die vier Grundsätze des biologischen Weinbaus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Tomic (vgl. 2006, S. 4)
Grundsätzlich unterscheidet man beim biologischen Weinbau zwischen zwei Bewirtschaftungssystemen:
- „organisch-biologischer“ Weinbau
- „biologisch-dynamischer“ Weinbau
2.1.2.1. Organisch-biologischer Weinbau
Die Bewirtschaftung beim organisch-biologischen Weinbau erfolgt gemäß der Richtlinien der EU-Verordnung 2092/91 aus dem Jahr 1995. Darüber hinaus sind zusätzliche Richtlinien von BIO AUSTRIA, dem österreichischen Bio-Dachverband, zu berücksichtigen (vgl. Dobretsberger / Neiss 2006, S. 150). Die vier wichtigsten Grundsätze werden nachfolgend näher erklärt.
Die Bodenbewirtschaftung ist stellt die Basis für organisch-biologischen Weinbau dar. Mit dem Verzicht auf leichtlösliche Mineraldünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel müssen die Erträge aus dem Boden eigenständig erwachsen. Daher rückt die Fruchtbarkeit des Bodens in das Zentrum der ökologischen Landwirtschaft. Diese kann durch „bodenlebenfördernde“ Maßnahmen, wie zum Beispiel Bodenlockerung, Bodenbegrünung und Bodendüngung gesteigert werden (vgl. Tomic 2006, S. 5).
Um einen Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna zu schaffen, die die Bodenfruchtbarkeit erhalten soll, muss der Weingarten ganzjährig begrünt sein. Um eine stabiles Ökosystem zu garantieren, sollte ein möglichst artenreiches Gemenge an Einsaaten verwendet werden (vgl. Hofman et al. 1995, S. 234). Für notwendige Bodenpflegemaßnahmen sowie in Junganlagen kann die Begrünung zwei Monate unterbrochen werden (vgl. Dobretsberger / Neiss 2006, S. 150).
Ziel der Düngung ist eine harmonische Ernährung der Rebe durch einen belebten Boden. Die Begrünung spielt dabei eine wichtige Rolle, da sie durch ihre Wurzelbildung für die Düngung des Bodens sorgt (vgl. Hofman et al. 1995, S. 235). Das Bodenleben kann zusätzlich in Form von organischem Material (z.B. Mist, Kompost, etc.) mit Energie versorgt werden. Es wird der Boden gedüngt und nicht die Rebe. Dabei wird gänzlich auf leicht lösliche Düngungsmittel („Kunstdünger“), Klärschlamm und Klärschlammkomposte verzichtet (vgl. Bio Austria 2007a, S. 1).
Der Pflanzenschutz im biologischen Weinbau baut überwiegend auf vorbeugende Maßnahmen auf (vgl. Tomic 2006, S. 9). Das Ziel der Pflanzenschutzmaßnahmen ist die Steigerung der Abwehrkraft der Rebe sowie die Vorbeugung und Vermeidung von Krankheiten und Schädlingen. Das „Ökosystem Weingarten“ soll sich im Gleichgewicht befinden. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, wie Fungizide, Insektizide und Herbizide sind strengstens verboten (vgl. Bio Austria 2007a, S. 1). Zum Schutz der Reben vor Krankheiten und Schädlingen sind ausschließlich jene Mittel erlaubt, die im Richtlinienkatalog unter „erlaubte Pflanzenschutzmittel“ angeführt sind (vgl. Dobretsberger / Neiss 2006, S. 150).
2.1.2.2. Biologisch-dynamischer Weinbau
Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise befolgt grundsätzlich die gleichen Prinzipien wie die organisch-biologische, mit dem Zusatz, dass die Rhythmen der Natur und der Gestirne sowie homöopathische Präparate eine besondere Rolle spielen (vgl. www.bioerleben.at 2007).
Noch vor einigen Jahren wurden Winzer, die ihren Betrieb biologisch-dynamisch bewirtschafteten als merkwürdige Sonderlinge angesehen, die sich nach dem Mondzyklus, den Planeten oder Sternen richten. Während der letzten zehn Jahre hat ein großer Wandel stattgefunden, und biologisch-dynamische Winzer haben sich durch ihren Erfolg in der Öffentlichkeit großen Respekt verschafft (vgl. Vortrag Zind-Humbrecht 2007).
Die Prinzipien der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise gehen auf Rudolf Steiner (1861 – 1925), dem Begründer der Anthroposophie, zurück. Demzufolge bedeutet bio-dynamisches Wirtschaften „die Einsichten, die durch die Geisteswissenschaft erarbeitet werden können, stets zu erweitern und an die Bedingungen des jeweiligen Hofes anzupassen“ (vgl. www.demeter.at 2007).
In Österreich wird die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise durch den Demeter-Bund vertreten, der Vereinigung zur Förderung der biologisch-dynamischen Lebensmittelqualität. Nach den Grundprinzipien des Demeter-Bundes steht ein gesunder Boden im Mittelpunkt der biologisch-dynamischen Bewirtschaftung. Dabei kommen spezielle Kräuter-, Quarz- und Mistpräparate zur Anwendung, die die Basis für ein aktives Bodenleben schaffen. Präparate aus Kuhdung und Heilpflanzen, wie Löwenzahn oder Baldrian, unterstützen den Prozess und bauen die Fruchtbarkeit des Bodens auf. Da all diese Bodenförderungsmaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt erfolgen müssen, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen, beachten und nutzen biologisch-dynamische Winzer die kosmischen Rhythmen, indem sie den Mond und die Sterne beobachten. Sie bedienen sich der Kräfte des Kosmos und begleiten dadurch das Wachstum der Pflanzen und das Reifen der Früchte. Sie nennen sich „Landschaftserhalter“, die die Natur schützen, heilen, aktiv gestalten und zur Kulturlandschaft machen (vgl. www.demeter.at 2007).
2.1.3. Dachorganisationen und Verbände für biologischen Landbau
Die IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) ist der internationale Dachverband für ökologischen Landbau. Sie wurde 1972 in Versailles, Frankreich, gegründet und umfasst inzwischen 750 Mitgliedsverbände in 108 Ländern. Das Ziel der IFOAM ist die Anpassung der weltweiten Öko-, Sozial- und Wirtschaftssysteme an die Prinzipien ökologischen Landbaus (vgl. www.ifoam.org 2007).
Bio Austria ist die Dachorganisation der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern, die rund 14.000 Mitglieder zählt und 16 österreichische Bioverbände vereinigt. Das Ziel von Bio Austria ist die nachhaltige Entwicklung und Förderung der biologischen Landwirtschaft sowie die Sicherung und der Ausbau der Absatzmärkte für Bioprodukte. Bio Austria bezeichnet sich als das „österreichische Bio-Netzwerk“, das mit Handel, Verarbeitern, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien eng zusammenarbeitet. Die fünf Grundwerte von Bio Austria sind Ökologie, Würde der Tiere, Forschung Innovation, faire Preise und biobäuerliche Lebensmittelkultur (vgl. www.bio-austria.at 2007a). Die Schwerpunkte von Bio Austria sind ein gemeinsames Bio-Erkennungszeichen, die Etablierung des Biolandbaus als agrarpolitisches Leitbild, eine bessere Verfügbarkeit von Biolebensmitteln und die Steigerung des Absatzes von Bioprodukten (vgl. www.umweltbundesamt.at 2007b). Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Bioverbände, die Bio Austria durch ihr Netzwerk vereinigt.
Abbildung 2: Bio Austria Netzwerk
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: vgl. Bio Austria 2006, S. 6
Bioveritas ist eine Winzergemeinschaft, die sich der Weinqualität und dem biologischen Weinbau verschrieben hat. Jährliche Verkostungen garantieren hohe Qualität und gleichen Standard. Bei den derzeit 16 Mitgliedsbetrieben handelt es sich um Bioweingüter aus Niederösterreich und dem Burgenland. Die Betriebe werden staatlich kontrolliert und sind verpflichtet, die betriebseigene Biokontrollnummer zu führen (vgl. www.bioveritas.at 2007).
2.2.DER MARKT VON BIOWEIN
2.2.1. Österreichischer Weinmarkt
In Österreich wird von rund 32.000 Weinbaubetrieben eine Gesamtfläche von ca. 43.900 ha bewirtschaftet. Insgesamt werden auf dieser Fläche 2.256.300 hl Wein produziert, davon 1,4 Mio. hl Weißwein, das sind 60 % und 904.300 hl Rotwein, das sind 40 % der Gesamtproduktion. Als Spitzenreiter bei den Rebsorten gilt der Grüne Veltliner, der mit 48,4 % den größten Anteil der Weißweinflächen einnimmt, gefolgt von der Rotweinsorte Zweigelt mit 35,2 % der Rotweinfläche (vgl. Statistik Austria 2007, S. 3).
Über die Hälfte (ca. 57 %) der gesamten Weinmenge wird im Bundesland Niederösterreich produziert. Mit einem Anteil von 34 % liegt das Burgenland an zweiter Stelle. Die Steiermark produziert etwa 8 % der Gesamtweinmenge, dahinter liegt Wien mit knapp 1 % und in den übrigen Bundesländern liegt die Produktion bei unter 0,1 % (vgl. Statistik Austria 2007, S. 3). Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Aufteilung der Weinproduktion nach Bundesländern.
Abbildung 3: Aufteilung der Weinproduktion nach Bundesländern 2006
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Statistik Austria 2007, S. 3
2.2.2. Österreichischer Markt von Biowein
Die Rebfläche von Wein aus biologischem Anbau beträgt 1.766 ha (Stand 2006), das sind ca. 4 % der Gesamtrebfläche Österreichs. Diese Fläche wird von insgesamt 469 Biowinzern bewirtschaftet (vgl. Größ 2008, o. S.). Rund 46 % der Biorebfläche befinden sich in Niederösterreich, 35 % im Burgenland, 19 % in der Steiermark und etwa 1 % in Wien (vgl. Vortrag Schinnerl 2000, S. 30). Abbildung 4 gibt eine grafische Darstellung des Biowein-Anteils am österreichischen Weinmarkt.
Abbildung 4 : Anteil von Biowein am österreichischen Weinmarkt 2006
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Bio Austria 2007b und Vortrag Schinnerl 2000, S. 30
Auf den 1.766 ha biologischer Weinbaufläche werden über 30 verschiedene Rebsorten kultiviert, darunter die Weißweinsorten Grüner Veltliner (36,7%), Welschriesling (9 %), Müller Thurgau (7,8 %), Weißburgunder (4,9%) und Riesling (2,6 %). Unter den Rotweinsorten befinden sich Zweigelt (7,9 %), Blaufränkisch (5,4 %) und Blauer Portugieser (5,2 %) (vgl. Vortrag Schinnerl 2000, S. 31).
Die Entwicklung des Bioweinbaus der letzten 13 Jahre zeigt einen deutlichen Anstieg, sowohl bei der Rebfläche in ha als auch bei der Anzahl der biologisch wirtschaftenden Betriebe. Während im Jahr 1993 erst 79 Bioweinbetriebe gezählt wurden, waren es 2006 bereits knapp 500 Betriebe, die sich dem biologischen Weinbau verschrieben haben. Der Trend zu „bio“ macht sich dieser Entwicklung zufolge also auch bei Wein breit (vgl. Bio Austria 2007b, o. S.). Immer mehr Weine aus biologischer und biologisch-dynamischer Erzeugung werden heute auf den Markt gebracht. Der anhaltende Bioboom, der die weltweite Weinproduktion stark beeinflusst hat, lässt sich in Österreich gut beobachten (vgl. Vortrag Ebster 2007). Abbildung 5 gibt einen Überblick über die Entwicklung des Bioweinbaus in Österreich.
Abbildung 5: Entwicklung Bioweinbau in Österreich 1993 – 2005
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: vgl. Bio Austria 2007b
Der steigende Trend spiegelt sich auch in den Produktionsmengen von Biowein wider. Im Jahr 2002 wurden etwa 3.794 hl Biowein produziert, im Jahr 2006 waren es bereits 6.520 hl. Dies ist eine Steigerung von 58 % innerhalb von vier Jahren. Abbildung 6 stellt die Produktionsentwicklung von Biowein in Österreich grafisch dar.
Abbildung 6: Produktionsentwicklung Biowein in Österreich 2002 – 2006 in hl
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: In Anlehnung an www.bio-austria.at 2007b
Eine von Stöckl (vgl. Vortrag 2007) an den Fachhochschulstudiengängen Burgenland durchgeführte Studie über Biowein bestätigt das Interesse der Österreicher an Biowein. So haben etwa 72 % der Österreicher bereits etwas über Biowein gehört. Etwa 27 % trinken sogar regelmäßig Biowein und weitere 20 % trinken zwar derzeit keinen Biowein, wären aber daran interessiert ein breiteres Angebot wahrzunehmen.
2.2.3. Produktion von biologisch erzeugten Produkten
Die internationale Produktion von biologisch erzeugten Produkten ist in den letzten Jahren rapide angestiegen. Mittlerweile wird weltweit in 120 Ländern biologischer Anbau praktiziert, und zwar auf einer Anbaufläche von insgesamt 31 Millionen Hektar. Die Länder mit den größten Anbauflächen sind Australien mit 12, 1 Millionen Hektar, China mit 3,5 Millionen Hektar und Argentinien mit 2,8 Millionen Hektar. Österreich liegt mit einer Anbaufläche von 344.916 Hektar weltweit an 15. Stelle (vgl. IFOAM 2006, S. 23 f.). Abbildung 7 dokumentiert die 20 wichtigsten Länder der Erde für biologischen Anbau.
Abbildung 7: Die 20 wichtigsten Länder in Bezug auf biologischen Anbau
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an IFOAM 2006, S. 24
In Relation zu konventionellem Anbau ist der Anteil an biologisch bewirtschafteten Flächen in europäischen Ländern am höchsten. Das Land mit dem höchsten Anteil an biologisch bewirtschafteter Fläche ist Liechtenstein mit 26,4 %. An zweiter Stelle steht bereits Österreich mit rd. 13,5 % biologisch bewirtschafteter Anbaufläche (vgl. IFOAM 2006, S. 31). Abbildung 8 zeigt jene 10 Länder mit dem höchsten Anteil von biologischem Anbau an der Gesamtanbaufläche in Prozent.
Abbildung 8: Länder mit dem höchsten %-Anteil an biologischem Anbau
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an IFOAM 2006, S. 36
2.2.4. Internationaler Markt von Biowein
Die globale Produktion von Biowein nimmt stark zu. Neben Kalifornien, wo Biowein schon eine lange Tradition hat, sind vor allem die Überseeländer Chile und Argentinien im Vormarsch. Bemerkenswert ist, dass von Australien bisher sehr wenig über biologischen Weinbau zu hören ist. In Europa ist das Wachstum der biologischen Rebflächen, neben Österreich, in Griechenland am höchsten. In den größeren Produktionsländern, wie Italien, Frankreich und Spanien hat sich die Entwicklung hingegen etwas verlangsamt. In Deutschland ist nach einigen Jahren des Entwicklungsstillstandes wieder ein Wachstum festzustellen (vgl. Römmelt 2007, S. 88 f.).
Italien ist mit 31.170 ha Biorebfläche Spitzenreiter am internationalen Markt für Biowein. Mit 3,9 % Bioweinfläche ist Italien Anführer der Liste jener Länder, in denen biologischer Weinbau praktiziert wird. Spanien und Frankreich liegen mit jeweils etwa 16.500 ha biologischer Rebfläche an zweiter Stelle, nicht aber hinsichtlich der Relation von Biorebfläche zu Gesamtrebfläche. Hier liegt Österreich mit 3,1 % an zweiter Stelle. Dahinter liegen Deutschland, Frankreich und Chile mit jeweils 1,9 % biologischer Rebfläche (vgl. Römmelt 2007, S. 119). Abbildung 9 stellt die weltweite Bioweinbaufläche übersichtlich dar.
Abbildung 9: Bioweinbaufläche weltweit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Römmelt 2007, S. 110
2.3. ZIELGRUPPENDEFINITION
2.3.1. Konsumenten von Bioprodukten
In den letzten Jahren hat sich ein großer Wandel im Konsum von Biolebensmitteln vollzogen. Marktforscher in den USA behaupten, dass eine ganz neue Generation von Biokäufern heranwächst, die die ehemals prinzipienfesten Öko-Bewegten mit hohen ideellen Werten ablösen. Eine Studie, die 2002 bis 2003 vom Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE) in Deutschland durchgeführt wurde, hat Biokonsumenten untersucht und dabei festgestellt, dass Bioprodukte zu zwei Drittel von Frauen mittleren oder höheren Alters gekauft werden. Außerdem werden Biolebensmittel von Familien mit Kindern bevorzugt oder von Haushalten, in denen die Kinder bereits ausgezogen sind. Das Interesse an Bioprodukten ist hingegen bei jüngeren Erwachsenen sehr gering. Als Kaufmotive spielen Umweltschutz sowie die Ziele des ökologischen Landbaus eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist dem Konsumenten der persönliche Nutzen, wie Frische, Geschmack, Sicherheit und Gesundheit (vgl. Stieß 2004, S. 25).
Die ISOE Studie unterteilt die Käufer von Bio-Lebensmitteln, je nach Kaufhäufigkeit und soziodemographischer Merkmale, in fünf unterschiedliche Gruppen. Diese sind in Abbildung 10 grafisch dargestellt (vgl. Stieß 2004, S. 26). Die Kaufhäufigkeiten für Bio-Lebensmittel definieren sich nach Stieß (vgl. 2007, o. S.) wie folgt:
- selten: Bio-Lebensmittel werden seltener als 1 mal / Monat gekauft
- gelegentlich: Bio-Lebensmittel werden 1 – 3 mal pro Monat gekauft
- intensiv: Bio-Lebensmittel werden mehrmals pro Woche gekauft
Abbildung 10 : ISOE-Lebensphasenmodell - Zielgruppen für Bio-Lebensmittel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Stieß 2004, S. 26
Die Gruppe der „ganzheitlich Überzeugten“ stellt knapp ein Viertel aller Bio-Käufer dar und ist somit die stärkste und wichtigste aller Gruppen. Sie sind die „Nachfolger“ der früheren typischen „öko-bewegten“ Biokäufer und bestehen zum größten Teil aus Frauen in der mittleren Lebensphase mit höherer Schulbildung sowie höherem Einkommen. Jüngere oder ältere Altersgruppen finden sich in dieser Gruppe kaum. Für diese Konsumenten bilden ethische Einstellungen und Genuss die Grundlage ihrer Ernährungsgewohnheiten. Die zweitgrößte Gruppe ist jene der „arriviert Anspruchsvollen“ . Diese setzt sich aus gut situierten und ausgebildeten Müttern zwischen 20 bis Mitte 40 mit kleinen Kindern zusammen. Deren leitende Motive für den Kauf von Bioprodukten sind das Wohl der Kinder, das ganzheitliche Gesundheitsverständnis, sowie eine ausgeprägte Wellness-Orientierung. Bei den „50+ Gesundheitsorientierten“ ist fast die Hälfte der Personen über 60 Jahre alt. Sie beziehen kleine bis mittlere Einkommen und wohnen vorwiegend auf dem Land oder in Kleinstädten. Die Vorliebe für regionale und saisonale Produkte sowie gesundheitliche Probleme veranlassen diese Gruppe zum Kauf von Bioprodukten. Faire Preise, qualifizierte Beratung und leichte Erreichbarkeit der Lebensmittel sind von großer Bedeutung. Das Potenzial dieser Gruppe ist noch lange nicht ausgeschöpft und wird künftig stark zunehmen. Die „distanziert Skeptischen“ bestehen zum Großteil aus Männern, die in Singlehaushalten oder kinderlosen Haushalten leben. Diese Gruppe hat kein sehr großes Interesse am Thema Ernährung. Es finden sich hier viele Spontan- oder Gelegenheitskäufer, deren Anzahl künftig steigen wird. Bei der letzten Gruppe der „jungen Unentschiedenen“ liegt der Altersschwerpunkt bei den unter 30-Jährigen mit einer hedonistischen Grundeinstellung. Was das Thema Ernährung betrifft, ist diese Gruppe sehr unsicher und daher schwierig zu bedienen. Diese Zielgruppe hat aber zukünftig eine große Relevanz und muss mit unkonventionellen Angeboten angesprochen werden (vgl. Stieß 2004, S. 25).
Im Jahr 2006 wurde von Sinus Sociovision in Deutschland eine Studie durchgeführt, die die Zielgruppe der Biokäufer je nach sozialer Lage und Grundorientierung in drei wichtige Gruppen unterteilt (vgl. Bio Verlag 2006, S. 9). Abbildung 11 stellt diese drei strategisch relevanten Sinus-Milieus dar.
Abbildung 11: Sinus-Milieus in Deutschland 2006 – Einkauf von Bioprodukten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: vgl. Bio Verlag 2006, S. 11
Die „Postmateriellen“ stellen das gesellschaftliche Leitmilieu dar und bestehen vorwiegend aus den aufgeklärten „Nach-68ern“. Sie sehen die Attraktivität von Bioprodukten als notwendige und wichtige Entwicklung, stehen aber dem steil wachsenden Markt sehr kritisch gegenüber, da sich immer mehr Produzenten den Biotrend zu Nutze machen. Für sie ist das Vertrauen ein zentrales Thema, daher bevorzugen sie bekannte Gütesiegel und kaufen gerne traditionelle sowie auch neue Marken (vgl. Bio Verlag 2006, S. 10).
Die „Bürgerliche Mitte“ ist vertreten durch den status-orientierten „Mainstream“ oder die soziale Mittelschicht und kauft vorwiegend Bioprodukte, weil es im Trend liegt und modern ist. Sie vertrauen dem Label „bio“ vorbehaltlos und kaufen Bioprodukte im konventionellen Supermarkt (vgl. Bio Verlag 2006, S. 11).
Die „Modernen Performer“ bestehen aus der unkonventionellen Nachwuchselite, die sowohl beruflich als auch privat sehr intensiv leben, multimedial begeistert sind und sehr stark wachsen. Für sie ist Umwelt- und Naturschutz eine Selbstverständlichkeit. Moderne Performer kaufen Bioprodukte aufgrund der besseren Qualität. Die Produkte müssen jedoch eine lifestyle-orientierte Verpackung, ein attraktives Äußeres sowie guten Geschmack aufweisen. Außerdem muss die Bequemlichkeit beim Einkauf gewährleistet sein. Diese Gruppe gilt als bioaffin und daher als potenzielle Zielgruppe der Zukunft (vgl. Bio Verlag 2006, S. 12).
2.3.2. Weinkonsumenten in Österreich
Im Auftrag der Österreichischen Weinmarketing GmbH wurde im Jahr 2004 eine Studie vom GfK Fessel Institut durchgeführt, die die soziodemografische Struktur der österreichischen Weinkäufer sowie deren Kaufverhalten in Bezug auf Wein untersuchte. Dabei wurden die Weinkonsumenten in zwei Subgruppen unterteilt: in „Heavy Buyers“ und „Little Buyers“. Heavy Buyers sind jene Konsumenten, welche mindestens einmal pro Monat Wein einkaufen, Little Buyers hingegen kaufen weniger als einmal pro Monat bzw. nie Wein (vgl. ÖWM 2006, S. 140).
Laut dieser Studie zählen etwas mehr als die Hälfte aller Weinkonsumenten zu den Little Buyers, die andere knappe Hälfte gehört den Heavy Buyers an. Zu einem sehr großen Anteil wird Wein direkt beim Winzer gekauft, vor allem von Little Buyers. Heavy Buyers verwenden aber auch vermehrt andere Absatzkanäle, wie etwa den Supermarkt oder Fachhandel. Etwa 40 % der Heavy Buyers kaufen beim Diskonter Hofer Wein ein, im Gegensatz zu nur 23 % der Little Buyers (vgl. ÖWM 2006, S. 140). Abbildung 12 veranschaulicht die Kauffrequenz und Kauforte für Wein von Heavy bzw. Little Buyers.
Abbildung 12: Kauffrequenz und Kaufort von Wein in %
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an ÖWM 2006, S. 142
Der Studie zufolge sind Heavy Buyers eher bereit, für Weine gewisser Herkunft und Güte mehr Geld auszugeben als Little Buyers. Beide Gruppen sind sich jedoch einig, dass österreichische Weine ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis aufweisen (vgl. ÖWM 2006, S. 140). Bei den soziographischen Merkmalen, die in Abbildung 13 dargestellt sind, lassen sich zwischen Heavy und Little Buyers Unterschiede erkennen. Demnach haben Heavy Buyers eine höhere Schulausbildung als Little Buyers. Darüber hinaus entstammen Heavy Buyers eher den oberen sozialen Schichten, hingegen gehört ein höherer Anteil an Little Buyers der sozialen D und E Schicht an. Beim Haushaltseinkommen verhält sich die Situation ähnlich. Während Little Buyers eher im unteren Bereich des Einkommens angesiedelt sind, gehören Heavy Buyers eher den höheren Einkommensschichten an (vgl. ÖWM 2006, S. 151).
Abbildung 13: Soziodemographische Struktur Heavy vs. Little Buyer in %
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an ÖWM 2006, S. 151
2.3.3. Konsumenten von Biowein
Laut einer Studie von Stöckl (vgl. Vortrag 2007), die an den Fachhochschulstudiengängen Burgenland zum Thema Biowein durchgeführt wurde, werden Bioweinkonsumenten in bioaffine und nicht-bioaffine Konsumenten unterschieden. Bioaffine Konsumenten assoziieren dieser Studie zufolge andere Eigenschaften mit Biowein als nicht-bioaffine Konsumenten und kaufen daher Biowein auch aus anderen Gründen. Der bioaffine Konsument assoziiert mit Biowein beispielsweise die beiden Eigenschaften „umweltschonend“ und „gesund“, während nicht-bioaffine Konsumenten Biowein als „austauschbar“ und „sauer“ beschreiben.
Aufgrund der ungenügenden und lückenhaften Informationen über die Konsumenten von Biowein, wird sich der empirische Teil dieser Arbeit ausschließlich diesem Thema widmen.
3. KONSUMENTENVERHALTEN
3.1. ALLGEMEINES ZUM KONSUMENTENVERHALTEN
Im Mittelpunkt jeder Kaufentscheidung steht der Mensch als Kunde mit all seinen irrationalen Verhaltensweisen (vgl. Pepels 2005, S. 19). Lange Zeit war das Bild vom
rationalen Käufer, der aufgrund vollständiger Informationen Entscheidungen trifft und
dadurch seinen Nutzen maximiert, dominierend. Da jedoch die vollständige Nutzung
von Informationen in der Realität kaum vorkommt, müssen wesentliche Aspekte des Kaufverhaltens mit größerer Realitätsnähe in die Konsumentenforschung miteinbezogen werden (vgl. Kuß / Tomczak 2004, S. 1). Heute weiß man, dass das Verhalten der Konsumenten nicht immer darauf gerichtet ist, den mit einem Kauf verbundenen Nutzen zu maximieren. Vielmehr wirken bei Kaufentscheidungen viele unterschiedliche Bedürfnisse und Faktoren zusammen, die für die Entwicklung von Marketingstrategien von großer Bedeutung sind (vgl. Kuß / Tomczak 2004, S. 7). Kroeber-Riel / Weinberg (vgl. 2003, S. 49) unterscheiden zwischen psychologischen Determinanten und Umweltdeterminanten des Konsumentenverhaltens. In dieser Arbeit wird auf die psychologischen Determinanten eingegangen.
3.2. PSYCHOLOGISCHE DETERMINANTEN
3.2.1. Grundlagen psychologischer Faktoren
Psychologische Ansätze im Konsumentenverhalten geben Auskunft über die verborgenen Ursachen einer Kaufentscheidung. Aktivierende Determinanten beschreiben innere Erregungszustände, die den Konsumenten aufmerksam und leistungsfähig machen. Zu ihnen zählen Einstellung, Motivation und Emotion (vgl. Pepels 2005, S. 51). Nach Kroeber-Riel / Weinberg (vgl. 2003, S. 53) können aktivierende Prozesse als menschliche Antriebskräfte verstanden werden, die für die Erklärung des Verhaltens eine große Bedeutung haben.
Kognitive Prozesse hingegen sind Vorgänge, durch die der Konsument die Informationen aufnimmt. Es sind Prozesse der gedanklichen Informationsverarbeitung, mit deren Hilfe der Konsument Kenntnis von seiner Umwelt und sich selbst erhält. Sie dienen dazu, das jeweilige Verhalten gedanklich zu steuern. Eingeteilt werden sie in Informationsverarbeitung, Wahrnehmung und Lernen (vgl. Kroeber-Riel / Weinberg 2003, S. 225).
3.2.2. Aktivierende Prozesse
3.2.2.1. Einstellung und Konsumentenverhalten
Eine Einstellung ist der Zustand einer gelernten und relativ dauerhaften Bereitschaft, einem Objekt gegenüber in einer bestimmten Situation entweder positiv oder negativ zu reagieren. Somit bezieht sich eine Einstellung immer auf ein bestimmtes Objekt (vgl. Trommsdorff 2004, S. 159).
Einstellungen sind immer mit gewissen Verhaltenstendenzen verbunden, sie gehen also über den rein gedanklichen Bereich hinaus. Einstellungen basieren auf Erfahrungen und führen zu Überzeugungen, Vorurteilen und Meinungen. Je nachdem ob eine Einstellung über ein bestimmtes Objekt positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert diese die Kaufchance. Sobald es einen Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten gibt, sind Einstellungen für das Marketing von erheblicher Relevanz. Im Marketing ist es wichtig zu erkennen, dass nicht die objektive Realität die Realität im Markt ist, sondern die Vorstellungen der Konsumenten über diese Realität (vgl. Pepels 2005, S. 62).
Nach Kuß / Tomczak (vgl. 2004, S. 45) wirken in der Einstellungsforschung drei Komponenten zusammen. Die kognitive Komponente (das Denken) stellt die Gegenstandsbeurteilung dar. Die entsprechende subjektive Bewertung (das Fühlen) wird als affektive Komponente bezeichnet und die Verhaltenskomponente (das Handeln) zeigt eine entsprechende Verhaltenstendenz auf. In der Praxis führt das Zusammenwirken dieser drei Komponenten dazu, dass beim Käufer eine gewisse Tendenz entsteht, einer bestimmten Marke einer anderen gegenüber den Vorzug zu geben. Abbildung 14 stellt die drei Komponenten der Einstellung dar.
Abbildung 14: Komponenten von Einstellungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Kuß / Tomczak 2004, S. 45
Nach Solomon et al. (vgl. 2001 S. 156 f.) variiert die relative Bedeutung der drei Einstellungskomponenten je nach dem Grad der Motivation des Konsumenten in Bezug auf das Produkt. Das Konzept der Effekthierarchie versucht den relativen Einfluss der drei Komponenten zu erklären. Dabei zeigt jede Hierarchie, dass auf dem Weg zu einer Einstellung eine bestimmte Sequenz erscheint. Wesentlicher Bestandteil bei der Bildung von Einstellungen ist das Sammeln von Wissen. Konsumenten bilden aufgrund kognitiver Informationsverarbeitung und Überzeugung bestimmte Einstellungen. Aus Überzeugungen entstehen Gefühle, die ein bestimmtes Verhalten hervorrufen und den Konsumenten zum Kauf anregen. In dieser Hierarchie „verbindet“ sich der Konsument mit dem Produkt. Ihn zum Ausprobieren eines anderen Produktes zu bewegen, ist nur sehr schwer möglich. Eine andere mögliche Variante der Einstellungsbildung beruht auf dem Prinzip des Verhaltenslernens. Der Konsument verfügt nur über begrenztes Wissen über ein Produkt und bildet sich erst nach der Handlung ein Urteil. Die Wahl des Konsumenten wird wahrscheinlich durch gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Produkt noch verstärkt. Dieses relativ niedrige Engagement des Konsumenten führt zu geringer Markentreue und dementsprechend hoher Wirkung diverser Marketing-Stimuli am POS. Als dritte und letzte Hierarchie heben Solomon et al. (vgl. 2001, S. 57 f.) die Bedeutung emotionaler Reaktionen bei Einstellungen hervor. Dieser Theorie entsprechend handeln Konsumenten aufgrund ihrer emotionalen Reaktionen. Der Konsument wird stark von wenig greifbaren Produkteigenschaften (z.B. Verpackungsdesign) sowie von begleitenden Stimuli wie Werbung und Markennamen beeinflusst. Die Kaufentscheidung richtet sich vor allem danach, welche Gefühle das Produkt beim Konsumenten auslöst bzw. wie viel Freude es ihm bereitet. Die Einstellung wird von der hedonistischen Motivation des Konsumenten beeinflusst. In Abbildung 15 sind die drei Effekthierarchien zusammengefasst.
Abbildung 15: Drei Effekthierarchien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: In Anlehnung an Solomon et al. (vgl. 2001, S. 156)
Der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten wird nach Kuß / Tomczak (vgl. 2004, S. 49) durch bestimmte Störfaktoren beeinflusst. So kann beispielsweise eine positive Einstellung zu mehreren Produkten dazu führen, dass trotz positiver Einstellung zu einem bestimmten Produkt, ein anderes Produkt aus der gleichen Gruppe gekauft wird. Situative Faktoren wie etwa ungeplante Wahrnehmungen, die zum Beispiel durch Sonderangebote hervorgerufen werden, können dazu beitragen, dass auf eine weniger bevorzugte Marke zurückgegriffen wird. Darüber hinaus können wirtschaftliche Beschränkungen, wie etwa finanzielle Engpässe dazu führen, dass ein „Ersatzprodukt“ gekauft wird. Soziale Einflüsse wie gesellschaftliche Wertvorstellungen oder Erwartungen von bestimmten Bezugsgruppen führen oft dazu, dass bestimmte Produkte trotz positiver Einstellung und Präferenz nicht gekauft werden.
Untersuchungen bezüglich des Zusammenhangs zwischen Einstellung und Verhalten belegen den umgekehrten Einfluss in zunehmendem Maße. Das Verhalten bestimmt die Einstellung. Dieses Phänomen tritt beispielsweise dann auf, wenn der Konsument nicht stark in die Kaufentscheidung involviert ist und eine positive Einstellung zum Produkt nicht Voraussetzung für den Kauf dieses Produktes ist, sondern das Ergebnis nach dem Kauf (vgl. Kroeber-Riel / Weinberg 2003, S. 173).
Nach Kroeber-Riel / Weinberg (vgl. 2003, S. 179) ist für eine erfolgreiche E-V-Hypothese (Einstellung beeinflusst Verhalten) die zeitliche Stabilität der Einstellung Voraussetzung. Demnach kann man von der zu einem Zeitpunkt gemessenen Einstellung nur bedingt auf eine Einstellung zu einem späteren Zeitpunkt schließen. Bestimmte Veränderungen von Einstellungen im Zeitablauf müssen dementsprechend bei der Messung von Einstellungen berücksichtigt werden.
Kuß / Tomczak (vgl. 2004, S. 51) betonen, dass vor der Messung von Einstellungen zunächst folgende Fragen beantwortet werden müssen:
- Ist das Produkt für den Konsumenten wichtig genug, damit er eine Einstellung dazu hat?
- Wie fundiert sind die Einstellungen, d.h. beruhen sie auf umfassendem Wissen oder einschlägigen Erfahrungen, um damit mehr Aussagekraft für das folgende Verhalten zu haben?
- Wie konkret ist die Einstellungsmessung auf ein spezifisches Verhalten bezogen und wie hoch ist dadurch die diesbezügliche Aussagekraft?
Nach Kuß / Tomczak (vgl. 2004, S. 52 f.) kann man bei der Messung von Einstellungen zwischen eindimensionalen und mehrdimensionalen Verfahren unterscheiden. Eindimensionale Einstellungsmessungen messen eine Einstellungskomponente, meist die affektive. Sie erfolgen meist durch einfache Rating-Skalen oder Skalierungsverfahren, wie der Thurstone-Skala, der Likert-Skala oder der Guttmann-Skala. Es ist zu bemerken, dass eindimensionale Messmethoden einfach durchzuführen sind, dennoch ist aber ihre Validität aufgrund der einseitigen Messung sehr begrenzt. Abbildung 16 zeigt einige illustrierende Beispiele zur eindimensionalen Einstellungsmessung.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836628228
- DOI
- 10.3239/9783836628228
- Dateigröße
- 3.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Wien – Studiengang Marketing & Sales
- Erscheinungsdatum
- 2009 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- biowein wein weinmarketing konsumentenverhalten
- Produktsicherheit
- Diplom.de