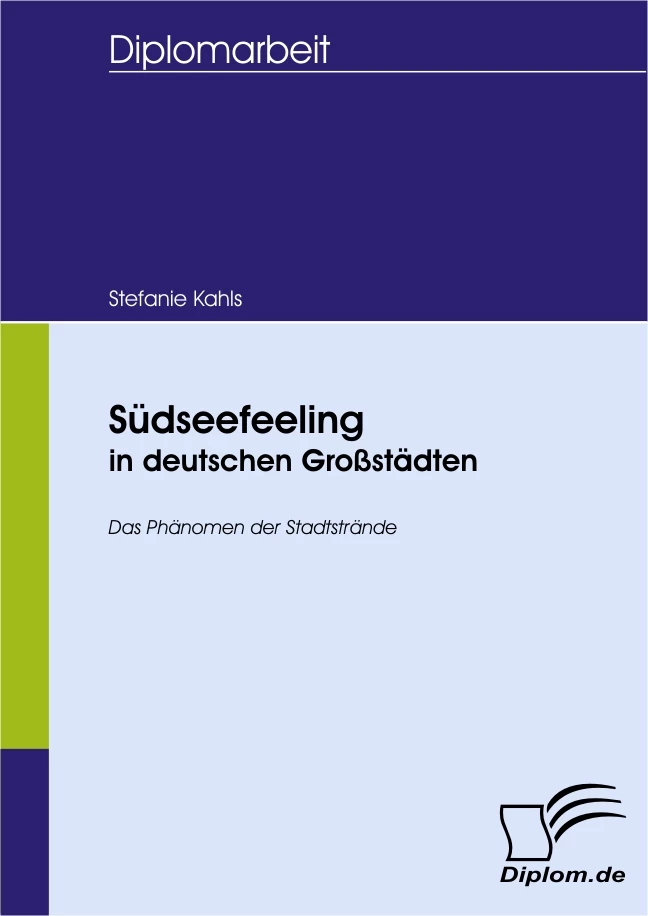Südseefeeling in deutschen Großstädten
Das Phänomen der Stadtstrände
©2008
Diplomarbeit
147 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.
Wir leben in einer Zeit die geprägt ist von ökonomischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Eine hohe und steigende Arbeitslosenquote und damit zusammenhängend die ständige Angst weiter Bevölkerungsschichten ihre Arbeit zu verlieren, verändert das gesellschaftliche Leben und löst Stresssituationen bei den Bürgern aus. Die Menschen sind immer weniger bereit große Ausgaben zu tätigen und zu allererst wird hier beim Urlaub gespart. Aus dem bestehenden Stress und der Eingrenzung von Urlaubsreisen ergibt sich, dass die Freizeit einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Es wird nach Ablenkung, nach Entspannung, Ruhe und Vergnügen gesucht, um für eine Zeit lang dem Alltag und seinen Sorgen zu entfliehen. Aufgrund der beschränkten Zeit die dafür zur Verfügung steht, begibt sich das Individuum auf die Suche nach konzentrierter Erholung, Entspannung und Regeneration. Die kurze Flucht aus dem Alltäglichen soll als emotionale Medizin gegen Erschöpfung, Stress und Depressionen wirken. Hierbei spielen neue Erfahrungen und Empfindungen - ein Zu-Sich-Selbst-Finden - eine bedeutende Rolle. Ausschlaggebend hierbei sind nicht neue oder ferne Orte, sondern das Betrachten des Bekannten und des Nahen mit anderen Augen.
Dieser Wunsch nach Mehr, nach einem emotionalen Zusatznutzen in der Freizeit, drückt sich in der gesteigerten Erlebnisorientierung der Menschen aus. Es wird nach Erlebnissen gesucht, die Gefühle auslösen. Die Freude, Spaß, Zerstreuung, Rührung, Spannung, Abenteuer, Erstaunen, Überraschung und Erinnerungen stimulieren. Genau dies versuchen Stadtstrände. Durch eine südländische Thematisierung und möglichst perfekte Inszenierung, wird dem Besucher eine Strandurlaubssituation vorgespielt. Dadurch soll dem Gast ein zeitgemäßes intensives Kurzerholen ermöglicht werden, welches zum einen Urlaubsgefühle hervorrufen soll, aber zum anderen gleichzeitig in der Nähe seines Arbeitsplatzes sich befindet und er somit die erforderliche neue Flexibilität in Bezug auf seine Arbeit nicht aufgeben muss. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ABBILDUNGSVERZEICHNIS6
TABELLENVERZEICHNIS8
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS9
1.EINLEITUNG10
2.PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT11
2.1Vorgehensweise und Methodik12
2.2Was sind Stadtstrände?14
3.ENTWICKLUNG DES STADTSTRANDPHÄNOMENS - HISTORISCHER ABRISS UND HEUTIGE SITUATION15
4.EINORDNUNG DES PHÄNOMENS DER […]
They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.
Wir leben in einer Zeit die geprägt ist von ökonomischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten. Eine hohe und steigende Arbeitslosenquote und damit zusammenhängend die ständige Angst weiter Bevölkerungsschichten ihre Arbeit zu verlieren, verändert das gesellschaftliche Leben und löst Stresssituationen bei den Bürgern aus. Die Menschen sind immer weniger bereit große Ausgaben zu tätigen und zu allererst wird hier beim Urlaub gespart. Aus dem bestehenden Stress und der Eingrenzung von Urlaubsreisen ergibt sich, dass die Freizeit einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Es wird nach Ablenkung, nach Entspannung, Ruhe und Vergnügen gesucht, um für eine Zeit lang dem Alltag und seinen Sorgen zu entfliehen. Aufgrund der beschränkten Zeit die dafür zur Verfügung steht, begibt sich das Individuum auf die Suche nach konzentrierter Erholung, Entspannung und Regeneration. Die kurze Flucht aus dem Alltäglichen soll als emotionale Medizin gegen Erschöpfung, Stress und Depressionen wirken. Hierbei spielen neue Erfahrungen und Empfindungen - ein Zu-Sich-Selbst-Finden - eine bedeutende Rolle. Ausschlaggebend hierbei sind nicht neue oder ferne Orte, sondern das Betrachten des Bekannten und des Nahen mit anderen Augen.
Dieser Wunsch nach Mehr, nach einem emotionalen Zusatznutzen in der Freizeit, drückt sich in der gesteigerten Erlebnisorientierung der Menschen aus. Es wird nach Erlebnissen gesucht, die Gefühle auslösen. Die Freude, Spaß, Zerstreuung, Rührung, Spannung, Abenteuer, Erstaunen, Überraschung und Erinnerungen stimulieren. Genau dies versuchen Stadtstrände. Durch eine südländische Thematisierung und möglichst perfekte Inszenierung, wird dem Besucher eine Strandurlaubssituation vorgespielt. Dadurch soll dem Gast ein zeitgemäßes intensives Kurzerholen ermöglicht werden, welches zum einen Urlaubsgefühle hervorrufen soll, aber zum anderen gleichzeitig in der Nähe seines Arbeitsplatzes sich befindet und er somit die erforderliche neue Flexibilität in Bezug auf seine Arbeit nicht aufgeben muss. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
ABBILDUNGSVERZEICHNIS6
TABELLENVERZEICHNIS8
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS9
1.EINLEITUNG10
2.PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT11
2.1Vorgehensweise und Methodik12
2.2Was sind Stadtstrände?14
3.ENTWICKLUNG DES STADTSTRANDPHÄNOMENS - HISTORISCHER ABRISS UND HEUTIGE SITUATION15
4.EINORDNUNG DES PHÄNOMENS DER […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Stefanie Kahls
Südseefeeling in deutschen Großstädten
Das Phänomen der Stadtstrände
ISBN: 978-3-8366-2751-1
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Universität Trier, Trier, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Inhaltsverzeichnis
3
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS... 6
TABELLENVERZEICHNIS ... 8
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS ... 9
1
EINLEITUNG... 10
2
PROBLEMSTELLUNG UND ZIEL DER ARBEIT... 11
2.1
Vorgehensweise und Methodik... 12
2.2
Was sind Stadtstrände?... 14
3
ENTWICKLUNG DES STADTSTRANDPHÄNOMENS - HISTORISCHER
ABRISS UND HEUTIGE SITUATION ... 15
4
EINORDNUNG DES PHÄNOMENS DER STADTSTRÄNDE... 17
4.1
Erlebniswelten ... 18
4.1.1
Freizeit-/Erlebnis-/Themenparks... 20
4.1.2
Ferienparks ... 22
4.1.3
Erlebnisgastronomie ... 23
4.2
Stadtstrände als neues Segment von Erlebniswelten... 25
4.3
Stadtstrände als neuer Bestandteil des Städtetourismus ... 26
5
DER WANDEL DER GESELLSCHAFT VON 1950 BIS HEUTE UNTER
BEZUGNAHME AUF DIE ALLGEMEINEN FREIZEIT- UND
TOURISMUSTENDENZEN ... 28
5.1
Die Arbeitsgesellschaft... 28
5.2
Die Erlebnisgesellschaft/Spaßgesellschaft/Freizeitgesellschaft ... 29
5.3
Die Leistungsgesellschaft ... 32
5.4
Die heutige gesellschaftliche Situation... 35
Inhaltsverzeichnis
4
6
EMPIRISCHE ANALYSE AUSGEWÄHLTER STADTSTRÄNDE IN
DEUTSCHLAND ... 39
6.1
Das Erhebungsdesign... 41
6.1.1
Ziel... 41
6.1.2
Vorgehensweise/Methodik ... 41
6.1.2.1
Betriebsanalyse ... 41
6.1.2.2
Besucherbefragung ... 43
6.2
Die untersuchten Betriebe... 44
6.2.1
Der Bit Sun Beach in Trier ... 44
6.2.2
Die Strandbar Mitte in Berlin ... 46
6.2.3
Der Bundespressestrand in Berlin ... 47
6.2.4
Hamburg del Mar in Hamburg... 49
6.2.5
Zusammenfassung... 51
6.3
Auswertung der Betriebserfassungsbögen ... 52
6.3.1
Bit Sun Beach in Trier ... 52
6.3.2
Strandbar Mitte in Berlin... 54
6.3.3
Bundespressestrand in Berlin ... 57
6.3.4
Hamburg del Mar in Hamburg... 60
6.3.5
Zusammenfassung... 63
6.4
Internetseitenanalyse... 68
6.4.1
Analyse des Layouts der Internetseiten... 69
6.4.1.1
Bit Sun Beach in Trier ... 70
6.4.1.2
Strandbar Mitte in Berlin... 72
6.4.1.3
Bundespressestrand in Berlin ... 73
6.4.1.4
Hamburg del Mar in Hamburg ... 75
6.4.2
Analyse des Informationsgehalts der Internetseiten... 76
6.4.3
Zusammenfassung... 79
6.5
Teilnehmende Beobachtung ... 80
6.6
Modell- und methodengestützte Bewertung der Betriebe ... 82
6.6.1
DESIRE Modell ... 82
6.6.1.1
Anwendung des DESIRE Modells... 84
6.6.2
SWOT Analyse... 87
6.6.2.1
Anwendung der SWOT Analyse... 88
6.7
Besucheranalyse ... 94
6.7.1
Zentrale Ergebnisse der Besuchererhebung ... 94
6.7.1.1
Der typische Stadtstrandbesucher ... 95
6.7.1.2
Das typische Besuchsverhalten ... 101
6.7.1.3
Motive für den Stadtstrandbesuch... 103
Inhaltsverzeichnis
5
6.7.1.4
Psychologische Aspekte eines Stadtstrandbesuchs... 105
6.7.2
Zusammenfassung... 107
7
SCHLUSSFOLGERUNGEN ... 109
7.1
Stadtstrände als Spiegel des Wandels von der Erlebnis-/Spaß-/Freizeitgesellschaft der
1980er/90er Jahre hin zur neuen Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts? ... 109
7.2
Besser Schein als Sein? Substitution des ,,klassischen" Urlaubs durch
Stadtstrände? ... 111
7.3
Die neue Flexibilität als Zukunftsgarantie für den deutschen Städtetourismus? ... 114
7.4
Zukunft der Stadtstrände... 116
8
SCHLUSSBEMERKUNG... 119
LITERATURVERZEICHNIS ... 121
ANHANG... 127
Abbildungsverzeichnis
6
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Aufbau der empirischen Analyse ausgewählter Stadtstrände
in Deutschland ... 13
Abbildung 2: Produkt-Lebenszyklus ... 16
Abbildung 3: Wachstum und Schrumpfung von Leistungs- und Arbeitsgesellschaft 33
Abbildung 4: Leistungs- und Lustmotivationen im Wandel ... 34
Abbildung 5: Deutschlandkarte mit den untersuchten Stadtstränden ... 40
Abbildung 6: Bit Sun Beach in Trier... 44
Abbildung 7: Strandbar Mitte Berlin ... 46
Abbildung 8: Bundespressestrand Berlin... 47
Abbildung 9: Hamburg del Mar Hamburg ... 49
Abbildung 10: Umsatzentwicklung der Strandbar Mitte ... 57
Abbildung 11: Aufbau der Internetseitenanalyse ... 68
Abbildung 12: Screenshot der Internetseite des Bit Sun Beachs... 70
Abbildung 13: Screenshot der Internetseite der Strandbar Mitte ... 72
Abbildung 14: Screenshot der Internetseite des Bundespressestrands ... 73
Abbildung 15: Screenshot der Internetseite des Hamburg del Mars... 75
Abbildung 16: Prozentuale Erfüllung der Informationskriterien je Stadtstrand... 78
Abbildung 17: Das DESIRE Modell ... 83
Abbildung 18: Matrix der SWOT Analyse ... 88
Abbildung 19: Angewendete SWOT Analyse ... 89
Abbildung 20: Alter der Stadtstrandbesucher ... 95
Abbildung 21: Einzugsgebiet des Bit Sun Beachs in Trier... 97
Abbildung 22: Einzugsgebiet der Strandbar Mitte in Berlin... 98
Abbildung 23: Einzugsgebiet des Bundespressestrands in Berlin ... 99
Abbildung 24: Einzugsgebiet des Hamburg del Mars in Hamburg... 100
Abbildungsverzeichnis
7
Abbildung 25: Länge eines durchschnittlichen Besuchs der jeweiligen
Stadtstrände ... 102
Abbildung 26: Mindestkriterien der Stadtstrandausstattung ... 103
Abbildung 27: Alternativen zum Stadtstrandbesuch ... 105
Abbildung 28: Empfindungen und Gefühle beim Besuch/Gedanken an
Stadtstrände ... 106
Abbildung 29: Gruppeneinteilung des typischen Besuchsverhaltens ... 108
Tabellenverzeichnis
8
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Abgleich der Charakteristika von Freizeitparks mit Stadtstränden... 21
Tabelle 2: Abgleich der Charakteristika von Ferienparks mit Stadtstränden ... 23
Tabelle 3: Abgleich der Charakteristika von der Erlebnisgastronomie
mit Stadtstränden... 24
Tabelle 4: Allgemeine Kernfaktoren Bit Sun Beach ... 44
Tabelle 5: Allgemeine Kernfaktoren Strandbar Mitte ... 46
Tabelle 6: Allgemeine Kernfaktoren Bundespressestrand... 48
Tabelle 7: Allgemeine Kernfaktoren Hamburg del Mar ... 50
Tabelle 8: Ausstattung des Bit Sun Beaches... 52
Tabelle 9: Ausstattung der Strandbar Mitte ... 54
Tabelle 10: Ausstattung Bundespressestrand ... 57
Tabelle 11: Ausstattung Hamburg del Mar ... 60
Tabelle 12: Tagesgästezahlen des Hamburg del Mar ... 61
Tabelle 13: Größe- und Mitarbeiterverhältnis der Stadtstrände ... 63
Tabelle 14: Gegenüberstellung der stadtstrandspezifischen Ausstattung ... 64
Tabelle 15: Auswertung der klassischen Vermarktungswege... 66
Tabelle 16: Layout Kriterienkatalog Bit Sun Beach... 70
Tabelle 17: Layout Kriterienkatalog Strandbar Mitte... 72
Tabelle 18: Layout Kriterienkatalog Bundespressestrand ... 73
Tabelle 19: Layout Kriterienkatalog Hamburg del Mar... 75
Tabelle 20: Informationsgehalt der Internetseiten... 77
Tabelle 21: Bewertung der Internetseiten der Stadtstrände ... 80
Tabelle 22: Übernachtungs- und Tagestouristenzahlen 2006 für Trier,
Berlin und Hamburg... 96
Abkürzungsverzeichnis
9
Abkürzungsverzeichnis
bzw.
= Beziehungsweise
ca.
= Circa
CD
= Compact Disc
d.h.
= Das heißt
DJ
= Disc Jockey
km
= Kilometer
m
= Meter
Mio.
= Million
PKW
= Personenkraftwagen
PR
= Public Relations
USA
= United States of America
usf.
= Und so fort
v.a.
= Vor allem
z.B.
= Zum Beispiel
Einleitung
10
1
Einleitung
"They may forget what you said,
but they will never forget how you
made them feel"
(Carl W. Buechner)
Wir leben in einer Zeit die geprägt ist von ökonomischen und wirtschaftlichen
Unsicherheiten. Eine hohe und steigende Arbeitslosenquote und damit
zusammenhängend die ständige Angst weiter Bevölkerungsschichten ihre Arbeit zu
verlieren, verändert das gesellschaftliche Leben und löst Stresssituationen bei den
Bürgern aus. Die Menschen sind immer weniger bereit große Ausgaben zu tätigen
und zu allererst wird hier beim Urlaub gespart. Aus dem bestehenden Stress und der
Eingrenzung von Urlaubsreisen ergibt sich, dass die Freizeit einen immer höheren
Stellenwert einnimmt. Es wird nach Ablenkung, nach Entspannung, Ruhe und
Vergnügen gesucht, um für eine Zeit lang dem Alltag und seinen Sorgen zu
entfliehen. Aufgrund der beschränkten Zeit die dafür zur Verfügung steht, begibt sich
das Individuum auf die Suche nach konzentrierter Erholung, Entspannung und
Regeneration. Die kurze Flucht aus dem Alltäglichen soll als emotionale Medizin
gegen Erschöpfung, Stress und Depressionen wirken. Hierbei spielen neue
Erfahrungen und Empfindungen ein Zu-Sich-Selbst-Finden eine bedeutende
Rolle. Ausschlaggebend hierbei sind nicht neue oder ferne Orte, sondern das
Betrachten des Bekannten und des Nahen mit anderen Augen.
Dieser Wunsch nach ,,Mehr", nach einem emotionalen Zusatznutzen in der Freizeit,
drückt sich in der gesteigerten Erlebnisorientierung der Menschen aus. Es wird nach
Erlebnissen gesucht, die Gefühle auslösen. Die Freude, Spaß, Zerstreuung,
Rührung, Spannung, Abenteuer, Erstaunen, Überraschung und Erinnerungen
stimulieren.
1
Genau dies versuchen Stadtstrände. Durch eine südländische
Thematisierung und möglichst perfekte Inszenierung, wird dem Besucher eine
Strandurlaubssituation vorgespielt. Dadurch soll dem Gast ein zeitgemäßes
intensives Kurzerholen ermöglicht werden, welches zum einen Urlaubsgefühle
1
Vgl. FREY 2000, S.16.
Problemstellung und Ziel der Arbeit
11
hervorrufen soll, aber zum anderen gleichzeitig in der Nähe seines Arbeitsplatzes
sich befindet und er somit die erforderliche neue Flexibilität in Bezug auf seine Arbeit
nicht aufgeben muss.
2
Problemstellung und Ziel der Arbeit
Das Phänomen der Stadtstrände ist eine relativ junge Erscheinungsform von
Erlebniswelten. In Deutschland wurde der erste Stadtstrand im Jahre 2002 in Berlin
eröffnet. Seit dem boomt das Segment. Mittlerweile verfügt fast jede deutsche
Großstadt über einen, oder sogar mehrere, solcher künstlichen innerstädtischen
Strände. Was jedoch bis heute fehlt ist eine wissenschaftliche Analyse des
Stadtstrandkomplexes. Die gegenwärtige Literatur beschränkt sich auf Zeitungs- und
Zeitschriftenartikel. Jedoch wurde bisher nicht versucht in einem größeren Kontext
das Stadtstrandphänomen zu lokalisieren und zu positionieren. Was sind
Stadtstrände überhaupt? Wieso sprießen sie auf einmal deutschlandweit aus dem
Boden? Sind sie wirklich eine komplett neue Erscheinungsform des Freizeit-/ und
Tourismusmarktes, oder nur eine Abwandlung schon bestehender Konstrukte?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, anhand einer umfassenden Analyse des
Stadtstrandkomplexes, auf diese und v.a. auf weitere, tiefer gehende Fragen
Antworten zu finden. Zum einen soll dies mit Hilfe einer empirischen Analyse von am
Markt agierenden Stadtstränden möglich werden. Zum anderen werden das
Besucheraufkommen und das Verhalten, sowie die Erwartungen, Empfindungen und
Emotionen der Besucher selbst analysiert. Gestützt wird das Ganze von einem
theoretischen Gerüst. Vier Leitfragen liegen der Arbeit zugrunde:
1. Können Stadtstrände als Spiegel des Wandels von der Erlebnis-/Spaß-
/Freizeitgesellschaft
der
1980er/90er
Jahre
hin
zur
neuen
Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts angesehen werden?
2. Kommt es zu einer Substitution des klassischen Urlaubs durch Stadtstrände?
Wird der Schein in unserer heutigen Zeit also wichtiger als das Sein?
3. Dient die neue erforderliche Flexibilisierung der Arbeitsumstände dem
deutschen Städtetourismus als Garantie für eine erfolgreiche Zukunft?
4. Wie sieht die Zukunft der Stadtstrände aus?
Problemstellung und Ziel der Arbeit
12
Auf diesen Fragen aufbauend strukturiert sich die vorliegende Arbeit und versucht
möglichst repräsentative Antworten zu finden.
2.1
Vorgehensweise und Methodik
Abgestimmt auf die Beantwortung der Fragen, welche sich aus der geschilderten
Problemstellung und Zielsetzung ergeben, ist die vorliegende Arbeit in verschiedene
aufeinander aufbauende Teile gegliedert.
Unabdinglich, für eine gemeinsame Ausgangsbasis, ist eine definitorische
Abgrenzung des Stadtstrandbegriffs in Kapitel 2.2. Da es noch keine
wissenschaftliche Analyse und Ausarbeitung zum Thema Stadtstrände gibt, ist dies
v.a. notwendig, um der bestehenden definitorischen Vielfältigkeit eine Struktur und
Plattform zu verleihen.
Aus der Darlegung, was Stadtstrände überhaupt sind, ergibt sich ein Rückblick und
eine Momentaufnahme der Stadtstrandsituation in Kapitel 3. Ein historischer Abriss
verdeutlicht die Entstehung des Stadtstrandphänomens aus europäischer Sicht, geht
aber näher auf die Entwicklung in Deutschland ein, da hier der Schwerpunkt der
vorliegenden Arbeit liegt.
Darauf aufbauend wird in Kapitel 4 eine Einordnung und Zuordnung des vorher
eingegrenzten Stadtstrandphänomens in den weiteren humangeographischen und
hier v.a. freizeit- und tourismusgeographischen Kontext gegeben. Dies ist hilfreich,
um festzustellen, ob es sich wirklich um eine neue Erscheinungsform bei den
Stadtstränden handelt, oder ob sie anderen schon bestehenden Typen zugeordnet
werden können. Anhand der Gegenüberstellung und Abwägung, mit Stadtstränden
verwandten Ausprägungen von Erlebniswelten, soll dies erreicht werden.
Um das Aufkommen, die Entwicklung und Daseinsform von Stadtstränden verstehen
zu können, wird in Kapitel 5 der gesellschaftliche Wandel der letzten 50 Jahre
betrachtet. Mit Hilfe dessen, sollen die Umstände die zu der Entstehung von
Stadtstränden beigetragen haben analysiert werden, um den vorher aufgebauten
theoretischen Kontext abzurunden.
In Kapitel 6 schließt sich die empirische Analyse der ausgewählten Stadtstrände in
Deutschland an. Insgesamt wurden vier Stadtstrände ausgesucht, die über das
Problemstellung und Ziel der Arbeit
13
gesamte Bundesgebiet verteilt liegen bzw. die von ihrer Struktur her sich möglichst
unterscheiden. Jeder dieser Stadtstrände wurde auf vielfältige Weise methodisch
untersucht. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Säulen der Untersuchung auf.
Abbildung 1: Aufbau der empirischen Analyse ausgewählter Stadtstrände in Deutschland
Quelle: Eigene Darstellung 2007.
Es wird zwischen der Analyse der Betreiber und ihrer Situation und der Besucher
unterschieden. Um einen Eindruck zu erhalten, wer die Betreiber sind und was ihre
genauen Motivationen, Beweggründe und Strategien in Bezug auf den von ihnen
betriebenen Stadtstrand sind, werden drei Hauptmethoden und eine ergänzende
angewendet.
Zum
einen
erfolgt
eine
allgemeine
Darstellung
des
Betreiberunternehmens, um erste generelle Eindrücke zu erlangen. Zum anderen
wurde an die Betreiber ein Betriebserfassungsbogen (siehe Anhang 1) im Vorfeld der
Studie geschickt, um nähere und tiefere Informationen zu erhalten. Die
anschließende Internetseitenanalyse analysiert die Online-Selbstdarstellung der
Stadtstrände und untersucht sie auf ihr Layout und den Informationsgehalt.
Ergänzend wird eine qualitative teilnehmende Beobachtung am jeweiligen
Stadtstrand durchgeführt, um aus der Sicht der Besucher die Stadtstrände zu
Problemstellung und Ziel der Arbeit
14
erleben und um dadurch auch praktisch feststellen zu können, wie sich die
Stadtstrände
darstellen
und
eventuelle
Unstimmigkeiten
und
Verbesserungsvorschläge machen zu können. Die Analyse der Besucher baut
hauptsächlich auf den an den Stadtstränden durchgeführten Befragungen bzw. den
ausgefüllten Fragebögen auf. Ergänzend wird auch hier die teilnehmende
Beobachtung angewendet, um das Verhalten der Besucher verfolgen zu können und
somit die Auswertung der Fragebögen auch qualitativ stützen zu können.
In Kapitel 7 schließt sich der Kreis wieder und die Ausgangsfragen werden anhand
der erarbeiteten theoretischen Grundlagen und gewonnenen empirischen Ergebnisse
explizit beantwortet, um in Kapitel 8 ein kurzes abschließendes Fazit in Bezug auf
das Stadtstrandphänomen folgen zu lassen.
2.2
Was sind Stadtstrände?
Grundlegend für ein einheitliches Verständnis der Problemstellung dieser Arbeit, ist
eine allgemeingültige Definition des Untersuchungsobjektes. Es existiert jedoch noch
keine veröffentlichte, wissenschaftliche Schrift, die als Grundlage und Bezugsrahmen
für eine Definition von Stadtstränden gelten könnte. Im Folgenden wird somit eine
eigene Definition aufgestellt, die sich bemüht umfassend zu sein, jedoch nicht den
Anspruch
auf
Vollständigkeit
erhebt,
auch
weil
die
Dynamik
des
Stadtstrandkomplexes es nur schwer ermöglicht alle Entwicklungen, die sich in
Zukunft ergeben könnten, mit einzubeziehen. So lässt sich die Definition, die dieser
Arbeit zu Grunde liegt, als zeitliche Momentaufnahme der Beschaffenheit von
Stadtstränden verstehen.
Moderne Stadtstrände, oder synonym genannt: City Beaches, Strandbars und Beach
Clubs, haben nichts mit der ursprünglichen Definition eines solchen gemein. So
handelt es sich nicht um Strände die zu einer am Meer liegenden Stadt gehören. Die
Stadtstrände auf die sich die vorliegende Arbeit bezieht, sind moderne, v.a.
mitteleuropäische,
innerkontinentale,
künstliche,
großstädtische
Erscheinungsformen. Stadtstrände bestehen aus aufgeschütteten Sandflächen.
Diese Flächen sind ca. zwischen 700 und 5000m² groß und liegen meist an
Flussufern. Es existieren jedoch auch Stadtstrände die nicht in unmittelbarer
Flussnähe liegen, sondern z.B. auf Häuserdächern. Fast jeder Stadtstrand hat ein
anderes Konzept. Von ,,chic bis hippie" (vgl. HOTTELLING 2005, S.5) ist alles zu
Entwicklung des Stadtstrandphänomens - Historischer Abriss und heutige Situation
15
finden. Die typische Mindestausstattung eines Stadtstrandes besteht aus
Strandliegen, Palmen und einem Gastronomie- bzw. reinem Getränkeangebot. Jeder
Stadtstrand verfügt außerdem über Musikbeschallung. Darüber hinaus stellen einige
Stadtstrände den Besuchern Sporteinrichtungen, wie z.B. Beachvolleyballfelder, und
Unterhaltungsprogramm, wie z.B. Tanzkurse und Partys, zur Verfügung. Aufgrund
der Witterungsverhältnisse im mitteleuropäischen Bereich, erstreckt sich die Saison
meist von Mai bis Ende September. Auch während dieser Zeit bleiben die
Stadtstrände geschlossen, wenn das Wetter zu kalt bzw. zu nass ist. Somit sind
Stadtstrände extrem witterungsabhängig.
3
Entwicklung
des
Stadtstrandphänomens
-
Historischer Abriss und heutige Situation
Das Stadtstrandphänomen findet seinen Ursprung in Frankreich bzw. in Paris. Im
Jahr 2001 wurde hier der ,,Paris Plage" zum ersten Mal inszeniert.
2
Der ,,Paris Plage"
ist ein 3,5 Kilometer langer aufgeschütteter Sandstrand entlang des rechten
Seineufers, auf der sonstigen Schnellstraße Georges Pompidou. Initiiert wurde das
jährlich stattfindende Projekt, von dem sozialistischen Bürgermeister Delanoe. Der
ursprüngliche Gedanke war, dass der Strand für Daheimgebliebene, die sich keinen
,,Urlaub unter Palmen" leisten konnten, eine Art Ersatzurlaub bieten sollte. Somit ist
der ,,Paris Plage" nicht kommerziell. Von den zwei Millionen Euro Kosten pro Jahr,
zahlen Sponsoren 1,4 Millionen. Der Rest wird von der Stadt finanziert.
3
In Deutschland wurde der erste Stadtstrand, mit der Strandbar Mitte in Berlin, im
Jahre 2002 ins Leben gerufen. Seit dem entwickelte sich das Phänomen der
Stadtstrände hierzulande schnell zum Trend. Jedes Jahr werden neue Stadtstrände
gegründet. Dadurch ist die Stadtstrandlandschaft sehr dynamisch aber auch recht
unübersichtlich. Heute existieren in Deutschland ca. 70 Stadtstrände, welche über
das gesamte Bundesgebiet verteilt sind. Fast jede Großstadt verfügt über einen
solchen. Berlin und Hamburg weisen sogar eine Art Stadtstrand-Kultur auf, mit
mehreren Stränden über das gesamte Stadtareal verteilt. Der große Unterschied
2
Vgl. SPIEGELONLINE 2005.
3
Vgl. SPIEGELONLINE 2004.
Entwicklung des Stadtstrandphänomens - Historischer Abriss und heutige Situation
16
zwischen dem ursprünglichen Modell, wie es in Paris anzufinden ist, und dem
deutschen, ist der Beweggrund. Wurde das Stadtstrandmodell in Frankreich aus
sozialistischen Gründen kreiert, so ist dieser Gedanke in Deutschland fern. Alle
deutschen Stadtstrände werden von privatwirtschaftlichen Unternehmen geführt und
verfolgen nicht den Wohlfahrtsgedanken.
Um die heutige Situation des Stadtstrand-Komplexes besser einschätzen zu können,
wird das Modell des Produkt-Lebenszyklus (siehe Abbildung 2) darauf bezogen.
Abbildung 2: Produkt-Lebenszyklus
Quelle: WÖHE 1990, S.716.
Das Modell des Produkt-Lebenszykluses gibt schematisch wieder, wie sich die
Umsatz- und Absatzentwicklung eines Produktes im Zeitablauf von Einführung bis
zum Ausscheiden aus dem Markt verhält.
4
Übertragen auf die Stadtstrand Situation,
muss die typische Entwicklung in der Einführungsphase relativiert werden. So hat die
Umsatz- und Gewinnbeschaffenheit der Stadtstrände in Deutschland nicht am
Anfang leicht zugenommen, um sich kontinuierlich zu steigern, sondern v.a. in den
ersten zwei Jahren gab es oft extreme Umsatz- und Gewinnwerte, die sich entweder
mit der Zeit abgeflacht haben, oder noch gesteigert werden konnten (siehe Kapitel
6). Bezogen auf die Untersuchungsstichprobe der vorliegenden Arbeit, befindet sich
das Stadtstrandphänomen allgemein in der Wachstumsphase. Es ist weder eine
4
Vgl. WÖHE 1990, S.715.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
17
Sättigung des Marktes, anhand von Umsatzrückgängen, noch ein Ende des Trends,
anhand von Schließungen, zu erkennen. Seit dem Aufkommen der Stadtstrände,
kommt es vielmehr jedes Jahr zu Neugründungen. Damit dieser Trend möglichst
anhält empfiehlt es sich, trotz der sehr positiven Werte, Innovationen und
Neuerungen in das Konzept einzubauen, um nicht unterzugehen. Anzumerken ist
außerdem, dass Lebenszyklen von Erlebniswelten, zu denen Stadtstrände gehören,
kürzere Phasen aufweisen, als bei Produkten. Dies erfordert häufigere
Pionierphasen mit Produkt- bzw. Prozessinnovationen.
5
Tiefere Einblicke in mögliche
Strategieanpassungen bzw. änderungen bietet Kapitel 6.6.
4
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
Stadtstrände können übergeordnet in den Städtetourismus bzw. Städtefreizeit
Bereich eingeordnet werden. Freizeittypische Motivationen, wie z.B. Regeneration,
soziale Kommunikation, anregendes Ambiente und der Wunsch nach Wiederholung
angenehmer Erlebnisse
6
, werden durch den Stadtstrandbesuch erfüllt.
Enger gefasst gehören Stadtstrände zu den künstlichen Erlebniseinrichtungen. Im
Tourismus werden die Begriffe Emotion und Erlebnis jedoch häufig synonym
verwendet. Dementsprechend sind Erlebnisse ,,innere" Ereignisse eines jeden
Menschen, die der Fremdbeobachtung meist verborgen bleiben.
7
Nach MÜLLER ist
ein Erlebnis ,,ein außergewöhnliches, subjekt- und situationsbezogenes inneres
emotionales Ereignis im Leben eines Menschen, das sich einer zielgerichteten
Selbst- oder Fremdsteuerung entzieht, dessen Rahmenbedingungen allerdings
phänomenfördernd gestaltet werden können" (MÜLLER 2001, S.42). An der
,,phänomenfördernden"
Gestaltung
der
Rahmenbedingungen,
greift
das
Stadtstrandmodell an. Es versucht den Erlebniswert, also den subjektiv erlebten
Beitrag zur Lebensqualität
8
, zu steigern. Da Erlebnisse aus dem Wechselspiel des
vom Unternehmen inszenierten Ereignisses und dem Bewusstseinszustand des
5
Vgl. HINTERHUBER; PECHLANER 2001, S.14/18.
6
Vgl. AGRICOLA 2001, S.148.
7
Vgl. WITTERSHEIM 2004, S.20.
8
Vgl. WEINBERG; NICKEL 2007, S.38.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
18
individuellen Kunden hervorgehen
9
, verfolgen künstliche Welten, und hier im
Speziellen Stadtstrände, den Wunsch nach Perfektion und Inszenierung, um das
emotionale Ereignis jeden Individuums zu fördern.
10
Warum Menschen
erlebnisorientierte Formen von Freizeit wählen, lässt sich psychologisch erklären.
Zum einen dient das Erleben als Bewältigung bzw. Erholung von Stress. Zum
anderen kann Erlebnissuche als Reizsuche, als ,,Sensation Seeking", aufgefasst
werden. Eine dritte Erklärung ist die ,,Flucht aus der Leere", also als Suche nach dem
Sinn des Lebens.
11
Wie oben beschrieben, können Stadtstrände den Erlebniswelten zugeordnet werden.
Es existiert eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausprägungen von Erlebniswelten.
Ob Stadtstrände sich in ein schon bestehendes Konstrukt einordnen lassen bzw. wie
sie im Erlebnisweltenkomplex positioniert werden können, wird im Folgenden
untersucht, um eine wissenschaftliche und definitorische Fundierung zu schaffen.
4.1
Erlebniswelten
Wie im vorangegangenen Kapitel analysiert, gehören Stadtstrände zu den so
genannten Erlebniswelten. Erlebniswelten sind komplexe, multifunktionale
Einrichtungen an der Schnittstelle von Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Konsum, Sport
und Tourismus. Wesentliche Erfolgsfaktoren für diese künstlichen Einrichtungen sind
u.a. die Berechenbarkeit der Leistungen, also die Sicherheit und die räumliche
Konzentration der Angebote.
12
Erlebniswelten können als Art von Traum- und
Wunschwelten klassifiziert werden, da sie die Wünsche und Träume der Besucher
von einem ,,schöneren" Leben widerspiegeln. Der Sinn des Lebens wird v.a. durch
die Qualität subjektiver Prozesse definiert. Somit werden innere Ereignisse zu
zentralen Lebenserfahrungen.
13
Künstliche Installationen dienen als Fluchtburgen für
Menschen, die in den Großstädten von Ballungsräumen zunehmend Sauberkeit,
Sicherheit und Freundlichkeit des Personals vermissen.
14
Allen Erlebniswelten ist
9
Vgl. PIKKEMATT; PETERS; SCHOPPITSCH 2006, S.160.
10
Vgl. SCHRÖDER 2006, S.113.
11
Vgl. KAGELMANN 2001, S.93ff.
12
Vgl. STEINECKE 2001, S.67f.
13
Vgl. PENZ; RÖSCH 2004, S.40.
14
Vgl. OPASCHOWSKI 2000a, S.47ff.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
19
gemein, dass sie den beschriebenen Kontrast zur Alltagswelt schaffen und als
,,Produktionsstätte positiver Erfahrungen" (ROMEIß-STRACKE 2004, S. 172) diese
dem Besucher gegen ein Entgelt anbieten.
15
KAGELMANN fasst die
Beschaffenheiten von Erlebniswelten definitorisch wie folgt zusammen:
,,Eine Erlebniswelt ist ein künstlich geplanter, kommerzieller Freizeit- (oder Urlaubs-)
bereich, in dem geplant versucht wird, den (...) Menschen besonders viele
Funktionen zu vermitteln und dabei als besondere Dienstleistung emotionale
Erlebnisse für einen begrenzten Zeitraum zu verschaffen. Es geht um eine
Angebotsvielfalt, es geht aber auch um Gefühle Spaß, Freude, Glückszustände
usf." (KAGELMANN 1998, S.61).
Erlebniswelten machen von drei Hauptinstrumenten Gebrauch, um den gewünschten
Effekt bei den Besuchern zu erzielen. Diese sind:
· Inszenierung
· Thematisierung
· Storytelling
Wörtlich übersetzt bedeutet inszenieren, etwas in Szene setzten. Genau dies
fabrizieren Stadtstrände. Inszenierungen sind ein wichtiges Gestaltungskriterium von
Erlebniswelten. Durch Symbole, Signale und Beschaffenheiten sollen Gefühle
marktorientiert hervorgerufen werden.
Thematisierung umschreibt die thematische Grundausrichtung einer Inszenierung.
Dies ist von Hilfe, damit der Kunde ein stimmiges und einprägsames ,,Produkt" findet.
Ein hoher Wiedererkennungswert steigert die emotionale Bindung des Kunden.
Auch das Storytelling ist ein Element der Inszenierung. Hierbei wird das Ziel verfolgt,
unterbewusste Erinnerungen und Gefühle der Kunden, durch Bilder bzw. Umstände
und Geschichten hervorzurufen und ihnen somit das Empfinden zu vermitteln, dass
sie Teil der ,,Story", also der Erlebniswelt sind.
16
15
Vgl. OPASCHOWSKI 2000b, S. 47.
16
Vgl. WITTERSHEIM 2004, S. 25f.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
20
Es existieren verschiedene Ausprägungen von Erlebniswelten. Im Folgenden werden
die wichtigsten bzw. populärsten Formen knapp vorgestellt. Dies erscheint als
sinnvoll, da Stadtstrände offensichtlich am Schnittpunkt vieler schon bestehender
Erlebniswelten existieren. Es ergeben sich teilweise Gemeinsamkeiten, aber auch
Abgrenzungen. Zur Positionierung von Stadtstränden ist es notwendig diese
Überschneidungen und Abgrenzungen aufzudecken und zu untersuchen, ob
Stadtstrände in ein schon bestehendes Konstrukt mit eingeflochten werden können,
oder ob sie ein eigenständiges und neues Element bilden.
4.1.1
Freizeit-/Erlebnis-/Themenparks
Die Begriffe Freizeit-/Erlebnis-/ und Themenpark werden meist synonym für die
gleiche Erscheinungsform verwendet und werden in der vorliegenden Arbeit, zur
Vereinfachung, Freizeitparks genannt.
Freizeitparks sind ,,abgeschlossene, großflächig angelegte, künstlich geschaffene,
stationäre Ansammlungen verschiedener Attraktionen, Unterhaltungs- und
Spielangebote." (HAHN; KAGELMANN 1993, S.407). Sie erstrecken sich über eine
große Bandbreite, vom einfachen Märchengarten bis hin zu inszenierten
Großanlagen mit mehreren Millionen Besuchern pro Jahr. Gemein ist allen
Freizeitparks, dass sie von privaten Unternehmen kommerziell geführt werden und
gegen ein bestimmtes Entgelt den Kunden ,,Unterhaltung, Entspannung und
Informationen" (FICHTNER 2000, S.80) offerieren. Alle weisen eine thematische
Geschlossenheit auf und versuchen eine breite Bevölkerungsschicht anzusprechen,
sich also nicht auf eine oder wenige Zielgruppen zu beschränken. Oft, aber nicht
zwingend, beinhalten Freizeitparks technische Fahr- und Spielgeräte. Prototypen
sind die Disneyparks, die mehr als 10 Millionen Besucher pro Jahr verzeichnen (z.B.
Disneyworld in Florida/USA 13,7 Mio. Besucher in 1998, Eurodisney bei
Paris/Frankreich 12,5 Mio. Besucher in 1998).
17
Der größte Freizeitpark in
Deutschland ist der Europapark Rust, mit 3,9 Millionen Besuchern (2005)
18
, gefolgt
vom Phantasialand mit 2,2 Millionen Besuchern (2007).
19
Freizeitparks zielen auf den
17
Vgl. FICHTNER 2000, S.80.
18
Vgl. EUROPAPARK RUST 2007.
19
Vgl. PHANTASIALAND 2007.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
21
Kurzreise- und Ausflugsverkehr ab und befinden sich meist außerhalb großer Städte
in Verdichtungsräumen.
20
Durch Abgleich der oben beschriebenen Charakteristika der Freizeitparks mit denen
von Stadtstränden, lassen sich einige Gemeinsamkeiten, aber auch deutliche
Abweichungen erkennen.
Tabelle 1: Abgleich der Charakteristika von Freizeitparks mit Stadtstränden
Charakteristika
Freizeitparks
Stadtstrände
Abgeschlossene, künstliche,
stationäre Einrichtung
X
X
Kommerziell strukturiert
X
X
Keine feste Zielgruppe
X
X
Thematische
Geschlossenheit
X
X
Technische
Fahr-
und
Spielgeräte
X
Ausgerichtet auf Kurzreise-
und Freizeitverkehr
X
X
Häufig
außerhalb
großer
Städte
X
Quelle: Eigene Darstellung 2007.
Wie Tabelle 1 verdeutlicht, unterscheiden sich Freizeitparks und Stadtstrände in ihrer
Ausstattung sowie ihrer räumlichen Lage. Aus der Gegenüberstellung nicht
ersichtbar ist zum einen der Unterschied in der Größe - Freizeitparks weisen eine
vielfache Größe von Stadtstränden auf - und zum anderen die Abweichung der
Hauptschwerpunkte der Inszenierungen. Zwar möchten beide den Gästen
Unterhaltung, Entspannung und Ablenkung bieten, aber das Medium um dies zu
erreichen ist sehr verschieden. Legen Freizeitparks meist ihren Schwerpunkt auf die
aktive Betätigung der Gäste, so konzentrieren sich Stadtstrände auf den passiven,
v.a. gastronomischen, Konsum der Besucher.
20
Vgl. HAHN; KAGELMANN 1993, S.407.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
22
4.1.2
Ferienparks
Ferienparks zählen zu Feriengroßprojekten. Diese beherbergen auf begrenztem
Raum eine große Anzahl von meist Kurzurlaubern und verfügen über mindestens
400 Betten. Sie bieten vielfältige Wohnmöglichkeiten. Es existieren, parkabhängig,
Hotelkomplexe, aber auch Ferienhäuser- bzw. Bungalowanlagen. Typisch ist die oft
breite Palette von wetterunabhängigen, also überdachten, Freizeiteinrichtungen.
Herausstechend ist das obligatorische Spaßbad, welches dem Ferienpark ein
tropisches Flair geben soll. Des Weiteren verfügen die Anlagen über
Gastronomiebetriebe und Einkaufsmöglichkeiten.
21
Räumlich sind sie meist am
Rande von Verdichtungsräumen, auf großen Arealen der ,,grünen Wiese"(ROMEIß-
STRACKE 2004, S.172) angesiedelt. Charakteristisch ist die starke Orientierung auf
eine möglichst unberührte Naturkulisse. Entweder im Park selbst, oder in der
Umgebung.
22
Bekannte Beispiele für Ferienparks sind z.B. Center Parc oder Gran
Dorado.
Ein Abgleich der Charakteristika der Ferienparks und der Stadtstrände (siehe Tabelle
2) ergibt, dass die beiden Erlebniswelten zwar, wie auch die Freizeitparks, dem Gast
Unterhaltung, Erholung und Entspannung bieten möchten, die Wege um dies zu
erlangen jedoch weit von einander abweichen.
21
Vgl. BECKER 2000. S.72.
22
Vgl. HUBER 1999, S. 33ff.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
23
Tabelle 2: Abgleich der Charakteristika von Ferienparks mit Stadtstränden
Charakteristika
Ferienparks
Stadtstrände
Künstliche, stationäre
Einrichtung
X
X
Kommerziell strukturiert
X
X
Sommer-/Südsee
Thematisierung
X
X
Schwerpunkt auf
Kurzurlauber
Übernachtungsgäste
X
Spaß-/Erlebnisbad
X
Lage außerhalb von
Ballungsräumen
X
Quelle: Eigene Darstellung 2007.
Die Thematisierung ist zwar bei Ferienparks und Stadtstränden gleich - beide
konzentrieren sich auf das Südsee- bzw. Sommerurlaubsfeeling -, aber Ferienparks
zielen eher auf das Urlaubs- und nicht Freizeitsegment ab, was die beiden
Erlebniswelten grundlegend voneinander unterscheidet. Außerdem unterscheidet
sich die räumliche Lage rudimentär voneinander. Befinden sich Ferienparks
außerhalb von Ballungszentren, so liegen Stadtstrände in deren Zentrum. Auch die
Einrichtung ist nicht vergleichbar.
4.1.3
Erlebnisgastronomie
Die Erlebnisgastronomie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Gastronomie
anhand ihres Zusatznutzens für die Gäste. Neben Speisen und Getränken offerieren
diese Erlebniswelten besondere, das Menü begleitende, Attraktionen. Dies können
z.B. Varieté Einlagen oder schauspielerische Darbietungen sein. Im Unterschied zu
normalen Restaurants ist bereits das Betreten der Räumlichkeit kostenpflichtig.
Durch wechselnde themenbezogene Inszenierungen, bildet die Erlebnisgastronomie
einen Kontrast zur Alltagswelt und verfolgt das Ziel emotionale Erlebnisse bei den
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
24
Gästen zu schaffen.
23
WITTERSHEIM definiert Erlebniswelten als ,,spezielle,
regelmäßig stattfindende, künstliche Attraktionen" (WITTERSHEIM 2004, S.64).
Seit einigen Jahren, nehmen außerhäusige Aktivitäten, mit denen keine
Erlebnisorientierung verfolgt wird, überproportional ab.
24
Dementsprechend ist
auffällig, dass die Gesamtzahl der Gaststättenbesuche und -umsätze seit Jahren
rückläufig ist. Eine Sonderposition nimmt hierbei jedoch die Erlebnisgastronomie ein,
die als Teilmarkt eine steigende Tendenz aufweist.
25
Tabelle 3: Abgleich der Charakteristika von der Erlebnisgastronomie mit Stadtstränden
Charakteristika
Erlebnisgastronomie Stadtstrände
Künstliche, stationäre
Einrichtung
X
X
Kommerziell strukturiert
X
X
Indoor Veranstaltung
X
Schwerpunktmäßige
Orientierung auf Freizeitler
X
X
Straff organisiertes
Unterhaltungsprogramm
X
Fokus auf Essen und
Darbietung
X
Quelle: Eigene Darstellung 2007.
Beim Vergleich der Charakteristika von der Erlebnisgastronomie mit Stadtstränden
(siehe Tabelle 3), ergeben sich, wie auch schon bei den Freizeit- und Ferienparks,
eindeutige Überschneidungen, aber auch signifikante Abweichungen voneinander.
So grenzen sich die beiden Erlebniswelten schon durch ihr grundlegendes
Tätigkeitsfeld
voneinander
ab.
Wobei
der
Hauptschwerpunkt
der
Erlebnisgastronomie auf dem mehrgängigen Menü und dem begleitenden
darstellenden Unterhaltungsprogramm liegt, ist dies dem Stadtstrandmodell fern.
Hier unterhält sich der Besucher selbst, entweder durch Konversation mit anderen
Gästen, oder sportlicher Betätigung. Der Konsum von Speisen ist bei Stadtstränden
23
Vgl. WITTERSHEIM 2004, S.64.
24
Vgl. INSTITUT FÜR MOBILITÄTSFORSCHUNG, S.131.
25
Vgl. THEMATA FREIZEIT- UND ERLEBISWELTEN SERVICE GMBH 2004, S.143.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
25
zwar meist möglich, jedoch nicht in der Qualität und Quantität eines
Erlebnisrestaurants. Zwar sprechen beide Konzepte Freizeitler und nicht Urlauber
wie die Ferienparks an, aber die erlebnisgastronomischen Aktivitäten erstrecken
sich hauptsächlich auf den innerhäuslichen Bereich, die der Stadtstrände eindeutig
auf den außerhäuslichen.
4.2
Stadtstrände als neues Segment von Erlebniswelten
Wie im vorangegangenem Kapitel festgestellt wurde, lassen sich Stadtstrände
eindeutig den Erlebniswelten zuordnen. Sie nutzen die Instrumente der Inszenierung,
der Thematisierung und des Storytellings. Es handelt sich bei ihnen um komplexe,
multifunktionale Konstrukte, die das Ziel verfolgen, durch ihre Strategien und
Konzepte, den Gästen ein ,,inneres" Erlebnis, also außergewöhnliche und
einprägsame Emotionen, durch äußere Stimulationen zu ermöglichen.
Bei dem Versuch der Zuordnung der Stadtstrände zu einigen der bereits
bestehenden Erlebniswelten - Freizeitparks, Ferienparks und Erlebnisgastronomie -,
in Kapitel 4.1, wurde festgestellt, dass sich zwar einige Überschneidungen der
Charakteristika ergeben, aber auch entscheidende Unvereinbarkeiten existieren.
Somit lassen sich Stadtstrände als ein neues Segment im Feld der Erlebniswelten
klassifizieren.
Stadtstrände zielen in ihrer Gestaltung auf Erfahrungen ab die, im Bewussten direkt
und im Unbewussten indirekt (durch Empfindungen und Stimmungen),
wahrgenommen werden.
26
Darüber hinaus wird den Gästen, durch die
monothematische Fokussierung, das Gefühl vermittelt, zu einer exklusiven
Gesellschaft zu gehören bzw. ein Gemeinschaftsgefühl zu empfinden.
27
ROMEIß-STRACKE formuliert die vier Prinzipien der Erlebnisökonomie wie folgt:
1. Inszenierung und Imagineering
2. Multioptionalität und Consumerism
3. Qualität und Service
26
Vgl. ALTENHÖNER 2004, S.126.
27
Vgl. HARTMANN 2006, S.199.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
26
4. Sicherheit und Sauberkeit
28
Zwar sind diese Prinzipien nicht generell nur auf Freizeit- und Erlebniswelten
beschränkt, aber sie sind dort leichter durchzuführen. Es ergibt sich eine vollständige
Erfüllung dieser Prinzipien in Bezug auf Stadtstrände, wie in den vorangegangenen
Kapiteln belegt wurde. Punkt vier, das Prinzip der Sicherheit und Sauberkeit, greift an
den tief liegenden Bedürfnissen der Menschen an, die in der ,,normalen" Welt nicht
unbedingt, oder nicht mehr erfüllt werden. Sicherheit kann hier in vielfältiger Weise
verstanden werden. Neben der Sicherheit von gleich bleibenden Angeboten, der
Erfüllung von Erwartungen, des Zurechtfindens, des ,,Happy Ends" und vor
unangenehmen Überraschungen, ist auch die Sicherheit vor Konflikten,
Katastrophen und Kriminalität zu verstehen.
29
Dieses Sicherheitsdenken und
gleichzeitiges Urlaubsfeeling direkt vor der Haustür (siehe Kapitel 7.2), ermöglichen
Stadtstrände und treffen somit den Puls der Zeit.
4.3
Stadtstrände als neuer Bestandteil des Städtetourismus
Die Stadt als Raum für Tourismus und Freizeit wurde in den 1970er Jahren erkannt
und entwickelt sowie verändert sich seitdem kontinuierlich. Die Erholungsfunktion der
Stadt, und hier v.a. der Innenstadt, rückte immer mehr in den Vordergrund. Seit
Mitte/Ende der 1990er Jahre verzeichnen Großstädte (über 100.000. Einwohner)
kontinuierlich überdurchschnittliche Wachstumsraten und entwickelten sich zum
beliebtesten Tagesreiseziel. Besonders und herausstechend am Städtetourismus ist
die Multioptionalität des touristischen Angebots. Die größte Herausforderung für den
Städtetourismus ist, die Kundenbedürfnisse auch zukünftig zu erkennen und zu
bedienen.
30
Genau an diesem Punkt greift das Stadtstrandphänomen an.
Stadtstrände liegen zwar meist an Binnengewässern, und hier vor allen an Flüssen,
aber immer in Laufentfernung zu den Innenstädten der jeweiligen Stadt. Diese
Charaktereigenschaft unterscheidet sie fundamental von der räumlichen Lage von
Freizeit- und Ferienparks, die hauptsächlich in den Randgebieten von
Ballungszentren zu finden sind (siehe Kapitel 4.1). Aufgrund dessen können
28
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2004, S.174.
29
Vgl. KAGELMANN 2001, S.98.
30
Vgl. ANTON-QUACK; QUACK 2003, S.193ff.
Einordnung des Phänomens der Stadtstrände
27
Stadtstrände als eine Bereicherung für den Städtetourismus angesehen werden, da
sie die Urlauber bzw. Freizeitler in den Städten halten, ihnen einen höheren
Attraktivitätsgrad verleihen und nicht in Konkurrenz zu den Innenstädten treten, wie
die außerstädtischen Freizeit- und Ferienparks. Es ergeben sich vielmehr
Synergieeffekte. Stadtstrände locken mehr Touristen/Freizeitler in die Innenstädte.
Dies begünstigt wiederum die Besucherrate der Stadtstrände selbst. ROMEIß-
STRACKE spricht sogar von einer Renaissance der Innenstädte als ,,echte" Freizeit-
und Erlebniswelten.
31
Die Beschreibung ,,echt" ist jedoch im Abstrakten zu verstehen.
Eine Definition wann etwas als ,,echt" zu bezeichnen gilt gibt es nicht. Letztendlich
kommt es z.B. nicht auf das Alter einer Stadt an, weil auch diese wurde irgendwann
künstlich geschaffen, sondern auf die Abgestimmtheit, Schlüssigkeit und Integration
der einzelnen städtischen Elemente. Somit erscheint ein Stadtstrand mit Sicherheit
,,echter", trotz seiner eindeutigen Fremdheit, als ein Freizeitpark, der, rein
theoretisch, durch seine Physiognomie und Abgeschlossenheit als eindeutiges
Fremdglied in Innenstädten auffallen würde. An diesem Punkt halten sich die Kritiker
von Inszenierungen in den Innenstädten fest. Der erhobene Vorwurf, dass
Innenstädte durch Inszenierungen ihre Identität verlören, bezieht sich wiederum auf
die, oben erwähnte, ,,echte" Stadt.
32
Da das Prädikat ,,echt" jedoch sehr relativ zu
benutzen ist, kann nicht von einem Verlust der Attraktivität bzw. der Identität der
Innenstädte durch Inszenierungen gesprochen werden, höchstens von einem
Wandel dieser Innnenstädte. Die Bedeutung von Freizeit und Tourismus für die
Entwicklung von Innenstädten geht über den quantitativ messbaren Anteil hinaus.
Freizeit und Tourismus haben das Potential das Image einer Stadt maßgeblich zu
beeinflussen.
33
Somit fällt auch den Stadtstränden diese Möglichkeit zu. Durch
flexiblere Arbeitszeitmodelle (siehe Kapitel 5.4) wächst die Bedeutung von
Kurzurlauben und führt zu einer steigenden Nachfrage im Städtetourimus. Somit
bedienen Stadtstrände ein aktuelles Bedürfnis der Touristen/Freizeitler und docken
an ein Trendsegment des (Deutschland-) Tourismus an.
Im folgenden Kapitel wird der Wandel der Gesellschaft innerhalb der letzten 60 Jahre
31
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2004, S.179.
32
Vgl. MONHEIM 2003, S.815.
33
Vgl. MONHEIM 2003, S.823.
Der Wandel der Gesellschaft von 1950 bis Heute Unter Bezugnahme auf die allgemeinen
Freizeit- und Tourismustendenzen
28
dargestellt und die heutige gesellschaftliche Situation, mit der ihr angegliederten
Tourismusveränderung, analysiert. Diese Aufarbeitung dient dazu das Phänomen
und den Erfolg von Stadtstränden unter der gesamtgesellschaftlichen Situation
nachvollziehen und verstehen zu können.
5
Der Wandel der Gesellschaft von 1950 bis Heute
Unter Bezugnahme auf die allgemeinen Freizeit-
und Tourismustendenzen
Seit 1950 bis zum heutigen Tag hat sich die deutsche Gesellschaft vielfach
verändert, erweitert und neu formiert. Gesellschaftliche Werte wandeln sich durch
soziodemographische, sozioökonomische und soziokulturelle Umgestaltungen.
34
Eng
damit verbunden sind Veränderungen im Freizeit- und Tourismusbereich. Im
Folgenden werden gesellschaftliche Hauptströme der letzten 60 Jahre knapp
vorgestellt und ihr Wandel hin zu der heutigen Gesellschaft analysiert. Abschließend
wird das Phänomen der Stadtstrände in die aktuelle gesellschaftliche Situation, aus
sozialer und freizeit- bzw. tourismusrelevanter Sichtweise, eingeflochten.
5.1
Die Arbeitsgesellschaft
"Erst die Arbeit, dann das Vergnügen". Mit diesem populären Sprichwort lässt sich
die Arbeitsgesellschaft der 1950er und 1960er Jahre knapp und vereinfacht
charakterisieren. Geistig, kulturell und psychologisch wurde hauptsächlich ums
Zentrum der Arbeit gekreist.
35
Werte wie Fleiß, Pflicht, Familie, Frömmigkeit, Treue
und Nutzen wurden hochgehalten und von der breiten Bevölkerung vertreten.
36
Ein
industrieller Zeit-. und Arbeitsablauf bestimmte immer mehr das Leben. So wurde
meist von Montag bis Freitag, von 8-17h gearbeitet. Die Wochenenden waren
festgelegte arbeitsfreie Zeiten. Auch der Urlaub war fest geregelt. Das Modell der
industriellen Arbeitszeitorganisation etablierte sich in Deutschland bis Ende der
34
Vgl. WITTERHEIM 2004, S.15.
35
Vgl. GUGGENBERGER 1998, S.177.
36
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S.51.
Der Wandel der Gesellschaft von 1950 bis Heute Unter Bezugnahme auf die allgemeinen
Freizeit- und Tourismustendenzen
29
1960er Jahre.
37
Der Urlaub entwickelte sich zum Gegenpol zur Arbeit und diente der
Regeneration von der Arbeit und zum Kräftesammeln für die Arbeit. Gehören
heutzutage der Orts- und somit Rollenwechsel zum Urlaub dazu, um sich von
Alttags- und Haushaltspflichten zu distanzieren, so wurde in der Zeit der
ausgeprägten Arbeitsgesellschaft Urlaub nicht unbedingt mit Verreisen gleichgesetzt.
V.a. in den 1960er und 1970er Jahren kristallisierte sich Freizeit immer mehr zu der
Zeit heraus in der das Individuum selbst bestimmen konnte, womit es die Zeit
verbringen wollte.
38
Gleichzeitig kam es ab den 1950er/1960er Jahren zu einer
ersten Blüte des Entertainments. So wurde 1955 das erste Disneyland in den USA,
sowie die erste Mc Donalds Filiale eröffnet. Des Weiteren kam der Fernseher auf und
bot der Bevölkerung die Möglichkeit sich massentauglich und gezielt unterhalten zu
lassen.
39
Neben dem allgemein ansteigenden Lebensstandart, der auch in unteren
sozioökonomischen Klassen Einzug hielt, wurde das Bildungswesen ausgebaut und
für eine breitere Bevölkerungsschicht geöffnet. Somit ergaben sich neue
Aufstiegsmöglichkeiten. Geschlossene Klassenwelten brachen auf. In den 1970er
und 1980er Jahren kam es immer stärker zu einer Entstrukturierung der
Klassengesellschaft.
40
5.2
Die
Erlebnisgesellschaft/Spaßgesellschaft/Freizeitgesellschaft
Die Begriffe Erlebnisgesellschaft, Spaßgesellschaft und Freizeitgesellschaft sind nur
vage voneinander zu differenzieren. Für jedes der Prinzipien gibt es eine Vielzahl
von Definitionen, die sich jedoch alle sehr ähneln. Grob kategorisieren lässt sich eine
zeitliche
Entstehungsgeschichte
der
Begriffe.
So
kam
zuerst
der
Freizeitgesellschafts-, dann der Spaßgesellschafts- und darauf folgend der
Erlebnisgesellschaftsbegriff auf. Der Begriff der Erlebnisgesellschaft wurde geprägt
von SCHULZE der diesen 1992 aufbrachte und somit ein großes Thema in der
37
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S.63.
38
Vgl. KREISEL 2003, S.74f.
39
Vgl. ALTENHÖNER 2004, S.131.
40
Vgl. PREGLAU 2001, S.61.
Der Wandel der Gesellschaft von 1950 bis Heute Unter Bezugnahme auf die allgemeinen
Freizeit- und Tourismustendenzen
30
Freizeit- und Tourismusforschung anstieß.
41
Für die vorliegende Arbeit, wird
hauptsächlich der Begriff Erlebnisgesellschaft verwendet, da er am verständlichsten
in Bezug auf den Kontext der Stadtstrände angesehen wird. Dieser wird aber,
aufgrund seiner großen Verwandtschaft zu den Begriffen der Spaß- und
Freizeitgesellschaft, mit diesen synonym gewertet.
Anfang der 1980er Jahre wandelte sich die industrielle Arbeitsgesellschaft (siehe
Kapitel 5.1) zur postindustriellen Erlebnisgesellschaft. Dies ging Hand in Hand mit
der Veränderung der Volkswirtschaften. Von der vorkriegszeitlichen Agrar-, zur
Industrie-, zur Dienstleistungsgesellschaft. Charakterisierend ist, dass durch den
gestiegenen Lebensstandart die Grundbedürfnisse relativ leicht befriedigt werden
konnten. Aufgrund dessen kam es zur Nachfrage an Leistungen zur
Selbstverwirklichung.
42
Die Ästhetisierung der Lebenswelt setzte ein. Die
Befriedigung von Erlebniswünschen wurde primärer Anlass des Konsums und nicht
hauptsächlich der eigentliche Nutzen der Produkte.
43
Somit wurde eine emotionale
Erlebniswelt geschaffen, in der sich Erlebnisse unabhängig vom Produkt verkaufen
lassen. Erlebniswelten, wie z.B. Freizeit- und Ferienparks (siehe Kapitel 4.1)
entstanden. Bei diesen wird ganz deutlich, dass das Erlebnis im Vordergrund steht
und das eigentliche Produkt in den Hintergrund drängt.
44
Fast jedes Produkt und jedes Angebot wurde mit ,,Erlebnis" vermarktet.
Erlebniseinkauf, Erlebnisferien und Erlebnisgastronomie (siehe Kapitel 4.1.3) sind
nur einige Bespiele für diesen Trend. Bis Ende der 1990er Jahre wurde ,,Erlebnis" zur
Obsession. ,,Schönheit" und ,,Glück" wurden zu zentralen Anliegen der
Erlebnisgesellschaft.
45
Damit
zusammenhängend
änderten
sich
die
gesellschaftlichen Werte, die unter 5.1 beschrieben wurden, von u.a. Pflicht, Familie,
Fleiß und Nutzen hin zum Hedonismus mit den Werten ,,Ich", Lust, Leistung,
41
Vgl. SCHULZE 1992.
42
Vgl. WITTERSHEIM 2004, S.28ff.
43
Vgl. PREGLAU 2001, S.61ff.
44
Vgl. HINTERHUBER; PECHLANER 2001, S.16f.
45
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S.22f.
Der Wandel der Gesellschaft von 1950 bis Heute Unter Bezugnahme auf die allgemeinen
Freizeit- und Tourismustendenzen
31
Materialismus, Eros und Fun.
46
Somit entwickelte sich seit den 1980er Jahren eine
zunehmend egozentrische Einstellung bei Teilen der Gesellschaft. Fun- und
Extremsportarten kamen auf und wurden zum Trend. Die Herausforderung des Ichs
und die Suche nach Befriedigung und dem Sinn des Lebens durch Erlebnis in der
Freizeit boomte. Erlebnis kann in diesem Kontext als ,,bedeutungsvolle Erfahrung, die
als Bereicherung der eigenen Persönlichkeit empfunden wird" (ALTENHÖNER 2004,
S.125) verstanden werden. Die Erlebnisgesellschaft ist geprägt von der Suche nach
,,inneren" Ereignissen. SCHULZE sieht in der Subjekt- und Innenorientierung die
Basis der Erlebnisgesellschaft.
47
Erlebnisse werden zu Waren gemacht. Ab den
1970er Jahren setzt der Boom der Reise- und Tourismusindustrie ein. Zudem kommt
es zur Gründung von zahlreichen großen und kleinen Freizeitparks bzw.
Erlebniswelten in Deutschland.
48
Neben dieser scheinbar freizeitorientierten Aufbruchsstimmung kommen auch starke
Kritiken an der Erlebnisgesellschaft und ihren Auswirkungen zu Tage. Seit den
1990er Jahren drängte der Erlebnisboom auch in die deutschen Städte. Urban
Entertainment Centre, Multiplexkinos und internationale Ketten, wie z.B. Mc Donalds
mischten sich immer mehr unter das Erscheinungsbild. Kritiker sprechen von einer
Gleichförmigkeit und einem Verlust der regionalen und nationalen Identität. Begriffe
wie Disneysfizierung und Mc Donaldisierung verfestigen sich.
49
Abschließend lässt sich zu dem Phänomen der Erlebnisgesellschaft festhalten, dass
es überzogen wäre von der deutschen Bevölkerung als Erlebnisgesellschaft im
Ganzen zu sprechen. Weder jetzt noch vor 10 bis 20 Jahren. Aufgrund der
anhaltenden hohen Arbeitslosenquote, der ,,jobless growth" und ,,working poor"
Erscheinung und dem immer größer werdenden Gefälle an Wohlstand, Sicherheit
und Freiheit, wäre diese allgemeine Plakatierung fehl am Platze. Zu den
Spitzenzeiten der Erlebnisgesellschaft kann höchstens von einer 2/3-
Erlebnisgesellschaft gesprochen werden. Trotz alle dem prägen die Erscheinungen
46
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S.51.
47
Vgl. GÜNTHER 2006, S.55.
48
Vgl. ALTENHÖNER 2004, S.131.
49
Vgl. ROMEIß-STRACKE 2003, S.108f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836627511
- Dateigröße
- 8.6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Trier – Geographie/Geowissenschaften FB VI, Angewandte Humangeographie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- stadtstrände spaßgesellschaft freizeitgesellschaft leistungsgesellschaft stadtgeographie
- Produktsicherheit
- Diplom.de