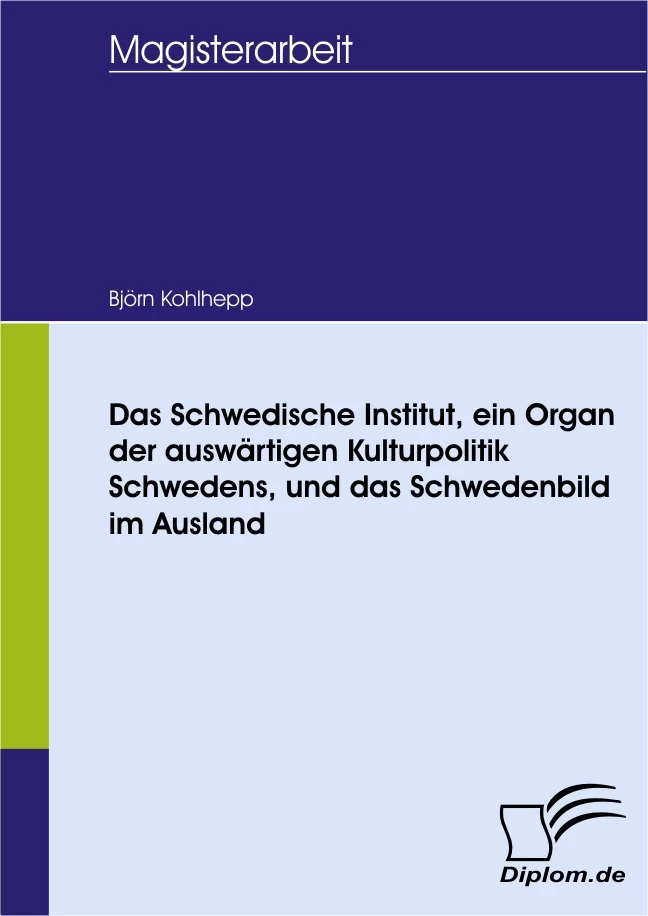Das Schwedische Institut, ein Organ der auswärtigen Kulturpolitik Schwedens, und das Schwedenbild im Ausland
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des Grades eines Magisters Artium soll sich mit dem Schwedischen Institut, dem wichtigsten Organ der schwedischen auswärtigen Kulturpolitik, beschäftigen. Dieses Thema liegt mir nicht zuletzt persönlich nahe, da ich im Rahmen meines Studiums der Nordischen Philologie bereits etliche Male mittelbar oder unmittelbar mit dem Schwedischen Institut in Kontakt gekommen bin, so beispielsweise als es mir ein Stipendium des Institutes im Frühjahr 2007 ermöglichte, ein Semester an einer folkhögskola (Heimvolkshochschule) in Schweden zu verbringen.
Aus einfachen Überlegungen, wie etwa welche Aufgaben genau in der Verantwortung des Schwedischen Institutes liegen, welche Zielsetzung es dabei verfolgt oder seit wann es existiert, sowie Gedanken zum zunächst vorwiegend deutschen Schwedenbild entwickelte sich die Idee zu dieser Arbeit. Die ursprüngliche Vorstellung, dass das Institut schlichtweg das schwedische Pendant des deutschen Goethe-Institutes sei, zeigte sich bei der Vertiefung in die Thematik als so nicht haltbar. Auf diesen Vergleich soll jedoch nur kurz eingegangen werden, im Mittelpunkt soll die Arbeit des Schwedischen Institutes stehen.
Ein Beweggrund für die recht ausführliche Behandlung des historischen Aspektes ist, dass etwas tiefergehende Literatur über das Institut kaum vorhanden ist, geschweige denn in einer anderen Sprache als Schwedisch. Zum anderen ist interessant, wie sich in den letzten Jahren langjährige Gemeinplätze zur Rechtsform des Institutes und zu seiner Zielsetzung mehr oder weniger schlagartig als obsolet erwiesen.
Was soll die Arbeit nun alles leisten? Sie soll die Entstehung des Schwedischen Institutes im Jahre 1945 sowie deren Umstände nachzeichnen. Dabei spielen die Außenbeziehungen Schwedens, in erster Linie zu den Westmächten und zu Deutschland, eine entscheidende Rolle. Sie soll weiter die Entwicklung des Institutes und seine Tätigkeit bis zum heutigen Tage behandeln, um dann speziell auf dessen veränderte Rolle in den letzten zehn Jahren, nach seiner Umwandlung von einer davor relativ unabhängigen Stiftung in eine staatliche Einrichtung, einzugehen. Da das Institut heute mit der Vermarktung Schwedens durch die Förderung eines positiven Schwedenbildes im Ausland befasst ist, soll zum einen die dahingehende Arbeit des Institutes und zum anderen kurz gefasst auch die Entwicklung dieses Bildes dargestellt werden, um so sowohl diese neue Aufgabe als auch das […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
Einleitung
Zielsetzung
Gliederung
Forschungsstand und Quellenlage
Zum Schwedischen Institut
Zu weiteren Themen
1 Auswärtige Kulturpolitik
1.1 Begriffliche Bestimmung
1.1.1 Der Kulturbegriff
1.1.2 Auswärtige Kulturpolitik
1.2 Die Auswärtige Kulturpolitik Schwedens
2 Die Entstehung des Schwedischen Institutes
2.1 Ziele
2.2 Schweden und das Ausland 1914 bis 1945
2.2.1 Der Erste Weltkrieg
2.2.2 Die Zwischenkriegszeit
2.2.3 Der Zweite Weltkrieg
2.2.4 Fazit
2.3 Von der Idee bis zur Gründung
2.4 Aufgabe
2.5 Schwedens auswärtige Kulturpolitik vor 1945
3 Das Schwedische Institut von 1945 bis heute
3.1 Organisation
3.1.1 Rechtsform, Zielsetzung und Finanzierung
3.1.2 Organisationsform
3.1.3 Standort
3.1.4 Personal
3.1.5 Finanzen
3.1.6 Geographische Schwerpunkte
3.2 Nachkriegshilfe
3.3 Allgemeine Auslandsinformation
3.3.1 Koordination und Zusammenarbeit
3.3.2 Publikationen
3.3.3 Filme
3.3.4 Ausstellungen
3.3.5 Dokumentationszentrum und Buchhandlung
3.3.6 Botschaftsservice
3.4 Kultur- und Erfahrungsaustausch
3.4.1 Gastdozentenaustausch
3.4.2 Studienbesuche
3.4.3 Stipendienaustausch
3.4.4 Kontaktvermittlung
3.4.5 Präsentation künstlerischer Tätigkeit
3.4.6 Kulturaustauschprogramme mit Osteuropa
3.4.7 Kurstätigkeit
3.4.8 Information über Studienmöglichkeiten in Schweden
3.5 Entwicklungszusammenarbeit und Sonderaufträge
3.5.1 Die Anfänge der Entwicklungszusammenarbeit
3.5.2 Stipendienprogramme
3.5.3 Expertenaustausch mit Entwicklungs- und Schwellenländern
3.5.4 Schwerpunktregion Mittel- und Osteuropa
3.5.5 Neue Programme
3.6 Schwedischunterricht im Ausland
3.6.1 Auslandslektorate
3.6.2 Gastdozenten- und Schriftstellerbesuche
3.6.3 Sommersprachkurse
3.6.4 Stipendien für Heimvolkshochschulen
3.7 Auslandsbüros
3.8 Skandinavische Zusammenarbeit
3.8.1 Auslandsinformation
3.8.2 Auslandslektorate
3.9 Fazit
4 Die Vermarktung Schwedens
4.1 Der Aufbau einer Ländermarke
4.1.1 Marketing
4.1.2 Der Markenbegriff
4.2 Die Bedeutung von Ländermarketing
4.3 Das Konzept der wettbewerbsfähigen Identität
4.4 Die Marke Schweden – das Schwedenbild
4.4.1 1936–1968
4.4.2 1968–1989
4.4.3 1990–1999
4.4.4 Nach 2000
4.4.5 Das aktuelle Schwedenbild
4.4.6 Exkurs: Das Schwedenbild der Deutschen
4.5 Die Rolle des Schwedischen Institutes
4.6 Das Schwedische Institut und das Schwedenbild
4.6.1 Analyse
4.6.2 Förderung
4.7 Fazit
5 Das Schwedische Institut im europäischen Vergleich
5.1 Deutschland
5.1.1 Auswärtige Kulturpolitik allgemein
5.1.2 Das Goethe-Institut
5.2 Großbritannien
5.2.1 Auswärtige Kulturpolitik allgemein
5.2.2 Der British Council
5.3 Frankreich
5.3.1 Auswärtige Kulturpolitik allgemein
5.3.2 Kulturinstitute
5.4 Dänemark
5.4.1 Auswärtige Kulturpolitik allgemein
5.4.2 Das Dänische Kulturinstitut
5.5 Österreich
5.5.1 Auswärtige Kulturpolitik allgemein
5.5.2 Kulturforen
5.6 Fazit
6 Resümee
Literaturverzeichnis
Wahrheitsgemäße Erklärung
Einleitung
Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit zur Erlangung des Grades eines Magisters Artium soll sich mit dem Schwedischen Institut, dem wichtigsten Organ der schwedischen auswärtigen Kulturpolitik, beschäftigen. Dieses Thema liegt mir nicht zuletzt persönlich nahe, da ich im Rahmen meines Studiums der Nordischen Philologie bereits etliche Male mittelbar oder unmittelbar mit dem Schwedischen Institut in Kontakt gekommen bin, so beispielsweise als es mir ein Stipendium des Institutes im Frühjahr 2007 ermöglichte, ein Semester an einer folkhögskola (Heimvolkshochschule) in Schweden zu verbringen.
Aus einfachen Überlegungen, wie etwa welche Aufgaben genau in der Verantwortung des Schwedischen Institutes liegen, welche Zielsetzung es dabei verfolgt oder seit wann es existiert, sowie Gedanken zum – zunächst vorwiegend deutschen – Schwedenbild entwickelte sich die Idee zu dieser Arbeit. Die ursprüngliche Vorstellung, dass das Institut schlichtweg das schwedische Pendant des deutschen Goethe-Institutes sei, zeigte sich bei der Vertiefung in die Thematik als so nicht haltbar. Auf diesen Vergleich soll jedoch nur kurz eingegangen werden, im Mittelpunkt soll die Arbeit des Schwedischen Institutes stehen.
Ein Beweggrund für die recht ausführliche Behandlung des historischen Aspektes ist, dass etwas tiefergehende Literatur über das Institut kaum vorhanden ist, geschweige denn in einer anderen Sprache als Schwedisch. Zum anderen ist interessant, wie sich in den letzten Jahren langjährige Gemeinplätze zur Rechtsform des Institutes und zu seiner Zielsetzung mehr oder weniger schlagartig als obsolet erwiesen.
Was soll die Arbeit nun alles leisten? Sie soll die Entstehung des Schwedischen Institutes im Jahre 1945 sowie deren Umstände nachzeichnen. Dabei spielen die Außenbeziehungen Schwedens, in erster Linie zu den Westmächten und zu Deutschland, eine entscheidende Rolle. Sie soll weiter die Entwicklung des Institutes und seine Tätigkeit bis zum heutigen Tage behandeln, um dann speziell auf dessen veränderte Rolle in den letzten zehn Jahren, nach seiner Umwandlung von einer davor relativ unabhängigen Stiftung in eine staatliche Einrichtung, einzugehen. Da das Institut heute mit der Vermarktung Schwedens durch die Förderung eines positiven Schwedenbildes im Ausland befasst ist, soll zum einen die dahingehende Arbeit des Institutes und zum anderen kurz gefasst auch die Entwicklung dieses Bildes dargestellt werden, um so sowohl diese neue Aufgabe als auch das gewünschte Bild erklärbar zu machen. Schließlich sollen kurz die Kulturinstitute anderer Länder und deren auswärtige Kulturpolitik allgemein vorgestellt werden, damit letztlich die Rolle des Institutes besser verständlich wird.
Gliederung
Zunächst wird auf die Begrifflichkeit „auswärtige Kulturpolitik“ eingegangen und der für die Tätigkeit des Schwedischen Institutes bzw. für auswärtige Kulturpolitik allgemein maßgebliche Kulturbegriff herausgearbeitet.
Im zweiten Kapitel wendet sich die Arbeit der Entstehungsgeschichte des Institutes zu und beleuchtet den historischen Kontext, d. h. die entscheidenden schwedischen Außenbeziehungen vom Beginn des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Kapitel drei hat sodann in groben Zügen, aber mit dem Anspruch, die wichtigsten Aspekte abzudecken, die Geschichte des Schwedischen Institutes von seiner Gründung bis zum heutigen Tage zum Thema. Das Kapitel gliedert sich – abgesehen von organisatorischen Entwicklungen – in der Hauptsache nach den verschiedenen Tätigkeitsbereichen.
Danach soll die Vermarktung Schwedens und das Wirken des Schwedischen Institutes für ein angestrebtes Schwedenbild im Ausland untersucht werden. Zu Beginn des Kapitels soll auf die allgemeine Bedeutung einer solchen Vermarktung sowie in dessen weiteren Verlauf eben auf die Entwicklung des Schwedenbildes und dessen Einflussfaktoren eingegangen werden.
Das nächste Kapitel soll dann den Vergleich zu ausgewählten europäischen Ländern – zu Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Österreich – bzw. deren Kulturinstitute ziehen.
Abschließend sollen in einem kurzen Resümee die in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst werden.
Forschungsstand und Quellenlage
Zum Schwedischen Institut
Der Forschungsstand zum Thema Schwedisches Institut ist als recht dürftig zu bezeichnen. Es existieren lediglich zwei Werke, die sich in der Hauptsache mit dem Institut befassen.
Das lange Jahre einzige war eine von Gunnar Helén geleitete, 1967 vollendete staatliche Untersuchung,[1] die aber nur sehr grob Entstehung und Geschichte des Institutes nachzeichnet und ansonsten das Zusammenspiel mit anderen schwedischen Informationsorganen zum Gegenstand hat.
Das zweite ist die zum 50-jährigen Jubiläum des Institutes erschienene Schrift Upplysningsvis. Svenska institutet 1945–1995 von Per-Axel Hildeman, einem ehemaligen Direktor des Institutes. Dieses ist zwar nicht sonderlich umfangreich, behandelt aber dankenswerterweise doch ziemlich ausführlich die Entstehungsgeschichte des Institutes und gibt einen breiten Einblick in dessen Entwicklung bis 1995. Das Werk erhebt jedoch nicht den Anspruch, die Geschichte des Institutes zu schreiben, wie es im Vorwort heißt, und geht in lockerem Ton vor allem auf interessante Begebenheiten und Umstände ein.
Darüber hinaus wird es hinsichtlich Literatur zum Institut sehr knapp. In der Anfangszeit des Institutes wurden von zwei weiteren ehemaligen Direktoren des Institutes – Tore Tallroth[2] und Gunnar Heckscher[3] – zwei kurze Aufsätze über dessen Tätigkeit verfasst, die mir vorlagen. Als Literaturgrundlage dienten daneben weitere vom schwedischen Staat in Auftrag gegebene Untersuchungen, die meist die Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Organen der auswärtigen Kulturpolitik Schwedens beleuchteten und dabei natürlicherweise auch auf die Geschichte, aber vor allem auf die jeweils aktuelle Tätigkeit des Institutes eingingen. Zu nennen wären in erster Linie die Studien von Arvidsson / Ahlander 1978[4], von Löfdahl / Jonsson 1988[5] und von Faxén 1993[6].
Dieser mäßige Forschungsstand machte eine eingehende Beschäftigung mit den zur Verfügung stehenden Quellen notwendig. Dies sind zum einen und vorwiegend die Jahresberichte des Schwedischen Institutes, wobei die älteren in ihrer Gesamtheit nur im schwedischen Reichsarchiv (Riksarkivet) in Stockholm zugänglich sind. Eine weitere Quelle stellen die sogenannten Weisungsbriefe (regleringsbrev) dar, die das Institut einmal jährlich vom Außenministerium erhält, und worin – zumindest was die Briefe in jüngerer Zeit anbelangt – Ziele, Tätigkeitsfelder und Pflichten sowie das jeweilige Budget des Institutes festgelegt sind. Für neuere Aspekte dienten etwa der Internetauftritt und diverse Veröffentlichungen des Institutes sowie persönliche Auskünfte als weitere Quellen.
Zu weiteren Themen
Das Thema Schwedenbild im Ausland ist insgesamt als sehr gut erforscht zu bezeichnen. Die bislang größte Studie hierzu aus dem Jahre 2005[7] diente als Hauptquelle für diesbezügliche Ausführungen. Ein Schwachpunkt dieser Studie ist jedoch, dass Ausführungen zum Schwedenbild in der Vergangenheit hauptsächlich auf Auswertungen von ausländischen Medien über deren Schwedenberichterstattung, die zwar sicherlich zur Bildung oder Bestätigung eines Schwedenbildes beitrug, die aber wohl kaum das gesamte komplexe Bild widerspiegelt, fußen.
Bei Arbeiten zum deutschen Schwedenbild, das hier nur kurz angerissen und hauptsächlich historisch behandelt wird, kommt man um Veröffentlichungen von Bernd Henningsen nicht herum. Diese beziehen sich jedoch häufig auf Skandinavien als Gesamtheit.
Die auswärtige Kulturpolitik anderer Länder findet sich relativ gut dokumentiert, mit Überblickinformationen und Links, auf der Internetseite des Institutes für Auslandsbeziehungen, www.ifa.de. Als hilfreich für dieses Thema erwies sich auch das Werk Nationalkultur oder europäische Werte? Britische, deutsche und französische Auswärtige Kulturpolitik zwischen 1989 und 2003 von Julia Sattler, in dem die Autorin eben die auswärtige Kulturpolitik Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens in diesem Zeitraum gegenüberstellt.
1 Auswärtige Kulturpolitik
1.1 Begriffliche Bestimmung
1.1.1 Der Kulturbegriff
Es stellt sich zu Beginn die Frage, was Kultur eigentlich ist oder vielmehr was im Rahmen dieser Arbeit und im Hinblick auf auswärtige Kulturpolitik darunter zu verstehen ist. Busche stellt fest, dass „[d]er Begriff Kultur […] für seine Unklarheit berüchtigt“ ist.[8] Wo Unklarheit herrscht, gibt es selbstredend viele Auslegungen eines Begriffes. So unternehmen beispielsweise Kroeber / Kluckhohn eine Analyse von 164 von 1870 bis 1950 verwendeten Kulturbegriffen und versuchen sich schließlich an einer allen Definitionen gerecht werdenden eigenen Begriffsbestimmung:
Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievement of human groups, including their embodiments in artifacts; the essential core of culture consists of traditional (i. e., historically derived and selected) ideas and especially their attached values; culture systems may, on the one hand, be considered as products of action, on the other as conditioning elements of further action.[9]
Das Ergebnis dieses Versuches musste selbstverständlich ein sehr weit gefasstes Verständnis von Kultur sein. Ein derart umfangreiches – und für die Belange dieser Arbeit maßgebliches – Verständnis findet sich auch in der 1982 formulierten und mehrmals bestätigten eingängigen Begriffsbestimmung der UNESCO:
Kultur [sollte] als Gesamtheit der unverwechselbaren geistigen, materiellen, intellektuellen und emotionalen Eigenschaften angesehen werden [...], die eine Gesellschaft oder eine soziale Gruppe kennzeichnen, und [...] sie [umfasst] über Kunst und Literatur hinaus auch Lebensformen, Formen des Zusammenlebens, Wertesysteme, Traditionen und Überzeugungen [...].[10]
Nilsson spricht in Bezug auf ein solches Kulturverständnis von Kultur als „Aspekt“ – im Gegensatz zu Kultur als „Sektor“, als welcher der Begriff lediglich die künstlerischen Ausdrucksformen und die Institutionen, Organisationen und Personen, die sich dadurch ausdrücken, umfasse.[11]
In der Literatur zu auswärtiger Kulturpolitik oder zu Kulturinstituten wird der Kulturbegriff oftmals nur auf „Werke, Manifestationen, Hervorbringungen geistiger, musischer, künstlerischer Natur“,[12] beschränkt, was jedoch weder auswärtiger Kulturpolitik insgesamt noch der Tätigkeit der mit ihr befassten Institutionen gerecht wird, wobei es freilich auch solche Organe auswärtiger Kulturpolitik gibt, deren Arbeit sich auf Kultur in diesem Verständnis beschränkt. Wie sich bei einem Blick auf die Internetseite oder in einen Jahresbericht beispielsweise eben des Schwedischen Institutes zeigt, umfasst dessen Kulturverständnis sowohl – oder vor allem – Kultur als Aspekt mit allen seinen Sphären als auch Kultur als Sektor.
Während Kulturpolitik innerhalb der Grenzen eines Landes oft – um bei obiger Unterscheidung zu bleiben – Kultur als Sektor meint,[13] ist auswärtige Kulturpolitik eben mit Kultur als Aspekt befasst. Es kommt also hier ein „erweiterter“ oder „umfassender“ Kulturbegriff zum Tragen.[14]
1.1.2 Auswärtige Kulturpolitik
Der Begriff „auswärtige Kulturpolitik“ wurde vermutlich zum ersten Mal im Jahre 1912 vom Historiker Karl Lamprecht verwendet.[15] Was darunter zu verstehen ist, dazu schreibt Arnold:
Mit dem Begriff auswärtige Kulturpolitik ist die Einbeziehung der internationalen Kulturbeziehungen in die Außenpolitik bzw. eine international ausgerichtete Kulturpolitik im Interesse der Außenbeziehungen eines Staates gemeint. In der außenpolitischen Praxis verwirklicht sich eine solche Politik in erster Linie in der Förderung internationaler Kulturbeziehungen durch den Staat.[16]
Auswärtige Kulturpolitik ist also ein Teil der Außenpolitik, wenn ihr auch international und über die Zeit unterschiedliche Bedeutung beigemessen wurde und wird.
Denn „kulturelle Kontakte und Wechselwirkungen zwischen Völkern [haben zwar] schon immer bestanden“, eine „bewußte Einbeziehung von kulturellen Beziehungen in die Außenpolitik der Staaten“ aber begann erst im 19. Jahrhundert. Damals wurden diese in erster Linie „als Mittel zur Unterstützung nationaler Interesse [sic!] im Zeichen des Kolonialismus und Imperialismus eingesetzt.“[17]
So verwundert es nicht, dass es bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges fast ausschließlich „die größeren Staaten Europas [waren], die aus außenpolitischen Motiven internationale Kulturbeziehungen förderten.“ Auswärtige Kulturpolitik lief damals vor allen Dingen auf „Kulturwerbung bzw. -propaganda“ hinaus, die der Überzeugung von der Überlegenheit der eigenen Kultur entsprang, und wurde als „Hilfsmittel für die Durchsetzung der jeweiligen Außenpolitik“ betrachtet.[18]
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bestand seitens der großen Machtblöcke die Notwendigkeit, um Verständnis für ihre Politik zu werben sowie ihre militärischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Interessengebiete zu stärken oder auszuweiten. Zugleich wuchs aber auch die Einsicht, dass Einvernehmen und Zusammenarbeit zwischen Ländern wichtig zur Erhaltung des Friedens sind. Länder spürten, dass sie nicht nur von den Regierungen, sondern auch von der öffentlichen Meinung in anderen Ländern abhängig sind. Personenaustausch, Informationsschriften, Kulturkontakte und Zusammenarbeit bei Wissenschaft und Forschung waren einige der Wege zur Festigung der Beziehungen zwischen den Völkern. Jetzt hielten es auch kleinere Länder besondere Anstrengungen für geboten, um am allgemeinen Erfahrungsaustausch teilzunehmen und um Aufmerksamkeit und Verständnis für ihre besonderen Probleme und Interessen zu gewinnen.[19]
Willy Brandt, zu jener Zeit Außenminister, nannte 1967 die auswärtige Kulturpolitik die „dritte Säule“ der Außenpolitik, was ihre hohe Bedeutung unterstreichen sollte. Die anderen Säulen wären dabei wohl zum einen die klassische Diplomatie und zum anderen die Außenhandelspolitik eines Landes.[20] Kathe konstatiert allerdings, dass sie im Falle Deutschlands zwar rein quantitativ – mit etwa einem Drittel des Budgets und nahezu einem Drittel der Stellen – mit den beiden anderen Teilen der Außenpolitik stets auf einer Stufe stand, dass sie indes in der außenpolitischen Realität eine deutlich untergeordnete Rolle spielte.[21] Dass dies in anderen Ländern durchaus anders ist, zeigen etwa die Beispiele Frankreich oder England, wo kulturelle Außenbeziehungen traditionell als „ein integrales und politisch wichtiges Element“ der Außenpolitik betrachtet werden.[22]
Arnold bezeichnet auswärtige Kulturpolitik als „Interessenpolitik“ und sieht es als deren legitimes Bestreben, „die eigene Kultur im Interesse des eigenen Staates international wirksam werden zu lassen.“[23] Als übergeordnetes Ziel einer auswärtigen Kulturpolitik sieht er deren Beitrag zur Völkerverständigung und damit zum friedlichen Zusammenleben der Völker durch kulturelle Mittel. Sie solle den Boden für die Außenpolitik bereiten und festigen.[24] Daher müsse sich auswärtige Kulturpolitik „an den Prioritäten orientieren, wie sie sich aus den eigenen kulturellen Möglichkeiten und aus den Notwendigkeiten des eigenen Landes […] ergeben.“[25]
Welche Formen auswärtige Kulturpolitik annehmen kann, soll folgende Tabelle nach Kathe veranschaulichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Formen der auswärtigen Kulturpolitik [26]
Für das Beispiel Deutschland steht in der vom Auswärtigen Amt abgefassten Konzeption 2000 zu lesen, welche Bereiche auswärtige Kulturpolitik umfassen kann:
[…] die Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft, der internationale Kulturdialog, der Kunst-, Kultur- und Personenaustausch, die Nutzung und Entwicklung der Medien in der internationalen Zusammenarbeit, die Erhaltung und Stärkung der deutschen Sprache als Schlüssel zur deutschen Kultur sowie das Auslandsschulwesen.[27]
Oftmals wird zwischen auswärtiger Kultur- und auswärtiger Bildungspolitik unterschieden, im Rahmen dieser Arbeit soll auswärtige Kulturpolitik aber beide Bereiche abdecken.
Trommer weist darauf hin, dass auswärtige Kulturpolitik „eindeutig eine staatliche Aufgabe ist“, sagt aber zugleich, dass daraus nicht die Folgerung abgeleitet werden könne, dass der Staat diese „in eigener Regie“ betreiben müsse.[28] Hier kommen die sogenannten Mittlerorganisationen ins Spiel.
Darunter sind besondere Organisationen zu verstehen, „welche als Mittler zwischen Inland und Ausland die eigentliche Auslandskulturarbeit“ übernehmen[29] bzw. „staatliche Aufgaben im Bereich der auswärtigen Kulturpolitik wahrnehmen“[30]. Beispiele wären etwa der 1934 gegründete British Council im Falle Großbritanniens[31] oder das Goethe-Institut als die größte und wichtigste Mittlerorganisation in der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands[32].
Solche Mittlerorganisationen sind „Instrumente für eine aus politischen Gründen für notwendig gehaltene auswärtige Kulturpolitik“ und, da ihre Tätigkeit im Interesse des Staates liegt, ja sogar Aufgabe des Staates ist, in der Regel gänzlich oder fast gänzlich staatlich aus Steuergeldern finanziert.[33]
Das Schwedische Institut war jedenfalls bis 1998 eine solche Mittlerorganisation. Nachdem es bereits ab 1970 zur Gänze staatlich finanziert worden war, wurde es vor zehn Jahren in eine dem schwedischen Außenministerium unterstellte staatliche Behörde umgewandelt.[34] Damit stellt sich die Frage, ob man das Institut heute überhaupt noch als Mittlerorganisation bezeichnen kann, wo es doch mittlerweile ein Teil des Außenministeriums und infolgedessen im engeren Sinne kein Mittler mehr ist. Wahrscheinlich wäre diese Bezeichnung für das Schwedische Institut heute nicht mehr korrekt. Diese Definitionsproblematik soll jedoch für die vorliegende Arbeit im Weiteren keine Rolle spielen.
1.2 Die Auswärtige Kulturpolitik Schwedens
Für die auswärtige Kulturpolitik Schwedens sind vor allen Dingen das Außenministerium sowie das Kultusministerium und das Bildungsministerium zuständig. Mittel kommen aber mitunter auch von anderen Ministerien.[35] Für die Durchführung der staatlich unterstützten auswärtigen Kulturarbeit zeichnen neben dem Schwedischen Institut staatliche Organisationen wie der Schwedische Kulturrat (Statens kulturråd), das Zentralamt für Denkmalpflege (Riksantikvarieämbetet), das Reichsarchiv und die Künstlerkommission (Konstnärsnämnden) verantwortlich. Daneben gibt es staatliche geförderte kulturelle Institutionen, wie etwa das Schwedische Filminstitut (Svenska filminstitutet) oder das Schwedische Konzertinstitut (Svenska Rikskonserter), die international kulturell tätig sind. Seit Mitte der 1980-er spielt darüber hinaus auch beim Schwedischen Amt für Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Sida (Swedish International Development Cooperation Agency), Kultur eine verstärkte Rolle.[36]
1979 beschloss der schwedische Reichstag Richtlinien für die auswärtige Kulturpolitik, genauer gesagt für den staatlich unterstützten allgemeinen Informations- und Kulturaustausch mit dem Ausland. Dabei wurden auch drei Motive hierfür genannt: das außenpolitische Interesse, dass schwedische Standpunkte im Ausland Gehör finden, die entscheidende Bedeutung internationaler Kontakte für die Entwicklung der schwedischen Gesellschaft und die Bedeutung des Informations- und Kulturaustausches für den schwedischen Außenhandel und Tourismus.[37] Die diesem Beschluss vorausgegangene staatliche Untersuchung aus dem Jahre 1978 sah die Abhängigkeit vom Ausland bei der Sicherheit des Landes, die wirtschaftliche Abhängigkeit und die sprachliche Isolation Schwedens als Gründe dafür, dass der Bedarf einer staatlichen Unterstützung des Informations- und Kulturaustausches mit dem Ausland in Schweden besonders hoch sei.[38]
Für die schwedische Kultur als Sektor wurde außerdem bereits 1974 in den Zielen für eine staatliche Kulturpolitik als ein Ziel die Förderung des Austausches von Erfahrungen und Ideen im Kulturbereich über sprachliche und nationale Grenzen hinweg festgelegt[39] und in den neuen Zielen von 1996 bestätigt[40].
Die heutige auswärtige Kulturpolitik Schwedens ist – legt man obige Tabelle zugrunde – irgendwo zwischen Austausch und Zusammenarbeit, Information, Selbstdarstellung und Kulturexport anzusiedeln. Diese Beurteilung fußt in erster Linie auf der Tätigkeit des Schwedischen Institutes, die in den Kapiteln 3 und 4 behandelt werden soll.
2 Die Entstehung des Schwedischen Institutes
Zu Beginn sollen die Umstände und Hintergründe, die zur Entstehung des Schwedischen Institutes im Jahre 1945 führten, untersucht werden. Als Ausgangspunkt sollen dabei die Ziele des zu gründenden Institutes dienen.
2.1 Ziele
Am 4. Februar 1944 wurde im schwedischen Außenministerium ein großer Empfang abgehalten, der die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, dem Organisationskomitee für die Aufklärungsarbeit im Ausland (Organisatonskommittén för upplysningsverksamhet i utlandet), zum Zweck hatte. Hierbei sprach einer der geistigen Väter des Schwedischen Institutes, der damalige Staatssekretär im schwedischen Außenministerium, Erik Boheman, der Zeitung Dagens Nyheter zufolge folgende Worte über die Ziele des künftigen Institutes, zu dem jenes Organisationskomitee Vorschläge erarbeiten sollte:
Ein Land in neutraler Position kann weder auf der einen noch auf der anderen Seite sonderlich beliebt sein. Deswegen gilt es, dafür zu sorgen, dass die Stimme unseres Geistes draußen in der Welt Gehör findet, dass wir eine schwedische Exportvereinigung auf geistigem und kulturellem Gebiet gründen, eine Organisation, die in gewissem Umfang auch für den Import auf diesem Gebiet bestimmt sein sollte.[41],[42]
In Schweden war man nun also offenbar besorgt um den Ruf des Landes im Ausland. Was zu einer solchen Sorge hätte Anlass geben können, dies soll ein kurzer historischer Exkurs zu den schwedischen Beziehungen zum Ausland, besonders zu den Westmächten und Deutschland, vom Beginn des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges beleuchten.
2.2 Schweden und das Ausland 1914 bis 1945
2.2.1 Der Erste Weltkrieg
Skandinavien wurde – trotz aller Anzeichen für einen militärischen Konflikt zwischen den europäischen Großmächten – vom Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht. Dänemark, Norwegen und Schweden waren sich einig darin, die schon zuvor praktizierte Politik der Neutralität auch in diesem Krieg fortzuführen.[43]
Die Sympathien unter den nordischen Ländern waren indes ungleich auf die Kriegsparteien verteilt. Während Norwegen zu England neigte, lagen die Sympathien Schwedens auf Seiten Deutschlands.[44] Weibull zufolge waren die schwedischen Sympathien für Deutschland „deutlich“,[45] was nicht sonderlich überrascht, war doch der kulturelle Einfluss Deutschlands auf Schweden zu jener Zeit enorm.[46] Und auch wirtschaftlich waren die Beziehungen sehr eng.[47]
Folge der deutschlandfreundlichen Politik und des Handels mit Deutschland war etwa, dass Alliierte die Kontrolle über den schwedischen Überseehandel verschärften und ihn schließlich ganz zum Erliegen brachten.[48] Nach dem Kriegseintritt der USA 1917 erhöhte sich der innere und äußere Druck auf Schweden wegen seiner Deutschlandpolitik immer mehr.[49]
Aufgrund der schwierigen Versorgungslage musste daraufhin im Frühjahr 1917 die schwedische Regierung zurücktreten. Eine neue Regierung verhandelte mit den Westmächten und es gelang ihr, das Land wieder für Importe aus dem Westen zu öffnen.[50]
Wie freundlich das Verhältnis Schwedens zu Deutschland war, zeigen Entdeckungen des amerikanischen Geheimdienstes, die die Regierung in Washington im September 1917 bekannt gab: „Deutsche Diplomaten durften in Buenos Aires die diplomatischen Kanäle der schwedischen Botschaft nutzen, um Erkenntnisse über den alliierten Schiffsverkehr zu übermitteln“.[51]
Diese bis zum Frühjahr 1918[52] ausgeübte deutschlandfreundliche Neutralität schmälerte sicherlich das Ansehen Schwedens bei den Alliierten bzw. der Entente.
2.2.2 Die Zwischenkriegszeit
Die sich bildenden faschistischen Bewegungen in Süd- und Mitteleuropa stießen in ganz Skandinavien auf Ablehnung.[53]
Ab 1920 beteiligte sich Schweden aktiv im Völkerbund,[54] dem es aber nur unter einem Neutralitätsvorbehalt beigetreten war.[55]
Da sowohl Russland als auch Deutschland zu den Verlierern des Ersten Weltkrieges zählten und stark geschwächt waren, wurde Schweden nach dem Ersten Weltkrieg zur vorherrschenden Ostseemacht. Aus diesem Grund wurde 1925 eine neue Verteidigungsordnung verabschiedet. Diese führte zu einer „Verringerung der Übungszeit der Wehrpflichtigen und [zur] Auflösung vieler Regimenter“.[56]
Nach der Demonstration der Machtlosigkeit des Völkerbundes im Abessinienkrieg und Hitlers Bruch des Versailler Vertrags durch Remilitarisierung des Rheinlandes im März 1936 erklärte Schweden im Juli selbigen Jahres, dass es sich nicht länger an die Bestimmungen des Völkerbunds über gemeinschaftliche Sanktionen gebunden fühle, womit es zu einer neutralen Außenpolitik zurückkehrte.[57]
Außerdem verstärkte Schweden nach jahrelangen Debatten über die Landesverteidigung im Jahre 1936 aufgrund der neuen politischen Situation in Europa seine Militärmacht wieder.[58] Diese Aufrüstung war jedoch, verglichen mit derjenigen Deutschlands und der der Sowjetunion, gering.[59]
Ideen einer gemeinsamen nordischen Verteidigungsgemeinschaft konnten sich ebenso wenig durchsetzen wie die norwegische Initiative zur sogenannten Oslo-Kovention, die einen wirtschaftlichen Zusammenschluss kleinerer Staaten Nord- und Mitteleuropas vorsah – Letzteres konnte Großbritannien durch eine sofortige „Drohgebärde“ erfolgreich abwenden.[60]
Hitlers an alle nordischen Staaten erfolgter Vorschlag eines Nichtangriffspaktes wurde von Schweden abgelehnt. Dänemark stimmte zwar zu, dies nützte aber bekanntlich nichts.[61]
In Schweden kam es in der Zwischenkriegszeit zu einem enormen wirtschaftlichen Wachstum.[62] Deutschland war dabei neben England der wichtigste Handelspartner. So kam 1938 knapp 25% des deutschen Eisenerzes aus Schweden.[63] Im Bereich Kultur und Wissenschaft hingegen nahm der Einfluss Deutschlands zugunsten Englands ab.[64] Die Schweden hegten im Allgemeinen eine starke Abneigung „gegen den deutschen Nationalsozialismus mit seiner unüberhörbaren Aggressivität“.[65] Allerdings weist Gustafsson darauf hin, dass das schwedische Bürgertum durchaus gewisse Sympathien für Nazideutschland gezeigt habe.[66]
2.2.3 Der Zweite Weltkrieg
Der Grund, weshalb man in Schweden aber konkret besorgt um seinen Ruf war, war Schwedens Verhalten während des Zweiten Weltkrieges. Da das nicht aktiv am Krieg beteiligte Schweden ständig ein Hineingezogenwerden in Form beispielsweise einer deutschen Invasion befürchtete,[67] war die Zeit geprägt von einem Lavieren der schwedischen Regierung, das sich zwischen nachgiebiger und ablehnender Haltung hauptsächlich gegenüber deutschen Forderungen bewegte.
So forderte Deutschland noch am Tage des Angriffes auf Polen von allen nordischen Ländern uneingeschränkte Neutralität, die diese auch umgehend erklärten.[68]
Schweden gelang es durch Verhandlungen mit den beiden großen Kriegsmächten Großbritannien und Deutschland, die schwedischen Im- und Exporte auf dem Niveau des Jahres 1938 festzuschreiben.[69] Dies war auch für Deutschland äußerst wichtig, da Eisenerzlieferungen aus Schweden entscheidend für die deutsche Kriegsindustrie waren.[70]
Im sogenannten „Winterkrieg“ zwischen der Sowjetunion und Finnland vom Herbst 1939 bis März 1940 erklärte sich Schweden allerdings nicht als neutral, sondern lediglich als „nicht kriegsführend“ – völkerrechtlich ein wichtiger Unterschied.[71] Schweden stand Finnland zwar nicht direkt bei, unterstützte es aber umfangreich und vermittelte beim Friedensschluss.[72] Bitten der Engländer und Franzosen, die ihre Truppen durch das Eisenerzrevier Norrbottens nach Finnland marschieren lassen wollten, schlug Schweden ab. Diese Haltung wurde in der britischen und französischen Presse scharf verurteilt.[73] Schweden hatte dabei aber neben Sorgen um seine Neutralität und der Angst vor Deutschland – wohl nicht ganz zu Unrecht – die Befürchtung, dass die Westmächte sich der Erzgruben im Norden des Landes bemächtigen wollten.[74]
In erster Linie in der Zeit vom April 1940, als Deutschland in Dänemark und Norwegen einfiel, bis zum Frühjahr 1943, als deutsche und verbündete Truppen an der Wolga unterlagen, war Schweden zu zum Teil großen Zugeständnissen an Hitler gezwungen.[75] Diese reichten von wirtschaftlichen, über logistische und politische bis hin zu militärischen.[76] Für besonders heftige Debatten und Unmut unter der schwedischen Bevölkerung sorgten deutsche Transite von zum Teil auch Kriegsmaterial und Kampftruppen durch Schweden.[77]
Weil Schweden unter allen Umständen seine Souveränität wahren und vermeiden wollte Hitler zu provozieren, wurde nicht nur Norwegens Bitte um Truppenhilfe und Kriegsmaterial abgelehnt, sondern sogar die schwedische Presse zensiert.[78] Mit der deutschen Besetzung Dänemarks und Norwegens geriet Schweden in eine noch größere wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland.[79]
Als sich im Frühjahr 1943 schließlich die Anzeichen für eine deutsche Niederlage mehrten, kam es zu stärkerem Widerstand gegen die deutschen Transitforderungen und im August selbigen Jahres zu einem Stopp.[80] Die Zugeständnisse wurden allmählich abgebaut und auf dringende alliierte Forderungen hin wurde ab 1943 auch der Export nach Deutschland in zunehmendem Maße eingeschränkt.[81] In der Endphase des Krieges zeigte sich Schweden den Alliierten gegenüber im Großen und Ganzen in jedem Wunsch entgegenkommend und war gewissermaßen als ein Nicht-Kriegführender auf der Seite der Westmächte zu betrachten.[82]
Auf humanitärem Gebiet leistete das neutrale Schweden im Zweiten Weltkrieg wichtige Arbeit. So kam es mehrfach zu einem über Göteborg abgewickelten Austausch von Kriegsgefangenen, zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Baltikum und den anderen skandinavischen Ländern sowie zur Rettung von etwa 7.500 dänischen Juden im September 1943.[83] Außerdem konnten im Februar 1945 nach Verhandlungen Graf Folke Bernadottes, dem Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes[84], mit Himmler etwa 19.000 Menschen, darunter auch Franzosen und Juden, aus deutschen Konzentrationslagern gerettet werden.[85]
Daneben bildete Schweden ab dem Frühjahr 1943 Flüchtlinge aus Dänemark und Norwegen polizeilich oder militärisch aus und unterstützte Dänemark militärisch.[86] Schweden vermittelte im September 1944 auch den neuerlichen Frieden Finnlands mit der Sowjetunion.[87]
2.2.4 Fazit
Hatte Schweden im Ersten Weltkrieg noch deutliche Sympathien für Deutschland, so nahmen diese spätestens seit der Machtergreifung Hitlers deutlich ab und gingen auf die Westmächte über.
Seine streng neutrale Haltung hat Schweden im Zweiten Weltkrieg zunächst auf Druck und zugunsten Deutschlands verlassen, später dann zugunsten der Alliierten. Auf diese Weise gelang es Schweden, seine Souveränität zu wahren und ein Hineingezogenwerden in den Krieg zu vermeiden.[88] Staatssekretär Boheman hatte im Spätherbst 1942 in London und Washington über ein Kriegshandelsabkommen, v. a. betreffend Öllieferungen nach Schweden, mit den Westmächten verhandelt, welche Verhandlungen einen Umschwung der schwedischen Kriegshandelspolitik als Ergebnis hatten.[89] Dabei muss ihn vor allem das tiefe Misstrauen der Amerikaner, an deren Sieg er keinerlei Zweifel hatte, sehr bekümmert haben. Schon zuvor hatte Churchill ihn gewarnt, dass man in Washington keinerlei Verständnis für die Situation Schwedens habe, das als völlig in Nazideutschlands Hand betrachtet werde.[90] Überhaupt, so Abrahamsen: „In the Allied countries and in occupied Norway, anti-Swedish sentiment was strong as long as the transit permit existed.“[91]
Bezüglich des Neutralitätsbruchs zugunsten Deutschlands „weist schließlich einiges darauf hin […], daß man dabei auch selber ganz gut verdiente“. Das Entgegenkommen gegenüber den Alliierten im späteren Verlauf lasse, so Setzen weiter, die Hoffnung auf „handfeste wirtschaftliche und politische Vorteile“ nach und auch noch während des Krieges vermuten,[92] worauf in gewisser Weise ja auch die in Kapitel 2.1 zitierte Rede Bohemans hindeutet.
In einem Artikel vom 30. Januar 1945 über die erste Ratssitzung des Schwedischen Institutes am Tage zuvor schrieb die Dagens Nyheter, dass Schweden – zumindest im Westen – trotz aller Befürchtungen jetzt ein viel besseres Ansehen als nach dem Ersten Weltkrieg genieße. Darin werden auch wiederum Worte Erik Bohemans zitiert, der das Schwedische Institut als einen bedeutenden Faktor im Wettbewerb um Exportmärkte sah.[93]
Es bestand indes durchaus Bedarf, dem Ausland die schwedische Haltung während des Krieges zu erklären und für einen besseren Ruf des Landes zu arbeiten bzw. Schweden im Ausland bekannter zu machen.
2.3 Von der Idee bis zur Gründung
Die Idee für eine Institution, die für das Ansehen Schwedens in der Welt wirken sollte, kam innerhalb des sogenannten Amerikaausschusses (Amerikautredningen) des schwedischen Außenministeriums auf, der auf Initiative von Staatssekretär Boheman im Frühjahr 1943 eingesetzt worden war.[94]
Anlass für die Gründung des Amerikaausschusses, der untersuchen sollte, wie Schweden gute Beziehungen zu beiden amerikanischen Kontinenten, die vom Krieg verhältnismäßig wenig berührt waren, aufbauen konnte, um nach Ende des Krieges intensive Handelsbeziehungen (wieder) aufnehmen zu können, war die zum Teil stark antischwedische Haltung, die Boheman in Amerika entgegengeschlagen war.
Recht bald kam man innerhalb des Ausschusses jedoch zu der Erkenntnis, dass es einer Institution mit Verantwortung für schwedische Aufklärungsarbeit in aller Welt, nicht nur auf den beiden amerikanischen Kontinenten bedürfe. Deshalb beschloss man ein Komitee einzusetzen, das die Einrichtung einer solchen Institution vorbereiten sollte.
Das einzurichtende Organ sollte nach Möglichkeit gegenüber staatlichen Ministerien selbstständig arbeiten können und sowohl die allgemeinen als auch die wirtschaftlichen und kulturellen Kontakte mit dem Ausland stärken. Daneben sollte es ein allseitiges und aktuelles Bild von Schweden und den schwedischen Verhältnissen vermitteln.[95]
Zur Einsetzung des Organisationskomitees für die Aufklärungsarbeit im Ausland lud Boheman etwa 200 bekannte Schweden – Repräsentanten von Kulturinstitutionen, Universitäten, Volksbewegungen, aus Kirche und Wirtschaft – samt Außenminister Günther und Kultusminister Bagge ein. Aus diesen wurde ein kleiner Kreis gewichtiger Persönlichkeiten für das Komitee ausgewählt.
Nach wöchentlichen Treffen des Komitees hatte man bereits Ende März 1943 einen Vorschlag ausgearbeitet, der dem schwedischen Reichstag am 12. Mai 1944 vorgelegt und später angenommen wurde. Demnach sollte ein Rat bestehend aus 100 Personen der Organisation, die den Namen „Schwedisches Institut“ erhalten sollte, vorstehen, wobei die Zusammensetzung des Rates die Finanzierung aus 50% staatlichen und 50% privaten Mitteln widerspiegeln sollte. Unternehmen und Organisationen sollten zahlende Mitglieder des Institutes werden. Die Mitglieder sollten die eine Hälfte der Ratsmitglieder auswählen, die Regierung die andere. Der Vorstand sollte sich aus elf Mitgliedern, sieben ernannt vom Aufsichtsrat, drei vom König sowie dem Direktor, zusammensetzen. Der Rat sollte jährlich den Jahresbericht des Vorstandes prüfen und ihm Eigenverantwortlichkeit bewilligen.
Im Vordergrund der Tätigkeit sollte die Vermittlung von Informationen durch bekannte Medien, Drucksachen, Filme, Ausstellungen, Vorträge, das Einladen von Multiplikatoren anderer Länder und auch Rundfunk stehen. Außerdem sollte das Institut auch in Schweden über andere Länder informieren.
Daneben sollte das Institut die schwedische Forschung durch Stipendien und Übersetzungen unterstützen.
In mancherlei Hinsicht, v. a. im Bereich des Kultur- und Erfahrungsaustausches, war der einige Jahre zuvor gegründete British Council Vorbild für das neu zu gründende Institut.[96] Der British Council war allerdings ganz staatlich finanziert und rein kulturell tätig.[97]
Das Komitee arbeitete bis zum Januar 1945, als das Schwedische Institut am 29. selbigen Monats schließlich – als ideelle Vereinigung Schwedisches Institut für kulturellen Austausch mit dem Ausland (Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet) – aus der Taufe gehoben wurde. Anfang Februar nahm das Institut schließlich seine Arbeit auf.
2.4 Aufgabe
Über die Aufgabe des Schwedischen Institutes ist in den ersten Statuten, die vom damaligen schwedischen König Gustav V. bereits am 12. Januar 1945 offiziell abgesegnet wurden[98], dann folgendes zu lesen:
§1 Aufgabe des Institutes: Aufgabe des Schwedischen Institutes ist es, zum Wohle für Schwedens kulturelle, soziale und wirtschaftliche Beziehungen mit dem Ausland, die bereits vorhandene Aufklärungsarbeit über Schweden im Ausland zu koordinieren und zu unterstützen sowie, insofern dies als notwendig und geeignet angesehen werden mag, neue Tätigkeitszweige im Dienste des Kulturaustausches aufzunehmen.[99]
Das Schwedische Institut sollte also zu einer koordinierenden Stelle innerhalb der auswärtigen Kulturarbeit Schwedens werden. Und auch wirtschaftliche Beziehungen spielten explizit eine Rolle, was durchaus verständlich ist, waren doch alle nordischen Länder von jeher auf internationalen Handel angewiesen.
2.5 Schwedens auswärtige Kulturpolitik vor 1945
Das Schwedische Institut war aber natürlich nicht das erste Organ der schwedischen auswärtigen Kulturpolitik. Es konnte auf die Arbeit anderer aufbauen bzw. mit ihnen zusammenarbeiten. Die wichtigsten sollen hier genannt werden.
1887 wurde die Allgemeine Exportvereinigung Schwedens (Sveriges Allmänna Exportförening) gegründet, die selbstverständlich eine kommerziell ausgerichtete Informationstätigkeit betrieb.[100]
Die Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet (Reichsvereinigung für die Bewahrung des Schwedentums im Ausland) hatte ab 1908 als ihre Aufgabe eben zum einen die Bewahrung und zum anderen die Förderung der schwedischen Sprache und Kultur im Ausland.[101]
Das schwedische Außenministerium hatte ab 1909 ein eigenes Pressebüro, das zentrale Informationsangelegenheiten betreute.[102]
Als Resultat der Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg und aufgrund der immer bedeutenderen Rolle der USA entstanden 1919 die Schweden-Amerika-Stiftung (Sverige-Amerika Stiftelsen) und 1921 das Schwedisch-amerikanische Nachrichtenbüro (Svensk-amerikanska nyhetsbyrån). Die Stiftung vergibt auch heute noch[103] Stipendien an Schweden, die in Nordamerika studieren oder forschen, und das Nachrichtenbüro mit Sitz in New York und Stockholm vermittelte Nachrichtenmaterial an amerikanische Medien.[104]
Im Jahre 1927 wurde das Schwedisch-internationale Pressebüro (Svensk-internationella Pressbyrån) mit besonderer Ausrichtung auf Südamerika ins Leben gerufen.[105]
Innerhalb des Außenministeriums entstanden 1935 der Aufklärungsausschuss (Upplysningsnämnden) und der Kulturrat (Kulturrådet). Diese beiden Organe hatten vor allem Beratungsaufgaben zu erfüllen.[106]
Manche dieser Organe bestehen – meist umbenannt – heute noch fort. Einige werden in dieser Arbeit auch noch ein oder mehrere Male zur Sprache kommen, eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den einzelnen Institutionen würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
3 Das Schwedische Institut von 1945 bis heute
Wenn man die Tätigkeitsfelder, die im ersten Jahresbericht des Institutes genannt werden, mit den heutigen vergleicht, kommt man zum Schluss, dass die Arbeit des Institutes seit seiner Gründung im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Die damaligen Tätigkeitsfelder, die auch heute noch Bestand haben, waren Publikationen, Filme, Ausstellungen, Bilderservice, Betreuung des Gastdozentenaustausches, von Stipendienprogrammen und von Studienbesuchen, die schwedischen Auslandslektorate und ein allgemeiner Auskunftsdienst.[107] Diese äußerst heterogenen Tätigkeitsfelder lassen sich – mehr oder weniger eindeutig – den Bereichen allgemeine Auslandsinformation, Kulturaustausch, Erfahrungsaustausch und Schwedischunterricht im Ausland zuordnen. Daneben betrieb das Institut mehrere Auslandsbüros, von denen heute nur noch das in Paris besteht.
Das Schwedische Institut konstatierte in seinem ersten Jahresbericht ein reges Interesse sowohl an Schweden als auch am Ausland und fungierte von Beginn an als eine Art Aufklärungs-, Beratungs- und Vermittlungszentrale.[108]
Bei seiner Arbeit war – und ist – das Institut auf die enge Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und Organisationen angewiesen. Dies spiegelte sich zu Beginn vor allem in der Zusammensetzung der verschiedenen Ausschüsse des Institutes, die im Grunde dessen Tätigkeitsfeldern entsprachen und die sich aus Fachleuten aus den jeweiligen Bereichen zusammensetzten, wider, später in den sogenannten Referenzgruppen, auf die noch eingegangen werden soll.
3.1 Organisation
3.1.1 Rechtsform, Zielsetzung und Finanzierung
Das Schwedische Institut wurde, wie erwähnt, als ideelle Vereinigung gegründet und war zu Beginn ein halboffizielles, selbstständiges und unpolitisches Organ, das teils durch staatliche Mittel, teils durch jährliche Beihilfen und Mitgliedsbeiträge von privaten Organisationen und Unternehmen finanziert wurde.[109] Diese Rechtsform wurde als glaubwürdiger, da keinem allzu großen politischen Einfluss unterworfen, und weniger bürokratisch als ein staatliches Organ angesehen.[110]
Während ursprünglich eine paritätische Finanzierung des Institutes durch den Staat und durch zahlende Mitglieder beabsichtigt war, stellte sich dies bald als utopisch heraus. Die staatlichen Mittel stiegen weit schneller als die privaten, so dass z. B. im Geschäftsjahr 1947/48 die privaten Mittel nur noch etwa 1/4 des Gesamthaushaltes ausmachten.[111] Aus diesem Grund wurde bereits im Geschäftsjahr 1946/47 beschlossen, dass nicht mehr die Hälfte der Mittel von privater Seite kommen müsse.[112]
Da die Schere immer weiter auseinander ging und beispielsweise 1966/67 gut 87% des Budgets vom Staat kamen,[113] der Staat also die wirtschaftliche, nicht aber die organisatorische Hauptverantwortung innehatte, und da zentrale Beschlüsse vom Rat des Institutes, der nur einmal jährlich zusammentrat, getroffen werden mussten, was für die Leitung des Institutes eine Erschwernis der Arbeit darstellen konnte,[114] war eine neue Rechts- und Finanzierungsform vonnöten.
Am 1. Juli 1970 dann wurde auf Vorschlag des schwedischen Außenministeriums[115] aus dem Schwedischen Institut für kulturellen Austausch mit dem Ausland die staatliche Stiftung Schwedisches Institut (Stiftelsen Svenska institutet). Die Form einer Stiftung sollte die selbstständige Stellung gegenüber dem Staat bewahren, wodurch garantiert werden sollte, dass das Institut ein unparteiisches, sachliches, nuanciertes und soweit möglich gerechtes Bild der schwedischen Gesellschaftsverhältnisse vermittelt.[116] Die Finanzierung ging durch die Umwandlung vollständig auf den Staat über, vor allem auf das Außenministerium, am Auftrag des Institutes änderte sich aber nichts: „Die Stiftung hat zum Zweck, den Kultur- und Erfahrungsaustausch mit dem Ausland zu fördern sowie Wissen über schwedisches Gesellschaftsleben zu verbreiten.“[117] Zu den Veränderungen gehörte die Auflösung des 100 Mitglieder umfassenden Rates, der vorher das höchste Organ des Institutes war, eine Verminderung des Vorstandes von 14 auf – inklusive dem Direktor – 11 Mitglieder, die jetzt allesamt vom König – bzw. der Regierung – ernannt wurden, und die Einrichtung von sogenannten Referenzgruppen,[118] um den Kontakt zur Gesellschaft zu wahren.[119] Laut veränderter Statuten sollte der Vorstand, 1993 z. B. bestehend aus Vertretern das Außen- und Bildungsministeriums, der Regierung, des Kulturlebens (3 Personen), der fachlichen Organisationen und der Wirtschaft (3), über Umfang und Richtung der Tätigkeit der Stiftung entscheiden, war aber in seinen Entscheidungsmöglichkeiten durch die Budgetierung sowie die jährlichen Weisungsbriefe vom Außenministerium beschränkt. Dennoch konnte der Vorstand die Schwerpunkte und Ziele für die Arbeit des Institutes setzen, was als wichtig für dessen Stellung als selbstständiges Organ und für dessen Glaubwürdigkeit angesehen wurde.[120]
Am 1. Januar 1998 wurde das Schwedische Institut schließlich zu einer staatlichen Behörde unter dem Außenministerium und der Direktor zum Generaldirektor.[121] Auf Anfrage nannte Erland Ringborg, der 1998 als Generaldirektor die Führung des Institutes übernahm und diese bis 2005 innehatte, ein neues Stiftungsgesetz als Anlass. Demnach sollten gänzlich staatlich finanzierte Organisationen nicht in Form einer Stiftung betrieben, sondern in eine Behörde umgewandelt werden.
An seiner Hauptaufgabe, der „Verbreitung von Wissen über Schweden im Ausland und der Verantwortung für den Austausch mit anderen Ländern in den Bereichen Kultur, Ausbildung, Forschung und Gesellschaftsleben“ hat sich gegenüber der Stiftungsform nichts wesentlich geändert, allerdings soll das Schwedische Institut bei seiner Tätigkeit nun ausdrücklich „schwedische Interessen fördern und zu Wachstum, Beschäftigung und kultureller Entwicklung in Schweden beitragen.“[122] Damit ist man in gewisser Weise wieder zur ursprünglichen Aufgabe des Schwedischen Institutes, nämlich „zum Wohle für Schwedens kulturelle, soziale und wirtschaftliche Beziehungen mit dem Ausland“ zu wirken, zurückgekehrt. Als weiteres Ziel hat das Institut im Bereich Entwicklungszusammenarbeit heute, Offenheit sowie die demokratische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Partnerländern zu fördern.[123]
3.1.2 Organisationsform
Nicht nur die Rechtsform hat sich im Laufe der Zeit verändert, sondern mit ihr und viel häufiger auch die Organisationsform des Institutes. Die Form der Organisation richtete sich dabei im Wesentlichen an den verschiedenartigen Tätigkeitsfeldern aus, die über die Jahre zu unterschiedlichen größeren Organisationseinheiten zusammengefasst wurden.
Zunächst waren die Tätigkeitsfelder ohne organisatorische Zwischenstufe direkt dem Vorstand und dem Direktor untergeordnet, wobei mit den Tätigkeitsfeldern, z. B. Publikationen, Ausstellungen und Auslandslektorate, in der Regel Ausschüsse, bestehend aus diversen Experten unter den Mitgliedern des Institutes, verknüpft waren.
Im Geschäftsjahr 1961/62 wurden die Tätigkeitsfelder zu insgesamt zwei Abteilungen zusammengefasst, einer allgemeinen Abteilung und einer Produktionsabteilung. Daneben existierte eine Finanzabteilung.[124]
Nach der Umwandlung in eine Stiftung wurden die einzelnen Aufgaben auf vier verschiedene Hauptprogramme, die sich an den vier verschiedenen Funktionen orientierten, verteilt: Information über Schweden, Studien und Forschung, Präsentation künstlerischer Tätigkeit sowie Ausbildung in schwedischer Sprache und Literatur. Als beratende Organe wurden jetzt, in einer Art Stabfunktion, neu die Referenzgruppen eingerichtet.[125]
Ab dem Jahresbeginn 1973 wurden die vier Hauptprogramme dann tatsächlich auch zur Grundlage für die Organisation. Für jedes Hauptprogramm gab es dabei einen verantwortlichen Planer oder Programmdirektor.[126]
In den folgenden Jahren wandelte sich die Anzahl und die Zusammensetzung der Hauptprogramme bzw. später Programmbereiche mehrfach und die Stellen der Planer und Programmdirektoren fielen wieder weg. Länger von Bestand war die Aufteilung des Geschäftsjahres 1978/79 in sieben Programmbereiche: 1. Informationsarbeit, 2. Allgemeiner Kulturaustausch, 3. Stipendien, 4. Übriger Personenaustausch in Studien und Forschung, 5. Unterstützung des Schwedischunterrichts im Ausland, 6. Das Schwedische Kulturhaus in Paris sowie 7. Personal und Administration/Zentrale in Stockholm.[127]
In den 1990-ern wurden aus den Programmbereichen dann Einheiten mit Stabfunktionen, wie z. B. Finanzen oder IT, und nach der Umwandlung zu einer Behörde wurde aus dem Direktor ein Generaldirektor und die Stabfunktionen wurden zum Zweck einer besseren übergreifenden Planung und Führung durch die Einrichtung eines besonderen Sekretariates (verksledningssekretariat) gestärkt.[128]
Seit 2007 gibt es eine neue Organisationsform.[129] Nach Auskunft des Institutes existieren nun sechs Abteilungen: Verwaltung und Service, Analyse und Koordination, Kommunikation und PR, Projekte und Präsentationen, das Kulturhaus in Paris sowie Verbindungsfördernde Tätigkeit. Die Abteilungsleiter bilden gemeinsam die Führungsgruppe, über der schließlich der Generaldirektor steht.
Seit diesem Jahr nun hat das Institut außerdem keinen Vorstand (styrelse) mehr, sondern einen Aufsichtsrat (insynsråd).[130]
3.1.3 Standort
In seinem mittlerweile über sechzigjährigen Bestehen ist das Schwedische Institut innerhalb von Stockholm mehrmals umgezogen. Besonders in den ersten Jahrzehnten wechselte man aufgrund ständigen Platzmangels gleich mehrere Male die Räumlichkeiten, so dass sich das Institut zuletzt sogar auf mehrere Adressen aufgeteilt fand.[131]
Im Geschäftsjahr 1959/60 kam dann der Vorschlag, ein neues Gebäude zu errichten, in dem, zur verbesserten Zusammenarbeit, gleich mehrere Aufklärungsorgane, neben dem Institut vor allem der Schwedische Tourismusverband, Platz finden sollten.[132] Im darauf folgenden Geschäftsjahr kam dann auch der positive Beschluss zum Bau eines gemeinsamen Schwedenhauses (Sverigehuset) in zentraler Lage am Kungsträdgården.[133] Es sollte aber noch bis zum 2. Januar 1969 dauern, bis das Schwedische Institut zusammen mit anderen Aufklärungsorganen tatsächlich einziehen konnte. Damit waren auch zum ersten Mal seit fast zwei Jahrzehnten die verschiedenen Einheiten des Institutes unter einem Dach.[134]
Nach über 30 Jahren im Schwedenhaus zog das Institut im Jahr 2002 dann erneut um – in ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert direkt hinter dem Schloss in Stockholms Altstadt Gamla Stan.[135]
3.1.4 Personal
Bei Aufnahme der Tätigkeit hatte das Institut – einschließlich des Direktors – insgesamt sechs Angestellte.[136] Im Berichtsjahr 1949/50 dann waren es insgesamt bereits 31 (inklusive drei Archivmitarbeitern und 5 Angestellte im Ausland).[137] Die Angestelltenzahl stieg danach stetig an, erreichte 1960 etwas mehr als 60, zwanzig Jahre später bereits über 90.[138] 1988/89 verzeichnete der Jahresbericht in Stockholm 91,5 und am schwedischen Kulturhaus in Paris, das dem Institut unterstellt ist, neun Stellen, 1997 dann die Gesamtzahl von 108 Angestellten.[139] Nachdem die Angestelltenzahl in Stockholm mit insgesamt 102 1998 offenbar ihren Höhepunkt erreichte, wurde diese bis 2002 auf nur noch 85 reduziert. Der Jahresbericht 2002 spricht von einer notwendigen Anpassung der Hauptgeschäftsstelle an die finanziellen Gegebenheiten.[140]
Von den 2004 81 in Stockholm und elf in Paris angestellten Personen waren insgesamt 74 Frauen und 18 Männer,[141] was einem Frauenanteil von über 80% entspricht. Momentan sind in Stockholm 84[142] und in Paris 10 Personen[143] angestellt.
Für 2001 berichtet das Institut, dass 25% seiner Angestellten einen Migrationshintergrund oder ein ausländisches Elternteil aufwiesen.[144] Für 2005 wird lediglich der Migrationshintergrund ausgewiesen, der damals etwa 15% betrug.[145]
3.1.5 Finanzen
Im Laufe seiner Geschichte hatte das Schwedische Institut immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zu Beginn bestand das Problem, dass vor allem die Mittel von privater Seite, also aus der Wirtschaft, nicht im ursprünglich erwarteten Umfang zuflossen, der Arbeitsaufwand aber stetig zunahm. Angesichts dessen hatte man sich wohl zum Teil etwas übernommen, da beispielsweise aus dem Geschäftsjahr 1948/49 aufgrund der klammen finanziellen Lage die Schließung von Lektoraten bzw. der Entzug der Unterstützung für diese berichtet wird.[146] Die hohe Inflation der Nachkriegsjahre[147] und kräftig steigende Kosten taten dabei ihr Übriges.[148]
[...]
[1] Helén, Gunnar / Alemyr, Stig u. a.: Svenska Institutet som organ för utlandsinformation och internationellt utbyte (Statens offentliga utredningar 1967:56). Stockholm 1967.
[2] Tallroth, Tore: Svenska Institutet och svensk upplysningsverksamhet i utlandet. In: Nauckhoff, Sigurd u. a.: Harald Nordenson. En samling uppsatser tillägnade Harald Nordenson på 60-årsdagen den 10.8.1946. Stockholm 1946, S. 368–378.
[3] Heckscher, Gunnar: Svenska Institutet. In: Industria 46(1950) H. 13, S. 33–36.
[4] Arvidsson, Ingrid / Ahlander, Dag Sebastian: Kultur och information över gränserna (Statens offentliga utredningar 1978:56). Stockholm 1978.
[5] Löfdahl, Göran / Jonsson, Anita u. a.: Sverigeinformation och kultursamarbete (Statens offentliga utredningar 1988:9). Stockholm 1988.
[6] Faxén, Magnus: Svenska Bilder. Översyn av Sverigeinformationen (Ds 1993:72). Stockholm 1993.
[7] Lundberg, Lars-Olof: Bilder av Sverige i utlandet. En studie av förändringar, nuläge och mätmetoder. Stockholm 2005.
[8] Vgl. Busche, Hubertus: Was ist Kultur? Erster Teil: Die vier historischen Grundbedeutungen. In: Dialektik. Zeitschrift für Kulturphilosophie. H. 1, 2000, S. 69.
[9] Kroeber, Alfred L. / Kluckhohn, Clyde: Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. 2. Auflage. New York 1967, S. 357.
[10] Deutsche UNESCO-Kommission (DUK): Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt. Auf: Internetseite der DUK. URL: http://www.unesco.de/443.html?&L=0 [08.07.2002 / 25.08.2008].
[11] Vgl. Nilsson, Sven: Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige. Malmö 1999, S. 10.
[12] Arnold, Hans: Auswärtige Kulturpolitik. Ein Überblick aus deutscher Sicht. München / Wien 1980, S. 9.
[13] Vgl. z. B. Schwedischer Kulturrat: Cultural Policy. A Review of State Cultural Policies and Practices. Stockholm 1990, S. 12 zur staatlichen Kulturpolitik Schwedens.
[14] Vgl. Trommer, Siegfried J.: Die Mittlerorganisationen der auswärtigen Kulturpolitik. Tübingen 1984, S. 3–6.
Trommer stellt diesem erweiterten den engeren Kulturbegriff gegenüber, der Kultur als etwas „Feierlich-Exklusives“, etwas Elitäres versteht, was offenbar dem Kulturverständnis in der deutschen auswärtigen Kulturpolitik bis 1970 entsprach. Vgl. ebd., S. 2–5.
[15] Vgl. Arnold 1980, S. 12.
Häufig findet sich in der Literatur auch die Schreibweise „Auswärtige Kulturpolitik“.
[16] Ebd., S. 9.
[17] Merkel, Stephanie: Interkulturelle Zusammenarbeit. Das Goethe-Institut als Mittlerorganisation in der auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. In: Lernen in Deutschland 12(1992) H. 2, S. 107.
[18] Arnold 1980, S. 11.
[19] Vgl. Arvidsson / Ahlander 1978, S. 35.
[20] Vgl. Merkel 1992, S. 106–109.
[21] Vgl. Kathe, Steffen R.: Kulturpolitik um jeden Preis. Die Geschichte des Goethe-Instituts von 1951 bis 1990. München 2005, S. 449.
[22] Vgl. Arnold 1980, S. 16f.
[23] Ebd., S. 18.
[24] Vgl. ebd., S. 30.
[25] Ebd., S. 33.
[26] Vgl. Kathe 2005, S. 38.
[27] Auswärtiges Amt: Auswärtige Kulturpolitik – Konzeption 2000. Berlin 1999, S. 2.
[28] Trommer 1984, S. 5f.
[29] Arnold 1980, S. 21.
[30] Trommer 1984, S. 52a.
[31] Vgl. Arnold 1980, S. 21.
[32] Vgl. Kathe 2005, S. 13.
[33] Vgl. Arnold 1980, S. 21.
[34] Siehe Kap. 3.1.1.
[35] Siehe z. B. Kap. 3.1.5.
[36] Vgl. Kleberg, Carl-Johan: Between Competition and Co-operation – Governmental Programmes versus Private Initiatives: The example of Sweden (ifa-Tagung Europäische Kulturpolitik). Berlin 2003. Auf: Internetseite des Institutes für Auslandsbeziehungen. URL: http://cms.ifa.de/fileadmin/content/informationsforum/dossiers/downloads/eu_kleberg.pdf [08.09.2008], S. 3.
[37] Vgl. Löfdahl / Jonsson 1988, S. 36.
[38] Vgl. Arvidsson / Ahlander 1978, S. 9/38.
[39] Vgl. Schwedischer Kulturrat 1990, S. 12.
[40] Vgl. Nilsson 1999, S. 423.
[41] Zit. bei Hildeman, Per-Axel: Upplysningsvis. Svenska institutet 1945–1995. Stockholm 1995, S. 9.
[42] Zitate aus dem Schwedischen sind, soweit nicht anders vermerkt, vom Verfasser übersetzt.
[43] Vgl. Schröter, Harm G.: Geschichte Skandinaviens. München 2007, S. 66.
[44] Vgl. ebd.
[45] Vgl. Weibull, Jörgen: Schwedische Geschichte. Stockholm 1994, S. 116.
[46] Vgl. Kummel, Bengt: Svenskar i all världen förenen eder! Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen. Åbo 1994, S. 255.
[47] Vgl. Imhof, Arthur Erwin: Grundzüge der nordischen Geschichte. Darmstadt 1970, S. 178; Findeisen, Jörg-Peter: Schweden. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg 1997, S. 224.
[48] Vgl. Weibull 1994, S. 116; Schröter 2007, S. 68.
[49] Vgl. Findeisen 1997, S. 225.
[50] Vgl. Weibull 1994, S. 117.
[51] Findeisen 1997, S. 225.
[52] Vgl. ebd.
[53] Vgl. Bracher, Ulrich: Geschichte Skandinaviens. Stuttgart 1968, S. 108.
[54] Vgl. ebd., S. 116.
[55] Vgl. Weibull 1994, S. 124.
[56] Ebd. 1994, S. 122/124.
[57] Vgl. Weibull 1994, S. 126.
[58] Vgl. Bracher 1968, S. 116.
[59] Vgl. Schröter 2007, S. 72.
[60] Vgl. ebd., S. 82.
[61] Vgl. Bracher 1968, S. 117; Schröter 2007, S. 82–83.
[62] Vgl. Schröter 2007, S. 75–80.
[63] Vgl. Wilhelmus, Wolfgang: Schweden und das faschistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg. In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 21(1973) H. 7, S. 791f.
[64] Vgl. Schröter 2007, S. 77f.
[65] Findeisen 1997, S. 235.
[66] Vgl. Gustafsson, Harald: Nordens historia. En europeisk region under 1200 år. Lund 2007, S. 259.
[67] Vgl. Gruchmann, Lothar: Schweden im Zweiten Weltkrieg. Ergebnisse eines Stockholmer Forschungsprojekts. In: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 25(1977) H. 4, S. 592/600.
[68] Vgl. Wilhelmus 1973, S. 795.
[69] Vgl. Findeisen 1997, S. 235.
[70] Vgl. Schröter 2007, S. 84.
[71] Vgl. Gustafsson 2007, S. 261.
[72] Vgl. Weibull 1994, S. 127f.
[73] Vgl. Findeisen 1997, S. 236.
[74] Vgl. Abrahamsen, Samuel: Sweden’s Foreign Policy. Washington 1957, S. 32f.
[75] Vgl. Wilhelmus 1973, S. 793f.
[76] Vgl. ebd., S. 802–804.
[77] Vgl. ebd., S. 802; Weibull 1994, S. 128.
[78] Vgl. Findeisen 1997, S. 236f.
[79] Vgl. Abrahamsen 1957, S. 40.
[80] Vgl. Findeisen 1997, S. 238.
[81] Vgl. Abrahamsen 1957, S. 53.
[82] Vgl. Möller, Tommy: Svensk politisk historia 1809–1975. 2. Aufl. Lund 2005, S. 143.
[83] Vgl. Weibull 1994, S. 130.
[84] Vgl. Wilhelmus 1973, S. 809.
[85] Vgl. Weibull 1973, S. 130; Findeisen 1997, S. 239.
[86] Vgl. Gruchmann 1977, S. 612; Schröter 2007, S. 88.
[87] Vgl. Findeisen 1997, S. 238.
[88] Vgl. Gruchmann 1977, S. 600.
[89] Vgl. Hägglöf, Gunnar: Svensk krigshandelspolitik under andra världskriget. Stockholm 1958, S. 223–227.
[90] Vgl. Boheman, Erik: På vakt. Kabinettssekreterare under andra världskriget. Stockholm 1964, S. 197/225.
[91] Abrahamsen 1957, S. 41.
[92] Setzen, Florian Henning: Neutralität im Zweiten Weltkrieg. Irland, Schweden und die Schweiz im Vergleich (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 14). Hamburg 1997, S. 92.
[93] Zit. bei Hildeman, Per-Axel: Upplysningsvis. Svenska institutet 1945–1995. Stockholm 1995, S. 6.
[94] Der Inhalt dieses Kapitels ist, soweit nicht anders vermerkt, entnommen aus: Hildeman 1995, S. 7–14.
[95] Vgl. Arvidsson / Ahlander 1978, S. 109.
[96] Vgl. Arvidsson / Ahlander 1978, S. 114.
[97] Vgl. Schwedisches Institut (SI): Verksamhetsberättelse 1947–48. Stockholm 1948, S. 4.
[98] Vgl. Hildeman 1995, S. 12.
[99] Ebd., S. 14.
[100] Vgl. Hildeman 1995, S. 13.
[101] Vgl. Kummel 1994, S. 71f.; Hildeman 1995, S. 13.
[102] Vgl. Hildeman 1995, S. 13.
[103] Vgl. Schweden-Amerika-Stiftung. Internetseite. URL: http://www.sweamfo.se/ [02.09.2008].
[104] Vgl. Tallroth 1946, S. 370; Hildeman 1995, S. 13.
[105] Vgl. Tallroth 1946, S. 370; Hildeman 1995, S. 13.
[106] Vgl. Hildeman 1995, S. 13.
[107] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1944–45. Stockholm 1945, S. 11–21.
[108] Vgl. SI 1945, S. 23f.
[109] Vgl. Brusewitz, S. / Backlund, Sven u. a.: Yttrande med förslag rörande upplysningsverksamheten i utlandet. In: SI: Verksamhetsberättelse 1955–56. Stockholm 1956, S. 14.
[110] Vgl. Heckscher 1950, S. 36; Helén / Alemyr 1967, S. 19.
[111] Vgl. SI 1948, S. 65.
[112] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1946–47. Stockholm 1947, S. 1.
[113] Vgl. Hildeman 1995, S. 66/68.
[114] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1969/70. Stockholm 1970, S. 52.
[115] Vgl. Löfdahl / Jonsson 1988, S. 40.
[116] Vgl. Faxén 1993, S. 19/25f.
[117] SI 1970, S. 3.
[118] Referenzgruppen waren beratende Organe in verschiedenen Bereichen, die sich aus Experten zu bestimmten Themen, z. B. Musik, Form, Architektur, Arbeitsmarkt, Literatur oder soziale Fragen, sowie Mitarbeitern des Institutes zusammensetzten. Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1970/71. Stockholm 1971, S. 1; SI: Verksamhetsberättelse 1971/72. Stockholm 1972, S. 7.
[119] Vgl. SI 1970, S. 3f.; Faxén 1993, S. 29.
[120] Vgl. Faxén 1993, S. 28f.
[121] Vgl. SI: Årsredovisning 1997. Stockholm 1998a, S. 1; Dahlberg, Ingrid / Enflo, Hans u. a.: Internationella kulturutredningen (Statens offentliga utredningar 2003:121). Stockholm 2003, S. 89.
[122] Dahlberg / Enflo 2003, S. 89.
[123] Vgl. Schwedisches Aussenministerium: Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Svenska institutet. 13.12.2007, S. 5f.
[124] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1961–62. Stockholm 1962, S. 74.
[125] Vgl. SI 1971, S. 1–4.
[126] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1972/73. Stockholm 1973, S. 11.
[127] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1984/85. Stockholm 1985, S. 6.
[128] Vgl. SI: Årsredovisning 1998. Stockholm 1999, S. 1.
[129] Vgl. SI: Årsredovisning 2007. Stockholm 2008a, S. 5.
[130] Vgl. SI: Svenska institutets insynsråd utsett. Auf: Internetseite des SI. URL: http://www.si.se/templates/NewsPage____4228.aspx [15.05.2008 / 02.09.2008].
[131] Vgl. Hildeman 1995, S. 68f.
[132] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1959–60. Stockholm 1960, S. 5–8.
[133] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1960–61. Stockholm 1961, S. 6.
[134] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1968/69. Stockholm 1969, S. 3.
[135] Vgl. SI: Årsredovisning 2002. Stockholm 2003a, S. 1.
[136] Vgl. Hildeman 1995, S. 14.
[137] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1949–50. Stockholm 1950, S. 32.
[138] Vgl. Hildeman 1995, S. 80.
[139] Vgl. SI 1989, S. 2; SI 1998a, S. 18.
[140] Vgl. SI 2003a, S. 4/109.
[141] Vgl. SI: Årsredovisning 2004. Stockholm 2005, S. 112.
[142] Vgl. SI: SI:s personal. Auf: Internetseite des SI. URL: http://www.si.se/templates/ContactListPage____2735.aspx [15.09.2008].
[143] Vgl. SI: Personal på CCS. Auf: Internetseite des SI. URL: http://www.si.se/templates/CCS_CommonPage.aspx?id=1425 [15.09.2008].
[144] Vgl. SI: Verksamhet 2001. Stockholm 2002, S. 38.
[145] Vgl. SI: Årsredovisning 2005. Stockholm 2006, S. 72.
[146] Vgl. SI: Verksamhetsberättelse 1948–49, Stockholm 1949, S. 4–6/23.
[147] Vgl. Möller 2005, S. 146.
[148] SI: Verksamhetsberättelse 1951–52. Stockholm 1952, S. 6f.; SI: Verksamhetsberättelse 1953–54. Stockholm 1954, S. 5.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836626965
- Dateigröße
- 838 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Philosophische Fakultät I, Nordische Philologie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- schwedenbild schwedisches insitut kulturpolitik schweden nation branding
- Produktsicherheit
- Diplom.de