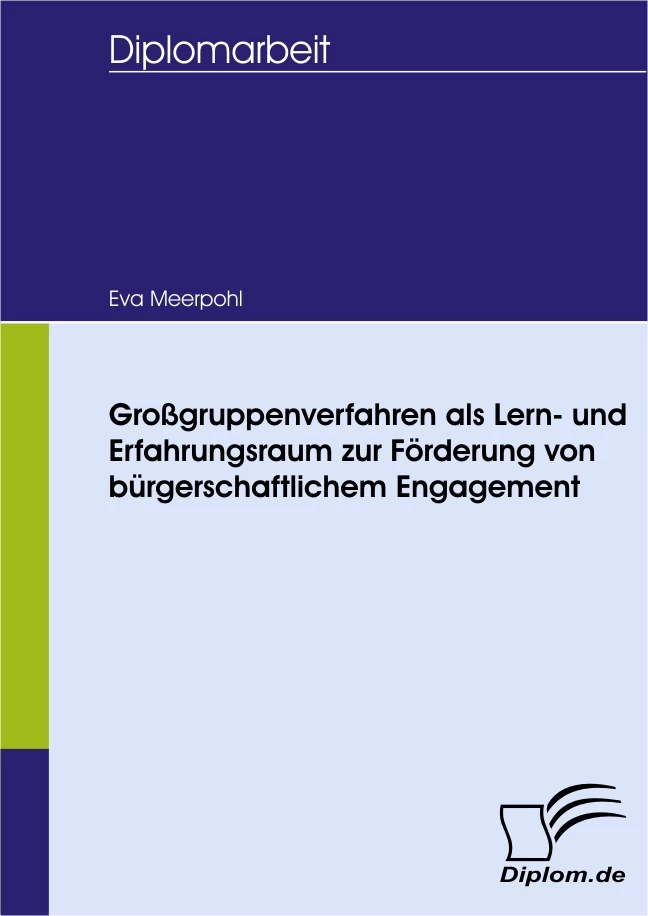Großgruppenverfahren als Lern- und Erfahrungsraum zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement
©2007
Diplomarbeit
142 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?. Diese Frage stellt das Gesellschafter-Projekt der Aktion Mensch. Das Projekt möchte die Verantwortung Einzelner für die Gesellschaft wieder bewusst machen. Die Bertelsmann Stiftung fokussiert in diesem Jahr das Thema Gesellschaftliches Engagement als Bildungsziel und sucht hierzu nach Strategien und Konzepten zur Motivation junger Menschen für ein Engagement. In jüngster Zeit gibt es einige Konzepte dieser Art, die auf die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement abzielen. Sie stehen vor dem Hintergrund einer Vision der Bürgergesellschaft, in der sich die Bürger aktiv für das Wohl der Gemeinschaft einbringen.
Das Thema Förderung bürgerschaftlichen Engagements bildet den Ausgangspunkt meiner Arbeit. Hierzu werden Großgruppenverfahren als mögliche Lern- und Erfahrungsräume vorgestellt und in Hinblick auf ihre Eignung zur Förderung von Engagement für das Gemeinwohl analysiert.
Meine persönliche Motivation zur Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt darin, dass ich mich selber in meinem Leben vielfältig engagiert habe und hierdurch das Gefühl hatte, etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beizutragen. Zugleich habe ich dies immer als eine persönliche Bereicherung empfunden. Diese Kombination aus Gemeinwohlorientierung und persönlicher Sinnstiftung wird im Rahmen dieser Arbeit behandelt. Das Thema Großgruppenverfahren fasziniert mich, weil ich deren Wirkung im Rahmen einer Konferenz selber erfahren durfte. Dort habe ich die Gelegenheit zur Reflexion und zum Austausch über persönlich bedeutsame Themen und Fragen nutzen können. Diesen Austausch sehe ich als ein bedeutendes Potential von Großgruppenverfahren, da er Menschen motiviert sich für die eigenen Ideen Verantwortung einzubringen und Verantwortung für sie zu übernehmen. Darum sehe ich Großgruppenverfahren als eine Möglichkeit, um Menschen für ein Engagement zu gewinnen.
Im Folgenden werde ich zunächst das Thema der Arbeit einführen und daraufhin den Aufbau der Arbeit erklären.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Frage, warum das Thema bürgerschaftliches Engagement bedeutsam und derzeit aktuell ist. Die Aktualität des Themas spiegelt sich unter anderem in der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements wieder. Außerdem wurde im Juli 2007 ein Gesetz1 zur Förderung von Engagement im Bundestag verabschiedet, das freiwillig engagierte Personen mit […]
In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?. Diese Frage stellt das Gesellschafter-Projekt der Aktion Mensch. Das Projekt möchte die Verantwortung Einzelner für die Gesellschaft wieder bewusst machen. Die Bertelsmann Stiftung fokussiert in diesem Jahr das Thema Gesellschaftliches Engagement als Bildungsziel und sucht hierzu nach Strategien und Konzepten zur Motivation junger Menschen für ein Engagement. In jüngster Zeit gibt es einige Konzepte dieser Art, die auf die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement abzielen. Sie stehen vor dem Hintergrund einer Vision der Bürgergesellschaft, in der sich die Bürger aktiv für das Wohl der Gemeinschaft einbringen.
Das Thema Förderung bürgerschaftlichen Engagements bildet den Ausgangspunkt meiner Arbeit. Hierzu werden Großgruppenverfahren als mögliche Lern- und Erfahrungsräume vorgestellt und in Hinblick auf ihre Eignung zur Förderung von Engagement für das Gemeinwohl analysiert.
Meine persönliche Motivation zur Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt darin, dass ich mich selber in meinem Leben vielfältig engagiert habe und hierdurch das Gefühl hatte, etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beizutragen. Zugleich habe ich dies immer als eine persönliche Bereicherung empfunden. Diese Kombination aus Gemeinwohlorientierung und persönlicher Sinnstiftung wird im Rahmen dieser Arbeit behandelt. Das Thema Großgruppenverfahren fasziniert mich, weil ich deren Wirkung im Rahmen einer Konferenz selber erfahren durfte. Dort habe ich die Gelegenheit zur Reflexion und zum Austausch über persönlich bedeutsame Themen und Fragen nutzen können. Diesen Austausch sehe ich als ein bedeutendes Potential von Großgruppenverfahren, da er Menschen motiviert sich für die eigenen Ideen Verantwortung einzubringen und Verantwortung für sie zu übernehmen. Darum sehe ich Großgruppenverfahren als eine Möglichkeit, um Menschen für ein Engagement zu gewinnen.
Im Folgenden werde ich zunächst das Thema der Arbeit einführen und daraufhin den Aufbau der Arbeit erklären.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Frage, warum das Thema bürgerschaftliches Engagement bedeutsam und derzeit aktuell ist. Die Aktualität des Themas spiegelt sich unter anderem in der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen Enquete-Kommission Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements wieder. Außerdem wurde im Juli 2007 ein Gesetz1 zur Förderung von Engagement im Bundestag verabschiedet, das freiwillig engagierte Personen mit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Eva Meerpohl
Großgruppenverfahren als Lern- und Erfahrungsraum zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement
ISBN: 978-3-8366-2667-5
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Universität Bielefeld, Bielefeld, Deutschland, Diplomarbeit, 2007
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
01
1.1 Einführung in die Themenstellung
01
1.2 Aufbau der Arbeit
04
2 Das bürgerschaftliche Engagement
06
2.1 Der Begriff ,,bürgerschaftliches Engagement"
07
2.1.1 Formen und Bereiche von Engagement
09
2.1.2 Das bürgerschaftliche Engagement in der Bürgergesellschaft
11
2.2 Die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements
14
2.2.1 Engagement und der Beitrag für die Gesellschaft
14
2.2.2 Engagement und der Beitrag für das Individuum
16
2.2.3 Empirische Befunde zum bürgerschaftlichen Engagement
17
2.3 Individualisierung und der Einfluss auf die Motive für ein Engagement 20
2.4 Kompetenzanforderungen an einen Bürger in einer Bürgergesellschaft 23
2.4.1 Der Begriff der Kompetenz
23
2.4.2 Die Kompetenz der Selbstorganisation
27
2.4.3 Die Gemeinsinn-Kompetenz
28
2.5 Zusammenfassung
29
3 Lern- und Erfahrungsräume
31
3.1 Der Begriff Lern- und Erfahrungsraum
31
3.2 Zu den Grundannahmen des Konstruktivismus
33
3.3 Das Konzept der Autopoiese nach Maturana und Varela
35
3.4 Lernen aus konstruktivistischer Perspektive
39
3.5 Ermöglichungsdidaktische Lern-und Erfahrungsräume
41
3.5.1 Ermöglichungsdidaktische Prinzipien
42
3.5.1.1 Das Prinzip des selbstorganisierten Lernens
43
3.5.1.2 Das Prinzip der Lernkontextgestaltung
44
3.5.1.3 Das Prinzip des sozialen Lernens
45
3.5.1.4 Das Prinzip der Subjektorientierung
46
3.5.1.5 Das Prinzip des Perspektivverschränkung
47
3.5.2 Die Anforderungen an die Lernenden
48
3.5.3 Die Rolle der Begleitenden
49
3.6 Zusammenfassung
50
2
4 Der Einsatz von Großgruppenverfahren
54
4.1 Begriffliche Darstellung und Hintergründe von Großgruppenverfahren 52
4.2 Ziele von Großgruppenverfahren
54
4.3 Methodisches Vorgehen für die Analyse der Großgruppenverfahren
57
4.4 Die Open Space Technology
58
4.4.1 Entwicklungshintergrund
59
4.4.2 Der Ablauf eines Open Space
60
4.4.3 Die Philosophie von Open Space
61
4.4.4 Analyse: Open Space als Lern- und Erfahrungsraum
62
4.5 Die Zukunftskonferenz
71
4.5.1 Die Herkunft der Zukunftskonferenz
72
4.5.2 Die Gestaltung einer Zukunftskonferenz
72
4.5.3 Die Phasen einer Zukunftskonferenz
73
4.5.4 Wesentliche Prinzipien
75
4.5.5 Analyse: Die Zukunftskonferenz als Lern-und Erfahrungsraum
77
4.6 Appreciative Inquiry
80
4.6.1 Die Herkunft von Appreciative Inquiry
87
4.6.2 Die Philosophie von Appreciative Inquiry
87
4.6.3 Der Ablauf eines Appreciative Inquiry - Prozesses
89
4.6.4 Das Interview Herzstück von Appreciative Inquiry
90
4.6.5 Analyse: Appreciative Inquiry als Lern- und Erfahrungsraum
91
4.7 Zusammenfassung und vergleichende Darstellung der
Großgruppenverfahren
99
5 Die Eignung von Großgruppenverfahren zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement
105
5.1 Bewertung der Eignung von Großgruppenverfahren zur Förderung
von bürgerschaftlichem Engagement
105
5.2 Erkenntnisse für die konkrete Umsetzung von
Großgruppenverfahren
108
6 Zusammenfassung und Ausblick
110
Literaturverzeichnis
115
Anhang I: Interview mit Stephan Zollondz, Mehrgenerationenhaus Bielefeld
127
Anhang II: Medienmitteilung: Zukunftskonferenz in Frankfurt/ Oder
136
3
1
Einleitung
1.1 Einführung in die Themenstellung
,,In was für einer Gesellschaft wollen wir leben?" (
http://diegesellschafter.de
; Stand:
05.08.2007). Diese Frage stellt das Gesellschafter-Projekt der ,,Aktion Mensch". Das
Projekt möchte die Verantwortung Einzelner für die Gesellschaft wieder bewusst machen
(vgl. http://diegesellschafter.de/projekt/ueber/utopie.php; Stand: 05.08.2007). Die
Bertelsmann Stiftung fokussiert in diesem Jahr das Thema ,,Gesellschaftliches Engagement
als Bildungsziel" und sucht hierzu nach Strategien und Konzepten zur Motivation junger
Menschen für ein Engagement (http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-
0A000F14-AAC7BC5F/bst/hs.xsl/49995_50031.htm; Stand: 05.08.2007). In jüngster Zeit
gibt es einige Konzepte dieser Art, die auf die Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement abzielen. Sie stehen vor dem Hintergrund einer Vision der Bürgergesellschaft,
in der sich die Bürger aktiv für das Wohl der Gemeinschaft einbringen (vgl. Enquete-
Kommission 2002: 25).
Das Thema Förderung bürgerschaftlichen Engagements bildet den Ausgangspunkt meiner
Arbeit. Hierzu werden Großgruppenverfahren als mögliche Lern- und Erfahrungsräume
vorgestellt und in Hinblick auf ihre Eignung zur Förderung von Engagement für das
Gemeinwohl analysiert.
Meine persönliche Motivation zur Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt darin, dass
ich mich selber in meinem Leben vielfältig engagiert habe und hierdurch das Gefühl hatte,
etwas Sinnvolles zur Gesellschaft beizutragen. Zugleich habe ich dies immer als eine
persönliche Bereicherung empfunden. Diese Kombination aus Gemeinwohlorientierung
und persönlicher Sinnstiftung wird im Rahmen dieser Arbeit behandelt. Das Thema
Großgruppenverfahren fasziniert mich, weil ich deren Wirkung im Rahmen einer
Konferenz selber erfahren durfte. Dort habe ich die Gelegenheit zur Reflexion und zum
Austausch über persönlich bedeutsame Themen und Fragen nutzen können. Diesen
Austausch sehe ich als ein bedeutendes Potential von Großgruppenverfahren, da er
Menschen motiviert sich für die eigenen Ideen Verantwortung einzubringen und
Verantwortung für sie zu übernehmen. Darum sehe ich Großgruppenverfahren als eine
Möglichkeit, um Menschen für ein Engagement zu gewinnen.
4
Im Folgenden werde ich zunächst das Thema der Arbeit einführen und daraufhin den
Aufbau der Arbeit erklären.
Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Frage, warum das Thema bürgerschaftliches
Engagement bedeutsam und derzeit aktuell ist. Die Aktualität des Themas spiegelt sich
unter anderem in der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen ,,Enquete-Kommission
Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements" wieder. Außerdem wurde im Juli 2007 ein
Gesetz
1
zur Förderung von Engagement im Bundestag verabschiedet, das freiwillig
engagierte Personen mit Steuervergünstigungen belohnt (vgl. http://
www.bundestag.de/aktuellpresse/2007
, Stand 10.07.07). Das Gesetz wird damit
begründet, dass bürgerschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag zur
Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft leistet und daher der freiwillige Einsatz der Einzelnen
für die Gemeinschaft eine wichtige Ressource darstellt. Somit erkennt das Gesetz den
Zusammenhang zwischen bürgerschaftlichem Engagement und den positiven
Auswirkungen auf die Gesellschaft an. Durch das Engagement wird ein Beitrag zum
Sozialkapital und zur Demokratieentwicklung geleistet (vgl. Zimmer, Priller 2005: 49).
Neben dieser gesellschaftlichen Dimension investiert der Bürger in sein Humankapital. Er
fördert durch das Engagement seine individuellen Kompetenzen und kann sich ein
Netzwerk an Kontakten aufbauen (vgl. Keupp 2000: 7). Diese Aspekte (Sozialkapital,
Demokratieentwicklung, Humankapital) wirken sich positiv auf die Zukunftsfähigkeit der
Gesellschaft aus. Daher liegt eine Förderung von Engagement im Interesse des Staates.
Wünschenswert ist aus diesen Gründen eine Gesellschaft, in der die Bürger
2
sich aktiv am
Gemeinwohl der Gesellschaft beteiligen.
Daraus ergibt sich die Frage, welche Voraussetzungen Bürger mitbringen müssen, wenn sie
sich engagieren wollen. Es wird davon ausgegangen, dass das Individuum über gewisse
Kompetenzen
3
und Fähigkeiten, die ein bürgerschaftliches Engagement ermöglichen,
verfügen muss (vgl. Olk 2001: 34).
Dabei geht es in dieser Arbeit nicht um die Lernchancen, die das bürgerschaftliche
Engagement für den Einzelnen bietet, sondern um die Förderung von Engagement und um
1 Das Gesetz stärkt das bürgerschaftliche Engagement, indem es einen allgemeinen Freibetrag in Höhe von
500 Euro für alle Engagierten einführt, die nebenberuflich Einnahmen aus gemeinnützigen Tätigkeiten
erwerben. Das Gesetz geht aus einer Empfehlung der Enquete-Kommission zur ,,Zukunft des
bürgerschaftlichen Engaments" hervor (vgl.
http://www.bundestag.de/aktuell/presse/2007/pz_070706.html
,
Stand: 10.07.07).
2 In dieser Arbeit wird der Begriff des ,,Bürgers" allgemein und unabhängig vom Alter oder vom
Lebenshintergrund verstanden.
3 Der Kompetenzbegriff wird in Kapitel 2.4 definiert.
5
die Kompetenzen, die dafür vorausgesetzt werden. Die Förderung verstehe ich in dieser
Arbeit als eine pädagogische Aufgabe und arbeite heraus, wie sie mit Hilfe von
Großgruppenverfahren wahrgenommen werden kann.
Wenn die Bürger Kompetenzen für ein bürgerschaftliches Engagement benötigen, so
müssen hierfür Räume und Gelegenheiten geschaffen werden, in denen die Bürger die an
sie gestellten Anforderungen erfahren und erlernen können (vgl. Heinze, Olk 2001: 64).
Als Pädagoge interessiert mich, wie solche Lerngelegenheiten in Form von Lern- und
Erfahrungsräumen für die Bürger gestaltet werden können, damit sie sich zur Förderung
der relevanten Kompetenzen eignen. Diese Frage soll vor dem Hintergrund der Theorie des
Konstruktivismus reflektiert werden. Aus der Theorie des Konstruktivismus lassen sich die
Ermöglichungsdidaktik und damit verbundene didaktischen Prinzipien ableiten (vgl.
Arnold, Schüßler 1998: 116 ff.). Diese didaktischen Prinzipien möchte ich einführen, weil
sie Hinweise auf die Gestaltung von Lern- und Erfahrungsräumen bieten und diese sich
förderlich auf die Kompetenzentwicklung der Lernenden auswirken.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche methodischen Arrangements sich im Detail für
die Umsetzung der didaktischen Prinzipien eignen. Hier wurden Großgruppenverfahren als
Lern- und Erfahrungsraum ausgewählt, weil ein Bezug zur Förderung von Engagement
herzustellen ist. Weiterhin werden die Verfahren Open Space, Zukunftskonferenz und
Appreciative Inquiry vorgestellt.
Großgruppenverfahren verfolgen im Allgemeinen das Ziel, dass sie eine große Gruppe von
Menschen (mindestens 25 Personen) zur Beteiligung anregen. Die Teilnehmer sollen
gemeinsam eine Gelegenheit haben, unabhängig von ihrer Herkunft einen Dialog zu führen
und ihre gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Dabei werden Aspekte wie die Kooperation
mit anderen und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, geübt (vgl. Weber
2005: 20). Diese Aspekte sind für das bürgerschaftliche Engagement ebenfalls eine
wichtige Voraussetzung. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwieweit
Großgruppenverfahren einen möglichen Lern- und Erfahrungsraum zur Entwicklung der
geforderten Kompetenzen darstellen und somit zur Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements geeignet sind.
6
Die zentrale Fragestellung der Arbeit befasst sich also mit der Eignung von
Großgruppenverfahren als Lern- und Erfahrungsraum zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement.
Die Annäherung an diese Thematik lässt sich durch folgende Fragen konkretisieren:
Warum ist eine Förderung von bürgerschaftlichem Engagement bedeutsam?
Welche Anforderungen (im Sinne von Kompetenzen) werden an das
bürgerschaftlich engagierte Individuum gestellt?
Wie soll ein Lern- und Erfahrungsraum gestaltet sein, der sich zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement eignet?
Inwieweit stellen Großgruppenverfahren geeignete Lern- und Erfahrungsräume
dar?
Meinen Fragestellungen liegen folgende Hypothesen zugrunde:
Die Förderung von Engagement ist sowohl auf einer gesellschaftlichen wie einer
individuellen Eben bedeutsam.
Für ein Engagement benötigen die Bürger gewisse Kompetenzen, unter anderen
Selbstorganisation und Gemeinsinn.
Wenn die Kompetenzen für ein Engagement gefördert werden sollen, sind
ermöglichende Lern- und Erfahrungsräume dafür geeignet.
Großgruppenverfahren als Lern- und Erfahrungsräume eignen sich zur Förderung
von bürgerschaftlichem Engagement.
1.2 Aufbau der Arbeit
Im zweiten Kapitel wird der Begriff des bürgerschaftlichen Engagements und der
Bürgergesellschaft erklärt. Zur Verdeutlichung werden Formen und Bereiche von
Engagement skizziert. Im Anschluss wird herausgearbeitet, warum das bürgerschaftliche
Engagement bedeutsam ist und daher eine Förderung Relevanz hat. Weiter wird
beschrieben, welchen Einfluss die Individualisierung auf das Engagement hat.
Nachfolgend werden ausgewählte notwendige Kompetenzen für das bürgerschaftlich
engagierte Subjekt beschrieben. Zuvor wird hierzu der Begriff der Kompetenz definiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Lern-und Erfahrungsräumen. Dieser Begriff soll
zunächst beschrieben werden. Der Konstruktivismus wird weiter als theoretische Basis
7
angeführt und als Theorie des Erkennens vorgestellt. Darauf aufbauend wird das Lernen
aus konstruktivistischer Perspektive veranschaulicht und die Ermöglichungsdidaktik so wie
eine Auswahl zugehöriger didaktischer Prinzipien vorgestellt. Die Rolle der Lernenden
sowie der Begleitenden in einem solchen Lernprozess werden in den Blick genommen.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Konzeption, dem Hintergrund und den Zielen
von Großgruppenverfahren. Nachfolgend wird das methodische Vorgehen beschrieben,
was als Leitfaden zur Analyse der Verfahren und ihrer Eignung zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement dient. Die Kriterien für die Analyse bilden die
didaktischen Prinzipien, die Rolle der Lernenden und der Begleitung in den
Großgruppenverfahren und die dargestellten Kompetenzen. Darauf aufbauend werden drei
ausgewählte Verfahren vorgestellt und analysiert: Die Open Space Technology, die
Zukunftskonferenz und das Appreciative Inquiry, im Deutschen bekannt als
wertschätzende Erkundung. Die Analyse dieser Verfahren ist in Hinblick auf ihre Eignung
zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement relevant. Es wird untersucht, wie sie
eine ermöglichende, kompetenzförderliche Struktur anbieten.
Das fünfte Kapitel diskutiert abschließend aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse,
wie sich Großgruppenverfahren als Lern- und Erfahrungsraum zur Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement eignen. Es werden weitere Aspekte aufgezeigt, um welche
die Großgruppenverfahren zur Förderung von Engagement ergänzt werden können.
Die Arbeit fasst abschließend die wesentlichen Erkenntnisse zusammen und weist auf offen
gebliebene Fragen hin.
8
2
Das bürgerschaftliche Engagement
Bürgerschaftliches Engagement ist ein aktuelles Thema in den Medien und in der Politik.
Dies erkennt man zum Beispiel daran, dass das Jahr 2001 von den vereinten Nationen zum
Internationalen Jahr der Freiwilligen gewählt worden ist (vgl. Heinze, Olk 2001: 19).
Bürgerschaftliches Engagement drückt sich dadurch aus, dass Privatpersonen sich in
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen freiwillig einsetzen und auf diesem Weg
ihren Beitrag zum Gemeinwohl leisten. Sie übernehmen z.B. die Verantwortung als
Vorstandsmitglied in einem Verband oder Leiter einer Jugendgruppe. Andere Varianten
sind Zusammenschlüsse in Selbsthilfegruppen oder die Beteiligung an Bürgerbegehren.
Die Formen und Facetten des Engagements sind vielfältig. Sie stärken durch die freiwillig
erbrachten Leistungen ,,die Zukunftsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft"
(Enquete-Kommission 2002: 24), da sie den Zusammenhalt der Gemeinschaft fördern.
Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie der Begriff bürgerschaftliches Engagement
genauer zu verstehen ist. Dabei werden seine verschiedenen Formen skizziert und die
aktive Bürgergesellschaft als Ziel von bürgerschaftlichem Engagement vorgestellt.
Weiterhin wird gefragt, welche Relevanz das Engagement für die gesellschaftliche und die
individuelle Ebene hat. Mein Ziel hierbei ist es herauszufinden, ob eine Förderung von
bürgerschaftlichem Engagement aus pädagogischer Perspektive sinnvoll ist. Auf der
gesellschaftlichen Ebene wirkt sich Engagement auf Aspekte wie das Sozialkapital aus.
Auf der individuellen Ebene beeinflussen Individualisierungsprozesse die
Engagementmotivation. Beispielsweise wird die herkömmliche Motivation, sich
solidarisch zu zeigen, um den Wunsch ergänzt, sich persönlich weiter zu entwickeln. Ich
gehe davon aus, dass im Zuge dieser Prozesse vom engagierten Subjekt auch
Kompetenzen erforderlich sind, wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Selbstorganisation.
Darüber hinaus ist die Gemeinsinn-Kompetenz notwendig. Mögliche Kompetenzen
werden in Kapitel 2. 4 beschrieben.
9
2.1 Der Begriff ,,bürgerschaftliches Engagement"
Der Begriff bürgerschaftliches Engagement ist von der Enquete-Kommission ,,Zukunft des
bürgerschaftlichen Engagements" des Deutschen Bundestages geprägt worden und findet
vielfach in Diskussionen um dieses Thema Erwähnung. Diese Kommission ist 1998 vom
deutschen Bundestag unter der Regierung von Gerhard Schröder ins Leben gerufen
worden. Ihre Aufgaben bestehen in der Entwicklung konkreter Strategien und Maßnahmen
zur Engagement-Förderung (vgl. Enquete-Kommission 2002: 2).
Bürgerschaftliches Engagement verweist auf die Verbindung zwischen Engagement und
Bürgerschaft (vgl. Zimmer/ Vilain 2005: 7). Die Enquete-Kommission betont mit der
Begriffswahl, dass Engagement als individuelles Handeln in politischen, gesellschaftlichen
oder sozialen Bereichen verstanden werden kann. Der Begriff der Bürgerschaft akzentuiert
die Verantwortung des Bürgers für die Gesellschaft, der durch sein Handeln zugleich
Teilhabe an der Gesellschaft ausübt (vgl. Enquete-Kommission 2002: 24).
Bürgerschaftliches Engagement umfasst mehr als die politische Meinungsbildung und
betont das ,,Interesse an den Leistungen und Gestaltungskompetenzen der Bürger für das
Gemeinwesen" (ebd.: 24) in unterschiedlichen Bereichen. Die Enquete-Kommission
definiert den Begriff folgendermaßen:
,,Bürgerschaftliches Engagement ist eine freiwillige, nicht auf das Erzielen eines
persönlichen materiellen Gewinns gerichtete, auf das Gemeinwohl hin orientierte,
kooperative Tätigkeit. Sie entfaltet sich in der Regel in Organisationen und Institutionen im
öffentlichen Raum der Bürgergesellschaft. Selbstorganisation, Selbstermächtigung und
Bürgerrechte sind die Fundamente einer Teilhabe und Mitgestaltung der Bürgerinnen und
Bürger an Entscheidungsprozessen. Bürgerschaftliches Engagement schafft Sozialkapital,
trägt damit zur Verbesserung der gesellschaftlichen Wohlfahrt bei und entwickelt sich, da es
von den Bürgerinnen und Bürgern aus der Erfahrung des Lebensalltags gespeist wird, als
offener gesellschaftlicher Lernprozess. In dieser Qualität liegt ein Eigensinn, der über den
Beitrag zum Zusammenhalt von Gesellschaft und politischem Gemeinwesen hinausgeht."
(ebd.: 40).
10
In dieser Definition werden die Eigenschaften von bürgerschaftlichem Engagement
4
hervorgehoben. Betont wird die Freiwilligkeit und Gemeinwohlorientierung der Bürger,
die so zu einer Stärkung des sozialen Kapitals beitragen und gesellschaftliche Lernprozesse
anregen. Die Selbstorganisation ist ein zusätzlicher Aspekt, der auf die selbstbestimmte
Entscheidung der Bürger für ein Engagement hinweist. Nach dieser Definition zählt bereits
die Beteiligung an Entscheidungs- und Beteiligungsprozessen zu bürgerschaftlichem
Engagement. Da Großgruppenverfahren
5
für ein solches Ziel geeignet sind, kann eine
Teilnahme nach der oben genannten Definition bereits als Engagement verstanden werden.
Ein weiterführendes Verständnis von Engagement haben Heinze und Olk. Sie treffen eine
Unterscheidung zwischen bürgerschaftlichen Formen und Formen von Engagement. Nach
ihrer Auffassung zählen freiwillige Zusammenschlüsse im privaten Bereich nicht zu
bürgerschaftlichem Engagement. Zwei entscheidende Kriterien sind für sie die
Öffentlichkeit, d.h. die Zugänglichkeit für andere Bürger und das Gemeinwohl, d.h. der
Einsatz zum Wohl der Gesellschaft (vgl. Heinze, Olk 2001: 13). Sie heben diese Kriterien
hervor, da die Begriffsverwendung laut Heinze und Olk im wissenschaftlichen Diskurs
mehrdeutig ist. Der Begriff umfasst häufig sowohl Aspekte aus den Bereichen der
Ehrenamts- und Selbsthilfeforschung, der Forschung zur politischen Partizipation sowie
der Forschung im Bereich des Dritten Sektors
6
und wird in all diesen Feldern verwendet
(vgl. ebd.: 13). Die Mehrdeutigkeit des Begriffes wird auch von Priller kritisch betrachtet
(vgl. Priller 2002: 50). Dabei sei die unzureichende theoretische Fundierung der Thematik
problematisch, da dies den direkten Vergleich von Forschungsergebnissen erschwere (vgl.
ebd. 2002: 50)
7
. Klages dagegen kommt zu dem Schluss, dass ein Vergleich der
4 Die Enquete- Kommission grenzt sich ab von der ursprünglichen Begriffsbedeutung ,,Ehrenamt" , der
innerhalb der Diskussion häufig genannt wird. Das Ehrenamt ging aus dem preußischen Staat hervor, welcher
zu Beginn des 19. Jahrhunderts aufgrund finanzieller Schwierigkeiten eine Verwaltungsreform durchführte.
In diesem Zusammenhang sind Aufgaben der Verwaltung bzw. des Staates unentgeltlich durch
,,Ehrenmänner" ausgeführt worden, die zur Übernahme dieser Aufgaben für drei Jahre verpflichtet wurden.
Die Bereitschaft zur Erfüllung dieser Ämter war dementsprechend nicht freiwillig, sondern durch den Staat
verordnet (vgl. Zimmer/ Vilain 2005: 8). Andere Traditionen des Ehrenamtes sind zurückzuführen auf die
Wohltätigkeit durch Privatpersonen, die sich selbst organisiert zur Lösung von lokalen Schwierigkeiten wie
Armut einsetzten. Engagement, das auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert, gewann durch die ab der Mitte
des 19.Jahrhunderts entstehenden Wohlfahrtsverbände an Bedeutung (vgl. Sachße 2002: 25).
5 Großgruppenverfahren werden in Kapitel 4 diskutiert. Sie werden verstanden als Veranstaltungsformen, in
denen Dialog und Austausch vieler Menschen möglich ist (vgl. Weber 2002: 17).
6 Der dritte Sektor beschreibt jene Organisationen, die sich von Staat, Markt und Familie abgrenzen (vgl.
Priller, Zimmer 2005:50, Kap. 2.1.2)
7 Priller fordert weitere Forschungen auf allen Ebenen und Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements.
Es fehlt derzeit an Strukturen und langfristiger Orientierung, wenngleich die Anzahl quantitativer
Untersuchungen zugenommen hat. Unzureichend geklärt sei zudem die Frage der Wirkungen,
Voraussetzungen und Zusammenhänge von Engagement. Auf der Ebene des Bürgers und seiner
Lebensumwelt müsse die Wirkung von geforderter Flexibilität und Mobilität am Arbeitstplatz und dessen
Wirkung auf das Engagement einbezogen werden (vgl. Priller 2002: 51 f).
11
Forschungsergebnisse bedenklich ist, da es im Bereich empirischer Erhebungen bisher
keine Standards gibt (vgl. Klages 1999: 101 f).
Eine Übereinstimmung besteht laut Heinze und Olk in den aktuell vorliegenden
Definitionen darin, dass es sich bei bürgerschaftlichem Engagement um Tätigkeiten
handelt, die ,,im weiten Handlungsfeld zwischen der Privatsphäre der Einzelnen, dem
Bereich des Marktes und der staatlichen Handlungssphäre" (Heinze, Olk 2001: 14), dem so
genannten dritten Sektor, stattfinden.
Ich möchte mich in dieser Arbeit auf das Begriffsverständnis der Enquete-Kommission
beziehen. Engagement wird hierbei verstanden als ein freiwilliges Handeln von Individuen.
Dies findet selbstorganisiert statt und ist am Wohl der Gemeinschaft orientiert. Der Begriff
soll wie bei Heinze und Olk das breite Spektrum ,,Ehrenamt, Selbsthilfe, politische
Partizipation, politischer Protest, ziviler Ungehorsam, freiwillige soziale Tätigkeiten"
umfassen und diese Aspekte miteinander verknüpfen (Heinze, Olk 2001: 15).
Um zu zeigen, welche Handlungsfelder der Begriff konkret umfasst, werde ich
nachfolgend unterschiedliche Formen von Engagement aufzeigen.
2.1.1 Formen und Bereiche von Engagement
Die Enquete-Kommission klassifiziert verschiedene Bereiche von Engagement:
Sie führt zunächst das
klassische Engagement
in Wohlfahrtsverbänden
8
,
Jugendorganisationen oder Kirchengemeinden an. Klassisches Engagement charakterisiert
sich durch die freiwillige Verantwortungsübernahme von Verbands- oder
Gemeindemitgliedern, beispielsweise im Bereich von Vorstandstätigkeiten oder der
Leitung von Jugendgruppen (vgl. Enquete-Kommission 2002: 27).
Auch das soziale Engagement kann über die Mitgliedschaft in einem Wohlfahrtsverband
erfolgen. Neuere Formen sozialen Engagements sind Gruppen, die Asylbewerber
unterstützen oder ,,Tafel-Einrichtungen", die Mahlzeiten an bedürftige Menschen verteilen
(vgl. ebd.: 27).
Die Beteiligung im Stadtrat, in Parteien, die Mitarbeit in Bürgerinitiativen oder lokalen
Agenda-21-Gruppen bezeichnet die Enquete-Kommission dagegen als politisches
8 Bekannte Wohlfahrtsverbände in Deutschland sind der Deutsche Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) oder das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Die Tätigkeiten der Verbände sind ausgerichtet an religiösen,
politischen oder humanitären Überzeugungen (vgl. http://www.bagfw.de/?id=338, Stand: 12.08.07).
12
Engagement (vgl. ebd.: 27).
Nachbarschaftshilfe oder Tauschringe werden als Formen der Gegenseitigkeit benannt.
Hierbei ist entscheidend, dass Menschen andere Personen der Nachbarschaft in alltäglichen
Belangen unterstützen (vgl. ebd.: 27). Dies umfasst beispielsweise den Einkauf oder
Behördengänge für ältere Menschen.
Auch Selbsthilfegruppen sind als Formen von Engagement zu verstehen. Der Austausch
innerhalb dieser Gruppen und die gegenseitige Unterstützung in diversen Bereichen wie
Gesundheit, Familie oder Arbeitslosigkeit ist hier kennzeichnend (vgl. ebd.: 27).
Relativ neu ist dagegen die Wahrnehmung des Engagements von Unternehmen in
gesellschaftlich relevanten Bereichen, welches sich sowohl durch finanzielle Spenden oder
Sachmittel als auch durch personellen Einsatz auszeichnet. Im Fachjargon wird dies als
,,Corporate Citizenship" oder ,,Corporate Social Responsibility" bezeichnet. Laut Enquete-
Kommission können Unternehmen ebenfalls als Akteure bürgerschaftlichen Engagements
auftreten, wenn sie zum Beispiel lokale Einrichtungen oder Vereine bei der Durchführung
ihrer Projekte unterstützen (vgl. ebd.: 27 f.). Folgt man jedoch der zu Anfang erläuterten
Definition der Enquete-Kommission, wonach Engagement als das freiwillige Handeln von
Individuen bezeichnet wird, so ist die Einteilung einer Organisation oder eines
Unternehmens in den Bereich bürgerschaftlichen Engagements als kritisch zu betrachten.
Gleichwohl handelt es sich um Aktivitäten, die am Gemeinwohl orientiert sind.
In der vorliegenden Arbeit sollen die oben genannten von der Enquete-Kommission
definierten Engagementformen anleitend sein. Gemeinsame Kriterien sind, dass es sich um
Tätigkeiten handelt, die sowohl selbstorganisiert als auch gemeinwohlorientiert sind (vgl.
Olk, Heinze 2001: 15; Enquete-Kommission 2002: 28).
Die zentrale Fragestellung meiner Arbeit ist, warum eine Förderung von Engagement
sinnvoll ist. Damit engagierte Personen die Möglichkeit erhalten, sich am Gemeinwohl
orientiert zu verhalten, muss ihnen eine Plattform geboten werden, auf der dies
Engagement möglich ist. Der Begriff der Bürgergesellschaft beschreibt eine solche ideale
Gesellschaft, in der ihre Mitglieder sich aktiv einbringen. In dieser Gesellschaft soll eine
Struktur gegeben sein, in der das Engagement und die Mitwirkung der Bürger möglich ist.
Aus diesem Grund wird der Begriff der Bürgergesellschaft nachfolgend erklärt.
13
2.1.2 Das bürgerschaftliche Engagement in der
Bürgergesellschaft
Das bürgerschaftliche Engagement ist mit der Bürgergesellschaft
9
eng verbunden, da eine
solche Gesellschaft aus aktiven Menschen besteht, die sich am Gemeinwohl beteiligen
(vgl. Heinze, Olk 2001: 14). Das Ziel einer Bürgergesellschaft ist die Schaffung von
Strukturen, in denen Partizipation und Engagement möglich sind (vgl. Enquete-
Kommission 2002: 24).
Die Idee der Bürgergesellschaft wurde bereits in der Antike entwickelt. Aristoteles
beschreibt diese Form gesellschaftlicher Organisation als ein Ideal menschlicher
Lebensweise. In der Aufklärung betonen Montesquieu und Kant das Ideal der
,,Bürgergesellschaft" als Auflehnung gegen den absolutistischen Staat. Priller definiert
diesen als ,,Gesellschaft mündiger Bürger, die in freien Assoziationen kooperieren, zwar
unter der Herrschaft des Rechts, aber ohne Gängelung durch einen Obrigkeitsstaat" (Priller
2002: 39).
Der Begriff der Bürgergesellschaft
10
wird in den Überlegungen dieser Arbeit aus der
republikanischen Perspektive beschrieben, da sie sich an die oben ausgeführte Definition
von bürgerschaftlichem Engagement anschließen lässt. Diese Perspektive fokussiert die
,,Werte des Selbstbewusstseins, der Selbstverantwortung und Selbststeuerung" (Pankoke
2002: 74) eines Mitgliedes in der Gesellschaft. Auf der Grundlage von Grundrechten und
der Demokratie prägen und gestalten Bürger hier das Gemeinwohl. Betont wird der
,,bürgerschaftliche Charakter" (Heinze, Olk 2001: 14) von Engagement. Die Aktivitäten
und Handlungen der Bürger, die als aktive ,,citoyen" am Gemeinwesen beteiligt sind,
bilden ,,Bürgerkompetenzen" und ,,Bürgertugenden" aus (ebd.: 14). Man verbindet mit
Engagement einen aktiven und kompetenten Bürger, der sich mit der Gemeinschaft
9 Der Begriff der Zivilgesellschaft betont eher die politische Seite und die Aufgaben und
Verantwortlichkeiten für den öffentlichen Raum (vgl. Pankoke 2002: 75). Die Begriffe Zivilgesellschaft und
Bürgergesellschaft werden hier trotzdem synonym verwendet, da eine ausführliche Begriffsdiskussion an
dieser Stelle nicht geleistet werden kann.
10 Im Abgrenzung zu der republikanischen Perspektive betrachtet die liberale Auffassung Bürgergesellschaft
als den "gesellschaftlichen Ort von Freiheit, Privatheit und Individualität" (Olk 2001: 36). Die
kommunitaristische Perspektive versteht die Bürger als Mitglied und Zugehörige einer Gemeinschaft, in der
bestimmte Werte geteilt werden. Es besteht hier die Gefahr einer Vereinnahmung der Bürgergesellschaft
durch den Staat,der eine bestimmte ethische Orientierung vorgibt (z.B. die deutsche Leitkultur) (vgl. ebd:
38). Der Begriff der Zivilgesellschaft, welcher häufig gleich verwendet wird, betont eher die politische Seite,
die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im öffentlichen Raum (vgl. Pankoke 2002: 75).
14
identifiziert und die Bereitschaft mitbringt, sich in Entscheidungsprozessen einzubringen,
am Gemeinwohl orientiert zu handeln und nicht nur für sich selbst Verantwortung zu
übernehmen, sondern auch für andere (vgl. ebd.: 17). Von einem solchen Bürger wird
bürgerschaftliche Kompetenz erwartet. Diese ist für ein selbstbestimmtes Handeln im
Sinne der Gemeinschaft nötig und geht über ein Individuum, was nur persönlichen Nutzen
aus seinem Engagement zieht, hinaus (vgl. Braun 2002: 59).
Das Konzept der Bürgergesellschaft löst sich von der Auffassung, dass der Staat für alles
zuständig ist. Es gilt das Prinzip der ,,Subsidiarität": Kleinere Einheiten organisieren sich
zunächst selbstbestimmt, bevor die Kommune, das Land oder der Staat eingreifen. Ein
Engagement wird durch die Bürger ,,von unten" durchgeführt und stärkt auf diese Weise
das Gemeinwesen. Hierzu zählen auch kritische Stimmen und gegnerische Positionen zu
Staat und Verwaltung. Die Bürgergesellschaft setzt sich zusammen aus selbstbestimmten
und selbstorganisierten Bürgern, die entscheidend das kulturelle, soziale, politische und
gesellschaftliche Zusammenleben der Gesellschaft mitgestalten möchten (vgl. Enquete-
Kommission 2002: 24). Dieses Ziel kann über die Förderung von bürgerschaftlichem
Engagement verwirklicht werden.
Olk beschreibt die Bürger im Sinne der republikanischen Auffassung als ,,Mitglieder
unterschiedlicher Gemeinschafts- und Assoziationsformen, die an den öffentlichen
Angelegenheiten interessiert und gemeinsam mit Gleichgesinnten bestrebt sind, in
vielfältiger Weise an der Beförderung gemeinsamer Anliegen mitzuwirken" (Olk 2001:
39).
Eine Struktur für die aktive Bürgergesellschaft wird in dem bereits erwähnten dritten
Sektor
11
geboten. Die Bezeichnung dritter Sektor wurde vom amerikanischen Soziologen
Amitai Etzioni Anfang der 1970er Jahre eingeführt. Er beschreibt jene Organisationen, die
sich von Staat, Markt und Familie abgrenzen. Das Ziel des dritten Sektors ist im Gegensatz
zum freien Markt nicht die Gewinnmaximierung. Entstandene Gewinne werden nicht an
die Mitglieder ausgeschüttet, sondern erneut in die Organisation investiert. Spezifisch ist
die Ausrichtung an Elementen wie ,,Solidarität" und gesellschaftlicher ,,Sinnstiftung".
Organisationen wirken als ,,Wertgemeinschaften", d.h. es werden mit dem Handeln der
Mitglieder bestimmte Ziele, Werte und Visionen verfolgt. Diese Elemente sind für die
11 Alternativ wird für diesen Bereich die Bezeichnung intermediärer Sektor verwendet. Er bezieht sich auf
die integrative Funktion der Organisationen als ein Bindeglied zwischen Individuen und Gesellschaft und
unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen (vgl. Priller, Zimmer 2005: 51).
15
Motivation der freiwillig Handelnden entscheidend und eine wesentliche
Existenzgrundlage der Organisationen (vgl. Priller, Zimmer 2005: 50).
Der dritte Sektor zeigt die Fähigkeit der Gesellschaft, sich im Sinne einer
Bürgergesellschaft (siehe obige Begriffserklärung) unabhängig vom Staat, aber innerhalb
der rechtlichen Rahmenbedingungen selbständig zu organisieren. Bürgerinnen und Bürger
können als Mitglieder einer Organisation ihre Interessen artikulieren und in diesem
institutionellen Rahmen Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen (vgl. Heinze, Olk
2001: 17). Der dritte Sektor wirkt sich damit auf die Innovationskraft der staatlichen
Gemeinschaft aus, wobei die Aufgabe der staatlichen Verwaltung darin liegt,
Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Handlungsfähigkeit sicherstellen. Priller fordert
mehr Einsatz von Seiten des Staates durch das Schaffen von Strukturen, besonders auf der
kommunalen Ebene, um dort die Potentiale des dritten Sektors zu nutzen und zu sichern
(vgl. Priller 2002: 43).
Eine Konsequenz, die sich aus der Vision der Bürgergesellschaft ergibt, ist, dass eine
Kultur der Kooperation und Beteiligung durch den Staat, Institutionen und Unternehmen
gefördert werden sollte. In der Diskussion werden dem Staat Verantwortlichkeiten im
Sinne eines ,,ermöglichenden Staates" oder ,,aktivierenden Staates" zugeschrieben (vgl.
Enquete-Kommission 2002: 25). Zur Realisierung einer Idee der Bürgergesellschaft bedarf
es weiterhin einer neuen Aufteilung von Aufgaben zwischen Staat, Markt und
Bürgergesellschaft (vgl. Heinze, Olk 2001: 18). Der Staat ist angewiesen auf die
Selbstorganisation der individuellen sowie gesellschaftlichen Akteure, die diesen bei der
Erledigung von gesellschaftlichen Aufgaben unterstützen. Er hat dabei die Verantwortung
für die Schaffung von förderlichen Rahmenbedingungen, die die Eigenverantwortung zur
aktiven Mitwirkung in der Gesellschaft stärken (vgl. ebd.: 20).
Zusammenfassend besteht eine Bürgergesellschaft also aus Individuen, die
selbstorganisiert handeln und die Bereitschaft mitbringen im Sinne des Gemeinwohls zu
handeln. Im dritten Sektor sind bereits Strukturen geboten, die den Bürgern ein solches
Handeln ermöglichen. In einer aktiven Bürgergesellschaft versteht sich der Staat als
Rahmengeber und Ermöglicher dieser Struktur. Die Bürgergesellschaft kann als ein Ziel,
welches bei einer Förderung von bürgerschaftlichem Engagement verfolgt wird,
verstanden werden. Die Gestaltung einer aktiven Bürgergesellschaft kann unter anderem
eine pädagogische Aufgabe darstellen, da es um die Entwicklung und Ausbildung von
16
Bürgerkompetenzen und aus individueller Sicht um Lernen geht. Die
Kompetenzentwicklung kann z.B. in Bildungseinrichtungen gefördert werden, was
allerdings in dieser Arbeit nicht betrachtet wird.
Im Folgenden wird geklärt, aus welchen Gründen eine Gesellschaft aktiver Bürger
wünschenswert ist und welche positiven Konsequenzen Engagement für die Gesellschaft
so wie für das Individuum hat.
2.2 Die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements
In der Diskussion um die Relevanz des bürgerschaftlichen Engagements werden allgemein
zwei Perspektiven aufgegriffen. Zum Einen betrachtet eine Perspektive Engagement und
ihren Beitrag für die Gesellschaft. Zum Anderen sieht die liberal-individualistische Debatte
Engagement in Hinblick auf das Individuum. Beide Perspektiven werden in Bezug auf die
Frage, ob eine Förderung von Engagement sinnvoll ist, erläutert. Des Weiteren werden
empirische Befunde, die für eine Engagementförderung sprechen, dargestellt.
2.2.1 Engagement und der Beitrag für die Gesellschaft
Auf gesellschaftspolitischer Ebene sind mit dem Engagement verschiedene Erwartungen
verbunden. Es soll zur Entlastung des Sozialstaates, zu einer zukunftsfähigen Demokratie
und der Stärkung des Sozialkapitals in der Gesellschaft beitragen. Außerdem stellt es eine
Alternative in der Erwerbsarbeit dar (vgl. Heinze, Olk 2001: 12).
Entlastung des Sozialstaates
Das freiwillige, am Gemeinwohl orientierte und unentgeltliche Engagement soll zu einer
Entlastung des Sozialstaates beitragen. Die Erwartung ist, dass eine Umverteilung von
sozialen Verantwortlichkeiten und die Beteiligung durch Bürger zu einer finanziellen
Entlastung beiträgt (vgl. Heinze, Olk 2001: 12). Die Einbeziehung von Bürgern
beispielsweise in soziale Institutionen führt zu einer verbesserten Qualität und Leistung
(vgl. Sachße 2002: 3).
17
Zukunft der Arbeitsgesellschaft
In der Debatte zur Zukunft der Arbeitsgesellschaft wird Engagement als eine Alternative
zur herkömmlichen Erwerbsarbeit gesehen. Bei diesen Tätigkeiten besteht außerdem die
Möglichkeit zur individuellen Identitätsbildung (vgl. Heinze, Olk 2001: 12).
Förderung der Demokratie
Innerhalb der Demokratie-Debatte wird Engagement als Beitrag der Bürger zur
Weiterentwicklung der Demokratie gesehen (vgl. Keupp 2001: 69). Diese beteiligen sich
und bringen eigene Anliegen hervor. Eine ,,starke Demokratie" (Heinze, Olk 2001: 14)
benötigt Chancen für die Bürger, eigene Interessen ausdrücken, auf die Politik Einfluss zu
nehmen und handeln zu können (vgl. Heinze, Olk 2001: 14).
Beitrag zum Sozialkapital
Der Diskurs um das soziale Kapital, der auch als kommunitaristische Bewegung
bezeichnet wird, ist anfänglich intensiv durch den Soziologen Putnam und sein Buch
,,Bowling alone"
geprägt worden. Er nimmt gesellschaftliche Phänomene wie
Individualisierung
12
und Pluralisierung
13
in den Blick. Putnam erklärt, dass diese
Phänomene eine Bedrohung für das soziale Kapital der Gesellschaft darstellen, weil durch
sie die Bereitschaft der Bürger schrumpft, sich zu engagieren (vgl. Keupp 2000: 22). Das
soziale Kapital und damit die Qualität einer Gesellschaft, lassen sich an der Bereitschaft
der Bürger zu einem Engagement messen. Je mehr dies vorhanden ist, desto gefestigter ist
die Gesellschaft (vgl. Gensicke 2006: 9). Aus der Individualisierung wächst die Gefahr,
sich weniger zu solidarisieren und gemeinwohlorientiert zu handeln. Keupp weist
allerdings darauf hin, dass die Individualisierung nicht zwangsläufig eine Gefährdung
darstellt. Der Bezug zu Solidarität und Gemeinsinn ist jedoch neu zu bestimmen (vgl.
Keupp 2001: 73). Hierzu ist es nötig, den Begriff der Individualisierung näher zu
betrachten (vgl. Kap. 2.3).
12 Der Begriff Individualisierung wird in Kapitel 2.3 geklärt.
13 Pluralisierung betrifft die Vielfalt von Lebensformen und -einstellungen in der Gegenwart. Die
Kleinfamilie ist nur noch eine mögliche Lebensform, neben vielen anderen (z.B. Singlehaushalt,
alleinerziehendes Elternteil, getrennte Ehen) (vgl. Kober 2002:14)
18
Neben der gesellschaftspolitischen Bedeutung von Engagement, ist es aus pädagogischen
Gründen interessant, welche Vorteile der freiwillige Einsatz für das Individuum bietet. Dies
ist das Thema des liberal-individualistischen Diskurses.
2.2.2 Engagement und der Beitrag für das Individuum
Die liberal-individualistische Diskussion nimmt den Einzelnen, speziell seine Motive
und Interessen für das Engagement, in den Blick. Das Engagement wird hier als eine
Möglichkeit, das Humankapital des Einzelnen zu fördern, betrachtet (vgl. Heinze, Olk
2001: 21). Durch den persönlichen Einsatz bieten sich verschiedene Möglichkeiten, eigene
Interessen und Bedürfnisse zu verwirklichen. Der Bürger verspricht sich von der gezeigten
Kooperation und Solidarität, die Kosten durch einen subjektiven Nutzen auszugleichen.
Dieser Ansatz versteht Engagement als eine Form des Egoismus und eine persönliche
Angelegenheit, durch die Befriedigung und Sinn gestiftet wird. Werte, Pflichten und
Gebote nehmen eine weniger entscheidende Rolle ein (vgl. Braun 2002: 56 f).
Der freiwillige Einsatz dient dazu, einen wichtigen Beitrag zur eigenen Identitätsfindung
und Sinngebung des Lebens zu leisten. In der freiwilligen Aktivität bietet sich die Chance
zu experimentieren, sich auszuprobieren und das eigene Leben zu bewältigen. Es werden
wichtige Kompetenzen, die für die persönliche Zukunft bedeutsam sind, entwickelt. Durch
die Erfahrung, etwas bewirken und bewegen zu können, kann das Selbstbewusstsein
gestärkt und die eigene Persönlichkeit bereichert werden. Dies hat besonders für
Jugendliche eine große Bedeutung (vgl. Keupp 2000: 16, 62).
Der liberal-individualistische Diskurs geht von einem rational-kalkulierenden Individuum
aus, das als ,,Unternehmer in eigener Sache" vorsorgt. Das Subjekt steigert den eigenen
Marktwert in der Arbeitswelt (vgl. Heinze, Olk 2001: 21). Grundlage dieser Debatte ist die
individualisierte Gesellschaft, in der es nicht um die Frage geht, was ein Engagement für
das Gemeinwohl bedeutet, sondern um die Vorteile für das Individuum (vgl. Braun 2002:
57).
Aus pädagogischen Gründen ist es wertvoll, diese individuelle Dimension
bürgerschaftlichen Engagements zu erkennen. Sie betont die Chance zur persönlichen
19
Entwicklung und Kompetenzförderung der Individuen, die sich engagieren. Allerdings
reicht diese Position nicht aus, um die Förderung von bürgerschaftlichem Engagement zu
rechtfertigen, da eine Orientierung am Gemeinwohl fehlt. Wie bereits erwähnt, soll eine
Förderung die Bildung einer Bürgergesellschaft anstreben. Das Ziel einer
Bürgergesellschaft sind Personen, die bereit sind, auch in Zukunft für gesellschaftliche
Belange Verantwortung zu übernehmen. Dieses Ziel wird im individual-liberalistischen
Diskurs nicht beachtet.
Es ist wichtig, dass eine Förderung von Engagement die gesellschaftliche sowie die
individuelle Perspektive integriert. Die Notwendigkeit dieser Förderung wird durch
aktuelle empirische Befunde bestätigt. Aus diesem Grund werde ich nun Ergebnisse des
Freiwilligensurveys darstellen, der das Engagementpotential in der Gesellschaft prüft und
zeigt, welche positiven Effekte es auf die engagierten Personen hat und wie sich soziale
Benachteiligung auf Engagement auswirkt.
2.2.3 Empirische Befunde zum bürgerschaftlichen Engagement
Hinweise auf das bürgerschaftliche Engagement der deutschen Gesellschaft liefert der
Freiwilligensurvey, der 1999 und 2004 allgemeine Daten zu Freiwilligkeit und Ehrenamt
durch die Befragung von 15.000 Bürgern ab 14 Jahren mit einem Wohnsitz in Deutschland
erhoben hat
14
.
Die Ergebnisse zeigen, dass sich im Jahr 2004 36% der befragten Personen aktiv am
öffentlichen Leben beteiligten und gesellschaftliche, gemeinwohlorientierte Aufgaben und
Funktionen übernahmen. Dieser Wert ist im Vergleich zu der Umfrage von 1999 um 2
Prozentpunkte gestiegen (1999: 34%). Weitere 34% beteiligten sich 2004 (1999: 32%) am
öffentlichen Leben ohne die Übernahme einer Funktion. Insgesamt ergibt sich aus diesen
Werten, dass ca. 70% der Bevölkerung als gemeinschaftsaktiv zu bewerten sind. Die
Ergebnisse zeigen eine leicht steigende Tendenz, sich zu engagieren, die positiv zu
bewerten ist (vgl. Gensicke 2006: 10ff.). Wichtige Bereiche, für die Bürger sich einsetzen,
stellen die Sektoren ,,Sport", ,,Schule/Kindergarten" und der ,,soziale Bereich" dar (vgl.
14 Die Studie ist im Auftrag des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
durchgeführt worden und umfasst jene Tätigkeiten, die freiwillig und unbezahlt übernommen wurden (vgl.
Enquete-Kommission 2002: 26). Klages weist darauf hin, dass es durch das unterschiedliche Verständnis und
die diffuse Begriffsklärung im Bereich bürgerschaftlichen Engagements keine Standards im Bereich der
Messung gibt. Aus diesem Grund liegen keine einheitlichen Ergebnisse vor; weiter nötig sind langfristige
Erhebungen für verlässliche Aussagen in diesem Bereich (vgl. Klages 1999: 101 f.).
20
ebd.: 12). Unterschiede finden sich in der Intensität der freiwilligen Aktivitäten der
Personen. Die Skala umfasst gemeinschaftlich aktive Personen ohne die Übernahme einer
Funktion, bis hin zu Personen, die drei oder mehr Tätigkeiten ausführen (vgl. ebd.: 12ff.).
Zusätzlich kommt der Freiwilligensurvey zu dem Ergebnis, dass die Bereitschaft für eine
freiwillige Tätigkeit gewachsen ist. Generell sind 32% der nicht-engagierten Bevölkerung
bereit, sich zu engagieren (vgl. Gensicke 2005: 6). Das Potential zur Aktivierung von
Bürgern ist groß. Dazu bedarf es jedoch der richtigen Adressierung und des Angebots von
Gelegenheiten (vgl. Zimmer, Vilain 2000: 58). Keupp ist der Meinung, dass ein hohes
,,Aktivitätsniveau von 30 bis 40 Prozent" (Keupp 2000: 8) für Engagement vorhanden ist.
Ergänzend sieht Klages diese generelle Bereitschaft als ,,eine riesige schlafende
Ressource" (Klages 1998: 34) an. Die Ursachen für die fehlende Ausschöpfung des
Potentials liegen in mangelnden Gelegenheiten und fehlenden Informationen und Anstößen
für ein Engagement (vgl. Klages 1998: 34 ff.). Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass
eine Förderung von Engagement wichtig ist.
Die Untersuchung zeigt weiterhin, dass sich das Engagement auf die Personen positiv
auswirkt. Hier ist der bestehende Zusammenhang zwischen Engagement und
Wertorientierungen auffallend. Die Werte engagierter Personen weisen auf eine ,,kreative
und engagierte Lebensführung" hin, die bei Personen mit einem geringeren Engagement in
so einer Form nicht beobachtet werden kann (vgl. Gensicke 2006: 13). Hierzu gehört auch,
dass freiwillig Engagierte über ,,mehr Lebenszufriedenheit und einen positiveren
Zukunftsbezug" (Keupp 2000: 51) verfügen. Aus der Perspektive des Individuums zeigt
sich, dass Engagement eine Investition in die Zukunft ist. Es trägt zur Entwicklung von
beruflichen sowie sozialen Kompetenzen bei. Daneben wird ein persönliches Netzwerk
aufgebaut (vgl. Priller, Zimmer 2006: 24). Engagement trägt demnach zur sozialen
Integration in die Gesellschaft bei (vgl. Pankoke 2002: 74).
Ein anderer Aspekt ist, dass die Ergebnisse des Freiwilligensurveys auf deutliche soziale
Unterschiede im Bereich des freiwilligen Engagements hinweisen. Soziale
Benachteiligung erweist sich demnach als hinderlich für ein Engagement. Benachteiligte
verfügen offensichtlich in geringerem Maße über zentrale Ressourcen für ein Engagement
wie z.B. Bildung und Einkommen. In den Erhebungen zeigt sich, dass Bürger mit einem
besseren Bildungshintergrund und einer höheren beruflichen Position sich häufiger
engagieren (vgl. Filsinger 2000: 45, Gensicke 2006: 13). Allerdings wird auch deutlich,
21
dass die Gesamtquote und das Potential in der Gruppe der Senioren, bei den Arbeitslosen
und Personen mit Migrationshintergrund im Vergleichszeitraum gestiegen ist (vgl.
Gensicke 2005: 6).
Dennoch stellt sich die Frage, wie insbesondere benachteiligte und bildungsferne
Schichten besser unterstützt werden können, sodass diese für gesellschaftliche Belange
eintreten und gleichzeitig ihre eigenen Perspektiven verbessern können (vgl. Filsinger
2000: 61). Ebenso muss man nach den gesellschaftlichen Ursachen für die Passivität
bestimmter Gruppen suchen (vgl. Pankoke 2002: 75). Wendt spricht sich dafür aus,
benachteiligte Menschen in ihrer Situation beratend zu unterstützen und die
Selbstverantwortung dieser Zielgruppe zu aktivieren (vgl. Wendt 1996: 67). Filsinger
betont, dass für eine Förderung eine gezielte lokale Planung und Umsetzung nötig ist, die
an vorhandenen Ressourcen ansetzt und den Bürgern ein selbstorganisiertes Agieren
ermöglicht (vgl. Filsinger 2000: 60).
Zusammenfassend zeigt sich, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich bereits freiwillig
engagiert und zusätzlich weiteres Potential vorliegt. Das verdeutlicht, dass eine Förderung
und Nutzung dieser Potentiale erstrebenswert ist. Ein weiterer Grund ist die Feststellung,
dass das Engagement zur persönlichen Entwicklung von Kompetenzen und zur sozialen
Integration in die Gesellschaft beiträgt. Daneben sind soziale Unterschiede sichtbar, die die
Frage aufwerfen, wie insbesondere benachteiligte Gruppen besser gefördert und unterstützt
werden können.
Die genannten Aspekte machen deutlich, dass sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene als
auch auf der individuellen Ebene eine Förderung von Engagement sinnvoll ist. Die
empirischen Befunde bestätigen dies. Einen großen Einfluss auf das Engagement haben die
Folgen der Individualisierung, die sich auf eine veränderte Motivation auswirken. Da
dieser Aspekt bei einer Förderung berücksichtigt werden sollte, werde ich nachfolgend
darauf eingehen.
22
2.3
Individualisierung und der Einfluss auf die Motive für ein
Engagement
Für eine Beantwortung der Frage nach dem Einfluss von Individualisierungsprozessen auf
das bürgerschaftliche Engagement und den Motiven, welche Individuen mit einem
Engagement verbinden, wird in diesem Kapitel zunächst der Begriff der Individualisierung
erläutert. Anschließend werden mögliche Konsequenzen aufgezeigt, die sich hieraus für
das Engagement ergeben.
Mit dem Begriff der Individualisierung wird eine Lösung von traditionellen sozialen
Bindungen und Beziehungsnetzen wie der Familie und Verwandtschaft und von
traditionellen Orientierungen verbunden. Die Pluralität von Lebensformen und
Überzeugungen sind dafür charakteristisch. Die Grundlage gemeinsamer Werte ist nicht
mehr zwangsläufig gegeben. Eine Folge dieser Loslösung ist die Erweiterung individueller
Handlungsoptionen und Spielräume (vgl. Keupp 2000: 26).
Die Individualisierungstendenz lässt sich unter anderen durch die zunehmend geforderte
Flexibilität und Mobilität an Arbeitsplätzen begründen (vgl. Zimmer 2005: 103). Die
Normalbiographie, im Sinne von kontinuierlicher Erwerbsarbeit, löst sich aufgrund
unsicherer Beschäftigungsverhältnisse auf. Menschen sind vor diesem Hintergrund zur
Individualisierung gezwungen, d.h. sie müssen flexibel und mobil auf die Anforderungen
des Marktes reagieren. Eine weitere Anforderung ist, dass die Menschen den individuellen
Erwerbsverlauf, d.h. ihre Wahlbiographie gestalten müssen (vgl. Kühnlein, Mutz 1999:
292). Wittwer beschreibt die künftige Biographie als einen ,,Flickenteppich", der sich aus
unterschiedlichen Phasen wie Ausbildung, Umschulungen, Erwerbstätigkeit,
Arbeitslosigkeit etc. zusammensetzt (vgl. Wittwer 2003: 24). Diese Veränderungen haben
zur Folge, dass die Menschen künftig vor erhöhte Anforderungen gestellt werden, da sie
sich auf kontinuierlich wechselnde Lebenssituationen einstellen müssen (vgl. ebd.: 24).
Noelle-Neumann sieht des Weiteren eine kulturpessimistische Tendenz. Sie ist der
Auffassung, dass ein Bindungsverlust an die Gemeinschaft entsteht und die Bereitschaft
für ein Engagement sinkt (vgl. Hepp 2001: 31). Keupp ist dagegen der Meinung, dass
Individualisierung nicht zwangsläufig eine Vereinsamung und Gemeinschaftslosigkeit der
Individuen bedeutet. So zeichnen sich Beziehungsnetze in der Gegenwart vielmehr durch
23
strukturelle Offenheit aus. Menschen können sich ein eigenes Netzwerk aufbauen, wobei
persönliche Interessen und Bedürfnisse im Vordergrund stehen (vgl. Keupp 2000: 28 f).
Der Mensch ist also durch die Individualisierung gefordert, das eigene Leben konstruktiv
zu gestalten und selbst zu bestimmen: Er muss die eigene Lebensform wählen, die
persönliche Erwerbsbiographie gestalten und Beziehungen und Netzwerke aufbauen, da
traditionelle Bindungen sich lösen. Ich habe zu Beginn dieses Kapitels die Frage gestellt,
wie sich die Phänomene der Individualisierung auf die Motivation für ein
bürgerschaftliches Engagement auswirken, was nachfolgend geklärt wird.
In Hinblick auf das Engagement wird deutlich, dass das Individuum mit dem Engagement
zunehmend das Interesse verbindet, sich persönlich weiter zu entwickeln und eigene
Interessen zu verwirklichen. Das Interesse zur Selbstverwirklichung ist aber nicht mit einer
,,Egomentalität" (Klages 1999: 103) gleichzusetzen. Selbstentfaltungswerte gewinnen
gegenüber Pflichten an Bedeutung (vgl. ebd.: 103). Die Orientierung am Gemeinwohl ist
damit aber nicht ausgeschlossen. Die beiden Pole, Engagement aus Solidarität und aus
Selbstverwirklichungsgründen, stehen vielmehr in einem Ergänzungsverhältnis zueinander
(vgl. Kober 2002: 19). Klages präsentiert im Rahmen einer empirischen Forschung
15
zum
Engagement ein Nebeneinander von Motiven wie Gemeinschaftsorientierung, individueller
Verwirklichung, Bürgerpflicht und Aktivsein (vgl. Klages 1999: 104). Der
Freiwilligensurvey bestätigt ebenfalls, dass ein Engagement nicht aus rein
individualistischen Zwecken durchgeführt wird. Der Aussage ,,Ich will durch mein
Engagement die Gesellschaft zumindest im Kleinen mitgestalten" stimmten 66% der
befragten engagierten Personen zu. Eine hohe Motivation liegt ebenfalls darin, andere
Menschen zu treffen (60 %). Das Gefühl sozialer Pflicht wird vor allem von älteren
Menschen genannt, wohingegen der Wunsch nach persönlicher Entfaltung vor allem bei
den Jüngeren anzutreffen ist (vgl. Gensicke 2006: 14).
Es zeigt sich also, dass Engagement sich aus verschiedenen Motiven zusammensetzt. Die
Orientierung an der Gemeinschaft ist nicht aufgehoben, sondern wird um das Motiv der
Selbstverwirklichung ergänzt. Eine Ursache bildet die Individualisierung: Sie erfordert,
dass das Individuum flexibel entscheidet und die eigene Biographie gestaltet.
15 Die Studie ,,Wertewandel und bürgerschaftliches Engagement" wurde mit 3000 Befragten durch Infratest
für das Forschungsprojekt ,,Wertewandel in Deutschland in den neunziger Jahren" durchgeführt (vgl. Klages
1999: 104).
24
Die Konsequenz ist ein qualitativer Wandel der Voraussetzungen für ein Engagement. Das
Bedürfnis, ,,Subjekt des eigenen Handelns zu sein" und damit verbunden der Wunsch
danach einen eigenen Handlungsspielraum zu haben, ist gewachsen (vgl. Hepp 2001: 32).
Das traditionelle Engagement (z.B. in Wohlfahrtsverbänden) verliert gegenüber
unkonventionellen Formen (z.B. in Selbsthilfegruppen) an Bedeutung; im Diskurs zum
bürgerschaftlichen Engagement wird dies als Wandel von einem alten Ehrenamt zum
neuen bezeichnet (vgl. Beher et al. 2001: 255 f.). Veränderungen wirken sich wie folgt aus:
Die engagierten Personen wünschen sich eine zeitliche Vereinbarkeit von
freiwilligen Tätigkeiten mit anderen Interessen. Sie benötigen Autonomie und
Gestaltungsfreiheit. Projektorientierte, zeitlich begrenzte Formen von Engagement
sind hierzu geeignet (vgl. Hepp 2001: 36).
Mit dem Engagement ist die Erwartung, eigene berufliche Möglichkeiten zu
fördern. Das Interesse der Individuen, sich selber zu entfalten, kann sich
begünstigend auf die Bereitschaft zu einem Engagement auswirken (vgl. Hepp
2001: 36 f). Heinze und Strünck empfehlen, dass eine ,,biographische Passung"
ermöglicht werden soll. Die aktuelle Lebenssituation und damit verbundene Motive
sollen mit den Gelegenheiten für ein Engagement verknüpft werden (vgl. Heinze,
Strünck 2001: 236). Fänderl weist darauf hin, dass eine Motivation von innen
(intrinsische Motivation) sich positiv auf die Bereitschaft zur Übernahme von
Verantwortung auswirkt. Dieser Aspekt sollte berücksichtigt werden (vgl. Fänderl
2005:37).
Mit der Individualisierung sind erhöhte Anforderungen an das Individuum verbunden, die
sich ebenfalls auf das Engagement auswirken: Hierfür benötigt es die Fähigkeit, die
eigenen Interessen und Bedürfnisse zu reflektieren. Das Individuum muss sich
beispielsweise bei der Entscheidung für ein Engagement orientieren können (In welchem
Bereich möchte ich mich überhaupt engagieren?). Daneben ist die Fähigkeit zur
Kooperation mit anderen Personen entscheidend. Kompetenzen, die für einen Bürger nötig
sind, werden im nächsten Teil spezifischer betrachtet.
25
2.4
Kompetenzanforderungen an einen Bürger in einer
Bürgergesellschaft
Die Entwicklung von Kompetenzen ist eine wichtige Grundvoraussetzung zur Förderung
von Engagement, da dies benötigt wird, um aktiv für das Gemeinwohl eintreten zu können.
Die Förderung dieser Kompetenzen kann als eine pädagogische Aufgabe verstanden
werden.
Aus diesem Grund wird im folgenden Abschnitt der Frage nachgegangen, welche
Kompetenzanforderungen an das bürgerschaftlich engagierte Individuum gestellt werden.
Einleitend wird der Begriff der Kompetenz erklärt. Anschließend werden spezifische
Kompetenzen, die für das bürgerschaftliche Engagement bedeutsam sind, aufgezeigt.
Dabei liegt der Schwerpunkt in meinen Ausführungen auf den Anforderungen selbst und
weniger auf dem Kompetenzbegriff. Aufbauend auf Kapitel 2.1.2 stellen die Fähigkeit zum
Gemeinsinn und die Kompetenz zur Selbstorganisation die Basis für die folgenden
Überlegungen dar. Diese sind vor dem Hintergrund einer aktiven Bürgergesellschaft
angestellt worden (vgl. Olk 2001: 43). Der Anspruch auf Vollständigkeit kann dabei nicht
gewährleistet werden, da ein Engagement in den verschiedenen Bereichen eine Vielzahl
von Kompetenzen erfordert.
2.4.1 Der Begriff der Kompetenz
Es zeigt sich, dass der Begriff der Kompetenz in der Debatte um eine Bürgergesellschaft
vermehrt genannt, jedoch kaum definiert wird. Für ein einheitliches Verständnis soll an
dieser Stelle dennoch der Versuch einer Definition vorgenommen werden und ein
Begriffsverständnis formuliert werden.
Der hier verwendete Begriff der Kompetenz lehnt sich an die Kompetenzdebatte der
Weiterbildung an, die vor dem Hintergrund von Veränderungsdynamiken
16
die
Notwendigkeit der Entwicklung von Kompetenzen diskutiert. Aufgrund der Veränderungen
ist die Vermittlung von Wissen allein nicht mehr ausreichend, da dies schnell an Aktualität
verliert (vgl. Wittwer 2003: 25). Der Kompetenzbegriff grenzt sich vom Wissensbegriff ab,
16 Gemeint sind hier Veränderungsdynamiken wie die Globalisierung und die Individualisierung.
26
da er eine ,,auf Dauer gestellte Fähigkeit, die sich zugleich selbst (kompetent)
weiterentwickelt" (Orthey 2002: 8) darstellt. Die Kompetenz veraltet nicht wie das Wissen,
sondern ist in verschiedenen Handlungssituationen abrufbar (vgl. ebd. 2002: 8).
Die Entwicklung von Kompetenzen wird von der Faure-Kommission, die durch die
UNESCO eingesetzt wurde, als eine notwendige Bildungsaufgabe beschrieben. Ihr bereits
1973 vorgelegter Bericht über die Zukunft der Bildung und des menschlichen Lernens ist
international von Bedeutung (vgl. Faure 1973). Die Kompetenzentwicklung soll einen
Beitrag leisten, ,,um eine aktive, verantwortungsbewusste demokratische Mitwirkung
möglichst vieler Menschen an der Sicherung einer gesunden friedlichen humanen Zukunft
zu ermöglichen" (Dohmen 1997:15). Die Delors-Kommission, die ebenfalls von der
UNESCO gebildet worden ist und die 1996 den Bericht ,,Learning the treasure within"
für eine zukunftsfähige Bildung im 21. Jahrhundert veröffentlicht hat, greift diese
Bildungsaufgabe erneut auf. Dort heißt es, dass jeder Mensch die Möglichkeit erhalten
soll, eine aktive Rolle zur Gestaltung der Gesellschaft zu übernehmen. Aufgabe der
Bildung ist es, auf diese Rolle vorzubereiten (vgl. Delors 1996: 61).
Die Kompetenzentwicklung der Menschen wird in beiden Berichten als eine
gesellschaftliche Notwendigkeit angesehen. In der Diskussion zur Bürgergesellschaft (vgl.
Kap. 2.1.2) wird vergleichbar argumentiert: Der Bürger soll auf seine Aufgabe,
Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen, vorbereitet werden. Daher wird die
Ausbildung von Bürgerkompetenzen vorausgesetzt (vgl. Kap. 2.1.2). Der Begriff der
Kompetenz wird allerdings in der Diskussion zur Bürgergesellschaft nicht ausführlich
beschrieben. Aus diesem Grund möchte ich mich an den Kompetenzbegriff aus der
Weiterbildung anlehnen.
Arnold und Schüßler beschreiben, dass sich der Begriff der Kompetenz innerhalb der
Weiterbildungsdebatte
17
auf das Individuum selbst und weniger auf konkrete
Anforderungen der Arbeitssituation - wie der Begriff der Schlüsselqualifikationen
18
-
17 Mit der Verwendung des Kompetenzbegriffes wandelt sich ebenfalls das Verständnis von Weiterbildung.
Kritisiert wird die ,,reine Wissensvermittlung". Vielmehr sei die Realisierung von lebenslangem Lernen
nötig: Es solle dabei erstens nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung, Können und Werte integrieren,
zweitens neben institutionalisierten Lernformen auch das Lernen außerhalb von Institutionen (am
Arbeitsplatz) als Lernchancen erkannt werden und drittens Lernprozesse nicht nur auf Individuen, sondern
auch auf Gruppen, Organisationen und ganze Gesellschaften bezogen und gefördert werden (vgl. Arnold,
Schüßler 1998: 106).
18 Der Begriff der Schlüsselqualifikationen ist 1974 von Mertens geprägt worden und wird mittlerweile
durch den Begriff der Kompetenz ersetzt. Schlüsselqualifikationen sind gebunden an die fremdbestimmten
Anforderungen z.B. des Unternehmens, die eine Qualifizierung der Person erfordern (vgl. Mertens 1974).
27
bezieht. Kompetenz verweist auf die Ganzheit der Person und nicht nur auf einzelne
Fähigkeiten und Kenntnisse, die vermittelt werden sollen. Zur Entwicklung der
Kompetenzen ist nach diesem Verständnis die selbstgesteuerte Aneignung der Subjekte
nötig. Weiter ist mit dem Kompetenzbegriff die Vermittlung von Werten nicht
ausgeschlossen (vgl. Arnold, Schüßler 1998: 107).
Dohmen versteht Kompetenzen wie in der zuvor erwähnten Begriffsklärung als subjekt-
und biographiebezogene Potentiale eines Individuums. Sie entwickeln sich seiner
Auffassung nach durch die Reflexion von praktischen Erfahrungen und können zur
Bewältigung von spezifischen Anforderungssituationen mobilisiert werden. Er betont, dass
eine einseitige Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung nicht ausreichend ist,
sondern die Ergänzung um praktische Erfahrungen und ein Lernen in der unmittelbaren
Lebenswelt nötig ist (vgl. Dohmen 2001: 42).
Dehnbostel sieht den Erwerb von Kompetenzen als einen lebensbegleitenden Prozess an.
Kompetenzentwicklung stellt nach seinem Verständnis die Basis für reflexive
Handlungsfähigkeit dar. Diese beschreibt ihm zufolge die Souveränität und Qualität der
handelnden Person sowie die kritische Reflexion, Bewertung und Deutung von Situationen
(vgl. Dehnbostel 2001: 76 ff).
Wittwer definiert Kompetenz als ein Handlungssystem, welches in wechselnden
Situationen aktiviert werden kann und sich am Subjekt orientiert. Die Kompetenz ist durch
zwei Aspekte bedingt, die einander ergänzen: Erstens durch die Person und ihre
Ressourcen (Fähigkeiten) und zweitens durch die Anforderungen der Situation (vgl.
Wittwer 2002: 115). Auf dieser Basis trifft er die Unterscheidung zwischen
Kernkompetenzen und Veränderungskompetenzen. Kernkompetenzen werden von ihm als
persönliche Ressourcen gesehen. Diese geben Orientierung für die eigene
Biographieentwicklung und sind kontinuierlicher Bestandteil des Individuums. Zugleich
begründen sie die Fachqualifikationen, da die Kompetenzen jeweils kontextgebunden (in
einem bestimmten Fach/Bereich) angewendet werden (vgl. Wittwer 2003: 26). Die
Verwendung der Kernkompetenzen erfolgt in bestimmten Anforderungssituationen. Eine
Ergänzung der Kernkompetenzen um so genannte Veränderungskompetenzen ist daher
nötig, um in Situationen und den damit verbundenen wechselnden Anforderungen agieren
und handeln zu können. Die Fachqualifikationen alleine sind Wittwer zufolge
unzureichend (vgl. ebd.: 27). Zu Kompetenzen, die zum Umgang mit Veränderungen
28
befähigen, zählt er unter anderem: ,,Persönliche Kompetenzen" (z.B. zielstrebiges Handeln
oder die Bereitschaft zur Verantwortung); ,,Reflexive Kompetenz" (z.B. die Fähigkeit aus
dem Handeln zu lernen); ,,Überberufliche Fähigkeiten" (die Fähigkeit selbstgesteuert zu
lernen, Lösungsvorschläge entwickeln) (vgl. Wittwer 2002: 116). Er begründet:
,,Veränderungskompentenz ermöglicht den Transfer vom Wissen zum Können. Das was man
einmal gelernt hat, muss somit bei Wechsel und Veränderung nicht `verlernt`, sondern kann
den Anforderungen der neuen Situation angepasst werden. Veränderungskompetenz ist damit
eine wichtige Fähigkeit, sich privat wie beruflich auf neue, wechselnde Situationen
einzulassen und die jeweiligen Anforderungen im Hinblick auf die individuelle berufliche
Entwicklung produktiver zu verarbeiten." (ebd.: 117).
Die Kompetenzentwicklung verläuft in Abhängigkeit von den individuellen
Voraussetzungen und Stärken des Individuums, wobei die Veränderungskompetenzen eine
Hilfestellung bieten, um Kernkompetenzen zur Geltung zu bringen und zu nutzen (vgl.
Wittwer 2003: 28).
Kritisiert wird bei Wittwer eine fremdgesteuerte
Kompetenzentwicklung, die sich hauptsächlich an den Anforderungen des Marktes
orientiert und wenig das Subjekt fokussiert (vgl. ebd.: 28 f).
Gemeinsam ist den Konstruktionen von Kompetenz die Betonung des Subjekts, so dass
diese Auffassung für diese Arbeit leitend ist. Ich teile weiter die Einsicht von Dohmen und
Dehnbostel, dass Kompetenzentwicklung die praktische Erfahrung des Subjekts und
dessen Reflexion benötigt. In Anlehnung an Wittwer soll hier Kompetenz als ein Konstrukt
verstanden werden, das in wechselnden Handlungssituationen aktiviert werden kann.
Weiterhin wird die Position von der Unterscheidung zwischen Kern- und
Veränderungskompetenzen berücksichtigt. So wird die Förderung individueller Stärken des
Individuums und die Entwicklung von Veränderungskompetenzen für den Umgang mit
wechselnden Anforderungssituationen betrachtet.
Für das bürgerschaftliche Engagement ist diese Förderung individueller Stärken
(Kernkompetenzen) entscheidend, da das Individuum eigene Fähigkeiten und Interessen
einbringen kann und dies die Selbstentfaltung unterstützt. Die Veränderungskompetenzen
geben dem Bürger die Möglichkeit, mit verschiedenen Situationen in der Gesellschaft
umzugehen, sich selbst zu organisieren und die Rolle als Bürger verantwortlich zu
gestalten.
Wie zuvor als zentrale Aspekte herausgestellt, sollen hier die Veränderungskompetenzen
Selbstorganisation und Gemeinsinn genauer betrachtet werden. Die Selbstorganisation
29
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836626675
- DOI
- 10.3239/9783836626675
- Dateigröße
- 859 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bielefeld – Pädagogik, Studiengang Erziehungswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Februar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- konstruktivismus open space zukunftskonferenz appreciate inquiry autopoiese
- Produktsicherheit
- Diplom.de