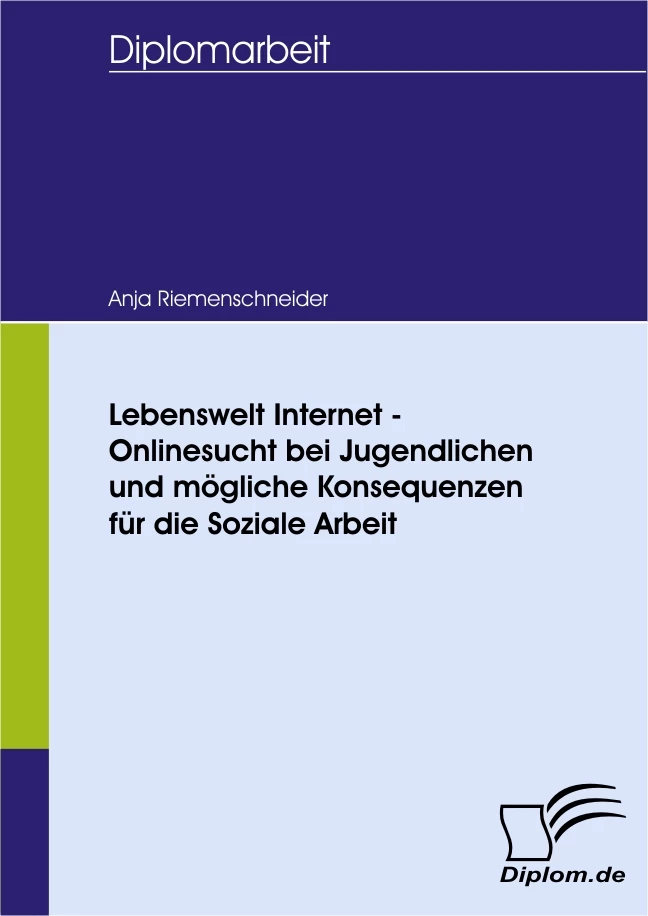Lebenswelt Internet - Onlinesucht bei Jugendlichen und mögliche Konsequenzen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung
In China grassiert die Internetsucht war eine Schlagzeile der Tageszeitung Die Welt am 17. Januar 2007. Natürlich kann man sagen, dass China weit weg und nicht mir der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen ist. Trotzdem denke ich, dass diese Aussage ein Hinweis ist auf eine weltweite Entwicklung, die noch sehr unerforscht ist.
Bei der Internetsucht handelt es sich um eine relativ neue und umstrittene Sucht. Die Meinungen der Fachwelt teilen sich bei der Frage nach der Existenz diese Sucht. Das hat verschiedene Gründe, die im Verlauf meiner Arbeit herausgestellt werden. Das Internet ist nicht das einzige Medium, das ein Suchtpotenzial beinhaltet. In den Bereich der Verhaltenssüchte fallen auch noch andere Süchte nach Medien. Beispiele dafür wären die Nachrichtensucht, Fernsehsucht, Videosucht, Computersucht und die Abhängigkeit von Computer- und Videospielen. Diese Aufzählung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie kann beliebig fortgesetzt werden.
Meiner Meinung nach ist ein Zusammenhang zwischen der Computer- und der Internetsucht zu sehen. Auch wenn sich diese unterscheiden, haben sie gemeinsame Ansätze. Es gibt verschiedene aktuelle Bezüge auch in Deutschland zum Themenkomplex Jugend Computer Internet. Beispiele dafür wären die immer wiederkehrenden Diskussionen in der Politik mit dem Gegenstand Jugendschutz und Computerspiele. Seit Jahren wird diskutiert, ob die Möglichkeit besteht, diesen effektiver zu gestalten. Außerdem werden meiner Meinung nach andere gesellschaftliche Probleme und Missstände leichtfertig auf einen bestimmten Bereich der Computerspiele geschoben. Auch dieser Aspekt wird in meiner Arbeit kurz erwähnt.
Es gibt verschiedene Studien zum Thema Internetsucht. Allerdings sind diese im Einzelnen nicht miteinander vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Gesichtspunkte ausgerichtet sind. Hinzu kommt, dass sie zum größten Teil regional begrenzt sind. Das bedeutet, dass trotz der unterschiedlichen Studien kein internationaler Vergleich möglich ist. Obwohl die erste Studie bereits im Jahr 1996 in den USA durchgeführt wurde, ist die Forschung auf diesem Gebiet noch nicht sehr weit entwickelt. Die meisten Studien beschäftigen sich zudem nur mit dem Anteil der Internetnutzer, die süchtig sind, und nicht mit den Ursachen und Hintergründen der Sucht.
Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich entschieden, meine Diplomarbeit zu dem Thema Internetsucht mit der besonderen Beachtung ihrer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition Sucht
2.1 Stoffgebundene Süchte
2.2 Stoffungebundene Süchte
2.3 Fazit
3. Internetsucht
3.1 Charakteristika der Internetsucht
3.2 Der Zusammenhang von pathologischer Internetnutzung und psychischen Störungen – Ergebnisse einer aktuellen Pilotstudie
3.3 Fazit
4. Betroffene
4.1 Jugendliche
4.2 Fazit
5. Gesellschaftliche Bedingungen
5.1 Lebenswelt
5.1.1 Familie
5.1.2 Schule
5.1.3 Freizeit und Gesellschaft
5.2 Fazit
6. Konsequenzen für die Soziale Arbeit bezüglich der Internetsucht
6.1 Definition Sozialer Arbeit
6.2 Das Hilfesystem für Internetabhängige
6.3 Ignoranz ist keine Lösung! Wie Soziale Arbeit im Bereich der Hilfe für Onlinesüchtige tätig werden kann
6.3.1 Soziale Arbeit und das Internet – Das Erstellen einer Internetseite gemeinsam mit Jugendlichen am Beispiel des Jugendclubs Allach
6.4 Fazit
7. Fazit und Stellungnahme
8. Literaturverzeichnis
8.1 Bücher
8.2 Internetquellen
1. Einleitung
„In China grassiert die Internetsucht“ war eine Schlagzeile der Tageszeitung „Die Welt“ am 17. Januar 2007. Natürlich kann man sagen, dass China weit weg und nicht mir der Bundesrepublik Deutschland zu vergleichen ist.
Trotzdem denke ich, dass diese Aussage ein Hinweis ist auf eine weltweite Entwicklung, die noch sehr unerforscht ist.
Bei der Internetsucht handelt es sich um eine relativ neue und umstrittene Sucht. Die Meinungen der Fachwelt teilen sich bei der Frage nach der Existenz diese Sucht. Das hat verschiedene Gründe, die im Verlauf meiner Arbeit herausgestellt werden. Das Internet ist nicht das einzige Medium, das ein Suchtpotenzial beinhaltet. In den Bereich der Verhaltenssüchte fallen auch noch andere Süchte nach Medien. Beispiele dafür wären die Nachrichtensucht, Fernsehsucht, Videosucht, Computersucht und die Abhängigkeit von Computer- und Videospielen. Diese Aufzählung hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sie kann beliebig fortgesetzt werden.
Meiner Meinung nach ist ein Zusammenhang zwischen der Computer- und der Internetsucht zu sehen. Auch wenn sich diese unterscheiden, haben sie gemeinsame Ansätze. Es gibt verschiedene aktuelle Bezüge auch in Deutschland zum Themenkomplex Jugend – Computer – Internet. Beispiele dafür wären die immer wiederkehrenden Diskussionen in der Politik mit dem Gegenstand Jugendschutz und Computerspiele. Seit Jahren wird diskutiert, ob die Möglichkeit besteht, diesen effektiver zu gestalten. Außerdem werden meiner Meinung nach andere gesellschaftliche Probleme und Missstände leichtfertig auf einen bestimmten Bereich der Computerspiele geschoben. Auch dieser Aspekt wird in meiner Arbeit kurz erwähnt.
Es gibt verschiedene Studien zum Thema Internetsucht. Allerdings sind diese im Einzelnen nicht miteinander vergleichbar, da sie auf unterschiedliche Gesichtspunkte ausgerichtet sind. Hinzu kommt, dass sie zum größten Teil regional begrenzt sind. Das bedeutet, dass trotz der unterschiedlichen Studien kein internationaler Vergleich möglich ist. Obwohl die erste Studie bereits im Jahr 1996 in den USA durchgeführt wurde, ist die Forschung auf diesem Gebiet noch nicht sehr weit entwickelt. Die meisten Studien beschäftigen sich zudem nur mit dem Anteil der Internetnutzer, die süchtig sind, und nicht mit den Ursachen und Hintergründen der Sucht.
Aufgrund dieser Tatsache habe ich mich entschieden, meine Diplomarbeit zu dem Thema Internetsucht mit der besonderen Beachtung ihrer Auswirkungen bei Jugendlichen zu verfassen. Der Stand der bisherigen Forschung ist vergleichbar mit der Infrastruktur des Hilfesystems in diesem Bereich. Beides befindet sich noch im Anfangsstadium.
Deshalb werde ich sowohl die bisher durchgeführten Studien als auch den Auf- und Ausbau eines flächendeckenden Hilfesystems betrachten.
Um das volle Ausmaß von Internetsucht und ihren Folgen für den Betroffenen verstehen zu können, werde ich zuerst den Begriff Sucht definieren. Dabei unterscheide ich in zwei Bereiche, stoffgebundene und stoffungebundene Sucht. Im danach folgenden Teil werde ich näher auf die Internetsucht eingehen. Im Vordergrund sollen die spezifischen Charakteristika der Internetsucht stehen. In diesem Teil werde ich auch erklären, worin das Suchtpotenzial des Internets liegt. Ich habe mich eingehend mit einer Studie beschäftigt, die den Zusammenhang zwischen einer psychischen Störung und der Internetsucht erforschen will. Deshalb werde ich diese vorstellen. Es kommt hinzu, dass diese Studie sehr aktuell ist, sie ist im letzten Jahr veröffentlicht worden.
Anschließend werde ich auf die Betroffenen eingehen. Gemäß des Titels meiner Arbeit werde ich Jugendliche gesondert betrachten. Dabei stellt sich die Frage, zu welchem Zweck Jugendliche das Internet benutzen und warum dieses Medium eine solche Faszination auf sie ausübt. Um diese Frage ausreichend klären zu können, bedarf es einer Betrachtung der Lebensphase Jugend. Dabei stelle ich die Besonderheiten dieser Altersgruppe vor.
Aus diesen verschiedenen Bereichen ergeben sich mögliche Konsequenzen für die Soziale Arbeit. Um diese darstellen zu können, werde ich zunächst eine Definition von Sozialer Arbeit vorstellen. Es folgen eine Beschreibung des bisher aufgebauten Hilfesystems und praktische Beispiele. Mit diesen möchte ich die Möglichkeiten aufzeigen, mit denen einer Internetsucht durch die Soziale Arbeit entgegengewirkt werden kann. Dabei stellt sich heraus, dass einige Bedingungen erfüllt sein müssen, dies zu ermöglichen.
Zur Vereinfachung und Förderung des Leseflusses verwende ich in dieser Arbeit die im normalen Sprachgebrauch übliche männliche oder weibliche Schreibweise.
2. Definition Sucht
Zu Beginn möchte ich den Begriff „Sucht“ definieren. Dabei wird heute zwischen stoffgebundenen und stoffungebundenen Süchten unterschieden, wobei ich die erstgenannte nur kurz beschreiben möchte.
Es gibt einige Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser beiden oben genannten Suchtformen. Eine wichtige Gemeinsamkeit ist der Hintergrund des Begriffs Sucht im Allgemeinen. Sucht bedeutet chronisches Ausweichen vor scheinbar unlösbaren Konflikten. Das geschieht in Form von einem unabweisbaren Verlangen nach einer Droge (bei stoffgebundenen Süchten) oder einem bestimmten Verhalten (bei stoffungebundenen). Das Ziel dabei ist, vor dem augenblicklichen unerwünschten Erlebnis- oder Bewusstseinszustand in einen anderen, angenehmeren zu fliehen. Mit jeder Sucht geht ein Kontrollverlust einher. Der Süchtige ist nicht mehr in der Lage, sein Verhalten zu kontrollieren, auch wenn er es vom Verstand her wollte. Es kommt zu einem Wiederholungszwang und zu einer Steigerung der Dosis. Er wird unfähig, der Sucht zu entsagen, das Leben dreht sich nur noch um die Sucht. In den meisten Fällen leiden sowohl das Arbeitsleben als auch die sozialen Kontakte des Abhängigen darunter. Die Folge ist der gesellschaftliche Abstieg und oft auch der körperliche Zerfall.[1]
2.1 Stoffgebundene Süchte
Beim Thema Sucht denkt man oft zuerst an stoffgebundene Süchte. Damit ist die Abhängigkeit von verschiedenen Substanzen, wie zum Beispiel Alkohol, Medikamenten oder Drogen bzw. Rauschmitteln gemeint. Unter Rauschmitteln versteht man psychoaktive Stoffe, die einen veränderten Bewusstseinszustand hervorrufen. Die Weltgesundheitsorganisation bezieht außerdem auch noch sogenannte Alltagsdrogen wie Tee und Kaffee ein. Durch diesen erweiterten Drogenbegriff werden Drogen von Genuss- und Lebensmitteln nicht mehr eindeutig abgegrenzt. Nach dieser Definition gilt jede Substanz als Droge, die in einem lebenden Organismus Funktionen verändert.
Sucht äußert sich dabei als latente Suchthaltung oder als manifestes süchtiges Verhalten, wobei dies zur Krankheit wird, wenn es zum zwanghaften Verhalten wird und eine Eigendynamik entwickelt. Es tritt dann nicht nur in einer Flucht- oder Unwohlsituation ein und organisiert sich selbst.[2]
Da es zum Thema „Stoffgebundene Sucht“ statistische Erhebungen gibt, möchte ich an dieser Stelle ein paar Daten und Fakten einfügen. In der Bundesrepublik Deutschland gab es im Jahr 2002 zwischen zwei und zweieinhalb Millionen AlkoholikerInnen, 1,4 Millionen Medikamentenabhängige, 120.000 Abhängige von illegalen Drogen (außer Haschisch und Marihuana) wie Heroin oder Kokain und 17 Millionen RaucherInnen.[3]
Das Institut für Therapieforschung (IFT) München geht allerdings von einer viel höheren Anzahl von beispielsweise Alkoholkonsumenten, -missbrauchern und
-abhängigen aus, wobei es sich dabei lediglich um Schätzungen handelt. Dabei stimmen die Zahlen für alkoholmissbrauchende und alkoholabhängige Personen weitestgehend mit den von Werner Gross angeführten überein, mit jeweils 1,7 Millionen (im Jahr 2005). Hier werden lediglich noch die Personen aufgeführt, deren Konsum riskant ist, was laut Schätzungen des IFT München bei 10,4 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2005 der Fall ist. Dieser Personenkreis taucht bei Werner Gross gar nicht auf.
Bei den RaucherInnen stimmen die Zahlen recht genau überein. Bei den KonsumentInnen von illegalen Drogen (außer Cannabis) gibt es ähnliche Abweichungen in der Statistik wie beim Alkohol. Auch hier geht das IFT München von einer höheren Anzahl aus, nämlich 275.000 Personen mit riskantem Konsum und 175.000 Abhängigen.
Aufgrund dieser zum Teil relativ starken Abweichungen der Zahlen gehe ich davon aus, dass es bei der Anzahl der Abhängigen bzw. KonsumentInnen aller Arten von Drogen im Sinne der Definition der Weltgesundheitsorganisation eine hohe Dunkelziffer gibt. Die Statistik des IFT München erscheint mir realistischer, obwohl es sich dabei lediglich um geschätzte Werte handelt. Zuverlässige Daten gibt es zu diesem Bereich allerdings nicht.
2.2 Stoffungebundene Süchte
In der aktuellen Diskussion zum Thema Sucht taucht allerdings immer häufiger der Begriff „stoffungebundene Sucht“ auf. Die wohl bekannteste unter ihnen ist die Spielsucht. Auch hier gibt es keine verlässlichen Zahlen, nach einer groben Schätzung gibt es momentan um die 180.000 pathologische Glücksspieler in der Bundesrepublik Deutschland.[4] Pathologisch = krankhaft verändert, wobei der Begriff „Pathologie“ seinen Ursprung im Griechischen hat; Pathos = Leidenschaft oder Sucht.[5]
Die Spielsucht ist aber nicht die einzige Form von stoffungebundener Sucht. Andere sind z. B. Spielsucht, Esssucht, Ess- Brech- Sucht, Arbeitssucht, Liebes- und Sexsucht und auch die Internetsucht.
Im Gegensatz zu den stoffgebundenen Süchten ist der erschwerende Faktor an den stoffungebundenen, dass sie physisch nicht klar zu erkennen sind, erst im weiteren Verlauf der Sucht werden die Symptome deutlich. Es gibt keine Substanz anhand derer man feststellen kann, ob man abhängig ist, wenn man diese in einem bestimmten Maße konsumiert. Die Übergänge zwischen normalem und pathologischem Verhalten sind dabei fließend. Wo liegt die Grenze? Ab welcher Anzahl von Stunden, die ein Mensch pro Tag online ist, kann er als süchtig bezeichnet werden? Diese fließende Grenze zwischen normalem und süchtigem Verhalten findet sich bei allen stoffungebundenen Süchten wieder.
Deshalb möchte ich hier nun weiter auf eben diese Grenze eingehen.
Diese fließenden Übergänge wurden von Werner Gross (Dipl. Psychologe und Mitglied der Leitung des Psychologischen Forums Offenbach) folgendermaßen weiter abgestuft:[6]
- Gebrauch
- Genuss
- Missbrauch
- Ausweichendes Verhalten/ Abweichendes bzw. auffälliges Verhalten
- Gewöhnung/ Gewohnheit
- Abhängigkeit
- Sucht/ Suchtkrankheit
Unter Gebrauch versteht er die sinnvolle und hilfreiche Verwendung zur persönlichen, gesellschaftlichen und natürlichen Weiterentwicklung. Im Bezug auf die Internetsucht könnte man also feststellen, dass eine Person, welche das Internet zu Recherchezwecken und/oder zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte (durch die Elektronische Post oder das Nutzen von sogenannten „Messengern“[7] ) benutzt, nicht dadurch gleich süchtig ist.
Genuss ist dagegen etwas, das wir nicht unbedingt brauchen, was wir aber gern haben und was uns kurzfristig befriedigt.
Missbrauch stellt selbstschädigendes Verhalten oder eine Verwendungsweise dar, die körperlich, psychisch oder sozial schädigend ist. Dabei kommt es auf die Häufigkeit oder Regelmäßigkeit an, mit der dieses Verhalten auftritt. Missbrauch steht oft für eine Anzahl ungelöster Probleme, von denen abgelenkt werden soll. Daraus ergibt sich ein enger Zusammenhang mit ausweichendem Verhalten. Dies liegt dann vor, wenn aufgrund bestehender Probleme eine bestimmte Verhaltensweise (ein Missbrauch) ausgelöst wird. Entscheidend ist, ob nach dieser Reaktion eine erneute Problemlösung angestrebt wird, oder ob weiterhin ausgewichen wird. Ausweichendes Verhalten kann schnell zu abweichendem oder auffälligem Verhalten werden, je nachdem, ob es den gesellschaftlichen Werten und Normen entspricht oder nicht. So wird der übermäßige Genuss von Alkohol in unserer Gesellschaft beispielsweise akzeptiert und toleriert, während die Einnahme von illegalen Drogen diesen Status nicht hat. Wenn dieses Verhalten nun häufiger auftritt, kommt es zur Gewöhnung, wobei eine psychische Bindung zu der Verhaltensweise entsteht. Zu diesem Zeitpunkt kann das Verhalten jedoch noch geändert werden. Wenn dies nicht geschieht und die vorher beschriebene psychische Bindung stärker wird, folgt eine Abhängigkeit.
Das Problem der Definition der stoffungebundenen Sucht liegt auch darin, wie der Suchtbegriff in unserer Gesellschaft gesehen wird. Die einzige als rehabilitationsbedürftig anerkannte stoffungebundene Sucht ist die Spielsucht, und das auch erst seit 2001.
Auf diesem Gebiet hat sich bis heute auch nichts geändert, Spielsucht bleibt weiterhin die einzige bei den Krankenkassen als rehabilitationsbedürftig anerkannte stoffungebundene Sucht. Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Frage, ob es sich bei der Sucht um eine Erkrankung handelt. Ernährungsbezogene Süchte wie Bulimie oder Esssucht sind ebenfalls als Krankheit eingestuft und deshalb rehabilitationsbedürftig. Bei anderen stoffungebundenen Süchten, wie der Internetsucht, wird im Einzelfall geprüft, was der jeweilige Auslöser des süchtigen Verhaltens ist. Laut Aussagen der Atlas BKK würde in diesem Fall die Frage nach einer Depression oder einer anderen psychischen Erkrankung geklärt. Bei dieser Krankenkasse gab es allerdings noch nie eine derartige Anfrage.[8]
Deshalb ist es wichtig, dass es eine klare Begriffsdefinition gibt, gleichgültig, ob es sich bei dem Suchtmittel um ein Verhalten oder um einen Stoff handelt. Nach Gross gibt es acht Kriterien, die klären sollen, ob ein Verhalten zur Sucht geworden ist:
1. Kontrollverlust (die süchtige Person ist nicht mehr in der Lage, seinen Konsum zu kontrollieren)
2. Abstinenzunfähigkeit (die süchtige Person kann ohne das Suchtmittel nicht mehr leben)
3. Wiederholungszwang (aufgrund dieser Lebensunfähigkeit ohne das Suchtmittel, tritt das süchtige Verhalten immer wieder ein)
4. Entzugserscheinungen (körperlich, in Form von Zittern, Schweißausbrüchen etc., oder psychisch, in Form von Ängsten, Wutausbrüchen, Trauer oder Unruhe)
5. Dosissteigerung oder „More-Effekt“ (der gleiche gefühlsmäßige Erlebniszustand wird nur noch mit Hilfe einer höheren Dosis seines Suchtmittels bzw. süchtigen Verhaltens erreicht)
6. Interessenabsorption bzw. –zentrierung (alle anderen Interessen werden unwichtig oder treten in den Hintergrund)
7. Gesellschaftlicher Abstieg (durch Verlust des Arbeitsplatzes und der sozialen Kontakte)
8. Psychischer und körperlicher Zerfall[9]
2.3 Fazit
Unter Sucht versteht man süchtiges Erleben und Verhalten. Die oben genannten Kriterien beschreiben den Übergang zwischen normalem und pathologischem Verhalten, welches sich wie beschrieben äußert. Es wird heute immer noch darüber diskutiert, ob eine solche Art von Sucht, wie es die Internetsucht ist, überhaupt existiert. Auf der anderen Seite ist diese noch relativ neue Sucht schon mehrfach untersucht worden. Aus diesen Studien ergeben sich verschiedene Charakteristika einer stoffungebundenen Sucht, die ich im Verlauf meiner Arbeit noch beschreiben werde.
Wenn diese Definition nun auf die Internetsucht angewandt wird, bedeutet das folgendes:
Die von Gross beschriebene Einleitungsphase einer Sucht, bestehend aus Gebrauch, Genuss und Missbrauch sieht vor, dass die Person, die internetsüchtig wird, zunächst das Internet nur gebraucht. Sie sucht zum Beispiel nach einer bestimmten Information zu einem Thema. Bei ihrer Recherche stellt sie fest, welche Möglichkeiten das Internet noch bietet. Sie besucht vielleicht außerdem noch verschiedene Chatrooms.[10]
Im Fall der Internetsucht beziehe ich mich auf die Personen, die nicht von Berufs wegen das Internet nutzen müssen, sondern dies in ihrer Freizeit tun.
Trotz dieser Schwierigkeit der Definition kann relativ klar gesagt werden, wann ein exzessives Verhalten zur Sucht wird. Dazu wird davon ausgegangen, dass eine Sucht dann vorliegt, wenn es zu einer Schädigung der eigenen oder einer anderen Person auftritt. Es gab in den letzten Jahren bereits Berichte von Personen, die wegen der zeit, die sie vor dem Computer verbrachten, auf die Aufnahme von Nahrungsmitteln oder Schlaf verzichteten. Gerade letzteres kommt bei exzessivem Verhalten in Bezug auf den Computer häufiger vor. Kommt es durch dieses Verhalten zum dauerhaften Schlafentzug, sodass der Betroffene seinen Alltag nicht mehr ohne Schwierigkeiten bewältigen kann, werden weitere Kriterien erfüllt, die auf eine Sucht hindeuten. Das fängt damit an, dass andere Interessen in den Hintergrund treten. Beispielsweise, ausreichend zu schlafen. Die Folge davon ist, wenn dieser Zustand länger andauert, der körperliche Zerfall. Dieser führt kann dann möglicherweise zum Verlust des Arbeitsplatzes und damit zum gesellschaftlichen Abstieg führen.
3. Internetsucht
Onlinesüchtige integrieren nicht das Internet in ihr Leben, sondern ihr Leben ins Internet. (www.onlinesucht.de)
Der Begriff Internet addiction disorder (engl.= Internetsucht als Verhaltensstörung) wurde erstmals 1991 vom Psychiater Ivan Goldberg benutzt. Er war ursprünglich als Scherz gemeint, Goldberg musste jedoch schnell erkennen, dass es diese Form von Sucht tatsächlich gibt. Er bekam viele Zuschriften von Menschen, die unter Internetsucht litten. Seitdem werden viele Untersuchungen zu diesem Thema durchgeführt, wobei es im Wesentlichen zwei Merkmale dieser Studien gibt. Zum einen beziehen sich die Untersuchungen auf die Diagnosekriterien der Sucht, zum anderen auf die Anzahl der Personen, die unter ihr leiden.[11]
Ich halte es, wie bereits beschrieben, für unumstritten, dass Internetsucht existiert, auch wenn es kontroverse Ansichten zu diesem Thema gibt („Man kann nicht süchtig nach einem Ding werden“ hört man oft, wenn man die Internetsucht anspricht). Es gab gerade in den letzten Jahren einen regelrechten „Internet-Boom“. Laut Heise-Online[12] verfügen mittlerweile mehr als zwei Drittel (68%) der erwachsenen Deutschen über einen eigenen Internet-Anschluss. Das bedeutet einen Zuwachs von 3% gegenüber dem Vorjahr. Gerade die Gruppe der 18-49- jährigen ist besonders stark vertreten, vier von fünf befragten Personen gaben an, über einen Internet-Anschluss zu verfügen. Dabei lässt sich allerdings ein deutliches Bildungsgefälle feststellen. Während 85% der Befragten die Hochschulreife und immerhin noch 70% die mittlere Reife besitzen, haben lediglich 26% der Personen mit Internet-Zugang einen Hauptschulabschluss (mit abgeschlossener Berufsausbildung 48%).[13] Das Internet wird nach Angaben der Befragten dabei hauptsächlich zum Vergleichen von Preisen, zum Einkaufen, zum Tätigen der Bankgeschäfte sowie zum Verfolgen der Nachrichten genutzt.
Auch bei der Gruppe der Kinder unter 18 Jahren steigt die Internetnutzung weiter an. Dazu gibt es eine Studie, die KIM-Studie 2006 (Kinder + Medien, Computer + Internet), durchgeführt vom Medienpädagogischen Landesverband Südwest. Knapp ein Drittel der befragten 1.203 Kinder besitzt einen eigenen Computer, mehr als die Hälfte (58%) nutzen das Internet. Die größte Rolle spielt dabei die Gruppe der über 10-jährigen, mit rund 80%. Die Internetnutzung ist dabei noch nicht fester Bestandteil im Leben von Kindern geworden, nur 14% gehen täglich und 42% seltener als ein Mal pro Woche ins Internet.[14]
Auch zur Gruppe der 12- 19-jährigen hat der Medienpädagogische Landesverband Südwest eine Studie veröffentlicht (die JIM-Studie 2006, JIM = Jugend, Information, (Multi-) Media). Demnach haben 92% der befragten Jugendlichen (gut 1000 Befragte) einen Internetzugang zu Hause, 38% haben einen eigenen Internetanschluss in ihrem Zimmer. Mehr als zwei Drittel sind mehrmals pro Woche oder häufiger online.[15]
Das Internet wird dabei hauptsächlich zur Kommunikation genutzt. 52% der Mädchen und 63% der Jungen benutzen Instant Messenger, rund 50% (beide Geschlechter) nutzen das Internet für elektronische Post (E-Mail).
In der Definition der stoffungebundenen Süchte habe ich bereits beschrieben, dass allein der Gebrauch eines Mediums noch keine Sucht darstellt. Die Übergänge zwischen exzessivem Gebrauch des Internets und Sucht sind fließend.
Deshalb werde ich nun auf besondere Merkmale und Charakteristika der Internetsucht eingehen.
3.1 Charakteristika der Internetsucht
Als Einstieg werde ich dazu einen Fragebogen vorstellen, den Kimberley S. Young[16] in ihrer ersten großen Studie zum Thema Internetsucht angewandt hat. Die Ergebnisse dieser Studie hat sie in ihrem Buch „Caught in the Net – Suchtgefahr Internet“ bereits im Jahr 1998 (1999 in deutscher Übersetzung) veröffentlicht. Er besteht aus insgesamt 20 Fragen, die von den Probanden beantwortet wurden. Dazu gibt es eine Skala, die die Häufigkeit angibt, anhand derer die Befragten ihre Antworten angeben sollten. Sie reicht von 1 (überhaupt nicht) bis 5 (immer).
Nach Beantwortung der zwanzig Fragen addiert man seine Ergebnisse. Je höher die Endsumme ist, umso höher ist der Grad der Abhängigkeit.
Doch zunächst der eigentliche Test:
Test zur Internetsucht
Zur Einschätzung Ihres Suchtgrades beantworten Sie bitte die folgenden Fragen anhand dieser Skala:
1 – überhaupt nicht
2 – selten
3 – manchmal
4 – oft
5 – immer
1. Wie oft stellen Sie fest, dass Sie länger als beabsichtigt online waren?
2. Wie oft vernachlässigen Sie häusliche Pflichten, um länger online bleiben zu können?
3. Wie oft ziehen Sie die Spannung im Internet dem Zusammensein mit Ihrem Partner vor?
4. Wie oft knüpfen Sie neue Beziehungen mit gleich gesinnten Online-Benutzern?
5. Wie oft beschweren sich Menschen in Ihrer näheren Umgebung über die Zeit, die Sie online verbringen?
6. Wie oft kommt es vor, dass Ihre Schulnoten oder Ihre Hausaufgaben unter der zeit leiden, die Sie online verbringen?
7. Wie häufig gehen Sie Ihre E-Mail-Post durch, bevor Sie etwas anderes, Notwendiges tun?
8. Wie oft leidet Ihre Arbeitsleistung oder Produktivität unter dem Internet?
9. Wie oft kommt es vor, dass Sie ausweichend antworten, wenn Sie jemand fragt, was Sie online machen?
10. Wie häufig vertreiben Sie belastende Gedanken über Ihr Leben mit tröstlichen Kommentaren aus dem Internet?
11. Wie oft ertappen Sie sich dabei, dass Sie sich aufs Internet freuen?
12. Wie häufig befürchten Sie, dass Ihr Leben ohne Internet langweilig, leer und traurig wäre?
13. Wie oft kommt es vor, dass Sie verärgert oder aggressiv reagieren, wenn jemand Sie stört, während Sie online sind?
14. Wie oft fehlt Ihnen der Schlaf, weil Sie sich spätabends noch einloggen?
15. Wie oft denken Sie nur ans Internet, wenn Sie offline sind oder sich vorstellen, online zu sein?
16. Wie oft ertappen Sie sich dabei zu sagen: „Nur noch ein paar Minuten“, während Sie online sind?
17. Wie oft wollen Sie die Zeit online reduzieren und scheitern dabei?
18. Wie häufig versuchen Sie zu vertuschen, wie lange Sie online waren?
19. Wie oft beschließen Sie, lieber mehr Zeit online zu verbringen als mit anderen auszugehen?
20. Wie oft fühlen Sie sich deprimiert, launisch oder nervös, wenn Sie offline sind – was sich ändert, wenn Sie wieder online sind?
Young hat zur Einordnung der Ergebnisse noch eine Tabelle mit herausgegeben, die die Ergebnisse in folgende drei Kategorien unterteilt:
- 20- 39 Punkte: Sie sind normaler Online-Benutzer. Sie surfen vielleicht manchmal ein bisschen zu lange im Web, aber insgesamt haben Sie die Sache im Griff.
- 40- 69 Punkte: Sie haben häufig Probleme wegen des Internets. Sie sollten sich über die Auswirkungen Gedanken machen, die es auf Ihr Leben hat.
- 70- 100 Punkte: Ihre Internetnutzung bereitet Ihnen massive Probleme im Leben. Sie müssen sich umgehend damit auseinandersetzen.[17]
Anhand dieses ausgearbeiteten Tests können einige Charakteristika der Internetsucht festgestellt werden.
Ein sehr wichtiges Merkmal der Internetsucht ist das Problem, dass die Betroffenen meist länger online als sie eigentlich geplant hatten. Im obigen Test von Young zielt direkt darauf ja auch die erste Frage ab. Diesen Aspekt der Sucht nennt sie „Die Zeitverzerrung am Bildschirm“.[18] Damit ist folgendes gemeint:
Laut Young hat fast jeder Internetbenutzer diese Zeitverzerrung schon einmal erlebt. Sie äußert sich darin, dass man beispielsweise mehrerer hundert Websites[19] nach einer bestimmten Information durchsucht, rund 50 E-Mails liest und beantwortet oder in einem Chat der Internetforum zu verschiedenen Themen mitdiskutiert. Das Ergebnis bleibt das gleiche: Schnell verliert man jegliches Zeitgefühl. Wenn man dann aufgefordert wird, sich darüber klar zu werden, wie viel Zeit man online verbracht hat, muss man sich die Realität eingestehen. Es waren vielleicht vier Stunden, auch wenn es einem wie 15 Minuten vorkam. Dabei ist es egal, warum man sich ursprünglich online begeben hat, die Informationen, die man sucht sind selten so schnell zu finden wie man anfänglich dachte. Young führt dazu ein Beispiel an:
„Joey, ein Oberstufenschüler, der sich für einen vollendeten Navigator im World Wide Web hält, klinkte sich neulich ins Net ein, nachdem er Howard Sterns Film Private Parts gesehen hatte. Er suchte nach Informationen über den Darsteller Jackie „The Joke Man“ Martling und schätzte, er würde fünf Minuten dazu brauchen. Er begann mit Sterns Web-Seite http://www.privateparts.com. Von dort aus musste sich Joey durch Dutzende von Audio- und Videoclips des Films kämpfen, die ihm aber nicht mehr so gut gefielen wie der Film selbst. Er stieß auch auf mehrere Standfotos aus dem Film. Ein Nebenpfad führte ihn zur Biographie aller wichtigen Schauspieler dieses Films. Als nächstes landete er mitten in mehreren Diskussionsgruppen zu diesem Film und musste natürlich jeweils seine Meinung zum Besten geben. Schließlich erreichte Joey sein Endziel: Seine harmlose Reise durchs Web hatte sieben Links[20] und 45 Minuten gedauert!“[21] Young beschreibt diesen Effekt als ein „Buch ohne Ende“. Jeder kann im Internet eine eigene Seite veröffentlichen, es gibt keinerlei Qualitätskontrollen. Auf der Suche nach den gewünschten Informationen muss sich der Internetnutzer oftmals durch eine Menge elektronischen Müll kämpfen, bis er sein Ziel erreicht hat. Dabei hat fast alles seinen eigenen Reiz, durch faszinierende Grafiken oder interessant klingende Überschriften wird man dazu verführt, sich alles doch noch eben schnell (nur fünf Minuten) anzuschauen.
Es scheint, als stünde die Zeit still, weil sie von niemandem gemessen wird. Darin liegt auch der Unterschied zu anderen Medien. Beim Fernsehen erinnert spätestens der Beginn der nachfolgenden Sendung den Zuschauer daran, dass eine gewisse Zeit verstrichen ist. Genauso kann man anhand mancher regelmäßigen Sendungen genau die Uhrzeit bestimmen (Zum Beispiel an Nachrichtensendungen wie der Tagesschau, die täglich um 20.00 Uhr läuft). Das Internet hat keinerlei Orientierungshilfen dieser Art. Genauso wenig gibt es ein Inhaltsverzeichnis wie bei einem Buch oder einer Zeitschrift. Auch diese können bewirken, dass man die Zeit vollkommen vergisst und viel länger liest, als man eigentlich vorhatte. Doch ein Buch oder eine Zeitschrift hat im Gegensatz zum Internet einen Anfang und ein Ende.[22]
Diese Zeitverzögerung ist nur ein Aspekt der Internetsucht, der jedoch eine entscheidende Rolle in dem Thema spielt, da er großen Einfluss auf das „Online-Verhalten“ der Nutzer hat.
Wichtig für die Charakterisierung der Internetsucht ist, ihren Einfluss auf das Leben der Abhängigen zu betrachten. Werden soziale Kontakte und Freundschaften im realen Leben vernachlässigt, oder wird das gesamte reale Leben vernachlässigt, während ein neues oder paralleles soziales Netzwerk im Internet aufgebaut wird, so ist die betreffende Person der Gefahr der Internetsucht ausgesetzt.
Der von Young benutzte Fragebogen zur Internetsucht kann auch kritisch betrachtet werden, wie beispielsweise von Adam Joinson.[23] Demzufolge sind die Kriterien für Internetsucht, also die Grenze zwischen Sucht und exzessivem Gebrauch, zu niedrig gesetzt. Der ursprüngliche Test von Young aus dem Jahr 1996 beinhaltete sieben Punkte, er war angelehnt an das DSM-4.[24] Sie benutzte dabei die Kriterien für die Sucht nach psychoaktiven Substanzen und wandte diese auf die Internetsucht an.
Probanden, die mindestens drei der Fragen zugestimmt haben, wurden als pathologische Internetnutzer eingestuft. Mit Blick auf die Testfragen fällt auf, dass es nicht schwer ist, drei von ihnen mit „ja“ zu beantworten. Drei Beispiele dafür sind:
- Bleiben Sie länger online als vorher geplant?
- Haben Sie eine soziale, berufliche oder erholende Aktivität wegen des Internets aufgegeben?
- Möchten Sie Ihren Internetgebrauch reduzieren?
Das Fazit, dass sich aus diesen Ausführungen geradezu aufdrängt ist, dass die Kriterien zu niedrig gesetzt sind. Joinson erwähnt noch andere Tests, die leider entweder die selben oder ebenfalls sehr niedrig gesetzte Kriterien anführen, die die Grenze zwischen Internetsucht und exzessivem Gebrauch des Internets aufzeigen sollen.[25]
[...]
[1] Vgl. Gross: Sucht ohne Drogen, 2003, S. 13f.
[2] Vgl. Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.): Sucht- und Drogenvorbeugung in der Schule, in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 1988
[3] Vgl. Gross: Sucht ohne Drogen, 2003
[4] Vgl. Meyer: Glücksspiel - Zahlen und Fakten, in: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., 2006
[5] Vgl. Langenscheidt Fremdwörterlexikon
[6] Gross: Sucht ohne Drogen, 2003, S. 30f.
[7] Bei Messengern oder auch Instant Messengern handelt es sich um Programme, die einen Nachrichtensofortversand ermöglichen. Kurze Textmeldungen können damit über ein Netzwerk (meist das Internet) an den Empfänger gesendet, der sofort darauf antworten kann. Die Kommunikation erfolgt in Echtzeit.
[8] Angaben von Andrea Eisenbarth, Mitarbeiterin der Atlas BKK, in einem Telefongespräch mit mir.
[9] Vgl. Gross: Sucht ohne Drogen, 2003, S. 34f.
[10] Ein Chatroom ist ein virtueller Raum, in dem Echtzeit-Kommunikation zwischen mehreren Teilnehmern stattfindet. „to chat“ = engl. Plaudern. Anders als Instant Messenger befinden sich Chatrooms auf Webseiten, außerdem können dort mehr als zwei Personen untereinander kommunizieren.
[11] Vgl.: Joinson: Understanding the Psychology of Internet Behavior, 2003, S. 55
[12] Heise-Online ist die Internetpräsenz des Heise-Verlags in Hannover, von welchem unter anderem die Computerzeitschrift c’t herausgegeben wird. Die Internetseite beschäftigt sich zudem aktuellen Meldungen aus der IT-Branche und führt Umfragen durch.
[13] Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/83774
[14] Vgl. http://www.mpfs.de/fileadmin/KIM-pdf05/Erste_Ergebnisse_KIM06.pdf
[15] Vgl. http://www.mpfs.de/index.php?id=86
[16] Kimberley S. Young ist Psychologin an der Universität Pittsburgh, die sich in ihrer Forschung auf das Thema Internetsucht spezialisiert hat
[17] Young: Caught in the Net – Suchtgefahr Internet, 1999, S. 46ff.
[18] ebd. S. 51
[19] Websites = Internetseiten (englisch)
[20] Unter einem Link versteht man einen Querverweis zu einer anderen Unterseite oder externen Internetseite. Diese kann durch Klicken auf das verlinkte Wort erreicht werden.
[21] Young: Caught in the Net, 1999, S. 54
[22] Vgl. ebd, S. 54ff.
[23] Adam Joinson ist Doktor der Sozialpsychologe und bekannt für seine Studien im Bereich der Psychologischen Aspekte des Internets.
[24] D iagnostic and S tatistical Manual of M ental Disorders (Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen), das Klassifikationssystem der American Psychiatric Association. Im Gegensatz zum ICD-10 handelt es sich beim DSM-4 um ein nationales Klassifikationssystem. Die ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems, engl. = Internationale Klassifizierung von Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen) ist die von der Weltgesundheitsorganisation herausgegebene Klassifikation der Krankheiten und verwandten Gesundheitsproblemen. Die 10 bezieht sich dabei auf die 10. Revision und ist die aktuelle Ausgabe der ICD.
[25] Vgl.: Joinson: Understanding the Psychology of Internet Behavior, 2003, S. 55
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836625470
- DOI
- 10.3239/9783836625470
- Dateigröße
- 591 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Hannover – Sozialwesen, Studiengang Sozialarbeit/Sozialpädagogik FH - Grundständig
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Februar)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- internetsucht onlinesucht jugendliche soziale arbeit suchtprävention
- Produktsicherheit
- Diplom.de