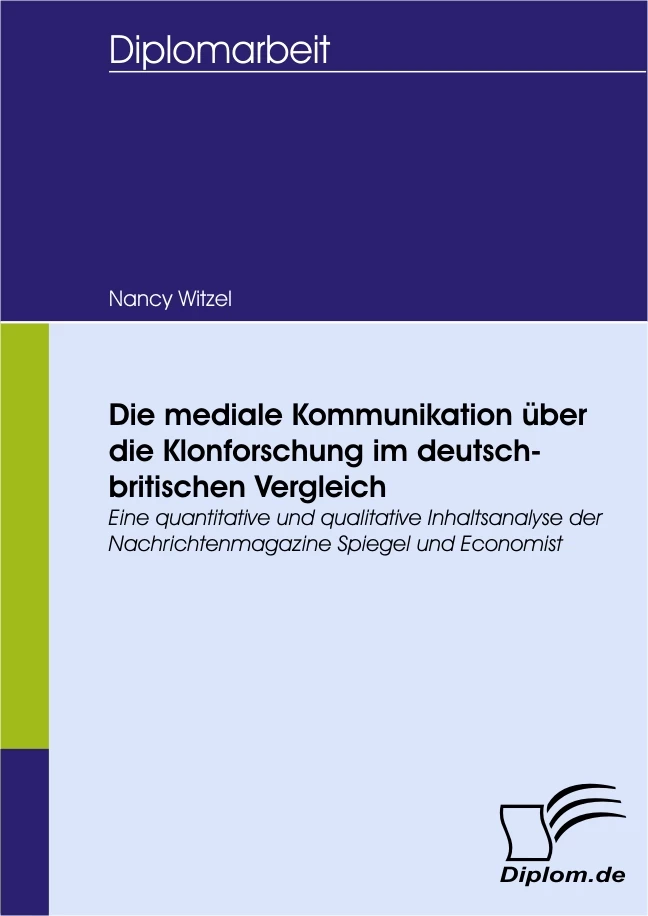Die mediale Kommunikation über die Klonforschung im deutsch-britischen Vergleich
Eine quantitative und qualitative Inhaltsanalyse der Nachrichtenmagazine Spiegel und Economist
Zusammenfassung
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der medialen Berichterstattung Deutschlands und Großbritanniens über die Klonforschung.
Die Grundannahme besteht darin, dass Kommunikation über Wissenschaftszweige wie dem Klonen in modernen Demokratien hauptsächlich über die massenmediale Öffentlichkeit stattfindet. Damit prägen die Medien in ihren sozialen, politischen und ökonomischen Funktionen die Inhalte und Strukturen der öffentlichen Meinungsbildung entscheidend.
Die theoretische Grundlage bildet die funktional-strukturelle Systemtheorie, die Öffentlichkeit als ein Funktionssystem betrachtet, für das der Journalismus als autonomer Beobachter Leistungen erbringt. Auch der Wissenschaftsjournalismus arbeitet als Teil dieses Leistungssystems und nicht nach dem Paradigma der Wissenschaftspopularisierung. Er fungiert folglich nicht als reiner Übersetzer wissenschaftlichen Wissens, sondern gemäß seiner eigenen Selektions- und Verarbeitungsmechanismen. Grundlage dieser Studie bilden in diesem Zusammenhang vor allem die Nachrichtenwerttheorie, das Framing-Konzept und journalistische Qualitätsfaktoren.
Zur Wissenschaftsberichterstattung existieren bereits zahlreiche Studien, die sich mit verschiedenen empirischen Methoden, sowohl allgemeinen als auch themenspezifischen Darstellungen in allen Medienarten gewidmet haben. Zum Thema Klonen gibt es bisher nur qualitative Querschnittsanalysen, die keinen repräsentativen Charakter haben. Daher wurde dieser Forschungsbereich durch eine umfassende Längsschnittanalyse ergänzt.
Geprüft wurde, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in der Darstellung des Klonens zwischen deutschen und britischen Medien gibt. Dies ist von besonderem Interesse, da beide Länder völlig unterschiedliche rechtliche Regelungen und Anwendungsmöglichkeiten in Bezug auf die Klonforschung haben. Dabei steht im Vordergrund das Erkenntnisinteresse nach den relevanten Nachrichtenfaktoren, weiterhin wie die Verfahren und Ziele des reproduktiven und therapeutischen Klonens inhaltlich vermittelt werden, wie der nationale und internationale Umgang mit der Klonforschung beschrieben wird und wie die die Berichterstattung sprachlich und illustrativ unterstützt wird. Als geeignetes Erhebungsinstrument wurde die Inhaltsanalyse gewählt. Untersuchungsgegenstand sind die meinungsführenden Nachrichtenmagazine Der Spiegel für Deutschland und The Economist für Großbritannien. Im Untersuchungszeitraum, der sich von Januar 1997 […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Klonforschung als Untersuchungsgegenstand
2.1 Naturwissenschaftliche Grundlagen
2.1.1 Der Begriff Klon
2.1.2 Natürliche Entstehung von Klonen
2.1.3 Künstliche Erzeugung von Klonen
2.1.4 Die Verfahren
2.1.5 Techniken
2.1.5.1 Embryo – Splitting
2.1.5.2 Zellkerntransfer
2.1.6 Anwendungsbereiche
2.1.6.1 Reproduktives Klonen
2.1.6.2 Therapeutisches Klonen
2.1.7 Stand der Forschung
2.1.8 Meilensteine der Klonforschung
2.2 Rechtliche Grundlagen
2.2.1 Internationale Regelungen
2.2.2 Europarechtliche Regelungen
2.2.3 Nationale Regelungen
2.2.3.1 Die deutsche Rechtslage
2.2.3.2 Die britische Rechtslage
2.3 Klonen als Wissenschaft und Technik
2.3.1 Wissenschaft
2.3.2 Technik / Technologie
2.3.3 Biotechnologie
3 Wissenschaftsberichterstattung: Wissenschaft – Medien – Öffentlichkei
3.1 Die Relevanz der Massenmedien für die öffentliche Kommunikation über Wissenschaft und Technik
3.1.1 Definition Massenmedien und Massenkommunikation
3.1.2 Massenmediale Öffentlichkeit
3.1.3 Funktion der Massenmedien
3.2 Wissenschaftsjournalismus
3.2.1 Begriffsbestimmung
3.2.2 Perspektiven der Wissenschaftsjournalismus – Forschung
3.2.2.1 Das Paradigma Wissenschaftspopularisierung
3.2.2.2 Journalismus als autonomer Beobachter
3.2.3 Die Situation des Wissenschaftsjournalismus
3.2.3.1 Die Situation in Deutschland
3.2.3.2 Die Situation in Großbritannien
3.3 Selektion, Aufbereitung und Rezeption von Wissenschafts- informationen
3.3.1 Medien und Realität
3.3.2 Selektionsprozesse
3.3.2.1 Gatekeeper-Forschung
3.3.2.2 Nachrichtenwert und Nachrichtenfaktoren
3.3.2.3 Das Framing – Konzept
3.3.3 Vermittlung von Inhalten
3.3.3.1 Arten der Vermittlung von Wissenschaft
3.3.3.2 Das Fachsprachenmodell nach Hoffmann
3.3.3.3 journalistische Qualitätsfaktoren
3.3.4 Rezeption der Nachrichten
3.4 Vergleich deutscher – britischer Journalismus
3.5 Forschungsstand
3.5.1 Wissenschaft in den Medien
3.5.2 Biotechnologie in den Medien
3.5.2.1 Biotechnologie allgemein
3.5.2.2 Gentechnik
3.5.3 Klonen in den Medien
3.5.4 Öffentliche Meinung zum Klonen
3.5.5 Einordnung / Nutzen der vorliegenden Arbeit
4 Forschungsdesign
4.1 Forschungsfragen und Hypothesen
4.2 Die Inhaltsanalyse als Methode
4.2.1 Begriffsbestimmung
4.2.2 qualitative und quantitative Aspekte der Forschung
4.3 Untersuchungsgegenstand
4.3.1 Der Spiegel
4.3.2 The Economist
4.4 Die empirische Erhebung
4.4.1 Grundgesamtheit und Stichprobe
4.4.2 Untersuchungszeitraum
4.4.3 Analyseeinheiten
4.5 Das Kategoriensystem
4.5.1 Grundlagen Kategorien und Codebuch
4.5.2 Anforderungen an das Kategoriensystem
4.5.2.1 Trennschärfe
4.5.2.2 Validität
4.5.2.3 Reliabilität
4.5.3 Codebuch vor dem Pretest
4.5.4 Codebuch nach dem Pretest
4.6 Reliabilitätstest
5 Ergebnisse
5.1 Forschungsfrage 1 – Nachrichtenfaktoren
5.2 Forschungsfrage 2 – Vermittlung der Verfahren und Ziele
5.2.1 Wissensvermittlung
5.2.2 Framing
5.3 Forschungsfrage 3 – Darstellung des nationalen und internationalen Umgangs
5.4 Forschungsfrage 4 – illustrative und sprachliche Darstellung
6 Schlussbetrachtung
6.1 Zusammenfassung
6.2 Fazit und Ausblick
7 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: reproduktives und therapeutisches Klonen (Schwarz 2004: 15)
Abbildung 2: Formen der massenmedialen Thematisierung von Wissenschaft (Peters 1994: 170)
Abbildung 3: Ziele und Kriterien der Qualitätsbewertung (Ruß-Mohl 1992: 86)
Abbildung 4: Erscheinungsjahr
Abbildung 5: Anlass der Berichterstattung
Abbildung 6: Wissensvermittlung therapeutisches Klonen
Abbildung 7: Wissensvermittlung reproduktives Klonen
Abbildung 8: Frames
Abbildung 9: Einsatzmöglichkeiten des Klonens
Abbildung 10: Gesetzesstatus therapeutisches Klonen
Abbildung 11: Status Menschenklone
1 Einleitung
Als im Juli 1996, in einem Stall im schottischen Edinburgh, Dolly das Licht der Welt erblickte, ahnten ihre Schöpfer noch nicht, welche Aufregung das Lamm bald erregen würde. Mehrere Monate vergingen, bis das Wissenschaftsmagazin „Science“ in einer unscheinbaren Pressemitteilung über die Geburt berichtete (vgl. Zinkant 2007) – und plötzlich stand die Welt Kopf. Eine Flut hysterischer Meldungen jagte um den Globus. Denn Dolly war kein gewöhnliches Schaf. Sie war das erste Säugetier, was jemals aus einem bereits ausgewachsenen Tier geklont wurde – die identische Kopie ihrer Mutter. Dieses Ereignis wurde zum einen als wissenschaftliche Sensation gefeiert, zum anderen warf es zahlreiche Fragen auf. Werden bald die ersten Menschen geklont werden, eine Armee von Einsteins oder Ghandis? Wird es reichen Leuten möglich sein, ihre toten Verwandten zum Leben zu erwecken oder gar sich selbst neu zu erschaffen? Werden geklonte Menschen als Ersatzteillager gezüchtet werden? Wie weit darf die Wissenschaft gehen? Aldous Huxleys Utopie der „Schönen neuen Welt“ schien plötzlich eine ganz neue Bedeutung zu bekommen. Inzwischen ist das Klonen von Tieren schon fast zur Routine geworden. Hund, Katze, Maus, Affe und Schwein, die Liste geklonter Tiere ist lang (vgl. Heinemann 2005: 185ff.). Das reproduktive Klonen von Menschen hingegen ist in den meisten Ländern der Erde offiziell geächtet, wenn auch nicht überall verboten. Es steht also weiterhin die Frage im Raum, ob es den geklonten Homo sapiens jemals geben wird.
Im gleichen Atemzug sind weitere Fragen entstanden: Gelten die moralischen Bedenken auch, wenn mit Hilfe der Klontechnik Millionen Menschen von ihren Krankheiten geheilt werden können? Die so genannten embryonalen Stammzellen gelten als medizinische Verheißung. Sie haben das Potential sich zu allen Zellen des Körpers auszudifferenzieren. Mit ihrer Hilfe könnte es in Zukunft möglich sein, schwere Krankheiten, wie Parkinson, Alzheimer oder Querschnittslähmung zu heilen. Werden diese Zellen aus geklonten Embryonen eines Patienten gewonnen, könnte man aus ihnen quasi maßgeschneidertes Gewebe züchten. Dieses Verfahren wird auch als therapeutisches Klonen bezeichnet (vgl. Berger 2007: 31f.).
Doch während die einen auf neuartige Therapien hoffen, kritisieren andere die Erzeugung und Zerstörung von Embryonen als Verletzung der Menschenwürde. 2001 hat Großbritannien als erstes Land weltweit das therapeutische Klonen zu Forschungszwecken genehmigt (vgl. §2 Abs.2 HFE Regulations 2001). In Deutschland dagegen existieren strenge Regelungen, die jegliches Klonen von Menschen ganz klar verbieten (vgl. §6 Art.1 ESchG).
Dabei stellt sich die Frage, wie Gesellschaften Wissenschaft kontrollieren und einen Rahmen für den Umgang mit ihr schaffen. Was für die Politik seit dem Bestehen von Demokratien gilt, gilt immer mehr auch für die Wissenschaft: Sie steht nicht immer in unangefochtener Position, sondern ist auf die allgemeine Zustimmung angewiesen. Dies gilt besonders für neue Forschungszweige, wie die Gentechnik, die Stammzellenforschung und eben das Klonen, da sie brisante ethische Fragen aufwerfen und das menschliche Selbstverständnis in Frage stellen. Bei diesen Debatten nehmen die Massenmedien eine bedeutende Rolle ein. „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann 1996: 9). Ihre Übermittlungsleistung prägt das öffentliche Meinungsbild entscheidend. Die Medien stellen zum einen die Arena dar, in der wissenschaftlich-technologische Entwicklungen vorgestellt und diskutiert werden, zum anderen müssen sie ihrer Kritik- und Kontrollfunktion nachkommen, indem sie Sachverhalte interpretieren und werten. Dies tun sie nicht als reiner Übersetzer wissenschaftlichen Wissens, sondern gemäß ihrer eigenen Selektions- und Verarbeitungsmechanismen.
In der vorliegenden Arbeit steht die Frage im Vordergrund, wie das Thema Klonforschung in Deutschland und in Großbritannien seit Dollys Geburt medial vermittelt wird. Da sich beide Länder in grundlegenden Rechtsfragen und damit auch in den Anwendungsmöglichkeiten und Forschungserfolgen stark unterscheiden, soll untersucht werden, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich in der Darstellung auftun und welche Gründe dies haben könnte. Die Forschungsfrage lautet demnach: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es in der deutschen und britischen Berichterstattung über das Thema Klonen?
Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Entwicklungen der Klonforschung sowie die internationalen und die jeweiligen nationalen gesetzlichen Regelungen herausgearbeitet.
Der zweite Teil widmet sich der Wissenschaftsberichterstattung mit ihren verschiedenen Funktionszuweisungen und den spezifischen Selektions- und Vermittlungsprozessen. Anschließend wird ein Überblick über den Forschungsstand zur Wissenschaft, und insbesondere zu Biotechnologie und Klonen in den Medien gegeben.
Auf den Theorieteil folgend, werden hinsichtlich des Erkenntnisinteresses Hypothesen gebildet und ein geeignetes Forschungsdesign entwickelt und angewendet. Anschließend werden die Ergebnisse dargestellt und zusammengefasst. In einem abschließenden Fazit wird schließlich der Forschungsprozess kritisch beleuchtet und ein Ausblick auf weiterführende Möglichkeiten der Forschung gegeben.
2 Die Klonforschung als Untersuchungsgegenstand
Die Geburt des Klonschafes Dollys ist für viele ein Meilenstein in der Geschichte der Biotechnologie. Durch diesen Forschungserfolg rückten die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten des therapeutischen und reproduktiven Klonens erstmals in greifbare Nähe. Um die Inhalte der Medienberichterstattung zu verstehen und richtig einordnen zu können, werden in Kapitel 2.1 zunächst die naturwissenschaftlichen Grundlagen und die Anwendungsbereiche des Klonens dargestellt. Für einen länderspezifischen Vergleich der medialen Darstellung eines Themas wie dem Klonen, ist es zudem notwendig, die rechtlichen Grundlagen der jeweiligen Länder und damit auch mögliche Unterschiede herauszuarbeiten. Daher sind in Kapitel 2.2 die internationalen Stellungnahmen und die nationalen Regelungen Deutschlands und Großbritanniens aufgezeigt. In Kapitel 2.3 folgt die Einordnung des Klonens in die Wissenschaftsbereiche der Biotechnologie und der Biomedizin.
2.1 Naturwissenschaftliche Grundlagen
Im folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff des Klons definiert und sowohl die natürliche Entstehung, als auch die künstliche Erzeugung von Klonen mit den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten erläutert. Eine Übersicht der Meilensteine der Klonforschung findet sich in Kapitel 2.1.8.
2.1.1 Der Begriff Klon
Der Begriff des Klons Klon geht zurück auf das griechische Wort klōn für Sprössling oder Abkömmling (vgl. Brockhaus 2006a: 179).
Er bezeichnet „a group of genetically identical cells or organisms originating from one single ancestral cell or organism” (Kahl 2001: 133).
Der Begriff lässt sich demnach nach verschiedenen Gesichtspunkten differenzieren. Auf der einen Seite bezeichnet man zwei Zellen als Klone, die aus einer einfachen Zellteilung[1] hervorgegangen und somit genetisch identisch sind. Nach dieser Definition ist jeder Mensch ein Klon, da sich seine 100 Billionen Körperzellen aus einer einzigen befruchteten Eizelle gebildet haben. Unter diese Bedeutung des Begriffes fällt auch die Genklonierung, bei der nur einzelne DNA-Sequenzen isoliert und geklont werden. So kann z.B. das Gen für Insulinproduktion aus einer menschlichen Zelle entnommen und einem Bakterium eingepflanzt werden, das dann menschliches Insulin erzeugt (vgl. Clausen 2006: 15).
In der zweiten Verwendungsweise bezeichnet man ganze Organismen als Klone, sobald sie genetisch identisch sind. Während also in der ersten Bedeutung einzelne Zellen als Klon bezeichnet wurden, handelt es sich hier um ganze Lebewesen, bzw. Zellkulturen (vgl. ebd.: 15).
Die künstliche Erzeugung gleichartiger Zellen oder Organismen nennt man Klonen. Die Vermehrung von DNA-Sequenzen wird hingegen oft als Klonieren bezeichnet (vgl. Brockhaus 2006a: 181).
2.1.2 Natürliche Entstehung von Klonen
Auf natürlichem Weg entstehen Klone durch asexuelle, d.h. ungeschlechtliche Vermehrung, wie es z.B. bei Einzellern wie Bakterien und Hefen der Fall ist. Bei ihrer Fortpflanzung teilt sich die Zelle in zwei genetisch identische Tochterzellen. Das bedeutet, es kommt nicht zu einer Neuordnung der Gene.
Demgegenüber steht die sexuelle, d.h. geschlechtliche Vermehrung, bei der sich die elterlichen, jeweils haploiden[2] Chromosomensätze, zu einem diploiden[3] Genom kombinieren (vgl. Heinemann 2005: 28f.).
Ein weiteres Beispiel für natürliche Klone, die durch asexuelle Fortpflanzung erzeugt werden, sind Regenwürmer und eine Reihe von Pflanzenarten. Sie können sich aus abgetrennten Teilen eines Organismus zu vollständigen Lebewesen entwickeln.
Auch die Küchenzwiebel und die Kartoffel sind Klone, da sie sich über spezifische, ungeschlechtliche Fortpflanzungsorgane vermehren. Dies nutzt man vor allem in der modernen Pflanzenzüchtung zur Erzeugung ertragreicher Nachkommen (vgl. Deckwer/Pühler/Schmid 1999: 438).
Es können jedoch auch natürliche Klone bei höheren Lebewesen entstehen, die sich durch geschlechtliche Fortpflanzung vermehren. Teilt sich der frühe Embryo mit seinem diploiden Chromosomensatz in eine oder mehrere unabhängige Zellen, entwickeln sich eineiige Zwillinge oder andere Mehrlinge. Auch sie besitzen untereinander das identische Erbgut (vgl. Brockhaus 2006a: 179ff.).
2.1.3 Künstliche Erzeugung von Klonen
Die verschiedenen Verfahren des künstlichen Klonens werden in der Literatur als Techniken (vgl. z.B. Heinemann 2005: 45ff.) bezeichnet und dem Wissenschaftsbereich der Biotechnologie zugeordnet (vgl. Altner 1998: 148), was in Kapitel 2.3 genauer erläutert ist. Sie verfolgen jeweils unterschiedliche Ziele mit dem Einsatz unterschiedlicher Mittel (vgl. z.B. Heinemann 2005: 45ff.) Nicht erst seit der Geburt von Klonschaf Dolly 1997 ist es möglich, Klone künstlich zu erzeugen. Im Folgenden werden die verschiedenen Techniken eingehend erläutert und durch Erfolge in der Praxis ergänzt. Weiterhin werden die beiden Anwendungsbereiche, das reproduktive und das therapeutische Klonen, anhand praktischer Einsatzmöglichkeiten dargestellt.
2.1.4 Die Verfahren
Das Klonen von Genen und Zellen
Bei der so genannten Genklonierung werden einzelne DNA-Fragmente z.B. aus einem menschlichen Genom isoliert und in Wirtszellen, wie Bakterien oder Viren, eingebaut. Diese kann man anschließend vermehren und somit unbegrenzte Mengen des gewünschten Genproduktes herstellen. So lässt sich z.B. menschliches Insulin oder Interferon in großen Mengen erzeugen. Diese Technik ist jedoch in die Disziplinen der Gentechnik einzuordnen und soll hier nur am Rande erwähnt sein (vgl. Regenass-Klotz 2005: 40ff.).
Das Klonen vollständiger Organismen
Die gesellschaftlichen Kontroversen drehen sich vor allem um die künstliche Erzeugung von Tieren und Menschen. Dabei unterscheidet man zwischen therapeutischem und reproduktivem Klonen. Beide Arten verfolgen unterschiedliche Ziele, verwenden jedoch dieselben Techniken. Wenn im Folgenden von Klonen die Rede ist, geht es ausschließlich um das Klonen vollständiger Organismen
2.1.5 Techniken
2.1.5.1 Embryo – Splitting
Unter dem Begriff Embryo-Splitting versteht man „die Zwillingsbildung durch künstliche Teilung des Embryos“ (Heinemann, 2005: 200). Dafür gibt es zwei unterschiedliche Methoden, die sich die frühen Entwicklungsphasen des Embryos zunutze machen. Bis zum 8-Zellenstadium sind die Zellen noch totipotent, d.h. jede einzelne besitzt die Fähigkeit, sich unabhängig zu einem eigenen Organismus zu entwickeln. Werden Zellen aus dem Verband getrennt und in intakte Schutzhüllen transferiert, können sich theoretisch bis zu acht identische Embryonen entwickeln. Die einzelnen Zellen des Haufens nennt man auch Blastomere, weshalb diese Form des Embryo-Splittings als Blastomeren-Separation bezeichnet wird.
Doch auch nach dem 8-Zellenstadium und dem Verlust der Totipotenz ist eine künstliche Mehrlingsbildung möglich. Teilt man einen bereits weiter entwickelten Zellverband, ist der Embryo in der Lage verlorenes Gewebe entsprechend nachzubilden.
Beide dieser Formen können auch auf natürlichem Weg bei der Entstehung von eineiigen Zwillingen vorkommen (vgl. Clausen 2006: 24ff.).
1891 wurde erstmals ein künstliches Embryonen-Splitting durchgeführt. Dabei klonte Hans Driesch durch Blastomeren-Separation einen Seeigel. Den gleichen Erfolg hatte man bei einem Rhesusaffen im Jahr 2000 (vgl. Heinemann 2005: 200ff.). 1993 gelang es Jerry Hall auf diesem Weg menschliche Klone herzustellen. Er setzte sie jedoch nicht in eine Gebärmutter ein (vgl. Leiner 2005). Gegenwärtig wird die Technik bereits seit geraumer Zeit in der Landwirtschaft zur Zucht wertvoller Nutztiere wie z.B. Rinder eingesetzt (vgl. Deutscher Bundestag 2001).
2.1.5.2 Zellkerntransfer
Die Technik des Zellkerntransfers macht es möglich, einen fast identischen Nachkommen eines bereits erwachsenen Lebewesens zu erzeugen. Die häufig verwendete Abkürzung SCNT steht für „Somatic Cell Nuclear Transfer“. Für dieses Verfahren benötigt man eine Empfänger-Eizelle und eine ausdifferenzierte Körperzelle eines Spenderlebewesens. Der Eizelle entfernt man zunächst den Zellkern und injiziert ihr dann die komplette Spenderzelle oder nur deren Zellkern. In dem spezifischen Milieu der Eizelle liegt nun ein diploider Chromosomensatz vor, der dem Zustand der Befruchtung gleicht (vgl. Berger 2005: 30). Damit anschließend die erste Zellteilung stattfindet und das Genom sozusagen reprogrammiert wird, muss ein Aktivierungsprogramm simuliert werden. Dazu verwendet man in der Regel elektrische oder chemische Impulse. Der Embryo kann nun in die Gebärmutter eines Ammentieres eingepflanzt werden und entwickelt sich im Idealfall zu einem vollständigen Organismus, dem Klon des Zellkernspenders (vgl. Heinemann 2005: 173f.).
Auch Dolly ist auf diesem Wege entstanden. Als das Schaf am 05.Juli 1996 im schottischen Edinburgh zur Welt kam, ahnte die Öffentlichkeit noch nichts von dem Ereignis. Erst zwei Monate später gaben ihre Schöpfer, Ian Wilmut und Keith Campbell im Wissenschaftsmagazin „Nature“ die Geburt des ersten Säugetieres bekannt, dass aus Körperzellen eines ausgewachsenen Tieres geklont ist (vgl. Zinkant 2007). Dolly stammt aus einer differenzierten Euterzelle eines 6-jährigen Finn-Dorset-Schafes. Diese wurde in einem Nährmedium vervielfältigt und vollständig in 277 Eizellen verschiedener Scottish-Blackface-Schafe integriert. Aus diesen 277 Versuchen entwickelten sich 29 Embryonen, die in 13 Schafe der Rasse Scottish-Blackface eingepflanzt wurden. Nur eines von ihnen brachte ein geklontes Finn-Dorset-Lamm, Dolly, zur Welt. Die Erfolgsquote des Versuches lag damit bei 0,4 Prozent (vgl. Wilmut/Campbel/Tudge 2001: 270f.).
1997, ein Jahr nach Dollys Geburt, glückte am schottischen Rosslin-Institut das Klonen eines transgenen Tieres. Das Schaf Polly verfügte zusätzlich über ein künstlich eingeschleustes menschliches Gen (vgl. ebd.: 288f.).
Die ersten Erfolge mit dem Verfahren des Zellkerntransfers konnten 1952 R. Briggs und T. King verzeichnen. Sie übertrugen Zellkerne von Fröschen in 104 zuvor entkernte Eizellen. Daraus entwickelten sich 27 Kaulquappen, am Ende jedoch kein Frosch (vgl. Schuh 2005).
Seit der Geburt Dollys wurde die Technik erfolgreich an Mäusen, Rindern, Schweinen, Kaninchen, Hunden usw. angewendet (vgl. Heinemann 2005: 185ff.).
Ende 2001 behauptete das US-amerikanische Biotechnikunternehemn Advanced Cell Technologies, erstmals einen menschlichen Embryo geklont zu haben, der allerdings nach wenigen Zellteilungen starb (vgl. Sentke/Bahnsen 2001).
Mittlerweile klont Dolly-Schöpfer Wilmut in Großbritannien humane embryonale Stammzellen, mit dem Ziel, die Nervenkrankheit ALS[4] zu untersuchen. Seit Beginn 2005 hat er eine Lizenz der zuständigen Regierungsbehörde (vgl. Gerewitz 2005: 14).
Die Erfolgsrate des Zellkerntransfers ist allerdings relativ gering. Aus den Versuchen gehen nur zu 3-5 Prozent lebende Tiere hervor. Diese haben zudem meist Fehlbildungen wie Organdefekte oder eine ungewöhnliche Körpergröße. Als Ursache hierfür wird eine unvollständige Reprogrammierung des Genoms vermutet. Weiterhin setzen bei geklonten Tieren oft vorzeitige Alterungserscheinungen ein, was an bereits verkürzten Chromosomenenden des Spendertieres liegen kann (vgl. Heinemann 2005: 192f.).
2.1.6 Anwendungsbereiche
Bezüglich der Anwendungsbereiche lassen sich zwei Formen des Klonens unterscheiden, das reproduktive und das therapeutische Klonen. Obwohl bei beiden die gleichen Verfahren zum Einsatz kommen können, verfolgen sie unterschiedliche Ziele.
2.1.6.1 Reproduktives Klonen
Wie bereits in Kapitel 2.1.5 erläutert, können durch die Verfahren des Embryo-Splittings und des Zellkerntransfers vollständige Organismen geklont werden. Wie die Abbildung 1 zeigt, ist es das Ziel des reproduktiven Klonens, aus einem bereits existierenden Lebewesen einen genetisch identischen Nachkommen zu erzeugen und auch austragen zu lassen (vgl. Berger 2007: 42). Das reproduktive Klonen auf den Menschen anzuwenden, ist in den meisten Ländern der Welt, so auch in Deutschland und Großbritannien, verboten. Darauf wird später näher in Kapitel 2.2 eingegangen.
Bei Tieren kommt das Verfahren bereits mit unterschiedlichen Zielen zum Einsatz. Besonders für Tierzüchter und die Pharmaindustrie besteht großes Interesse.
Transgene Tiere
Eine Anwendungsmöglichkeit der Klontechnik liegt auf dem Gebiet der Pharmaindustrie im Klonen transgener Tiere. Diese Tiere werden erzeugt, indem man während der Befruchtung ein kloniertes fremdes Gen in sie einschleust. Dieses Gen ist mit einer bestimmten Funktion verknüpft, die man im besten Fall auf das Tier überträgt (vgl. Schenkel 2006: 3).
Im September 1991 wurde im schottischen Edinburgh eines der bekanntesten transgenen Tiere geboren, das Schaf Tracy. Seinen Schöpfern war es gelungen, ein menschliches Gen in die Schafseizelle zu integrieren. Durch dieses Gen schied das Schaf große Mengen eines pharmazeutisch wirksames Protein mit seiner Milch aus, das menschliche Alpha-1-Antitrypsin (AAT). Es stoppt den Abbau der Lunge bei Menschen mit angeborenem AAT-Mangel. Medikamente aus transgenen Tieren lassen sich viel preisgünstiger und in größeren Mengen herstellen, als es in Bioreaktoren der Fall ist (vgl. Ärztezeitung 1997). Wirtschaftlich nutzbar werden transgene Tiere jedoch erst durch das Klonen. Man muss in diesem Zusammenhang wiederholt betonen, dass Klonen keine Gentechnik ist. Durch Gentechnik wird die DNA eines Lebewesens verändert, mit Hilfe des Klonens kann sie und damit das komplette Lebewesen, kopiert werden. Man kann demnach beide Techniken kombinieren und so transgene Tiere mit ihren speziell entstandenen Merkmalen klonen (vgl. Podschun 1999: 44).
Dadurch lassen sich die Tiere gezielter züchten. Würden sie sich sexuell fortpflanzen, könnte man durch die Vermischung des Erbmaterials nicht ausschließen, dass das neue Gen seine Funktion verliert (vgl. Ach/Brudermüller/Runtenberg 1998: 28). 1997 versuchte man Tracy zu klonen und erzeugte nach mehreren Anläufen Polly, das erste geklonte transgene Säugetier (vgl. Wilmut/Campbel/Tudge 2001: 288).
Eine weitere Einsatzmöglichkeit transgener Tiere ist die Xenotransplantation. Mit diesem Verfahren transplantiert man dem Menschen Organe von artfremden Lebewesen wie z.B. Schweinen. Diese müssen jedoch meist zuvor gentechnisch verändert werden, um Abstoßungsreaktionen des menschlichen Immunsystems abzumildern. Ist das Genom „bereinigt“, können die Tiere geklont werden, um sie anschließend für mehrere Transplantationen verwenden zu können (vgl. Podschun 1999: 335f.).
Zuchttiere
Eine weitere Einsatzmöglichkeit für das reproduktive Klonen stellt das Kopieren wertvoller und teurer Zuchttiere dar. So kann man die Nutztiere verjüngen bzw. Sicherheitskopien von ihnen anfertigen oder Gewebe an andere Züchter verkaufen. Am 02.Dezember 2006 wurde in Großbritannien erstmals ein Holsteiner-Kalb geboren, was zwar selbst nicht geklont wurde, aber eine geklonte Kuh als Mutter hat. Vandy-K Integrity Paradise 2 ist der Klon einer preisgekrönten Milchkuh im Wert von 50.000 Dollar. Ob die Milch oder das Fleisch von Nachkommen geklonter Tiere auf den Markt kommen dürfen, wird die zuständige Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA bis Ende 2007 prüfen (vgl. Charisius 2007).
Die Technik des Embryo-Splittings wird bereits seit langem in der Landwirtschaft eingesetzt. So kann man beispielsweise aus der befruchteten Eizelle einer Hochleistungskuh mehrere identische Nachkommen erzeugen, die von weniger wertvollen Kühen ausgetragen werden können (vgl. Ach/Brudermüller/Runtenberg 1998: 27). Wie in Kapitel 2.1.5.1 erläutert ist, sind diese nur untereinander geklont, haben jedoch zwei Elterntiere.
Bedrohte Tierarten
Mit Hilfe des reproduktiven Klonens sollen künftig auch bedrohte Tierarten vor dem Aussterben bewahrt werden. So kamen beispielsweise im Oktober 2005 im südkoreanischen Seoul 2 geklonte Wölfe zur Welt, die in der Wildnis gar nicht mehr existieren. Wissenschaftler der Nationaluniversität hatten das Erbgut eines in Gefangenschaft lebenden Wolfes mit Hundeeizellen kombiniert und die Embryonen von Hündinnen austragen lassen (Süddeutsche Zeitung 2007).
2.1.6.2 Therapeutisches Klonen
Unter der Technik des therapeutischen Klonens versteht man die Gewinnung von Embryonen ausschließlich zum Zweck der Forschung. Im Gegensatz zum reproduktiven Klonen, bei dem die Embryonen in die Gebärmutter eingesetzt und ausgetragen werden, werden sie bei dieser Technik nur wenige Tage am Leben erhalten. Wie Abbildung 1 veranschaulicht, besteht das Ziel darin, aus ihnen embryonale Stammzellen zu gewinnen, um Gewebe zu züchten, dessen Erbgut exakt mit dem des Patienten übereinstimmt (vgl. Berger 2007: 31f.). Im Folgenden wird erläutert, welche verschiedenen Arten von Stammzellen es gibt, welche spezifischen Eigenschaften und Funktionen sie haben und wie sich diese für die Medizin nutzen lassen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: reproduktives und therapeutisches Klonen (Schwarz 2004: 15)
Stammzellen können nicht nur aus Embryonen gewonnen werden, sondern auch aus vielen ausgewachsenen Geweben und Organen. Stammzellen sind Zellen, die sich im Gegensatz zu Somazellen noch nicht spezialisiert haben und in der Lage sind, sich zu teilen und zu verschiedenen Zelltypen auszudifferenzieren (vgl. Schwarz 2004: 12). Diese Fähigkeit nennt man Pluripotenz. Totipotente Zellen aus dem frühen Embryo hingegen können sich bei einer Abtrennung noch zu einem eigenständigen Organismus entwickeln. Je nach Entwicklungsstadium des Lebewesens existieren embryonale, fetale und adulte Stammzellen (vgl. Deutsche Forschergemeinschaft 2006).
Adulte Stammzellen
Adulte Stammzellen befinden sich nach dem heutigen Stand der Forschung in 20 Organen des erwachsenen und kindlichen Körpers, wie z.B. im Blut, im Knochenmark, im Gehirn und sogar in der Nabelschnur. Ihre Aufgabe ist die ständige Regeneration des spezifischen Gewebes. Sie können sich im Vergleich zu embryonalen Stammzellen bislang nur begrenzt vermehren und differenzieren (vgl. ebd.).
Fetale Stammzellen
Auch aus abgetriebenen fünf- bis neunwöchigen Föten lassen sich Stammzellen gewinnen. Ihnen werden Vorläufer von Ei- oder Samenzellen entnommen. Diese können sich zu Zellen entwickeln, die sich von embryonalen Stammzellen kaum unterscheiden (vgl. ebd.).
Embryonale Stammzellen
Die embryonalen Stammzellen liegen im Inneren der Blastozyste, also des frühen Embryos und besitzen die Eigenschaft, sich zu fast allen Zelltypen des Körpers differenzieren zu können (vgl. Heinemann 2005: 194).
Das Ziel der Wissenschaftler ist es, sie zu extrahieren und mit ihnen quasi maßgeschneidertes Gewebe für Patienten zu züchten (vgl. Heinemann 2005: 194). Dieses Verfahren bezeichnet man als therapeutisches Klonen. Um die embryonalen Stammzellen zu gewinnen muss ein menschlicher Embryo erzeugt werden, der mit dem Patienten genetisch identisch und somit dessen Klon ist. Dabei macht man sich die Technik des Zellkerntransfers zunutze und injiziert das Erbmaterial einer Körperzelle des Patienten in eine gespendete Eizelle. Nach einer Aktivierung kann sich die Zelle zu einem Embryo weiterentwickeln. Auf diese Weise ist auch das Klonschaf „Dolly“ entstanden (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2006).
Der Begriff therapeutisches Klonen ist jedoch irreführend. Das Klonen allein hat noch keinen therapeutischen Wert, sondern erst die Verwendung der gezüchteten Gewebe oder Organe. Doch dies ist derzeit noch unausführbar (vgl. Berger 2007: 32).
2.1.7 Stand der Forschung
Adulte Stammzellen werden bereits seit vier Jahrzehnten bei der Transplantation von Knochenmark zur Behandlung von Blutkrankheiten wie Leukämien eingesetzt. Weiterhin konnten klinische Studien zeigen, dass Knochenmarkstammzellen die Funktion des Herzens nach einem Herzinfarkt verbessern konnten. In welche Art von Zellen sie sich dabei umwandeln, ist jedoch noch unklar (vgl. Donner 2006). Im Vergleich zu embryonalen Stammzellen können sich die adulten bislang nur begrenzt vermehren und differenzieren (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2006).
Da sich embryonale Stammzellen hingegen in nahezu alle Gewebearten entwickeln können, werden in sie große Hoffnungen gesetzt. So sollen sie neue Therapiemöglichkeiten zur Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose oder Alzheimer und einer Reihe anderer Krankheiten ermöglichen (vgl. Berger 2007: 33f.). Durch ihren Einsatz können auch die Abstoßungsreaktionen des Körpers minimiert werden. Im Gegensatz zu fetalen Stammzellen ist das kultivierte Ersatzgewebe aus embryonalen Stammzellen genetisch identisch mit dem des Zellkernspenders und gleichzeitigen Transplantatempfängers. Es ist noch nicht absehbar, ob ganze Organe wie Herzen oder Leber erzeugt werden können, aber bereits die Züchtung von Zellkulturen könnte geschädigte Gewebe zur Regeneration anregen (vgl. Heinemann 2005: 194). Der südkoreanische Forscher Hwang Woo-suk hatte 2004 behauptet, den ersten Menschenklon erzeugt und aus ihm Stammzellen gewonnen zu haben. Die Forschung erwies sich jedoch als Fälschung. In Europa klonte das britische Forscherteam um Miodrag Stojkovic 2005 erstmals menschliche Embryonen (vgl. Die Zeit 2005).
2.1.8 Meilensteine der Klonforschung
1891
Hans Driesch führt das erste Tierklonexperiment durch, indem er einen Seeigelembryo im 2-Zellenstadium teilt und so künstlich eineiige Zwillinge erzeugte. Diese Technik bezeichnet man heute als Embryonen-Splitting (vgl. Heinemann 2005: 200f.).
1928
Der deutsche Forscher Hans Spemann klont einen Molch, indem er mit einem Haar eine kernlose Stelle der befruchteten Eizelle abschnürte und sie sich bis zum 16-Zellenstadium teilen ließ. Dann wanderte einer der Zellkerne in den kernlosen Teil. Diesen trennte Spemann ab und ein eigener Molchembryo entwickelte sich. Damit war zum ersten Mal ein Zellkerntransfer angewendet worden (vgl. Hillebrandt/Lanzerath 2002: 60).
1951
Robert Briggs und Thomas King klonen Frösche, indem sie Zellkerne in vorher entleerte Eizellen übertragen (vgl. ebd.).
1974
John B. Gurdon klont Krallenfrösche durch Zellkerntransfer von bereits differenzierten Zellen in entkernte Froscheier (vgl. ebd.: 61).
1986
Dem Dänen Steen M. Willadsen gelingt es erstmal mittels Zellkerntransfer ein Schaf aus Embryozellen zu klonen (vgl. ebd.).
1993
Der Amerikaner Jerry Hall klont erstmals menschliche Embryonen durch Embryo-Splitting. Sie erwiesen sich aber als nicht entwicklungsfähig (vgl. ebd.).
1996
Die britischen Wissenschaftler Ian Wilmut und Keith Campbell klonen das Schaf Dolly, indem sie eine Euterzelle eines ausgewachsenen Tieres in eine entkernte Eizelle injizieren. Dieser Erfolg sorgt nach seiner Veröffentlichung in der Zeitschrift „Nature“ im Februar 1997 weltweit für Aufsehen (vgl. Wilmut/Campbel/Tudge 2001: 270ff.).
1997
Li Meng und ihr Forscherteam klonen erstmals zwei Affen aus den Zellkernen von Embryonen (vgl. Hillebrandt/Lanzerath 2002: 62). Außerdem wird das transgene Schaf Polly geboren. Wilmut und Campbell hatten ihm das menschliche Gen für den Blutgerinnungsfaktor IX eingeschleust (vgl. Wilmut/Campbel/Tudge 2001: 288).
1999
Dem Bonner Neurobiologen Oliver Brüstle gelingt es embryonale
Stammzellen aus geklonten Mäuseembryonen zu gewinnen und damit zerstörtes Nervengewebe von Mäusen zu heilen. Das therapeutische Klonen im Tierversuch ist auf diese Weise bewiesen (vgl. Schuh 2005).
2001
Die US-Firma ACT behauptet zum ersten Mal einen menschlichen Embryo nach der Dolly-Methode geklont zu haben. Er soll nach wenigen Zellteilungen gestorben sein. Viele Wissenschaftler bezweifeln jedoch den Erfolg der Experimente (vgl. Sentke/Bahnsen 2001).
2004
Die südkoreanische Forschergruppe um Hwang Woo-suk behauptet, einen menschlichen Embryo geklont und aus ihm Stammzellen gewonnen zu haben. Ein Jahr später erwiesen sich die Ergebnisse als Fälschung (vgl. Charisius 2007).
2005
Der britischen Arbeitsgruppe um den Mediziner Miodrag Stojkovic gelang es innerhalb Europas erstmals, menschliche Embryonen zu klonen. Die britischen Behörden hatten die Versuche, mit dem Ziel Diabetes zu erforschen, bereits im vergangenen Jahr genehmigt (vgl. Die Zeit 2005).
2007
Im Juni 2007 gelang es dem amerikanischen Forscher Shoukhrat Mitalipov erstmals, embryonale Stammzellen aus einem geklonten Rhesusaffenembryo zu gewinnen. Sie konnten zu pulsierenden Herzzellen und Neuronen weiterentwickelt werden. Die Isolation von Stammzellen aus geklonten Embryonen funktionierte bisher nur bei Mäusen (vgl. Charisius 2007).
2.2 Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen, vor allem im Bezug auf den Beginn des Lebens und die damit verbundene Schutzwürdigkeit des Embryos, sind von Land zu Land verschieden. Das reproduktive Klonen ist in fast allen Ländern der Welt verboten oder ein Verbot wird angestrebt. Das Klonen zu therapeutischen Zwecken ist zurzeit nur Großbritannien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA erlaubt (vgl. Graf 2003: 384ff.).
Im folgenden Kapitel werden die jeweiligen Positionen bezüglich Klonen anhand von Stellungnahmen und rechtlichen Regelungen auf internationaler und EU-Ebene sowie in Deutschland und Großbritannien dargestellt.
2.2.1 Internationale Regelungen
Weder auf der Ebene der Vereinten Nationen noch auf europäischer Ebene existieren derzeit verbindliche Regelungen zur Anwendung der Klontechniken. Dennoch gibt es einschlägige Stellungnahmen, die zumindest empfehlenden Charakters sind.
So hat die UNESCO 1997 die „Allgemeine Erklärung über das menschliche Genom und Menschenrechte“ verabschiedet. Sie soll als Rahmenvorschlag für die jeweiligen nationalen Regelungen gelten, mit dem Ziel einen weltweiten Konsens zu schaffen. Dabei stehen vor allem die Menschenwürde und grundlegende Menschenrechte im Vordergrund (vgl. Berger 2007: 148f.). Im Artikel 11 der Deklaration heißt es: „Praktiken, die der Menschenwürde entgegenstehen, wie das reproduktive Klonen von menschlichen Lebewesen, sollen nicht erlaubt sein“ (Art 11 der UNESCO-Deklaration). Bezüglich des therapeutischen Klonens macht die Deklaration keine genauen Angaben.
Auch die Weltgesundheitsorganisation hat 1997 eine Resolution erlassen, in der das reproduktive Klonen als ethisch unvertretbar deklariert wird. Eine Richtlinie für die Anwendung des therapeutischen Klonens ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgearbeitet. Dennoch wurde wiederholt der potentielle Nutzen dieser Technik für die Forschung betont (vgl. Berger 2007: 152).
2.2.2 Europarechtliche Regelungen
Bei einer ethisch bedenklichen Forschung wie dem Klonen sind die EU und der Europarat bemüht, grenzüberschreitende Regelungen zu finden. Am 07. Dezember 2000 wurde die „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ verabschiedet. In Artikel 3, dem Recht auf Unversehrtheit, heißt es: „Im Rahmen der Medizin und Biologie muss insbesondere beachtet werden: […] d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen“ (GR Charta, Art 3Abs.2).
Die anderen Formen des Klonens werden von der Charta weder gestattet noch verboten. Die Charta ist jedoch nicht rechtsverbindlich und erfüllt lediglich eine Signalwirkung (vgl. Wolf 2005: 48f.).
Am 01.Dezember 1999 ist das „Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte und der Menschenwürde im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin“, kurz MÜB in Kraft getreten. Es ist das erste Rechtsdokument, welches international verbindliche Mindeststandards zum Schutz der Menschenwürde im Bereich der Biomedizin geschaffen hat (vgl. ebd.: 50f.). Die Verordnung untersagt in Artikel 18 ganz klar die Zeugung menschlicher Embryonen zum Zweck der Forschung:
„Artikel 18
(1) Die Rechtsordnung hat einen angemessenen Schutz des Embryos zu gewährleisten, sofern sie Forschung an Embryonen in vitro zulässt.
(2) Die Erzeugung menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken ist verboten“ (Art.18 Menschenrechtskonvention zur Biomedizin).
Das Wort „angemessen“ lässt jedoch in diesem Zusammenhang Raum für Interpretation. Zudem ist im Absatz 2 nicht eindeutig bestimmt, ab wann von einem Embryo gesprochen werden kann, ob gleich nach der Befruchtung oder erst in einem späteren Stadium.
Die Konvention ist keine von sich aus verbindliche Verordnung für die Mitgliedstaaten. Erst wenn diese sie ratifiziert haben, werden die Richtlinien in nationales Recht umgesetzt. Bisher haben 30 Staaten des Europarates unterschrieben und 10 haben sie ratifiziert, Deutschland und Großbritannien bisher nicht. Eine Konfliktlage zwischen dem deutschen EmbrSchG und den Vorschriften der MÜB würde nicht vorliegen. Innerhalb der festgelegten Mindeststandards ist es dem jeweiligen Land vorbehalten, höhere Schutzstandards einzuführen (vgl. Berger 2007: 140ff.).
Der Europarat hat als Ergänzung zum „Menschenrechtsübereinkommen zur Biomedizin“ im Januar 1998 ein Zusatzprotokoll über das Klonverbot menschlicher Lebewesen verabschiedet. Es verbietet nach Artikel 1 „ein menschliches Lebewesen zu erzeugen, das mit einem anderen lebenden oder toten menschlichen Wesen genetisch identisch ist“ (Art.1 Zusatzprotokoll der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin). Die Erzeugung von Embryonen zu Forschungszwecken ist damit jedoch nicht ausgeschlossen. Bislang haben 29 Mitgliedsstaaten des Europarates unterzeichnet, 8 haben es ratifiziert. Die Voraussetzung dafür ist die Einverständniserklärung der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin, an der Deutschland und Großbritannien bisher nicht teilgenommen haben (vgl. ebd.: 144f.).
2.2.3 Nationale Regelungen
Die ethische Beurteilung des Klonens ist von Land zu Land unterschiedlich. Reproduktives Klonen ist in allen Ländern verboten oder soll verboten werden. Das therapeutische Klonen ist europaweit nur in Großbritannien erlaubt. Ex-Premierminister Tony Blair begründete diesen Gesetzesbeschluss damit, dass es wichtig sei „zu erfahren, was die Wissenschaft zu leisten vermag, bevor man ihr Grenzen zieht“ (Blair, 2001). Im Folgenden werden die relevanten rechtlichen Regelungen bezüglich Klonen in Deutschlands und Großbritannien aufgezeigt.
2.2.3.1 Die deutsche Rechtslage
Die Gewinnung embryonaler Stammzellen durch das Klonen von Menschen liegt in Deutschland in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz der Menschenwürde gemäß Art.1 Abs.1 GG und der Freiheit der Forschung gemäß Art.5 Abs.3S.1 GG. Die Forschungsfreiheit ist jedoch nicht unbegrenzt und hat durch das Embryonenschutzgesetz verfassungsrechtliche Schranken bekommen (vgl. Deutsche Forschungsgemeinschaft 2003: 20).
Das Embryonenschutzgesetz
Das in Deutschland verbindliche Embryonenschutzgesetz ist am 01. Januar 1991 in Kraft getreten (vgl. Wolf 2005: 35). Die maßgebliche Norm dieses Beschlusses ist §6 Abs.1, der das Klonen von Menschen unter Strafe stellt:
„Wer künstlich bewirkt, dass ein menschlicher Embryo mit der gleichen Erbinformation wie ein anderer Embryo, ein Fötus, ein Mensch oder ein Verstorbener entsteht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft“ (§6 Art.1 ESchG).
Damit sind sowohl die Techniken des reproduktiven Klonens, Embryo-Splitting und Zellkerntransfer, als auch das Klonen zu Forschungszwecken ausdrücklich verboten. In §6 ist festgelegt, ab welchem Stadium der Embryo als solcher bezeichnet werden kann und somit schutzwürdig ist. Da heißt es:
„Als Embryo im Sinne des Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige, menschliche Eizelle vom Zeitpunkt der Kernverschmelzung an…“ (§8 Art.1 ESchG).
Damit wird das menschliche Leben ab dem Beginn seiner Entwicklung geschützt.
Das Stammzellgesetz
In Ausnahmefällen können Forscher im Ausland gewonnene embryonale Stammzellen importieren und damit forschen. Diese Regelungen sind im deutschen Stammzellengesetz verankert, welches am 01. Juli 2002 in Kraft getreten ist (vgl. Wolf 2005: 39). Nach §4 Abs.1 StZG ist der Import und die Forschung mit embryonalen Stammzellen generell verboten. §4 Abs.2 StZG regelt jedoch die Ausnahmemöglichkeiten. Danach dürfen nur Stammzellen importiert werden, die vor dem 1. Januar 2002 erzeugt und gelagert wurden. Weiterhin dürfen sie nur aus überzähligen Embryonen der künstlichen Befruchtung entstammen und müssen ohne Entgelt zur Verfügung gestellt worden sein (vgl. §4 StZG 2002). Die Regelung des Stichtages soll bewirken, dass Embryonen in anderen Ländern nicht allein für deutsche Forschungszwecke erzeugt und zerstört werden (vgl. Catenhusen 2003: 278f.).
Das Tierschutzgesetz
Das Klonen von Tieren ist in Deutschland unter derzeitigen Bedingungen prinzipiell zulässig und wird nur bedingt durch das seit 1972 bestehende Tierschutzgesetz (TierSchG) eingeschränkt. Es ist im weiteren Sinne durch die Regelungen des §7 TierSchG erfasst (vgl. Schreiner 2005: 21f.), in dem es heißt:
„Tierversuche im Sinne dieses Gesetzes sind Eingriffe oder Behandlungen zu Versuchszwecken
1. an Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden für diese Tiere oder
2. am Erbgut von Tieren, wenn sie mit Schmerzen, Leiden oder Schäden […] verbunden sein können“ (§7 Abs.1 TierSchG).
Doch weder beim Zellkerntransfer noch beim Embryo-Splitting handelt es sich um Eingriffe am Tier oder an dessen Erbgut. Noch befindet sich die Technik des Zellkerntransfers im Experimentalstadium. Kommt es zu einem praktischen Einsatz, könnte §11(b) des Tierschutzgesetzes in Kraft treten. Dieser verbietet Qualzüchtungen. Sollten die Merkmale geklonter Tiere also zu Leiden oder Schäden führen, wäre die Kerntransfertechnik in der Praxis verboten. Aus Sicht der Verfassung würde ein Klonierungsverbot jedoch die Grundrechte der Forschenden gemäß Art.5 Abs.3 GG (Forschungsfreiheit) und Art.12 Abs.11 GG (Berufsfreiheit) verletzen (vgl. Schreiner 2005: 21f.).
2.2.3.2 Die britische Rechtslage
Die Gesetzeslage Großbritanniens bietet der biomedizinischen Forschung einen großen Spielraum. Sie erlaubt es, menschliche Embryonen innerhalb der ersten vierzehn Tage zu Forschungszwecken herzustellen und zu verbrauchen. Das Klonen zu reproduktiven Zwecken ist jedoch ausdrücklich verboten. Bezüglich des Klonens von Tieren existiert zurzeit keine rechtliche Regelung.
HFE Act 1990 und HFE Regulations 2001
Zur Regelung des Umgangs mit menschlichen Embryonen außerhalb des Körpers wurde 1990 der „Human Fertilisation & Embryology Act 1990“, kurz HFE Act, erlassen. Paragraph drei legt zunächst ein grundsätzliches Verbot der Erzeugung, Aufbewahrung und Verwendung menschlicher Embryonen fest, was jedoch durch die Vergabe einer Lizenz eingeschränkt wird (vgl. Heinemann 2005: 365):
„(1) No person shall
(a) bring about the creation of an embryo, or
(b) keep or use an embryo, except in pursuance of a licence”
(Schedule 1 §3 Abs.1 HFE Act 1990).
Diese Genehmigung muss durch die in Paragraph fünf festgehaltene Genehmigungs- und Kontrollbehörde „Human Fertilisation and Embryology Authority, kurz HFEA, erteilt werden. Die Lizenzen werden nur nach eingehender, strenger Prüfung vergeben und nur dann, wenn die Forschung eine der in Schedule 2 §3 Abs.2 festgelegten Ziele verfolgt. Dazu zählt z.B. der Erkenntnisgewinn über die Ursache von erblichen Krankheiten oder die Entwicklung sicherer Verhütungsmethoden (vgl. Schedule 2 §3 Abs.2 HFE Act 1990). Forschungsziele, die das therapeutische Klonen berechtigen, sind jedoch im HFE Act 1990 nicht genannt. Ergänzt wurde dies mit den am 31.01.2001 in Kraft getretenen „Human Fertilisation and Embryology Regulations 2001“, kurz HFE Regulations 2001 (vgl. Berger 2007: 128). Mit dieser Gesetzesausweitung ermöglichen folgende Forschungsziele eine Lizenzvergabe:
„(a) increasing knowledge about the development of embryos;
(b) increasing knowledge about serious disease, or
(c) enabling any such knowledge to be applied in developing treatments for
serious disease” (§2 Abs.2 HFE Regulations 2001).
Damit ist es möglich, Forschung an menschliche Embryonen zu betreiben, um Therapiekonzepte zu entwickeln. Die HFEA muss jedoch weiterhin von der Notwendigkeit der beantragten Forschungsarbeit überzeugt sein (vgl. Berger 2007: 129).
Im HFE Act 1990 sind nicht nur Ziele festgelegt, die eine Forschung berechtigen können, sondern auch Handlungen, für die keine Genehmigungen erteilt werden.
Zum einen ist es verboten
“(a) keeping or using an embryo after the appearance of the primitive streak” (Schedule 1 §3 Abs.3(a) HFE Act 1990).
Dieser Zeitpunkt des Auftretens des Primitivstreifens wird durch §3 Abs.4 auf den vierzehnten Tag nach der Befruchtung festgelegt. Ab diesem Moment darf nicht mehr an einem Embryo geforscht werden (vgl. Heinemann 2005: 366).
Weiterhin darf keine Lizenz erteilt werden bei:
“(d) replacing a nucleus of a cell of an embryo with a nucleus taken from a cell of any person, embryo or subsequent development of an embryo” (Schedule 1 §3 Abs.3(d) HFE Act 1990).
Damit ist zwar der Zellkerntransfer erfasst und verboten, allerdings mit der Voraussetzung, dass eine befruchtete Eizelle vorliegt. Die Technik mit der auch Dolly erzeugt wurde nimmt den Zellkerntransfer hingegen bei unbefruchteten Eizellen vor. Damit fällt dieses Verfahren nicht unter den HFE Act 1990 und ist nicht grundsätzlich verboten. Auch die Technik des Embryo-Splittings ist nicht explizit genannt und somit bewilligungsfähig durch die HFEA (vgl. Berger 2007: 131ff.).
HRC Act 2001
Während in Großbritannien das therapeutische Klonen unter den genannten Bedingungen möglich ist, ist das Klonen zu reproduktiven Zwecken ausdrücklich verboten. Diese Regelung ist im „Human Reproductive Cloning Act 2001“, kurz dem HRC Act 2001 verankert. Er trat am 4. Dezember 2001 in Kraft (vgl. ebd.: 127). Danach wird jemand straffällig, “who places in a woman a human embryo which has been created otherwise than by fertilisation” (§1 Abs.1 HRC Act 2001). Bei Zuwiderhandlungen kann nach §2 Abs.1 des HRC Act 2001 eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden (vgl. §1 Abs.2 HRC Act 2001).
Tierschutz
In Großbritannien ist das Klonen von Tieren derzeit durch keine rechtliche Regelung erfasst und somit grundsätzlich zulässig. Auch das Pendant zum deutschen Tierschutzgesetz, der „Animals Act 1986“ ist in diesem Zusammenhang nicht wirksam, da die mehrheitliche Rechtsmeinung ist, dass den Tieren durch das Klonen keine Leiden oder Schmerzen zugefügt werden. Auch der „Agriculture Act 1968“ und die „Welfare of Livestock Regulations 1994“ enthalten keine Verbote zum Klonen von Tieren (vgl. Deutscher Bundestag 2000: 84).
2.3 Klonen als Wissenschaft und Technik
Die Einordnung der verschiedenen Verfahren des künstlichen Klonens in einen Forschungsbereich ist in der Literatur nicht ganz eindeutig. Zwar werden sie mehrheitlich als Techniken bezeichnet (vgl. Heinemann 2005: 45ff; Renneberg 2007: 216f;), doch die Zuordnung zu einem übergeordneten Anwendungsbereich erfolgt kaum und wenn, dann meist schwammig. Vor allem im Bereich der naturwissenschaftlichen Grundlagenliteratur sucht man vergebens. Trotz allem soll hier der Versuch einer Eingliederung unternommen werden. Ein Teil der Literatur ordnet die Techniken des Klonens ganz konkret dem Wissenschaftsbereich der Biotechnologie zu (vgl. Altner 1998: 148; Renneberg 2007: 216f.). Ein weiterer Teil gliedert Klontechniken in den Bereich der Biomedizin ein (vgl. Graumann 2003: 225ff.) und eine weitere Definition versucht die Brücke zwischen diesen beiden Teilgebieten zu schlagen. Die genauen Erläuterungen dazu finden sich in Kapitel 2.3.3 Zunächst sollen jedoch die bereits verwendeten Überbegriffe Wissenschaft, Technik, Technologie in ihren Zusammenhängen erläutert werden, um dann Klonen als spezielle Technik des Wissenschaftsbereiches Biotechnologie einordnen zu können.
2.3.1 Wissenschaft
Als Wissenschaft bezeichnet man „eine Gesamtheit von Erkenntnissen, die sich auf einen Gegenstandsbereich beziehen […] und in einem intersubjektiv nachvollziehbaren Begründungszusammenhang stehen“ (Brockhaus 2006b: 202). Diese Erkenntnisse können Tatbestände mit systematischen Beschreibungen und, sofern es möglich ist, auch mit Erklärungen sein. Im weitesten Sinne unterscheidet man Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Mathematik und Logik. Für die Naturwissenschaften gilt zusätzlich, dass die aufgestellten Thesen sich auf wiederholbare Gesetzmäßigkeiten beziehen, für die Voraussagen getroffen werden können und die mittels Beobachtungen und Experimenten kontrolliert werden können (vgl. Körner 1980: 726f.).
2.3.2 Technik / Technologie
Während die Naturwissenschaften also ein System von Aussagen darstellen (vgl. Stork 1991: 41), ist von Technik die Rede, wenn naturwissenschaftliche Erkenntnisse als Mittel zum Erreichen eines Ziels verwendet werden. Bei diesen Zielen handelt es sich vorrangig um die Verbesserung der menschlichen Lebensbedingungen (vgl. Steinbuch 1970: 18). Stork definiert Technik als Handeln „durch das der Mensch naturgegebene Stoffe und Energien intelligent so umformt, dass sie seinem Bedarf und Gebrauch dienen“ (Stork 1991: 1). Durch dieses Handeln entstehen dann immer mehr Dinge und Verfahren (vgl. ebd.: 1). Auch Ropohl verknüpft den in der Literatur häufig verwendeten weiten Technikbegriff, der unter Technik lediglich kunstfertige Verfahren versteht, mit dem engen Technikbegriff, der nur Maschinen allein als Technik definiert. Nach Ropohls Definition umfasst Technik „(a) die Menge der nutzenorientierten, künstlichen, gegenständlichen Gebilde […], (b) die Menge menschlicher Handlungen und Einrichtungen, in denen Sachsysteme entstehen und (c) die Menge menschlicher Handlungen, in denen Sachsysteme verwendet werden“ (Ropohl 1999: 31). Mit Sachsystemen sind dabei die technischen Artefakte gemeint (vgl. ebd.: 117ff.). Diese Entstehung und Verwendung der Technik geschieht nach Ropohl in einem soziotechnischen System, was dadurch gekennzeichnet ist, dass Technologien (technisches Sachsystem) und Menschen (soziales System) nach dem Prinzip der Arbeitsteilung interagieren, um ein Ergebnis zu produzieren. Die technische Komponente können z.B. Apparaturen in einem Labor sein und die soziale Komponente die Mitarbeiter, die diese Apparaturen bedienen (vgl. ebd.: 135ff.).
In der Literatur verwendet man den Begriff Technik oft synonym mit Technologie, was so nicht richtig ist. Nach Kleinsteuber versteht man unter Technologie „die Lehre oder die Wissenschaft von der Technik und ihren wissenschaftlichen Regeln, Prozessen und Erfahrungen“ (Kleinsteuber 2002: 608). Auch Ropohl definiert Technologie als die Gesamtheit der systematischen und wissenschaftlichen Aussagen über Technik (vgl. Ropohl 1999: 32).
2.3.3 Biotechnologie
Wie bereits eingangs angeführt, ist eine genaue Zuordnung des Klonens in einen übergeordneten Anwendungsbereich nicht ganz eindeutig. Einigkeit besteht lediglich darin, die verschiedenen Verfahren als Techniken zu bezeichnen (vgl. z.B. Heinemann 2005: 45ff.). Ein großer Teil der Literatur ordnet diese dann konkret den Biotechniken zu (vgl. vgl. Altner 1998: 148; Renneberg 2007: 216f.). Diejenigen Verfahren, die speziell auf Hilfe für den Menschen abzielen, wie das therapeutische Klonen und die Stammzellenforschung, werden zum Teil noch spezialisierter im Bereich der Humanbiotechnologie lokalisiert (vgl. Sorgner 2005: 13). Die Biotechnologie integriert viele Disziplinen und interagiert mit vielen Wissenschafts- und Technikbereichen. Nach der Definition der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ist Biotechnologie die Anwendung wissenschaftlicher und technischer Verfahren „to the processing of materials by biological agents to provide goods and services" (OECD 2007). Heiden definiert sie noch spezifischer als „wissenschaftliche Lehre in der Technik der Nutzung von Organismen […] sowie Teilen davon, die unter Einsatz mikrobiologischer, biochemischer und thermischer Verfahren mit dem Ziel angewendet wird, Organismen zu züchten und zu vermehren sowie Substanzen oder Produkte zu bilden oder umzubilden sowie zu gewinnen und herzustellen“ (Heiden 2001: 9). Das allgemeine Ziel der Biotechnologie ist es, Produkte für das tägliche Leben herzustellen. Dennoch existieren unterschiedliche Anwendungsbereiche, die durch Farben gekennzeichnet sind und hier kurz erläutert werden sollen.
Die Grüne Biotechnologie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Eigenschaften von Pflanzen zu verbessern, um sie z.B. mit Hilfe der Gentechnik resistenter zu machen und die Erträge zu erhöhen.
Die Weiße Biotechnologie nutzt Mikroorganismen, wie Bakterien, zur industriellen Herstellung verschiedener Rohstoffe, wie z.B. Insulin, Antibiotika oder auch Bioalkohol.
Die Rote Biotechnologie dient der Entwicklung von Medikamenten und anderen Therapiemöglichkeiten zur Behandlung menschlicher Krankheiten und Schäden. Auch das Klonen ist diesem Anwendungsbereich zuzuordnen, da es darauf abzielt durch Transplantation von Gewebe eines geklonten Patienten körperliche Schäden zu regenerieren.
Es existiert weiterhin noch die blaue Biotechnologie, die sich mit marinen Organismen und Prozessen beschäftigt sowie die Graue, Braune und Gelbe Biotechnologie, deren Spektrum jedoch nicht eindeutig definiert ist (vgl. Lippold 2007).
Da sich die Rote Biotechnologie medizinischen Verfahren zur Behandlung und Therapie menschlicher Krankheiten widmet, wird sie z.B. von Arndt (2004) als Biotechnologie in der Medizin bezeichnet und ist somit ein Teil des Fachbereiches der Biomedizin. Dieser wird von Arndt definiert als „die wissenschaftliche und medizinische Arbeit an und mit menschlichen Körper- und Keimzellen am Menschen“ (Arndt 2004: 1). Auch Graumann gliedert Klonen und Stammzellenforschung, neben Präimplantationsdiagnostik und Keimbahntherapie, bei der Biomedizin ein, ohne jedoch die Brücke zur Biotechnologie zu schlagen (vgl. Graumann 2003: 225ff.). Die Biomedizin ist wiederum ein Teilbereich der Humanmedizin (vgl. Arndt 2004:1).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Klonen eine Technik der Roten Biotechnologie ist, die wiederum wegen ihrer humanmedizinischen Ausrichtung Teil der Biomedizin ist.
3 Wissenschaftsberichterstattung: Wissenschaft – Medien – Öffentlichkeit
Noch relativ junge Forschungsbereiche wie die Biotechnologie und speziell das Klonen, die das menschliche Selbstverständnis in Frage stellen, werden in der Öffentlichkeit meist äußerst kontrovers diskutiert. Dabei erfüllen die Medien eine wichtige Funktion, da nur wenige Menschen einen persönlichen Bezug zu Ergebnissen oder Forschungen dieses Fachbereiches haben. Das öffentliche Bild der verschiedenen Teilbereiche der Biotechnologie sowie die Einstellungen der Bevölkerung, sie abzulehnen oder zu akzeptieren, basieren hauptsächlich auf der Übermittlungsleistung der Medien (vgl. Gutteling/Oloffson/Fjestad/ Kohrng/Goerke/Bauer/Rusanen 2002: 95f.). Luhmann spricht der massenmedialen Kommunikation einen bedeutenden Einfluss auf die öffentliche Wirklichkeitswahrnehmung zu: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“ (Luhmann 1996: 9). Im Folgenden wird zunächst in Kapitel 3.1 die Relevanz der Medien für die öffentliche Kommunikation über Wissenschaft und Technik diskutiert. Anschließend ist in Kapitel 3.2 der Wissenschaftsjournalismus als Teil des Leistungssystems Journalismus dargestellt, was durch bisherige Studien über die Situation in Deutschland und Großbritannien ergänzt wird. Daraufhin folgt in Kapitel 3.3 eine Darstellung der für die vorliegende Studie relevanten journalistischen Selektions- und Vermittlungskriterien. In Kapitel 3.4 findet sich eine kurze Zusammenfassung prägnanter Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutschem und britischem Journalismus. Schließlich ist in Kapitel 3.5 der gegenwärtige Forschungsstand bezüglich der Darstellung von Wissenschaft, Biotechnologie und Klonen in den Medien sowie der öffentlichen Meinung über die Klonforschung erläutert.
Die Berichterstattung über das Thema Klonen wird nicht unter dem Aspekt der Risikokommunikation betrachtet, da Klonen kein Risiko im weiten Sinne darstellt. Unter dem Begriff des Risikos versteht man eine Gefahr, die gesundheitliche, ökologische oder wirtschaftliche Schäden oder Verluste bewirken kann und von Wissenschaft und Technik ausgeht. Darunter fallen z.B. Atomenergie und Gentechnik (vgl. Wiedemann/Rohrmann/Jungermann 1990: 1f.). Klonen stellt jedoch in dem Sinne kein Risiko für die Menschen dar, es sei denn in fiktionalen Utopien oder im engen Sinn bei der noch unausführbaren Transplantation von maßgeschneiderten Geweben und Organen.
3.1 Die Relevanz der Massenmedien für die öffentliche Kommunikation über Wissenschaft und Technik
3.1.1 Definition Massenmedien und Massenkommunikation
Die wesentliche Voraussetzung für eine öffentliche Darstellung und Diskussion eines Themas wie dem Klonen ist das Agieren der Massenmedien. Luhmann definiert Massenmedien als „alle Einrichtungen der Gesellschaft […], die sich zur Verbreitung von Kommunikation technischer Mittel der Vervielfältigung bedienen“ (Luhmann 1996: 10). Auch das Nachrichtenmagazin fällt unter diese Definition, da während der Produktion Technik zum Einsatz kommt.
Die Kommunikation über Massenmedien bezeichnet man als Massenkommunikation. Sie ist eine spezielle Form der öffentlichen Kommunikation, worauf in Kapitel 3.1.2 genauer eingegangen wird. Als Kommunikation wird ein Austausch von Zeichen verstanden. Sie wird öffentlich sobald sie jedem zugänglich ist (vgl. Vowe 2003: 385ff.).
Dieses Kriterium erfüllen alle Arten von Massenmedien. Sie übertragen die Informationen einseitig und indirekt, d.h. es besteht eine räumliche Distanz zwischen den Kommunikationspartnern. Die Massenkommunikation richtet sich zudem an ein disperses Publikum, was bedeutet dass es eine Vielzahl von Rezipienten gibt, die zeitlich und räumlich verteilt die Botschaften empfangen (vgl. Maletzke 1963: 76ff.).
Luhmann unterscheidet inhaltlich drei verschiedene Programmbereiche der Massenmedien:
1. Nachrichten und Berichte
2. Werbung
3. Unterhaltung (vgl. Luhmann, 1996, S.51).
Man kann davon ausgehen, dass Klonen vor allem im Programmbereich der Nachrichten bzw. Berichterstattung zu finden ist. Da sich die vorliegende Arbeit mit der öffentlichen Debatte über das Thema Klonen beschäftigt, konzentriert sie sich auf diese Säule.
3.1.2 Massenmediale Öffentlichkeit
Da mediale Kommunikation über das Thema Klonen vor allem öffentliche Kommunikation ist, soll zunächst erläutert werden, was unter dem Begriff der medialen Öffentlichkeit zu verstehen ist.
Donges und Imhof (2005) unterscheiden drei Ebenen von Öffentlichkeit. Bei der ersten Ebene handelt es sich um kurze, meist spontane öffentliche Kommunikation in alltäglichen Begegnungen wie z.B. in der Mensa. Die zweite Ebene betrifft wenig bis gut organisierte Versammlungen, wie Demonstrationen oder andere Veranstaltungen. Dabei haben die Teilnehmer meist eine zugewiesene Rolle als Sprecher, Vermittler oder Publikum.
Die dritte Ebene, die Medienöffentlichkeit, erreichen aufgrund von Selektionsmechanismen nur wenige Themen der ersten beiden Ebenen. Massenmedial vermittelte Kommunikation erreicht potentiell alle Gesellschaftsmitglieder und ist daher am erfolgreichsten. (vgl. Donges/Imhof 2005: 151f.). Sie bietet allen gesellschaftlichen Akteuren ein Forum zum Austausch. Dabei stellen die Massenmedien verschiedene Kommunikationsbeziehungen zwischen Sprechern, Vermittlern und Publikum her. Das Ziel der Sprecher ist es, ihre Botschaften in den Medien zu platzieren und so Interesse und Zustimmung vom Publikum zu erlangen (vgl. Wunden 2005: 20). Sie treten dabei als individuelle oder kollektive Akteure mit unterschiedlichen Interessen auf. Im Fall der öffentlichen Kommunikation über Klonen können dies beispielsweise Repräsentanten gesellschaftlicher Gruppierungen, Wissenschaftler oder Kommentatoren aus der Politik sein (vgl. Donges/Imhof 2005: 154).
Als Vermittler der Botschaften fungieren die Massenmedien und speziell die Journalisten. Ihre Aufgabe ist es, aus der Vielzahl der Themen, die für sie relevanten zu selektieren, aufzubereiten und zu kommentieren (vgl. ebd.: 154). Dabei versuchen sie vor allem ökonomisch zu handeln und die Publikumsinteressen zu erfüllen (vgl. Wunden 2005: 20).
Das Publikum ist der Adressat der Botschaften von Sprechern und Vermittlern. Erst durch seine Anwesenheit wird Öffentlichkeit hergestellt. Es besteht vorwiegend aus Laien unterschiedlichster sozialer Gruppen und ist meist nur schwach organisiert (vgl. Donges/Imhof 2005: 154f.). Das Publikum besteht jedoch auch selbst aus Sprechern und Vermittlern. Aussagen der Opposition oder Konkurrenten können Ausgangspunkt für eine öffentliche Debatte und indirekte Kommunikation zwischen einzelnen gesellschaftlichen Akteuren sein (vgl. Peters 1994: 169).
Im Folgenden wird Öffentlichkeit als ein Funktionssystem betrachtet, für das das organisierte Leistungssystem Journalismus unabhängig Ereignisse auswählt und an die verschiedenen gesellschaftlichen Systeme kommuniziert (vgl. Kohring 2005: 246ff.). Die Grundlage dafür ist die funktional-strukturelle Systemtheorie.
Funktional differenzierte Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie keinen gesamtgesellschaftlichen Beobachter haben, sondern durch die verschiedenen autonomen Funktionssysteme, wie z.B. das Rechts- und das Wissenschaftssystem, auch viele verschiedene Beobachterperspektiven aufweisen. Damit diese Systeme sich jedoch nicht nur selbst beobachten, existiert ein weiteres Funktionssystem, was die Vielfalt der gesellschaftlichen Ereignisse beobachtet und kommuniziert. Dieses Funktionssystem ist die Öffentlichkeit. Von ihr werden ausschließlich Ereignisse beobachtet, die mehreren Systemen zugehörig sind und so auch in mehreren Systemen Anschlusskommunikation erzeugen können. Die entsprechende Leistungsrolle für das Funktionssystem Öffentlichkeit übernimmt der Journalismus mit seinen spezifischen Selektionskriterien (vgl. ebd.: 251ff.).
3.1.3 Funktion der Massenmedien
Massenmedien, wie Zeitschriften, nehmen eine wichtige Rolle in modernen Demokratien ein, da sie eine große Anzahl an Menschen gleichzeitig ansprechen. Dabei werden ihnen oft bestimmte Leistungen für den Bestand des Gesellschaftssystems zugeschrieben bzw. abverlangt. Für Hiebert und Gibbons (2000) bestehen die Aufgaben der Massenmedien darin, zu informieren, interpretieren, unterhalten, bilden und zu verkaufen. Ein Ereignis, wie die Geburt von Klonschaf Dolly, wird zur Nachricht wenn es von Journalisten als relevante Information ausgewählt und für ein bestimmtes Medium strukturiert wurde. Dieser Selektionsprozess ist ausführlich in Kapitel 3.3 beschrieben. Neben der reinen Informationsvermittlung kommt den Medien auch die Aufgabe zu, die Fakten einzuordnen, zu analysieren, zu interpretieren und auch zu werten. Damit geben sie den Rezipienten eine Orientierungshilfe und tragen zur öffentlichen Meinungsbildung bei. Neben der informativen, besitzen die Massenmedien auch eine unterhaltende sowie eine bildende Funktion. Letzteres beziehen Hiebert und Gibbons vor allem auf soziale Kompetenzen, da die Medien den Rezipienten verdeutlichen können, was sozial akzeptiert ist und was nicht. Eine weitere Funktion besteht darin, Anzeigen zu schalten und so die Wirtschaft anzukurbeln (vgl. Hiebert/Gibbons 2000: 36ff.).
Burkart (1998) bezeichnet dies als ökonomische Funktion. Er unterscheidet die Funktionen der Massenmedien in soziale, politische und ökonomische. Erstgenannte bestehe darin, die Mitglieder der Gesellschaft optimal in das System zu integrieren, ihnen soziale Orientierung zu geben und ihnen mit unterhaltenden Elementen auch zur Entspannung zu verhelfen.
Bei den politischen Funktionen gehe es vor allem darum, Öffentlichkeit herzustellen, d.h. ein Forum zu schaffen, bei dem alle Parteien, Verbände und Interessengruppen zu Wort kommen können (vgl. Burkart 1998: 368ff.). Daher ist es interessant zu sehen, wie sich die Akteurszusammensetzung in der Berichterstattung zweier Länder wie Deutschland und Großbritannien unterscheiden. Die Massenmedien zielen nicht darauf ab, einen übereinstimmenden Standpunkt der Realität zu erzeugen. In ihnen werden vor allem Meinungsverschiedenheiten ausgetragen (Luhmann 1996: 126). Es geht darum, den Mitgliedern der Gesellschaft die Möglichkeit zu verschaffen, sich zu informieren, politisch zu bilden und so aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen.
Eine weitere wesentliche Leistung besteht nach Burkart darin, eine Kritik- und Kontrollfunktion gegenüber der Regierung und Rechtsprechung sowie Unternehmen und Institutionen einzunehmen (vgl. Burkart 1998: 383f.).
Nach den Ausführungen von Jarren und Meier stehen die Interessen der Gesellschaft und die der einzelnen Medienunternehmen sowohl in einem symbiotischen als auch einem antagonistischen Verhältnis. Die Symbiose besteht darin, dass die einzelnen Gesellschaftssysteme, wie z.B. die Politik oder die Wissenschaft, den Medien die Themen liefern. Umgekehrt bieten die Medien ein Forum, durch das die einzelnen Belange in die Öffentlichkeit gelangen können. Das antagonistische Verhältnis äußert sich darin, dass Politiker, Wissenschaftler oder andere Interessenvertreter versuchen, ihre Positionen und Handlungen durch die Öffentlichkeit zu legitimieren, während es die Aufgabe der Medien ist, jede Machtausübung zu prüfen (Jarren/Meier 2002: 101).
Zeitungen und Nachrichtenmagazine erfüllen demnach die zweifache öffentliche Aufgabe, einerseits aktuelle Nachrichten und Entscheidungen zu vermitteln und sie andererseits zu kommentieren. In einer demokratischen Gesellschaft sind sie wichtige Kontrollorgane, indem sie über das Handeln der Regierung, der Rechtsprechung und der einzelnen Institutionen informieren, Stellung beziehen und gegebenenfalls Kritik ausüben (vgl. Schulze 2001: 13ff.).
Die Rahmenbedingung für die soziale, politische sowie ökonomische Funktionserfüllungen liefern in demokratischen Gesellschaften, wie Deutschland und Großbritannien, die Rechtsgrundlagen der Informations-, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit. Die Medien unterliegen keiner Zensur und können so ausgewogene und objektive Darstellungen der Realität vermitteln (Neuber 1993: 12).
3.2 Wissenschaftsjournalismus
Nachdem bereits erläutert wurde was unter Medienöffentlichkeit zu verstehen welche Funktionen die Massenmedien erfüllen, stellt sich nun die Frage, was dies für die Arbeit der Wissenschaftler und Journalisten bedeutet.
Die Grundannahme besteht darin, dass die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit vor allem über die Massenmedien stattfindet und der Großteil der Bevölkerung Informationen über Wissenschaft und Technik hauptsächlich aus den Massenmedien bezieht (vgl. Hömberg 1989: 7; Stuber 2005: 4). Themen, die früher ausschließlich innerhalb der Forschergemeinschaft, der so genannten „scientific community“, in Fachsprache diskutiert wurden, sind heute fester Bestandteil der Medienlandschaft (vgl. Maier/Miljkovic/Palmar/Ranner 2004: 26) und werden meist in spezialisierten Wissenschaftsredaktionen aufbereitet (vgl. Lublinski 2004: 22).
3.2.1 Begriffsbestimmung
Unter Wissenschaftsjournalismus versteht man im Allgemeinen „nonfiction portrayals of science in newspapers, magazines, books, and television news“ (Lewenstein 1995: 343). Dies beinhaltet prinzipiell die gesamte „journalistische Berichterstattung über Naturwissenschaften, Technik und Medizin“ (Göpfert/Ruß-Mohl 1996: 10), was das Klonen mit einschließt. Die Geistes- und Sozialwissenschaften werden in der Literatur meist von dieser traditionellen Definition ausgeschlossen, doch nach Göpfert und Ruß-Mohl finden auch sie allmählich Eingang in die Berichterstattung (vgl. ebd.: 10).
Grabowski definiert Wissenschaftsjournalismus als Leistung des Journalisten, „der / die mit Themen, Problemen oder Ergebnissen aus dem Bereich der Wissenschaft journalistisch umgeht“ (Grabowski 1982: 20). Wissenschaftsjournalismus ist demnach kein Journalismus, der sich bestimmter wissenschaftlicher Methoden bedient oder von Wissenschaftlern ausgeübt wird, wie oft fälschlicherweise angenommen wird. Er ist, wie der Wirtschafts- oder Sportjournalismus auch, Teil des gesamten Leistungssystems Journalismus und nutzt die Wissenschaft als Recherchequelle (vgl. Lublinski 2004: 22). Eine von den Funktionsbeschreibungen des Journalismus isolierte Theorie ist die des „Paradigmas der Wissenschaftspopularisierung“, die ausführlich in Kapitel 3.2.2.1 erläutert wird.
Die Wissenschaftsberichterstattung betrifft alle tatsächlichen und möglichen Wechselwirkungen zwischen dem Wissenschaftssystem und seiner gesellschaftlichen Umwelt. So kann der Anlass direkt aus der Wissenschaft selbst kommen und beispielsweise neue Forschungsergebnisse präsentieren, wie die Geburt des Klonschafes Dolly. Oder der Anlass liegt in ihrer Umwelt und behandelt forschungspolitische Entscheidungen wie den britischen HFE Act 1990 oder das deutsche Stammzellengesetz (vgl. Weischenberg/Kleinsteuber/Pörksen 2005: 485). Im letzteren Beispiel wird ein Ereignis thematisiert, was sowohl dem Politik-, als auch dem Wissenschaftssystem zuzuweisen ist. Öffentliche Themen haben immer für mehrere Systeme eine Bedeutung, was Kohring als Mehrsystemzugehörigkeit bezeichnet. Wissenschaftsereignisse sind also nicht nur im Wissenschaftsressort zu finden (vgl. Kohring 2005: 284.).
3.2.2 Perspektiven der Wissenschaftsjournalismus – Forschung
In der Literatur existieren seit Beginn des 20. Jahrhunderts verschiedene Ansätze der Funktionszuweisungen für den Wissenschaftsjournalismus, die in zwei Perspektiven unterteilt werden können. Zum einen existiert eine wissenschaftszentrierte Perspektive, die fordert, die Arbeit des Journalismus an wissenschaftlichen Kriterien auszurichten. Auf der anderen Seite gibt es die journalismuszentrierte Perspektive, die Journalismus als autonomes Leistungssystem betrachtet. Im Folgenden sollen sowohl die deutschen, als auch die internationalen Entwicklungen auf diesem Gebiet zusammengefasst werden.
3.2.2.1 Das Paradigma Wissenschaftspopularisierung
Einen wichtigen Beitrag zum kommunikationswissenschaftlichen Verständnis des Wissenschaftsjournalismus hat Matthias Kohring (2005) geliefert, indem er die deutsche und angloamerikanische Literatur seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts zusammengefasst hat.
Nach Kohrings Studien wurden in Deutschland bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und später in den fünfziger und sechziger Jahren vor allem normative Leistungsanforderungen an den Journalismus gestellt. Ein Großteil der Wissenschaftler und Politiker weist in dieser Zeit auf die ständig wachsende Bedeutung von Wissenschaft und Technik für Politik und Wirtschaft hin und plädiert im Namen der eigenen Interessen für mehr Öffentlichkeit (vgl. Kohring 2005: 40ff.). Dem Journalismus wird die Funktion eines Dolmetschers zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zugewiesen, wobei mit Öffentlichkeit vor allem das Laienpublikum gemeint ist. Dieses müsse Wissenschaft und Technik vor allem akzeptieren, um sie zu legitimieren (Demokratie-Argument) und zu fördern (Sponsoring-Argument). Kohring fasst diese dominierenden Vorstellungen der wissenschaftlichen Gemeinschaft als „Paradigma der Wissenschaftpopularisierung“ zusammen. Die Grundannahme besteht darin, dass in der Gesellschaft ein Informationsdefizit bezüglich Wissenschaft existiert und damit einhergehend eine gewisse Technikfeindlichkeit. Dieses Defizit wird auf eine einseitige oder falsche Berichterstattung zurückgeführt und als Kommunikations-, bzw. Vermittlungskrise bezeichnet. Der Weg aus dieser Krise soll über eine Popularisierung, d.h. eine intensivere Berichterstattung über Wissenschaft und Technik führen. Dieser Aufklärung und Relevanzbekundung, so die Annahme der Autoren, folgt dann die Akzeptanz der Öffentlichkeit (vgl. ebd.: 63ff.). Bislang konnten Studien jedoch keinen Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Bildung und Akzeptanz nachweisen (vgl. ebd.: 218).
Auch in den USA und in Großbritannien hat sich der Wissenschaftsjournalismus in der Zeit zwischen den Weltkriegen entwickelt. Genau wie in der deutschen Literatur wird ihm von Anfang an die Rolle des Vermittlers zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zugewiesen und das Ziel in der Verbreitung und Interpretation wissenschaftlichen Wissens für Nichtwissenschaftler gesehen (vgl. Lewenstein 1995: 344). Ebenso werden Demokratie- und Sponsorargumente angeführt, um zu begründen, dass das Laienpublikum über die wissenschaftliche Arbeit aufgeklärt und von ihr überzeugt werden muss. Die Kenntnisse des Publikums werden als „public understanding of science“ bezeichnet. Sie gilt es zu steigern und mögliche Defizite zu beheben. Diese normative Funktionszuweisungen sind nahezu identisch mit denen der deutschen Forschung und können somit dem Paradigma der Wissenschaftspopularisierung zugeordnet werden (vgl. Kohring 2005: 142ff.). Die Wissenschaftsberichterstattung wird zudem hauptsächlich aus Sicht des Wissenschaftssystems betrachtet. So wird Anstoß an journalistischen Selektionskriterien wie Sensationalismus genommen und vom Wissenschaftsjournalismus gefordert, er solle wissenschaftliches Wissen nach wissenschaftlichen Maßstäben, wie Genauigkeit und Vollständigkeit vermitteln. Angestrebt wird dabei ein „real understanding of science“ (vgl. ebd.: 156). Ein Beispiel der Forschung stellen die Accuracy-Studien dar, die die Genauigkeit journalistischer Wissensvermittlung untersuchen (vgl. Lewenstein 1995: 346).
Die Positionen des Paradigmas der Wissenschaftspopularisierung werden in Deutschland seit den siebziger Jahren zunehmend kritischer betrachtet (vgl. Kohring 2005: 288ff.).
In den 80er Jahren löst sich auch die amerikanische Wissenschaftsjournalis-musforschung langsam von ihren normativen Popularisierungsstrategien, mit der Erkenntnis, dass sowohl bei der Produktion, als auch bei der Rezeption, soziale Prozesse eine Rolle spielen und wissenschaftliches Wissen nicht automatisch als höherwertig und widerspruchsfrei gelten kann (Vgl. ebd.: 165ff.). Denn wissenschaftliche Experten sind keine neutralen Wissenslieferanten, sondern verfolgen mit ihrem produzierten Wissen meist ökonomische und andere Ziele (vgl. Jarren/Weßler 1998: 193). Kritik am Modell des public understanding of science findet sich auch in der britischen Literatur. Die Aufmerksamkeit gilt seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts nicht weiter der bloßen Vermittlung von Wissen, sondern der Integration wissenschaftlichen Wissens in bereits bestehende Wissensbestände. Dazu gehören auch nicht-wissenschaftliche Kontexte (vgl. Kohring 2005: 204). Lewenstein fordert, Wissenschaftskommunikation als multidirektionalen Prozess zu verstehen, der genauso von den Interessen und Belangen des Publikums abhängt, wie von denen der Wissenschaftler oder anderer bestimmter Autoritäten. Zukünftige Studien sollten zudem die Rolle der Wissenschaftskommunikation eingebettet in die Beziehung von Wissenschaft und Gesellschaft betrachten (vgl. Lewenstein 1995: 358f.).
[...]
[1] in der Fachsprache als Mitose bezeichnet
[2] halben
[3] doppelten oder vollständigen
[4] Amyotrophe Lateralsklerose – eine Erbkrankheit
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836625180
- DOI
- 10.3239/9783836625180
- Dateigröße
- 783 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Ilmenau – Mathematik und Naturwissenschaften, Medien- und Kommunikationswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- klonen spiegel economist berichterstattung nachrichtenmagazin
- Produktsicherheit
- Diplom.de