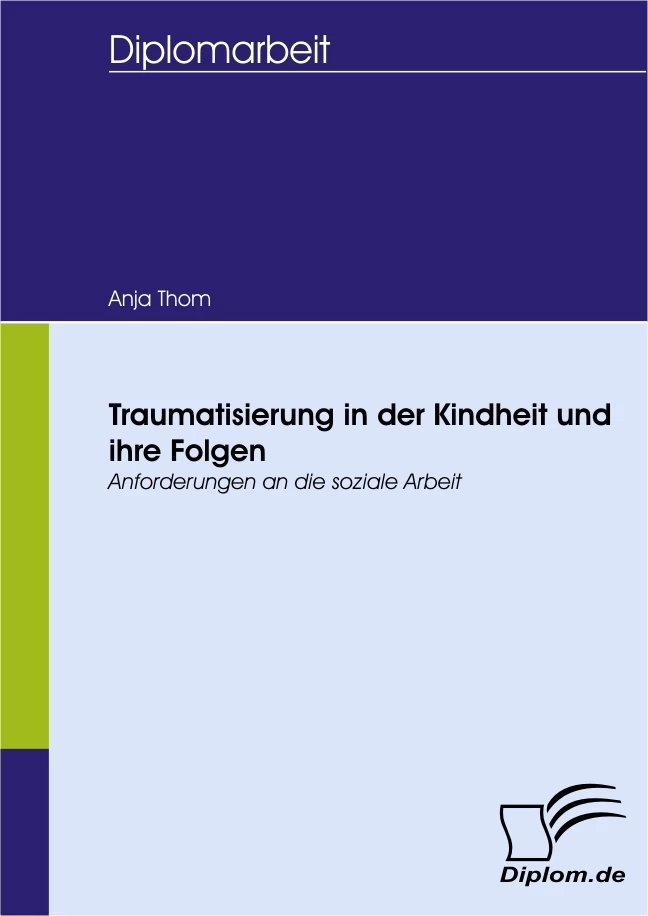Traumatisierung in der Kindheit und ihre Folgen
Anforderungen an die soziale Arbeit
Zusammenfassung
Wir leben in einer Welt voller Wunder und zugleich voller Übel. Schon immer haben Menschen auf traumatische Ereignisse reagiert und an ihnen gelitten. Die Welt wird immer wieder heimgesucht von Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürmen und anderem Unheil. Schlägt man die Tageszeitung auf, so liest man täglich Schlagzeilen wie z.B. Lübecker erschlägt seine Ex-Frau mit dem Beil- Sohn (4) und Tochter (7) warteten vergeblich auf ihre Mutter, Bluttat auf offener Straße: Er schlug zu, als sie mit dem Fahrrad fuhr, 24 Jahre im Kellerverlies: Inzest-Drama in Österreich schockt die Welt, Grausiger Fund in der Tiefkühltruhe: Sohn (18) entdeckt drei Babyleichen, Junge (12) vergewaltigt Mädchen (8) oder Zyklon Myanmar: Birmesen kämpfen ums Überleben- Leichen treiben im Wasser, Hungernde stürmen Läden, Junta schikaniert Helfer, Ostholstein: 13- jährige Skaterin vergewaltigt- Unbekannter überfällt Mädchen auf Radweg am frühen Abend.
Psychische Traumata sind die Folgen plötzlicher oder anhaltender bedrohlicher, extrem ängstigender und auswegloser Ereignisse. Sie hinterlassen unbehandelt oft lebenslang Spuren in Form von zahlreichen psychischen und körperlichen Symptomen mit unterschiedlich einschneidenden Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Lebensgestaltungsmöglichkeiten und können der jeweiligen Biografie eines Menschen eine neue, unvorhergesehene Richtung geben.
Während meines Studiums konnte ich viele Erfahrungen in der Krisenintervention machen. Ich arbeitete vor allem mit Frauen und Kindern zusammen, die von unterschiedlichen Traumatisierungen betroffen waren, z.B. verursacht durch häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Flucht, Verfolgung und Missbrauch. Viele dieser belastenden Ereignisse die zu Traumata führen, spielen sich im Stillen ab und sind weniger spektakulär. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind von diesen weniger spektakulären Traumata in ihrem Arbeitsfeld oftmals betroffen. In Einrichtungen wie z.B. dem Kinderschutzbund, Frauenhäusern, Jugendämtern oder Sozialpädagogischen Familienhilfen arbeiten Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen, deren Klientel oftmals traumatische Erlebnisse erfahren haben.
Am 28. Dezember 2007 wurde auf offener Straße und am helllichten Tage eine 36-Jährige Frau von ihrem Ex-Mann hinterrücks und brutal durch einen Schlag mit dem Beil in den Nacken erschlagen. Seither berichten Tageszeitungen, TV-Sender und Radiosender vom Beil-Mord in Lübeck.
Der Täter wurde von einer […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Leben mit dem Trauma- Danach ist nichts mehr wie es vorher war!
2.1 Terminologie
2.1.1 Psychotraumatologie
2.1.2 Trauma
2.1.3 Terminologische Abgrenzung: Trauma- Stress- belastendes Lebensereignis
2.1.4 Klassifikationssysteme in der Traumatologie
2.1.4.1 Die Klassifikation der Traumatologie im ICD-10
2.1.4.2 Die Klassifikation der Traumatologie im DSM-IV-TR
2.1.4.3 Sonstige Klassifikationen in der Psychotraumatologie
3. Die historische Entwicklung der Psychotraumatologie
4. Epidemiologie- Häufigkeit und Ausmaß frühkindlicher Traumatisierungen
5. Formen von Traumata
6. Ursachen von kindlichen Traumatisierungen
6.1 Die physische Gewalt
6.2 Die psychische Gewalt
6.3 Vernachlässigung
6.4 Verwahrlosung und Hospitalismus
6.5 Die Deprivation
6.6 Sexuelle Gewalt
6.7 Die häusliche Gewalt
6.8 Bindungsstörungen
6.9 Trennung und Scheidung
6.10 Kinder psychisch kranker Eltern
6.11 Tod und Verlust von Bezugspersonen
6.12 „Kinder vor Gericht“- Trauma und Belastungen im Gerichtsverfahren
6.12.1 Terminologische Abgrenzung: Kind, Jugendlicher, Erwachsener
6.12.2 Das Kind vor dem Familiengericht
6.12.3 Das Kind vor dem Vormundschaftsgericht
6.12.4 Das Kind und das Strafverfahren
6.13 Exkurs: Traumatische Erlebnisse in einer globalisierten Welt
7. Die Folgen von unverarbeiteten frühkindlichen Traumatisierungen und ihre Auswirkungen im Erwachsenenalter
7.1 Komorbide Störungen
7.2 Dissoziative Störungen
7.3 Borderline- Persönlichkeitsstörung
7.4 Autoaggressives Verhalten
7.5 Suizidalität
8. Resilienz und Trauma
8.1 Terminologie: Resilienz
8.2 Terminologie: Vulnerabilität
8.3 Empirische Forschungsbefunde der Risiko- und Resilienzforschung
8.3.1 Die Kauai-Längsschnittstudie
8.3.2 Die Mannheimer Risikokinderstudie
8.3.3 Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie
8.4 Entwicklungsprobleme (Risikofaktoren) und Bewältigungsstrategien (Schutzfaktoren) in der Entwicklung von Kindern
8.5 Exkurs: Coping und Coping- Strategien
9. Behandlung von frühkindlichen Traumatisierungen
9.1 Grundlagen für eine erfolgreiche Traumabehandlung
9.2 Diagnose und Anamnesenerhebung in der Traumatherapie
9.3 Traumatherapie und die unterschiedlichen Behandlungsansätze
9.3.1 Die kognitiv-behaviorale Therapie
9.3.2 EMDR
9.3.3 KIDNET – Narrative Expositionstherapie (NET) für Kinder
9.3.4 Die traumazentrierte Spieltherapie
9.3.5 Die psychodynamisch imaginative Traumatherapie (PITT)
9.3.6 Die mehrdimensionale psychodynamische Traumatherapie in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen (MPTT-KJ)
9.3.7 Die Hypnotherapie
9.3.8 Die Gruppenpsychotherapie
9.3.9 Die Pharmakotherapie
10. Trauma und Sozialarbeit
10.1 Konkrete Arbeitsfelder und Aufgabengebiete von Sozialarbeitern, die mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen
10.1.1 Frauenhaus
10.1.2 Suchtberatung
10.1.3 Kinder- und Jugendpsychiatrie
10.1.4 Die Jugendhilfe
10.1.4.1 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)
10.1.4.2 Erziehungsberatungsstellen
10.1.4.3 Stationäre und teilstationäre Hilfen und Pflegefamilie
10.1.5 „Kinder vor Gericht“
10.1.5.1 Die Vernehmung des Kindes oder des Jugendlichen und der Einsatz von Video- und Tonbandaufzeichnungen
10.1.5.2 Zeugenbegleitprogramme
10.2 Methoden von Sozialarbeitern in der Arbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen
10.2.1 Die psychosoziale Beratung
10.2.2 Empowerment
10.2.3 Einzelfallhilfe
10.2.4 Die soziale Netzwerkarbeit
10.2.5 Prävention und Öffentlichkeitsarbeit
10.3 Grenzen der Sozialarbeit- rechtliche Rahmenbedingungen
10.4 Exkurs: „Wenn der Beruf zum Alptraum wird“- SozialarbeiterInnen erfahren durch die Arbeit traumatische Erlebnisse am eigenem Leib- Die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen in der sozialen Arbeit, um trotz der Belastungen weiterhin „gesund“ zu bleiben.
11. Interview mit einem Richter und einer Richterin
11.1 Angaben zur Person
11.1.1 Das Interview
11.2 Angaben zur Person
11.2.1 Das Interview
12. Interview mit einer Sozialarbeiterin
12.1 Angaben zur Person
12.1.2 Das Interview
13. Interview mit dem Leiter des WEISSEN RINGES Lübeck
13.1 Angaben zur Person
13.1.2 Das Interview
14. Auswertung der Interviews
15. Fazit
Quellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung
1. Einleitung
„ Es sind nicht die Ereignisse, die Menschen beunruhigen, sondern die Vorstellung von diesen Ereignissen.“
(Epiktet, 50-138 n. Chr.)
"Die Menschen werden nicht durch die Dinge selbst verwirrt, sondern durch die Art, wie sie über sie denken."
(Albert Ellis, Psychotherapeut)
Wir leben in einer Welt voller Wunder und zugleich voller Übel. Schon immer haben Menschen auf traumatische Ereignisse reagiert und an ihnen gelitten. Die Welt wird immer wieder heimgesucht von Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürmen und anderem Unheil. Schlägt man die Tageszeitung auf, so liest man täglich Schlagzeilen wie z.B. „Lübecker erschlägt seine Ex-Frau mit dem Beil- Sohn (4) und Tochter (7) warteten vergeblich auf ihre Mutter“, „Bluttat auf offener Straße: Er schlug zu, als sie mit dem Fahrrad fuhr“, „24 Jahre im Kellerverlies: Inzest-Drama in Österreich schockt die Welt“, „Grausiger Fund in der Tiefkühltruhe: Sohn (18) entdeckt drei Babyleichen“, „Junge (12) vergewaltigt Mädchen (8)“ oder „Zyklon Myanmar: Birmesen kämpfen ums Überleben- Leichen treiben im Wasser, Hungernde stürmen Läden, Junta schikaniert Helfer“, Ostholstein: 13- jährige Skaterin vergewaltigt- Unbekannter überfällt Mädchen auf Radweg am frühen Abend“ (LN- Lübecker Nachrichten 2007/ 2008).
Psychische Traumata sind die Folgen plötzlicher oder anhaltender bedrohlicher, extrem ängstigender und auswegloser Ereignisse. Sie hinterlassen unbehandelt oft lebenslang Spuren in Form von zahlreichen psychischen und körperlichen Symptomen mit unterschiedlich einschneidenden Beeinträchtigungen von Lebensqualität und Lebensgestaltungsmöglichkeiten und können der jeweiligen Biografie eines Menschen eine neue, unvorhergesehene Richtung geben.
Während meines Studiums konnte ich viele Erfahrungen in der Krisenintervention machen. Ich arbeitete vor allem mit Frauen und Kindern zusammen, die von unterschiedlichen Traumatisierungen betroffen waren, z.B. verursacht durch häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Flucht, Verfolgung und Missbrauch. Viele dieser belastenden Ereignisse die zu Traumata führen, spielen sich im „Stillen“ ab und sind weniger spektakulär. Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen sind von diesen „weniger spektakulären Traumata“ in ihrem Arbeitsfeld oftmals betroffen. In Einrichtungen wie z.B. dem Kinderschutzbund, Frauenhäusern, Jugendämtern oder Sozialpädagogischen Familienhilfen arbeiten Sozialarbeiter/ Sozialpädagogen, deren Klientel oftmals traumatische Erlebnisse erfahren haben.
Am 28. Dezember 2007 wurde auf offener Straße und am helllichten Tage eine 36-Jährige Frau von ihrem Ex-Mann hinterrücks und brutal durch einen Schlag mit dem Beil in den Nacken erschlagen. Seither berichten Tageszeitungen, TV-Sender und Radiosender vom „Beil-Mord in Lübeck“.
Der Täter wurde von einer zufällig vorbeikommenden Polizistin an der Flucht gehindert. Die Polizistin war privat, in zivil, ohne Waffe und Handy mit ihren zwei Kindern (10 Jahre und 8 Jahre) im Auto unterwegs. Die Kinder der Polizistin mussten diese schrecklichen Geschehnisse ebenfalls, wie viele andere Passanten auch, miterleben. Ich persönlich war ebenfalls direkt am Tatgeschehen vor Ort. Ich arbeitete zu diesem Zeitpunkt in meiner Projektstelle, dem Autonomen Frauenhaus Lübeck, welches unmittelbar direkt am Tatort liegt. Da unsere Klientinnen mit ihren Kindern selber akut von Gewalt betroffen sind, kam es nach dieser Tat zu enormen physischen und psychischen Zusammenbrüchen unserer Klientinnen und ihrer Kinder. Wir als Sozialarbeiterinnen waren in der Kriseninterventionsstelle gefragt wie nie zuvor. Ich habe miterleben müssen, wie neben den unmittelbar Betroffenen auch Polizisten, Berater/ Beraterinnen und Anwesende von Traumatisierungen betroffen sein können (siehe Punkt 10.4).
Der Anlass für das Thema „Traumatisierung in der Kindheit und ihre Folgen- Anforderungen an die Soziale Arbeit “ ergab sich aus diesem Geschehnis, meinen gemachten Erfahrungen und den vielen anderen schockierenden Kindeswohlgefährdungen aus den Nachrichten. Mein Studienschwerpunkt beinhaltete vor allem Vorlesungen aus der Psychologie und aus dem Rechtsgebiet. Prüfungen absolvierte ich u.a. im Bereich Kindeswohlgefährdungen und Entwicklungspsychologie, welches für die Soziale Arbeit eine enorm wichtige Bedeutung darstellt.
„Wer wünscht seinen Kindern nicht eine glückliche Kindheit? Mit allem, was dazugehört: Unbeschwertheit, Gesundheit, Liebe, Freundschaften, Vertrauen und Zuversicht. Doch leider können auch die besten Eltern ihr Kind nicht vor allen Gefahren beschützen und immer wieder passieren Dinge, die Kinder aus der Bahn werfen können“ (Eckardt, Jo 2005: 7). Kinder sind zunächst auf Zuwendung und Unterstützung von Erwachsenen angewiesen. Die Persönlichkeitsstruktur ist bei Kindern noch nicht so gefestigt, so dass bereits geringe Auslöser genügen, um sie zu traumatisieren. Nicht jedes Kind reagiert gleich auf Ereignisse. Kinder, die noch nicht sprechen können, haben es besonders schwer, da sie das Erlebnis überhaupt nur auf der sprachlichen und kognitiven Ebene wahrnehmen und es somit nur schwer verarbeiten können. Manche Kinder entwickeln Ängste, andere reagieren mit Rückzug, Verleugnung, wieder andere zeigen aggressives Verhalten oder verletzen sich selbst. Es ist wichtig, dass Eltern, Erzieher, Lehrer und vor allem Sozialarbeiter lernen, die gewichtigen Anhaltspunkte einer Störung, sowie die Bedürfnisse von Kindern zu erkennen und auf sie einzugehen.
In meiner Diplomarbeit möchte ich auf folgende Fragestellungen näher eingehen und in diesem Zusammenhang einen ausführlichen Überblick über die Aufgabengebiete eines Sozialarbeiters schaffen:
- Welche Traumatisierungen gibt es?
- Welche Folgen entwickeln sich aus Traumatisierungen, die in der Kindheit gemacht wurden?
- Wie verarbeiten Kinder traumatische Erlebnisse?
- Welche Bedeutungen und Auswirkungen haben Traumatisierungen auf Erwachsene?
- Welche Folgen von unverarbeiteten frühkindlichen Traumatisierungen sind bekannt?
- Welches Aufgabengebiet haben Sozialarbeiter in der Arbeit mit kindlichen Traumatisierungen?
- „Kinder vor Gericht“- Welche Rollen nehmen Kinder bei Polizei und Gericht ein?
- Welche Auswirkungen von Verfahrensabläufen, z.B. durch Scheidungen, sind bei Kindern bekannt?
- Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass betroffene Kinder nicht erneut Opfer von traumatischen Erlebnissen werden?
Ebenfalls notwendig sind für mich das Aufzeigen der Grenzen der Sozialarbeit im rechtlichen Bereich und die Darlegung der Grenzen von sozialer Arbeit und Therapie.
Abgerundet wird meine Diplomarbeit am Ende mit vier Interviews zur Thematik. Ich freue mich sehr darüber, einen vorsitzenden Richter vom Landgericht Stade, Herrn Rolf Armbrecht; eine Familienrichterin aus Stade, Cordula Anlauf; Heidrun Steegen, eine Frauenhausmitarbeiterin und Kinder- und Jugendtherapeutin aus Hamburg/Lübeck sowie Detlef Hardt vom WEISSEN RING Lübeck, zur Thematik interviewen zu dürfen.
2. Das Leben mit dem Trauma- Danach ist nichts mehr wie es vorher war!
2.1 Terminologie
Zu Beginn meiner Diplomarbeit möchte ich mit oft verwendeten Termini beginnen, diese erläutern und differenzieren. Dieses halte ich für unerlässlich, um eine gute Arbeitsgrundlage für die vorliegende Thematik zu schaffen. Ich möchte dem Leser Orientierung und zugleich ein besseres Verständnis beim Lesen geben.
2.1.1 Psychotraumatologie
Unter Psychotraumatologie wird die Lehre der Erforschung und Behandlung von Traumata verstanden, die mit seelischen Verletzungen einhergehen. Sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen von psychischer Traumatisierung auf Entstehung und Verlauf von Krankheiten, psychischen und psychosomatischen Störungen oder Verhaltensauffälligkeiten (vgl. Fischer, G./Riedesser, P. 1998: 15).
Der Kinderpsychiater Donovan benutzte im Jahre 1990 den Begriff der „Traumatology“ und definierte diesen wie folgt: „Traumatologie ist das Studium der natürlichen und vom Menschen hervorgerufenen Traumata (vom natürlichen Trauma, von Unfällen und Erdbeben bis hin zu den Schrecken unbeabsichtigter oder auch beabsichtigter menschlicher Grausamkeit), von deren sozialen und psychobiologischen Folgen und den prädiktiven/präventiven/interventionistischen Regeln, die sich aus dem Studium ergeben“ (Donovan 1991: 434, zitiert in Fischer, G./ Riedesser, P. 1998: 17).
In Deutschland wäre der Terminus „Traumatologie“ nicht sinnvoll gewählt, da dieser Begriff im medizinischen Bereich, speziell der Chirurgie, bereits seine Anwendung gefunden hat.
„Die Erkennung und Behandlung von Unfall- und Verletzungen gehört zu den ältesten Zweigen ärztlicher Tätigkeit. Verletzungen des Menschen durch Unfälle als Folge menschlicher Auseinandersetzungen sind so alt wie die Menschheit selbst, und in der Notwendigkeit, dem verletzten Mitmenschen zu helfen, liegt die Wurzel jeder Traumatologie“ (Kuner und Schlosser 1988, zitiert in Fischer, G./Riedesser, P. 1998: 17).
Der Begriff der Psychotraumatologie wurde im Jahre 1991 in Deutschland eingeführt und stellt die Grundlage für jede Traumatherapie dar.
2.1.2 Trauma
Der Begriff „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und wird mit „Verletzung“ und „Wunde“ ins Deutsche übersetzt. In der Literatur lässt sich der Begriff in zahlreichen Kontexten wiederfinden. In meiner Diplomarbeit handelt es sich vor allem um Traumen mit psychologischem Schwerpunkt, wie die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), die sich aufgrund von schweren Belastungen entwickeln kann.
Der Psychologie Brockhaus definiert den Begriff Trauma mit „1) in der Medizin eine körperliche Verletzung durch von außen einwirkende mechanische, physikalische oder chemische Faktoren“ und „2) in der Psychologie eine psychische oder nervöse Schädigung aufgrund seelischer Belastungen, die einmalig oder andauernd derart auf einen Menschen einwirken, dass sie nicht mehr bewältigt werden können und eine anhaltende Störung des seelischen Gleichgewichts bewirken“ (F.A. Brockhaus 2001: 624f).
Das klinische Psychologie- Psychotherapie- Lehrbuch beschreibt ein Trauma als ein Ereignis, das für eine Person entweder in direkter persönlicher Betroffenheit oder in indirekter Beobachtung eine intensive Bedrohung des eigenen Lebens, der Gesundheit und körperlichen Integrität darstellt und Gefühle von Grauen, Schrecken und Hilflosigkeit auslöst (vgl. Perrez, M./Baumann, U. 2005: 970).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Trauma bzw. die posttraumatische Belastungsstörung im ICD 10, im Kapitel F43.1. Ein Trauma bzw. die posttraumatische Belastungsstörung wird dort als „eine verzögerte (…) Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ , beschrieben. „Hierzu gehören eine durch Naturereignisse oder von Menschen verursachte Katastrophe, eine Kampfhandlung, ein schwerer Unfall oder Zeuge des gewaltsamen Todes anderer oder selbst Opfer von Folterung, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen zu sein“ (WHO 2005: 169).
In der Definition des amerikanischen Klassifikationssystems, dem DSM-IV-TR, wird Trauma bzw. die posttraumatische Belastungsstörung (309.81) wie folgt beschrieben:
„Die Person wurde mit einem traumatischen Ereignis konfrontiert, bei dem die folgenden Kriterien vorhanden waren:
1. Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die tatsächlichen oder drohenden Tod oder ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der körperlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen beinhalteten.
2. Die Reaktion der Person umfasste intensive Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzen“ (Saß, Henning/Wittchen, Hans-Ulrich/Zaudig, Michael/Houben, Isabel: 2003: 195f).
Ein Trauma beinhaltet also das direkte persönliche Erleben einer belastenden Situation und kann sich durch viele Ereignisse ergeben, wie z.B. durch Tod, Androhung des Todes, eine schwere Verletzung, Kidnapping, schwere Unfälle, Naturkatastrophen, gewaltsame Angriffe, Vergewaltigung, Folter, Terrorismus oder durch eine Gefangenschaft.
Michaela Huber gilt als eine Pionierin auf dem Gebiet der Traumaforschung. In ihrem aktuellen Buch „Trauma und die Folgen“, welches bereits in der 3. Auflage erschienen ist, beschreibt sie sehr prägnant, worum es sich bei einem Trauma handelt: „Ein Trauma ist überwältigend; lebensgefährlich; über alle Maßen erschreckend; etwas, das man eigentlich nicht verkraften kann; ein Ereignis außerhalb dessen, was der Mensch sonst nicht kennt; verbunden mit der Überzeugung, dass man es nie verwindet; so schlimm, dass man nachher denkt, das könne nicht passiert sein; mit enormen seelischen und/oder körperlichen Schmerzen verbunden; etwas, das von unserem Gehirn aufgesplittet oder ganz verdrängt wird“ ( Huber 2007: 38).
Einem Trauma ausgesetzt zu sein, bedeutet also für die Betroffenen immer, im direkten Erlebnis extremem Stress ausgesetzt zu sein. Ein Trauma tritt plötzlich und unerwartet auf und geht mit einer starken Überforderung in der Bewältigung des Ereignisses einher. Für Kinder sind traumatische Erlebnisse am schlimmsten, da sie noch nicht über ausreichende Möglichkeiten des Schutzes und der Verarbeitung verfügen. Bei Kindern kommt es neben der extremen Hilflosigkeit und Ohnmachtgefühlen darüberhinaus zu Gefühlsüberflutungen, Panik und Todesängsten (vgl. Reddemann, L./Dehner-Rau, C. 2004: 14ff).
Die folgende Abbildung gibt eine allgemeine Zusammenfassung darüber, welche Bedingungen vorhanden sein müssen, damit von einem psychischen Trauma ausgegangen werden kann. Es ist jedoch wichtig zu unterscheiden, dass nicht jedes belastende, stressbesetzte Ereignis traumatisch wirken muss.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung: Traumaformel
2.1.3 Terminologische Abgrenzung: Trauma- Stress- belastendes Lebensereignis
Nicht jedes belastende Lebensereignis ist gleichzusetzen mit einem Trauma. Wie bereits unter Punkt 2.1.2 beschrieben, handelt es sich bei einer Traumatisierung um ein tatsächliches, extremes, stressreiches, äußeres Ereignis, das mit seelischen und/oder körperlichen Schmerzen verbunden und vom Menschen eigentlich nicht zu verkraften ist. Ein Trauma entsteht aufgrund einer seelischen oder körperlichen Verletzung, verbunden mit Leiden und Kranksein. Traumatische Ereignisse sind z.B. katastrophale Unfälle, Überfälle, Wirbelstürme oder Kriege.
Stress hingegen unterscheidet sich vom Trauma darin, dass hierbei ein eher kognitiver Zustand des Menschen beschrieben wird, der alltäglich sein kann und die Menschen in irgendeiner Art und Weise damit zurechtkommen lässt. Stress kommt aus dem Englischen und wird mit „Druck“, „Belastung“, „Beanspruchung“ und „Anspannung“ übersetzt. Menschen fühlen immer dann eine gewisse Bedrohung, wenn sie mit Forderungen oder Anlässen konfrontiert sind, die schwerwiegende Änderungen von ihnen verlangen. Dieses wird in der Literatur „Stresszustand“ genannt. Er besteht aus einem „Stressor“, dem Ereignis, das die Anforderungen erzeugt und einer „Stressreaktion“, der spezifischen Reaktion einer Person auf diese Anforderungen. Stressoren sind z.B. alltägliche Belastungen wie Berufsverkehr oder plötzlich erscheinende, unerwartete Gäste zu Hause. Ein belastendes Lebensereignis stellt immer die Grundlage eines Traumas dar. Hierbei handelt es sich in der Regel um länger andauernde Probleme wie z.B. Armut oder eine schwache Gesundheit (vgl. Comer, Ronald J. 1995: 192).
Die Traumatherapeutin Michaela Huber macht in ihren Büchern deutlich, dass ein belastendes Lebensereignis erst dann zum Trauma wird, wenn eine Dynamik in Gang gesetzt wird, die das Gehirn buchstäblich „in die Klemme bringt“ und es geradezu dazu nötigt, auf besondere Weise mit diesem Ereignis umzugehen. Sie spricht in diesem Zusammenhang von der „traumatischen Zange“, die in der folgenden Abbildung verdeutlicht wird.
Abbildung : Die „traumatische Zange“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bildquelle: Huber, Michaela: Trauma und die Folgen 2007: 39
Die Abbildung zeigt, dass das Informationssystem des Gehirns und die vorhandenen Stressbewältigungsmechanismen eines Menschen bei einem äußeren, stressreichen Ereignis überfordert sind und das Erlebte nicht verarbeitet werden kann. Es wird hier auch von „Überflutung mit aversiven Reizen“ gesprochen. Von aversiven Reizen spricht man, wenn bestimmte Reize feindlich oder nicht bewältigbar erscheinen. Ein aversiver Reiz kann z.B. sein dass ein Mensch die unvorhergesehene Nachricht eines Arztes hört, unheilbar krank zu sein, da er an einem Tumor mit Metastasen leide. Ein anderer aversiver Reiz wäre, zusehen zu müssen, wie jemand völlig außer Kontrolle ist und eine andere Person verletzt oder gar tötet. In diesem Moment reagiert man häufig mit Ohnmacht, Scham und Verzweiflung darüber nicht eingreifen zu können (vgl. Huber, Michaela 2007: 40f).
„Kämpfe gegen den Stressor an (fight) oder fliehe davor (flight)“ (Cannon, Walter, zitiert in Huber, Michaela 2007: 41). Eine Fight-or-Flight- Reaktion ist situations- und personenabhängig. Bei der Fight-or-Flight- Reaktion handelt es sich um Reflexe von Menschen, die vom Stammhirn gesteuert werden. Das Gehirn als zentrales Informationsverarbeitungssystem versucht auf schnelle und wirksame Weise, mit Stresssituationen zurechtzukommen. Dieses geschieht bei jedem Menschen individuell, denn jeder Mensch reagiert anders auf belastende Lebensereignisse. Wie er reagiert, hängt davon ab, über welche Stressbewältigungs- und Verarbeitungsmechanismen er verfügt. So ist es z.B. möglich, dass ein Opfer eine extreme Situation nicht verarbeiten kann und es bei ihr zu einer Traumatisierung kommt, während ein anderes Opfer in derselben Situation diese besser bewältigt und das Geschehene ein belastendes Lebensereignis bleibt. Eine Fight- Reaktion kann z.B. sein, wenn ein Junge, der Zeuge der Misshandlung seiner Mutter wird, wegläuft und Hilfe holt oder sich zwischen die Eltern stellt und den Täter irritiert oder abdrängt und damit die Katastrophe verhindern oder mildern kann. Eine Flight- Reaktion wäre z.B. wenn jemand sich weg duckt oder um Hilfe oder Gnade fleht bzw. sich von einem Angreifer lösen kann und dann schnell wegläuft. Durch die Fight-or-Flight- Reaktion kann es dem Menschen gelingen, mit dieser Situation umzugehen und sie (nur) als belastendes Lebensereignis zu verarbeiten. Wenn die Fight-or-Flight- Reaktion nicht umgesetzt werden kann, dann reagiert das Gehirn mit dem Mechanismus „Freeze“ und „Fragment“. Freeze bedeutet „Einfrieren“/„Erstarren“. Es handelt sich dabei um eine Lähmungsreaktion. Diese Reaktion wird dann als Trauma verarbeitet und es handelt sich schließlich um mehr als ein belastendes Lebensereignis. Wenn es nicht gelingt, die aversiven Reize unschädlich zu machen, dann distanziert sich der Organismus davon. Viele körpereigene Endorphine (z.B. Adrenalin und Noradrenalin) werden ausgeschüttet und es kommt zu einem „geistigen Wegtreten“ und zu einer „Neutralisierung“ akuter Todesangst. Der Mensch reagiert mit einer „Entfremdung vom Geschehen“, er unterwirft sich der Situation. Viele Menschen bekommen oftmals erst sehr viel später die Reaktionen des Geschehens mit, wenn die Gefahr vorüber ist und sie sich in Sicherheit befinden. In diesem Moment löst sich die Lähmungsreaktion wieder und häufig reagieren die Menschen dann mit Weinen, Schreien, Schmerzempfindungen und Zusammenbrüchen. Wird das Erlebte nicht mehr vollständig wahrgenommen und kann nicht mehr genau wiedererinnert werden, dann spricht man von Fragment (vgl. Huber, Michaela 2007: 41ff).
Exkurs: Was passiert bei einem Trauma im Gehirn?
Das limbische System im Gehirn ist entscheidend bei der Erstbewältigung und späteren Erinnerung extrem stressreicher Ereignisse. Es dient der Verarbeitung von Emotionen und besteht aus der Amygdala, dem Hippocampus und dem Hypothalamus, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.
Abbildung: Das limbische System
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bildquelle: http://www2.uni-wuppertal.de, zugegriffen am 12. Juni 2008
Das limbische System ist über den Hypothalamus mit dem darunterliegenden Stammhirn und über den Thalamus mit dem darüber liegenden Großhirn verknüpft. Es wird auch das „emotionale Gehirn“ genannt, das für die Ausschüttung von Endorphinen und körpereigenen Morphinen verantwortlich ist, und Prozesse, wie z.B. den Hormonhaushalt, Blutdruck, Herzfunktionen, Verdauung und das Immunsystem, steuert. Es beeinflusst und bestimmt des Weiteren das Angriffs-, Abwehr-, Angst- und Sexualverhalten (vgl. F.A. Brockhaus 2001: 349). Alle Hirnregionen sind direkt mit dem limbischen System verschaltet (die rechte Gehirnhälfte allerdings stärker als die linke), wie die folgende Abbildung des Hirnstamms zeigt.
Abbildung: Der Hirnstamm
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bildquelle: http://www2.uni-wuppertal.de, zugegriffen am 12. Juni 2008
Der Hirnstamm verbindet das Gehirn mit dem Rückenmark. Hier laufen alle Informationen zusammen und überkreuzen sich im unteren Teil. Aufgrund dieser Überkreuzung wird die rechte Körperhälfte von der linken Gehirnhälfte gesteuert und umgekehrt. Der Hirnstamm ist für die allgemeinen Lebensfunktionen zuständig. Seine Strukturen kontrollieren die Herzfrequenz, den Blutdruck und die Atmung (vgl. http://www.gesundheit.de/, zugegriffen am 12. Juni 2008). Beim Hippocampus handelt es sich um das sogenannte „Archiv“ unseres Gedächtnisses. Es sorgt dafür, dass Menschen Ereignisse biografisch, episodisch und narrativ erinnern können. Das biografische Erinnern meint, dass Menschen sich genau daran erinnern können, was ihnen selbst geschehen ist (z.B. dass ihrem selbst ein Unfall passiert ist). Das episodische Erinnern bedeutet, dass Menschen Ereignisse zu bestimmten Zeiten zuordnen können (z.B. am Tag X ist der Unfall Y passiert); das narrative Erinnern bedeutet, dass Menschen über Erinnerungen reden können und dabei nicht sprachlich blockiert sind. Die Amygdala ist wesentlich an der Entstehung von Angst beteiligt. Sie bestimmt, ob es zu einer Reaktion auf Stress kommt oder nicht (vgl. F.A. Brockhaus 2001: 34). Ist die Amygdala zerstört, führt dieses zum Verlust von Furcht- und Aggressionsempfinden und schließlich zum Zusammenbruch der lebenswichtigen Warn- und Abwehrreaktionen. Die unmittelbar körperlichen und seelischen Reaktionen werden aufgesplittet (Fragment) und es kommt häufig zu Entfremdungsgeschehen (z.B. kurzzeitiger Schmerzunempfindlichkeit oder emotionaler Taubheit). In traumatischen Situationen dominiert also die Amygdala kurzfristig. Die Funktionen des Hippocampus fallen dadurch teilweise aus und schalten sich ab, so dass häufig bewusste Erinnerungen an Ereignisse ganz oder teilweise fehlen (Freeze). Die Amygdala und der Hippocampus arbeiten parallel und schaffen es also nicht, gemeinsam die extremen Ereignisse innerpsychisch zu verarbeiten. Dieses führt dann am Ende zu traumatischen Reaktionen und anhaltenden Stressreaktionen (vgl. Huber, Michaela 2007: 46ff).
2.1.4 Klassifikationssysteme in der Traumatologie
Neurologen, Psychiater, Psychologen und Psychotherapeuten benutzen in ihrer Arbeit Klassifikationssysteme, die es ihnen ermöglichen, durch schnelles Nachschlagen in Untersuchungsituationen das Vorhandensein oder das Fehlen störungsspezifischer Symptome zu prüfen. Die Klassifikationssysteme dienen als Kriterienliste und als Richtlinie. Klare Beschreibungen dienen des Weiteren dazu, dass sich Kliniker und Forscher untereinander verständigen können. In Deutschland ist der ICD-10 das offiziell anerkannte diagnostische Klassifikationssystem. Der DSM-IV bzw. DSM-IV-TR wurde von der American Psychiatric Association (APA) entwickelt (siehe Punkt 3.).
In meiner Diplomarbeit gehe ich auf diese beiden Klassifikationssysteme ein, da sie für eine differenzierte Darstellung der Symptomatik und für die Diagnose von Störungen unerlässlich sind und beide in der heutigen Praxis Anwendung finden. Für die soziale Arbeit sind diese beiden Klassifikationssysteme ebenfalls von großer Bedeutung und finden in der Praxis immer mehr Anwendung. Die Zusammenarbeit mit Institutionen und Fachpersonen, wie z.B. mit Kliniken und Ärzten, ist dadurch beispielsweise erleichtert worden. Diese beiden Systeme werden u.a. in psychosozialen Beratungsstellen angewendet, da sie einheitliche und systematische Definitionen beinhalten. Das einheitliche Vokabular erreicht, dass u.a. die Diagnosen von Ärzten von Sozialarbeitern in der Praxis besser verstanden werden und schneller Möglichkeiten gefunden werden können, Beratungsziele und –inhalte zu erarbeiten.
Aus meiner eigenen Praxis kann ich berichten, dass wir uns innerhalb der Beratung mit der Symptomatik bestimmter Störungen in den Klassifikationssystemen vertraut gemacht haben. Wir konnten einige Symptome durch Beobachtungen bei einer Klientin feststellen. Über diese Beobachtungsinhalte und Vermutungen aus der Sicht der Beratung haben wir mit der Frau gesprochen und anschließend gemeinsam Rat bei Ärzten eingeholt. Mit ihnen führten wir einen transparenten Austausch. Die Frau wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und schließlich von Ärzten behandelt, die im Gegensatz zu uns Sozialarbeiterinnen eine genaue Diagnose erstellen und therapeutische Arbeit leisten können (siehe Punkt 10.3).
Wie bereits unter Punkt 2.1.2 und Punkt 2.1.3 beschrieben, möchte ich die traumatischen Störungen der Klassifikationssysteme ausführlicher und operationalisierter beschreiben, um einen Gesamtüberblick in der Terminologie zu ermöglichen. Beide Klassifikationssysteme verwenden ein Codierungssystem. Dieses beinhaltet jeweils diagnostische Codeziffern. Jede Codeziffer bezeichnet eine Störung und enthält jeweils dazu eine Kriterienliste. Der DSM-IV-TR hat zusätzlich die offiziellen Codierungsziffern des ICD-10 mit in das Handbuch aufgenommen und in Klammern hinter die eigenen Codeziffern gesetzt.
2.1.4.1 Die Klassifikation der Traumatologie im ICD-10
Im ICD-10 wird die Psychotraumatologie den „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen (F43)“ zugeordnet. Die Störungen in diesem Kapitel sind abhängig von Faktoren wie z.B. einem außergewöhnlichen, belastenden Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft bzw. eine besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat und schließlich eine Anpassungsstörung hervorruft. Der ICD-10 beschreibt, dass die aufgeführten Störungen des Kapitels F43 immer als direkte Folge der belastenden Ereignisse oder der andauernden, unangenehmen Situationen ausschlaggebend sind und auftreten. Ohne die Einwirkungen der unangenehmen Situationen würden diese Störungen nicht entstehen.
Als akute Belastungsstörung (F43.0) wird laut dem ICD-10 als eine „vorübergehende Störung von beträchtlichem Schweregrad, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche körperliche oder seelische Belastung entwickelt, und im allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt,“ bezeichnet. „ Die individuelle Vulnerabilität (Verwundbarkeit) und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen (Coping-Strategien) spielen beim Auftreten und beim Schweregrad der akuten Belastungsreaktion eine Rolle“ (WHO 2005: 168).
Symptome der akuten Belastungsstörung beginnen häufig mit einer Art von Betäubung. Weitere Symptome sind z.B. das eingeengte Bewusstsein, die eingeschränkte Aufmerksamkeit, Reize können nicht mehr verarbeitet werden und es kommt zu Desorientiertheit. Hinzu kommen Symptome wie z.B. Rückzug, Unruhe, Überaktivität, Flucht, Schwitzen, Erröten und Zeichen von panischer Angst. Die Symptome treten in der Regel innerhalb von Minuten nach dem belastenden Lebensereignis auf und klingen innerhalb weniger Tage (2-3 Tage) bzw. innerhalb weniger Stunden wieder ab (vgl. WHO 2005: 168).
Die akute Belastungsstörung wird in der Literatur mit ABS abgekürzt. Sie stellt ein erhöhtes Risiko für die Ausbildung einer posttraumatischen Belastungsstörung dar.
Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS; PTB oder PTSD) wird wie bereits unter 2.1.2 definiert als „eine verzögerte (…) Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes (kurz- oder langanhaltend), die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde“ , beschrieben (WHO 2005: 169).
Zu ihren Symptomen zählen das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Flashbacks), Gefühle von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, übermäßige Schreckhaftigkeit, Schlaflosigkeit, Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, sowie Furcht und Vermeidung von Stichworten und Gegebenheiten, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Des Weiteren kann es zu dramatischen akuten Ausbrüchen von Panik, Angst oder aggressiven Verhaltensweisen kommen, die ebenfalls durch ein plötzliches Erinnern oder Wiedererleben des Traumas oder der ursprünglichen Reaktion ausgelöst werden. Depressionen, übermäßiger Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch und Suizidgedanken sind bei der PTBS nicht selten.
„Die Störung folgt dem Trauma mit einer Latenz, die Wochen bis Monate dauern kann (doch selten mehr als 6 Monate nach dem Trauma). Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. Bei wenigen Patienten nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf (…)“ (WHO 2005: 170).
Der ICD-10 ordnet die PTBS als eine „andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“ ein, wenn die Folgen noch nach Jahren auftreten und chronifiziert sind. Die PTBS gehört dann im ICD-10 zu der Codierungsziffer F62.0. Sie wird zu den andauernden Persönlichkeitsänderungen, nicht als Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns, klassifiziert.
2.1.4.2 Die Klassifikation der Traumatologie im DSM-IV-TR
Im DSM-IV und DSM-IV-TR werden die Traumata den Angststörungen zugeordnet.
Die akute Belastungsreaktion besitzt die Codierungsziffer 308.3 und enthält Kriterien wie z.B. die Konfrontation mit einem oder mehreren extrem belastenden Ereignissen, die den tatsächlichen oder drohenden Tod oder eine ernsthafte Verletzung oder Gefahr der körperlichen Unversehrtheit am eigenen Leib oder von anderen Personen beinhaltet, sowie mit Reaktionen wie Furcht, Hilflosigkeit oder Entsetzten einhergeht. Personen, die an einer akuten Belastungsstörung leiden, weisen Symptome auf wie z.B. ein subjektives Gefühl der „Taubheit“, ein Losgelöstsein oder ein Fehlen emotionaler Reaktionsfähigkeit, ein deutlich vermindertes Interesse oder eine verminderte Teilnahme an Aktivitäten, Derealisationserleben (eine zeitweilige oder dauerhafte abnorme oder verfremdete Wahrnehmung der Umwelt), Depersonalisationsleben, dissoziative Amnesien (z.B. die Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Aspekt des Traumas zu erinnern), Angst, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Wutausbrüche, übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilanz), Konzentrationsschwierigkeiten, übertriebene Schreckreaktionen, motorische Unruhe, sowie Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Die betroffenen Personen weisen ein Gefühl einer eingeschränkten Zukunft auf. Sie erwarten z.B. nicht Karriere, Ehe, Kinder oder ein normales langes Leben zu haben. Sie erleben das traumatische Ereignis häufig auch erneut wieder, z.B. in Form von wiederkehrenden Bildern, Gedanken, Träumen, Illusionen und anderen Flashback- Episoden. Die Betroffenen leiden sehr stark und versuchen Reize, die an das Trauma erinnern, bewusst zu vermeiden. Zu diesen Reizen zählen Gespräche, Gedanken und Gefühle, sowie das bewusste Vermeiden von Aktivitäten, Orten oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten.
Die diagnostischen Kriterien für die posttraumatische Belastungsstörung sind der Codierungsziffer 309.81 zugeordnet. Sie enthält dieselben Kriterien wie die akute Belastungsstörung (308.3). Beide Störungen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Intensität und Dauer. Bei der akuten Belastungsreaktion (ABS) dauern die Symptome mindestens zwei Tage und höchstens vier Wochen an und treten innerhalb von vier Wochen nach dem traumatischen Ereignis auf. Bei der ABS müssen mindestens vier der genannten Symptome auftreten. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung hingegen dauern die Symptome länger als einen Monat an. Mindestens sechs der genannten Symptome müssen auftreten. Von einer akuten PTBS wird gesprochen, wenn die Symptome weniger als drei Monate andauern. Bei einer chronischen PTBS hingegen müssen die Symptome länger als drei Monate andauern. Von einem verzögerten Beginn wird gesprochen, wenn der Beginn der Symptome mindestens sechs Monate nach dem Einwirken des Belastungsfaktors liegt (vgl. Saß, Henning/Wittchen, Hans-Ulrich/Zaudig, Michael/Houben, Isabel: 2003: 193ff).
Das DSM weist im Gegensatz zum ICD-10 speziell daraufhin, dass Kinder ebenfalls an der PTBS leiden können. Kinder weisen dabei andere Symptome auf als Erwachsene. Agitiertes (unruhiges, erregtes oder aufgelöstes) Verhalten, Schlafstörungen, beängstigende Träume ohne wiedererkennbaren Inhalt (z.B. Alpträume mit Monstern), Verhaltensänderungen, traumaspezifische Neuinszenierungen oder Spiele, in denen wiederholt Themen oder Aspekte des Traumas ausgedrückt werden, sind hier beispielsweise zu nennen.
2.1.4.3 Sonstige Klassifikationen in der Psychotraumatologie
In klinischen Psychologie- Standardwerken, wie z.B. in dem von Gerald C. Davison und John M. Neale, werden die traumatischen Störungen zu den Angststörungen kategorisiert. Davison und Neale unterscheiden deutlich zwischen der akuten Belastungsstörung und der posttraumatischen Belastungsstörung. „Nahezu jeder, der ein Trauma erlebt, erfährt auch eine Belastung, die manchmal sehr groß sein kann. Das ist völlig normal. Aber von einer akuten Belastungsreaktion erholt man sich nach einigen Tagen oder Wochen und führt weiterhin ein Leben, das nicht durch eine posttraumatische Belastungsstörung gekennzeichnet ist“ (Davison/Neale 1998:174).
Die Hauptursache für eine PTBS ist für Davison/Neale das stattgefundene Ereignis. Des Weiteren fassen sie die Symptome in drei Kategorien zusammen, die grundsätzlich länger als einen Monat bestehen müssen. Bei den Symptomen handelt es sich um das Wiedererleben des traumatischen Ereignisses, oftmals verbunden mit Alpträumen, einer intensiven emotionalen Erregung und der Meidung der mit dem Ereignis verbundenen Reize (z.B. bestimmte Geräusche oder Gerüche) oder Einschränkung der Reaktivität, sowie Symptome mit gesteigerter Erregung.
„Für das Ereignis kann sogar eine Amnesie bestehen. Die Einschränkung bezieht sich auf ein vermindertes Interesse an Anderen, ein Gefühl der Entfremdung und die Unfähigkeit, etwas Angenehmes zu fühlen. (…) Der Betroffene schwankt zwischen Wiedererleben und Rückzug hin und her“ (Davison/Neale 1998: 174f).
Neben Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz und starken Schreckreaktionen zählen Davison/Neale in ihrem Buch andere Probleme wie Ängste (z.B. Phobien), Depressionen, Zwänge, Ärger, Schuldgefühle, Substanzmissbrauch (Süchte), Eheprobleme, Beeinträchtigungen der Berufstätigkeit, explosive Ausbrüche von Gewalttätigkeit, psychosomatische Probleme wie z.B. Rückenprobleme, Kopfschmerzen oder Magen-Darm-Beschwerden, Herz-Kreislauf-Störungen, Suizidgedanken und –Pläne auf (vgl. Davison/Neale 1998: 175).
Das klinische Psychologie- Lehrbuch von Ronald J. Comer nennt drei Faktoren für eine PTBS: Kindheitserfahrungen, die Persönlichkeit und das soziale Unterstützungssystem der Betroffenen. Diese drei Faktoren spielen für Comer eine wichtige Rolle und die Ereignisse können so extrem und traumatisch sein, dass sie eine positive Kindheit, eine robuste Persönlichkeit und einen unterstützenden sozialen Kontext wirkungslos machen können (vgl. Comer 1995: 235ff).
Tölle und Windgassen zählen die traumatischen Störungen zu den reaktiven, neurotischen und psychosomatischen Störungen. In ihrem Psychiatrie-Lehrbuch beschreiben sie neben der akuten Belastungsreaktion (F43.0 nach ICD-10) und der posttraumatischen Belastungsstörung (ICD-10: F43.1) die Anpassungsstörungen. Die Folgen stärkerer Belastungen (Traumen) sind so stark, dass die Betroffenen aus dem „Gestörtsein“ nicht mehr herauskommen und gleichzeitig Probleme in der Anpassung und Bewältigung der neuen Situation aufweisen. Die Anpassungsstörungen sind im ICD-10 unter F43.2 zu finden und reichen von der Reaktion auf den Verlust eines nahen Menschen (Trauerreaktion) bis zu den Anpassungsstörungen von Migranten.
Tölle und Windgassen machen in ihrem Lehrbuch deutlich, dass traumatische Störungen bei Kindern ebenfalls auftreten können, diese jedoch an anderen Symptomen leiden wie Erwachsene. Bei Kindern kann Regression eintreten, erkennbar an Enuresis und anderem kleinkindhaften Verhalten. Bei Jugendlichen kann es auch zu dissozialen Störungen kommen, wie z.B. Zündeln, Schulschwänzen, Diebstahl, Vandalismus und aggressive Verhaltensweisen (vgl. Tölle/Windgassen 2006: 69f).
3. Die historische Entwicklung der Psychotraumatologie
Die Geschichte der Psychotraumatologie beginnt in der Literatur häufig mit der Veröffentlichung der Schrift „Ätiologie der Hysterie“ von Sigmund Freud im Jahre 1896.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Sigmund Freud lebte von *1856 - † 1939. Er war ein österreichischer Arzt und Tiefenpsychologe und ist der Begründer der Entwicklungspsychologie und der Psychosomatik .
Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud, zugegriffen am 09.04.2008
Freuds Veröffentlichung „Ätiologie der Hysterie“ hatte jedoch gewichtige Vorläufer, wenn es um die Geschichte der Psychotraumatologie geht. In tieferen Literaturrecherchen gelangt man bis ins Altertum, wo besonders Soldaten von Traumatisierungen betroffen gewesen waren. Die wissenschaftliche Geschichte der Psychotraumatologie fand hingegen erst im 19. Jahrhundert statt. Hat das Trauma organische oder psychische Ursprünge? Über diese Fragestellung wurde in der damaligen Zeit viel diskutiert.
John Eric Erichsen war ein Londoner Chirurg, der im Jahre 1866 mit dem Buch „Railway spine syndrome“ großen Einfluss auf die Geschichte der Psychotraumatologie nahm. Erichsen beschäftigte sich mit den kognitiven und psychischen Symptomen nach Eisenbahnunfällen. Er stellte die These auf, dass Traumata rein organische Ursprünge haben: Die Symptomatik beinhalte Ängste, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Albträume sowie verschiedene somatische Symptome. Als Ursache galt für ihn ausschließlich eine Verletzung des Rückenmarks. Er warnte außerdem eindringlich davor, dieses Störungsbild mit jenem der Hysterie zu verwechseln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
John Eric Erichsen lebte von *1818 - † 1896. Er war ein britischer Chirurg und gehört heutzutage zu den Entscheidungsträgern der modernen Chirurgie.
Bildquelle: http://www.npg.org.uk, zugegriffen am 09.04.2008
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wilhelm Griesinger lebte in der Zeit von *1817- † 1868. Er war ein deutscher Psychiater und Internist und gilt als Begründer der modernen Psychiatrie.
Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Griesinger.jpg, zugegriffen am 10.04.2008
Im Jahre 1885 wurde die These von Erichsen von Herbert Page, ebenfalls einem Londoner Chirurgen, hinterfragt und als falsch bezeichnet. Page vertrat die Meinung, dass Traumata psychologische Ursprünge haben und der Schreck und der Schock das Wesentliche für die Traumata seien. Page sah überwiegend das Gehirn als Ursache und Auslöser von Traumata an und schlug deshalb vor, besser von „Railway Brain“ zu sprechen.
Griesinger vertrat die Auffassung, dass in jeder Geisteskrankheit das Gehirn leiden würde und dass bei psychischen Krankheiten ebenfalls Störungen des Gehirns zu erkennen seien (vgl. Sachsee, Ulrich 2005: 7 ). Griesinger ging von einem ganzheitlichen Denken aus, in dem der Leib und die Seele eine Einheit bildeten. Des Weiteren vertrat er die Meinung, dass „Irresein“ von schweren Schicksalsschlägen oder zu harter Erziehung verursacht werden könne (vgl. Sachsee, Ulrich 2005: 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hermann Oppenheim lebte von *1858 - † 1919. Er war ein deutscher Neurologe und wurde vor allem durch seine Studien zur multiplen Sklerose bekannt. Außerdem wurden nach ihm Krankheiten, wie die Oppenheimsche Krankheit, die Oppenheimsche zerebrale Kinderlähmung, der Oppenheimsche Unterschenkelreflex und der Oppenheimsche Fressreflex benannt.
( Bildquelle: http://www.uic.edu , zugegriffen am 10.04.2008)
Hermann Oppenheim beschrieb 1889 als erster den Begriff der „traumatischen Neurose“, die organisch bedingt als Folge tiefgreifender Erschütterungen im zentralen Nervensystem mit den Symptomen der Desorientiertheit, Aphasie, Schwindel sowie Schlafstörungen einhergehe (vgl.http://deposit.ddb.de, zugegriffen am 10.04.2008). Oppenheimer griff damit das Konzept von Wilhelm Griesinger auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auguste Ambroise Tardieu lebte in der Zeit von *1818- †1879. Er war ein französischer Toxikologe und forensischer Mediziner. Er schrieb das erste Buch über die Misshandlung von Kindern.
Bildquelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Ambroise_Tardieu
Im Jahre 1860 erwachte erstmals das Interesse am Kinderschutz. Tardieu veröffentlichte eine gerichtsmedizinische Studie über Misshandlungen von Kindern, die oft durch die eigenen Eltern begangen worden waren. In Frankreich entstanden die ersten Kinderschutzvereine. Dass Kinder traumatische Erfahrungen erleben könnten, spielte jedoch zu der Zeit nur eine untergeordnete Rolle. Die Sorge um Kinder beschränkte sich in dieser Zeit lediglich auf verwaiste und ausgesetzte Kinder. Das psychologische Trauma von Erwachsenen war stattdessen im Interesse der damaligen Zeit und wurde immer wieder mit der Hysterie in Verbindung gebracht.
Die Hysterie als Krankheit gab es bereits im Altertum. Symptome der Hysterie waren u.a. Nervenleiden, Lähmungen, Bewegungsstörungen, Ausfälle der Sinnesorgane und Wahnvorstellungen. In der damaligen Zeit wurde die Ursache für eine Hysterie zunächst im Zusammenhang mit dem weiblichen Geschlecht gesehen. Der Name „Hysterie“ stammt aus dem Griechischen und wird mit „Gebärmutter“ ins Deutsche übersetzt. Das hysterische Verhalten wurde anfangs ausschließlich damit begründet, dass die Gebärmutter nicht regelmäßig ausreichend mit Samenflüssigkeit männlicher Menschen versorgt wurde. Stattdessen wandere die Samenflüssigkeit (Sperma) frei im Körper einer Frau umher, bis sie sich schließlich im Gehirn absetzen könne. Im Mittelalter galten die Menschen mit hysterischer Symptomatik als „vom Teufel besessen“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Thomas Sydenham lebte von * 1624- † 1689.
Er war ein englischer Arzt, der sich auf Infektionskrankheiten spezialisierte und sich mit der Epilepsie, Hysterie, Gicht und Rheuma beschäftigte.
Bildquelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sydenham, zugegriffen am 10.04.2008
Sydenham wiedersprach diesen Behauptungen bezüglich der Ursachen von hysterischem Verhalten aus dem Altertum und dem Mittelalter, ebenso wie dies Jean- Martin Charcot und Sigmund Freud taten.
Freud führte in diesem Zusammenhang den Begriff der „Konversionsneurose“ ein. Ihm gelang es, die tatsächlichen Ursachen für die Hysterie aufzudecken. In seinen Studien beobachtete er, dass hysterische Symptome verschwanden, wenn es im hypnotischen Zustand gelang, die entsprechenden, aus dem Bewusstsein verdrängten Inhalte und den dazugehörigen Affekt wieder in Erinnerung zu bringen, ihn zu beleben. Freud schloss daraus, dass hysterische Symptome die Folgen neurotischer Verarbeitung intrapsychischer Konflikte (also Konflikte, die innerhalb der Psyche ablaufen) sind, und dass die Konversion, d.h. die Umsetzung eines psychischen Konfliktes in körperliche (somatische) Symptome, typisch für eine Hysterie sei (vgl. http://www.btonline.de, zugegriffen am 19.Mai 2008).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jean-Martin Charcot lebte in der Zeit von *1825-† 1893. Er war ein französischer Neurologe, der u.a. Sigmund Freud als berühmten Schüler hatte.
Bildquelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Martin_Charcot, zugegriffen am 10.04.2008
Jean- Martin Charcot stellte ebenfalls fest, dass sich hysterische Symptome durch Hypnose behandeln und provozieren lassen (vgl. Sachsee, Ulrich 2005: 9). Er kam schließlich zu der Erkenntnis, dass hysterische Anfälle das Ergebnis von durchgemachten, unerträglichen traumatischen Erlebnissen darstellten. Sigmund Freud und Pierre Janet, Schüler von Jean- Martin Charcot, erforschten die Erkenntnisse Charcots weiter. Sie kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass in der Anamnese von Frauen sehr häufig Hinweise auf sexuelle Übergriffe im Kindesalter auftauchten. Weiterhin stellte sich heraus, dass Frauen unter Hypnose gerade diese Erlebnisse mit ihrem ganzen Schrecken wiedererlebten und danach nicht mehr „besessen“ waren (vgl. Weinberg, Dorothea 2005: 21).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Pierre Janet lebte in der Zeit von *1859- †1947. Er war ein französischer Psychiater und Psychotherapeut. Sein Schwerpunkt war u.a. die „Dissoziation“.
Bildquelle: http://www.arikah.net/enciclopedia-portuguese/Pierre_Janet
Die Ursache für die Hysterie lag nach Pierre Janets Auffassung darin, dass sie entweder angeboren oder durch ein psychisches Trauma bedingt sei. Dissoziation verstand er als Folge einer Überforderung des Bewusstseins. Janets Patienten zeigten durch Erinnerungen Reaktionen, die bei den ursprünglichen Traumata eine Rolle spielten. Er war der Auffassung, dass furchterregende Ereignisse und die dazugehörigen heftigen Emotionen dazu führen können, dass Menschen die Erinnerungen an diese Erfahrungen nicht in das Bewusstsein integrieren können (vgl. Janet 1904 in: Weiß, Wilma 2008: 62). Janet verdanken wir die erste umfassende Beschreibung der Wirkungen eines Traumas auf die Psyche.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836624978
- DOI
- 10.3239/9783836624978
- Dateigröße
- 7.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg – Fakultät für Bildungs-, Kultur- und Sozialwissenschaften, Soziale Arbeit/Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- trauma traumatisierung gerichtsverfahren frühe kindheit soziale arbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de