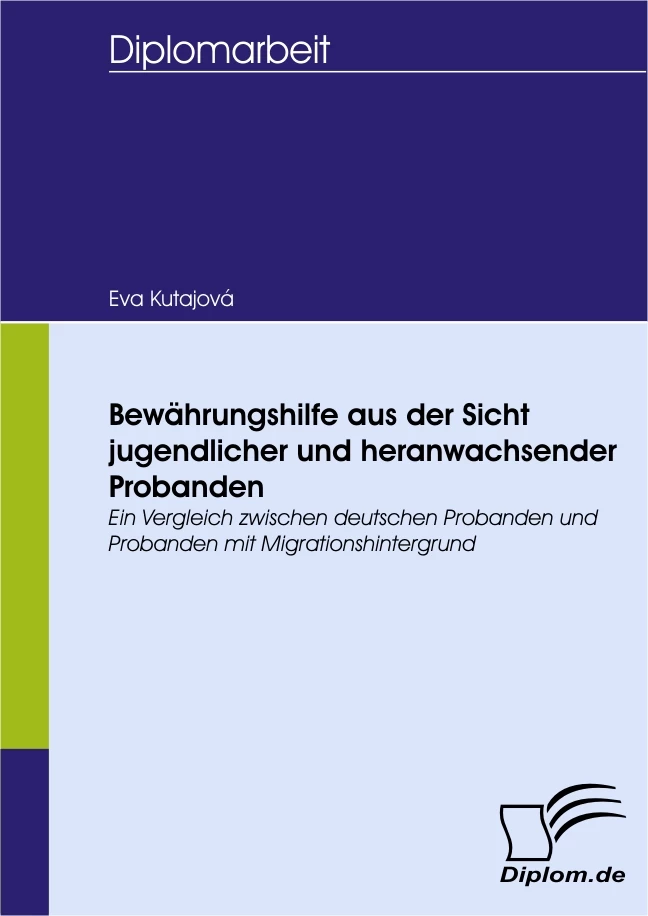Bewährungshilfe aus der Sicht jugendlicher und heranwachsender Probanden
Ein Vergleich zwischen deutschen Probanden und Probanden mit Migrationshintergrund
Zusammenfassung
Das Gesetz kann niemanden zwingen, seinen Nächsten zu lieben, aber es kann es schwieriger für ihn machen, seinem Hass Ausdruck zu geben.
Dieses Zitat des amerikanischen Juristen Neil Lawson könnte ein Denkanstoß für die innenpolitische Diskussion zur Verschärfung des Jugendgerichtsgesetzes sein. Das Thema erhöhter Gewaltbereitschaft und des daraus resultierenden Gewaltausbruches, vor allem unter nichtdeutschen Jugendlichen, wird in der deutschen Presse immer präsenter und immer lauter wird auch das Verlangen nach schärferen Strafen. Vermehrt stellt man sich die Frage nach den möglichen Gründen des augenfälligen, zum Teil heftigen Verhaltensumschwungs innerhalb dieser Altersgruppe. Woher kommt dieser Hass auf Alles und Jeden? Ist es die Perspektivlosigkeit, soziale, gesellschaftliche und kulturelle Desintegration, sind es materielle Defizite oder einfach nur Willkür der jungen Generation? Wird die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen durch die Verschärfung der Gesetze überhaupt gedämmt?
Das deutsche Rechtssystem tritt die Würde des Menschen nicht mit Füßen. Im Gegenteil: jeder, der in seinem Leben auf die schiefe Bahn geraten ist, bekommt eine zweite Chance, in die Normalität zurückzukehren. Das für manche, nach law and order amerikanischer Ausprägung trachtende, deutsche Politiker (und auch Bürger) zu lasche Strafsystem, ermöglicht vielen erwachsenen und jugendlichen Straffälligen aus den eigenen Fehlern zu lernen, sich zu bessern und sich in die Gesellschaft neu einzugliedern. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die Befähigung zur Führung eines straffreien Lebens und somit die Verhinderung des weiteren Vollzugs einer Freiheitsstrafe, wird dem Straffälligen durch die Bewährungshilfe, die ein wichtiger Teil der Straffälligenhilfe in Deutschland ist, ermöglicht.
Welche Ziele die Bewährungshilfe verfolgt, welche Aufgaben sie erfüllt, welches die Tätigkeitsbereiche eines Bewährungshelfers sind, und noch sehr viel mehr, wird in der vorliegenden Arbeit thematisiert.
Der tatsächliche Fokus der Arbeit liegt aber auf der Klientel der Bewährungshilfe. Ziel dieser Arbeit ist die Klärung der folgenden beiden Fragen:
Wie wird die Bewährungshilfe von jugendlichen und heranwachsenden Straffälligen wahrgenommen?
Gibt es kulturbedingte Wahrnehmungsunterschiede unter deutschen und nichtdeutschen Probanden? Hierbei werden diejenigen Probanden, die zwar die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber in […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Begriffserläutung
3. Bezugsnahme auf Fachliteratur
3.1. Hans – Wilhelm Schünemann
3.2. Rolf Bieker
3.3. Heinz Cornel
4. Geschichtliche Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung im deutschen Kulturkreis
4.1. Geschichtliche Entwicklung der Strafaussetzung vor 1953
4.2. Geschichtliche Entwicklung der Bewährungshilfe vor 1953
4.3. Entwicklung der Strafaussetzung und Bewährungshilfe nach
5. Sanktionsformen im Jugendgerichtsgesetz
5.1. Formelle Sanktionen
5.1.1. Erziehungsmaßregeln
5.1.2. Zuchtmittel
5.1.3. Jugendstrafe
5.2. Informelle Sanktionen
6. Organisatorischer Rahmen der Bewährungshilfe
6.1. Bewährungshilfe in Bayern
6.2. Bewährungshilfe in Baden-Württemberg
7. Aufgabenbereiche der Bewährungshilfe
7.1. Gesetzliche Grundlage der Aufgaben des Bewährungshelfers
7.1.1. Aufgabenbereiche Hilfe und Betreuung
7.1.2. Aufgabenbereiche Kontrolle und Überwachung
7.1.3. Aufgabenbereich Führungsaufsicht
7.2. Doppelmandat des Bewährungshelfers
7.3. Methodische Grundlagen der Bewährungshilfe
8. Klientel der Bewährungshilfe
8.1. Allgemeine Daten über die Klienten der Bewährungshilfe
8.2. Soziodemografische Merkmale der Klientel der Bewährungshilfe
8.3. Gewaltbereitschaft und Delinquenz der Jugendlichen
8.3.1. Ansätze zur Gewaltentstehung bei jungen Migranten
8.3.2. Gewaltbereitschaft unter deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen
9. Bewährungshilfe aus der Sicht jugendlicher und heranwachsender Probanden
9.1. Ziele der Erhebung
9.2. Erhebungsmethodik
9.3. Auswertung der Befragung
9.3.1. Soziodemografische Merkmale der Befragten
9.3.2. Kultureller Hintergrund der Befragten
9.3.3. Straffälligkeit der Befragten
9.3.4. Einstellung der Befragten zur Bewährungshilfe
10. Fazit
11. Anhang
11.1. Begleitbrief für die Bewährungshelfer
11.2. Begleitbrief für die Probanden
11.3. Fragebogen
12. Literaturverzeichnis
13. Internetquellen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Arbeitsfelder der Straffälligenhilfe im allgemeinen Strafrecht
Abbildung 2: Arbeitsfelder der Straffälligenhilfe im Jugendstrafrecht
Abbildung 3: Sanktionsfsormen bei Jugendlichen in Deutschland
Abbildung 4: Organisation der Bewährungshilfe in Bayern
Abbildung 5: Altersstruktur der Probanden
Abbildung 6: Allgemeine Beschäftigungssituation der Probanden
Abbildung 7: Beschäftigungssituation der Probanden nach Migrationshintergrund
Abbildung 8: Zugehörigkeitsgefühl des Probanden
Abbildung 9: Benutzte Sprache im familiären Setting
Abbildung 10: Alter der Probanden bei der Erstverurteilung
Abbildung 11: Alter der deutschen und nichtdeutschen Probanden bei der jetzigen Verurteilung
Abbildung 12: Vertrauen gegenüber dem Bewährungshelfer
Abbildung 13: Offene Äußerungen der Probanden über persönliche Angelegenheiten
Abbildung 14: Erfahrungen mit dem Bewährungshelfer
Abbildung 15: Hilfe des Bewährungshelfers zum straffreien Leben
Abbildung 16: Sinn der Bewährung für den Probanden
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Standorte der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg
Tabelle 2: Bestehende Unterstellungen unter Bewährungsaufsicht nach dem Grund der Unterstellung – Bestehende Unterstellungen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung
„Das Gesetz kann niemanden zwingen, seinen Nächsten zu lieben, aber es kann es schwieriger für ihn machen, seinem Hass Ausdruck zu geben.“
Dieses Zitat des amerikanischen Juristen Neil Lawson könnte ein Denkanstoß für die innenpolitische Diskussion zur Verschärfung des Jugendgerichtsgesetzes sein. Das Thema erhöhter Gewaltbereitschaft und des daraus resultierenden Gewaltausbruches, vor allem unter nichtdeutschen Jugendlichen, wird in der deutschen Presse immer präsenter und immer lauter wird auch das Verlangen nach schärferen Strafen. Vermehrt stellt man sich die Frage nach den möglichen Gründen des augenfälligen, zum Teil heftigen Verhaltensumschwungs innerhalb dieser Altersgruppe. Woher kommt dieser Hass auf Alles und Jeden? Ist es die Perspektivlosigkeit, soziale, gesellschaftliche und kulturelle Desintegration, sind es materielle Defizite oder einfach nur Willkür der jungen Generation? Wird die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen durch die Verschärfung der Gesetze überhaupt gedämmt?
Das deutsche Rechtssystem tritt die Würde des Menschen nicht mit Füßen. Im Gegenteil: jeder, der in seinem Leben auf die „schiefe Bahn“ geraten ist, bekommt eine zweite Chance, in die „Normalität“ zurückzukehren. Das für manche, nach „law and order“ amerikanischer Ausprägung trachtende, deutsche Politiker (und auch Bürger) zu „lasche“ Strafsystem, ermöglicht vielen erwachsenen und jugendlichen Straffälligen aus den eigenen Fehlern zu lernen, sich zu bessern und sich in die Gesellschaft neu einzugliedern. Die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, die Befähigung zur Führung eines straffreien Lebens und somit die Verhinderung des weiteren Vollzugs einer Freiheitsstrafe, wird dem Straffälligen durch die Bewährungshilfe, die ein wichtiger Teil der Straffälligenhilfe in Deutschland ist, ermöglicht.
Welche Ziele die Bewährungshilfe verfolgt, welche Aufgaben sie erfüllt, welches die Tätigkeitsbereiche eines Bewährungshelfers[1] sind, und noch sehr viel mehr, wird in der vorliegenden Arbeit thematisiert.
Der tatsächliche Fokus der Arbeit liegt aber auf der Klientel der Bewährungshilfe. Ziel dieser Arbeit ist die Klärung der folgenden beiden Fragen:
Wie wird die Bewährungshilfe von jugendlichen und heranwachsenden Straffälligen wahrgenommen?
Gibt es kulturbedingte Wahrnehmungsunterschiede unter deutschen und nichtdeutschen Probanden? Hierbei werden diejenigen Probanden, die zwar die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber in irgendeiner Art und Weise über einen Migrationshintergrund in den letzten beiden Generationen verfügen, zur Gruppe der nichtdeutschen Klientel gezählt.
Zur Klärung dieser Fragen trägt vor allem die durchgeführte Befragung der jugendlichen und heranwachsenden Klientel der Bewährungshilfe in Ravensburg bei. Die Durchführung der Umfrage, die methodische Vorgehensweise und die Auswertung der gewonnenen Daten werden in Kapitel 9 ausführlich beschrieben.
Dieser Einleitung folgend, werden in Kapitel 2 tragende Begriffe dieser Arbeit, wie etwa Bewährungshilfe, Bewährung an sich, Migrationshintergrund oder Resozialisierung straffällig Gewordener definiert und erläutert.
Kapitel 3 befasst sich mit der bisher zum Thema erschienenen, wenn auch nur in Ansätzen vergleichbaren, Fachliteratur.
In Kapitel 4 schließt eine Darstellung der historischen Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung im deutschen Kulturkreis an, die den Zeitraum vom 17. Jh. bis zur Gegenwart abdeckt.
Sanktionsformen des Jugendgerichtsgesetzes, sowohl formeller, wie auch informeller Art, werden in Kapitel 5 thematisiert.
Der organisatorische Rahmen der Bewährungshilfe wird in Kapitel 6 behandelt, wobei sowohl ein kurzer internationaler Anriss, als auch ein etwas ausführlicherer Überblick über das System der Bewährungshilfe in Bayern erfolgt, um schlussendlich das baden-württembergische System detailliert zu analysieren.
In Kapitel 7 und 8 werden dann die Aufgabenbereiche und die Klientel der Bewährungshilfe erläutert.
Abschließend stellt Kapitel 9 den empirischen Teil der Arbeit dar, in dem sämtliche Ergebnisse der Befragung ausgewertet und dargestellt werden.
2. Begriffserläutung
Die Bewährungshilfe ist eine, in das deutsche Strafsystem integrierte Form der Straffälligenhilfe. Ziel der Straffälligenhilfe ist die Wiedereingliederung der Straffälligen in die Gesellschaft. Aufgrund dessen, dass das Thema dieser Ausarbeitung die Bewährungshilfe ist, werden in diesem Kapitel die Zusammenhänge zwischen der Resozialisierung, Straffälligenhilfe und Bewährungshilfe aufgezeigt und die am häufigsten verwendeten Begriffe, wie z. B. Bewährung, Bewährungshilfe, die Klientel und Mitarbeiter der Bewährungshilfe, Migration etc. erläutert.
Der Oberbegriff dieser Arbeit ist die Resozialisierung einer straffällig gewordenen Person. Dabei wird der Begriff Resozialisierung als Synonym für ein Wiedereingliederungsprogramm verwendet, dessen Ziel die Reintegration in die Gesellschaft ist. Damit soll der Straffällige nach den in einer Gesellschaft geltenden Normen und Wertvorstellungen leben.[2] Die Resozialisierung ist eine „gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalität“[3], die durch verschiedene Resozialisierungsangebote gesichert werden soll. Die Straffälligenhilfe ist eine Bezeichnung für alle privaten und öffentlichen, sich an der Wiedereingliederung der Straffälligen in die „Normalität“ sich orientierende Hilfeformen.[4] Um welche Arbeitsfelder der Straffälligenhilfe für Erwachsene und Jugendliche es sich handelt, wird in den folgenden Abbildungen veranschaulicht:
Abbildung 1: Arbeitsfelder der Straffälligenhilfe im allgemeinen Strafrecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: Cornel, H.; Maelicke, B.: Überblick über Rechtsgebiete der Resozialisierung. In: H. Cornel; B. Maelicke; B.R. Sonnen (Hrsg.) (1995): Handbuch der Resozialisierung. 57.
Abbildung 2: Arbeitsfelder der Straffälligenhilfe im Jugendstrafrecht
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: Cornel, H.; Maelicke, B.: Überblick über Rechtsgebiete der Resozialisierung. In: H. Cornel; B. Maelicke; B.R. Sonnen (Hrsg.) (1995): Handbuch der Resozialisierung. 56.
Wie in beiden Darstellungen sichtbar, ist die Bewährungshilfe ein fester Bestandteil der Straffälligenhilfe und damit der Resozialisierung. Im Fachlexikon der sozialen Arbeit ist die Bewährungshilfe als „…Institution, welche bei der Aussetzung einer Freiheitsstrafe zur Bewährung sowie bei der Aussetzung eines Strafrestes für die Dauer der Bewährungszeit tätig wird...“ definiert. Eine der Hauptaufgaben und -ziele der Bewährungshilfe ist es, Straffällige zu resozialisieren, sie dazu befähigen, ein straffreies Leben zu führen und somit den weiteren Vollzug der Freiheitsstrafe zu verhindern.[5]
Die Klienten der Bewährungshilfe werden, nicht wie im Justizbereich üblich, Straffällige oder Entlassene, sondern Probanden[6] genannt.
Die Vollziehung der Freiheitsstrafe oder des Restes einer Freiheitsstrafe kann im deutschen Strafsystem zur Bewährung ausgesetzt werden. Wenn der erwachsene Straffällige zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als einem Jahr verurteilt wurde, kann diese zur Bewährung ausgesetzt werden. In diesem Fall wird eine positive Sozialprognose (Persönlichkeit, Lebensverhältnisse, Umfeld des Verurteilten, etc.) berücksichtigt. Zur Bewährung kann auch eine Vollstreckung der Freiheitsstrafe, die zwei Jahre nicht übersteigt, ausgesetzt werden. Dies geschieht, wenn besondere Umstände zugunsten des Verurteilten vorliegen (§ 56 StGB).[7] Die Bewährungszeit beträgt dann zwei bis fünf Jahre. In dieser Zeit muss sich der Verurteilte „bewähren“, was so viel heißt, dass er beweisen muss, dass er straffrei leben kann.
Zu den Jugendstrafe–Sanktionen gehören Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel, Jugendstrafe, etc.. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) kann die Vollstreckung einer Jugendstrafe von nicht mehr als einem Jahr mit einer günstigen Prognose zur Bewährung ausgesetzt werden. Eine zwei Jahre nicht übersteigende Jugendstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn die Vollziehung der Strafe eine negative Auswirkung auf die Entwicklung des Jugendlichen oder Heranwachsenden haben könnte (§ 22 JGG). Die Bewährungszeit beträgt bei beiden Varianten nicht weniger als zwei und nicht mehr als drei Jahre.[8]
Wer Jugendlicher und wer Heranwachsender ist, wird im Strafgesetz genau definiert. Nach § 1 JGG ist derjenige jugendlich, der zur Tatzeit noch nicht achtzehn, aber bereits vierzehn Jahre alt ist. Im Alter von achtzehn bis einundzwanzig Jahren werden junge Menschen als heranwachsend bezeichnet. Diese Altersgrenze ist an bestimmte Rechtsfolgen, entsprechend der körperlichen und geistigen Entwicklung des jungen Menschen, gebunden. So versucht das deutsche Rechtssystem junge Menschen mit zunehmendem Alter an das Erwachsenenstrafrecht „anzugleichen“.[9]
In einem Bewährungsbeschluss des Gerichts wird die Dauer der Bewährungszeit bestimmt, werden Bewährungsauflagen oder Weisungen erteilt und festgelegt, ob der Proband unter die Leitung und Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt wird. Zu erwähnen ist, dass ein Jugendlicher nach § 24 Abs.1 S.1 JGG immer unter die Aufsicht eines Bewährungshelfers gestellt wird.[10]
Der Bewährungshelfer ist ein „Vermittler“ zwischen Justiz und Proband[11]. I. d. R. ist ein Bewährungshelfer ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge mit entsprechender abgeschlossener Ausbildung[12]. Seine Aufgaben bestehen darin, „dem Probanden helfend und betreuend zur Seite zu stehen“ (§ 56d Abs.3 Satz 1 StGB, § 24, Abs.3, Satz 1, JGG). Im Einvernehmen mit dem Richter achtet der Bewährungshelfer darauf, dass Weisungen, Auflagen oder Zusagen vom Probanden eingehalten und erfüllt werden. Eine weitere Aufgabe im Jugendstrafrecht ist die Förderung der Erziehung des Jugendlichen und die Unterstützung Erziehungsberechtigter. Über die Lebensführung des Probanden wird das Gericht in regelmäßigen Abständen unterrichtet.[13]
Gegenstand dieser Arbeit ist die Feststellung möglicher unterschiedlicher Einstellungen deutscher Probanden zur Bewährungshilfe im Gegensatz zu jenen mit einem Migrationshintergrund. Daher ist es notwendig, dass die Begriffe Migration, Migranten, o. Ä. näher erläutert werden.
Der Begriff Migration[14], kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bezeichnet einen über eine Staatsgrenze übergreifenden Wanderungsprozess eines Einzelnen oder einer Gruppe[15]. Es wird ein Zustand bezeichnet, in dem sich Personen (Migranten) befinden, die für längere und unbestimmte Zeit aus unterschiedlichen Gründen ihren Herkunftsort verlassen haben. Dabei ist der Zielort ein „fremdes“ Land oder Gebiet[16]. Zu den Migranten werden folgende Personengruppen gezählt: Ausländer, Eingebürgerte, Aussiedler oder Asylbewerber. Mit der Migration hängt der Begriff „Migrationshintergrund“ eng zusammen. Einen Migrationshintergrund haben nicht nur in einem Land lebende Immigranten[17], sondern auch Nachkommen der zweiten oder dritten Generation. Einen Migrationshintergrund haben somit Menschen, die seit 1949 oder danach auf dem heutigen Gebiet der Bundesrepublik leben, alle Ausländer die hier geboren wurden oder diejenigen, von denen mindestens ein Elternteil zugewandert ist oder als Ausländer in Deutschland geboren wurde.[18] Einen Migrationshintergrund haben auch Personen, die nicht eingebürgert wurden oder keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen[19].
In der Wahrnehmung der einheimischen Bevölkerung ist die ethnische Herkunft ein Faktor, der die Delinquenz[20] fördert. Für Kriminalität[21] sind jedoch soziodemographische Merkmale, wie z. B. Geschlecht, Bildung, Milieuzugehörigkeit, etc. und nicht etwa die Staatsangehörigkeit ausschlaggebend.[22] Ein wichtiges Merkmal der Kriminalitätsbelastung ist das Alter. Gesetzwidriges Verhalten einer strafmündigen Person, die dem Jugendstrafrecht untersteht (Jugendlicher oder Heranwachsender) wird als „Jugendkriminalität“ gekennzeichnet. Da die Sozialisation in diesem Alter noch nicht ganz abgeschlossen ist und abweichendes Verhalten ein Resultat der persönlichen Entwicklung sein kann, wurde das Gesetz den Besonderheiten dieser Gruppe angepasst.[23] Ob es herkunftsbedingte Unterschiede in der Jugendkriminalität gibt, wird in Kapitel 8.3.2.: „Gewaltbereitschaft bei deutschen und nichtdeutschen Jugendlichen“ erklärt.
3.Bezugsnahme auf Fachliteratur
Die Bewährungshilfe war bereits mehrfach Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Mit den Sichtweisen und Erfahrungen jugendlicher und heranwachsender Probanden, hinsichtlich der Bewährungshilfe, befassten sich aber bis heute nur wenige Autoren. Dabei wurde in keiner von diesen Arbeiten der kulturelle Hintergrund der Klientel als möglicher Untersuchungsfaktor berücksichtigt.
Gegenstand dieses Kapitels ist es, einen Überblick über die veröffentlichten Untersuchungen und deren Erkenntnisse zu geben. Zwar entsprechen die Zielgruppen der Untersuchungen nicht immer der Zielgruppe dieser Arbeit, aber die gewonnenen Erkenntnisse sind von teilweise großer Bedeutung. Die Analysen wurden je nach Erscheinungsjahr aufgelistet, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, die tendenziellen Veränderungen in der Wahrnehmung von Probanden, bezüglich der Bewährungshilfe, beobachten zu können:
- Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden – Eine Untersuchung über die verlaufs- und erfolgsrelevanten Faktoren des Vorlebens und der Bewährungszeit, durchgeführt an 180 zu einer Jugendstrafe mit Bewährung verurteilten Probanden, verfasst von Hans – Wilhelm Schünemann,
- Bewährungshilfe aus der Adressatenperspektive – Sichtweisen, Erfahrungen und Reaktionen der Probanden, untersucht von Rolf Bieker,
- Probanden der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende in Berlin – ihre Lebenslagen und Erwartungen an das Hilfesystem, von Heinz Cornel.
3.1. Hans – Wilhelm Schünemann
Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden Diese Arbeit wurde im Jahr 1971 in Göttingen geschrieben.
Ziel der Untersuchung war die Forschung nach verlaufs- und erfolgsrelevanten Faktoren, die den Erfolg oder Misserfolg der Arbeit des Bewährungshelfers bedingen. Die Befragung wurde an 180 zu einer Jugendstrafe mit Bewährung verurteilten Probanden durchgeführt und besteht aus zwei Bereichen:
1) Nachwirkung des Vorlebens der Probanden,
2) Die Einwirkung des Bewährungshelfers während der Bewährungszeit.
Wie in der Analyse des ersten Teils geschildert wird, gab es bei fast allen jugendlichen und heranwachsenden Probanden mehr oder weniger ausgeprägte störungsrelevante Faktoren in familiären oder sozialen Bereichen.[24] Zu diesen vorbelastenden Faktoren gehört die Kriminalität eines Elternteils, die „Trunksucht“ eines Elternteils, eine nicht vollständige Familienkonstellation (Trennung oder Scheidung der Eltern), die Verwaisung des Probanden vor dem 12. Lebensjahr, eine Heimerziehung von mehr als 6 Monaten, eine schlechte oder keine Schulbildung und Ausbildung, o. Ä.. Diese untersuchten Faktoren wurden in vier Beziehungsbereiche unterteilt, um festzustellen, ob es Zusammenhänge zwischen den Faktoren und dem Bewährungsverlauf gibt:
1. Elternhaus und Erziehung – hier ist der Autor zur Erkenntnis gelangt, dass bei verwaisten Kindern ein besonders guter Verlauf der Bewährung zu erkennen ist. Ein positiver Verlauf ist auch bei den Probanden festzustellen, die nur bei ihren Müttern aufwuchsen. Bei Probanden mit mehr als drei Geschwistern ist der Verlauf der Bewährung eher negativ. Dies bezieht sich auch auf den Erfolg der Bewährung. Diese Untersuchung ließ überdies den Schluss zu, dass Probanden, die mehr als sechs Monate in einem Heim verbrachten, eher Schwierigkeiten im Verlauf der Bewährung hatten und der Erfolg dieser auf niedrigem Niveau begrenzt war.
2. Schule und Beruf – Die Untersuchung zeigte, dass ein weniger guter Schulabschluss mit einem schlechten Verlauf und Erfolg der Bewährung korreliert. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch im Bereich Berufsausbildung wider. Demnach ist der Verlauf und Erfolg bei denjenigen Probanden, die eine Lehre nicht begonnen haben, schlecht. Der Verlauf und Erfolg der Bewährung steigt mit dem Erfolg im beruflichen Bereich an. Somit wirkt sich die Eingliederung in einen Betrieb positiv auf die Bewährung aus.
3. Persönlichkeit – Überdurchschnittlich begabte Probanden haben sich nur knapp durchschnittlich bewährt. Schwach begabte Probanden hatten Probleme im Verlauf und Erfolg der Bewährung.
4. Kriminelle Vorbelastung – Persönliche kriminelle Vorbelastungen des Probanden haben Auswirkungen auf den Erfolg und Verlauf der Bewährung. Demnach ist der Verlauf bei Probanden, die im „späteren“ Alter eine erste Straftat begingen, überdurchschnittlich gut.[25]
In erstem Teil der Arbeit wurde deutlich, dass das Vorleben, die Persönlichkeit und die kriminelle Vorbelastung eine Auswirkung auf den Verlauf und Erfolg der Bewährung haben. Im zweiten Teil der Arbeit wollte der Autor herausfinden, wie die Einwirkung der Arbeit und der Persönlichkeit des Bewährungshelfers auf den Verlauf und Erfolg der Bewährung einzuschätzen ist. Um dies festzustellen, wurden die persönlichen Einstellungen der Probanden in den Mittelpunkt der Befragung gerückt.
Der Verfasser war der Meinung, dass für einen erfolgreichen Verlauf der Bewährung günstigstenfalls bis zu 50 Probanden auf einen Bewährungshelfer kommen sollten. In der Praxis hat ein Bewährungshelfer jedoch deutlich mehr Probanden zu betreuen, was an den Vorgaben der übergeordneten Instanzen festzumachen ist[26].
Zu berücksichtigen ist auch die Tatsache, dass bei relativ geringem Altersunterschied zwischen Proband und Bewährungshelfer ein überdurchschnittlich guter Verlauf des Bewährungsprozesses zu beobachten war. Daher wäre von Bedeutung festzustellen, ob sich Bewährungshelfer etwa auf bestimmte Altersgruppen spezialisieren sollten.
Wie schon erwähnt, wurden in dieser Untersuchung die Einstellungen der Probanden zur Bewährungshilfe und zum Bewährungshelfer berücksichtigt. Die Einstellung des Probanden zur Bewährungshilfe kann vom persönlichen Verhältnis zum Bewährungshelfer bestimmt werden. 24% der Befragten hatten demnach eine negative Einstellung zur Bewährungshilfe mitgebracht.
Wie die Einstellung zur Bewährungshilfe ist, kann als Verlaufs- und Erfolgsindiz gedeutet werden. Wenn die Einstellung positiv ist, steigt die Wahrscheinlichkeit eines positiven Verlaufs und Erfolgs der Bewährung. Mit der Einstellung zur Bewährungshilfe steht die Einstellung zum Bewährungshelfer in engem Zusammenhang. Wenn die Einstellung zur Bewährungshilfe eher negativ ist, überträgt sich diese auch auf den Bewährungshelfer. Ob sich diese im Verlauf der Bewährungszeit ändert, hängt von der Persönlichkeit und dem Einfühlungsvermögen des Betreuers ab. Eine Reserviertheit und etwaige Ablehnung gegenüber dem Bewährungshelfer schlägt sich auch in der Nachbewährungszeit nieder. Wenn die Beziehung zwischen Bewährungshelfer und Proband positiv ist, ist ein positiver Verlauf und somit ein Erfolg vorprogrammiert.
Die Einstellung des Bewährungshelfers hingegen zum Probanden wirkt sich nicht auf den Verlauf der Bewährung aus. Diese Annahme des Autors stimmt nach den Aussagen mehrerer Bewährungshelfer mit der Realität jedoch nicht überein[27]. Ausschlaggebend für den weiteren Verlauf der Bewährung ist das erste Gespräch. Demnach wirkt sich eine lockere Atmosphäre besser auf den zukünftigen Verlauf aus, als eine angespannte. Diese Tendenz zeigte sich auch beim Erfolg der Bewährungshilfe. Die Intensität der Betreuung steigt mit zunehmend schlechtem Verlauf der Bewährung. Andererseits schwächt sich die Intensität mit gutem Verlauf der Bewährung ab. Ein weiteres Mal bestätigt sich diese Tendenz bei der Mitarbeitsintensität. Wenn der Proband regelmäßig die Sprechstunden besucht, steigt auch die Chance der positiven Beendigung des Bewährungsprozesses.[28]
Ein Jahr später wurde eine ähnliche Untersuchung, „Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden“, von Hans-Günter Vogt veröffentlicht. Ziel seiner Abhandlung: …„anhand des Vorlebens und des späteren Verhaltens nach der Strafaussetzung zur Bewährung von 200 männlichen Probanden sollen die Faktoren herausgestellt werden, die für den Widderruf der Strafaussetzung oder einen späteren Rückfall höchstwahrscheinlich ausschlaggebend sind…“[29]. Bei dieser Forschungsarbeit stand im Vordergrund zu ergründen, ob es Faktoren gibt, die den Rückfall eines Probanden beschleunigen oder aufhalten können. Gäbe es solche Faktoren, wäre es von vornherein möglich, ungeeignete Probanden von der Strafaussetzung zur Bewährung auszuschließen. Dies sollte durch die Beobachtung des Verlaufs der Bewährungszeit festgestellt werden. Es wurden das soziale Verhalten des Probanden und die Arbeit des Bewährungshelfers beobachtet. Mit der Beobachtung der Arbeit des Bewährungshelfers sollte festgestellt werden, inwieweit diese Arbeit den Verlauf der Bewährung beeinflusst. Durch das Abfragen der Ansichten der Probanden zur Bewährungshilfe sollte dies festgehalten werden.
Wie in der Arbeit von Schünemann wurde im ersten Teil der Untersuchung nach Faktoren gesucht, die den Verlauf der Bewährung negativ beeinflussen können und das Rückfallsrisiko steigen lassen. Zusammenfassend ist der Autor zur gleichen Erkenntnis gekommen, nämlich dass sich vorbelastende Faktoren, wie z. B. die Kriminalität oder „Trunksucht“ eines Elternteils, eine nicht vollständige Familie, die Verwaisung des Probanden, eine etwaige Heimerziehung, eine schlechte oder keine Schulbildung und Ausbildung, etc., negativ auf den Bewährungsverlauf auswirken können.[30]
Im nächsten Kapitel der Analyse befasste sich der Autor mit den Rückfallfaktoren. Die Untersuchung bestätigte, „dass Probanden, bei denen in der Aszendenz[31] erhebliche Kriminalität zu verzeichnen ist, besonders rückfallgefährdet sind“[32]. Weiterhin wurde festgestellt, dass mit steigender Intelligenz die Rückfallgefährdung abnimmt. Häufiger rückfällig sind auch Probanden mit „charakterologischen Eigenarten“, wie z. B. Labilität, Sensibilität oder Willensschwäche.
Wie bereits Schünemann erkennt auch Vogt Waisenkinder als weniger rückfällig gegenüber Scheidungskindern oder Kindern, die in Heimen erzogen wurden[33]. Die wenigsten Rückfälle wurden bei Probanden, die bei ihrer allein erziehenden Mutter aufwuchsen, verzeichnet[34]. Erfolge im schulischen Bereich und im Bereich der beruflichen Ausbildung wurden auch als positive Faktoren gedeutet. Auch als Rückfallfaktor bedeutend ist das Alter des Probanden. Demnach wurden die Probanden, die vor dem vierzehnten Lebensjahr die erste Straftat begingen, fast dreimal so häufig rückfällig wie diejenigen, die zum angesprochenen Zeitpunkt schon achtzehn waren[35].
Ziel des zweiten Schwerpunktes war es, die Ansichten und Eindrücke des Probanden über die Bewährungszeit und den Bewährungshelfer zu erfahren.
In dieser Untersuchung, wie auch in der von Schünemann, war die Mehrheitsmeinung der Probanden über deren Bewährungshelfer eher positiv.
Die meisten Probanden hatten im Vorfeld nur vage Vorstellungen darüber, was Bewährung bedeutet und wer der Bewährungshelfer ist. Über die Hälfte der Probanden fanden während der Bewährungszeit den Bewährungshelfer sympathisch. Nach Meinung der Befragten wäre das ideale Alter der Bewährungshelfer zwischen 25 – 30 Jahren. Zwei Drittel der Probanden waren der Meinung, dass die Bewährungshelfer an der Seite des Richters stünden, weswegen sie dem Bewährungshelfer nicht trauten. Trotzt dieses geringen Vertrauens würden sich die Meisten, im Bedarfsfall, wieder an den gleichen Bewährungshelfer wenden[36].
Zusammenfassend wurde in beiden Arbeiten festgestellt, dass es Faktoren gibt, die den Verlauf und Erfolg der Bewährung sowie das Rückfallrisiko minimalisieren oder fördern können. Ausschlaggebend ist aber die Tatsache, dass die „Arbeitsbeziehung“ zwischen den Probanden und Bewährungshelfern eher positiv ist.
Zu den Aufgaben des Bewährungshelfers gehört es nicht nur dem Probanden zu helfen, sondern auch seine Lebensführung zu kontrollieren und dem Gericht darüber Bericht zu erstatten. Aus diesem Grund können viele Probanden dem Betreuer nicht vertrauen. Ob sie trotzdem diese Barriere überwinden können und gut zusammenarbeiten, hängt von der persönlichen Einstellung des Probanden, dem Engagement des Bewährungshelfers und dem gegenseitig entgegengebrachten Respekt ab.
3.2. Rolf Bieker
Bewährungshilfe aus der Adressatenperspektive - Sichtweisen, Erfahrungen und Reaktionen der Probanden
Im Mittelpunkt dieser im Jahr 1989 geschriebenen Arbeit stehen drei Kernfragen:
- Wie werden der Handlungsauftrag der Bewährungshilfe und die Rolle des Bewährungshelfers vom Probanden wahrgenommen?
- Wie sind die Erfahrungen der Probanden bezüglich „Hilfe und Betreuung“ und „Überwachung der Lebensführung“?
- Wie ist die Einstellung des Probanden zur Kooperation mit dem Bewährungshelfer?[37]
Berücksichtigt wurden in der Befragung programm- und praxisbezogene Sichtweisen und kooperationsbezogene Reaktionen der Probanden.
Programmbezogene Sichtweisen des Probanden – hierbei geht es um Sichtweisen der Probanden hinsichtlich des Zwecks der Bewährungsunterstellung und der Rolle des Bewährungshelfers. Die Überwachung, Kontrolle und Beobachtung der Lebensführung werden von den Probanden negativ bewertet. Nach Meinung der Probanden hat der Bewährungshelfer die Macht und damit die Möglichkeit, auf den Probanden „Druck auszuüben“. Diese Meinung wird bestärkt durch die Berichtserstattung des Bewährungshelfers gegenüber dem Gericht. Wenn der Proband sich nicht nach den Vorgaben des Bewährungshelfers richtet, könnte die Bewährung widerrufen werden. Viele Probanden sehen den Bewährungshelfer auch als „Erzieher und Helfer“, dessen Aufgabe darin besteht, den Probanden „umzuerziehen“.
Der Adressat soll dazu gebracht werden, nach Normvorgaben der Gesellschaft zu leben, was so viel heißt, dass der Bewährungshelfer ihm hilft, ein straffreies Leben zu führen.[38]
Praxisbezogene Sichtweisen – hier wurde die persönliche Einschätzung des Probanden im Hinblick auf das berufliche Handeln des Bewährungshelfers abgefragt. Die Mehrheit der Befragten schätzt demnach die Hilfsbereitschaft und das Hilfsengagement der Bewährungshelfer positiv ein. Für die Erfahrung des Adressaten ist der Verzicht des Bewährungshelfers auf kontrollorientierte Handlungspraktiken, wie z. B. Ausfragen des Probanden, Erteilung von Vorschriften oder Androhung eines Widerrufes, bedeutsam. Diesbezüglich sind die Erfahrungen der Probanden sehr positiv. 95 % der Befragten hatten keinerlei Erfahrungen mit kontrollorientierten Handlungen des Bewährungshelfers. Diese positive Tendenz zeigt sich auch bei der Frage nach der Nützlichkeit des Bewährungshelfers. Fast 83 % der Befragten waren der Meinung, dass sich die Tätigkeit des Bewährungshelfers und die Unterstellung unter diesen sich eher günstig auf die Lebensführung des Probanden ausgewirkt haben. Die Bewährungshelfer standen den Probanden vor allem bei Problemlösungen mit dem Gericht oder der Polizei, mit Behörden, Partnern oder etwa der Wohnungssuche oder bei beruflichen Unregelmäßigkeiten helfend zur Seite. Diese positive Bewertung wäre nicht ohne Vertrauen zwischen Bewährungshelfer und Proband möglich. Fast 90 % der befragten Probanden geben an, dass der Bewährungshelfer Zeit für sie hatte, wenn sie ihn brauchten.
Eine der Aufgaben des Bewährungshelfers ist die Mitteilungspflicht, also die Berichterstattung an das zuständige Gericht. Diese Berichtserstattung bezieht sich auf Lebensführung, Erfüllung und Einhaltung der Auflagen und Weisungen sowie auf das Kontaktverhalten des Probanden. In den meisten Fällen ist die Häufigkeit der Kontakte vom Gericht nicht geregelt. Deswegen hat ein Bewährungshelfer einen relativ großen Spielraum zur individuellen Regelung. Die Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass Bewährungshelfer die Meldepflicht „locker sehen“. Was die regelmäßige Berichterstattung des Bewährungshelfers an das zuständige Gericht angeht, sieht nur ein Teil der Befragten dies als eindeutig problematisch.
Die Mehrheit der Probanden ist der Meinung, dass die Weiterleitung der Informationen vom Bewährungshelfer an das Gericht notwendig ist. Da sich viele Bewährungshelfer um eine auf Vertrauen basierende Beziehung bemühen, legen sie ihre Berichte gegenüber den Probanden offen.[39]
Kooperationsorientierte Reaktion des Probanden – dabei geht es um die Feststellung des Kooperationsinteresses und Kooperationsverhaltens des Probanden gegenüber dem Bewährungshelfer. Das Kooperationsinteresse des Probanden kann sich im Verlauf der Bewährung aufgrund des Verhaltens des Sozialarbeiters ändern. Anhand der Untersuchung kann das Kooperationsinteresse der Probanden in drei Grundpositionen unterteilt werden:
- Die Zusammenarbeit mit dem Bewährungshelfer kann nützlich und vorteilhaft bei einer Problemlösung sein.
- Eine Zusammenarbeit ist für den Probanden in Ausnahmefällen denkbar.
- Der Proband interessiert sich nur bedingt für eine Kooperation mit dem Bewährungshelfer.
In letzteren Fällen sind die Gründe der Ablehnung unterschiedlich: Das Ersuchen um Hilfe ist mit einer Bedrohung des Selbstbildes („Ich komme selbst zu recht“) verbunden. Dem Bewährungshelfer zu vertrauen, ist für den Probanden zu riskant, da der Bewährungshelfer dem Gericht alles mitteilen kann. Der Proband ist der Meinung, dass der Bewährungshelfer ihm nicht helfen kann.
3.3. Heinz Cornel
Probanden der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende in Berlin – ihre Lebenslage und Erwartungen an das Hilfesystem.
Diese Arbeit entstand im Jahr 2000 als Eigeninitiative der Mitarbeiter der Bewährungshilfe in Berlin. Deren Anliegen war es, mehr über die Lebenslagen der jugendlichen und heranwachsenden Probanden und deren Erwartungen an die Bewährungshilfe zu erfahren. Der Anlass zu dieser Untersuchung war die Tatsache, dass den Bewährungshelfern nicht ausreichend Informationen, bezüglich der oben genannten Anliegen zur Verfügung standen. Diese Analyse wurde mit der Unterstützung von 1 740 jugendlichen und heranwachsenden Probanden durchgeführt.
In dieser Zusammenfassung der Untersuchung möchte ich mich auf die Besonderheiten der Analyse beziehen. Demnach hatten 34,7 % der Probanden, die teilnahmen, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Von 1 705 Befragten hatte über die Hälfte keinen Schulabschluss. Mit dieser Erkenntnis steht auch die Höhe der Arbeitslosigkeit im Einklang. Demnach sind 40,9 % der Befragten ohne Arbeit und bekommen Hilfe zum Lebensunterhalt durch das Sozial- oder Jugendamt.[40] Im Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen, wurde hier nach Gewalt in der Familie gefragt. Zwar gab die Mehrheit an, nie geschlagen zu werden, trotzdem gaben andererseits 41 % an, Gewalt in der Familie erleben zu müssen. In vielen dieser Familien wurde Gewalt gegen andere Familienmitglieder gerichtet, aber nicht gegen den Probanden selbst.[41]
Wie in den Befragungen von Schünemann und Bieker, unterstützten die Bewährungshelfer die Probanden oft bei Problemlösungen. Verständnis seitens des Bewährungshelfers wurde von den meisten Probanden anerkannt. Wie aus der Befragung ersichtlich wird, gibt es einen Zusammenhang zwischen einer positiven Einstellung des Probanden und seiner Umgebung.[42]
Leider wurden in dieser Analyse der Befragung keine genauen Angaben zum Vertrauen gegenüber den Bewährungshelfern nachgefragt, um feststellen zu können, ob es Widersprüche, wie in den vorigen Arbeiten gibt.
4. Geschichtliche Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung im deutschen Kulturkreis
Die historische Entwicklung der Bewährungshilfe und der Straf- und Strafrestaussetzung hängt eng mit der Entwicklung der Freiheitsstrafe zusammen. Um die Entstehung und weitere Entfaltung der Strafaussetzung zur Bewährung zu beobachten ist es notwendig, die Entwicklung der Freiheitsstrafe zu berücksichtigen. Daher bezieht sich der Inhalt dieses Kapitels auf die Entstehung und Entwicklung der Strafaussetzung als Sanktionsform und die Bewährungshilfe als Art der Straffälligenhilfe.
4.1. Geschichtliche Entwicklung der Strafaussetzung vor 1953
In der Zeit des Altertums und Mittelalters bestand die Aufgabe der Gefängnisse v. a. darin, die Gefangenen abzuurteilen, sie in kalten und dunklen Verließen zu verwahren oder sie hinzurichten. Die Leibes- und Lebensstrafen wurden im 17. und 18. Jahrhundert durch die Freiheitsstrafe ersetzt. Die ersten Zuchthäuser mit Freiheitsstrafe auf dem Gebiet Deutschlands wurden in Brandenburg-Preußen gegen Ende des 17. Jahrhundert eingerichtet. Hauptphilosophie dieser Zeit war die „Resozialisierung“ durch Arbeit. Die Häuser fungierten als Arbeitsbetriebe mit billigen Arbeitskräften. Auf engstem Raum lebten und arbeiteten Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer, Geisteskranke, Bettler, Prostituierte, Diebe und Mörder. Diese Verhältnisse waren vor allem für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen verheerend.[43]
Die Aufklärung brachte endgültig Veränderungen im Sanktionssystem der Justiz mit sich. Die Freiheitsstrafe wurde in Jahr 1794 definitiv als Sanktion anerkannt und angewandt. In dieser Zeit kam es auch zur Veränderung der Gefangenensituation. Vor allem wurden Kinder und Jugendliche nach und nach von erwachsenen Gefangenen separiert, um den negativen Einfluss der straffälligen Erwachsenen zu verringern.[44]
Der Staat leistete in jenem Jahrhundert keine Unterstützung bei der Entlassung von Strafgefangenen. Die erste Angabe hierzu stammt von 1783. Mit der „Zirkularverordnung der Glogauischen Kriegs- und Domänenkammer“ wurde angeordnet, dass die Grundherrschaft über die Entlassung des Sträflings benachrichtigt wird und ihm daraufhin wenigstens für ein Jahr Arbeit zur Verfügung stellen sollte[45]. Diese Anordnung wurde von der Grundherrschaft in vielen Fällen ignoriert.
Im Jahr 1797 wurden Instruktionen über den Umgang mit den zu Festungs- oder Zuchthausarbeit Verurteilten formuliert. Somit war es die Aufgabe der Gemeinden und anderer Körperschaften dafür zu sorgen, dass der Entlassene eine Beschäftigung findet. Wenn dieser aber keine Arbeit gefunden haben sollte, musste umgehend das Gericht benachrichtigt werden und der Richter selbst musste für ihn sorgen. Durch diese Fürsorgeinstruktionen wurde die Strafentlassenenhilfe, also die Unterkunfts- und Arbeitsbeschaffung, zu einer Staatsaufgabe.[46]
Für die historische Entwicklung der Strafaussetzung war das „Reskript[47] “ aus dem Jahr 1798 bedeutsam. Es wurde in den damaligen 42 Zuchthäusern und Festungen Preußens überprüft, ob sich in diesen Insassen befinden, die aufgrund guten Benehmens begnadigt werden konnten. Falls die Begnadigten eine neue Straftat begingen, mussten sie dann die ganze Strafe verbüßen. Diejenigen Entlassenen, die keine Arbeit und Unterkunft in der Freiheit fanden, konnten in den Häusern weiterleben. Es musste ihnen jedoch die Möglichkeit gegeben werden, in die Stadt ausgehen zu können.
Die Fürsorgeinstruktion und das Reskript sind die wichtigsten staatlichen Veranlassungen, die den Umgang mit Entlassenen zu jener Zeit ausführlich formulieren. Die Aufgabe des Staats war es, den Entlassenen Arbeit und Unterkunft zu gewähren, mit dem Ziel, dass sie keine weiteren Straftaten begingen. Dies war der Anfang der Wiedereingliederung straffällig Gewordener in die Gesellschaft.[48]
In der weiteren geschichtlichen Entwicklung sind drei unterschiedliche Formen der Strafaussetzung zur Bewährung zu berücksichtigen:
- Form der nachträglichen Aussetzung,
- Form der anfänglichen Strafaussetzung,
- Form der „Polizeiaufsicht“ oder der Aufsicht durch „Schutzvereine“ (jetzige Führungsaufsicht).[49]
Die Strafaussetzung zur Bewährung als nachträgliche Aussetzung wurde bereits im Jahr 1862 als eine Gnadenmaßnahme angewendet. Dabei ging es um die Unterbrechung des Strafvollzuges und eine darauf folgende Begnadigung des Häftlings unter der Bedingung, dass er sich in der Freiheit „bewährt“ hat. Nachdem das Strafgesetzbuch des Norddeutschen Bundes als Strafgesetzbuch für das gesamte Deutsche Reich eingeführt wurde (1870), wurde die nachträgliche Strafaussetzung als selbständige und vollzugsunabhängige Maßnahme anerkannt und in „vorläufige Entlassung“ umbenannt.[50]
Eine frühere Form der anfänglichen Strafaussetzung zur Bewährung wurde bereits im Mittelalter als erzieherische Maßnahme bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. 1895 wurde in Preußen die anfängliche Strafaussetzung als eine „bedingte Begnadigung“ erlassen. Diese Maßnahme bezog sich vor allem auf Jugendliche, die eine Tat vor dem 18. Lebensjahr begangen hatten und zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt wurden. Die Freiheitsstrafe konnte gnadenhalber vom Justizminister zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Form der anfänglichen Strafaussetzung wurde bis zum Jahr 1935 ständig weiterentwickelt. So wurden bspw. 1912 die Oberstaatsanwälte bzw. Generalstaatsanwälte zum Aussetzen der Strafe zur Bewährung ermächtigt. Mit diesem Erlass wurde der Personenkreis auf die Erwachsenen erweitert und die Freiheitsstrafe bei Jugendlichen auf ein Jahr erhöht. Die Freiheitsstrafe konnte ab dem Jahr 1920 durch die Gerichte zur Bewährung ausgesetzt werden.[51]
In der im Jahr 1923 geregelten Strafaussetzung zur Bewährung wurde erstmals die Bewährungshilfe erwähnt. So sollten diejenigen, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, unter Polizeiaufsicht stehen. Die Schutzaufsicht konnte von der Polizei selbst oder von Schutzaufsichtsvereinen durchgeführt werden.[52]
Darüber hinaus wurde in dieser Gesetzesänderung die Grenze der Strafmündigkeit bei Kindern und Jugendlichen von 12 auf 14 Jahre erhöht. Diese Regelung wurde durch die nationalsozialistische Regierung wieder revidiert.[53]
Das Begnadigungsrecht wurde im Jahr 1938 durch die „Reichsgnadenordnung“ neu geregelt, was zu einer Rückentwicklung der Strafaussetzung führte. Die Gnadenentscheidungen ordnete die Staatsanwaltschaft an. Die anfängliche Strafaussetzung wurde 1943 annulliert und anstelle der nachträglichen Aussetzung wurden die Strafaussetzung und die Entlassung auf Probe eingeführt. So konnte die Strafe, nachdem sie zu einem Drittel verbüßt wurde, zur Probe (2 bis 5 Jahre) ausgesetzt werden.[54]
Zusammenfassend können folgende Daten bei der Entwicklung angeführt werden:
1895 – mit diesem Erlass konnte eine sechs Monate nicht überschreitende Freiheitsstrafe bei Häftlingen unter 18 Jahren ausgesetzt werden. Dabei konnte die Strafaussetzung beginnen, bevor eine Vollstreckung überhaupt begann (anfängliche Strafaussetzung).
1912 – die Oberstaatsanwälte bzw. Generalstaatsanwälte konnten eine Strafe zur Bewährung aussetzen. Die Aussetzung kam nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Erwachsenen in Frage. Die sechsmonatige Freiheitsstrafe wurde auf ein Jahr erhöht.
1920 – die anfängliche und nachträgliche Strafaussetzung wurden in der bedingten Aussetzung der Strafvollstreckung zusammengeführt. Über die Strafaussetzung konnten die Gerichte entscheiden.
Das Begnadigungsrecht wurde 1938 nach der nationalsozialistischen Machtergreifung außer Kraft gesetzt. Die Strafaussetzung als eine Maßnahme kam ab 1943 nicht mehr zur Anwendung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zunächst zu keinen nennenswerten Veränderungen in der Entwicklung der Strafaussetzung zur Bewährung als Maßnahme.
4.2. Geschichtliche Entwicklung der Bewährungshilfe vor 1953
Der Anfang der Bewährungshilfe hängt mit der Entstehung so genannter „visiting agents“ 1869 / 70 in Massachusetts zusammen. Die Aufgabe des „Agenten“ bestand darin, für das Gericht eine Einschätzung und Beurteilung zu einem straffällig gewordenen Jugendlichen abzugeben. 1878 gruppierten sich in Boston einige Polizeibeamte, um Jugendliche während der Bewährungszeit zu beaufsichtigten und der Besserung zuzuführen. Ein gesetzlicher Erlass von 1907 ermächtigte die Gerichte, einen Bewährungshelfer zur Betreuung einzusetzen.
Auf deutschem Gebiet wurde die „Bewährungshilfe“ 1871 reichsgesetzlich geregelt. Demnach war die Regelung der nachträglichen Aussetzung des Strafrestes Sache der einzelnen Länder. Die im Jugendgerichtsgesetz (1923) geregelte anfängliche und nachträgliche Strafaussetzung bei Jugendlichen machte deutlich, dass ein zur Strafaussetzung Verurteilter unter Schutzaufsicht gestellt werden konnte. Somit konnte die Betreuung der Entlassenen entweder von einem Polizeibeamten oder von einer, einem öffentlichen oder privaten Träger zugehörigen Person, übernommen werden. Die Schutzaufsicht konnte von der Polizei an geeignete Schutzaufsichtsvereine übertragen werden.[55]
In der weiteren Entwicklung der Bewährungshilfe passierte bis zum Jahr 1953 nicht sehr viel. Erst das Dritte Strafrechtsänderungsgesetz (3. StrÄndG) brachte neue Fortschritte.
[...]
[1] Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde nur die männliche Form der Anrede im Text verwendet. Unter der Bezeichnung Bewährungshelfer, Richter oder Proband werden in gleichem Maße auch Bewährungshelferinnen, Richterinnen und Probandinnen verstanden.
[2] Vgl. Cornel, H.: Resozialisierung, Klärung des Begriffs, seines Inhaltes und seiner Verwendung. In: H. Cornel; B. Maelicke; B.R. Sonnen (Hrsg.) (1995): Handbuch der Resozialisierung. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden–Baden. 16-17.
[3] Vgl. Schellhoss, H.: Rehabilitation, Resozialisierung. In: G. Kaiser; H. J. Kerner; F. Sack, H. Schellhoss (Hrsg.) (1985): Kleines Kriminologisches Wörterbuch. C. F. Müller Juristischer Verlag. Heidelberg. 357.
[4] Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Eigenverlag, Frankfurt am Main. 945.
[5] Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Eigenverlag, Frankfurt am Main. 150.
[6] Proband (lat. probare – sich bewähren) – ist ein Verurteilter, dessen Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde und der sich während der Bewährungsfrist bewähren muss. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. 635.
[7] Vgl. DBH e.V. - Fachverband für Soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik (2008): ju-lex.com – Glossar „Strafrecht in Europa“. http://www.ju-lex.com/ger/search/index.htm. Weigend, T. (2007): Strafgesetzbuch. 44. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München. 26–27.
[8] Vgl. Weigend, T. (2007): Strafgesetzbuch. 44. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München. 189.
[9] Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Eigenverlag, Frankfurt am Main. 27.
[10] Vgl. Weigend, T. (2007): a. a. O. 190.
[11] Vgl. Böttner, S. (2004): Der Rollenkonflikt der Bewährungshilfe in Theorie und Praxis . Diss., Rechtswissenschaftliche Fakultät der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden. 19.
[12] Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Eigenverlag, Frankfurt am Main. 149–150.
[13] Vgl. Weigend, T. (2007): Strafgesetzbuch. 44. Auflage. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG. München. 28, 190.
[14] Migration (lat. migrare) - Wanderung, Bewegung von Individuen od. Gruppen im geographischen od. sozialen Raum, die mit einem Wechsel des Wohnsitzes verbunden ist. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. 499.
[15] Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.) (2002): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Eigenverlag, Frankfurt am Main. 643.
[16] Vgl. Hamburger, F.: Migration In: H. U Otto; H. Thiersch, (Hrsg.) (2005): Handbuch der Sozialarbeit Sozialpädagogik. Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag. München. 1211-1222.
[17] Immigrant (lat.) - Einwanderer. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. 335.
[18] Vgl. Statistisches Bundesamt (2007): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Fachserie 1. Reihe 2.2.. Wiesbaden. 6.
[19] Vgl. BBMFI Beauftragter der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2007): 7. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Berlin. 14.
[20] Delinquenz – Straffälligkeit. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich.. 170.
[21] Kriminalität - Straffälligkeit; oder Umfang der strafbaren Handlungen, die in einem bestimmten Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums [von einer bestimmten Tätergruppe] begangen werden. Vgl. a. a. O.: 437.
[22] Vgl. BBMFI Beauftragter der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2005): 6. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland. Berlin..283.
[23] Vgl. Kaiser, G.; Kerner, H. J.; Sack, F.; Schellhoss H. (Hrsg.) (1985): Kleines Kriminologisches Wörterbuch. C. F. Müller Juristischer Verlag. Heidelberg. 160.
[24] Vgl. Schünemann, H.-W. (1971): Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Eine Untersuchung über die verlaufs- und erfolgsrelevanten Faktoren des Vorlebens und der Bewährungszeit, durchgeführt an 180 zu Jugendstrafe mit Bewährung verurteilten Probanden. Verlag Otto Schwartz & Co Göttingen. Göttingen. 13-15.
[25] Vgl. a. a. O.: 53–97.
[26] Persönliche Einschätzung von Bewährungshelfern der Bewährungshilfe Ravensburg.
[27] Persönliche Einschätzung von Bewährungshelfern der Bewährungshilfe Ravensburg.
[28] Vgl. Schünemann, H.-W. (1971): Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Eine Untersuchung über die verlaufs- und erfolgsrelevanten Faktoren des Vorlebens und der Bewährungszeit, durchgeführt an 180 zu Jugendstrafe mit Bewährung verurteilten Probanden. Verlag Otto Schwartz & Co Göttingen. Göttingen. 167–224.
[29] Vogt, H.–G. (1972): Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden; Eine Untersuchung an 200 zu einer Jugendstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilten Probanden. Diss., Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen. 1.
[30] Vgl. a. a. O.: 3-80.
[31] Aszendenz (lat.) – Verwandtschaft in aufsteigender Linie. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. 88.
[32] Vgl. Vogt, H.–G. (1972): Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden; Eine Untersuchung an 200 zu einer Jugendstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilten Probanden. Diss., Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen. 181.
[33] Vgl. Schünemann, H.-W. (1971): Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden. Eine Untersuchung über die verlaufs- und erfolgsrelevanten Faktoren des Vorlebens und der Bewährungszeit, durchgeführt an 180 zu Jugendstrafe mit Bewährung verurteilten Probanden. Verlag Otto Schwartz & Co Göttingen. Göttingen. 57. Vogt H.–G. (1972): Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden; Eine Untersuchung an 200 zu einer Jugendstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilten Probanden. Diss., Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen. 39.
[34] Vgl. Vogt, H.–G. (1972): Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe bei Jugendlichen und Heranwachsenden; Eine Untersuchung an 200 zu einer Jugendstrafe mit Strafaussetzung zur Bewährung verurteilten Probanden. Diss., Juristische Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. Göttingen. 187.
[35] Vgl. a. a. O.: 197–201.
[36] Vgl. a. a. O.: 221–250.
[37] Vgl. Bieker, R. (1989): Bewährungshilfe aus der Adressatenperspektive. Sichtweisen, Erfahrungen und Reaktionen der Probanden. Forum Verlag Godesberg. Bonn. 7.
[38] Vgl. a. a. O.: 133-137.
[39] Vgl. a. a. O.: 141–189.
[40] Vgl. Cornel, H. (2000): Probanden der Bewährungshilfe für Jugendliche und Heranwachsende in Berlin. Ihre Lebenslage und Erwartungen an das Hilfesystem. Berlin. Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Berlin. University of Applied Sciences. 31.
[41] Vgl. a. a. O.: 28.
[42] Vgl. a. a. O.: 64.
[43] Vgl. Tögel, S.: Frühformen der Strafaussetzung und der Strafentlassenenhilfe. In: H. J. Kerner (Hrsg.) (1990): Straffälligenhilfe in Geschichte und Gegenwart: Beiträge und Dokumente zur Entwicklung von Gerichtshilfe, Strafaussetzung, Bewährungshilfe, Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe aus Anlass des 40. Jahrestages praktischer Bewährungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Forum Verlag Godesberg. Bonn. 3-7. Westphal, K. (1995): Die Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung gemäss § 21 JGG. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. 29-30.
[44] Vgl. Westphal, K.: (1995): Die Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung gemäss § 21 JGG. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien. 31.
[45] Vgl. Tögel, S.: Frühformen der Strafaussetzung und der Strafentlassenenhilfe. In: H. J. Kerner (Hrsg.) (1990): Straffälligenhilfe in Geschichte und Gegenwart: Beiträge und Dokumente zur Entwicklung von Gerichtshilfe, Strafaussetzung, Bewährungshilfe, Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe aus Anlass des 40. Jahrestages praktischer Bewährungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Forum Verlag Godesberg. Bonn. 7.
[46] Vgl. a. a. O: 10
[47] Reskript - (veraltet) amtlicher Bescheid, Verfügung, Erlass. Vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion (Hrsg.) (1990): Das Fremdwörterbuch. Band 5. Dudenverlag. Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich. 679.
[48] Vgl. Tögel, S.: Frühformen der Strafaussetzung und der Strafentlassenenhilfe. In: H. J. Kerner (Hrsg.) (1990): Straffälligenhilfe in Geschichte und Gegenwart: Beiträge und Dokumente zur Entwicklung von Gerichtshilfe, Strafaussetzung, Bewährungshilfe, Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe aus Anlass des 40. Jahrestages praktischer Bewährungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Forum Verlag Godesberg. Bonn. 11-12.
[49] Vgl. Damian, H.: Die (anfängliche) Strafaussetzung und die (nachträgliche) Aussetzung des Strafrestes. Grundzüge ihrer Entwicklung bis zum Dritten Strafrechtsänderungsgesetz. In: H. J. Kerner (Hrsg.) (1990): Straffälligenhilfe in Geschichte und Gegenwart: Beiträge und Dokumente zur Entwicklung von Gerichtshilfe, Strafaussetzung, Bewährungshilfe, Strafvollzug und Strafentlassenenhilfe aus Anlass des 40. Jahrestages praktischer Bewährungshilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Forum Verlag Godesberg. Bonn. 56.
[50] Vgl. a. a. O.: 58-71.
[51] Vgl. a. a. O.: 71-79.
[52] Vgl. a. a. O.: 82.
[53] Vgl. Ostendorf, H.: Jugendgerichtsgesetz. In: H. U Otto; H. Thiersch, (Hrsg.) (2005): Handbuch der Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag. München. 851.
[54] Vgl. a. a. O.: 79-80.
[55] Vgl. a. a. O.: 82.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836624756
- DOI
- 10.3239/9783836624756
- Dateigröße
- 984 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Ravensburg-Weingarten – Sozialwesen, Soziale Arbeit und Pädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- soziale arbeit bewährungshilfe jugendliche migration straftat
- Produktsicherheit
- Diplom.de