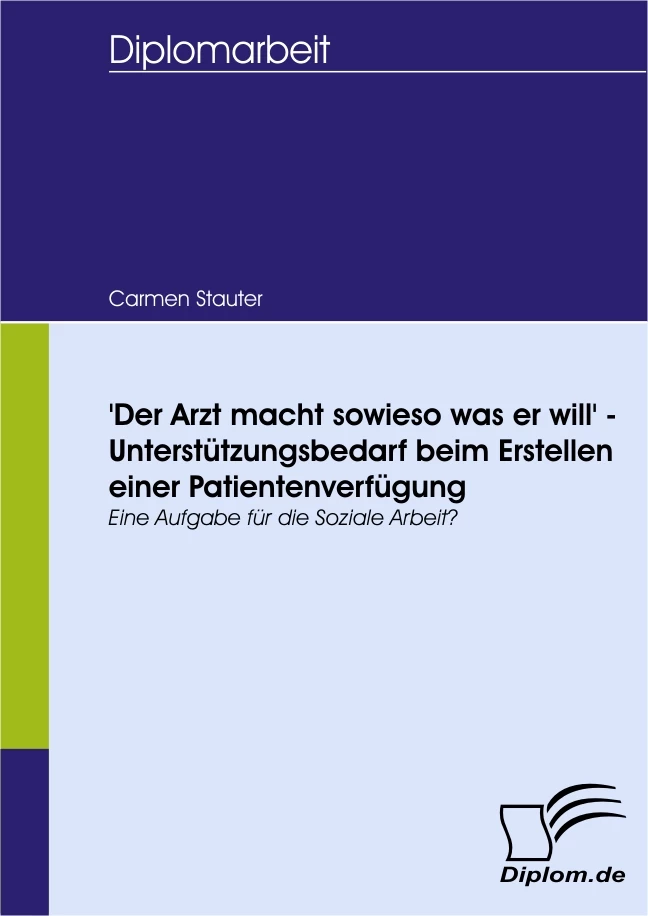'Der Arzt macht sowieso was er will' - Unterstützungsbedarf beim Erstellen einer Patientenverfügung
Eine Aufgabe für die Soziale Arbeit?
Zusammenfassung
Ja, ich weiß es von meinem Schwager, der hat immer gesagt, sprecht nicht darüber, sprecht nicht! Sag ich, wir sind geboren, um zu sterben. Es nützt nichts. Der eine früh, der andere spät. Bleiben tun wir alle net. (Frau Z., Interviewpartnerin).
Der medizinische Fortschritt bietet heute auf der einen Seite vielen Patienten die Chance auf einen erwünschten Lebenserhalt, auf der anderen Seite schürt er in der Bevölkerung die Angst vor Übertherapie und sinnloser Leidensverlängerung am Ende des Lebens. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Pluralismus und Individualisierung geprägt ist.
Das Autonomiestreben macht auch vor der letzten Lebensphase, dem Sterben, keinen Halt. Der Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben kann sich im Verfassen einer Patientenverfügung manifestieren. Sie ist Ausdruck des Bedürfnisses, auch am Lebensende den eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprechend behandelt zu werden, selbst wenn man diese nicht mehr selbst äußern kann. Das Erstellen einer Patientenverfügung stellt jedoch hohe Anforderungen an den Einzelnen, und diese zu ergründen, war Teil meiner Arbeit.
Die Entstehung meiner Fragestellung geht auf eine lange Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema Patientenverfügung zurück. Erstmals wurde ich innerhalb meiner Familie konfrontiert, als meine Eltern eine solche Verfügung verfassen wollten. Schon zu diesem Zeitpunkt stellte ich fest, dass es keine konkreten Anlaufstellen für eine Beratung gibt.
Bei Recherchen im Internet stieß ich auf eine Vielzahl von Formularen, die in ihrer Struktur sehr unterschiedlich waren. Steigt man über dieses Medium etwas intensiver ein, erfährt man eine Fülle von unterschiedlichsten Informationen, die sich in wichtigen Fragen teilweise widersprechen.
Dies führte dazu, dass ich an verschiedenen Vorträgen zu diesem Thema teilnahm. Jedoch musste ich auch hier schnell feststellen, dass selbst unter den Experten keine Einigkeit herrschte und teilweise falsche Aussagen getroffen wurden. Meine persönlichen Erfahrungen zeigten also, dass eine große Unsicherheit bezüglich der Problematik der Patientenverfügung besteht und der Laie völlig überfordert ist, sich in dem Wust an Informationen zurechtzufinden. Die in der Öffentlichkeit viel diskutierte ungeklärte Rechtsposition trägt selbstverständlich ebenfalls ihren Teil dazu bei. Während meines Praktikums im Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e.V. wurde ich mehrfach mit Anfragen zum Thema Patientenverfügung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsübersicht
Einleitung
1 Theorie
0.1 Die Patientenverfügung: juristische Hintergründe
0.1.1 Begriffsklärung
0.1.1.1 Patientenverfügung
0.1.1.2 Betreuungsverfügung
0.1.1.3 Vorsorgevollmacht
0.1.1.4 Sterbehilfe
0.1.2 Rechtsentwicklung
0.1.2.1 Das „Recht auf den eigenen Tod“
0.1.2.2 Die „Patientenautonomie am Lebensende“
0.2 Öffentliche Stellungnahmen zur Patientenverfügung
0.2.1 Empfehlungen der wichtigsten Kommissionen
0.2.1.1 Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums (10.06.2004)
0.2.1.2 Enquete-Kommission des Bundestages (13.09.2004)
0.2.1.3 Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz (23.04.2004)
0.2.1.4 Vergleich der drei Kommissions-Empfehlungen
0.2.2 Stellungnahmen der Kirchen
0.2.2.1 Die Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche
0.2.2.2 Der Katholikenrat im Bistum Speyer (11.03.2006)
0.2.3 Stellungnahme des Nationalen Ethikrates
0.3 Der schwerkranke Mensch und die Institution
0.3.1 Die „singuläre“ Interaktion zwischen Arzt und Patient
0.3.2 Foucault und die Macht zwischen Arzt und Patient
0.3.3 Vom Paternalismus zum „informed consent“
0.3.3.1 Die Entstehungsgeschichte des „informed consent“
0.3.3.2 Das ethische Fundament des Informed Consent
0.3.3.3 Patientenautonomie im Bereich der Pflege
0.3.4 Derzeitiger Diskussionsstand
0.3.4.1 Das Prinzip der Patientenautonomie
0.3.4.2 Einwände der Ärzteschaft gegen die Patientenverfügung
0.3.4.3 Vorschläge für sinnvolle Patientenverfügungen
1 Methode
1.1 Auswahl der Forschungsmethode
1.1.1 Das problemzentrierte Interview
1.1.2 Die Interview-Situation
1.2 Die Instrumente des problemzentrierten Interviews
1.2.1 Der Leitfaden
1.2.2 Die Tonbandaufzeichnung
1.2.3 Das Postskriptum
1.2.4 Kurzfragebogen
1.3 Die Aufbereitung des Materials
1.3.1 Die zusammenfassende Transkription
1.3.2 Konstruktion deskriptiver Systeme
1.4 Die Auswertung
1.4.1 Die qualitative Inhaltsanalyse
1.4.2 Die kommunikative Validierung
2 Auswertung
2.1 Vorstellung der Interviewpartnerin
2.2 Zugang
2.2.1 „Man hört halt viel, auch im Fernsehen sieht man das“
2.3 Erfahrungswelt in dieser Lebenssituation
2.3.1 „Kopf hängen lassen nützt nichts“
2.3.2 „Ich hab ja schon alles vorbereitet“
2.3.3 „Deswegen bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig“
2.3.4 „Der Arzt macht sowieso was er will“
2.3.5 „Da wird eine fremde Person einfach eingesetzt“
2.3.6 „Dann müssen se’s aber auch mal festlegen“
2.3.7 „Das muss von jedem Arzt anerkannt werden“
2.3.8 „So stell ich mir das vor“
2.3.9 „Ich möchte das jetzt dieses Jahr machen“
2.3.10 „Da gibt’s ja so viel, was man da alles machen muss“
2.3.11 „Die hat’s allerdings nicht schriftlich“
2.4 Unterstützung
2.4.1 „Ja, da hätt’ ich jemand“
2.4.2 „So müsste das sein“
3 Diskussion
3.1 Zugang
3.1.1 „Man hört halt viel, auch im Fernsehen sieht man das“
3.1.2 Fazit zum Zugang
3.2 Erfahrungswelt in dieser Lebenssituation
3.2.1 „Kopf hängen lassen nützt nichts – ich hab ja schon alles vorbereitet“
3.2.2 „Ein Arzt kann sagen, ich lehne das ab“
3.2.3 „Deswegen bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig“
3.2.4 „Ja, die sagt immer, das wird rechtlich festgelegt – und was ist bis dahin?“
3.2.5 „Mit meinem Mann – damit er dann ja auch weiß“
3.2.6 „Damit man dann dieses Formular hat – für normale und für kranke mit Brustkrebs“
3.2.7 „Der Arzt macht sowieso, was er will“
3.2.8 „Da wird eine fremde Person einfach eingesetzt“
3.2.9 „Ich möchte das jetzt dieses Jahr machen“
3.2.10 „Da gibt’s ja so viel, was man da alles machen muss“
3.2.11 „Die hat’s allerdings nicht schriftlich“
3.2.12 Fazit zur Erfahrungswelt in dieser Lebenssituation
3.3 Unterstützung
3.3.1 „Ja, ich hätt’ da jemand“
3.3.2 „So müsste das sein“
3.3.3 Fazit zur Unterstützung
3.4 Quintessenz
3.4.1 Juristische Regelung
3.4.2 Beziehungsaspekt
3.4.3 Unterstützung
3.4.4 Betreuungsverfügung/Vorsorgevollmacht
3.4.5 Machtaspekt
3.4.6 Abschließende Gedanken
4 Implikationen für die Soziale Arbeit
Literatur
Anhang
Anschreiben zur Kontaktaufnahme
Transkription des Interviews
Eidesstattliche Erklärung
Einleitung
„Ja, ich weiß es von meinem Schwager, der hat immer gesagt, sprecht nicht darüber, sprecht nicht! Sag ich, wir sind geboren, um zu sterben. Es nützt nichts. Der eine früh, der andere spät. Bleiben tun wir alle net. (Frau Z., Interviewpartnerin)
Der medizinische Fortschritt bietet heute auf der einen Seite vielen Patienten die Chance auf einen erwünschten Lebenserhalt, auf der anderen Seite schürt er in der Bevölkerung die Angst vor Übertherapie und sinnloser Leidensverlängerung am Ende des Lebens. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Pluralismus und Individualisierung geprägt ist.
Das Autonomiestreben macht auch vor der letzten Lebensphase, dem Sterben, keinen Halt. Der Wunsch nach einem selbstbestimmten Sterben kann sich im Verfassen einer Patientenverfügung manifestieren. Sie ist Ausdruck des Bedürfnisses, auch am Lebensende den eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprechend behandelt zu werden, selbst wenn man diese nicht mehr selbst äußern kann. Das Erstellen einer Patientenverfügung stellt jedoch hohe Anforderungen an den Einzelnen, und diese zu ergründen, war Teil meiner Arbeit.
Die Entstehung meiner Fragestellung geht auf eine lange Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema Patientenverfügung zurück. Erstmals wurde ich innerhalb meiner Familie konfrontiert, als meine Eltern eine solche Verfügung verfassen wollten. Schon zu diesem Zeitpunkt stellte ich fest, dass es keine konkreten Anlaufstellen für eine Beratung gibt.
Bei Recherchen im Internet stieß ich auf eine Vielzahl von Formularen, die in ihrer Struktur sehr unterschiedlich waren. Steigt man über dieses Medium etwas intensiver ein, erfährt man eine Fülle von unterschiedlichsten Informationen, die sich in wichtigen Fragen teilweise widersprechen.
Dies führte dazu, dass ich an verschiedenen Vorträgen zu diesem Thema teilnahm. Jedoch musste ich auch hier schnell feststellen, dass selbst unter den Experten keine Einigkeit herrschte und teilweise falsche Aussagen getroffen wurden. Meine persönlichen Erfahrungen zeigten also, dass eine große Unsicherheit bezüglich der Problematik der Patientenverfügung besteht und „der Laie“ völlig überfordert ist, sich in dem Wust an Informationen zurechtzufinden. Die in der Öffentlichkeit viel diskutierte ungeklärte Rechtsposition trägt selbstverständlich ebenfalls ihren Teil dazu bei. Während meines Praktikums im Tumorzentrum Rheinland-Pfalz e.V. wurde ich mehrfach mit Anfragen zum Thema Patientenverfügung konfrontiert. Die Patienten wandten sich recht hilflos an die Beratungsstelle, da sie sonst keine Anlaufstelle finden konnten. Dadurch wurde mir die Notwendigkeit einer klaren Zuordnung des Beratungsangebotes nochmals deutlich bewusst. Für viele Problemlagen unserer Gesellschaft sind konkrete Beratungsstellen vorhanden – wie z.B. Schuldner-, Ehe-, Erziehungs- oder Drogenberatung. Dies auch für die Beratung zur Patientenverfügung zu erreichen, wäre ein wünschenswertes Ziel.
Bis heute hat sich keine Profession die Beratung zur Patentenverfügung eindeutig zur Aufgabe gemacht. Zwar gibt es verschiedene Einrichtungen, die Beratung anbieten –dies aber überwiegend durch persönliche Betroffenheit bzw. Interesse bei den entsprechenden Mitarbeitern begründet zu sein, nicht jedoch durch eine institutionelle Struktur. So sind die Ratsuchenden meist auf sich gestellt und müssen sich in der Fülle der Informationen allein zurechtfinden, was oft das Entstehen von falschen bzw. nicht verwertbaren Patientenverfügungen zur Folge hat. Es ist letztlich unzumutbar, insbesondere jene Menschen mit einer bestehenden Diagnose und all den Problemen, die damit einhergehen, noch zusätzlich zu belasten, indem sie gezwungen sind, viele Einrichtungen anzufragen, bzw. sich durch den „Datendschungel“ des Internets zu kämpfen. In diesem Zusammenhang stellte ich mir auch die Frage, ob eine besondere Form der Patientenverfügung eine Möglichkeit bieten würde, auf die spezielle Problematik der Krebserkrankten eingehen zu können und die unsichere Rechtslage durch konkrete Formulierungen etwas zu entschärfen wäre. Bei den Gesprächen im Rahmen meines Praktikums wurde sehr schnell deutlich, wie umfassend und vielschichtig die Thematik ist. Juristische und medizinische Professionen, die unumstritten einen wichtigen Teil der Beratung ausmachen, reichen jedoch bei weitem nicht aus, um die Probleme beim Erstellen einer solchen Verfügung abzudecken.
Es wurde deutlich, dass die Patienten Erwartungen an eine solche Verfügung stellen, die dieses Schriftstück niemals erfüllen kann. So wollte mich beispielsweise ein Klient dazu bringen, mit seiner Lebensgefährtin zusammen die Verfügung auszufüllen und sie dabei gleich als „Betreuungsverfügte“, also zuständige Pflegeperson, in die Verantwortung zu nehmen. Er selbst wollte sich mit seiner Patientenverfügung nicht weiter befassen.
Aufgrund dieser persönlichen Erfahrungen kam ich zu den nachfolgend aufgeführten Fragestellungen:
- Wie muss eine sinnvolle und umfassende Beratung zur Patientenverfügung gestaltet sein, und welche Inhalte sind notwendig?
- Welche Erwartungen bestehen bezüglich der Tragweite einer solchen Verfügung?
- Inwieweit ist eine spezielle Patientenverfügung für Krebsbetroffene sinnvoll?
- Welche Disziplinen/Professionen sind zum Erstellen einer solchen Verfügung notwendig? Kann die Soziale Arbeit einen Beitrag zur Beratung leisten, bzw. sie zu ihrem Aufgabenfeld hinzufügen?
Ich führte Interviews mit vier an Krebs erkrankten Frauen, die sich bereits mit dem Thema der Patientenverfügung beschäftigt hatten. Im Laufe der Auswertung verschob sich meine Aufmerksamkeit auf ein weiteres Phänomen, das für mich im Zusammenhang mit der Thematik von großem Interesse war:
- Was ist der Hintergrund für die Diskrepanz zwischen der großen Zahl jener Menschen, die eine Patientenverfügung für sinnvoll erachten, und der geringen Zahl derer, die tatsächlich eine solche für sich verfasst haben?
- Inwieweit besteht zwischen der Machtstruktur im Arzt-Patienten-Verhältnis einerseits und dem Erstellen bzw. Nichterstellen einer Patientenverfügung andererseits ein Zusammenhang, der Aufschluss zu der aufgeworfenen Frage geben könnte? Die Interview-Auswertung ließ diesbezüglich einige Hypothesen zu, die ich in der vorliegenden Arbeit darzustellen versuche.
In einem einführenden Kapitel erfolgt zunächst eine Erklärung der juristischen Hintergründe zur Patientenverfügung. Danach werden die Stellungnahmen von eigens einberufenen Regierungskommissionen sowie der Kirchen und des Nationalen Ethikrates erläutert. Das Hauptaugenmerk dieses theoretischen Kapitels liegt anschließend auf dem einzelnen Menschen in der Institution „Medizin“: hier wird insbesondere die Beziehung zwischen Arzt und Patient aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Im zweiten Kapitel soll die gewählte methodische Vorgehensweise des Interviews vorgestellt werden. Daran anknüpfend erfolgt im dritten Kapitel die Auswertung des Interviews, die im vierten diskutiert wird. Die vorliegende Arbeit schließt in einem fünften Kapitel mit den aus den Ergebnissen resultierenden Implikationen für die Soziale Arbeit.
1 Theorie
„Und das müsste gesetzlich festgelegt werden. Der Arzt muss es machen. Wenn eine Patientenverfügung vorliegt, der Arzt muss fragen, liegt eine vor, und wenn die vorliegt, müsste er das machen.“ (Frau Z., Interviewpartnerin)
Das Thema Sterben und Tod war immer schon beunruhigend. Dennoch gehörte es zu den alltäglichen Erfahrungen, solange in Großfamilien noch mehrere Generationen unter einem Dach lebten. Verstorbene wurden im Kreise der Familie aufgebahrt, jeder konnte Abschied nehmen, der Anblick eines toten Menschen hatte nichts Schockierendes. Der Tod wurde nicht tabuisiert – im Gegenteil: er wurde öffentlich zelebriert. Die Begleitung während des Sterbeprozesses wurde oft geleitet von – vor allem christlichen – Ritualen, die in ihrer Abfolge und Ausprägung festgelegt waren und somit den Angehörigen und dem Sterbenden eine gewisse Sicherheit boten.
Heute gibt es die Großfamilie, wenn überhaupt, nur noch im ländlichen Raum; die arbeitsmarktpolitische Forderung nach Mobilität und Flexibilität steht einem lebenslangen Zusammenleben im Familienverbund entgegen; der Glaube spielt bei vielen Menschen nur noch eine untergeordnete Rolle. Der demographische Wandel stellt uns heute vor ganz neue Herausforderungen; die Zahl der Pflegebedürftigen und chronisch Kranken steigt stetig an. Der medizinisch-technische Fortschritt hat bewirkt, dass wir zunehmend Möglichkeiten zur Verlängerung und Erhaltung unseres Lebens zur Verfügung haben. Dadurch erscheint der Tod eher als Ergebnis einer Entscheidung, die wir selbst treffen können. Auch hier zeigt sich der Wunsch nach Autonomie, der in vielen Bereichen unseres Lebens zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Eine Autonomie, die jedoch gesetzlicher Absicherung bedarf: mit der so genannten Patientenverfügung.
0.1 Die Patientenverfügung: juristische Hintergründe
Die in den 60er Jahren entwickelte gesetzliche Regelung des „ informed consent “ ist als Grundstein unserer heutigen Patientenverfügung zu sehen. Bereits in den 70er Jahren entstanden erste Formulare für eine solche Verfügung. Die Frage, ob die Medizin alles darf, was sie kann, wurde erstmals öffentlich diskutiert. In jener Zeit gründete Ciceley Saunders das erste Hospiz in England.
Spätestens jedoch mit der Erfindung der Perkutanen Endoskopisch kontrollierten Gastrostomie (PEG) im Jahre 1984 ist das Thema der Selbstbestimmung in die öffentliche Diskussion gerückt: erlaubt doch die Magensonde die künstliche Ernährung eines Menschen, der dazu auf anderem Wege nicht mehr in der Lage oder Willens ist. Jährlich wird etwa 140 000 Menschen eine PEG angelegt (Bundesärztekammer, 2001, S. A4209); ohne diese Maßnahme gäbe es keine langfristigen Komapatienten. Sie ermöglicht eine perfekte Versorgung mit allen notwendigen Stoffen und garantiert eine hohe Flüssigkeitszufuhr. Für viele Menschen beginnt in dem Augenblick, da ihnen eine PEG angelegt wird, das „ ewige Leben an der Sonde, während ihre Krankheit, Behinderung, ihre Demenz oder ihr sonstiger körperlicher Verfall kaum beeinflussbar fortschreiten. Der natürliche Sterbevorgang, ein synchrones Verlöschen von Körper, Geist und Seele, wird damit verhindert.“ (Putz & Steldinger, 2004, S. 8)
0.1.1 Begriffsklärung
0.1.1.1 Patientenverfügung
Bei der Patientenverfügung[1] handelt es sich um eine Willenserklärung zu medizinischen und begleitenden Maßnahmen, die für den Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit im Vorfeld festgelegt werden. Sie kann die Einleitung, den Umfang oder die Beendigung bzw. Ablehnung bestimmter Maßnahmen betreffen und Anweisungen an behandelnde Ärzte und Pflegepersonal enthalten. Auch eigene Wertvorstellungen oder Richtlinien für die gewünschte Behandlung können Teil einer Patientenverfügung sein. Trotz aktueller Entscheidungsunfähigkeit kann ein Patient so die ärztliche Behandlung beeinflussen und sein Selbstbestimmungsrecht wahren (vgl. Arbeitskreis Vorsorge, 2005, S. 11).
0.1.1.2 Betreuungsverfügung
Für den Fall einer Einwilligungsunfähigkeit wird beim Vormundschaftsgericht eine Betreuung eingerichtet. Diese wird mit einem entsprechenden Aufgabenkreis betraut, der die Bereiche der Einwilligungsunfähigkeit abdeckt. Der Vormundschaftsrichter ist verpflichtet, den Betroffenen dazu anzuhören und seine Wünsche bezüglich der zu bestimmenden Person zu berücksichtigen. Die diesbezüglichen Vorschriften sind nach § 1901a BGB (i.V.m. §§ 1897 Abs. 4, 1901 Ans.2 und 1901a BGB) geregelt. Eine schriftliche Betreuungsverfügung bietet die Möglichkeit, im Vorfeld eine oder mehrere Personen, die für den Betroffenen in Frage kommen, zu bestimmen. Hier kann selbstverständlich auch festgelegt werden, wer auf keinen Fall zum Betreuer benannt werden soll. Der Betreuer ist verpflichtet, die Angelegenheiten für den Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl und Willen entspricht (vgl. ebd., S. 8f.).
0.1.1.3 Vorsorgevollmacht
Mit einer Vorsorgevollmacht kann der Betroffene nach § 1896 Abs. 2 BGB eine oder mehrere Personen bevollmächtigen, Entscheidungen für ihn zu treffen, wenn er dazu nicht mehr in der Lage ist. Eine Vollmacht ist eine durch ein Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht. Man unterscheidet zwischen einem Außen- und einem Innenverhältnis:
Im Innenverhältnis werden Absprachen zwischen dem Vollmachtgeber und dem Bevollmächtigten getroffen. Im Außenverhältnis interessiert für die Wirksamkeit der Erklärungen des Bevollmächtigten nur der Inhalt der Vollmacht. Nach dem am 1.1.1999 in Kraft getretenen Betreuungsrechtänderungsgesetz ist es möglich, die Vorsorgevollmacht auch für den Bereich der Gesundheitsfürsorge zu erteilen. Die Vollmacht ermöglicht ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Es ist jedoch notwendig, die genauern Aufgabenbereiche zu benennen, in denen der Bevollmächtigte im Sinne des Vollmachtgebers handeln darf. Eine Generalvollmacht deckt verschiedene Bereiche nicht ab. Die Vorsorgevollmacht ist der Betreuerbestellung vorrangig. Wenn für einen bestimmten Bereich ein Bevollmächtigter benannt wird, darf hierfür kein Betreuer bestellt werden.
0.1.1.4 Sterbehilfe
Man unterscheidet fünf Formen der Sterbehilfe, zwei passive und drei aktive Formen.[2] Diese Unterscheidung ist von großer Bedeutung für das Verständnis der Patientenverfügung: Der Patient kann den Arzt zwar zwingen, eine Behandlung zu unterlassen, nicht jedoch, eine solche vorzunehmen. Dies bedeutet konkret, er kann beispielsweise eine künstliche Ernährung verbieten, aber den Arzt nicht zu einer bestimmten Dosis Morphiumgabe veranlassen. Aktiv oder passiv sagt, entgegen der vielverbreiteten Meinung, zunächst nichts über die Rechtmäßigkeit aus.
Passive Sterbehilfe
Passive Sterbehilfe liegt immer dann vor, wenn man den Tod ohne Intervention zulässt. In den Grundsätzen der Bundesärztekammer heißt es dazu:
„Der Arzt ist verpflichtet, Sterbenden, d.h. Kranken oder Verletzten mit irreversiblem Versagen einer oder mehrerer vitaler Funktionen, bei denen der Eintritt des Todes in kurzer Zeit zu erwarten ist, so zu helfen, dass sie unter menschenwürdigen Bedingungen sterben können. An die Stelle von Lebensverlängerung und Lebenserhaltung treten dann palliativ-medizinische Versorgung einschließlich pflegerischer Maßnahmen.“ (Bundesärztekammer, 2004, Abschnitt I und II)
Sterbebegleitung: Hierzu gehören insbesondere Beistand, Seelsorge, eine menschenwürdige und vertraute Umgebung und eine einfühlsame Betreuung. Gemeint ist vor allem die palliativ-medizinische Betreuung (z.B. Schmerztherapie). Der Arzt hat ausschließlich die Linderung im Sinne, eine Lebensverkürzung durch die Medikamentengabe findet weder objektiv noch subjektiv statt. Dies entspricht den o.g. Grundsätzen der Bundesärztekammer (Abschnitt I): „Die Hilfe besteht in palliativ-medizinischer Versorgung und damit auch in Beistand und Sorge für Basisbetreuung.“
Zulassen des Sterbens: Hierunter fallen das Unterlassen oder Beenden von lebensverlängernden Maßnahmen wie Magensonde oder Beatmung. Grundlage hierfür ist der Wille des Patienten. Nach den Grundsätzen der Bundesärztekammer ändert sich das Therapie- bzw. das Behandlungsziel: „Maßnahmen zur Verlängerung des Lebens dürfen in Übereinstimmung mit dem Willen des Patienten unterlassen oder nicht weitergeführt werden, wenn diese nur den Todeseintritt verzögern und die Krankheit in ihrem Verlauf nicht mehr aufgehalten werden kann.“ (ebd.) Diese Form der passiven Sterbehilfe wird fälschlicherweise immer wieder als aktives Handeln eingestuft. Wenn sich aufgrund des geäußerten Willen des Patienten das Behandlungsziel dahingehend ändert, dass eine Lebensverlängerung nicht mehr angestrebt wird, darf der natürliche Sterbeprozess nicht weiter aufgehalten werden. Konkret bedeutet dies, dass eine Beatmung, die bereits begonnen wurde, beendet werden muss und keine begonnen werden darf, wenn der Patient nicht mehr selbstständig atmen kann. Die Rechtssprechung bewertet beide Vorgänge als ein Unterlassen, also kein aktives Handeln, denn der Patient stirbt an seiner Krankheit.
Aktive Sterbehilfe
Aktiv ist Sterbehilfe dann, wenn in den Krankheitsverlauf eingegriffen wird und dieser Eingriff dazu führt, dass ein Mensch stirbt. Man unterscheidet drei Formen der aktiven Sterbehilfe:
Indirekte aktive Sterbehilfe: Die Verwendung von Medikamenten zur Linderung von Schmerzen bewirken in manchen Fällen eine Lebensverkürzung. Die Willensrichtung des Arztes ist auf die Bekämpfung der Schmerzen ausgerichtet, die Lebensverkürzung wird billigend in Kauf genommen. Somit wird nicht auf den Tod des Patienten abgezielt (direkte Sterbehilfe), sondern dieser wird lediglich in Kauf genommen (indirekt). Von aktiver Sterbehilfe spricht man, da der Patient an den Nebenwirkungen der Medikamente und nicht an seiner Krankheit verstirbt. Vorraussetzung ist auch hier der Wille des Patienten. Die Bundesärztekammer (2004, Abschnitt I) hat auch in diesem Fall eine klare Aussage getroffen: „Beim Sterbenden kann die Linderung des Leidens so im Vordergrund stehen, dass eine möglicherweise dadurch bedingte unvermeidbare Lebensverkürzung hingenommen werde darf.“
Direkte aktive Sterbehilfe: Hierunter fällt die Tötung durch aktives Handeln (z.B. durch eine Überdosis Morphium). Der so Handelnde macht sich strafbar wegen Totschlags (§ 212 StGB) oder wegen Mordes (§ 211 StGB). Handelt er aufgrund der Aufforderung des Patienten, so ist er wegen Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB) zu belangen. Von direkter Sterbehilfe spricht man hier, da sie den Tod des Patienten zum Ziel hat, von aktiv, weil der Mensch nicht an seiner Krankheit verstirbt, sondern an den Folgen des Eingriffs von außen. Die Bundesärztekammer (ebd.): „Eine gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen oder das Sterben beschleunigen sollen, ist als aktive Sterbehilfe unzulässig und mit Strafe bedroht.“
Beihilfe zur Selbsttötung des Patienten: Wer sich selbst tötet, begeht nach geltendem Recht keine Straftat. Wer einem anderen hilft, den Suizid vorzubereiten, begeht ebenfalls keine Straftat, solange er an der eigentlichen Tötungshandlung nicht beteiligt ist – ausschließlich dem Arzt ist die Suizidbeihilfe standesrechtlich verboten. Aktiv ist die Sterbehilfe, da der Patient an der durch die Beihilfehandlung geschaffenen Ursache verstirbt und nicht an den Folgen seiner Krankheit. Doch diese Form der Sterbehilfe birgt eine große Gefahr in sich: Hat der Suizidant seine Handlung abgeschlossen und gerät in eine hilflose Lage (z.B. Bewusstlosigkeit), so besteht für den Arzt bzw. den nahen Angehörigen die Gefahr, sich aufgrund der so genannten Garantenstellung strafbar zu machen („unterlassene Hilfeleistung“, § 323c StGB, bzw. „Tötung durch Unterlassung“, §§ 212, 13 StGB). Hier empfiehlt sich eine schriftliche Modifizierung der Garantenpflicht. Außerdem muss beweissichernd dokumentiert sein, dass es sich um die freie Willensbildung des Patienten handelt.
0.1.2 Rechtsentwicklung
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten hat sein Fundament in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Jede ärztliche Maßnahme bedarf grundsätzlich der ausdrücklichen Einwilligung des Patienten. Dies ergibt sich aus Art. 1 Abs.1 GG sowie Art. 2 Abs.1und 2 GG, die zu Achtung und Schutz der Würde und der Freiheit des Menschen verpflichten und das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit schützen. Der Arzt hat für eine fachgerechte Untersuchung, Diagnose und Indikation für oder gegen eine bestimmte Handlung Sorge zu tragen und muss dem Patienten hierüber Aufklärung anbieten. Der Patient hat das Recht, selbst über die Art und Weise seiner Behandlung zu entscheiden. Grundlage einer jeden Behandlung ist die Zustimmung des Patienten, ohne die sich der Arzt der Körperverletzung strafbar machen würde (§ 223 StGB). Man spricht hier vom „ informed consent “, dem Einverständnis nach vollständiger Information (vgl. Ackermann Ernst, 2004, S. 54). Zu keinem Zeitpunkt darf der Arzt eigenmächtig oder gar unter Zwang eine Behandlung ausführen und hat demnach kein eigenständiges Behandlungsrecht (vgl. Lipp, 2002).
0.1.2.1 Das „Recht auf den eigenen Tod“
„Das Recht auf Leben und das Recht auf Sterben ist der Kern der Selbstbestimmung, es ist ein unveräußerliches Recht und schließt die Freiheit ein, selbst über das Wann und Wie unseres Endes zu entscheiden, anstatt diese Entscheidung anderen oder dem Ausgang des ärztlichen Eingriffs zu überlassen.“ (Harry M. Kuitert, 1991, S. 68f.)
In der für das Arztrecht grundlegenden Entscheidung von 1957 (BGHSt 11, 111) führte der Bundesgerichtshof aus, dass das in Art.1 Abs.2 Satz1 GG gewährleistete Recht auf körperliche Unversehrtheit auch bei Menschen greift, die es ablehnen, von einem lebensgefährlichen Leiden befreit zu werden. Daraus leitet sich ab, dass auch in Fällen, in denen der Patient eine zuvor angenommene Zustimmung widerruft, diesem Widerruf Folge zu leisten ist. Eine Weiterbehandlung ohne Zustimmung wäre ein Verstoß gegen die Patientenautonomie und wiederum als rechtswidrige Körperverletzung gem. § 223 StGB strafbar. Es ist also grundsätzlich nicht die Frage, ob ein Abbruch der Behandlung rechtlich zulässig, sondern vielmehr, ob eine Fortsetzung der Behandlung erlaubt ist (vgl. Vetter, 2005, S. 21-23).
Weder die Krankheit noch der ärztliche Heilauftrag begründen demnach ein eigenständiges Behandlungsrecht des Arztes. Andererseits verleiht das Selbstbestimmungsrecht dem Patienten keinen Anspruch auf eine medizinische Behandlung, die aus ärztlicher Sicht nicht indiziert oder gar kontraindiziert ist. (vgl. BMJ, 2004b, S. 8). Dieses Verständnis ist für die Diskussion um die Patientenverfügung von größter Bedeutung, denn das sog. „Recht auf den eigenen Tod“ ist somit eine selbstverständliche Konsequenz aus der Anerkennung der Patientenautonomie.
Die Forderung nach Rechtsverbindlichkeit löste der Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 17.3.2003 (BGH, 2003) aus. Bei der Entscheidung des BGH ging es um einen Betroffenen, der am 29.11.2000 infolge eines Myocardinfarktes einen hypoxischen Gehirnschaden im Sinne eines apallischen Syndroms erlitten hatte und seitdem über eine PEG-Sonde ernährt wurde. Sein Sohn wurde als Betreuer unter anderem für die Aufgabenkreise „Sorge um die Gesundheit des Betroffenen“ und für die „Vertretung gegenüber Behörden und Einrichtungen“ bestellt. Aufgrund einer entsprechenden Patientenverfügung des Vaters beantragte er beim zuständigen Amtsgericht die Einstellung der Ernährung über die PEG-Sonde. Das Amtsgericht lehnte den Antrag ab. Beschwerden des Sohnes gegen die Entscheidungen und Abweisungen der Gerichte gingen den weiteren Weg durch die Instanzen bis zum BGH. In dessen Beschuss wurde zur Reichweite und Verbindlichkeit der Patientenverfügung sowie zu Fragen der Zulässigkeit des Behandlungsabbruchs und zu den Grenzen der passiven und aktiven Sterbehilfe Stellung genommen.
„Für eine Einwilligung des Betreuers und eine Zustimmung des Vormundschaftsgerichtes ist kein Raum, wenn ärztlicherseits eine solche Behandlung oder Weiterbehandlung nicht angeboten wird – sei es, dass sie von vorneherein medizinisch nicht indiziert, nicht mehr sinnvoll oder aus sonstigen Gründen nicht mehr möglich ist.“ (BGH, 2003)
Der BGH betont hierin, dass nicht der Abbruch, sondern die weitere Behandlung des Patienten der Einwilligung bedarf. Ist dieser einwilligungsunfähig und ein Betreuer bestellt, so ist die Weiterbehandlung nur zulässig, wenn der Betreuer einwilligt. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Arzt die Behandlung anbietet. Letzterer hat in eigener Verantwortung zu beurteilen, ob eine Behandlung nach den Regeln der ärztlichen Kunst noch indiziert oder konkret möglich ist. Beschließt er, dass eine lebensverlängernde Maßnahme nicht (mehr) indiziert ist und wird in dieser Entscheidung vom Betreuer unterstützt, so beruht die Einstellung der lebenserhaltenden Maßnahmen nicht auf der Entscheidung des Betreuers, sondern darauf, dass der Arzt diese nicht länger anbietet (vgl. auch Lipp, 2004).
Der Maßstab für die Entscheidungen des Betreuers ergibt sich aus § 1901 BGB. Entscheidend ist demnach der erklärte Wunsch des Patienten (§ 1901 Abs.3 S.1). Erst wenn dieser nicht festzustellen ist, kommt es auf den mutmaßlichen Willen des Patienten an (§ 1901 Abs.2 BGB). Wie dieser zu bestimmen ist, wenn es an individuellen Anhaltspunkten fehlt, beantwortet der BGH nur sehr oberflächlich.
„Nur wenn ein solcher erklärter Wille des Patienten nicht festgestellt werden kann, beurteilt sich die Zulässigkeit solcher Maßnahmen nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten, der dann individuell – also aus dessen Lebensentscheidungen, Wertvorstellungen und Überzeugungen – zu ermitteln ist.“ (BGH, 2003)
Der BGH schließt sich der Auffassung an, wonach die Entscheidung des Betreuers, lebenserhaltende Maßnahmen einzustellen, der Genehmigung des Vormundschaftrichters bedarf (§ 1904 BGB): „Seine Einwilligung in eine ärztlicherseits angebotene lebenserhaltende oder – verlängernde Behandlung kann der Betreuer jedoch nur mit Zustimmung des Vormundschaftsgerichts wirksam verweigern.“ (BGH, 2003)
Der Richter trifft keine Entscheidung über das Für und Wieder der Behandlung, sondern kontrolliert die Entscheidung des Betreuers. Mit dieser Zustimmungserfordernis wird der Fürsorgepflicht gegenüber dem Betreuer Rechnung getragen. Indem er unter Umständen eine Entscheidung gegen eine lebensverlängernde oder -erhaltende Behandlung des Betroffenen treffen muss, bürdet ihm dies eine Last auf, die alleine zu tragen ihm nicht zugemutet werden kann. Das Prüfverfahren entlastet somit den Betreuer, legitimiert seine Entscheidung und schützt ihn zudem vor dem Risiko einer abweichenden strafrechtlichen Beurteilung (vgl. BGH, 2003).
Im Falle des BGH-Urteils lag ein solcher Konfliktfall vor. Arzt und Betreuer waren über den Willen des Patienten unterschiedlicher Meinung: der Arzt wollte eine lebenserhaltende Maßnahme einleiten bzw. weiterführen, der Betreuer lehnte dies ab. Hier geht es um den Konflikt, ob der Wille des Patienten darin besteht, zu sterben. An dieser Stelle kann der Betreuer die Einstellung der Maßnahmen erst verlangen, wenn das Vormundschaftsgericht geprüft hat, ob dies tatsächlich dem Willen des Patienten entspricht. Die Entscheidungszuständigkeit der Vormundschaftsgerichte folgt laut BGH nicht konkret aus dem § 1904 BGB, sondern leitet sich aus einer Gesamtschau des Betreuungsrechts ab, dem Schutz des Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen. Die kritischste, und am meisten zu Diskussionen und Unsicherheiten führende Formulierung des 12. Zivilrates war der erste Leitsatz des Beschlusses (BGH, 2003):
„Ist ein Patient einwilligungsunfähig und hat sein Grundleiden einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen, so müssen lebenserhaltende oder -verlängernde Maßnahmen unterbleiben, wenn dies seinem zuvor – etwa in Form einer sog. Patientenverfügung – geäußerten Willen entspricht.“
Die hier vorgenommene Einschränkung auf ein Grundleiden mit irreversibel tödlichen Verlauf hat zu vielen Verwirrungen geführt. Was meint das Gericht mit „Grundleiden“ oder mit „irreversibel“ und „tödlich verlaufend“? Borasio et. al. (2003) weisen darauf hin, dass der „irreversible tödliche Verlauf“ sich nach der Entscheidung ausdrücklich auf das Grundleiden bezieht und nicht nur auf den unmittelbaren Sterbeprozess; sie fassen darunter ebenfalls alle Maßnahmen, bei deren Beendigung das rasche Sterben „mit Sicherheit zu erwarten“ ist (BGH, 2003, S. A2065).
Ein Definitionsversuch von Bühler und Stolz (2003) beschreibt Krankheitszustände, in denen die Summe der Merkmale abgeleitet werden, die den bis dato getroffenen Entscheidungen gemein sind und bei denen man von einem irreversibel tödlich verlaufenden Grundleiden im Sinne des BGH sprechen kann. Diese müssen kumulativ folgende Merkmale aufweisen:
1 „Irreversible Bewusstlosigkeit und Kommunikationsunfähigkeit;
2 Schwerstpflegebedürftigkeit;
3 Notwendigkeit medizinisch indizierter künstlicher Unterstützung von Nahrungsaufnahme, ‚Entgiftung’ und Ausscheidung oder Beatmung;
4 rasches Ableben bei Beendigung dieser künstlichen Unterstützungsmaßnahmen ist mit Sicherheit zu erwarten.“ (ebd., S. 1623)
Bei dem zu entscheidenden Fall konnte man im o.g. Sinne von einem irreversiblen Sterbeprozess sprechen, jedoch nicht von einer unmittelbaren Sterbephase. Dies erschließt sich allein schon aus der Tatsache, dass der Patient bereits seit 2000 im Koma lag und die Entscheidung zur Beendigung der ärztlichen Maßnahme erst 2003 getroffen wurde.
Die Verunsicherung entstand wohl aufgrund der Tatsche, dass die Formulierung „irreversibel tödlicher Verlauf“ bis dato die unmittelbare Sterbephase bezeichnete. Würde man diese Formel ernst nehmen, könnte der Betreuer nur bei einem Sterbenden die Behandlungseinstellung fordern und eben gerade nicht bei einem Komapatienten. Jedoch wird es nur in diesen Fällen überhaupt zu einer Entscheidung vom Betreuer kommen müssen, da grundsätzlich nur in diesen Fällen eine lebenserhaltende Behandlung vom Arzt angeboten wird (vgl. Lipp, 2004, S. 20).
Diese Weiterfassung der Irreversibilität im Beschluss des BGH führte zu weitreichenden Verunsicherungen; eine Vielzahl von Kommissionen befasst sich seither mit der Thematik. Die wichtigsten Ergebnisse sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.
0.1.2.2 Die „Patientenautonomie am Lebensende“
Der „Entwurf eines 3. Gesetzes zur Änderung des Betreuungsrechts“ vom 2.11.2004 (BMJ, 2004), ausgearbeitet von der Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“, sieht vor, die Patientenverfügung im Betreuungsrecht zu verankern. Soweit dies zumutbar ist, haben Betreuer und Bevollmächtigte den in einer Patientenverfügung geäußerten Willen des Betreuten zu beachten und die von ihm getroffenen Entscheidungen durchzusetzen. Das Vormundschaftsgericht ist einzuschalten, falls der Betreuer in ärztlich angezeigte Maßnahmen nicht einwilligt und die begründete Gefahr besteht, dass der Betreute aufgrund des Unterbleibens oder Abbruchs der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger dauernden Schaden erleidet und zwischen Betreuer und Arzt kein Einvernehmen besteht. Die Einwilligung des Patienten ist bei jedem ärztlichen Eingriff erforderlich, und es kommt dabei nicht darauf an,
„ob die Entscheidung des Patienten aus medizinischer Sicht als vernünftig oder unvernünftig anzusehen ist. (…) Die Wahrung der persönlichen Entscheidungsfreiheit des Patienten darf nicht durch das begrenzt werden, was aus ärztlicher oder objektiver Sicht erforderlich oder sinnvoll wäre.“ (ebd., S. 7)
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das im Grundgesetz festgelegte Selbstbestimmungsrecht auch das Recht zur Selbstgefährdung bis hin zur Selbstaufgabe und damit auch die Ablehnung lebensverlängernder und gesundheitserhaltender Maßnahmen einschließt. Der Entwurf stellt sich somit deutlich gegen die von der Enquete-Kommission geforderte Beschränkung der Gültigkeit von Patientenverfügung auf Grundleiden, die irreversibel zum Tode führen.
Auf die lang umstrittene Frage, ob die Nichteinwilligung oder der Widerruf der Einwilligung des Betreuers in die Durchführung lebenserhaltender Maßnahmen die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts bedarf, schließt sich der Beschluss weitgehend der Auffassung des Bundesgerichtshofes an. Dieser sieht in einem vormundschaftsgerichtlichen Verfahren einen geeigneten Rahmen, um zu überprüfen, ob der Betreuer den in der Patientenverfügung geäußerten Willen des Betroffenen erschöpfend ermittelt hat, und um verbindlich festzustellen, dass die vom Betreuer gewünschte Einstellung der Behandlung auch den Wünschen des Betreuten entspricht.
Die zustimmungspflichtigen Entscheidungen werden auf jene Fälle begrenzt, in denen die Nichteinwilligung oder der Widerruf des Betreuers zum Tod oder zu schweren und länger andauernden Schäden des Betreuten führen kann. Nicht Zustimmungspflichtig bleiben „die Entscheidungen des Betreuers nur in den Fällen, in denen zwischen Arzt und Betreuer übereinstimmende Auffassungen über den konkret behandlungsbezogenen mutmaßlichen Patientenwillen bestehen.“ (ebd., S. 21)
Der Entwurf regelt weiterhin, dass der Betreuer die Patientenverfügung unabhängig davon zu beachten hat, ob konkrete Behandlungssituationen oder allgemeine Behandlungswünsche festgelegt wurden. Bei Ersterem beschränkt sich die Aufgabe des Betreuers lediglich auf die Durchsetzung der Entscheidung, die der Betreute selbst getroffen hat. Wenn lediglich allgemeine Wünsche geäußert wurden, sind diese als ein Indiz zur Ermittlung des mutmaßlichen Willens heranzuziehen und vom Betreuer zu entscheiden. Hier kam es in der Vergangenheit häufig zu Problemen,
„weil Rechtslehre und Rechtssprechung auch Patientenverfügungen, welche die konkrete Behandlungssituation betreffen, zum Teil nur als ein Indiz bei der Ermittlung des im Zeitpunkt der Behandlung anzunehmenden mutmaßlichen Patientenwillens werten und eine Einwilligung des Betreuers in die ärztliche Behandlung fordern, obwohl der (betreute) Patient diese Entscheidung bereits selbst getroffen hat“ (ebd., S. 18)
Von einer Beratungspflicht sieht der Entwurf bewusst ab, wenngleich darauf hingewiesen wird, dass sie sehr sinnvoll und hilfreich sein kann.
Im Februar 2005 wurde dieser Gesetzentwurf zurückgezogen. Konkrete Rechtsvorschriften zur Bindungswirkung der Patientenverfügung existieren in Deutschland daher bisher nicht.
0.2 Öffentliche Stellungnahmen zur Patientenverfügung
Die Unsicherheit bezüglich der Patientenverfügung und lauter werdende Forderungen nach klaren Regelungen riefen verschiedene Kommissionen ins Leben, die sich mit der Thematik befassten und Empfehlungen aussprachen. Diese sollen im Folgenden zunächst zusammengefasst, anschließend die Stellungnahmen der Kirchen sowie des Nationalen Ethikrates skizziert werden.
0.2.1 Empfehlungen der wichtigsten Kommissionen
0.2.1.1 Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums (10.06.2004)
Das Bundesjustizministerium setzte eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Patientenautonomie am Lebensende“ ein. Der Arbeitsgruppe gehörten VertreterInnen von Ärzteschaft und Patienten, Wohlfahrtspflege, Hospizbewegung und Kirchen sowie der Konferenz der JustizministerInnen, JustizsenatorInnen und der Konferenz der für das Gesundheitswesen zuständigen MinisterInnen und SenatorInnen der Länder an. Ziel der Beratungen der Arbeitsgruppe war es, Fragen der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen zu diskutieren und Eckpunkte für die Abfassung einer Patentenverfügung zu erarbeiten sowie zu prüfen, ob Gesetzesänderungen in diesem Bereich erforderlich scheinen, und hierfür ggf. Vorschläge zu unterbreiten.
Ein eigenständiges Gesetz über Patientenverfügungen hält die Arbeitsgruppe laut ihrem Abschlussbericht vom Juni 2004 (BMJ, 2004b) nicht für notwendig, lediglich Ergänzungen im § 1901 BGB. Zur Aufgabe des Betreuers heißt es, er habe in jedem Fall dem in einer Patientenverfügung geäußerten Willen Folge zu leisten und für die Durchsetzung der vom Betreuten bereits getroffenen Entscheidung zu sorgen. Die Arbeitsgruppe fordert, die Stellung des Bevollmächtigten zu stärken und seine zustimmungspflichtigen Entscheidungen auf Konfliktfälle zu beschränken sowie die Einschaltung des Vormundschaftsgerichts klarer zu regeln.
„Nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe ist die Einschaltung des Vormundschaftsgerichts erforderlich, wenn zwischen Arzt und Betreuer Zweifel oder Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt des Patientenwillens bestehen. Denn dieser und nicht die ärztliche Indikation als solche ist maßgebend dafür, ob auf lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet werden darf.“ (BMJ, 2004b, S. 47f.)
Liegt jedoch eine ausdrückliche Willensbekundung des Betreuten vor, die die anstehende Behandlungssituation situationsbezogen und eindeutig beschreibt, „so hat das Vormundschaftsgericht festzustellen, dass es einer Genehmigung nicht bedarf, weil nicht der Betreuer, sondern der Betreute selbst in Ausübung seines – keiner vormundschaftlichen Kontrolle unterliegenden – Selbstbestimmungsrechts bereits eine Entscheidung getroffen hat (…).“ (ebd., S. 49) Dies gilt „unabhängig davon (…), ob die Grunderkrankung des Betreuten bereits einen irreversibel tödlichen Verlauf angenommen hat“ (ebd., S. 46).
Aktive Sterbehilfe soll weiterhin verboten bleiben. Aufgrund der öffentlichen Unsicherheiten über die Abgrenzung von aktiver, passiver und indirekte Sterbehilfe schlägt die Arbeitsgruppe eine Ergänzung zum § 216 StGB vor: „Nicht strafbar ist (1) die Anwendung einer medizinisch angezeigten leidmindernden Maßnahme, die das Leben als nicht beabsichtigte Nebenwirkung verkürzt, (2) das Unterlassen oder Beenden einer lebenserhaltenden medizinischen Maßnahme, wenn dies dem Willen des Patienten entspricht.“ (ebd., S. 50)
0.2.1.2 Enquete-Kommission des Bundestages (13.09.2004)
Der Bundestag rief eine Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ ins Leben. Sie setzte sich zusammen aus Abgeordneten und Sachverständigen der Parteien SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP. Angesichts der bestehenden Rechtsunsicherheit legte die Kommission im September 2004 einen Zwischenbericht vor (Deutscher Bundestag, 2004). Abschließend stellt die Kommission darin Regulierungsvorschläge und die sich daraus ergebenden anstehenden Fragen und Möglichkeiten für den Gesetzgeber vor.
„Die Enquete-Kommission empfiehlt dem Deutschen Bundestag, im Rahmen einer gesetzlichen Regelung die Gültigkeit von Patientenverfügungen, die einen Behandlungsabbruch oder -verzicht vorsehen, der zum Tode führen würde, auf Fallkonstellationen zu beschränken, in denen das Grundleiden irreversibel ist und trotz medizinischer Behandlung nach ärztlicher Erkenntnis zum Tode führen wird. Maßnahmen der Basisversorgung können durch Patientenverfügungen nicht ausgeschlossen werden“. (ebd., S. 38)
Es wird vorgeschlagen, Mindestvoraussetzungen in einem sog. Anforderungskatalog an die Bürger zu verteilen, mit einer Anleitung für die Erstellung, Aktualisierung, Hinterlegung und Registrierung. Die Patientenverfügung soll schriftlich niedergelegt sein und muss Unterschrift und Datum enthalten. Die Kommission empfiehlt, den Hinweis auf die Existenz einer Patientenverfügung in die elektronische Gesundheitskarte einzuspeichern. Außerdem soll bei Aufnahmen in Altenheimen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und ärztlichen Behandlungen nach einer evtl. vorhandenen Patientenverfügung gefragt werden. Es wird empfohlen,
„durch eine gesetzliche Regelung sicherzustellen, dass der Betreuer/Bevollmächtigte durch ein Konzil beraten wird, wenn es um die Verweigerung der Aufnahme oder Fortsetzung einer medizinisch indizierten lebenserhaltenden Maßnahme geht. Dem Konzil sollen angehören: der beratende Arzt, der rechtliche Vertreter, ein Mitglied des Pflegeteams und ein Angehöriger. Die Beratung soll in einem gemeinsamen Gespräch stattfinden und in der Patientenakte dokumentiert werden. Darüber hinaus geht die Enquete-Kommission davon aus, dass zur Interpretation einer Patientenverfügung das Konzil regelhaft beratend eingeschaltet wird.“ (ebd., S. 43)
Einen Schwerpunkt setzt die Kommission bei der Genehmigungspflicht des Vormundschaftsgerichts. Dies soll grundsätzlich bei Einwilligungsablehnung des Betreuers oder des Bevollmächtigten in eine medizinisch indizierte lebenserhaltende Maßnahme eingeschaltet werden. Das Vormundschaftsgericht soll prüfen, ob die Beratung durch o.g. Konzil durchgeführt wurde, ob die Entscheidung des Betreuers dem Willen des Betreuten entspricht und die weiteren objektiven Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Entscheidung gegeben sind. Zusätzlich empfiehlt die Enquete-Kommission „eine Regelung einzuführen, die klarstellt, dass ein Betreuer nach § 1896 Abs. 1 BGB zu bestellen ist, wenn eine Willensäußerung umgesetzt werde soll, in welcher auf medizinisch indizierte lebenserhaltende Maßnahmen verzichtet werden soll.“ (ebd., S. 44)
Die Kommission schlägt abschließend vor, eine Verpflichtung zum Verfassen einer Patientenverfügung gesetzlich abzuwenden. Dies wird bei Aufnahme in Krankenhäusern oder Pflegeheimen teilweise verlangt und sei rechtlich zu unterbinden.
0.2.1.3 Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz (23.04.2004)
Die Bioethik-Kommission des Landes Rheinland-Pfalz wurde erstmals 1985 vom Landesjustizministerium einberufen. Mitglieder sind Sacherständige aus den unterschiedlichenBereichen von Medizin, Justiz und Ethik, Mitglieder aus den Ressorts der Landesregierung und Sachverständige zu den Einzelthemen sowie VertreterInnen der beiden großen Kirchen, der Gewerkschaft und der Industrie. Ihre Aufgabe ist die Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen aus ethischer, sozialer, rechtlicher und wirtschaftlicher Perspektive.
In ihrem Endbericht vom April 2004 (Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz) äußert sich die Ethik-Kommission dezidiert zur Patientenverfügung. Auch sie fordert im Zusammenhang mit der Patientenverfügung eine klare gesetzliche Regelung zur aktiven, passiven und indirekten Sterbehilfe. Nicht unter Strafe gestellt werden sollten solche Handlungen, die für den Betroffenen einen unerträglichen Leidenszustand beenden, der durch andere Maßnahmen nicht behoben oder gelindert werden kann. Der bestehende § 214 zu Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen sollte daher nach Ansicht der Kommission geändert werden (vgl. ebd., S. 129f.) und sowohl Arzt als auch Betreuer bei entsprechenden Handlungen von Schuld freisprechen. Die Kommission fordert ausdrücklich dazu auf, zusätzlich zu den vorgeschlagenen Gesetzen den Passus, dass die Zulässigkeit der dort genannten Maßnamen nicht davon abhängt, ob das Grundleiden des Patienten einen irreversiblen tödlichen Verlauf angenommen hat (ebd., S. 130).
In ihrer letzten Empfehlung spricht sich die Bioethik-Kommission für eine Ergänzung des § 1904 BGB aus. Es soll klar gestellt werden, dass „Gesundheitsbevollmächtigte, BetreuuerInnen und Vormundschaftsgerichte bei Vorliegen einer rechtswirksamen Patientenverfügung an diese Willensäußerung gebunden sind.“ (ebd., S. 142)
0.2.1.4 Vergleich der drei Kommissions-Empfehlungen
Einigkeit besteht bei allen drei Kommissionen darin, dass eine Patientenverfügung jederzeit widerrufen werden kann. Alle drei Kommissionen sprechen sich für eine Koppelung der Patientenverfügung mit einer Vorsorgevollmacht oder einer Betreuungsverfügung aus. Ebenfalls gleiche Meinung besteht darin, dass Bevollmächtigter und Vollmachtgeber sich intensiv über den Inhalt und die Tragweite der Patientenverfügung austauschen und besprechen sollten.
Eine Hinterlegung der Patientenverfügung verlangt lediglich die Enquete-Kommission, was die beiden anderen Kommissionen nur empfehlen, aber nicht zur Voraussetzung machen. Die Enquete-Kommission empfiehlt, Vordrucke zu hinterlegen und die verschiedenen Hinterlegungs- und Registrierungsarten bekannt zu machen. Die Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums jedoch spricht sich konkret gegen eine Hinterlegung aus.
Die ersten gravierenden Unterschiede in den Empfehlungen zeigen sich bei der Regelung der Reichweite der Patientenverfügung: Während die Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums und die Bioethik-Kommission die Gültigkeit nicht auf Patienten beschränken wollen, deren Leiden einen irreversibel tödlichen Verlauf angenommen hat, fordert die Enquete-Kommission, diese Beschränkung festzulegen.
Lediglich von der Ethik-Kommission wird hier eine gesetzliche Änderung bzw. Klarstellung bezüglich der Garentenpflicht bei Selbsttötung gefordert. Sie sollte dann nicht bestehen, wenn ein Suizidversuch nach ernsthafter Überlegung und auf Grund freier Willensbestimmung zur Beendigung schweren unheilbaren Leiden begangen wird. Die Nichthinderung eines Suizids soll daher straffrei gestellt werden. Strafbar solle die Mitwirkung bei einem Suizid aber dann bleiben, wenn sie nicht zur Minderung von Leiden, sondern „aus Gewinnsucht“ (Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz, S. 133) erfolge.
Zur Beratung bezüglich der Patientenverfügung äußern sich die drei Kommissionen unterstschiedlich. Die Bioethik-Kommission fordert als Bindungsvoraussetzung für die Patientenverfügung eine eingehende Aufklärung über die Folgen (Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz, S. 42) und will damit „längere Reflexionsprozesse“ beim Betroffenen erreichen, damit er sich „seiner individuellen medizinischen Situation und deren vorhersehbaren Entwicklung sowie auch seiner individuellen Präferenzen und Wünsche klar“ wird (ebd., S. 139). Die Arbeitsgruppe des Bundesjustizministeriums hingegen empfiehlt als Voraussetzung der Verbindlichkeit, dass eine ärztliche oder auch nichtärztliche spezialisierte Einrichtung „die Beratung dokumentieren und die Einwilligungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Abfassung in der Patientenverfügung“ (BMJ, 2004b, S. 17-19) zu bestätigen habe. Auch die Enquete-Kommission des Bundestages regt ein „qualifizierten Aufklärungs- und Beratungsgespräch“ an. Hierzu seien „qualifizierte Berater aus den Bereichen Medizin, Rechtspflege, Psychologie, Pflege, Hospiz und Seelsorge geeignet“ (Deutscher Bundestag, S. 2004, S. 41).
0.2.2 Stellungnahmen der Kirchen
0.2.2.1 Die Kammer für Öffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche
Im Herbst 2004 beauftragte der Rat der evangelischen Kirche in Deutschland die Kammer für Öffentliche Verantwortung damit, einen Beitrag zur aktuellen Diskussion um die Patientenverfügung auszuarbeiten. Ziel dabei war, „den Menschen zum Gespräch über das Sterben und über erwünschte und unerwünschte Schritte im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung anzuregen“ (EKD, 2004, S. 3). Die Stellungnahme stellt allgemeine Grundsätze und Haltungen aus evangelischer Sicht dar und geht nicht auf die rechtlichen Details der Regelungen ein.
Der Kirchenrat empfiehlt eine schriftliche oder anders dokumentierte Form (Ton- oder Videoaufnahme) (ebd., S. 6). Die Reichweite der Patientenverfügung wird über die Sterbephase hinaus ausgedehnt gesehen. Vier ethische Regeln werden aufgeführt, nach denen aus evangelischer Sicht im Sinne und zum Wohle des Patienten mit Patientenverfügungen verfahren werden sollte (ebd., S. 8):
„1. Wenn es nach medizinischer Einschätzung therapeutische Möglichkeiten gibt, die dem Patienten neue Lebensperspektiven eröffnen, dann kann sein vorgreifend geäußerter oder in einer Verfügung hinterlegter Sterbewunsch nicht maßgebend sein, und es ist alles zu tun, um sein Leben zu erhalten.“
2. Wenn aufgrund von vorhandenen medizinischen Möglichkeiten gute Aussichten bestehen, dass der Patient das Bewusstsein und die Urteilsfähigkeit wiedererlangen und dann selbst Entscheidungen treffen kann, die sein Leben oder Sterben betreffen, dann sollten die medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
3. Patientenverfügungen, die im Blick auf Krankheitszustände formuliert sind, bei denen der Patient zwar urteilsunfähig ist, aber Wünsche, Bedürfnisse und einen Lebenswillen haben und – wenn auch mit Einschränkungen – am sozialen Leben teilhaben kann, können nur unter Einschränkungen für den Arzt handlungsleitend sein.
4. In Fällen, in denen der Patient ohne Bewusstsein ist und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trotz Ausschöpfung aller medizinischen Möglichkeiten das Bewusstsein niemals wiedererlangen wird, ist gemäß dem voraus verfügten Willen des Patienten zu handeln, was auch heißen kann, dass man auf therapeutische Interventionen verzichtet und sterben lässt.“
Die Erteilung einer Vorsorgevollmacht wird explizit befürwortet, da ihr eher als einem gerichtlich bestimmten Betreuer zugetraut wird, aufgrund des entgegengebrachten Vertrauens eine Entscheidung im Sinne und zum Wohle des Patienten fällen zu können. Eine große Rolle spielt in der Diskussion der Gegensatz zwischen der Selbstbestimmung des Patienten und der Fürsorge für den Patienten: Aus evangelischer Sicht ist die Selbstbestimmung aus einer falsch verstandenen Opposition zum Gebot der Fürsorge zu befreien. Es gehöre „zu recht verstandener Fürsorge, die Selbstbestimmung eines Patienten zu achten und ihr so weit wie möglich Folge zu leisten. Der Respekt vor der Selbstbestimmung ist, so gesehen, geradezu eine Implikation der Fürsorge.“ (ebd., S. 17)
0.2.2.2 Der Katholikenrat im Bistum Speyer (11.03.2006)
Im März 2006 veröffentlichte der Katholikenrat im Bistum Speyer eine Stellungnahme zur Patientenverfügung (Katholikenrat, 2006). Zugrunde liegt die christliche Überzeugung, dass es keinen moralischen Zwang zu einer künstlichen Lebensverlängerung um jeden Preis geben könne.
Die vom Betroffenen derart formulierte Handlungsanweisung hält der Katholikenrat für „ Momentaufnahmen “ (ebd., S. 1) und gibt zu bedenken, dass dieser Wille evtl. zum Zeitpunkt der Anwendung überholt sei. Daher dürfe die Patientenverfügung keine rechtlich bindende Wirkung haben, sondern lediglich den Charakter einer Empfehlung (ebd., S. 3).
Der Rat hält es für problematisch, mit dem Verfassen einer Patientenverfügung dritte Personen (Ärzte, Pflegekräfte und Angehörige) einzubinden und möglicherweise zu Handlungen oder Unterlassungen zu verpflichten, die sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren könnten (ebd., S. 2). Es wird als sinnvoll erachtet, hier das persönliche Gespräch über dieses Thema zu suchen und eine Vertrauensperson zu benennen.
Des weiteren macht der Katholikenrat auf die Gefahr aufmerksam, dass in Zeiten steigender Kosten im Gesundheitswesen eine Patientenverfügung zum Vorwand genommen werden könne, auf aufwändige Therapiemaßnahmen zu verzichten.
Der Katholikenrat betont, dass die aktive Sterbehilfe uneingeschränkt abgelehnt wird. Die passive Sterbehilfe, beispielsweise der Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen, ist grundsätzlich nur zulässig, wenn
1. „das Grundleiden des Kranken nach ärztlicher Überzeugung unumkehrbar ist;
2. dieses Grundleiden einen tödlichen Verlauf angenommen hat und insbesondere;
3. der Tod in kurzer Zeit eintreten wird.“ (ebd., S. 3)
Als Forderungen werden unter anderem ein menschenwürdiger Umgang mit Schwerkranken und Sterbenden genannt. Politik und Gesellschaft seien aufgefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Dazu gehören insbesondere die verbesserte Ausbildung von Ärzten und Pflegepersonal sowie eine entsprechende personelle Ausstattung, die Weiterentwicklung von Schmerztherapie und der Palliativmedizin sowie der Ausbau des Hospizwesens.
0.2.3 Stellungnahme des Nationalen Ethikrates
Im Juni 2005 veröffentlichte der Nationale Ethikrat eine Stellungnahme zum Umgang mit Patientenverfügungen (Nationaler Ethikrat, 2005). Die Empfehlungen sind als Teil einer umfassenden Stellungnahme zu ethischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der Realität der Sterbebegleitung zu verstehen.
Vor allem betont der Rat, die Diskussionen um die Patientenverfügung dürfe nicht dazu führen, das Verbot der aktiven Sterbehilfe in Frage zu stellen. Es wird empfohlen, die Voraussetzungen und die Reichweite der Patientenverfügung gesetzlich zu regeln. Zugleich sollen palliativmedizinische, schmerztherapeutische, pflegerische und psychosoziale Unterstützungsangebote fortgesetzt und verstärkt werden. Zusätzlich zu den Regelungen im BGB sollen ergänzende Gesetze im Strafrecht eine größere Sicherheit und eine hinreichende Abgrenzung zur aktiven Sterbehilfe geschaffen werden.
Der Ethikrat ist der Auffassung, dass eine Patientenverfügung per Gesetz für Arzt und Pflegepersonal verbindlich sein soll. Die Reichweite und Verbindlichkeit der Patientenverfügung soll nicht auf bestimmte Phasen der Erkrankung beschränkt werden. Es wird empfohlen, die Kompetenzen von Betreuern oder Bevollmächtigten gesetzlich zu präzisieren. Diese haben die festgelegten Behandlungsmodalitäten gegenüber den Ärzten, Pflegekräften sowie ggf. gegenüber den Angehörigen zur Geltung zu bringen. Weiterhin wird empfohlen, „dass eine Patientenverfügung, mit der der Patient erkennbar und hinreichend konkret eine eigene Entscheidung für die anstehende Situation getroffen hat, für den Betreuer oder Bevollmächtigten verbindlich ist, selbst dann, wenn aus deren Sicht diese Entscheidung nicht dem Wohl des Patienten entspricht.“ (ebd., S. 31f.) Das Vormundschaftsgericht soll nur eingeschaltet werden, wenn Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Verwendung der Patientenverfügung durch den Bevollmächtigen oder den Betreuer bestehen und wenn es bei der Auslegung und Anerkennung des Patientenwillens zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Betreuer, Arzt, Pflegekraft oder Angehörigen kommt.
Beim Betreuer sollte für alle Entscheidungen, die mit der Gefahr des Todes oder eines schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schadens verbunden sind, die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts einholen müssen. Beim Bevollmächtigten hingegen sollte sich die Entscheidungsbefugnis aus der in der Vollmacht eröffneten Entscheidungsspielräumen ergeben. Hier sollte das Vormundschaftsgericht nur eingeschaltet werden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese Spielräume überschritten werden (ebd., S. 32).
Die Gültigkeit einer Patientenverfügung sollte von der Schriftform oder einer vergleichbar verlässlichen Dokumentation (Video) anhängig gemacht werden. Alle anderen Äußerungen sollten bei der Ermittlung des mutmaßlichen Willens berücksichtigt werden. Nicht abhängig von der Gültigkeit soll eine vorausgegangene fachliche Beratung sein (ebd., S. 33). Die Mehrheit des Ethikrates spricht sich gegen eine Abhängigkeit der Gültigkeit von vorgegebenen Fristen oder von wiederholter Bestätigung aus.
Der Gesetzgeber wird aufgefordert, bei Anzeichen von Lebenswillen eines Entscheidungsunfähigen (z.B. Demenzerkrankten) die Bindungswirkung einer behandlungsablehnenden Patientenverfügung aufzuheben. Ausnahmen sollen nur gelten, wenn
a. „die medizinische Entscheidungssituation hinreichend konkret in der Patientenverfügung beschrieben ist;
b. die Patientenverfügung auf die genannten Anzeichen von Lebenswillen Bezug nimmt und deren Entscheidungserheblichkeit ausschließt;
c. die Patientenverfügung schriftlich abgefasst oder in vergleichbarere Weise verlässlich dokumentiert und
d. dem Abfassen der Patientenverfügung eine geeignete Beratung vorausgegangen ist.“ (ebd., S. 34)
0.3 Der schwerkranke Mensch und die Institution
„Denn der Arzt muss dafür sorgen, dass das Heilbare nicht unheilbar werde; er muss wissen, wie man die Entwicklung zur Unheilbarkeit verhindern kann. Im Unheilbaren aber muss er sich auskennen, damit er nicht nutzlos quäle.“ (Hippokrates)
Die Arzt-Patienten-Beziehung war über viele Jahrtausende von eher magischreligiösen Handlungsmustern geprägt. In der hippokratischen Schule der klassischen griechischen Kultur bildeten sich Ansätze einer Berufsethik der Ärzte als eine zentrale Profession von Heilern aus. Die Entstehung einer Expertendominanz und des damit einhergehenden Professionalisierungsprozesses bestimmt die heutige Beziehung.
„Industrialisierung, zunehmende Medikadisierung der Gesellschaft und Institutionalisierung eines sozialstaatlich orientierten Krankenversicherungssystems führten dazu, dass der Ärzteschaft gleichsam ein staatlich sanktioniertes Definitionsmonopol über Krankheit bzw. Gesundheit zuwuchs. Eine solche Experten-, Definitionsund Steuerungsmacht bewirkt zugleich, dass die Arzt-Patienten-Beziehung strukturell eine asymmetrische ist. Diese Asymmetrie nimmt zu – die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Patienten nimmt ab –, je instrumentell-technischer ärztliches Handeln wird.“ (Höfling & Lang, 1999, S. 17)
Diese Asymmetrie soll im Folgenden aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden. Einen ersten Zugang bieten Andreas Hanses und Peter Ahleit, die die historisch gewordene „Singularität“ des Verhältnisses von Arzt und Patient hervorheben. Als zweite wesentliche Perspektive bietet sich die Machttheorie Michel Foucaults, mit ihrem expliziten Fokus auf die im Krankenhausbetrieb herrschenden Machtstrukturen.
0.3.1 Die „singuläre“ Interaktion zwischen Arzt und Patient
Andreas Hanses und Peter Ahleit (2004) beschreiben mit Blick auf die Historie der Medizin sehr anschaulich, wie sie als eine der ältesten Professionen mit einer expliziten Tradition der Institutionalisierung die Asymmetrie im Verhältnis von Arzt zu Patient bekräftigt. Einerseits konnte sich die Medizin nur aufgrund der Errichtung von Kliniken und Hospitälern etablieren, andererseits ist die Entstehung der ärztlichen Praxis ohne die Disziplin der Medizin nicht vorstellbar: „Die Medizin ist zweifellos als eine der ‚harten’ Professionen zu beschreiben, die auf einen hohen Grad an Institutionalisierungen im professionellen Alltag zurückgreifen können.“ (ebd., S. 13) Die Autoren differenzieren zwischen den Ebenen der Medizin als Wissensorganisation, als professionelle Praxis und als Interaktionsordnung.
Die Medizin als Wissensorganisation: Die Praxis der Medizin kann auf die alte Metapher der „Heilung“ zurückblicken. Dieses Grundmuster ärztlicher Praxis setzt ein Leiden eines Menschen voraus, dem von einer als „Heiler“ anerkannten Person geholfen wird. Das Praxiswissen der Medizin ist stark durch wissenschaftliches Wissen gekennzeichnet und hat die so genannte „Expertenmacht“ zum Ergebnis. Mit der naturwissenschaftlichen Medizin und dem biomedizinischen Paradigma ergibt sich ein spezifisches Bild von Krankheit und dem kranken Körper.
„In diesem künstlichen Definitionsprozess wird Krankheit dekontextualisiert, die soziale und biographische Einbettung leiblicher ‚Störungen’ negiert und der kranke Mensch zum Träger eines defekten und dysfunktionalen Körpers. Dies hat weitreichende Implikationen für die professionelle Praxis der Medizin. Die Krankheit kann vom Menschen ‚abgespalten’ werden. Die professionelle ‚Kunst’ liegt in der Bearbeitung des kranken Körpers und professionelle Begegnungen mit dem Kranken reduzieren sich im Wesentlichen auf die Erfassung und Behandlung der Krankheit.“ (ebd., 2004, S. 13)
Mit dieser Einstellung kann der Arzt eine distanzierte Haltung gegenüber der Krankheit und dem Kranken einnehmen. Gleichzeitig bestimmt der Arzt die Krankheit, was er unter dem Aspekt der „Expertenmacht“ tut, ohne jedoch die Aussage des Kranken zu berücksichtigen. Letztlich werden Krankheiten durch die eigenen Wissensanordnungen „erzeugt“. Die Diagnose entwickelt sich als eine zentrale Strategie und trägt hauptsächlich zur Etablierung der Profession bei, womit sie zugleich eine Machtposition gegenüber anderen Professionen und vor allem gegenüber den Patienten bedingt.
Die Medizin als professionelle Praxis in Institutionen: Die professionelle Praxis in der Medizin ist an klar strukturierte und institutionelle Rahmen gebunden. Dies gilt vor allem für Krankenhäuser, jedoch auch für ambulante Arztpraxen. Dazu trägt bei, dass Patienten allein schon von den „Rahmenbedingungen“ an klare Vorgaben gebunden sind, indem sie sich an Vorgaben wie Wartezeiten, Praxiszeiten etc. zu halten haben. Aufgabe der Professionellen ist es, beim Patienten eine Übernahme der institutionellen Definition von Krankheit zu übernehmen. Darin liegt der Erfolg medizinischer Institutionen. Damit muss die Interaktion ärztlichen Handelns in den Blick genommen werden.
Die Medizin als Interaktionsordnung in ärztlicher Praxis: Viele Studien belegen, dass die Kommunikation zwischen Arzt und Patient durchaus zu wüschen übrig lässt. Der unterschiedliche Sprachgebrauch und die damit verbundenen Hierarchisierungen und Missverständnisse sind jedoch nur ein Teil des Problems. Hier handelt es sich um einen komplexen sozialen Prozess, in dem wichtige Vorstrukturierungen und die Implantation von Machtverhältnissen geleistet werden.
„Die zumeist ‚singuläre’ Interaktion des kranken Menschen mit dem Arzt, gegebenenfalls mit einer Gruppe von Professionellen bei der Visite, die latente Unterstellung an den Gesundheitswunsch des Patienten, die Positionierung der Ärzte als Krankheits-Experten und die Strukturierung durch klassische Frage-Antwort-Situationen machen die Vorstrukturiertheit der Interaktionen aus.“ (ebd., 2004, S. 15)
0.3.2 Foucault und die Macht zwischen Arzt und Patient
Aufgrund der bereits geschilderten Asymmetrie der Arzt-Patienten-Beziehung drängt sich förmlich die Frage nach den Machtstrukturen in diesem Verhältnis auf. Trotz aller Forderungen in der Moderne ist noch keine deutliche Trendwende in diesem Gefälle zu erkennen. Der Arzt verfügt „von Natur aus“ über mehr Macht. Diese wird weitgehend geleugnet und abgelehnt. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Macht in diesem Kontext ignoriert und somit jeglicher Kritik entzogen und unkontrollierbar wird . „Die offensichtlichste Seite des Machtgefälles betrifft das Wissen des Experten. Die Kenntnisse des Arztes über bestimmte, was weitere Leben des Kranken betreffende Informationen, muss eindeutig als Machtfaktor angesehen werden.“ (Giese, 2002, S. 85)
[...]
[1] Man liest jedoch auch von „Patiententestament“, „Patientenvorausverfügung“ oder ähnlichen Begriffen. Das Wort „Patiententestament“ stiftet jedoch insofern Verwirrung, als ein Testament erst nach dem Tod zur Wirkung kommt, was den eigentlichen Sinn einer solchen Verfügung deutlich verfehlt.
[2] Für die nachfolgenden Ausführungen verweise ich vor allem auf Putz & Steldinger (2004, S. 149- 155) und Vetter (2005, S. 47-54) sowie die Grundsätze der Sterbebegleitung der Bundesärztekammer.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836624749
- DOI
- 10.3239/9783836624749
- Dateigröße
- 702 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Ludwigshafen am Rhein – Soziale Arbeit
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Januar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- patientenverfügung sterbehilfe patientenautonomie soziale arbeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de