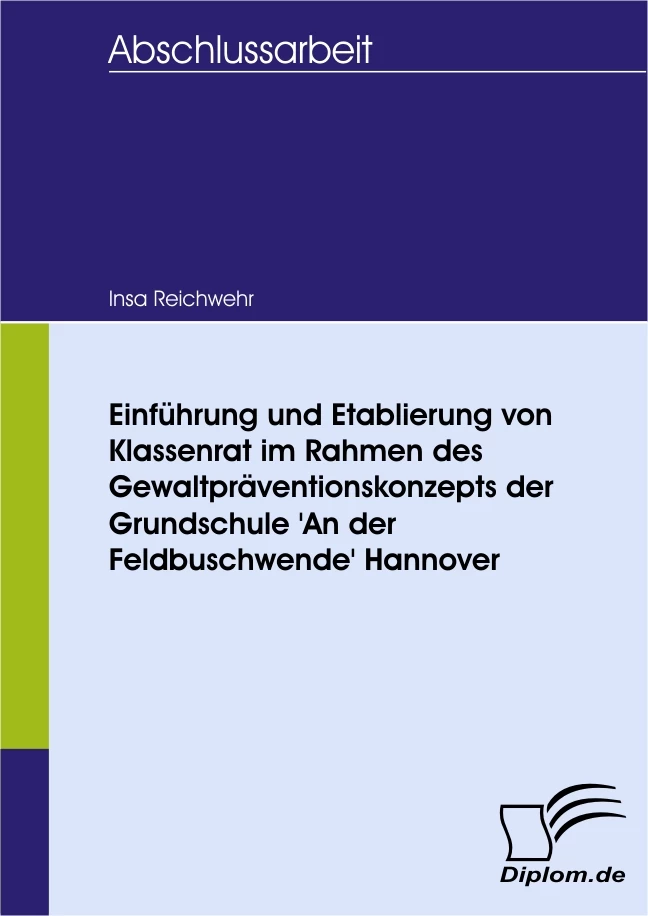Einführung und Etablierung von Klassenrat im Rahmen des Gewaltpräventionskonzepts der Grundschule 'An der Feldbuschwende' Hannover
©2008
Wissenschaftliche Studie
60 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Im Zuge der Vorbereitungen auf die Weltausstellung Expo 2000 mit dem Motto Mensch - Natur - Technik wurden das in der Nähe des Messe-Gelände liegende Expo-Gelände und das Naherholungsgebiet Kronsberg nach erwähntem Motto geplant und schrittweise erbaut. Kommunalpolitisch betrachtet gehört der heute zu weiten Teilen bebaute Kronsberg zum Stadtteil Bemerode.
Für die dort vorgesehenen Schulen (Grund- und Integrierte Gesamtschule) bestanden Planungsgruppen. Mit Beginn der konkreten baulichen Planung 1996 begann für die Grundschule Kronsberg Nord - so der damalige, vorläufige Arbeitstitel - die pädagogische Planung.
Die Grundschule startete im Schuljahr ´98/´99 mit fünf Kindern der zweiten und dritten Klasse und zwei Lehrerinnen aus der Planungsgruppe im Schulzentrum Bemerode. Im April ´99 erfolgte der Umzug in das fertig gestellte GS-Gebäude mit ca. 80 Kindern. Im Schuljahr ´00/´01 eröffnete der Schulkindergarten, gleichzeitig stieg die Schülerzahl enorm an (auf ca. 360 Kinder), so dass die Schule seitdem in zwei Jahrgängen fünf- und in zwei Jahrgängen vierzügig ist. Da die GS An der Feldbuschwende nach wie vor in einem kinderfreundlichen und -reichen Zuzugsgebiet liegt, besuchen heute etwa 450 Kinder aus ca. 25 Nationen die Grundschule An der Feldbuschwende.
Durch die skizzierte Situation ergeben sich für die Grundschule An der Feldbuschwende vielfältige Beratungsanlässe:
Durch die städtebauliche Entwicklung am Kronsberg für nun rund 6500 Bewohnerinnen und Bewohner ist die Bevölkerung des Stadtteils Bemerode insgesamt von rund 10.000 (1995) auf rund 15.500 (Ende 2000) angestiegen. Abgesehen von einer regulären Fluktuation wie in jedem hannoverschen Stadtteil gilt der Zuzug von etwa 5500 Menschen als besonders; denn kaum jemand besagter Personen war hier heimisch oder hatte seine Wurzeln in diesem Stadtteil.
Während in Bemerode soziale und kulturelle Infrastrukturen über Generationen und Jahrzehnte entstehen konnten, musste dieses auf dem Kronsberg erst entwickelt werden. Deren Ziel war sowohl baulich-räumlich als auch inhaltlich und organisatorisch ein integratives Konzept der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu entwickeln und umzusetzen Entstanden ist ein System mit den Themenschwerpunkten Soziale Stadtteilarbeit, Stadtteilkulturarbeit, Ökologische Stadtteilarbeit, Kinder- und Jungendarbeit, Familienarbeit und -bildung, Seniorenarbeit und Stadtteilbibliothek.. Zwar erwähnt der Sozialbericht, dass es […]
Im Zuge der Vorbereitungen auf die Weltausstellung Expo 2000 mit dem Motto Mensch - Natur - Technik wurden das in der Nähe des Messe-Gelände liegende Expo-Gelände und das Naherholungsgebiet Kronsberg nach erwähntem Motto geplant und schrittweise erbaut. Kommunalpolitisch betrachtet gehört der heute zu weiten Teilen bebaute Kronsberg zum Stadtteil Bemerode.
Für die dort vorgesehenen Schulen (Grund- und Integrierte Gesamtschule) bestanden Planungsgruppen. Mit Beginn der konkreten baulichen Planung 1996 begann für die Grundschule Kronsberg Nord - so der damalige, vorläufige Arbeitstitel - die pädagogische Planung.
Die Grundschule startete im Schuljahr ´98/´99 mit fünf Kindern der zweiten und dritten Klasse und zwei Lehrerinnen aus der Planungsgruppe im Schulzentrum Bemerode. Im April ´99 erfolgte der Umzug in das fertig gestellte GS-Gebäude mit ca. 80 Kindern. Im Schuljahr ´00/´01 eröffnete der Schulkindergarten, gleichzeitig stieg die Schülerzahl enorm an (auf ca. 360 Kinder), so dass die Schule seitdem in zwei Jahrgängen fünf- und in zwei Jahrgängen vierzügig ist. Da die GS An der Feldbuschwende nach wie vor in einem kinderfreundlichen und -reichen Zuzugsgebiet liegt, besuchen heute etwa 450 Kinder aus ca. 25 Nationen die Grundschule An der Feldbuschwende.
Durch die skizzierte Situation ergeben sich für die Grundschule An der Feldbuschwende vielfältige Beratungsanlässe:
Durch die städtebauliche Entwicklung am Kronsberg für nun rund 6500 Bewohnerinnen und Bewohner ist die Bevölkerung des Stadtteils Bemerode insgesamt von rund 10.000 (1995) auf rund 15.500 (Ende 2000) angestiegen. Abgesehen von einer regulären Fluktuation wie in jedem hannoverschen Stadtteil gilt der Zuzug von etwa 5500 Menschen als besonders; denn kaum jemand besagter Personen war hier heimisch oder hatte seine Wurzeln in diesem Stadtteil.
Während in Bemerode soziale und kulturelle Infrastrukturen über Generationen und Jahrzehnte entstehen konnten, musste dieses auf dem Kronsberg erst entwickelt werden. Deren Ziel war sowohl baulich-räumlich als auch inhaltlich und organisatorisch ein integratives Konzept der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu entwickeln und umzusetzen Entstanden ist ein System mit den Themenschwerpunkten Soziale Stadtteilarbeit, Stadtteilkulturarbeit, Ökologische Stadtteilarbeit, Kinder- und Jungendarbeit, Familienarbeit und -bildung, Seniorenarbeit und Stadtteilbibliothek.. Zwar erwähnt der Sozialbericht, dass es […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Insa Reichwehr
Einführung und Etablierung von Klassenrat im Rahmen des Gewaltpräventionskonzepts
der Grundschule 'An der Feldbuschwende' Hannover
ISBN: 978-3-8366-2441-1
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Landesschulbehörde, Hannover, Deutschland, Abschlussarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Anstelle eines Vorworts
,,`Es geht alles zurück in die Kindheit da kann man demokratische Partizipationsprozesse am
selbstverständlichsten lernen.´" (zit. n. Schacht, 2008, S. 4, Interview mit Oskar Negt)
,,`Im Kern´, sagt Negt, `geht es um eine Balance zwischen Selbstregulierung der Kinder und
Angeboten der Pädagogen.´" (a. a. O.)
1
Inhaltsverzeichnis der Arbeit
1.
Situation der Schule und meine dortige Tätigkeit als Beratungslehrerin ...
S. 2
2.
Theoretische Überlegungen zum Klassenrat ... S. 4
2.1 Strukturierung des Klassenrats in der Schule ... S. 5
2.2 Rolle der Lehrerin / des Lehrers während des Klassenrats ... S. 6
2.3 Rolle der Beratungslehrerin bei Einführung und Etablierung des Klassenrats ...
S. 7
3.
Konzeption des Klassenrats in der GS An der Feldbuschwende ... S. 7
3.1 Strukturierung des Klassenrats in einer vierten Klasse ...S. 8
3.2 Rolle der Lehrerin während des Klassenrats ... S. 9
3.3 Meine Rolle bei Einführung und Etablierung des Klassenrats ...
S. 10
4.
Darstellung exemplarischer Klassenratstunden ... S. 12
4.1 Erste Stunde ... S. 13
4.2 Zweite Stunde ... S. 15
4.3 Fünfte Stunde ...
S. 16
5.
Abschlussgespräch mit der Klassenlehrerin ...
S. 17
6.
Schlussreflexion und Ausblick ...
S. 18
7.
Literaturverzeichnis ...
S. 20
Schlusserklärung
2
1.
Situation der Schule und meine dortige Tätigkeit als Beratungslehrerin
Im Zuge der Vorbereitungen auf die Weltausstellung Expo 2000 mit dem Motto ,,Mensch
Natur Technik" wurden das in der Nähe des Messe-Gelände liegende Expo-Gelände und das
Naherholungsgebiet Kronsberg nach erwähntem Motto geplant und schrittweise erbaut.
Kommunalpolitisch betrachtet gehört der heute zu weiten Teilen bebaute Kronsberg zum
Stadtteil Bemerode.
Für die dort vorgesehenen Schulen (Grund- und Integrierte Gesamtschule) bestanden
Planungsgruppen. Mit Beginn der konkreten baulichen Planung 1996 begann für die
,,Grundschule Kronsberg Nord" - so der damalige, vorläufige Arbeitstitel - die pädagogische
Planung.
Die Grundschule startete im Schuljahr ´98/´99 mit fünf Kindern der zweiten und dritten Klasse
und zwei Lehrerinnen aus der Planungsgruppe im Schulzentrum Bemerode. Im April ´99 erfolgte
der Umzug in das fertig gestellte GS-Gebäude mit ca. 80 Kindern. Im Schuljahr ´00/´01
eröffnete der Schulkindergarten, gleichzeitig stieg die Schülerzahl enorm an (auf ca. 360
Kinder), so dass die Schule seitdem in zwei Jahrgängen fünf- und in zwei Jahrgängen vierzügig
ist. Da die GS An der Feldbuschwende nach wie vor in einem kinderfreundlichen und -reichen
Zuzugsgebiet liegt (vgl. Landeshauptstadt Hannover, 2002, S. 17), besuchen heute etwa 450
Kinder aus ca. 25 Nationen die Grundschule An der Feldbuschwende
1
.
Durch die skizzierte Situation ergeben sich für die Grundschule An der Feldbuschwende
vielfältige Beratungsanlässe:
Durch ,,die städtebauliche Entwicklung am Kronsberg für nun rund 6500 Bewohnerinnen und
Bewohner" (Landeshauptstadt Hannover, Sozialbericht 2002, S. 104) ist die Bevölkerung des
Stadtteils Bemerode insgesamt von rund 10.000 (1995) auf rund 15.500 (Ende 2000)
angestiegen. Abgesehen von einer regulären Fluktuation wie in jedem hannoverschen
Stadtteil gilt der Zuzug von etwa 5500 Menschen als besonders; denn kaum jemand besagter
Personen war hier heimisch oder hatte seine Wurzeln in diesem Stadtteil.
Während in Bemerode soziale und kulturelle Infrastrukturen über Generationen und
Jahrzehnte entstehen konnten, musste dieses auf dem Kronsberg erst entwickelt werden.
1
Zwar liegen jüngere Sozialberichte Hannovers im Internet unter www.hannover.de von 2003 bis 2006 ebenfalls
vor, doch weisen diese keine nach Stadtteilen detaillierten Statistiken mehr auf (Berichte, Tabellen und Karten), was
mit der im Jahre 2002 gegründeten Region Hannover zusammen hängt. Somit finden sich dort Statistiken der
Region im Vergleich zur Stadt und Statistiken der Stadt aufgeteilt nach sog. Stadtbezirken. Der Stadtteil Bemerode
samt Kronsberg findet Erwähnung unter ,,Stadtbezirk 06 Kirchrode, Bemerode Wülferode", während der
Sozialbericht 2002 als kleinste Betrachtungseinheit noch die Ebene der Stadtteile zur Analyse heranzieht. Unsere
Schülerschaft setzt sich zum sehr überwiegenden Teil aus Kindern des Neubaugebiets Kronsberg und wenigen
Kindern aus Bemerode zusammen (abgesehen von einzelnen Schülerinnen und Schülern mit behördlicher
Ausnahmegenehmigung). Zudem lassen sich einige erwähnter Sozialberichte nicht einsehen oder aus dem Internet
,,herunterladen". Der Sozialbericht von 2008, der Daten so erfasst wie der Sozialbericht 2002, lag zur Vorbereitung
des Kapitels dieser Arbeit noch nicht vor. Ein kurzer Vergleich beider Berichte zeigt aber ebenfalls das, was hier
beschrieben wird.
3
Deren Ziel war ,,sowohl baulich-räumlich als auch inhaltlich und organisatorisch ein
integratives Konzept der sozialen und kulturellen Infrastruktur zu entwickeln und umzusetzen
[...]. Entstanden ist ein System [...] mit den Themenschwerpunkten Soziale Stadtteilarbeit,
Stadtteilkulturarbeit, Ökologische Stadtteilarbeit, Kinder- und Jungendarbeit, Familienarbeit
und -bildung, Seniorenarbeit und Stadtteilbibliothek." (a. a. O., S. 105f). Zwar erwähnt der
Sozialbericht, dass es noch einige Jahre erforderlich sein werde, ,,die Entwicklung am
Kronsberg weiter intensiv zu beobachten und zu begleiten" (a. a. O., S. 106); dennoch
bestehen einige der erwähnten Einrichtungen z. T. schon seit Jahren nicht mehr (Beispiele:
Kronsberg Umwelt Kommunikationsagentur = kuka, Hermannsdörfer Landwerkstätten,
Kronsberg Umwelt Bildungsinitiative = kubi).
Von den etwa 6500 Menschen, die 2002 auf dem Kronsberg lebten, waren rund 27 % Kinder
und Jugendliche, was weit über dem städtischen Durchschnitt (15 %) lag.
Der Anteil nichtdeutscher Bewohnerinnen und Bewohner betrug zum selben Zeitpunkt rund
18 % (leicht überdurchschnittlich im Vergleich zum städtischen Durchschnitt: 15 %), der
Anteil der Aussiedlerinnen und Aussiedler lag bei rund 12 % (hoch im Vergleich zum
städtischen Durchschnitt: 4 %).
Hilfe zum Lebensunterhalt erhielten im Stadtteil Bemerode rund 8 % der Menschen (leicht
überdurchschnittlich im Vergleich zum städtischen Durchschnitt: 7 %). Allerdings waren
hiervon nichtdeutsche Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit rund 40 %
überdurchschnittlich oft betroffen (im Vergleich zum städtischen Durchschnitt von 31 %).
Die aktuelle Anzahl der Kinder im Schuljahr ´07/´08 beträgt 454. Davon haben 16 % keine
deutsche
Staatsbürgerschaft
und
19
%
eine
doppelte
Staatsbürgerschaft
(Spätaussiedler/innen).
Durch die erwähnten Bedingungen gestaltet sich das Schulleben sehr lebendig, was nicht immer
konfliktfrei und harmonisch verläuft. So setzen sich die Lehrkräfte in Elterngesprächen immer
wieder damit auseinander, dass es die unterschiedlichsten, sozial oder kulturell-ethnisch
bedingten Auffassungen darüber gibt, auf welche Weise Kinder in einer Gemeinschaft wie der
Schule miteinander leben, lernen und arbeiten und welche Aufgaben die Kinder im Verlaufe von
vier Schuljahren zunehmend in eigener Verantwortung übernehmen können, sollen und müssen
(vgl. Kerncurricula). An dieser Stelle gibt es im Kollegium einen nicht unerheblichen, immer
wieder nachgefragten Beratungs- und Unterstützungsbedarf, zumal der Erlass Die Arbeit in der
Grundschule festlegt: ,,In der Grundschule wird eine altersangemessene Form des
Zusammenlebens und Arbeitens entwickelt. Diese erfordert entsprechende Regeln, die mit der
Akzeptanz unterschiedlicher Lebensformen sowie der Achtung der religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen Anderer einhergeht. [...] Die Schule sorgt für ein positives
4
Klima, [und] nimmt auf den unterschiedlichen Stand sozialer Fähigkeiten [...] Rücksicht."
(Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.), 2005, S. 3)
Aus diesem Blickwinkel heraus betrachtet erscheint es als sehr sinnvoll einen
Beratungsschwerpunkt auf Einführung und Etablierung des Klassenrats, eingebunden in das
Gewaltpräventions- und folglich auch in das Beratungskonzept der GS An der Feldbuschwende
zu legen. Anbahnen, Einführung und Etablierung des Klassenrats eröffnen ab Schuleintritt und
im Verlaufe von vier Grundschuljahren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit ,,sich
anderen Schülerinnen und Schülern gegenüber situationsangemessen, hilfsbereit und
rücksichtsvoll zu verhalten, eigene Wünsche zurückzustellen [...], sich an Ordnungsformen zu
halten, Regeln der Zusammenarbeit [und des Zusammenlebens] zu beachten, aber auch sich
selbst zu behaupten und eigene Standpunkte zu vertreten." (a. a. O.)
2.
Theoretische Überlegungen zum Klassenrat
Der Begriff Klassenrat geht ursprünglich zurück auf den französischen Pädagogen Célestin
Freinet (1896 - 1966). In der Pädagogik Freinets ist der Klassenrat Teil eines umfassenden
Konzepts, das jedoch nicht ohne weiteres für jede Schule passt und / oder übernommen werden
kann. Grundsätzlich wird unter Klassenrat eine Klassenversammlung unter bestimmten
Bedingungen mit speziellen Funktionszuschreibungen verstanden (vgl. Friedrichs, 2004, S.
186f):
Förderung der Gemeinschaft
Moralerziehung durch ,,Gewissenserforschung"
Identifikation der / des Einzelnen mit der Klasse bzw. der Schule
Vermittlung von Verantwortungsbewusstsein
Vermeidung von Disziplinproblemen
Nach Hanna Kiper ist der Klassenrat ,,eine Form, Partizipation zu praktizieren" (Kiper, 1997, S.
1). Durch Partizipation werden Strukturen und Prozesse in der Schule für die Schülerinnen und
Schüler erfahrbar. Es entsteht das Bewusstsein ,,Ich kann mitreden, ich werde gehört, ich
bestimme mit, aber auch: Ich muß mich der Mehrheit beugen und Regeln anerkennen."
(Klünenberg, Poesthorst, 1998, S. 180) Vor diesem Hintergrund ist ,,Partizipation in der
Schulklasse [...] ein wichtiger Schritt zur Hinführung von Kindern und Jugendlichen an Formen
der politischen und gesellschaftlichen [demokratischen] Beteiligung." (Kiper, 1998, S. 120)
Gleichzeitig besitzt der Klassenrat für Schülerinnen und Schüler eine hohe emotionale
Bedeutung. So zitiert Friedrichs aus den Handreichungen der Offenen Schule Kassel-Waldau,
dass der Klassenrat ,,der Klasse als Gruppe, aber auch den einzelnen Individuen die Möglichkeit
5
gibt, Verhalten zu beobachten, zu überprüfen, sich zu verändern und sich weiterzuentwickeln."
(Friedrichs, 2004, S. 59)
2
Im Einzelnen ausgeführt bedeutet das:
der Klassenrat bietet Selbstregulierungsmechanismen
er schützt die Rechte von Minderheiten
er fördert die Integration von Außenseitern und von verhaltensauffälligen Schülerinnen und
Schülern
er verzögert den Umgang mit Aggressionen
er ist ein Steuerungsinstrument und eine Informationsquelle für die Lehrkräfte
Zugeschnitten auf eine Regelschule findet sich eine Definition des Klassenrats bei Blum: ,,Der
Klassenrat ist eine regelmäßig stattfindende Gesprächsrunde, in der sich Schüler und die
Klassenlehrkraft gemeinsam mit konkreten Anliegen der Klassengemeinschaft (z. B. Ausflüge
oder Projekte, Organisationsfragen wie Dienste und Regeln, Probleme und Konflikte)
beschäftigen und dafür möglichst einvernehmliche Lösungen finden." (Blum, 2006, S. 10) Es
werden nach Blum im Klassenrat die Dinge bearbeitet, ,,die alle angehen und die für das
Wohlfühlen von Schülern und Lehrern im Lebensraum Schule Bedeutung haben." (a. a. O.)
Um diese konkreten Schulanliegen im Klassenrat Erfolg versprechend im Sinne des Erarbeitens
einvernehmlicher Lösungen mit allen Beteiligten zu erreichen erscheint es als sehr sinnvoll den
Klassenrat in das Schulkonzept und / oder sogar in spezielle schulinterne Konzepte (wie z. B.
Partizipations-, Kommunikations-, Gewaltpräventions-, Beratungs-konzept etc.) einzubinden.
Außerdem müssen grundsätzliche Vorüberlegungen zur Strukturierung des Klassenrats
insgesamt in der Schule, die Rolle der Lehrerin / des Lehrers während des Klassenrats und die
temporär-prozessuale Begleitung durch die Beratungslehrerin angestellt werden und
Entscheidungen getroffen werden.
2.1
Strukturierung des Klassenrats in der Schule
Wenn der Klassenrat die Funktion von Partizipations-Praxis einer Schulklasse am Schulleben
haben soll und konkrete Klassenangelegenheiten organisiert werden sollen, muss der Klassenrat
regelmäßig ritualisiert durchgeführt werden nur so kann Sicherheit entstehen, dass die Belange
gehört, ernst genommen und besprochen werden.
Über die Häufigkeit von Klassenratsitzungen wurde in einschlägiger Literatur diskutiert.
Favorisiert wird mittlerweile eine Unterrichtsstunde Klassenrat pro Woche am Freitag, wobei
Uneinigkeit darüber besteht, ob diese Stunde freitags in der letzten Schulstunde betreffender
2
Leider werden erwähnte Handreichungen der Offenen Schule Kassel-Waldau nicht mehr neu aufgelegt, und die
letzte Überarbeitung liegt 14 Jahre zurück. Eine aktuelle Anfrage per Email zum Erwerb der Handreichungen ergab,
dass bei Rückfragen zum Klassenrat ein Kollege Auskunft und Hilfestellungen geben würde, aber ein gedrucktes
Exemplar nicht ausgehändigt oder gemailt wird.
6
Klasse liegen muss / sollte oder ob es ebenso gut eine beliebige Freitagsstunde sein könne.
Einigkeit herrscht unter den Autorinnen / Autoren über Regelmäßigkeit und Ritualisierung des
Klassenrats.
Klassenratsitzungen folgen einem ,,transparenten Ritual". Dazu bedarf es einer guten
Vorbereitung:
Klassenratsitzungen finden im Sitzkreis statt, folglich muss geklärt sein oder werden, wie
dieser zu bilden ist
3
.
Grundlegende Gesprächsregeln sollten bekannt sein
4
. In jedem Fall sollten sie für den
Klassenrat gemeinsam wiederholt, evtl. ergänzt, verschriftlicht und im Klassenraum für alle
zugänglich ausgehängt werden.
Was im Klassenrat besprochen werden soll, wird in der Woche schriftlich auf vorbereitetem
Papier und mit Namen versehen festgehalten und auf diese Weise gesammelt. Grundsätzlich
werden die Beiträge nach zwei Kategorien aufgelistet: Lob Anliegen (Kritik oder Wunsch).
Es muss geklärt werden, ob dafür eine Wandzeitung, Pinnwände, ein Briefkasten, ein
Klassenratbuch oder ein Klassenratordner mit Protokollblättern für die jeweilige
Klassensituation als sinnvoll erachtet wird. Die verschiedenen Formen bringen jeweils Vor-
und Nachteile mit sich, die auch nach jeweiliger Klassensituation gut abgewogen werden
sollten. Dieses im Verlaufe der Woche entstehende Papier wird nach festen Regeln im
Klassenrat bearbeitet. Über die ,,Arbeit" wird ein Protokoll angefertigt, das u. a. Beschlüsse,
Unerledigtes und auch Reflexionen zum stattgefundenen Klassenrat enthält.
2.2
Rolle der Lehrerin / des Lehrers während des Klassenrats
Wie erwähnt besitzt der Klassenrat auch die Funktion eines Steuerungsinstruments betreffender
Schulklasse. Gleichzeitig ist er eine wichtige Informationsquelle nicht nur für Lehrende; denn
die verschriftlichte Wochensammlung ist schon während ihres Entstehungsprozesses für alle am
Klassenrat Beteiligten (fast) jederzeit einsehbar. So kann nachgelesen werden welche Personen
wofür gelobt werden. Gleichzeitig lässt sich auch feststellen welche Probleme mit welchen
Personen sich ergeben / ergeben haben. Es liegt auf der Hand, dass die Bearbeitung dieser Dinge
eine andere Ebene als die in der Schule sonst übliche zur Voraussetzung hat. Eine Kollegin / ein
Kollege, die / der den Klassenrat in ihrer / seiner Klasse durchführen will, sollte die Bereitschaft
mitbringen sich im Klassenrat auf die Arbeit an der Beziehungsebene mit Schülerinnen und
Schülern einzulassen. Lehrperson und Schülerinnen / Schüler begegnen sich im Klassenrat als
3
In einer nicht unerheblichen Anzahl von Schulklassen sind Sitz- / Stuhlkreise fest ritualisiert und man kann darauf
zurückgreifen. Für den Fall, dass Sitzkreise erst eingeführt werden müssen, favorisiere ich für den Klassenrat aus
mehreren Gründen ,,Ein Junge nimmt ein Mädchen dran, ein Mädchen nimmt einen Jungen dran" usw.
4
Sollte das nicht der Fall sein müssten Gesprächsregeln vor Einführung des Klassenrats gründlich mit der Klasse
erarbeitet werden.
7
Partner, die Lehrperson entscheidet also nicht allein nach der Prämisse, dass sie wisse, was gut
und richtig sei. Sie nimmt viel mehr die Haltung ein, ,,dass alle in der Klasse gemeinsam
entscheiden und damit auch gemeinsam für das Ergebnis verantwortlich sind." (Blum, 2006, S.
11) Die Rolle der Lehrperson ist demnach eine teilnehmend-begleitende wie auch schützende
und wahrende denn die Lehrperson bleibt verantwortlich für den Rahmen des Klassenrats, die
Rahmenkompetenz wird nicht an Schülerinnen und Schüler delegiert. Blum E. u. H.-J. halten
dazu ausdrücklich fest: ,,Die Lehrkraft übernimmt die Rolle des Begleiters sowie die
Verantwortung für den Prozess, nicht jedoch für das Ergebnis. Sie leitet die Schüler an, wie man
zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommt. Sie setzt den Rahmen, innerhalb dessen
Entscheidungen fallen können, und macht ihn transparent." (a. a. O.) Die Lehrperson wird
idealer Weise für die Schülerinnen und Schüler in diesem Rahmen sehr viel deutlicher als
Mensch erlebbar, indem sie transparent und klar kommuniziert, sich immer wieder einfühlsam
zuwendet und die Kinder / Jugendlichen in ihren Anliegen ernst nimmt (vgl. a. a. O.).
2.3
Rolle der Beratungslehrerin bei Einführung und Etablierung des Klassenrats
Lehrkräfte, die den Klassenrat einführen möchten, können sich diesen per Literaturstudium
aneignen, Fortbildungen zu diesem Thema besuchen (LschB-Schulpsychologie: KIK. Vgl. Blum,
2006, S. 7) oder an einigen Schulen die Beratungslehrkraft diesbezüglich ansprechen. Allerdings
kann die Rolle der Beratungslehrkraft nach einem ausführlichen Gespräch lediglich eine
temporär-prozessuale sein. Gemeinsam mit nachfragender Lehrkraft werden Möglichkeiten und
Ziele, aber auch Grenzen des Klassenrats erörtert. Aufgabe der Beratungslehrkraft kann es nicht
sein den Klassenrat fortwährend zu leiten und nachfragende Lehrkraft nimmt lediglich eine
hospitierende Haltung ein.
Eingebunden in Schul- und Beratungskonzept jeweiliger Schule wird die Beratungslehrkraft den
Klassenrat theoretisch und praktisch für eine vorher zu vereinbarende Anzahl von Schulstunden
,,doppelgesteckt" in betreffender Klasse einführen und etablieren, wobei gleichzeitig
nachfragende Lehrkraft eingearbeitet, begleitet und unterstützt wird. Ziel dieser Einarbeitung
und Begleitung ist die Lehrkraft in die Lage zu versetzen den Klassenrat selbstständig, sicher
und für alle an diesem Prozess Beteiligten Gewinn bringend weiterzuführen.
3.
Konzeption des Klassenrats in der GS An der Feldbuschwende
Schon vor tatsächlicher Aufnahme des Unterrichts in der GS An der Feldbuschwende war es
erklärtes Ziel der Planungsgruppe ein hohes Maß an Partizipations-Praxis für alle an der Schule
Beteiligten einzuführen und zu etablieren. Für die Ebene von Schülerinnen und Schülern
8
bedeutete das u. a. die Einführung eines Schülerparlaments: Es tagt einmal pro Woche für etwa
15 Minuten vor Unterrichtsbeginn und setzt sich zusammen aus Klassensprecherinnen und
Klassensprechern aller Schulklassen
5
. Für alle einsehbar hängt ein von jeweils einer
Viertklässlerin
/
einem
Viertklässler
angefertigtes
Schülerparlamentprotokoll
im
Eingangsbereich der Schule. Die Erfahrung zeigt, dass es sinnvoll ist die besprochenen Themen
auch in der Klasse zum selbst gewählten Zeitpunkt immer wieder nachlesen und ggf. darauf
verweisen zu können und zwar von Kinderseite (!).
Von daher schien es wichtig die schriftliche Wochensammlung des Klassenrats so zu gestalten,
dass die Themen des Schülerparlaments dort ebenfalls Eingang finden, ja sogar schon während
des Schülerparlaments eingetragen werden und später jederzeit im Klassenraum nachlesbar sind.
So werden also zu Beginn des Klassenrats die Schülerparlamentthemen vor der Klasse öffentlich
von Klassensprecherin und Klassensprecher vorgetragen (für evtl. Nichtleserinnen / Nichtleser).
Da damit besagte Kinder die Wochensammlung samt Schülerparlamentthemen sowieso schon in
den Händen halten, erschien es sinnvoll den Klassenrat von der Klassensprecherin und dem
Klassensprecher eröffnen und organisieren zu lassen.
Nach Vorstellung des eben Beschriebenen in einer Dienstbesprechung am 25.02.2008 wurde
schließlich in der Gesamtkonferenz am 07.04.2008 die Verankerung der Einführung und
Etablierung von Klassenrat in den Gewaltpräventions- und Beratungskonzepten unserer Schule
mit großer Mehrheit angenommen
6
.
3.1
Strukturierung des Klassenrats in einer vierten Klasse
Im November vergangenen Jahres wandte sich die Klassenlehrerin S. einer vierten Klasse an
mich in meiner Rolle als Beratungslehrerin. Sie fragte nach Möglichkeiten oder Methoden um
Miteinander und Umgangsformen der Kinder ihrer Klasse insgesamt zu verbessern.
Im ausführlichen Erstgespräch erfuhr ich Folgendes: Die vierte Klasse von S. besteht aus 19
Kindern - 11 Mädchen und acht Jungen. Es ist nach Ss. Einschätzungen eine insgesamt recht
leistungsstarke und leistungsfreudige Klasse mit eloquenten Schülerinnen und Schülern. Sieben
Kinder besitzen einen Migrationshintergrund, in acht Fällen bestehen Ein-Eltern-Familien und
sieben Kinder sind sog. Einzelkinder. Es gibt erhebliche soziale Unterschiede (die Spanne reicht
von Familien mit Hartz-IV-Einkommen bis zu doppelverdienenden Akademikerehepaaren). Zur
Klasse gehört Sch., ein Mädchen mit einer Körperbehinderung in Form einer erhöhten
Muskelspannung und Neigung zu Verkrampfungen. Die körperlich-geistige Entwicklung Schs.
5
Schulstundenplan im Schuljahr 2007 / 2008: das Schülerparlament findet dienstags statt.
6
Vgl. Anhang: Sicherheits- und Gewaltpräventionsmaßnahmen an der GS An der Feldbuschwende Gem. Rd.Erl.
v. 30.09.2004 und 15.02.2005
und
Beratungskonzept der GS An der Feldbuschwende
9
ist insgesamt verzögert und ihre Sehfähigkeit liegt bei 80 %. Sch. hat Anspruch auf
sonderpädagogischen Förderbedarf
7
. Sch. wird zusätzlich seit der ersten Klasse durch eine
Einzelfallhelferin unterstützt, die Schs. gesamten Schulalltag innerhalb der Schule begleitet.
Aus dieser Klassengesamtsituation ergeben sich Schwierigkeiten, die das Unterrichtsgeschehen
zeitweise enorm beeinflussen. Im Einzelnen benannte S. folgende Punkte, für die sie sich Hilfe
erhoffte:
viele Unterrichtsstörungen
erhebliche Gender-Konflikte
beginnende Ausgrenzungen im Falle Schs.
zu wenig Zeit für grundsätzliche Klärungen
Daraufhin stellte ich ihr die Methode Klassenrat i. S. der unter Punkt 2 dieser Arbeit
(Theoretische Überlegungen zum Klassenrat) referierten theoretischen Überlegungen vor.
Während des Gesprächs gewann ich den Eindruck, dass S. interessiert, aufgeschlossen und
motiviert einer Einführung und Etablierung des Klassenrats zur Lösung der Probleme in ihrer
Klasse gegenüber stand - obwohl ich auch Grenzen des Klassenrats aufzeigte (wie z. B.
Mobbing, Straftaten, anonyme Anschuldigungen).
Wir bemühten uns anschließend für das zweite Schulhalbjahr bei der Konrektorin um eine
meiner Beratungsstunden freitags, die parallel zu Ss. Unterrichtsstunden in ihrer Klasse lag, so
dass wir für die Dauer des Einführungsprozesses ,,doppelgesteckt" sein konnten. Nach
Sicherstellung dieser stundenplantechnischen Schwierigkeit vereinbarten wir beide fünf
aufeinander folgende Termine in besagter Stunde, die fortan freitags in der dritten Schulstunde
liegen sollte. Ich sicherte zu, ggf. die Einführung des Klassenrats (falls nötig) länger zu
begleiten, allerdings für max. insgesamt acht Freitagsstunden
8
.
3.2
Rolle der Lehrerin während des Klassenrats
Anschließend besprach ich mit S. die unter 2.1 und 2.2 (Strukturierung des Klassenrats in einer
vierten Klasse und Rolle der Lehrerin während des Klassenrats) erwähnten Punkte sehr
ausführlich. Stichworte und Fragen dieses zweiten Vorgesprächs waren:
1.
Klassenrat samt Wochensammlung ist Steuerungsinstrument und Informationsquelle für dich
- du erfährst, wer gelobt wird und auch welche Probleme es gibt
2.
Kinder, die sich schriftlich äußern können / mögen und bis Freitag ,,abwarten können"?
3.
Ernst-Nehmen der Partzipations-Praxis deiner Schulklassenkinder
7
Zwei Schulstunden pro Woche erfolgt Beschulung durch eine Förderschullehrerin der Werner-Dicke-Schule oder
besagte Förderschullehrerin berät Sch. unterrichtende Lehrkräfte.
8
Vgl. Anhang, Abb. 1: Stundenplanverankerung und -verbindung von Montagserzählkreis Schülerparlament -
Klassenrat von Klasse 4/X im Schuljahr 2007 / 2008, 2. Halbjahr.
10
4.
Bereitschaft dich auf die Arbeit an der Beziehungsebene mit ,,deinen" Kindern einzulassen
5.
Bereitschaft die Rahmenverantwortlichkeit für den Klassenrat zu übernehmen, die
Rahmenkompetenz nicht zu delegieren
6.
Bereitschaft die Klassenratprozessverantwortung zu übernehmen (was nicht gleichbedeutend
ist kompletter Ergebnisverantwortung)
7.
Bereitschaft klar und transparent zu kommunizieren, dich einfühlsam zuzuwenden =
deutlicher als sonst für die Kinder als Mensch erlebbar zu werden
8.
Rituale in deiner Klasse: Sitzkreisbildung? Gesprächsregeln, evtl. verschriftlicht? -
Montagserzählkreis als Wochenbeginn
9
? regelmäßiger Schülerparlamentbesuch deiner
Klassensprecher/in jeweils Dienstag vor Unterrichtsbeginn? regelmäßiger Klassenrat am
Freitag in der dritten Stunde als Wochenreflexion und abschluss
Die Rolle von S. während der Einführungsphase des Klassenrats also in den Freitagsstunden,
in denen ich den Klassenrat leiten würde definierten wir für sie als ,,aktive Hospitation" und
wir vereinbarten Folgendes
10
:
S. würde links neben mir im Kreis sitzen, so dass wir uns kurzfristig verständigen könnten,
falls dieses nötig sein sollte.
Rechts neben mir würden die ,,Managerinnen und Manager des heutigen Klassenrats" (= von
Klassensprecher/in fünf ernannte Kinder) sitzen, damit ich diese anleiten und unterstützen
könnte.
Nach Ende der vereinbarten fünf bis max. acht Einführungsstunden würde S. meinen Platz
einnehmen, das Klassenratritual wie erlernt fortführen und mich evtl. um Rat fragen, falls sie
alleine nicht weiterkäme.
3.3
Meine Rolle bei Einführung und Etablierung des Klassenrats
Aus dem bisher Geschilderten lässt sich m. E. schon erahnen, dass meine Beratungslehrrolle bei
Einführung und Etablierung des Klassenrats in einer Klasse verschiedensten Ansprüchen gerecht
werden muss. Zunächst oblag mir im Vorfeld die für unsere Schulsituation im Allgemeinen und
die für Ss. Klassensituation im Besonderen möglichst optimal zugeschnittene formale
Strukturierung eines Klassenrats:
-
Dazu gehören die Erarbeitung und Erstellung eines Gesprächsregelplakats, die Konzeption
von Protokollblättern der Wochensammlung für einen Klassenratordner (welcher von den
Kindern selbsttätig geführt werden kann) und die Erstellung einer Übersicht zum Verlauf der
Klassenratsitzungen.
9
In vielen (Grundschul-)Klassen gibt es Montagserzählkreise; dabei wird nach festgelegten Regeln vom
Wochenende erzählt oder aber gesagt, wie es einem an diesem Montagmorgen geht.
10
Vgl. Anhang, Abb. 2: Sitzkreisanordnung bei Einführung und Etablierung des Klassenrats.
11
-
Anschließend bin ich während der gemeinsamen Klassenratsitzungen zuständig für die
möglichst gute inhaltliche Strukturierung. Dazu gehören neben einer intensiven Prozess-
Aufmerksamkeit authentisches Praktizieren der Punkte 2. bis 7. des zweiten Vorgesprächs mit
S. (vgl. 3.2 Rolle der Lehrerin während des Klassenrats). Die Prozesse während des
Klassenrats erfordern stetige Rahmenaufrechterhaltung durch Klassensprecher/innen /
Manager/innen, die darin unterstützt werden müssen. Ebenso benötigen die Kinder
zwischendurch inhaltliche Zusammenfassungen / Klärungen, was eigentlich gemeint ist,
sprachliche (Formulierungs-) Hilfen bei der Sammlung und Wiederholung von
Lösungsvorschlägen (welche zur Abstimmung gebracht werden), sie müssen vertraut werden
mit Konsensformulierungen oder Mehrheitsbeschlüssen und ebenso damit, wann
Abstimmungen wenig sinnvoll sind (vgl. 6. Schlussreflexion und Ausblick).
In der Klasse von S. sind seit der ersten Klasse Sitzkreisbildung, Gesprächsregeln und ein
Redegegenstand feste Bestandteile des Unterrichts - die Sitzkreisbildung erfolgt nach der Regel:
,,Ein Mädchen ruft einen Jungen auf, der neben ihm sitzen soll; ein Junge ruft ein Mädchen auf,
das neben ihm sitzen soll." Gesprächsregeln sind vorhanden und bekannt (überprüft durch
Nachfragen bei den Kindern). Als Redegegenstand dient seit der ersten Klasse ein weißes
Marmorei.
Für den Klassenrat habe ich die Gesprächsregeln vertieft, wichtige Regeln zusätzlich mit den
Kindern erarbeitet, auf einem Plakat festgehalten und im Klassenraum betreffender Klasse
ausgehängt
11
.
Da der Klassenraum dieser Klasse auch ,,schulöffentlich", d. h. von Fördergruppen,
Arbeitsgemeinschaften und einer aus drei Klassen zusammengesetzten ev. Religionsgruppe
genutzt wird, musste die Wochensammlung so konzipiert werden, dass sie ,,wegräumbar" und
damit für Klassenfremde uneinsehbar bleibt. Ich entschied mich daher für einen
Klassenratordner mit einzelnen, für unsere Grundschulsituation eigens layouteten
Protokollblättern eins und zwei
12
. Diese Seiten erfüllen mehrere Aufgaben gleichzeitig:
1.
nennen sie das aktuelle Datum des stattfindenden Klassenrats (S. 1),
2.
weisen sie für Klassensprecherin und Klassensprecher Zeilen aus, in denen die im
Schülerparlament aktuell besprochenen Themen eingetragen werden (S. 1),
3.
halten sie eine Reflexionsmöglichkeit zu den Beschlüssen des vergangenen Klassenrats
bereit (S. 1),
4.
listen sie die Wochensammlung von Lob und Anliegen (Kritik oder Wünsche) auf (S. 1 u.
2)
11
Vgl. Anhang: Klassenrat-Gesprächsregeln
12
Vgl. Anhang: Klassenrat-Protokollblätter
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836624411
- DOI
- 10.3239/9783836624411
- Dateigröße
- 14 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Studienseminar für das Lehramt an berufsbildenden Schulen Hannover – Schulpsychologie Hannover, Beratungslehre
- Erscheinungsdatum
- 2009 (Januar)
- Note
- 1,5
- Schlagworte
- klassenrat grundschule gewaltprävention beratungskonzept demokratie-erziehung
- Produktsicherheit
- Diplom.de