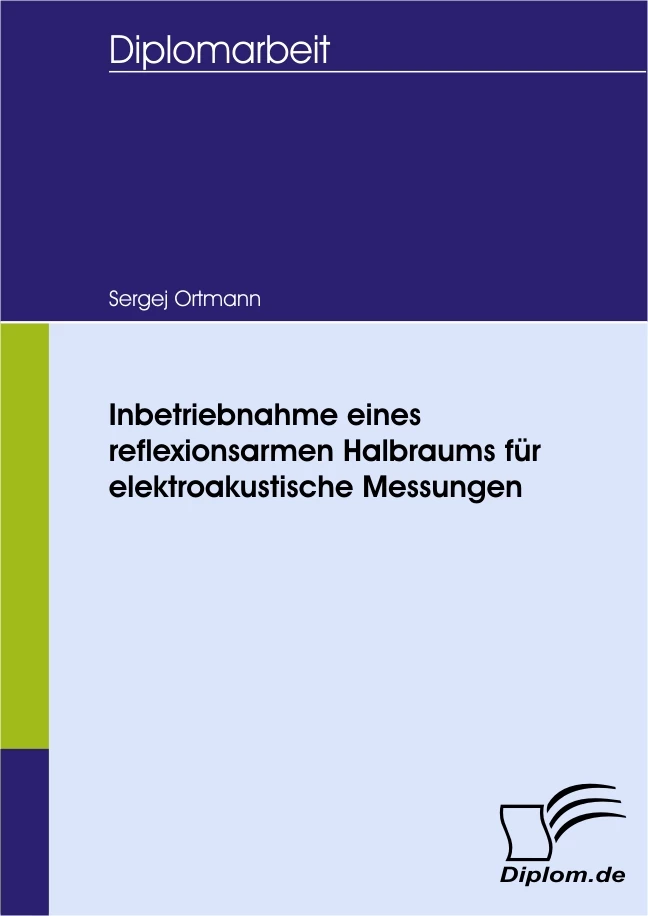Inbetriebnahme eines reflexionsarmen Halbraums für elektroakustische Messungen
©2001
Diplomarbeit
131 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Wie laut sind die Maschinen? Es ist nicht einfach, eine präzise Antwort auf diese Frage zu finden. Zur Charakterisierung des Geräusches einer Maschine, eines Fahrzeugs, eines Presslufthammers oder eines Haushaltsgerätes reicht es nicht aus, den Schalldruckpegel in einem bestimmten Abstand zur Quelle zu messen. Der gemessene Schalldruckpegel ist von der jeweiligen Richtcharakteristik der Quelle sowie auch von den akustischen Eigenschaften der Umgebung abhängig. Ein unzweideutiges Maß für die Lärmmenge, die von einer Quelle erzeugt wird, ist die Gesamtschallleistung, die von der Quelle abgestrahlt wird. Die Schallleistung einer Quelle ist die gesamte akustische Abstrahlung, z.B. in Watt. Sie lässt sich als Pegel in dB relativ zu einem Bezugspegel ausdrücken, genau wie man den Schalldruck als Schalldruckpegel ausdrückt.
Die meisten Schallleistungspegel, denen wir täglich begegnen, liegen zwischen 20 und 140 dB, bezogen auf 1 Picowatt.
Die Harmonisierung der Normen und Richtlinien auf dem europäischen und internationalen Absatzmarkt führt zu einer Flut von neuen Vorschriften und Normen. Maschinen und Fahrzeuge dürfen heute ohne Angaben über ihre Geräuschentwicklung nicht mehr hergestellt und auf den Markt gebracht werden. Hersteller und Anwender sind verpflichtet, im sogenannten Geräuschdatenblatt Angaben über die arbeitsplatzbezogenen Geräuschemissionen sowie den Schallleistungspegel der Geräte zu machen. Diese Angaben dienen einer besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Maschinen. Die Käufer werden immer lärmbewusster und ruhige Produkte lassen sich leichter verkaufen. Daher steigt der Bedarf an Schallleistungsmessungen stetig. Auch bei der Fertigungskontrolle, z.B. von Staubsaugern, Nähmaschinen, Düsentriebwerken usw., sind Schallleistungsmessungen von Nutzen. In der HiFi-Technik dienen Schallleistungsmessungen zur Bestimmung des elektroakustischen Wirkungsgrades von Lautsprechern und ihren Richtwerten.
Alle gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung von Schallleistung basieren auf der Messung des Schalldrucks, da dieser einfach und genau zu bestimmen ist. Der Schalldruckpegel einer Quelle variiert (mit Ausnahme isotroper Quellen), wenn man sich um die Quelle bewegt, d.h. jede Schallquelle hat eine spezielle Richtcharakteristik. Weiterhin ändert sich die Richtcharakteristik erheblich bei Veränderung der unmittelbarer Umgebung der Quelle, z.B. wenn sie von einem freien Feld (in einem reflexionsarmen Raum) auf einer harten, […]
Wie laut sind die Maschinen? Es ist nicht einfach, eine präzise Antwort auf diese Frage zu finden. Zur Charakterisierung des Geräusches einer Maschine, eines Fahrzeugs, eines Presslufthammers oder eines Haushaltsgerätes reicht es nicht aus, den Schalldruckpegel in einem bestimmten Abstand zur Quelle zu messen. Der gemessene Schalldruckpegel ist von der jeweiligen Richtcharakteristik der Quelle sowie auch von den akustischen Eigenschaften der Umgebung abhängig. Ein unzweideutiges Maß für die Lärmmenge, die von einer Quelle erzeugt wird, ist die Gesamtschallleistung, die von der Quelle abgestrahlt wird. Die Schallleistung einer Quelle ist die gesamte akustische Abstrahlung, z.B. in Watt. Sie lässt sich als Pegel in dB relativ zu einem Bezugspegel ausdrücken, genau wie man den Schalldruck als Schalldruckpegel ausdrückt.
Die meisten Schallleistungspegel, denen wir täglich begegnen, liegen zwischen 20 und 140 dB, bezogen auf 1 Picowatt.
Die Harmonisierung der Normen und Richtlinien auf dem europäischen und internationalen Absatzmarkt führt zu einer Flut von neuen Vorschriften und Normen. Maschinen und Fahrzeuge dürfen heute ohne Angaben über ihre Geräuschentwicklung nicht mehr hergestellt und auf den Markt gebracht werden. Hersteller und Anwender sind verpflichtet, im sogenannten Geräuschdatenblatt Angaben über die arbeitsplatzbezogenen Geräuschemissionen sowie den Schallleistungspegel der Geräte zu machen. Diese Angaben dienen einer besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Maschinen. Die Käufer werden immer lärmbewusster und ruhige Produkte lassen sich leichter verkaufen. Daher steigt der Bedarf an Schallleistungsmessungen stetig. Auch bei der Fertigungskontrolle, z.B. von Staubsaugern, Nähmaschinen, Düsentriebwerken usw., sind Schallleistungsmessungen von Nutzen. In der HiFi-Technik dienen Schallleistungsmessungen zur Bestimmung des elektroakustischen Wirkungsgrades von Lautsprechern und ihren Richtwerten.
Alle gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung von Schallleistung basieren auf der Messung des Schalldrucks, da dieser einfach und genau zu bestimmen ist. Der Schalldruckpegel einer Quelle variiert (mit Ausnahme isotroper Quellen), wenn man sich um die Quelle bewegt, d.h. jede Schallquelle hat eine spezielle Richtcharakteristik. Weiterhin ändert sich die Richtcharakteristik erheblich bei Veränderung der unmittelbarer Umgebung der Quelle, z.B. wenn sie von einem freien Feld (in einem reflexionsarmen Raum) auf einer harten, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sergej Ortmann
Inbetriebnahme eines reflexionsarmen Halbraums für elektroakustische Messungen
ISBN: 978-3-8366-2419-0
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort Wilhelmshafen,
Wilhelmshaven, Deutschland, Diplomarbeit, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Überblick
Seite 4
Überblick
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Einmessung eines reflexionsarmen Halbraums und
die Überprüfung dessen genereller Eignung wie auch der Eignung zur
Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen nach DIN EN ISO
3745 (Bestimmung der Schallleistungspegel von Geräuschquellen aus
Schalldruckmessungen, Verfahren der Genauigkeitsklasse 1).
Im Kapitel 1 werden Gründe für die Wichtigkeit der Schallleistungsmessung
vorgestellt sowie das Unternehmen, wo diese Diplomarbeit durchgeführt wurde.
Die für diese Diplomarbeit relevanten elektroakustische Grundlagen werden im
Kapitel 2 zusammengefasst.
Kapitel 3 beschäftigt sich speziell mit reflexionsarmen Räumen und Halbräumen
sowie deren Aufbau und Merkmalen.
Die Anforderungen an die Vorgehensweise bei der Einmessung und Feststellung
der Eignung von reflexionsarmen Räumen und Halbräumen nach ISO 3745,
sowie Durchführung der Einmessung werden im Kapitel 4 beschrieben.
Im Kapitel 5 wird ein Verfahren zur Bestimmung der Schallleistungspegel aus
Schalldruckmessungen nach ISO 3745 sowie die praktische Bestimmung der
Schallleistung am Beispiel eines Staubsaugers beschrieben.
Die bei dieser Diplomarbeit aufgetretenen Probleme und gesammelten
Erkenntnisse wie auch die Schlussbetrachtung werden im Kapitel 6 dargestellt.
Im Anhang werden verwendete Messgeräte und alle aufgenommenen und
ausgewerteten Messergebnisse dokumentiert.
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Inhaltsverzeichnis
Seite 5
Inhaltsverzeichnis
Überblick... 4
Inhaltsverzeichnis... 5
1
Einführung ... 7
1.1
Praktische Bedeutung der Schallleistungsmessungen... 7
1.2
Richtlinien für die Schallleistungsbestimmung... 10
1.3
Firma PZT... 11
2
Elektroakustische Grundlagen... 12
2.1
Schall, Schallgrößen... 12
2.2
Schallausbreitung... 24
2.3
Schallanalyse... 33
2.4
Elektroakustische Wandler... 36
2.4.1 Mikrofon... 36
2.4.2 Lautsprecher... 47
3
Reflexionsarme Räume und Halbräume... 53
3.1
Reflexionsarme Räume... 53
3.2
Reflexionsarme Halbräume... 55
3.3
Absorptionsverkleidung... 56
3.4
Bau von reflexionsarmen Räumen... 58
4
Einmessung des reflexionsarmen Halbraums... 59
4.1
Verfahren zur Feststellung der Eignung des Raums... 59
4.1.1 Verfahren zur Feststellung der generellen Eignung von
reflexionsarmen Räumen und Halbräumen... 59
4.1.2 Verfahren zur Feststellung der Eignung zur Bestimmung der
Schallleistungspegel von Geräuschquellen... 64
4.2
Durchführung der Einmessung... 67
4.2.1 Feststellung der generellen Eignung von reflexionsarmen
Räumen und Halbräumen... 67
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Inhaltsverzeichnis
Seite 6
4.2.2 Feststellung der Eignung zur Bestimmung der
Schallleistungspegel von Geräuschquellen... 82
4.3
Protokollierung... 88
5
Bestimmung der Schallleistungspegel... 89
5.1
Verfahren zur Bestimmung des Schallleistungspegels
nach ISO 3745... 89
5.2
Praktische Bestimmung des Schallleistungspegels eines
Staubsaugers... 94
6
Schlussbetrachtung... 99
Literaturverzeichnis... 101
Anhang... 103
Baueigenschaften des reflexionsarmen Halbraums bei PZT... 103
Verwendete Messgeräte... 104
HP 35665A Spezifikationen... 105
Aufgenommene Messwerte Mikrofonbahn 1-8... 112
Abweichung vom Entfernungsgesetz Mikrofonbahn 1-8... 120
Aufgenommene Messwerte Zweiflächen-Verfahren... 128
Abweichung Zweiflächen-Verfahren... 130
Aufgenommene Messwerte Grundgeräusch im Raum... 131
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 1 Einführung
Seite 7
1
Einführung
1.1 Praktische Bedeutung der Schallleistungsmessungen
Wie laut sind die Maschinen?
Es ist nicht einfach, eine präzise Antwort auf diese Frage zu finden. Zur
Charakterisierung des Geräusches einer Maschine, eines Fahrzeugs, eines
Presslufthammers oder eines Haushaltsgerätes reicht es nicht aus, den
Schalldruckpegel in einem bestimmten Abstand zur Quelle zu messen. Der
gemessene Schalldruckpegel ist von der jeweiligen Richtcharakteristik der Quelle
sowie auch von den akustischen Eigenschaften der Umgebung abhängig. Ein
unzweideutiges Maß für die Lärmmenge, die von einer Quelle erzeugt wird, ist die
Gesamtschallleistung, die von der Quelle abgestrahlt wird.
Die Schallleistung einer Quelle ist die gesamte akustische Abstrahlung, z.B. in
Watt. Sie lässt sich als Pegel in dB relativ zu einem Bezugspegel ausdrücken,
genau wie man den Schalldruck als Schalldruckpegel ausdrückt. Für den
Schallleistungspegel benutzt man oft das Symbol L
W
, und er ist durch diese
Gleichung definiert:
=
0
lg
10
W
W
L
W
dBpW
(1-1)
wobei
W
Schallleistung der Quelle, Watt
W
0
Bezugsleistung von 1 Picowatt
Die meisten Schallleistungspegel, denen wir täglich begegnen, liegen zwischen
20 und 140 dB, bezogen auf 1 Picowatt.
1
1
Vgl. Brüel & Kjaer, Schallleistungsbestimmung, S. 1
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 1 Einführung
Seite 8
Die Harmonisierung der Normen und Richtlinien auf dem europäischen und
internationalen Absatzmarkt führt zu einer Flut von neuen Vorschriften und
Normen. Maschinen und Fahrzeuge dürfen heute ohne Angaben über ihre
Geräuschentwicklung nicht mehr hergestellt und auf den Markt gebracht werden.
Hersteller und Anwender sind verpflichtet, im sogenannten Geräuschdatenblatt
Angaben über die arbeitsplatzbezogenen Geräuschemissionen sowie den
Schallleistungspegel der Geräte zu machen. Diese Angaben dienen einer
besseren Vergleichbarkeit der einzelnen Maschinen. Die Käufer werden immer
lärmbewusster und ruhige Produkte lassen sich leichter verkaufen. Daher steigt
der Bedarf an Schallleistungsmessungen stetig.
Auch bei der Fertigungskontrolle, z.B. von Staubsaugern, Nähmaschinen,
Düsentriebwerken usw., sind Schallleistungsmessungen von Nutzen. In der HiFi-
Technik dienen Schallleistungsmessungen zur Bestimmung des
elektroakustischen Wirkungsgrades von Lautsprechern und ihren Richtwerten.
Alle gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung von Schallleistung basieren auf
der Messung des Schalldrucks, da dieser einfach und genau zu bestimmen ist.
Der Schalldruckpegel einer Quelle variiert (mit Ausnahme isotroper Quellen),
wenn man sich um die Quelle bewegt, d.h. jede Schallquelle hat eine spezielle
Richtcharakteristik. Weiterhin ändert sich die Richtcharakteristik erheblich bei
Veränderung der unmittelbarer Umgebung der Quelle, z.B. wenn sie von einem
freien Feld (in einem reflexionsarmen Raum) auf einer harten, reflektierenden
Oberfläche (eine Wand oder ein Fußboden) angebracht wird.
Eine einzelne Schalldruckmessung reicht daher zur Bestimmung des
Schallleistungspegels nicht aus. Stattdessen ist eine räumliche Mittelung des
Schalldruckpegels notwendig. Ändert sich die Richtcharakteristik zeitlich, muss
auch über die Zeit gemittelt werden. Einzelheiten dieser räumlichen und zeitlichen
Mittelungen hängen sowohl von der Natur des emittierten Schalls als auch von
der Prüfumgebung ab.
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 1 Einführung
Seite 9
Als Beispiel für die Veränderung des Schalldruckpegels bei Ortsveränderung der
Schallquelle sei ein Schalldruckpegel von 80 dB angenommen, der in einem
Abstand von 2 m von der Breitbandschallquelle in einem reflexionsarmen Raum
gemessen wurde. Wird diese Quelle mit Kugelcharakteristik in der Ecke eines
großen Raums aufgestellt, so beträgt der gemessene Schalldruckpegel bei einem
Abstand von 2 m 89 dB, obwohl die Schallleistungsabgabe unverändert war.
1
Daher müssen die Schalldruckpegel-Messungen für die
Schallleistungsbestimmung möglichst in einem reflexionsarmen Raum
durchgeführt werden, wo es keine Reflexionen gibt (außer der reflektierenden
Ebene in einem reflexionsarmen Halbraum).
1
Vgl. Brüel & Kjaer, Schallleistungsbestimmung, S. 2
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 1 Einführung
Seite 10
1.2 Richtlinien für die Schallleistungsbestimmung
In vielen nationalen und internationalen Normen und Richtlinien wird die
Ermittlung der Schallleistung beschrieben. ISO hat z.B. eine Reihe von Normen
und Vornormen zu diesem Thema herausgebracht. Ihr Anwendungsbereich
erstreckt sich von der groben Abschätzung über technische Genauigkeit bis zu
Präzisions-Labormethoden. Die Tabelle 1.1 zeigt die Übersicht über die
Richtlinien für die Schallleistungsbestimmung.
ISO
No.
Genauigkeits-
klasse
der Methode
Messraum
Größe des
Prüfobjektes
Art des
Geräusches
Messbare
Schall-
leistungs-
Pegel
Zusätzlich erhältliche
Informationen
3741
Stationär,
breitbandig
3742
Präzision
Hallraum,
der die
spezifizierten
Bedingungen
erfüllt
Stationär,
reiner Ton oder
schmallbandig
In Terz- oder
Oktavbändern
A-bewerteter
Schallleistungspegel
3743
Spezieller
Hallraum
Vorzugsweise
kleiner als
1 % des
Messraums
Stationär,
breitbandig,
schmallbandig
oder reiner Ton
A-bewertet
und in
Oktavbändern
Anders bewertete
Schallleistungspegel
3744
Technisch
Im Freien oder
großen
Räumen
Maximale
Abmessung
unter 15 m
Jede
3745
Präzision
Schalltoter
oder
semischalltoter
Raum
Vorzugsweise
kleiner als
0,5 % des
Messraums
Jede
A-bewertet
und in Terz-
oder
Oktavbändern
Richtcharakteristik
und Schalldruckpegel
als Funktion der Zeit,
anders bewertete
Schallleistungspegel
3746 Überschlägig
Kein spezieller
Messraum
Außer des
zur Verfügung
stehenden
Messraums
keine
Begrenzung
Stationär,
breitbandig,
schmallbandig
oder reine Töne
A-bewertet
Schalldruckpegel
als Funktion der Zeit,
anders bewertete
Schallleistungspegel
Tabelle 1.1 Übersicht über die Richtlinien für die Schallleistungsbestimmung
(Vgl. Brüel & Kjaer, Schallleistungsbestimmung, S. 2)
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 1 Einführung
Seite 11
1.3 Firma PZT
Das Unternehmen PZT GmbH (Prüf- und Zulassungslabor für
Telekommunikation) ist ein akkreditiertes Prüflabor und wurde nach den
Vorgaben der DIN 45001 (neu EN ISO/IEC 17025) (allgemeine Kriterien zum
Betreiben von Prüflaboren) geprüft.
Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und führt Prüfungen auf den
Prüfgebieten analoger und digitaler Netzzugang und Akustik durch.
Im Frühling 2001 ist das Unternehmen in die neuen Geschäftsräume umgezogen,
wo ein reflexionsarmer Halbraum eingerichtet wurde. Damit soll das
Dienstleistungsangebot des Unternehmens um elektroakustische Messungen
erweitert werden.
Darunter verbirgt sich unter anderem:
·
Schallleistungsmessungen nach ISO 3744 / 3745 (Genauigkeitsklasse 2
und 1)
·
Geräuschanalyse
·
Psychoakustik
·
Sound Design
·
Fahrzeuginnenakustik
·
Schallschutz
Damit die Schallleistungsmessungen nach ISO 3744 / 3745 in dem neu
eingerichteten reflexionsarmen Halbraum durchgeführt werden können, muss
dessen generelle Eignung und Eignung zur Bestimmung der Schallleistungspegel
von Geräuschquellen nach in ISO 3745 beschriebenen Verfahren festgestellt
werden.
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 12
2
Elektroakustische Grundlagen
2.1 Schall, Schallgrößen
Schall
Unter Schall bezeichnet man Alles, was mit dem menschlichen Hörorgan
wahrgenommen werden kann. In den meisten Fällen entsteht Schall durch
Schwingungen, z.B. schwingt eine Gitarrensaite, eine Lautsprechermembran,
eine Glocke oder Teile einer laufenden Maschine.
Durch das Schwingen dieser Gegenstände entstehen entsprechende
Veränderungen des Luftdrucks. Dem statischen Gleichdruck überlagert sich der
durch die Schwingungen entstehender Wechseldruck, der sog. Schalldruck. Das
sind wechselnde Luftverdichtungen und Luftverdünnungen. Diese Druckstörung
breitet sich in einem Medium (z.B. in der Luft) in Form einer Welle aus und wird
vom Hörorgan als Schall wahrgenommen. Für die Schallausbreitung ist also ein
Medium notwendig.
Schallfeld
1
Als Schallfeld wird diejenige Raumzone bezeichnet, in der sich Schallwellen
ausbreiten. Ein Schallfeld wird physikalisch meist durch zwei Größen beschrieben
·
der Schalldruck ist ein Maß für die Stärke des Schallvorgangs
·
die Schallgeschwindigkeit gibt an, wie schnell sich die Schallwellen in
einem bestimmten, schallführenden Medium ausbreiten.
Im völlig freien Schallfeld breiten sich die Schallwellen kugelförmig nach allen
Raumrichtungen hin gleichmäßig aus. In der Praxis werden die Schallwellen
jedoch meist an Grenzflächen reflektiert, was z.B. in geschlossenen Räumen zu
einer Schallverstärkung führt.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 197
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 13
Schallgeschwindigkeit
1
Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Schallwellen in
gasförmigen, flüssigen oder festen Medien ausbreiten. Die Schallgeschwindigkeit
ist eine Materialkonstante und hängt in starkem Maß von den physikalischen
Eigenschaften des schallführenden Mediums ab. Die Schallgeschwindigkeit ist bei
den hörbaren Schallfrequenzen immer von der Frequenz unabhängig. In der
Tabelle 2.1 ist die Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien dargestellt.
Medium
Schallgeschwindigkeit
in m/s
Weichgummi
50
Sauerstoff
315
Luft
340
Kork
530
Helium
971
Benzin
1166
Wasserstoff
1286
Blei
1200
Süßwasser
1440
Meerwasser
1510
Beton
1660
Gold
3240
Tannenholz
3320
Kupfer
3600
Stahl
6000
Aluminium
6400
Tabelle 2.1 Schallgeschwindigkeit in verschiedenen Medien (Vgl. ABC der
Elektroakustik, S. 199-201)
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 198
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 14
Schalldruck
1
Formelzeichen von Schalldruck ist p, Angabe in N/m
2
oder Pascal (Kurzzeichen
Pa). Der atmosphärische Gleichdruck beträgt ohne Schalleinwirkung in etwa
10
5
N/m
2
entsprechend 10
5
Pa. Wird nun eine Schallquelle in Betrieb gesetzt, so
entstehen durch deren Schwingungen in der Luft in wechselnder Folge
Luftverdichtungen und Luftverdünnungen. Man spricht vom Schalldruck oder
genauer vom Schallwechseldruck. Dieser Schallwechseldruck wird dem
atmosphärischen überlagert und ist das wichtigste Maß für die physikalische
Stärke eines Schallvorgangs. In der messtechnischen Praxis gibt man jedoch
meist nicht den Schalldruck in N/m
2
bzw. Pa an, sondern man nimmt den
Schalldruckpegel mit der Angabe in dB.
Wie empfindlich das menschliche Ohr auf Druckschwankungen der Luft (Schall)
reagiert, zeigt sich an der Hörschwelle: das Ohr kann bei 1 kHz bereits einen
Schalldruck von 20 µN/m
2
wahrnehmen. Das entspricht 2
10
-5
Pa bzw. 2
10
-4
µb.
Bei diesem Wert beträgt die Auslenkung der schwingenden Luftteilchen etwa
0,8
10
-9
cm.
Schalldruckpegel
2
Schalldruckpegel L
p
ist in der akustischen Messtechnik das wichtigste Maß zur
Angabe der physikalischen Stärke eines Schallvorganges. Man bildet dabei das
Verhältnis des gemessenen Schalldrucks p zu einem Bezugsschalldruck p
0
mit
dem DIN-genormten Wert p
0
= 2
10
-4
µb (entspricht 2
10
-5
Pa) (das ist genau der
Wert der Hörschwelle bei der Frequenz f = 1 kHz).
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 194
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 195
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 15
0
lg
20
p
p
L
p
=
in dB SPL (Sound Pressure Level)
(2-1)
Die Logarithmierung bietet den Vorteil, dass man den außerordentlich großen
Bereich der in der Praxis vorkommenden Schalldrucke auf einem leicht
überschaubaren Zahlenbereich beschränkt. Somit wird einfacheres Rechnen
möglich.
Schallschnelle
1
Als Schallschnelle v wird die Geschwindigkeit der hin- und herschwingenden
Teilchen des Mediums bezeichnet. Sie hängt von der Frequenz und der
Amplitude ab.
=
a
v
(2-2)
v
Schallschnelle, m/s
a
Amplitude, m
Kreisfrequenz 2·
·f
Schallkennimpedanz (Wellenwiderstand)
2
Schallkennimpedanz
Z
0
(auch Wellenwiderstand genannt) ist die
Materialkonstante zur Kennzeichnung der verschiedenen schallführenden
Übertragungsmedien. Man erhält die Kennimpedanz Z
0
als Quotient aus
Schalldruck p und Schallschnelle v, oder als Produkt von Ruhedichte
des
Mediums und dessen Schallgeschwindigkeit c.
3
1
Vgl. Ernst Kammerer, Technische Elektroakustik, S.15
2
Vgl. Ernst Kammerer, Technische Elektroakustik, S.15
3
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S.203
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 16
c
v
p
Z
=
=
(2-3)
Z
Wellenwiderstand, Ns/m
3
p
Schalldruck, N/m
2
v
Schallschnelle, m/s
c
Schallgeschwindigkeit, m/s
Dichte des Mediums, kg/m
3
Für trockene Luft bei Normaldruck und die Temperatur von 20°C ist Z = 414
Ns/m
3
.
1
Der Wellenwiderstand ist druckabhängig und nimmt in verdünnten Gasen
ab.
Schallintensität
2
Schallintensität I, in W/m
2
angegeben, ist ein Maß zur Kennzeichnung der in
einem Schallfeld vorhandenen Schallenergie. Man versteht darunter das
Verhältnis von der Schallleistung W zu einer Fläche S, die senkrecht zur
Schallrichtung steht.
S
W
I
=
(2-4)
I
Schallintensität, W/m
2
W
Schallleistung, Watt
S
Fläche, m
2
1
Vgl. Ernst Kammerer, Technische Elektroakustik, S.15
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S.202
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 17
Eine Schallwelle transportiert mechanische Energie. Zum Berechnen der
Leistung, die von einer ebenen Sinuswelle übertragen wird, betrachtet man eine
Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung. Die Teilchen vor der Ebene drücken
auf die Teilchen hinter der Ebene mit der Kraft je Flächeneinheit p. Die an ihnen
verrichtete Arbeit ist gleich dem Produkt aus Kraft und Weg. Die im zeitlichen
Mittel je Flächeneinheit übertragene Leistung, die Schallintensität wird dann
1
v
p
I
=
(2-5)
I
Schallintensität, W/m
2
p
Schalldruck, N/m
2
v
Schallschnelle, m/s
Setzt man den Wellenwiderstand
c
v
p
Z
=
=
ein, so wird die Schallintensität
c
v
c
p
v
p
I
=
=
=
2
2
(2-6)
Für die Luft ist die Schallintensität
2
2
0
2
414 m
W
p
c
p
I
=
=
(2-7)
1
Vgl. Ernst Kammerer, Technische Elektroakustik, S. 15, 16
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 18
Schallleistung
1
Die Schallleistung ist das Produkt aus Schallintensität und Ausbreitungsfläche
S
c
P
S
I
W
=
=
2
(2-8)
W
Schallleistung, W
I
Schallintensität, W/m
2
S
Ausbreitungsfläche, m
2
P
Schalldruck, N/m
2
Dichte des Mediums, kg/m
3
c
Schallgeschwindigkeit, m/s
Bei einem Kugelstrahler im freien Feld breitet sich die Schallwelle in Form einer
Kugelfläche mit der Fläche S aus. Es ist also
2
4
r
S
=
(2-9)
Bei Verdoppelung der Größe r, d.h. des Abstandes vom Kugelstrahler, geht die
Schallintensität auf ein Viertel zurück und der Schalldruck auf die Hälfte. Der
Schalldruck fällt also linear mit der Vergrößerung des Abstandes von der
Schallquelle, d.h. bei jeder Verdoppelung um 6 dB ab. Die Tabelle 2.2 zeigt, wie
hoch Schallleistungen ausgewählter Schallquellen sind.
1
Vgl. Ernst Kammerer, Technische Elektroakustik, S. 17
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 19
Schallquelle
Schallleistung, W
Unterhaltungssprache
7·10
-6
Geige (sehr laut)
10
-3
Trompete (sehr laut)
10
-1
Große Orgel (alle Register)
10
Großdiesel mit 600 kW
10
2
Großlautsprecher
10
2
Strahlturbine auf Volllast
10
3
Alarmsirene
10
3
Sicherheitsventile
10
4
Raketenzündung
bis 10
8
Tabelle 2.2 Schallleistungen ausgewählter Schallquellen (Vgl. Michael
Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 195)
Schallleistungspegel
1
Der Schallleistungspegel L
W
ist eine wichtige Größe zur Angabe der
physikalischen Stärke eines Schalls. Man bildet dabei das Verhältnis der
ermittelten Schallleistung W zu einer Bezugsschallleistung W
0
mit dem DIN-
genormten Wert W
0
= 10
-12
W.
0
lg
10
W
W
L
W
=
in dBpW
(2-10)
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 196
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 20
Schallenergie
1
Schallenergie ist die Gesamtheit der mechanischen Lage- und
Bewegungsenergie, die in einem von Schallwellen erfassten Raumgebiet
nachweisbar ist. Bezeichnet man die Schallschnelle mit v, die Dichte des
Übertragungsmediums mit
und das vom Schallvorgang erfasste Raumvolumen
mit V, so erhält man die mittlere Schallenergie E wie folgt:
V
v
E
=
2
(2-11)
E
Schallenergie, Ws
Dichte des Übertragungsmedium, kg/m
3
v
Schallschnelle, m/s
V
Raumvolumen, m
3
Schallfluss
2
Schallfluss q ist das Produkt aus Schallschnelle v und einer gegebenen Fläche S,
die senkrecht zur Schallrichtung steht.
S
v
q
=
(2-12)
q
Schallfluss, m
3
/s
v
Schallschnelle, m/s
S
Fläche, m
2
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 196
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 197
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 21
Phon
1
(griech. phone Schall)
Phon ist eine Einheit der subjektiven Lautstärke von Schall, während die Einheit
des objektiven messbaren Pegels dB ist.
Laut DIN-Normung stimmen dabei für die Bezugsfrequenz 1 kHz immer der
Schallpegelwert in dB und der Lautstärkewert in phon überein. Hat z.B. ein
Schallvorgang einen Pegel von 100 dB, so beträgt die Lautstärke nur bei 1 kHz
auch 100 phon. Da nun das Ohr bei etwa 4 kHz noch deutlich empfindlicher ist als
bei 1 kHz, würde bei 4 kHz beispielsweise eine Schallstärke von nur noch 88 dB
ausreichen, um die gleiche Lautstärke-Empfindung von 100 phon hervorzurufen.
Geräusch
2
Geräusch ist ein Störschall, der meist durch den Betrieb von Maschinen
verursacht wird, z.B. Verkehrslärm oder Baulärm. Schalltechnisch gesehen
bestehen solche Geräusche immer aus sehr zahlreichen, meist sehr dicht
beieinander liegender Frequenzen, sog. ,,Frequenzbändern". Amplituden und
Phasen der beteiligten Frequenzen schwanken dabei regellos.
Nach den vorwiegend beteiligten Frequenzen unterscheidet man niederfrequente,
z.B. Brummgeräusch von einer Transformatoren-Station, und hochfrequente
Geräusche, z.B. laufender Motor mit hoher Drehzahl. Je höher die auftretenden
Frequenzbänder, desto größer ist die Störwirkung des Geräusches.
Ferner unterscheidet man Dauergeräusche und intermittierende Geräusche. Beim
Dauergeräusche bleiben Frequenz und Amplitude der Schwingung über einen
bestimmten Zeitraum konstant, z.B. ein laufender Ventilator.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 160
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 71, 72
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 22
Beim intermittierenden Geräusch schwankt die Schallstärke regellos, z.B. Tippen
auf einer Schreibmaschine, laute Hammerschläge. Intermittierende Geräusche
stören mehr als Dauergeräusche.
Ist das Geräusch sehr kurzzeitig und dabei sehr stark, so spricht man von Knall,
z.B. Pistolenknall, Funkenknall, Überschallknall.
Damit in Wohngebbieten und in der Nähe von Fabrikanlagen ein angemessener
Ruheschutz für die Bürger garantiert ist, wurden rechtlich verbindliche Geräusch-
Grenzwerte festgesetzt.
Hörschwelle
1
Als Hörschwelle bezeichnet man den geringsten Schalldruck, bei dem ein Mensch
mit normalem Hörvermögen einen Ton eben als solchen erkennen kann.
Wie man der Abbildung 2.1 entnimmt, ist der Schwellenwert sehr stark von der
Schallfrequenz abhängig. So müssen sehr tiefe Töne einen Schallpegel von etwa
60 dB aufweisen, damit man sie eben hören kann.
Bei Tönen zwischen 1 und 5 kHz ist das Ohr am empfindlichsten. Es registriert in
diesem mittleren Frequenzbereich Töne mit einem Schalldruck von nur 2
10
-4
µb.
Das entspricht einer Auslenkung der schwingenden Luftteilchen von nur 0,8
10
-9
cm. Die Empfindlichkeit des Ohres wurde somit von der Natur sehr dicht an die
physiologische vertretbare Grenzen gesteigert: wäre das Ohr nur geringfügig
empfindlicher, so würde man ständig das thermische Rauschen der Luftmoleküle
hören müssen.
Für sehr hohe Frequenzen wird das Ohr wieder bedeutend unempfindlicher.
Diese Unempfindlichkeit gegenüber sehr hohen und sehr tiefen Frequenzen hat
physiologische Gründe.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 89, 90
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 23
Wäre das Ohr z.B. für tiefe Frequenzen empfindlicher, so würde man etwa die
Erschütterungen des Kopfes beim Gehen als lautes Dröhnen und Krachen
empfinden, man würde ferner erheblich gestört durch Kaubewegungen,
Windgeräusche und die Blutströmung im Kopf.
S
ch
a
lle
g
e
l
Frequenz
20
140
dB
60
0
20
40
80
120
100
10
3
10
4
10
2
Hz
Schmerzschwelle
Hörschwelle
Abbildung 2.1
Verlauf der Hörschwellen- und Schmerzschwellenkurven.
(Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 85)
Die Abbildung 2.1 zeigt auch die Schmerzschwellenkurve, die Schmerzschwelle
ist auch frequenzabhängig, im unteren und im oberem Frequenzbereich ist das
menschliche Ohr empfindlicher gegen laute Geräusche.
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 24
2.2 Schallausbreitung
Ebene Wellen
Ebene Welle ist eine Welle, bei der die Wellenfeldgrößen in der Ebene senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung konstant sind. In einem ebenen Wellenfeld verlaufen die
Schallwellen nur in eine Ausbreitungsrichtung. Die Intensität in einem ebenen
Wellenfeld ist unabhängig vom Ort.
Kugelwelle
1
Kugelwelle ist eine Welle, die sich konzentrisch nach allen Raumrichtungen hin
ausbreitet. In der Praxis treten annährend kugelförmige Schallwellen immer dann
auf, wenn die Abmessungen der Schallquelle sehr klein gegenüber der
abgestrahlten Wellenlänge sind. Das ist z.B. bei einem Tieftonlautsprecher der
Fall, wenn dieser einen sehr niederfrequenten Ton von 50 Hz abstrahlt. Der
Membrandurchmesser des Lautsprechers ist dann sehr klein gegenüber der
Wellenlänge
= 6,8 m.
Im Gegensatz zu einem ebenen Wellenfeld ändert sich die Intensität eines
Kugelwellenfeldes abhängig vom Ort. Sie ist aber im Abstand r um die
Schallquelle gleich.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S.115
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 25
Schallbeugung
1
Schallbeugung ist Umlenkung der Schallrichtung an Kanten, Ecken, Pfeilern usw.
(siehe Abbildung 2.2). Somit kann der Schall auch in die Zone des
,,Schallschattens" hinter einem Hindernis gelangen. Die Schallbeugung erklärt,
warum der Schall auch ,,um die Ecke geht", etwa bei einem Haus, oder warum
man den Lärm auch hinter einer Abschirmwand hören kann, z.B. an einer
Autobahn.
Es kann aber nur dann zum Beugungseffekt kommen, wenn die Wellenlänge sehr
viel größer ist als die Abmessungen des Hindernisses. So hört man z.B. hinter
einer 4 m hohen Lärmschutzwand noch deutlich die tiefen Frequenzen, weil die
Wellenlänge bei 50 Hz etwa 6,8 m beträgt und somit größer ist als die Höhe der
Lärmschutzwand. Die hohen Schallanteile werden aber reflektiert, weil ihre
Wellenlängen viel kleiner sind als die Wandhöhe. Man hört also das Geräusch
hinter einer Lärmschutzwand ,,dumpf", weil die hohen Frequenzanteile entfallen,
die tiefen jedoch auf Grund der Beugung in die Schattenzone hinter der Wand
gelangen.
Reflektierter
Schall
Gebeugter
Schall
Schall-
Schatten
Hindernis
(z.B. Säule)
Geradlinige Schallausbreitung
Schal-
Richtung
Abbildung 2.2
Schallbeugung (Vgl. Michael Rieländer, ABC der
Elektroakustik, S. 188)
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 188
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 26
Schallbrechung
1
Trifft eine Schallwelle schräg auf ein anderes Medium auf, so ändert sie ihre
Richtung (siehe Abbildung 2.3).
Schallstrahl
Medium 2
Medium 1
Trenn-
fläche
Einfalls-
winkel
Brechungs-
winkel
Einfallslot
Abbildung 2.3
Schallbrechung (Vgl. Michael Rieländer, ABC der
Elektroakustik, S. 188)
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 189
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 27
Schalldämmung
1
Auch Schallisolation genannt. Wird Schall an einer Grenzfläche, z.B. einer Wand,
reflektiert, so wird der Schalldurchgang durch die Wand durch den Rückwurf
gemindert. Man spricht von Schalldämmung. Die wichtigste Kenngröße für die
Schalldämmung ist das Schalldämm-Maß R
d
a
P
P
R
lg
10
=
in dB
(2-12)
Dabei ist P
a
die auffallende Schalleistung und P
d
diejenige Schallenergie, die von
der Rückseite der Wand noch abgestrahlt wird.
Man erzielt gute Schalldämmung bei Verwendung möglichst dicker und möglichst
schwerer Wände.
Schalldämpfung
2
Schalldämpfung ist die Umwandlung der Schallenergie in nicht hörbare
Wärmeenergie. Diesen Effekt erzielt man durch Verwendung
schallabsorbierenden Materialien, z.B. offenzellige Schaum-Kunststoffe,
Glaswolle- oder Mineralfaserplatten. Der Schall dringt dann in die Poren des
offenzelligen Materials ein und wird durch Reibungseffekte der schwingenden
Luftteilchen an den Porengängen in Wärme umgewandelt.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 190, 191
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 193
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 28
Schalldiffusität
1
(lat. diffundere zerstreuen)
Sind die Grenzflächen eines Raums stark unterteilt, so werden die auffallende
Schallwellen nicht nach Art eines glatten Schallspiegels in nur eine Richtung
zurückgeworfen, sondern sie werden in alle Raumrichtungen zerstreut reflektiert.
Dadurch ergibt sich eine allseitig ziemlich gleichmäßige Schallverteilung im
Raum, die günstig für eine gute Innenakustik ist.
Schalldispersion
2
(lat. dispergere ausstreuen)
Schalldispersion ist die Änderung der Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von
der Schallfrequenz.
Im Frequenzbereich des menschlichen Hörens etwa 16 Hz bis 16 kHz ist
jedoch die Schallgeschwindigkeit immer konstant und nicht von der Frequenz
abhängig. Dispersion gibt es nur im hochfrequenten, unhörbaren
Ultraschalbereich.
Interferenz
3
(lat. Inter dazwischen und ferre tragen)
Interferenz ist eine Überlagerung von mehreren Schallwellen in Räumen, im
Freien oder in geschlossenen akustischen Systemen wie Rohrleitungen oder
Interferenzdämpfern.
1
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 193
2
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 194
3
Vgl. Michael Rieländer, ABC der Elektroakustik, S. 95
Diplomarbeit WS 2001/2002
Sergej Ortmann
Kapitel 2 Elektroakustische Grundlagen
Seite 29
Im einfachsten Fall betrachtet man dabei zwei sinusförmige Wellenzüge von
gleicher Frequenz und Amplitude, jedoch unterschiedlicher Phase. Im Falle a) (s.
Abbildung 2.4) sind Wellenberge, Wellentäler und Nulldurchgänge zeitlich genau
synchron. Somit addieren sich Wellenberge und Wellentäler, die Amplitude der
resultierenden Schwingung nimmt also zu. In einem solchen Fall von Interferenz
würden sich also zwei Schallwellen in einem Raum mechanisch verstärken, d.h.
Schall würde lauter. Im Falle b) beträgt die Phasenverschiebung 180°, d.h. beide
Wellen gehen zwar zeitgleich durch die Nulllage, jedoch in umgekehrter Richtung.
Daher löschen sich die Wellenzüge gegenseitig aus, die Amplitude s der
resultierender Welle ist zu jedem Zeitpunkt gleich null. Zwischen diesen beiden
Extremfällen sind andere Fälle möglich.
a)
b)
Ausgangsschwingungen
Ausgangsschwingungen
Resultierende
Schwingung
Resultierende
Schwingung
Abbildung 2.4
Entstehung von Interferenzen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783836624190
- DOI
- 10.3239/9783836624190
- Dateigröße
- 3.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven; Standort Wilhelmshaven – Technik, Studiengang Elektrotechnik
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Dezember)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- elektroakustik messung halbraum einmessung schall
- Produktsicherheit
- Diplom.de