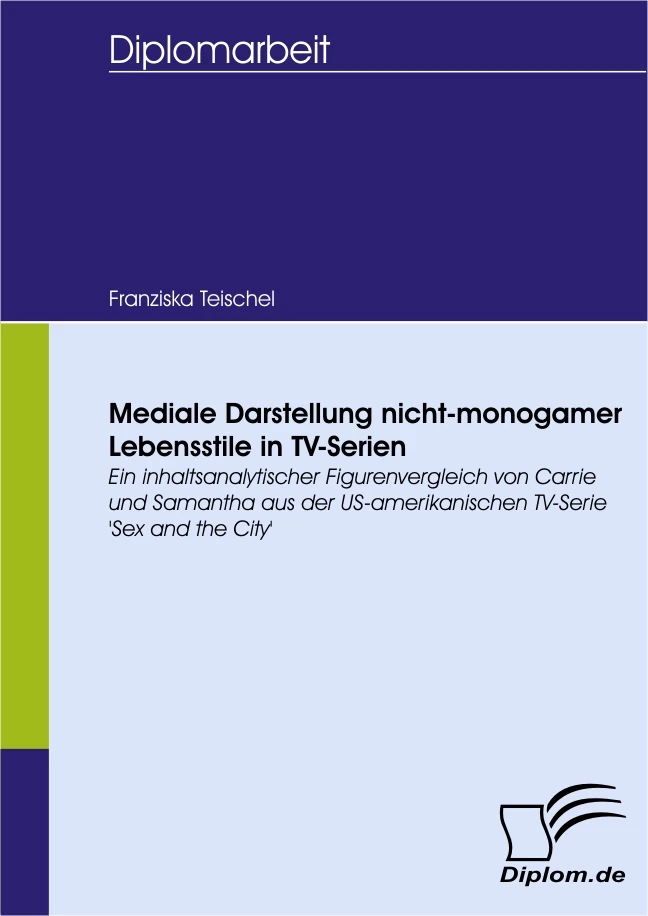Mediale Darstellung nicht-monogamer Lebensstile in TV-Serien
Ein inhaltsanalytischer Figurenvergleich von Carrie und Samantha aus der US-amerikanischen TV-Serie 'Sex and the City'
Zusammenfassung
Die US-amerikanische Serie Sex and the City wurde als lang laufende Serie von 1998 bis 2004 in den USA gesendet, aufgrund des anhaltenden Erfolgs hatte im Mai 2008 ein inhaltlich anschließender Kinofilm weltweit Premiere. Der thematische Schwerpunkt der Serie ist die detaillierte Darstellung und Diskussion der Freundschaft und des Sexuallebens von vier New Yorker Singlefrauen Mitte dreißig. Dieser inhaltliche Fokus führte zu zeitnahen kontroversen Kritiken einerseits (etwa Pergament, 1998; Mate, 2001) und einem nachhaltigen Forschungsinteresse verschiedener Disziplinen andererseits.
Ein Hauptkritikpunkt der Debatte war dabei die als zu offenherzig, zu umfassend und dadurch als unmoralisch bewertete Darstellung nicht-monogamer Lebensstile. Diskutiert wurden zum einen die schwer einzuschätzende Vorbildfunktion gegenüber dem Zielpublikum, zum anderen die ambivalent gesehene Positionierung innerhalb der aktuellen genderorientierten bzw. feministischen Medienforschung.
Der Vorwurf der negativen Vorbildfunktion in Bezug auf verantwortungsbewussten Umgang mit Sexualität wurde inzwischen entkräftet (etwa durch Studien zur positiven Auswirkungen von embedded messages, die der Serie u.a. den SHINE-Award einbrachten). Ebenso wurde der Kritikpunkt der übermäßigen Konzentration auf Sexualthemen in einer Studie widerlegt, in der die Serie im Verhältnis zum sonstigen TV-Programm analysiert wurde. Die Untersuchung bleibt jedoch rein quantitativ. Eine qualitative Analyse der Darstellung nicht-monogamer Lebensstile in Sex and the City als Grundlage einer fundierten Einordnung fehlt bisher. Dazu soll diese Arbeit anhand der Figuren der Carrie und Samantha einen Beitrag leisten.
Das zweite Kapitel zu den Grundlagen der Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen gliedert sich in zwei Abschnitte und dient der grundlegenden Begriffsklärung und -abgrenzung der aktuellen Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen, sexueller und soziosexueller Orientierung. Zunächst werden die Formen nicht-monogamer Lebensstile vorgestellt und die Konzepte von Promiskuität, serieller Monogamie, Casual Sex, Swinging, Polygamy, Polyfidelität und Polyamourösität entsprechend der vorliegenden Studien voneinander abgegrenzt. Innerhalb der noch immer fließenden Begrifflichkeiten soll dadurch eine kohärente Sprachregelung zur Terminologie für die Arbeit festgelegt und erläutert werden. Zum vertieften Verständnis folgt im zweiten Abschnitt eine Zusammenstellung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen der Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen
2.1 Formen nicht-monogamer Lebensstile
2.1.1 Promiskuität
2.1.1.1 Serielle Monogamie
2.1.1.2 Seitensprung, (notorische) Untreue und Swinging
2.1.1.3 Casual Sex
2.1.2 Polygamie, Polyandrie, Polyfidelität, Polyamourösität
2.2 Einflussfaktoren für den sexuellen Lebensstil
2.2.1 Gender-Differenz
2.2.2 Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexuelle Orientierung
2.2.3 Soziosexuelle Orientierung
2.2.4 Die Einflüsse des soziologischen Umfelds
3 Sex and the City: Analyse der Darstellung nicht-monogamer Lebensstile
3.1 Methode zur Analyse medialer Darstellung
3.1.1 Methode der systematischen Filmanalyse nach Korte
3.1.2 Analysekriterien nach Hickethier
3.1.2.1 Inhalt, Dramaturgie und Erzählstrategien
3.1.2.2 Entstehungsumfeld, diegetisches Umfeld und Rezeptionsumfeld
3.1.2.3 Besonderheiten des Formats „Lang laufende Serie“
3.2 Inhaltszusammenfassung unter Bezugnahme auf die aktuelle Forschung
3.2.1 Inhaltszusammenfassung
3.2.2 Konzepte von Liebe und Freundschaft und ihre Darstellung
3.2.3 Sexualthematik: Quantitative Studie von Jensen & Jensen
3.3 Formal-inhaltliche Bestandsaufnahme
3.3.1 Episodenprotokoll als vereinfachtes Sequenzprotokoll
3.4 Konkretisierung der Fragestellung: Inhaltsanalytischer Kriterienkatalog
3.5 Ergebnisse der Inhaltsanalyse anhand des Kriterienkatalogs
3.5.1 Ergebnisse soziokulturelles Umfeld
3.5.2 Ergebnisse Carrie Bradshaw und Samantha Jones im Vergleich
3.6 Diskussion der Ergebnisse
4 Bewertung und Ausblick: Ansätze zur weitergehenden Forschung
Literaturverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Episodenprotokoll Seasons #1 bis #6
Tab. 2: A1. Engeres soziokulturelles Umfeld
Tab. 3: A2. Geschlechtsrollenspezifische Erwartungen des Freundes-und Bekanntenkreis
Tab. 4: B1. Sexuelle und soziosexuelle Orientierung
Tab. 5: B2. Geschlechtsrollenspezifisches Verhalten und Ausprägung feminin bzw.
maskulin konnotierter Charakteristika
Tab. 6: Exemplarischer Codierleitfaden: Merkmal ‚Egozentrik –Selbstlosigkeit/ Hilfsbereitschaft’
Tab. 7: C1. Orte und Anlässe der Partnerwahl
Tab. 8: C2. Dauer, Frequenz des Partnerwechsels, vorhergehender Bekanntheitsgrad
Tab. 9: C3. Formen von Beziehungen
Tab. 10: C4. Verhaltensregeln und Ethiken
Tab. 11: C6. Grad der emotionalen Involviertheit
Tab. 12: C7. Kriterien zur Auswahl ‚short’- bzw. ‚long-term-mates’
Tab. 13: D1. Gründe und Motive für den praktizierten Lebensstil
Tab. 14: E1. Intrapersonelle Aspekte
Tab. 15: E2. Reaktionen des engeren bzw. erweiterten Umfelds
Tab. 16: Carrie/Samantha – A1. Engeres soziokulturelles Umfeld
Tab. 17: Carrie / Samantha – A2. Geschlechtsrollenspezifische Erwartungen des
Freundes- und Bekanntenkreis
Tab. 18: Carrie – B1. Sexuelle und soziosexuelle Orientierung
Tab. 19: Samantha – B1. Sexuelle und soziosexuelle Orientierung
Tab. 20: Carrie – B2. Geschlechtsrollenspezifisches Verhalten und Ausprägung feminin bzw. maskulin konnotierter Charakteristika
Tab. 21: Samantha – B2. Geschlechtsrollenspezifisches Verhalten und Ausprägung feminin bzw. maskulin konnotierter Charakteristika
Tab. 22: Carrie – C1. Orte und Anlässe der Partnerwahl
Tab. 23: Samantha – C1. Orte und Anlässe der Partnerwahl
Tab. 24: Carrie – C2. Dauer, Frequenz des Partnerwechsels, vorhergehender
Bekanntheitsgrad
Tab. 25: Samantha – C2. Dauer, Frequenz des Partnerwechsels, vorhergehender Bekanntheitsgrad
Tab. 26: Carrie – C3. Formen von Beziehungen
Tab. 27: Samantha – C3. Formen von Beziehungen
Tab. 28: Carrie – C4. Verhaltensregeln und Ethiken
Tab. 29: Samantha – C4. Verhaltensregeln und Ethiken
Tab. 30: Carrie / Samantha – C5. Tabus im Sexualverhalten
Tab. 31: Carrie – C6. Grad der emotionalen Involviertheit
Tab. 32: Samantha – C6. Grad der emotionalen Involviertheit
Tab. 33: Carrie – C7.a) Kriterien zur Auswahl ‚short-term-mates’
Tab. 34: Carrie – C7.b) Kriterien zur Auswahl ‚long-term-mates’
Tab. 35: Samantha – C7.a) Kriterien zur Auswahl ‚short-term-mates’
Tab. 36: Samantha – C7.b) Kriterien zur Auswahl ‚long-term-mates’
Tab. 37: Carrie – D1. Gründe und Motive
Tab. 38: Samantha – D1. Gründe und Motive
Tab. 39: Carrie / Samantha – D2. Konkrete psychologische Ursachen für das
Verhalten der Figuren (Auswahl)
Tab. 40: Carrie – E1. Konsequenzen aus Lebensstil: Intrapersonelle Aspekte
Tab. 41: Samantha – E1. Intrapersonelle Aspekte
Tab. 42: Carrie – E2.a) Reaktionen des engeren Umfelds
Tab. 43: Samantha – E2.a) Reaktionen des engeren Umfelds
Tab. 44: Carrie – E2.b) Reaktionen des erweiterten Umfelds
Tab. 45: Samantha – E2.b) Reaktionen des erweiterten Umfelds
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
Die US-amerikanische Serie Sex and the City wurde als lang laufende Serie von 1998 bis 2004 in den USA gesendet, aufgrund des anhaltenden Erfolgs hatte im Mai 2008 ein inhaltlich anschließender Kinofilm weltweit Premiere. Der thematische Schwerpunkt der Serie ist die detaillierte Darstellung und Diskussion der Freundschaft und des Sexuallebens von vier New Yorker Singlefrauen Mitte dreißig. Dieser inhaltliche Fokus führte zu zeitnahen kontroversen Kritiken einerseits (etwa Pergament, 1998; Mate, 2001) und einem nachhaltigen Forschungsinteresse verschiedener Disziplinen andererseits (Akass & McCabe 2004, Hinz 2004, Bubel 2006).
Ein Hauptkritikpunkt der Debatte war dabei die als zu offenherzig, zu umfassend und dadurch als unmoralisch bewertete Darstellung nicht-monogamer Lebensstile. Diskutiert wurden zum einen die schwer einzuschätzende Vorbildfunktion gegenüber dem Zielpublikum, zum anderen die ambivalent gesehene Positionierung innerhalb der aktuellen genderorientierten bzw. feministischen Medienforschung (Whelehan 2000, Henry 2004).
Der Vorwurf der negativen Vorbildfunktion in Bezug auf verantwortungsbewussten Umgang mit Sexualität wurde inzwischen entkräftet (etwa durch Studien zur positiven Auswirkungen von „embedded messages“, die der Serie u.a. den SHINE-Award einbrachten). Ebenso wurde der Kritikpunkt der übermäßigen Konzentration auf Sexualthemen in einer Studie widerlegt, in der die Serie im Verhältnis zum sonstigen TV-Programm analysiert wurde (Jensen & Jensen 2007). Die Untersuchung bleibt jedoch rein quantitativ. Eine qualitative Analyse der Darstellung nicht-monogamer Lebensstile in Sex and the City als Grundlage einer fundierten Einordnung fehlt bisher. Dazu soll diese Arbeit anhand der Figuren der Carrie und Samantha einen Beitrag leisten.
Das zweite Kapitel zu den Grundlagen der Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen glie-dert sich in zwei Abschnitte und dient der grundlegenden Begriffsklärung und -abgrenzung der aktuellen Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen, sexueller und soziosexueller Orientierung. Zunächst werden die Formen nicht-monogamer Lebensstile vorgestellt und die Konzepte von Promiskuität, serieller Monogamie, Casual Sex, Swinging, Polygamy, Polyfidelität und Polyamourösität entsprechend der vorliegenden Studien voneinander abgegrenzt (Klesse 2005, Bellis, Hughes & Ashton 2004). Innerhalb der noch immer fließenden Begrifflichkeiten soll dadurch eine kohärente Sprachregelung zur Terminologie für die Arbeit festgelegt und erläutert werden. Zum vertieften Verständnis folgt im zweiten Abschnitt eine Zusammenstellung maßgeblicher Faktoren, die die Gestaltung des sexuellen Lebensstils beeinflussen. Hierzu werden Theorien zur Geschlechtsidentität und sexuellen Orientierung (Attwood 2007, Bellis, Hughes & Ashton 2004) vorgestellt und im Zusammenhang mit der soziosexuellen Orientierung und ihrer restriktiven bzw. nicht-restriktiven Ausrichtung diskutiert (Simpson & Gangestal 1991, Kentler 1978, Schmitt 2005). Abschließend werden die Einflüsse des soziologischen Umfelds erörtert (Jensen & Jensen 2007; Bandura 1986; Ostovich & Sabini 2004).
Das dritte Kapitel stellt den Hauptteil der Arbeit dar und gliedert sich in sechs Unterkapitel. Nach der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen für den Kriterienkatalog werden zunächst die relevanten Konzepte der medienwissenschaftlichen Filmanalyse vorgestellt (Korte 2004, Hickethier 2001). Die eigentliche Analyse beginnt im nächsten Schritt mit einer kurzen Inhaltszusammenfassung, ergänzt um eine Bezugnahme auf die aktuelle Forschung . Dabei wird das vorliegende Material des Untersuchungsgegenstands, also die insgesamt 94 Episoden aus sechs Staffeln, in einer Ziel führenden Inhaltsbeschreibung mit Fokus auf den Figuren Carrie und Samantha vorgestellt. Unter Bezugnahme auf die vorliegenden Forschungsarbeiten werden die zentralen Themen von Freundschaft, Sexualität und der Überlappung beider hinsichtlich ihrer Darstellung vorgestellt (Bubel 2006, Hinz 2004, Akass e.a. 2004). Ausführlich diskutiert werden wird in diesem Zusammenhang die bereits vorliegende Studie zur quantitativen Analyse der Präsenz von Sexualthemen in der Serie (Jensen & Jensen 2007). Die Zusammenfassung wird zur besseren Orientierung für den Leser durch ein Episodenprotokoll in Form eines verkürzten Sequenzprotokolls ergänzt.
Im vierten Teil der Analyse wird ein inhaltsanalytischer Kriterienkatalog erarbeitet, der auf der im zweiten Kapitel zusammengeführten Theoriebildung zu nicht-monogamen Lebensstilen basiert und im Wesentlichen die Fragen des Was, Wie und Wodurch konkretisiert:
- Welche Formen nicht-monogamer Lebensstile werden mit den Figuren von Carrie und Samantha dargestellt?
- Wie erfolgt die Darstellung, welche Muster, Verhaltensregeln, Ausprägungen, Kommentierungen, Konsequenzen werden gezeigt?
- Welche Begründungen für den Lebensstil werden gegeben und wodurch?
- Welches Umfeld wird wie dargestellt? Welche Reaktionen und/oder Beeinflussungen durch das Umfeld werden gezeigt?
- Welche Entwicklung durchlaufen die Figuren? Wodurch ist diese bedingt?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden zunächst Hypothesen entwickelt, die mit Hilfe eines deduktiv entwickelten Kategoriensystems auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden. Insbesondere die Entwicklung der Figuren über die sechs Staffeln erlaubt dann eine Einschätzung, wie die Lebensstile und ihre Darstellung vor dem Hintergrund der Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen einerseits und der aktuellen Medienforschung andererseits einzuordnen sind.
Im fünften und sechsten Abschnitt werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse anhand des Kriterienkatalogs präsentiert und diskutiert. Die abschließenden Kapiteln widmen sich einer kritischen Hinterfragung der Arbeit und der angewandten Methodik ebenso wie einem Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.
2 Grundlagen der Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen
Für nicht-monogame Lebensstile als Objekt im Forschungsbereich der menschlichen Sexualität ergeben sich Anknüpfungspunkte für mehrere Wissenschaften. So beschäftigen sich aufgrund der Multidimensionalität des Untersuchungsgegenstands neben der klinischen Sexologie auch die weiter gefassten Sexualwissenschaften, Soziologie, Psychologie, Gesundheitswissenschaften und auch Philosophie mit der Thematik. Dies entspricht der multifunktionalen Anlage der menschlichen Sexualität, die unbestritten ist, auch wenn teilweise stark differierende Funktionen benannt werden. So spricht Faßnacht von den vier Kategorien Fortpflanzungs-, Lust-, Spielfunktion und gemeinschaftsbildende Funktion (Faßnacht 1973), Runkel fasst es allgemeiner, indem er die biologische von der anthropologischen, kulturellen und politischen Funktion unterscheidet (Runkel 2003). Gemeinsamer Nenner scheint dabei nur die Reproduktionsfunktion als offenkundigster und „ursprünglicher“ Faktor der Sexualität, auch wenn sie, wie Hertoft anmerkt, „nur eine Teilfunktion [ist], subjektiv gesehen nicht einmal die wichtigste“ (Hertoft 1989, S. 263).
Im Kontext dieser Arbeit spielen die zugrunde liegenden rein biologischen bzw. evolutionstheoretischen Vorgänge nur insofern eine Rolle, als sie die Basis bilden für die hier näher zu betrachtenden sozialen, sozialpsychologischen und psychologischen Aspekte des Themas. Die physischen und klassisch sexologischen Erkenntnisse etwa zu Perversionen und sexuellen Neurosen werden deshalb hier nicht weiter verfolgt. Im wichtigen Bereich der Partnerwahl zeigt sich jedoch etwa, dass die Auswahlkriterien nicht nur nach „soziokulturellem Umfeld, sozialer Schichtzugehörigkeit, Alter und Geschlecht der Beteiligten und (sehr deutlich) nach Art der gewünschten Partnerschaft [variieren], […] [sondern zugleich] die Orientierung auf optimale Vererbung eigener Gene nahe legen“ (Dressler & Zink 2002, S. 387) – eine ergänzende Betrachtung sowohl der biologischen als auch psychologischen Aspekte ist hier also unumgänglich. Wie schwierig eine Abgrenzung der Themenbereiche ist, da sie sich immer wieder zu beeinflussen und teilweise zu widersprechen scheinen, belegt die in der Forschungspraxis häufig angewendete Methode, evolutionstheoretische Ansätze mit sozialpsychologischen Ansätzen zur Partnerbeziehung zu kombinieren (etwa bei Kenrick, Groth, Trost & Sadalla 1993).
In der Soziologie zeichnet sich Sexualität und Sexualverhalten als Bestandteil des gesellschaftlichen Zusammenlebens in den meisten Kulturen durch einen hohen Grad an Normierung und zugleich Tabuisierung aus. In der vornehmlich christlich geprägten westlichen Welt stellt dabei die Monogamie als Lebensform noch immer das gesellschaftlich angestrebte Ideal für die menschliche Paarbeziehung dar:
„Die traditionelle Gleichsetzung von Monogamie mit ‚natürlichem’ Partnerschafts-verhalten hat eine moralische Abwertung zahlreicher anderer Partnerschaftsformen mit sich gebracht.“ (Dressler & Zink 2002, S. 338)
Die Annahme jedoch, dass der Mensch von Natur aus monogam (und heterosexuell) sei, wurde inzwischen sowohl empirisch als auch theoretisch widerlegt, wie etwa Dressler und Zink oder Newitz mit Verweis auf Barker anführen (Dressler & Zink 2002; Newitz 2006). Bellis, Hughes und Ashton formulieren dazu:
"In reality of course [...] many individuals move in and out of polygamy, serial monogamy, long term monogamy, and even abstinence." (Bellis, Hughes & Ashton 2004, S. 890)
Dabei sprechen sie nebenbei als einen weiteren wesentlichen Punkt an, dass der Mensch nicht nur nicht monogam veranlagt, sondern zudem sein sexueller Lebensstil im Verlauf des Lebens wandelbar ist. Die Formen, die Nicht-Monogamie dabei annehmen kann, sind vielfältig, in der Begriffsabgrenzung unklar und zum Teil vom jeweiligen Kontext abhängig. Im ersten Teil dieses Kapitels werden deshalb die einzelnen Formen kurz vorgestellt und für diese Arbeit in ihrer Begrifflichkeit voneinander abgegrenzt.
Im zweiten Teil des Kapitels werden die Einflussfaktoren auf den sexuellen Lebensstil erläutert. Dazu wird zunächst auf die fundamentale Rolle eingegangen, die die Gender-Differenz in Bezug auf das Sexualverhalten einnimmt. Die Differenz zwischen den Geschlechtern bezieht sich auf alle Funktionen der Sexualität, angefangen von den grundlegenden biologischen Kriterien der Partnerwahl (vgl. Roese, Pennington, Coleman & Kenrick 2006; Regan 1998) bis hin zu den komplexen ‚double standards’ innerhalb der Gesellschaft, die normierte Erwartungshaltungen gegenüber männlichen und weiblichen Verhaltensweisen abbilden (vgl. Attwood 2007; Bettis & Adams 2005).
Personen mit einem nicht-monogamen Lebensstil sehen sich aufgrund der oben genannten Normierung also tendenziell einer gesellschaftlichen Kritik ausgesetzt und können damit als Minorität gesehen werden. Vor diesem Hintergrund verwundert es deshalb nicht, dass die Forschung zu nicht-monogamen Lebensstilen einen Ursprung in der Auseinandersetzung mit anderen sexuellen Minderheiten hat und wesentliche Erkenntnisse aus der Forschung zur sexuellen Orientierung und ihren Merkmalen und Lebensstilen stammen (Klesse 2006; Newitz 2006). Da sich diese Arbeit weitestgehend mit heterosexuellen Lebensweisen beschäftigt, werden die entsprechenden Ergebnisse hier nur insoweit erläutert, als sie Relevanz auch für eine heterosexuelle Orientierung haben. Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexuelle Orientierung werden deshalb kurz in Hinblick auf ihre Wirksamkeit für den sexuellen Lebensstil vorgestellt.
Besondere Relevanz für das sexuelle Verhalten von Menschen hat weitergehend die soziosexuelle Orientierung, ein Begriff, der im Lauf der Zeit unterschiedlich belegt war, aktuell aber vorrangig in der Definition durch Simpson und Gangestad verwendet wird (Simpson & Gangestad 1991). Da der Einfluss dieses Faktors auf den Lebensstil unabhängig von der sexuellen Orientierung weit reichend ist und vielfältige Aspekte der Auswirkungen bereits erforscht wurden, werden die grundlegenden Konzepte in einem eigenen Teil des Kapitels vorgestellt.
Die oben erwähnte traditionelle Tabuisierung vor allem von Lebensstilen, die nicht der Norm entsprechen, ist also einer zunehmenden Liberalisierung und Enttabuisierung der Debatte gewichen – zumindest in der Forschung, die ein diesbezüglich offenes, da neutral-wissenschaftliches Umfeld bietet. Diese Liberalisierung ergibt sich jedoch nur teilweise auch für das soziokulturelle Umfeld. Die weit reichende Bedeutung, die das gesellschaftliche Umfeld für den Umgang mit Sexualität hat, wird im abschließenden Teil des Kapitels diskutiert.
Insgesamt ist die Forschung zu sexuellen Verhalten und nicht-monogamen Lebensweisen inzwischen so ausdifferenziert und umfassend, dass im Rahmen dieser Arbeit zwangsläufig eine Auswahl getroffen werden musste. Diese erfolgte stets im Hinblick auf das grundlegende Forschungsinteresse, einen Kriterienkatalog zur Analyse einer TV-Serie zu entwickeln.
2.1 Formen nicht-monogamer Lebensstile
‚Nicht-monogamer Lebensstil’ steht in dieser Arbeit als „Sammelbezeichnung für alle Formen des Wechsels von Sexualpartnern“, d. h. eine mehr oder weniger ausgeprägte Partnermobilität, wie sie Dressler und Zink definieren:
„Partnermobilität wird als ein mit dem Rückgang von Dauerbeziehungen häufiger werdendes Phänomen beschrieben, bei dem gelegentlich verschiedene Formen wie einmaliger Partnerwechsel (z. B. Seitensprung), aufeinander folgende treue Partnerschaften (serielle Monogamie) oder häufig wechselnde, kurze Sexualbeziehungen (vgl. Promiskuität) unterschieden werden.“ (Dressler & Zink 2002, S. 385)
Aufgrund der bereits erwähnten, in der christlich-westlichen Gesellschaft vorherrschenden Idealisierung der Monogamie werden nicht-monogame Lebensweisen zumeist moralisch negativ bewertet und sind zum Teil gesellschaftlich sanktioniert, auch wenn sich zeigt, wie Dressler und Zink fortfahren, „dass durch Partnermobilität gewonnene sexuelle und partnerschaftliche Erfahrungen eher günstige Auswirkungen auf den Aufbau stabiler Beziehungen haben“ (Dressler & Zink 2002, S. 385).
Nicht-monogame Lebensstile können beschrieben werden anhand der Formen, in denen sie ausgelebt werden, und der zugrunde liegenden Einflussfaktoren. Innerhalb der einzelnen Formen ergeben sich teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Auch wenn die Gender-Differenz als Einflussfaktor erst im nächsten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt wird, werden die daraus resultierenden Varianten jeweils mit erfasst und vorgestellt. Der Fokus liegt dabei auf der jeweils weiblichen Ausprägung, da sie für die spätere Untersuchung die größere Relevanz hat.
2.1.1 Promiskuität
„Promisk ist eine Person, die mehr Sexualpartner hatte, als Sie es für richtig halten.“
Alfred Kinsey
Mit diesem pointierten Zitat führt Kinsey die zwei Hauptkriterien an, die generell zur Definition von promiskem Sexualverhalten angewandt werden: Zum einen eine erhöhte Anzahl von Sexualpartnern, zum anderen ein notwendigerweise zugrunde liegender Bewertungsmaßstab, welche Menge als „erhöhte Anzahl“ zu sehen ist. Die Abhängigkeit beider Kriterien voneinander wird allgemein in der Forschung bestätigt (etwa bei Dressler & Zink 2002). Die Normierung erfolgt vor allem durch individuelle Moralvorstellung und soziokulturelle Vorgaben. Durch die wertende Komponente des Begriffs entsteht eine zumeist negative Konnotation (Faßnacht 1973; Klesse 2006), diese gilt für Frauen im Vergleich zu Männern verschärft, wie etwa in umgangssprachlichen Bezeichnungen deutlich wird (Attwood 2007).
Eine Kategorisierung der verschiedenen Ausprägungen von Promiskuität kann anhand der folgenden Unterscheidungsmerkmale vorgenommen werden:
- genereller Beziehungsstatus
- Dauer der promisken Beziehung
- Häufigkeit des Kontakts innerhalb der Beziehung
- Grad der emotionalen Involviertheit.
Diesem Usus schließt sich die folgende Vorstellung an. Forschungsfelder, die eine weitere Spezifizierung ermöglichen, sind außerdem Gründe und Motive für Promiskuität, Zusammenhänge mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen, Kriterien für Partnerwahl, Entwicklung/Wandel des sexuellen Verhaltens im Zeitablauf. Diese sollen hier kurz vorgestellt und im weiteren Verlauf genauer ausgeführt werden, wenn sich eine besondere Relevanz ergibt.
Über die Gründe, Ursachen und Motive von Promiskuität ergibt sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten, selbst wenn man die streng sexologischen und physiologischen Erkenntnisse ausklammert. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit zur Promiskuität besteht, je früher mit der sexuellen Aktivität begonnen wird (Bellis, Hughes & Ashton 2004; Grello, Welsh & Harper 2006). Ein gesteigertes sexuelles Verlangen muss dabei nicht notwendigerweise vorliegen (Ostovich & Sabini 2004), vielmehr entspringt, gerade bei Frauen, ein promiskes Verhalten häufig aus dem Wunsch, Aufmerksamkeit zu erlangen (Liston & Moore-Rahimi 2005). Townsend kommt diesbezüglich zu dem Schluss, dass insbesondere für Frauen Promiskuität ein Weg zu einer monogamen Beziehung ist, zumindest in ihrer Wunschvorstellung:
„[The] goal of most of these women is to establish a stable, monogamous, affectionate relationship with a high quality mate, i.e., a mate with superior willingness and ability to invest.” (Townsend 1995, S. 196)
Diese Motive prägen einerseits die Partnerwahl und stehen andererseits in engem Zusammenhang mit anderen, auch geschlechtsspezifischen Persönlichkeitsmerkmalen. So weist Walsh darauf hin, dass das Selbstwertgefühl in direktem Verhältnis zur Anzahl der Sexualpartner steht (Walsh 1991). Eine besondere Variante der geschlechtsspezifischen Ausprägung der soziosexuellen Orientierung stellen Ostovich und Sabini vor, indem sie darauf hinweisen, dass Frauen mit vergleichsweise vielen Sexualpartnern tendenziell maskuline Persönlichkeitszüge ausweisen (Ostovich & Sabini 2004), eine Erkenntnis, die sowohl in der Untersuchung der soziosexuellen Orientierung als auch der Analyse der Kriterien zur Partnerwahl relevant wird, da sich hier jeweils eklatante Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen.
Als Kriterien für die Partnerwahl wurden von Regan die folgenden eingeführt, die inzwischen allgemein übernommen und etabliert sind: Attraktivität, Dominanz, Sozialstatus, ähnliche Interessen, Sozialverhalten/Extrovertiertheit, Familienorientierung, Intellekt, emotionale Stabilität und Alter (Regan 1998, S. 62.). Der generelle Ansatz besteht darin, dass Personen einen individuellen Standard festlegen, welchen Kriterien potenzielle Partner in welcher Ausprägung entsprechen müssen. Bei der Partnersuche kommen nur die Personen in Frage, die diesem Standard so weit als möglich entsprechen (Townsend 1995; Regan 1998). Dabei entstehen Unterschiede zwischen der Auswahl von angestrebten eher kurz- bzw. eher langfristigen Partnerschaften (Konzept des „short term mate“ im Unterschied zum „long term mate“), auch diese differieren zwischen den Geschlechtern (Townsend, Kline & Wasserman 1995; Regan & Dreyer 1999).
Zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass das Sexualverhalten im Lebenslauf eines Menschen keine Konstante darstellt, sondern einem Wandel unterliegen kann. Das kann sich sowohl darin äußern, dass ein promiskes Verhalten sich zunehmend verstärkt, d. h., Anzahl und Häufigkeit der Sexualkontakte zunimmt, oder umgekehrt Promiskuität zu (seriell) monogamen Beziehungen führt (Tanfer & Schoorl 1992), dies vor allem in Zusammenhang mit der oben erwähnten Tendenz bei Frauen, durch kurzfristige Beziehungen den richtigen Partner für eine längerfristige Beziehung zu finden (Townsend 1995). Townsend, Kline und Wasserman nehmen hierfür eine Einteilung in drei Entwicklungsstadien speziell von Frauen vor (Townsend, Kline & Wasserman 1995, S. 35–38ff.), bei der im Zeitverlauf verschiedene Formen des Sexualverhaltens stattfinden können, wie sie nachfolgend vorgestellt werden.
2.1.1.1. Serielle Monogamie
Dressler und Zink unterscheiden zwischen „absolute[r] oder strenge[r] Monogamie, bei der eine Auflösung der Ehe bzw. Partnerschaft rechtlich nicht oder nur in Ausnahmefällen möglich ist“ und „gemäßigte[r] Monogamie, bei der Ehen u. Partnerschaften auch wieder gelöst werden können“ (Dressler & Zink 2002, S. 338). Danach stellt serielle Monogamie eine Sonderform der gemäßigten Monogamie dar, bei der nach Beendigung einer monogamen Beziehung eine weitere folgen kann. Diese Form der Nicht-Monogamie stellt inzwischen wohl die häufigste Art des Zusammenlebens in der westlichen Gesellschaft dar, im Unterschied zu anderen nicht-monogamen Lebensstilen ist sie weitgehend akzeptiert und als „normal“ konnotiert. Mit dieser zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz geht eine Verschiebung der Voraussetzungen zur Lösung einer Beziehung einher: Während Dressler und Zink v. a. den rechtlichen Aspekt herausstreichen, kann inzwischen vorausgesetzt werden, dass nicht mehr nur die juristische, sondern auch eine generelle, moralisch akzeptierte Möglichkeit zur Beendigung einer Beziehung im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein besteht. Damit geht eine gewandelte Einstellung zur Verbindlichkeit der Paarbeziehung allgemein einher: Die „Hemmschwelle“, eine Beziehung wieder zu lösen, ist nicht mehr durch formal-juristische Vorgaben definiert, sondern liegt im Wesentlichen in der persönlichen Einstellung jedes Einzelnen begründet. Eine fast zynische Würdigung erfährt dieser Umstand, wenn umgangssprachlich der Partner „Lebensabschnittsgefährte“ genannt wird.
Diesbezüglich kann in Hinblick auf die serielle Monogamie eine Unterscheidung vorgenommen werden. Auf der einen Seite gibt es Personen, die eigentlich eine monogame, d. h. lebenslange Beziehung anstreben, und nur aufgrund der Umstände diese Vorstellung nicht verwirklichen können. Auf der anderen Seite stehen Personen, die man als genuin seriell monogam bezeichnen könnte und nicht oder nur bedingt davon ausgehen, dass eine Beziehung ein Leben lang hält. Die beiden Modelle unterscheiden sich also im Grad der avisierten Verbindlichkeit und Dauer der Beziehung.
2.1.1.2. Seitensprung, (notorische) Untreue und Swinging
Die Zusammenfassung dieser drei Begriffe in einer Kategorie mag auf den ersten Blick erstaunen, erklärt sich aber aus einem wesentlichen Merkmal, das sie gemeinsam haben. Alle drei Formen nicht-monogamer Lebensstile bzw. Verhaltensweisen zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur innerhalb bestehender Partnerschaften vorkommen können. Der signifikante Unterschied besteht dabei in der Einvernehmlichkeit. Swinging ist laut Dressler und Zink eine
„Bezeichnung für Personen, die an einem Partnertausch teilnehmen oder wechselnde Beziehungen haben; auch Bezeichnung für Personen, die Gruppensex praktizieren.“ (Dressler & Zink 2002, S. 527)
Es handelt sich also um einen einvernehmlichen Akt, an dem beide Partner teilhaben. Vor dem Hintergrund einer festen, d. h. quasi-monogamen Beziehung, bedeutet eine Swinging- Aktivität damit zugleich ein hohes Maß an Vertrauen, da beide Partner sich darauf verlassen, dass die sexuellen Aktivitäten außerhalb der Beziehung diese selbst nicht in Frage stellen.
Im Unterschied dazu ereignen sich Seitensprung und Untreue in bestehenden Beziehungen i. d. R. ohne das Wissen, geschweige denn die Erlaubnis des Partners, es handelt sich also um einen Akt des Vertrauensbruchs, man „betrügt“ seinen Partner. Auch wenn Newitz mit Verweis auf Barker festhält, dass die Untreue-Quote in festen Beziehungen bei 60-70% liegt und somit als „normal“ anzusehen sei, stellt sie für die jeweils betroffenen Beziehungen eine Herausforderung dar, die nicht selten in der Trennung endet (Newitz 2006). Die Problematik besteht hier darin, dass eine (quasi-)monogame Beziehung neben sexuellen vor allem emotionale Anteile innehat. Selbst wenn der eigentliche Akt des sexuellen Betrugs nicht so schwer wiegt, so findet doch eine Übertragung des erlittenen Vertrauensbruchs auf mögliche Vertrauensbrüche auch im emotionalen Bereich statt: Die Beziehung als ganzes wird in Frage gestellt. Dies geschieht umso leichter, wenn statt eines einmaligen Seitensprungs eine notorische Untreue eines Partners vorliegt, entweder durch häufige, einmalige Sexualkontakte außerhalb der Beziehung, oder durch eine andauernde Affäre.
2.1.1.3. Casual Sex
Im Unterschied zur seriellen Monogamie oder einer generell bestehenden, quasi-monogamen Beziehung, die durch eine mehr oder weniger große emotionale Verbindlichkeit gekennzeichnet ist, ist ein wesentliches Charakteristikum für Casual Sex eine deutlich oder ausschließlich sexuelle Ausrichtung, wie Grello, Welsh und Harper festhalten:
„Regardless of terminology, all are describing sexual relationships in which the partners do not define the relationships as romantic or their partner as a boyfriend or girlfriend. These meetings are often superficial, based on sexual desire or physical attraction, spontaneous, and often impulsive.” (Grello, Welsh & Harper 2006, S. 255)
Um die verschiedenen Formen des Casual Sex konkreter zu fassen, kristallisieren sich in der Forschung die folgenden Kriterien heraus:
- Zeitdauer, bis es zum Sexualkontakt kommt;
- Dauer der Beziehung, Häufigkeit des Sexualkontakts mit demselben Partner;
- vorheriger Grad der Bekanntheit der Partner;
- Form der sexuellen Aktivität (nicht-koital oder koital).
Während Herold und Mewhinney dabei nur en passant von „Sex am selben Abend des Kennenlernens“ sprechen (Herold & Mewhinney 1993, S. 37), werden Regan und Dreyer konkreter, wenn sie zusätzlich davon ausgehen, dass Casual Sex nur zwischen Fremden oder entfernten Bekannten stattfindet und nur einmalig stattfindet (Regan & Dreyer 1999, S. 2f). Diese Definition wurde vielfach diskutiert, bis Weaver und Herold darauf aufbauend eine stärkere Differenzierung vornahmen, die vor allem auf dem Prinzip der emotionalen Nicht-Involviertheit aufbaut, unter dieser Voraussetzung aber sehr verschiedene Ausprägungen erlaubt. So unterscheiden die Autoren zwischen One-Night-Stands, „Flings“ (kurzzeitigen Affären) und Casual-Sex-Beziehungen, bei denen eine rein sexuell ausgerichtete Beziehung über einen längeren Zeitraum gepflegt wird. Auch öffnen sie das Konzept gegenüber möglichen Sexualkontakten auch zwischen Freunden und Expartnern, solange der Casual Sex aus rein sexuellen Absichten stattfindet (Weaver & Herold 2000, S. 24). Grello, Welsh und Harper kommen dazu zu dem Ergebnis, dass Casual Sex sogar tendenziell eher zwischen Bekannten/Freunden als zwischen gänzlich Fremden stattfindet (Grello, Welsh & Harper 2006, S. 255). Die Grenzen sind natürlich dann fließend, wenn aus zunächst unverbindlichen sexuellen Aktivitäten auch emotional begründete Beziehungen entstehen. Weaver und Herold weisen zusätzlich darauf hin, dass auch nicht-koitale Aktivitäten als Casual Sex gewertet werden können, dazu liegen aber noch wenig weitere Erkenntnisse vor.
Als Begleitumstände für Casual Sex werden die generelle Erwartung darauf und die Freude daran benannt, beide führen zu einer höheren Bereitschaft zur Annahme von sexuellen Angeboten (Herold & Mewhinney 1993). Ein spezielles lokales Umfeld ist förderlich, um unverbindliche sexuelle Beziehungen aufzunehmen, Urlaub oder Dating-Bars als Rahmenbedingungen sind dazu geeigneter als etwa ein College-Campus (Ragsdale, Difranceisco & Pinkerton 2006; Herold & Mewhinney 1993).
Gründe und Motive für eine generelle Bereitschaft und ein aktives Ausleben von Casual Sex liegen nach Regan und Dreyer im Erziehungshintergrund bzw. dem soziokulturellen ebenso wie dem evolutionstheoretischen Umfeld (Regan & Dreyer 1999). In Studien erforschten sie darüber hinaus die individuellen Motive von weiblichen Probanden und fanden fünf Gruppen von Gründen und Motiven: Intrapersonelle Gründe, Gründe des Sexualpartners, interpersonelle Gründe, Gründe aus Sozialumfeld sowie Gründe durch das physische Umfeld (Regan & Dreyer 1999, S. 12.). Diese Ergebnisse werden z. B. durch Weaver und Herold in einer offenen Befragung weiblicher Probanden bestätigt (Weaver & Herold 2000).
Für einen oder beide Partner können sich unbefriedigende Folgen aus der Praktizierung von Casual Sex ergeben, wenn die intrapersonellen Vorstellungen voneinander abweichen. Bei gleicher Zielsetzung kann von einem befriedigenden Erlebnis ausgegangen werden, bei differierenden Vorstellungen können sich intra- und interpersonelle Komplikationen ergeben, die sich laut Regan und Dreyer geschlechtsspezifisch verallgemeinern lassen:
„To the extent, however, that each gender enters a short-term liaison with disparate goals, sexual miscommunication and interpersonal conflict may result.” ((Regan & Dreyer 1999, S. 19f.)
Es ist von einer generellen Differenz in männlichen und weiblichen Motiven, Wünschen und Strategien in Bezug auf Casual Sex auszugehen, die z. B. Roese in seiner Untersuchung der Theorie des Bedauerns analysiert und dabei zu dem Ergebnis kommt, dass Männer eher bedauern, zu wenig Sexualpartner gehabt zu haben, Frauen hingegen, zu viele. Daraus resultieren als konträre Zielsetzungen die männliche Suche nach mehr Partnern („promotion goal“) bzw. die Vermeidung zu vieler Sexualkontakte bei Frauen („prevention goal“), die Roese auch auf differierende evolutionstheoretische Modelle zurückführt (Roese, Pennington, Coleman & Kenrick 2006, S. 771). Diese Differenz in Vermeidung von bzw. Suche nach Sexualkontakten wird durch die Erkenntnis von Herold und Mewhinney gestärkt, wenn sie feststellen:
„The women had as many sexual partners as the men, but […] reported less enjoyment and more guilt about casual sex than did the men.” (Herold & Mewhinney 1993, S. 36)
Die Gender-Differenz spiegelt sich auch in der Partnerwahl. Auch wenn insgesamt und bei beiden Geschlechtern gleichermaßen die Ansprüche an „short term mates” im Vergleich zu denen an „long term mates” niedriger sind, ergeben sich bei den Kriterien für erstere deutliche Unterschiede, wie Regan anmerkt: „Women were more selective than men when considering a potential short-term […] mate“ (Regan 1998, S. 53). Kenrick, Groth et al. bringen das in Zusammenhang mit evolutionsbedingten Aspekten, „as men would potentially make little investment in any resulting offspring“ (Kenrick, Groth, Trost & Sadalla 1993, S. 952). Wie weiter oben schon angemerkt, sehen Frauen unverbindliche Sexualkontakte darüber hinaus eher als Strategie, eine langfristige, auch emotional verbindliche Beziehung einzugehen, dieser Aspekt dürfte die höheren Ansprüche auch an „short term mates“ zusätzlich erklären. Zudem steigt der Auswahlstandard bei Frauen, je höher sie ihren eigenen Wert als Partner einschätzen. Ein solcher Zusammenhang besteht bei Männer nicht (Regan 1998, S. 66).
Generell stellt Townsend für Casual Sex als Konzept für unverbindliche, rein sexuell ausgerichtete Beziehungen fest, dass Frauen auch bei genereller Aufgeschlossenheit gegenüber Casual Sex i. d. R. durch die sexuelle Aktivität verletzbarer werden und schneller ein höheres Maß an Verbindlichkeit anstreben. Um dieser Verletzlichkeit angemessen zu begegnen, versuchen sie einerseits, ihre Gefühle zu kontrollieren, andererseits aber auch, durch selektive Partnerwahl oder Investition in bestehende Beziehungen eine erhöhtes Maß an Verbindlichkeit zu erreichen (Townsend 1995, S. 196).
Abschließend kann festgehalten werden, dass für unverbindliche Sexualkontakte die bestehenden oder erst entstehenden Erwartungen an die Beziehung eine geschlechtsspezifisch und individuell differierende Rolle spielen und der Übergang von „short term mates“ zu „long term mates“ in den jeweiligen Beziehungen jeweils neu ergründet und im Idealfall ein beiderseits befriedigender Status festgelegt werden muss.
2.1.2 Polygamie, Polyandrie, Polyfidelität, Polyamourösität
Auch wenn sie für die weitere Untersuchung nur sehr bedingt von Interesse ist, stellen einige der nachfolgend vorgestellten Konzepte einen hochaktuellen Teil der Forschung zu nicht-monogamen Lebensformen dar. Die Clusterung nach der Vorsilbe „Poly“ bringt dabei vollkommen unterschiedliche Vorstellungen auf den kleinsten und einzigen gemeinsamen Nenner, indem Ansätze zu partnerschaftlichen Beziehungen mit mehr als zwei Partnern zusamengefasst werden.
Auf der einen Seite stehen mit der Polygamie und Polyandrie zwei historische, inzwischen nur noch sehr bedingt relevante Konzepte zur sexuellen Beziehung, in der ein Geschlecht klar dominiert. Polygamie bezeichnet eine Konstruktion, in der ein Mann mehrere Frauen ehelicht, bei der Polyandrie kann umgekehrt eine Frau mehrere Männer heiraten. Die gesellschaftlichen Wurzeln für diese Konzepte liegen meist in ideologischen oder religiösen Überzeugungen, in der westlichen Welt stehen als eines der wenigen verbleibenden Beispiele die Mormonen. Die Verflechtungen, die sich dabei in der Erfüllung religiöser und persönlicher Pflichten ergeben, stellen ein eigenes Forschungsgebiet dar und sind aufgrund des sehr speziellen Umfelds, in dem sie auftreten, hier nicht weiter von Interesse.
Polyfidelität und weitergehend Polyamourösität hingegen stellen aktuelle Strömungen dar, die seit den 1960er Jahren zunächst in homo- und bisexuellen Kreisen entstanden sind. Polyfidelität beschreibt dabei nach Lano und Parry „a relationship involving more than two people who have made a commitment to keep the sexual activity within the group and not to have outside partners” (Lano & Parry 1995). Die Abgrenzung zur Polyamourösität ist fließend und kann am ehesten über den Grad der rein sexuellen Beziehung erfolgen: Während Polyamourösität eine „Grenzüberschreitung zwischen sexuell und nicht-sexuell, Freundschaft und Beziehung“ darstellt, ist bei der Polyfidelität tendenziell immer eine sexuelle Komponente enthalten (Klesse 2006, S. 566). Dennoch gehen beide Formen nicht-monogamer Lebensweisen ineinander über.
Weitaus klarer und von den Vertretern der Polyamourösität stets betont ist die Abgrenzung der Konzepte zu Casual Sex, Swinging und ähnlichen promisken Verhaltensweisen. Als wesentliche Grundprinzipien verweist Klesse auf Ehrlichkeit, Übereinstimmung und Einigkeit innerhalb und über die Form des Zusammenlebens (Klesse 2006). Newitz kommt zu dem Schluss, dass Polyamourösität „realistischer“ sei als Monogamie, da mit ihr der Tatbestand akzeptiert werde, dass Monogamie nicht in der Natur des Menschen liegt und vor allem eine gesellschaftlich geforderte Norm darstellt (Newitz 2006). Wiederum in Abgrenzung zur Promiskuität betont Polyamourösität, wie Klesse anmerkt, dabei die Liebe, während sonstige Nicht-Monogamie auf einem sexorientierten Lebensstil beruht (Klesse 2006). Insofern kann sie ein Konzept für moderne Beziehungskonstellationen liefern, in dem emotionale und sexuelle Komponenten und Verbindlichkeiten für die jeweilige Gruppe erarbeitet werden, um ein gleichberechtigtes und beständiges Zusammenleben zu ermöglichen. Darin sehen die Polyamouristen das große Potenzial des Konzepts, auch wenn gegenüber der Gesellschaft noch auf längere Zeit hin ein hohes Maß an Überzeugungsarbeit notwendig sein wird, um Akzeptanz zu erreichen (vgl. Klesse 2006; Newitz 2006).
2.2 Einflussfaktoren für den sexuellen Lebensstil
Im folgenden Kapitel werden als Einflussfaktoren für den sexuellen Lebensstil die Gender-Differenz, Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexuelle Orientierung, die soziosexuelle Orientierung und die Einflüsse des soziokulturellen Umfelds in ihren relevanten Forschungsaspekten vorgestellt. Der zweite, dritte und vierte Abschnitt bauen dabei aufeinander auf und gehen von einer engeren, vorrangig biologischen Betrachtung des einzelnen Individuums über eine breitere, auch andere Wissenschaften einbeziehende Untersuchung bis zur Einordnung in den größeren Kontext des soziokulturellen Umfelds. Da die Gender-Differenz als Grundproblematik in Bezug auf das Sexualverhalten übergeordnet eine maßgebliche Rolle spielt, ist die Vorstellung dieses Themenbereichs einleitend vorangestellt.
2.2.1 Gender-Differenz
Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern beziehen sich im Kontext dieser Untersuchung auf ein voneinander abweichendes Sexualverhalten allgemein, die evolutionstheoretischen und psychoanalytischen Varianten in Bezug auf die Partnerwahl sowie auf die durch die Gesellschaft geprägten Erwartungen an das Rollenverhalten, den „double standard“.
Das Sexualverhalten von Männern und Frauen ist allgemein von signifikanten Unterschieden geprägt, wie Townsend, Kline und Wasserman feststellen:
„Sex differences remain strong in masturbation rates, timing and causes of first arousal, motivations for coitus, attraction to dominance, and the tendency to dissociate coitus from emotional involvement.” (Townsend, Kline & Wasserman 1995, S. 31)
Für die Geschlechter gelten konträre Ziele darüber, was sie in einer Beziehung erreichen wollen: Während Frauen nach emotionaler Verbindlichkeit streben, erhoffen sich Männer sexuellen Zugang. Nach Townsend, Kline und Wasserman führt das dazu, dass die Geschlechter mit jeder Beziehung, die sie eingehen, einen Handel, einen Austausch des jeweils gewünschten Guts vornehmen (Townsend, Kline & Wasserman 1995, S. 35f). Im Einzelnen ermittelt Townsend folgende Charakteristika des männlichen Sexualverhaltens:
- Männer sind für rein sexuelle Bekanntschaften offener als Frauen;
- Männer bevorzugen Partnervielfalt;
- Männer sind mehr auf den Coitus und Orgasmus fixiert als Frauen;
- Männer werden durch visuelle Stimuli schneller erregt als Frauen;
- die Entscheidung über möglichen Sexualkontakt kann von Männern quasi sofort getroffen werden;
- Männer sehen mehr auf äußere Attraktivität als Frauen, die eher auf sozioökonomischen Status achten (Townsend 1995, S. 174).
Vor dem Hintergrund dieser Merkmale haben Mikach und Bailey ermittelt, dass für Frauen mit einer vergleichsweise hohen Anzahl von Sexualpartnern, also einem diesbezüglich eher maskulin konnotierten Verhalten, auch in Bezug auf andere Charakteristika eine maskuline Prägung festzustellen war (Mikach & Bailey 1999, S. 141).
Auch in der Partnerwahl zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Unter anderem weist Regan darauf hin, dass Frauen insgesamt höhere Auswahl-Standards haben als Männer (Regan 1998, S. 62). Dies wird in der evolutionstheoretischen Forschung mit den möglichen biologischen Folgen erklärt, da Frauen bei einer möglichen Fortpflanzung höhere Risiken und mehr Arbeit auf sich nehmen, Männer hingegen potenziell wenig Investition in möglichen Nachwuchs geben müssen (Bailey, Gaulin, Agyei & Gladue 1994; Kenrick, Groth, Trost & Sadalla 1993). Schon daraus resultiert für Männer eine generell höhere Bereitschaft zu unverbindlichem Sex und niedrigeren Standards in der Auswahl von „short term mates“. Townsend geht noch weiter, indem er bei andauernder Promiskuität eine Verstärkung für Männer feststellt:
„For men, increasing numbers of partners will correlate with ease of not becoming emotionally involved or feeling emotionally vulnerable, and not having investment thougths.” (Townsend 1995, S. 178)
Diesem männlichen Interesse steht aus weiblicher Sicht eine Suche und Tests nach Anzeichen dafür entgegen, dass Männer bereit sind, eine verbindliche Beziehung mit den entsprechend notwendigen Investitionen einzugehen (Townsend, Kline & Wasserman 1995).
Diese Verhaltensweisen entsprechen dem gesellschaftlich etablierten „double standard”, wie ihn McCormick erläutert, wenn Sexerlangung als ein männliches, Sexvermeidung als typisch weibliches Ziel beschreibt (McCormick 1987). Normativ angewendet führt dieser „double standard“ dazu, dass Frauen, die ihm nicht entsprechen, von der Gesellschaft als unmoralisch verurteilt werden. Auf diesen Umstand verweisen Liston und Moore-Rahimi in ihrer ethymologischen Untersuchung zum Schimpfwort „slut“ („Schlampe“) für Frauen: „These words [slut et al.] apply only to female and as such underscore the gender inequality in notions of sexuality“ (Liston & Moore-Rahimi 2005, S. 214). Frauen erleben zwar inzwischen eine größere Freiheit als früher, ein aktives Sexualverhalten zu haben, aber sie sind „still constrained by a more covert but powerful double standard about morality“ (Katz & Farrow 2000, S. 802). Klesse verweist mit Blick auf den aktuellen Forschungsstand in diesem Zusammenhang darauf, dass es für Frauen im Sinne einer gesellschaftlichen Achtung förderlich sein kann, ein promiskes Verhalten durch romantische Liebesvorstellungen zu erklären, sich also lieber naiv-verklärt darzustellen, als sich unmoralisch nennen zu lassen (Klesse 2006, S. 578).
Diese Erkenntnis erweitert den Ansatz von Herold und Mewhinney, wenn sie feststellen, dass der „double standard“ seit dem späten 20. Jahrhundert zwar zunehmend aufweicht, Frauen aber weniger an befriedigenden Sex ohne Liebe glauben und noch immer eher durch Liebe und das Interesse an einer dauerhaften Beziehung zum Sex motiviert sind (Herold & Mewhinney 1993, S. 36). Darin schließt sich der Kreis zu den oben aufgeführten geschlechtsdifferenten Kriterien zur Partnerwahl.
2.2.2 Geschlechtsidentität, Geschlechtsrolle und sexuelle Orientierung
Die Geschlechtsidentität kann als das signifikanteste Merkmal der Geschlechtscharakterisierung gelten, da die Einordnung im Wesentlichen aufgrund biologischer Anlagen und mit dem Prozess der Selbstidentifikation i. d. R. innerhalb der ersten drei Lebensjahre erfolgt (Dressler & Zink 2002). Einer Person wird entsprechend der Anlagen dabei, mit wenigen Ausnahmen, eine männliche oder weibliche Geschlechtsidentität zugewiesen.
Einen weitergehenden Aspekt der Geschlechtsidentität sehen Beier, Bosinski, Hartmann und Loewit dabei im Zusammenhang mit der Geschlechtsrolle: „Die Geschlechtsidentität ist die eigene Erfahrung der Geschlechtsrolle, und die Geschlechtsrolle ist die Manifestation der Geschlechtsidentität nach außen“ (Beier, Bosinski, Hartmann & Loewit 2001, S. 73). Die Geschlechtsrolle selbst ist einer Person dabei nicht eingeschrieben, vielmehr ist „Handeln in Geschlechtsrollen […] erlernt“, d. h. durch die Erfahrung innerhalb und Erziehung durch das individuelle Umfeld angeeignet (Runkel 2003, S. 15). Auch und vor allem in Bezug auf das Sexualverhalten lassen sich dabei vielfache geschlechtsrollentypische Verhaltensweisen feststellen. So weisen Roese, Pennington, Coleman und Kenrick darauf hin, dass generell in der Anbahnung von Beziehungen Männer aktiver und direkter, Frauen hingegen weniger initiativ sind (Roese, Pennington, Coleman & Kenrick 2006, S. 771). Noch weiter geht McCormick, wenn er feststellt, dass die Gestaltung und Definition von Beziehungen und Situationen, auch hinsichtlich ihrer sexuellen Komponenten, traditionell eher durch Männer erfolgt, Frauen hingegen weniger dazu ermutigt (McCormick 1987, S. 4). In Bezug auf die Art und Weise der Partnerwahl haben das Geschlecht und die Geschlechtsrolle einen größeren Einfluss als die sexuelle Orientierung, wie Bailey, Gaulin, Agyei und Gladue anmerken (Bailey, Gaulin, Agyei & Gladue 1994, S. 1089).
Als sexuelle Orientierung wird die „Ausrichtung des sexuellen Interesses auf bestimmte Sexualobjekte“ bezeichnet. Im engeren Sinne gilt dazu die Kinsey-Skala mit einem Kontinuum zwischen hetero-, bi- und homosexuell, im Weiteren, hier zu vernachlässigenden Sinne können auch andere sexuelle Vorlieben erfasst werden (Dressler & Zink 2002, S. 374). Um eine Zuordnung auf der Kinsey-Skala vornehmen zu können, finden z. B. die vier Ebenen der sexuellen Orientierung Anwendung, die Ebene der physiologischen Reaktion, die Ebene der Phantasie, die Ebene des Verhaltens und die Ebene der Selbsteinordnung (Beier, Bosinski, Hartmann & Loewit 2001, S. 59). Eine extreme Zuordnung auf der Skala geht danach mit einer generell eher einheitlich orientierten Objektwahl einher. Bei einem mittleren Wert, also einer insgesamt bisexuellen Orientierung, können Wechsel im bei der Partnerwahl bevorzugten Geschlecht erfolgen.
Welche Verbreitung die jeweiligen Orientierungen innerhalb der Gesellschaft einnehmen, lässt sich aufgrund der in der christlichen Tradition nach wie vor starken Tabuisierung und Ablehnung von Homosexualität schwer sagen. Schon Kinseys Studien haben jedoch ergeben, „dass 50% der männlichen und 28% der weiblichen Probanden sich irgendwann schon mal zum anderen Geschlecht hingezogen fühlten“ (Alfred Kinsey, zit. n. Beier, Bosinski, Hartmann & Loewit 2001, S. 58).
2.2.3 Soziosexuelle Orientierung
Der Begriff der soziosexuellen Orientierung leitet sich in seiner aktuell vorrangigen Anwendung in der Forschung nicht vom klassischen Begriff der Soziosexualität ab, wie er etwa von Kentler vertreten wurde (Kentler 1973). Vielmehr wird er in der Definition von Gangestad und Simpson verwendet, die unter der soziosexuellen Orientierung eine „spezielle Verhaltensveranlagung“ verstehen. Dazu haben sie ein System entwickelt, um den individuellen Grad innerhalb eines Kontinuums zwischen restriktiver und unrestriktiver soziosexueller Orientierung zu bestimmen (Gangestad & Simpson 1990; Simpson & Gangestad 1991). Die Einordnung erfolgt anhand von fünf Kategorien, die die Autoren in ihrer weiteren Arbeit teilweise modifizieren, im Wesentlichen aber wie folgt lauten:
- Anzahl der Sexualpartner im vergangenen Jahr;
- Anzahl von One-Night-Stands insgesamt;
- vermutete Anzahl der Sexualpartner in den nächsten fünf Jahren;
- Häufigkeit von Sexualphantasien über einen anderen als den aktuellen Partner;
- Veranlagung zu unverbindlichem Sex und Sex ohne emotionale Bindung.
Hohe Werte auf der Skala entsprechen demnach einer unrestriktiven, niedrige Werte einer restriktiven soziosexuellen Orientierung (Gangestad & Simpson 1990, S. 71), wobei eine unrestriktive soziosexuelle Orientierung insgesamt eine Veranlagung zu einem aktiveren, weniger durch moralische oder andere Grenzen bestimmten Sexualverhalten bedeutet.
Statistisch wurde etwa für die amerikanische Bevölkerung nachgewiesen, dass Männer generell höhere Werte aufweisen als Frauen (Schmitt 2005). Auch wenn das für eine deutliche Gender-Differenz in Bezug auf die soziosexuelle Orientierung spricht, stellen Simpson und Gangestad jedoch fest, dass die Spannbreite innerhalb eines Geschlechts deutlich größer als die Differenz zwischen den Geschlechtern ist“(Simpson & Gangestad 1991, S. 870).
Die soziosexuelle Orientierung ist keine angeborene, sondern eine erlernte. Simpson und Gangestad benennen als Einflussfaktoren die Umgebungseinflüssen allgemein, den oben erwähnten „double standard“ der Gesellschaft sowie auch Kindheitserfahrungen und genetische Einflüsse (Simpson & Gangestad 1991, S. 879f).
Schmitt merkt im Zusammenhang der Gender-Differenz im Bereich der soziosexuellen Orientierung an:
„In addition, women's sociosexuality, in many cases, was more strongly related to environmental demand than men's sociosexuality.” (Schmitt 2005, S. 272)
Zu den Vorgaben aus den institutionalisierten Erwartungshaltungen exisitieren verschiedene Ergebnisse. Regan und Dreyer belegen theoretisch und empirisch, dass die Rolle des Mannes in Bezug auf sexuelle Initiative allgemein als eher aktiv, die der Frau als eher passiv angenommen wird (Regan & Dreyer 1999). Ähnliches stellen Weaver und Herold fest, wenn sie folgende Faktoren des traditionellen „sexual script“ für Frauen benennen: Frauen haben kein Interesse und keinen Spaß an Casual Sex; sie bevorzugen Sex in emotionalen und verbindlichen Beziehungen und fühlen sich schuldig, wenn ihr Sexualverhalten nicht der kulturellen Norm entspricht (Weaver & Herold 2000, S. 25). Im Zusammenhang mit Schmitts Erkenntnis lässt sich im Umkehrschluss die Tendenz zur unrestriktiven soziosexuellen Orientierung bei Frauen erklären.
In diesem Kontext stellen Mikach und Bailey vor dem Hintergrund ihrer These, dass Frauen mit vielen Sexualpartnern tendenziell maskuline Persönlichkeitsmerkmale zeigen, die Frage der Ursächlichkeit, ob also eine unrestriktive soziosexuelle Orientierung die maskuline Prägung von Frauen fördert oder aber umgekehrt die maskuline Disposition ein unrestriktives Sexualverhalten. (Mikach & Bailey 1999, S. 148)
In der Untersuchung des Zusammenhangs von soziosexueller Orientierung und weiteren Persönlichkeitsmerkmalen kommen Simpson und Gangestad zu dem Ergebnis, dass „sexually permissive individuals, relative to less permissive ones, are known to be less religious, less socially and politically conservative and better educated“ (Simpson & Gangestad 1991, S. 871).
Dabei wird auch für die soziosexuelle Orientierung bestätigt, was schon für die Neigung zu Casual Sex festgestellt wurde: Die Orientierung ist nicht notwendigerweise lebenslang einheitlich, vielmehr können sich im Zeitablauf Änderungen ergeben (vgl. Mikach & Bailey 1999; Townsend 1995; Simpson & Gangestad 1991). Darüber hinaus kann eine Differenz zwischen der Veranlagung und dem tatsächlich gelebten Verhalten bestehen, so ist es durchaus möglich, eine unrestriktive soziosexuelle Orientierung aufzuweisen und dennoch keinen promisken Lebensstil anzunehmen (Simpson & Gangestad 1991, S. 871).
2.2.4 Die Einflüsse des soziologischen Umfelds
„Jede Kultur hat Vorstellungen, Regeln und Normen für das Verhalten der Geschlechter, und jede Kultur setzt mehr oder weniger große Energien daran, diese Normen für adäquates, geschlechtsrollenkonformes Verhalten durchzusetzen.“ (Beier, Bosinski, Hartmann & Loewit 2001, S. 76)
Die Feststellung von Beier, Bosinski, Hartmann und Loewit trifft in besonderem Maße auf das geschlechtsrollenspezifische Sexualverhalten zu, da die menschliche Sexualität noch immer einer starken gesellschaftlichen Tabuisierung unterliegt und Normabweichungen in diesem Bereich umso stärker verurteilt werden. Für die christlich-westliche Gesellschaft gilt weitgehend noch immer das Ideal der monogamen Beziehung, Simpson und Gangestad vermerken „contemporary social sanctions against sex outside of longterm, committed relationships“ (Simpson & Gangestad 1992, S. 34).
Die Regulierungen betreffen Frauen weitaus stärker als Männer, was Runkel aus der traditionell patriarchalischen Gesellschaftsordnung ableitet:
„In einer patriarchalischen Gesellschaft, die auf der Trennung von Lust und Leistung beruht, wurde die Frau primär vom außerfamiliären Leistungsbereich abgeschnitten und auf den innerfamiliären Lustbereich […] verwiesen.“ (Runkel 2003, S. 113)
Die Konsequenzen, die ein negativ bewertetes Verhalten mit sich bringt, können sehr gut anhand des Forschungsfelds zur „slut“ („Schlampe“) nachvollzogen werden. Zum einen zeigt sich die Relevanz der jeweiligen Gestaltung des zugrunde liegenden Wertemaßstabs. Dazu weist Tanenbaum darauf hin, dass es keinen allgemeinen Konsens darüber gibt, was ein Mädchen zur „Schlampe“ macht, sondern im Gegenteil vielfältige, kontextbezogene Unterscheidungen zwischen „gut“ und „schlampig“ (Tanenbaum 2000, S. 88). Dies bestätigen auch Liston und Moore-Rahimi, die verschiedene Gründe auflisten, die zur Stigmatisierung eines Mädchens als „slut“ führen können ((Liston & Moore-Rahimi 2005), aber nicht müssen.
Als einen weiteren Punkt verdeutlichen Liston und Moore-Rahimi, welches Verhalten der Umwelt die Einordnung als „Schlampe“ nach sich zieht: „Often, students and even the staff of a school marginalize, mistreat, abuse, and disregard a labeled girl“ (Liston & Moore-Rahimi 2005, S. 214). Die aufgrund des sexuellen Verhaltens vorgenommene Beurteilung wird also für andere Lebensbereiche übernommen und bringt dadurch für die Betroffene zusätzliche Nachteile mit sich.
Die Stigmatisierung kann auch auf Personen im Umfeld der „Schlampe“ übertragen werden, vielleicht einer der Gründe, weshalb bei der Betrachtung historischer wie aktueller Situationen Frauen häufig selbst die härtesten Richter gegenüber ihren Geschlechtsgenossinnen waren und sind (Attwood 2007).
Die Einflüsse des soziokulturellen Umfelds bestehen also darin, einerseits Vorgaben für akzeptiertes, geschlechtsrollenkonformes Verhalten zu institutionalisieren und andererseits durch drohende Stigmatisierung und Nachteile im sozialen Umfeld eine Einhaltung der Normen zu kontrollieren. Diese Vorgaben im Hinblick auf das Sexualverhalten sind für Frauen noch immer restriktiver als für Männer, so dass Frauen in Bezug auf ihr Sexualverhalten insgesamt schneller zu Schuldgefühlen, Scham und Reue neigen.
Daran ändert auch die zunehmende Aufweichung des „double standards“ wenig bzw. sorgt für eine zusätzliche Komplikation, wie Attwood mit Verweis auf Griffin anmerkt:
„The space and performance of youthful femininity continues to be difficult precisely because of the continuation of a double standard, and is newly so because of the contemporary neo-liberla ideals of individual freedom which oblige girls to ‘be free’ and ‘have fun’.” (Attwood 2007, S. 242, Hervorhebung im Original)
Statt einer liberalisierten Entscheidungsfindung beschreibt dies ein Spannungsfeld zweier einander diametral entgegen gesetzter Normierungskonzepte, innerhalb dessen jede Frau für sich die passende Position finden und im Zweifelsfall verteidigen muss.
3 Sex and the City: Analyse der Darstellung nicht-monogamer Lebensstile
„Was das Fernsehen liefert, sind nicht Programme, sondern eine semiotische Erfahrung.“ (Fiske 2002, S. 237)
Im vorstehenden Kapitel wurden die Grundlagen zum Forschungsfeld nicht-monogamer Lebensstile vorgestellt. Bei der Anwendung dieser Grundlagen zur Analyse der Serie Sex and the City ergeben sich im Wesentlichen drei Problematiken.
Zum einen beziehen sich die vorgestellten Erkenntnisse auf die westlich geprägte Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Anhand dessen soll eine Analyse einer fiktionalen Welt erfolgen, die zwar große Ähnlichkeit mit der realen Welt impliziert, diese aber zu keinem Zeitpunkt realistisch (im Sinne eines wahren Abbilds) sein kann oder will. Die daraus resultierende Differenz zwischen den Bedeutungsebenen und Rezeptionsebenen muss in der Analyse stets begleitend beachtet werden.
Zwei weitere Problematiken ergeben sich zur Methodik. Theorien und Methoden zur Filmanalyse beziehen sich vorrangig auf eben Filme, entweder fürs Kino oder Fernsehen, explizite Analyseverfahren für Serien, spezieller: lang laufende Serien, finden sich so nicht bzw. nur in Ansätzen. Es besteht also die Notwendigkeit der Adaption und Anpassung des Instrumentariums aufgrund der spezifischen Charakteristika des Materials (vgl. dazu Kapitel 3.1.2.3.).
Die dritte Problematik ergibt sich aus dem interdisziplinären Forschungsansatz, aufgrund dessen eine passende Wahl von Methode bzw. angemessener Methodenkombination vorzunehmen ist. Die entsprechenden Möglichkeiten werden im einleitenden Kapitel 3.1. diskutiert und die schlussendlich getroffene Kombination von empirisch-sozialwissenschaftlich und hermeneutisch-interpretativ begründet.
Im weiteren Verlauf des Kapitels werden zunächst die verwendeten Analysemethoden von Korte und Hickethier unter Bezugnahme auf die Serie vorgestellt. In der anschließenden Inhaltszusammenfassung wird unter Berücksichtigung der Forschung zur Serie der Untersuchungsgegenstand vorgestellt. Dabei werden die für die Frage relevanten Aspekte fokussiert, die Untersuchungen z.B. zur Präsentation der Stadt New York und die Fashion-Thematik werden nicht näher betrachtet. Ergänzend dazu und zur besseren Orientierung des Lesers erfolgt die formal-inhaltliche Bestandsaufnahme anhand eines Episodenprotokolls, das der Darlegung des großen inhaltlichen Bogens dient.
Der nachfolgende inhaltsanalytische Fragenkatalog umfasst eine Mischung aus empirischer und hermeneutischer Fragenstellung, beides auf Grundlage der in Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Basis: Wo möglich, sind die Erkenntnisse im Sinne eines konkreten Codierleitfaden eingeflossen, bei den komplexeren Fragestellungen, die eine vollständige Operationalisierung zu aufwändig gemacht hätten, finden sie Eingang als adäquate Untermauerung bzw. wissenschaftlicher Kontext nach Korte, um die Intersubjektivität der Analyse möglichst gering zu halten. Ergänzend dazu und zur besseren Orientierung des Leser erfolgt die formal-inhaltliche Bestandsaufnahme anhand eines Episodenprotokolls, das der Darlegung des großen inhaltlichen Bogens dient.
Die Vorstellung der Ergebnisse bildet den Kernteil des Kapitels und liefert entsprechend der gewählten Methodenkombination sowohl empirisch-sozialwissenschaftlich als auch hermeneutisch-interpretativ begründete, qualitativ detaillierte Ergebnisse zum Fragenkatalog für die Figuren Carrie und Samantha. Diese werden in der Diskussion der Ergebnisse einander vergleichend gegenübergestellt.
3.1 Methode zur Analyse medialer Darstellung
In der Filmanalyse stehen sich zwei grundsätzlich verschiedene Methoden gegenüber, Hickethier grenzt sie mit den Begriffen der empirisch-sozialwissenschaftlichen Methode und dem hermeneutischen Interpretationsverfahren voneinander ab (Hickethier 2001, S. 30ff). Während für die klassische, medienwissenschaftliche Filmanalyse die hermeneutisch-interpretativen Verfahren überwiegen, finden für die Analyse von Texten, wie sie auch Filme darstellen, in den Sozialwissenschaften qualitativ-empirische Methoden wie etwa die qualitative Inhaltsanalyse Anwendung. Aus unterschiedlichen Disziplinen kommend, scheinen sich beide in Teilen diametral entgegengesetzt zu stehen, müssen sich aber dennoch nicht ausschließen. Im Gegenteil, so auch der Ansatz dieser Arbeit, kann insbesondere für das vorliegende interdisziplinäre Forschungsfeld eine sinnvolle Kombination beider Ansätze die Analyse umso fruchtbarer machen.
Auf der einen Seite steht das aus der Soziologie stammende, über die Literaturwissenschaft Einzug in die geisteswissenschaftliche Forschung erhaltende Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse. Diese basiert vor allem auf der Theorie von Mayring und stellt eine Erweiterung einer quantitativen Auswertung dar:
„Qualitative Inhaltsanalyse will dabei die methodische Systematik der quantitativen Inhaltsanalyse beibehalten und damit die qualitativen Schritte der Textinterpretation ausarbeiten, ohne in vorschnelle Quantifizierungen zu verfallen.“ (Mayring & Hurst 2005, S. 436)
Die Vorteile der qualitativen Inhaltsanalyse bestehen dabei laut Wegener vor allem in der Möglichkeit, „einen Untersuchungsgegenstand - je nach Erkenntnisinteresse des Forschers - aus differenten Blickwinkeln fundiert und methodisch reflektiert [zu] beleuchten […]“ (Wegener 2005, S. 200). Weitergehend stellen Validität und Reliabilität zwei wesentliche Kriterien der empirischen Sozialwissenschaften dar. Aus dieser Sicht verfügt die qualitative Inhaltsanalyse über klare Vorteile gegenüber hermeneutischen Verfahren, da über die Operationalisierung der Variablen und durch genau festgeschriebene und einzuhaltende Codierleitfäden eine größtmögliche Intercoder-Reliabilität gewährleistet ist.
Die Intercoder-Reliabilität stellt auch für die medienwissenschaftlichen Hermeneutiker eine Herausforderung dar, obwohl in dieser Disziplin als ‚Intersubjektivität’ bezeichnet. Eine Beliebigkeit und fehlende Validität soll auch hier vermieden werden. Insgesamt versteht die Medienwissenschaft die Analyse jedoch als Textinterpretation, dies vor allem begründet durch die Annahme, dass die komplexen Bedeutungsebenen insbesondere von Filmen nicht voll operationalisierbar seien: Das Ganze wird hier immer als mehr als die Summe seiner Teile aufgefasst. Dementsprechend spricht z. B. Hickethier davon, dass „die einzelnen Zeichenebenen voneinander zu isolieren und getrennt zu betrachten, […] beim Film wenig ergiebig [ist]: Entscheidend ist immer ihr Zusammenspiel“ (Hickethier 2001, S. 24f). Für ihn liefert die Analyse deshalb vielmehr die Möglichkeit zum „Sinnverstehen künstlerischer Texte“, bei dem
„hinter diesem Schein des allgemein Verständlichen die Strukturen der Gestaltung hervorgehoben und die zusätzlich noch vorhandenen Bedeutungsebenen und Sinnpotentiale aufgedeckt werden.“ (Hickethier 2001, S. 32.)
Ein Grundgedanke ist dabei die latente ‚Mehrdeutigkeit’ von Filmen, die niemals final festgeschrieben werden kann, weshalb die hermeneutisch orientierte Analyse zum Ansatz hat, diese Mehrdeutigkeiten zwar erkennbar zu machen, aber nicht bis ins letzte auszuloten (vgl. Hickethier 2001, S. 32). Faulstich unterscheidet hierzu sechs verschiedene Richtungen der Filmanalyse: allgemeiner „trukturalistischer“ Zugriff, ferner „biografische, literatur- oder filmhistorische, soziologische, psychologische und genrespezifische Filminterpretation“ (Faulstich 1988, S. 90). Diese ermöglichen dann „analytische Zugänge“ und ein „tieferes Verstehen“, ohne den Anspruch auf vollständige Rekonstruktion des Materials zu erheben (vgl. Hickethier 2001, S. 27).
Wie weiter oben erwähnt, befasst sich trotz dieses Verständnisses von komplexer Mehrdeutigkeit auch die hermeneutische Filmanalyse mit der Problematik der Intersubjektivität: Auch wenn die Situation des individuellen Rezipienten anders bewertet wird als bei der qualitativen Inhaltsanalyse, stellt eine fundierte Einbettung in den jeweiligen (Forschungs-)Kontext einen wesentlichen Bestandteil der Analyse dar, um Beliebigkeit in der Interpretation zu vermeiden – für die vorliegende Arbeit wäre das also eine adäquate Berücksichtung der soziologischen und psychologischen Erkenntnisse zur Promiskuität.
Ein weiterer Punkt zur größtmöglichen Ausblendung intersubjektiver Störfaktoren stellt der ‚hermeneutische Zirkel’ dar, durch den die Annäherung an den Text eine immer stärkere Konkretisierung und Verdichtung erfährt, wie Koebner beschreibt:
„Wiederholte Anschauung und wiederholte Kontrolle der Beschreibung durch den Blick auf den Gegenstand, die Fähigkeit zur Einfühlung und Abstraktion, der ausreichenden Begründung und der Veranschaulichung am Beispiel.“ (Koebner 1990, S. 7)
Insgesamt wird die Intersubjektivität also von der hermeneutischen Analyse zwar anders bewertet, dennoch aber in ihren Auswirkungen, vor allem in Hinblick auf den Vorwurf der Beliebigkeit, ernst genommen:
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836624039
- DOI
- 10.3239/9783836624039
- Dateigröße
- 726 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Ilmenau – Angewandte Medienwissenschaft, Medien- und Kommunikationswissenschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Dezember)
- Note
- 2,2
- Schlagworte
- city filmanalyse korte inhaltsanalyse kriterienkatalog
- Produktsicherheit
- Diplom.de