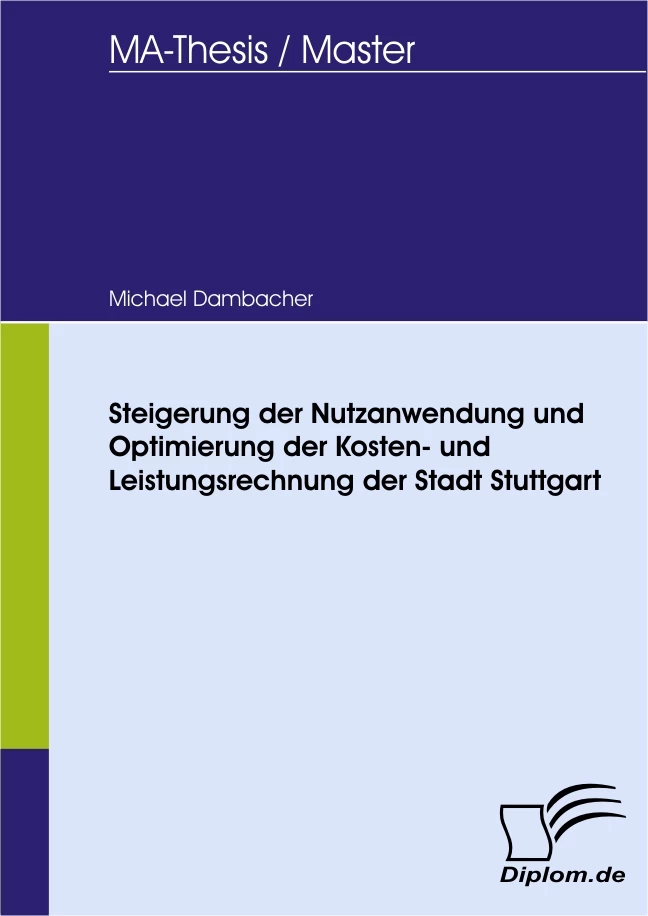Steigerung der Nutzanwendung und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart
Zusammenfassung
Im Jahr 1999 begann die Landeshauptstadt Stuttgart mit der Einführung eines Neuen Finanzwesens mit SAP/R3 und dem gleichzeitigen Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).
Die KLR ist in den verschiedenen Ämtern der Stadt Stuttgart mittlerweile unterschiedlich stark in ihrer Kostenstellen- bzw. Produktgliederungstiefe ausgeprägt und weist stadtweit einen sehr unterschiedlichen Grad der Nutzanwendung auf.
Die Kosten- und Leistungsrechnung findet derzeit hauptsächlich Anwendung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation, sowie für ein amtsinternes Berichtswesen innerhalb technischer Ämter, wie z.B. beim Garten- und Friedhofsamt.
Ferner finden die Jahresergebnisse der KLR stadtweit Berücksichtigung bei den sog. Jahresprogrammen, die ähnlich einer Balanced Scorecard, der Führungsebene eine Steuerung der Stadt Stuttgart über Ziele und Kennzahlen ermöglicht.
Sieben Jahre nach Einführung der KLR herrscht seitens der Führungsebene Unzufriedenheit über den geringen Grad der Nutzanwendung und Akzeptanz der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die teils geringe Aussagekraft des Zahlenmaterials zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Einheiten der Ämter und Vergleichbarkeit von Eigen- und Fremdleistungen Dritter.
Eine Organisationsuntersuchung eines externen Beratungsunternehmens im Bereich der technischen Ämter, wie z.B. im Hoch- oder im Tiefbauamt, wies die o.g. Defizite nochmals gesondert aus und stellte zugleich mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung in der Stadtverwaltung dar. Da das Thema Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung in den letzten zwei Jahren kaum noch forciert wurde, sieht die Stadtkämmerei anlässlich der Ergebnisse dieser Organisationsuntersuchung konkreten Handlungsbedarf.
Die Amtsleitung der Stadtkämmerei hat sich daher entschlossen, die Nutzanwendung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Ämtern zu steigern.
Im Rahmen der Master Thesis soll daher ein Sollkonzept entwickelt werden, das zur Steigerung der Nutzanwendung der Kosten- und Leistungsrechnung dienen soll.
Dabei soll die Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, z.B. die Qualität des Zahlenmaterials oder ein Benchmarking (Lernen von den Besten) innerhalb der Stadt vorangetrieben werden.
Die vorliegende Master Thesis soll dem Leser zunächst einen Überblick über den derzeitigen Entwicklungsstand der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einführung
1.1 Ausgangssituation
1.2 Ziele der Arbeit
1.3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Master Thesis
2 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
2.1 Ziele und Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
2.2 Begriffserklärungen
2.2.1 Kostenbegriff
2.2.2 Kostenartenrechnung
2.2.3 Kostenstellenrechnung
2.2.4 Kostenträgerrechnung
3 Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart
3.1 Vorhandene Gesetze, Regelungen und Fachkonzepte
3.1.1 Kommunales Haushaltsrecht
3.1.2 CO-Fachkonzept
3.1.3 Dienstvereinbarungen
3.1.4 Dienstanweisungen
3.1.5 Geschäftsanweisung „Interne Leistungsverrechnung“
3.2 Stellenausstattung für den Betrieb der KLR
3.3 SWOT-Anlayse der Kosten- und Leistungsrechnung
3.3.1 Stärken
3.3.2 Schwächen
3.3.3 Chancen
3.3.4 Risiken
3.4 Weitere städtische Finanzinformationssysteme
3.5 Mitarbeiterqualifikation
3.6 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse
4 Sollkonzeption
4.1 Ziele der Konzeption
4.2 Strategie
4.3 Die drei Säulen der Sollkonzeption
4.3.1 Mitarbeiterqualifizierungskonzept
4.3.1.1 Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter.
4.3.1.2 Zielgruppen
4.3.1.3 Schulungsinhalte
4.3.1.4 Schulungsformen
4.3.2 Stadtinternes Marketingkonzept
4.3.2.1 Kundenportfolio der KLR.
4.3.2.2 Unique Selling Proposition
4.3.3 Grobkonzeption eines städtischen Finanzcontrollingsystem
4.3.3.1 Anforderungen an ein Finanzcontrollingsystem…
4.3.3.2 Mögliche Ansätze einer Plankostenrechnung
4.3.3.3 Berichtsarten im Finanzcontrollingsystem…
4.3.3.4 Empfängerorientierte Gestaltung des Finanzberichtswesens…
5 Handlungsempfehlungen
5.1 Maßnahmen zur Mitarbeiterqualifizierung
5.1.1 Klärung des stadtweiten Schulungsbedarfs
5.1.2 Qualifizierungsangebote für Zielgruppen
5.2 Innerstädtischer Marketingmix
5.2.1 Maßnahmen zur Produktpolitik (Product)
5.2.2 Maßnahmen zur Preispolitik (Price)
5.2.3 Maßnahmen zur Distributionspolitik (Place)
5.2.4 Maßnahmen zur Kommunikationspolitik (Promotion)
5.3 Maßnahmen zum Aufbau eines Finanzcontrollingsystems
5.3.1 Anpassung der innerstädtischen Rahmenregelungen
5.3.2 Klärung zentraler Fragen
5.3.3 Anpassung der KLR- Strukturen
5.3.4 Stufenweiser Aufbau einer Plankostenrechnung
5.4 Zusammenfassung aller Maßnahmen
5.5 Terminplanung
6 Ausblick – Die Kosten- und Leistungsrechnung im Neuen Kommunalen Finanzwesen
6.1 Die Bedeutung der KLR im neuen doppischen Stadthaushalt
6.2 Generelle Auswirkungen auf die Stadt Stuttgart
7 Schlussfolgerungen
Literaturverzeichnis
Anhang
Lebenslauf
Eidesstattliche Erklärung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen beiden Betreuern Herrn Hans Drexler von der Steinbeis Hochschule Berlin und Herrn Jochen Münz von der Landeshauptstadt Stuttgart für ihre Bereitschaft und Unterstützung bei der Erstellung dieser Master Thesis recht herzlich bedanken.
Mein besonderer Dank gilt aber auch unserem Ersten Bürgermeister, Herrn Michael Föll, und dem Amtsleiter der Stadtkämmerei Stuttgart, Herrn Volker Schaible, die es mir ermöglicht haben, ein berufsbegleitendes Masterstudium an der Steinbeis Hochschule zu absolvieren.
Abschließend danke ich all meinen Kolleginnen und Kollegen der Stadtkämmerei Stuttgart für die vielfältigen Anregungen, Ideen und die erfahrene Unterstützung während des gesamten zweijährigen Studienverlaufs.
Westhausen, im Februar 2007
Michael Dambacher
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Ziele der Kosten- und Leistungsrechnung
Abbildung 2 Auszug Kostenstellenhierarchie der Stadt Stuttgart
Abbildung 3 Überblick über die Kostenrechnung
Abbildung 4 Auszug aus dem Stuttgarter Intranet
Abbildung 5 Beispiel Kostenstellenbericht der Stadt Stuttgart
Abbildung 6 KLR-Aufgaben der Verantwortlichen im Fachamt
Abbildung 7 Organisatorische KLR-Struktur der Stadt Stuttgart
Abbildung 8 Ergebnisse der SWOT–Analyse
Abbildung 9 Auszug aus dem Stuttgarter Haushaltsplan 2006 / 2007
Abbildung 10 Auszug aus dem KLR-Produktverantwortlichenbericht
Abbildung 11 Auszug aus dem Führungsinformationssystem BEST
Abbildung 12 Auszug aus Stuttgarter Jahresprogramm 2006/2007
Abbildung 13 Auszug aus Stuttgarter Jahresprogramm 2006/2007
Abbildung 14 Auswertungsergebnisse Mitarbeiterschulungen
Abbildung 15 Entwicklung der Schulungsteilnehmerzahl
Abbildung 16 Entwicklungsstand der Stuttgarter KLR
Abbildung 17 Ziele der Konzeption
Abbildung 18 Abgeleitete SWOT-Strategien
Abbildung 19 Die drei Säulen der Gesamtkonzeption
Abbildung 20 Qualifikationsanforderungen an Mitarbeiter
Abbildung 21 Kategorisierung der Schulungsgruppen
Abbildung 22 Modulares Schulungsprogramm
Abbildung 23 KLR-Kundenportfolio
Abbildung 24 Empfängerorientiertes Berichtswesen
Abbildung 26 Säulen des Marketingmixes
Abbildung 27 KLR-Marketingmaßnahmen
Abbildung 28 Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen
Abbildung 29 Terminplanung Maßnahmenpakete
Abbildung 30 Die Drei Komponenten-Rechnung
Abbildung 31 Verzahnung der KLR mit neuer Haushaltsplanung
Abbildung 32 Operative Planung im Neuen Haushalts- und Rechnungswesen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einführung
1.1 Ausgangssituation
Im Jahr 1999 begann die Landeshauptstadt Stuttgart mit der Einführung eines „Neuen Finanzwesens“ mit SAP/R3 und dem gleichzeitigen Aufbau einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung (KLR).[1]
Die KLR ist in den verschiedenen Ämtern der Stadt Stuttgart mittlerweile unterschiedlich stark in ihrer Kostenstellen- bzw. Produktgliederungstiefe ausgeprägt und weist stadtweit einen sehr unterschiedlichen Grad der Nutzanwendung auf.
Die Kosten- und Leistungsrechnung findet derzeit hauptsächlich Anwendung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation, sowie für ein amtsinternes Berichtswesen innerhalb technischer Ämter, wie z.B. beim Garten- und Friedhofsamt.
Ferner finden die Jahresergebnisse der KLR stadtweit Berücksichtigung bei den sog. Jahresprogrammen, die ähnlich einer Balanced Scorecard, der Führungsebene eine Steuerung der Stadt Stuttgart über Ziele und Kennzahlen ermöglicht.
Sieben Jahre nach Einführung der KLR herrscht seitens der Führungsebene Unzufriedenheit über den geringen Grad der Nutzanwendung und Akzeptanz der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die teils geringe Aussagekraft des Zahlenmaterials zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Einheiten der Ämter und Vergleichbarkeit von Eigen- und Fremdleistungen Dritter.
Eine Organisationsuntersuchung eines externen Beratungsunternehmens im Bereich der technischen Ämter, wie z.B. im Hoch- oder im Tiefbauamt, wies die o.g. Defizite nochmals gesondert aus und stellte zugleich mögliche Ansatzpunkte zur Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung in der Stadtverwaltung dar. Da das Thema „Fortentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung“ in den letzten zwei Jahren kaum noch forciert wurde, sieht die Stadtkämmerei anlässlich der Ergebnisse dieser Organisationsuntersuchung konkreten Handlungsbedarf.
Die Amtsleitung der Stadtkämmerei hat sich daher entschlossen, die Nutzanwendung der Kosten- und Leistungsrechnung in den Ämtern zu steigern.
Im Rahmen der Master Thesis soll daher ein Sollkonzept entwickelt werden, das zur Steigerung der Nutzanwendung der Kosten- und Leistungsrechnung dienen soll.
Dabei soll die Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung, z.B. die Qualität des Zahlenmaterials oder ein Benchmarking (Lernen von den Besten) innerhalb der Stadt vorangetrieben werden.
1.2 Ziele der Arbeit
Die vorliegende Master Thesis soll dem Leser zunächst einen Überblick über den derzeitigen Entwicklungsstand der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart verschaffen.
Gleichzeitig sollen dem Leser die Problembereiche bewusst gemacht und zugleich mögliche Wege aufgezeigt werden, wie die Fragen praxisnah gelöst werden können.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine Sollkonzeption mit entsprechenden Handlungsempfehlungen aufzustellen, die zur Steigerung der Nutzanwendung und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart führen kann.
1.3
Methodisches Vorgehen und Aufbau der Master Thesis
Im ersten Teil der Arbeit werden die Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung dem Leser vermittelt.
Unter Anwendung der SWOT-Analyse werden im zweiten Teil Problem- und Schwachstellen der Stuttgarter KLR identifiziert und es wird die derzeit herrschende Situation aus verschiedenen Blickwinkeln näher beleuchtet. Dabei werden auch die städtischen Regelungen und das städtische Umfeld beleuchtet und abschließend bewertet.
In einem dritten Schritt wird aus den gewonnenen Ergebnissen der Istaufnahme eine Sollkonzeption zur Steigerung der Nutzanwendung und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung erarbeitet, die wiederum die Grundlage bildet, den Führungskräften der Stadt Stuttgart notwendige Handlungsempfehlungen geben zu können.
Ein Ausblick in die zukünftige Rolle der Kosten- und Leistungsrechnung im Hinblick auf die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzwesens und die gezogenen Schlussfolgerungen runden die Master Thesis inhaltlich ab.
Aufgrund des begrenzten Seitenumfangs können nicht alle Gliederungspunkte abschließend behandelt werden.
2 Grundlagen der Kosten- und Leistungsrechnung
2.1 Ziele und Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
Die öffentlichen Haushalte sind seit jeher zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflichtet.[2]
Somit kommt auch die Kostenrechnung als klassisches Instrumentarium der Wirtschaftlichkeitssteuerung in kommunalen Verwaltungen zur Anwendung.
Dabei werden mit dem Einsatz einer Kostenrechnung i. d. R. folgende Zielsetzungen verfolgt:
- Verursachungsgerechte Kostenzuordnung zur Wirtschaftlichkeitskontrolle: Die Kosten sollen den einzelnen Leistungen bzw. Produkten möglichst verursachungsgerecht zugeordnet werden, um so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu ermöglichen.
- Kostentransparenz und Kostenbeeinflussung: Kostenstrukturen und die Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung sollen offen gelegt werden.
- Preiskalkulation: Kostenrechnung dient als Grundlage der kommunalen Preiskalkulation in Form von privatrechtlichen Entgelten und öffentlichrechtlichen Gebühren.[3]
In der Vergangenheit beschränkte sich die Anwendung der Kostenrechnung im öffentlichen Bereich häufig auf die sog. „kostenrechnenden Einrichtungen “ im haushaltsrechtlichen Sinn, d. h. vor allem auf die Einrichtungen, die in der Regel und nicht nur in geringem Umfang aus Entgelten finanziert werden. Ziel dieser Kostenrechnung war und ist die Kalkulation von Benutzungsgebühren und entsprechenden privatrechtlichen Entgelten und damit deren rechtliche Absicherung nach den kommunalabgabenrechtlichen Vorgaben. [4]
Im Vordergrund stehen Wirtschaftlichkeitskontrolle und -steuerung in der Gesamtverwaltung als originäre Ziele der Kostenrechnung durch
- Ermittlung von Produktbudgets und von Budgetspielräumen innerhalb der Produktbudgets,
- Abwägung und Entscheidung zwischen Eigenerstellung und Fremdbezug,
- Kostenvergleiche auf Produktbasis bis hin zum Benchmarking oder
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades.[5]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Ziele der Kosten- und Leistungsrechnung
Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit haben die Kenntnis der Kosten- und Erlössituation und die Suche nach möglichen Einflussfaktoren eine immer größere Relevanz erlangt und dies nicht nur für die kostenrechnenden Einrichtungen, sondern für alle kommunalen Aufgabenbereiche und Organisationseinheiten.
Es wird immer deutlicher, dass für eine dienstleistungsorientierte Verwaltung die Kostenrechnung ein dringend benötigtes Instrument im Rahmen des Planungs-, Steuerungs- und Kontrollprozesses ist und damit eine der Grundlagen für ein wirkungsvolles Controlling bildet. Neben den weiterhin bestehenden traditionellen Aufgaben im Zusammenhang mit der Preiskalkulation wird die Kostenrechnung vermehrt mit dem Ziel durchgeführt, den Produktverantwortlichen, der Führungsebene und der Politik steuerungsrelevante Informationen über die verbrauchten Ressourcen und damit über die Wirtschaftlichkeit einzelner Produkte bzw. Produktbereiche zur Verfügung zu stellen. Nur mit diesen Informa-tionen kann über eventuell erforderliche Anpassungsmaßnahmen oder über eine alternative Verwendung von Ressourcen entschieden werden.
Damit ist die Kostenrechnung eine wichtige Grundlage für die Budgetierung und Haushaltsplanung. Des Weiteren bildet die Kostenrechnung die Basis zur Bildung unterschiedlicher Kennzahlen, die eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung über interne oder interkommunale Vergleiche ermöglichen. Über die Darstellung dieser Kennzahlen in einem empfängerorientierten Berichtswesen wird die Kostenrechnung zu einem Instrument des verwaltungsweiten Controllings.[6]
2.2 Begriffserklärungen
2.2.1 Kostenbegriff
Der herrschende Kostenbegriff, der in dieser Arbeit zugrunde gelegt wird, ist der auf Schmalenbach zurückgehende wertmäßige Kostenbegriff.
Demnach sind Kosten allgemein der bewertete Verzehr von Sachgütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, die Erstellung und den Absatz von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten sowie öffentlicher Aufgaben[7].
2.2.2 Kostenartenrechnung
Die Kostenartenrechnung hat die Aufgabe der Erfassung, Verteilung und Zurechnung der Kosten, die bei der betrieblichen Leistungserstellung und Leistungsabgabe entstehen. Die Kostenartenrechnung gibt Antwort auf die Frage:
„Welche Kosten sind angefallen?“
Um eine Kosten- und Leistungsrechnung für die öffentliche Verwaltung führen zu können, müssen die für das Betriebsergebnis wirksamen Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Unterabschnitte, d.h. die Erlöse und Kosten aus der kameralen Buchung abgeleitet und in die Kosten- und Leistungsrechnung überführt werden.
Die derzeit noch bestehende kameralistische Buchführung stellt eine reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung dar. Die Buchungen sind nach Einnahmen und Ausgaben gegliedert und jeweils nach Arten (Kostenarten) gemäß der Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ aufgeteilt. Kostenarten sollten entsprechend dem Gruppierungsplan gegliedert werden, d.h. wenn die kameralistischen Ausgabearten der betriebswirtschaftlichen Definition nach Schmalenbach entsprechen, sind sie als Kosten in die Kostenrechnung zu
übernehmen.[8]
Die Kostenarten untergliedern sich nach der Art der eingesetzten Güter, z.B. in
- Personalkosten
- Sachkosten
- Kalkulatorische Kosten (kalkulatorische Abschreibung und Zins)
- Sonstige Kosten
2.2.3 Kostenstellenrechnung
Kostenstellen sind die Orte der Kostenentstehung, d.h. rechnungsmäßig abgegrenzte Leistungs- und Verantwortungsbereiche, für die alle entstehenden Kosten gesondert ermittelt werden.[9]
Die Kostenstellenrechnung baut auf der Kostenartenrechnung auf und verteilt die anfallenden Kosten auf die abgegrenzten Leistungsbereiche im Umfang der für sie maßgeblichen Kostenverursachung.
Alle Kosten werden dabei soweit möglich direkt über die Belegbuchung den Kostenstellen zugeordnet (Primäre Kosten) oder werden gesammelt und indirekt über geeignete Umlageverfahren verteilt (Sekundärkosten).
Die Kostenstellenrechnung soll die Frage beantworten:
„ Wo sind Kosten entstanden?“
Die Gesamtkosten einer Kostenstelle stellen den Ressourcenverbrauch für die Leistungen und Produkte der Kostenstelle dar. Diese sind abhängig von der Quantität und Qualität der erstellten Produkte / Leistungen und der Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung. Durch Vergleich der tatsächlichen Kosten (Istkosten) mit den durchschnittlichen oder geplanten Kosten (Plankosten) ergeben sich kostenstellenbezogene Abweichungen, die ein Anhaltspunkt für die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung sein können.
Wirtschaftliche Vergleiche lassen sich auch zwischen Kostenstellen mit vergleichbaren Produkten / Leistungen anstellen (z.B. verschiedene Baubetriebshöfe). Daneben schafft die Kostenstellenrechnung die Grundlagen für die Kostenrechnung.
Die Kostenstellen sollten möglichst als Abbild von Leistungsbereichen mit eigener Verantwortung in Anlehnung an Organisationsstrukturen gebildet werden.
Als Kostenstellen kommen daher Ämter, Betriebe und Einrichtungen, insbesondere auch Abteilungen, Sachgebiete, Stabstellen in Betracht. In Stuttgart wird die gesamte Organisation der Stadtverwaltung teilweise bis auf Sachgebietsebene als Kostenstellen abgebildet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Auszug Kostenstellenhierarchie der Stadt Stuttgart
Bei der Bildung der Kostenstellen sind dabei folgende Faktoren zu berücksichtigen:
1. Zielsetzung der Kostenermittlung: Je größer Informationsbedarf und Informationsgenauigkeit sein sollen, desto detaillierter muss die Kostenstellengliederung sein,
2. Größe und Leistungsvielfalt der Organisationseinheit; da für kleine Organisationseinheiten mit gering differenzierter Leistungsstruktur oft wenige Kostenstellen ausreichen,
3. Verwaltungsaufwand zur Durchführung der Kostenermittlung; denn mit zunehmender Kostenstellengliederung wächst auch der Arbeitsaufwand für die Erfassung der Kosten und Auswertung der Ergebnisse.[10]
Wichtig zu wissen ist hierbei noch, dass ein Vergleich zwischen den Ergebnissen der KLR und der kameralen Haushaltsrechnung i.d.R. nur auf Ämterebene und nicht auf der Ebene der Unterabschnitte möglich ist, da die KLR rein organisationsorientiert, der Haushalt hingegen aufgaben- und funktionsorientiert gegliedert ist.
2.2.4 Kostenträgerrechnung
Kostenträger sind Leistungseinheiten, die den Güter- und Leistungsverzehr letztlich auslösen und demzufolge die Kosten auch „tragen“ sollen.
Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist es, die bei der Produkterstellung anfallenden Kosten verursachungsgerecht den Produkten zuzuordnen. Die Kostenträgerrechnung findet insbesondere bei der Ermittlung von Gebühren und Entgelten sowie bei der Bewertung des internen Leistungsaustausches Anwendung.
Die Kostenträgerrechnung baut auf der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung auf und gibt Antworten auf die Frage:
„Wofür sind Kosten angefallen?“
Für den kommunalen Bereich wurden die von der Produktbörse Baden-Württemberg definierten Produkte grundsätzlich aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger gebildet.
Diese Produktpläne sollen nach dem Konzept des „Neuen Steuerungsmodells“ in produktorientierten Haushaltsplänen als Kostenträger ausgewiesen werden. Hier werden ferner auch Produktgruppen oder Produktbereiche als Kostenträger dargestellt. Allerdings können nicht nur die kommunalen Produkte oder Teile davon als Kostenträger gebildet werden, sondern je nach Informationsbedürfnis auch andere Kalkulationsobjekte, wie z.B. Aufträge, Projekte oder Stadtbezirke ausgewählt werden.[11]
Das Schaubild verdeutlicht abschließend nochmals die Zusammenhänge der verschiedenen Teilkomponenten der Kostenrechnung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3 Überblick über die Kostenrechnung
3 Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart
In den nachfolgenden Gliederungspunkten werden die vorhandenen Regelungen zur Führung der KLR, die Stellenausstattung, sowie weitere städtische Informationssysteme untersucht.
Des Weiteren wird der derzeitige Entwicklungsstand der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart mit Hilfe einer Stärke-Schwäche-, Chancen-Risiko-Analyse (SWOT-Analyse) genauer beleuchtet und mögliche Schwachstellen und Problembereiche identifiziert.
3.1 Vorhandene Gesetze, Regelungen und Fachkonzepte
3.1.1 Kommunales Haushaltsrecht
Die gesetzliche Begründung zum Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung findet sich in verschiedenen Gesetzen. Jedoch müssen hierbei „Kann“- und „Muss“-Vorschriften unterschieden werden.
Nach § 12 Absatz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen für kostenrechnende Einrichtungen und für Hilfsbetriebe der Gemeinde die für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit erforderlichen Unterlagen geführt werden. Die Kosten und Leistungen sind verursachungsgerecht, insbesondere nach Kostenstellen, Kostenarten oder Kostenträgern zu erfassen; die Kosten sind aus der Buchführung nachprüfbar herzuleiten.
Für die übrigen hoheitlichen Aufgabenbereiche der Gemeinde kann nach § 12 Absatz 3 GemHVO eine KLR geführt werden.
Mit Hilfe der Verwaltungsvorschrift zum § 12 GemHVO schafft der Gesetzgeber die haushaltsrechtlichen Grundlagen, um diese Einrichtungen innerbetriebliche Kosten- und Leistungskontrollen wirtschaftlich und sparsam führen und steuern (Output-Steuerung) sowie für externe und interkommunale Kosten- und Leistungsvergleiche betriebliche Kennzahlen ermitteln zu können.
Durch die Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen wird darüber hinaus eine betriebswirtschaftlich gesicherte Entscheidungsgrundlage für die alterna-tive Inanspruchnahme von Fremd- oder Eigenleistungen bei der Erbringung kommunaler Dienstleistungen geschaffen.
Auf Basis der betriebswirtschaftlichen Instrumente sollen zudem laut § 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 2 des Landesgebührengesetzes (LGebG) die Gebühren und Entgelte berechnet werden.
Anhand der neuesten Gesetzesänderungen, wie z.B. im Bereich des Gebührenrechts kann man die Intention des Gesetzgebers, die betriebswirtschaftlichen Instrumente zukünftig stärker einzusetzen, leicht nachvollziehen.[12]
3.1.2 CO-Fachkonzept
Nach der Einführung der neuen Software SAP R/3 für das Finanzwesen bei der Stadt Stuttgart wurde seitens der damaligen Projektmitarbeiter der Stadtkämmerei ein knapp 200-seitiges Fachkonzept für das städtische Controlling (CO-Fachkonzept) erarbeitet und schriftlich festgehalten.
Dieses CO-Fachkonzept wurde in den vergangenen Jahren stets von den zuständigen Mitarbeitern des KLR-Teams der Stadtkämmerei (20-2 KLR) an die neuesten technischen Entwicklungen der Finanzsoftware SAP R/3 angepasst und weiterentwickelt.
Auf Basis des Fachkonzepts wurde ein Anwenderhandbuch für die KLR-Ver-antwortlichen zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit in den Fachämtern erstellt und als weitere Hilfestellung für die Arbeit mit dem neuen KLR-Instrument mitgegeben.
Darüber hinaus wurde ein Exemplar in das städtische Intranet eingestellt, damit alle interessierten Mitarbeiter die Möglichkeit haben, diese Informationen jederzeit einzusehen und zu verwenden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4 Auszug aus dem Stuttgarter Intranet
Inhaltlich werden dem Leser in sehr ausführlicher Weise nochmals die Ziele der KLR, Begriffserklärungen sowie genaue Vorgaben zur Führung der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart klar gemacht.
Mit Hilfe der stadtweit gültigen Vorgaben kann die Einheitlichkeit und Standardisierung der Kosten- und Leistungsrechnung innerhalb der Stadtverwaltung größtenteils gewährleistet werden.
Die vergangenen Jahre haben allerdings gezeigt, dass aufgrund der Komplexität dieses Themas und des daraus resultierenden großen Seitenumfangs das Anwenderhandbuch seitens der städtischen Mitarbeiter kaum gelesen wird.
Statt sich selbst mit den alltäglichen Problemstellungen des KLR-Betriebs näher auseinander zu setzen und einen Blick in das Anwenderhandbuch zu werfen, wird es von vielen KLR-Verantwortlichen der Fachämter oftmals eher vorgezogen, ihren zuständigen KLR-Betreuer der Stadtkämmerei zu konsultieren.
3.1.3 Dienstvereinbarungen
Eine Dienstvereinbarung (DV) zur Kostenrechnung ist eine rein personalwirtschaftlich ausgerichtete Vereinbarung zwischen Personalrat und Verwaltungsführung oder Führungsebenen, die nach Personalvertretungsrecht möglicherweise berechtigt sind, eine Dienstvereinbarung abzuschließen.
a) Dienstvereinbarung über die Durchführung der KLR bei der Stadt Stuttgart:
Die Stadt Stuttgart schloss im Juni 2000 zusammen mit dem Gesamtpersonalrat eine Vereinbarung, die zum Schutz der Interessen der Beschäftigten zum Interessensausgleich zwischen dem städtischen Personal und der Verwaltungsführung bzw. anderen internen Führungsebenen dienen soll.
Dabei wurde auf beiden Seiten vereinbart, dass folgende Punkte beim Betrieb der Kosten- und Leistungsrechnung ausgeschlossen werden müssen:
- Es darf grundsätzlich keine Erfassung oder Verarbeitung von Daten geben, die einen Personenbezug ermöglichen.
- Auswertungen der Kostenrechnung und Berichte sind so zu gestalten, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder deren Leistung und Verhalten möglich sind, d.h. es muss sichergestellt sein, dass mit der Kostenrechnung keine individuelle bzw. individualisierbare Leistungs- und Verhaltenskontrolle stattfinden kann. Aus diesem Grund müssen mindestens vier Mitarbeiter einer Kostenstelle zugeordnet sein.
- Schutz der in der Kostenrechnung ermittelten Daten vor unbefugtem Zugriff und unbefugter Verarbeitung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (Berechtigungskonzept).[13]
Die Anforderungen der Dienstvereinbarung wurden in der städtischen Softwarelösung SAP R/3 Kommunalmaster verwirklicht.
Über eine anonymisierte Schnittstelle wird die Personalkostenverbuchung vom Großrechnerverfahren PWES (Personalwesen) an das SAP R/3-System übergeben. Die auf den Kostenstellen monatlich verbuchten Personalkosten werden dabei jeweils als Summenbeträge aller zugeordneten Mitarbeiter (pro Kostenstelle mindestens vier Mitarbeiter) ausgewiesen. Ein Rückschluss auf die einzelnen Aktivbezüge der Mitarbeiter ist damit ausgeschlossen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5 Beispiel Kostenstellenbericht der Stadt Stuttgart
Die Anonymisierung der Personalkosten kommt den einzelnen Mitarbeiter zwar entgegen, dennoch hat sich in der täglichen Praxis gezeigt, dass die Verfremdung personalbezogener Daten einen enormen und teils unnötigen Verwaltungsaufwand bei den verantwortlichen Stellen - Abteilung Bezügeabrechnung des Haupt- und Personalamtes (10-5) sowie des KLR-Teams der Stadtkämmerei (20-2 KLR) - nach sich zieht.
Sobald organisatorische Änderungen oder Personalwechsel innerhalb der Stadtverwaltung stattfinden, sollten die Fachämter eine Meldung an 10-5 zur Pflege der Kostenstellenzuordnungen der Mitarbeiter in dem Großrechnerverfahren PWES erbringen, um mögliche Fehler in der Personalkostenverbuchung auszuschließen. Aus diesem Grund werden monatliche sog. PWES-Listen seitens 20-2 KLR an die KLR-Verantwortlichen versandt, die die aktuelle Zuordnung der Mitarbeiter beinhalten.
In der Regel werden die Änderungen oftmals verspätet oder gar nicht von den zuständigen Mitarbeitern gemeldet, so dass Fehlerlisten erzeugt werden, die manuell von den zuständigen Sachbearbeitern (10-5 und 20-2 KLR) bereinigt werden müssen. Da die noch zu verbuchenden Restbeträge ohne Personalnummer auf der Fehlerliste ausgewiesen werden, wird eine schnelle und effiziente Fehlersuche erschwert.
Gerade im Öffentlichen Dienst sind die Besoldungs- und Entgeltgruppen der städtischen Mitarbeiter für jedermann einsehbar. Die Stellenbewertung einzelner Arbeitsplätze kann im Rahmen der Stellenbeschreibungen ebenso nachvollzogen werden.
Spezielle stadteigene SAP-Kostenstellenberichte und entsprechende Berechtigungszuteilungen gewährleisten bereits jetzt, dass nur ein vorher bestimmter Kreis von Mitarbeitern Einblick in die Personaleinzelpostenliste erhält.
Es stellt sich daher für den Verfasser die Frage, ob die Anonymisierung der Personalkostenverbuchung im Hinblick auf den zusätzlichen Verwaltungsaufwand wirklich gerechtfertigt ist?
b) Dienstvereinbarung zur Leistungserfassung mit dem SAP-Arbeitszeitblatt (CATS) bei der Stadt Stuttgart:
Die Regelungen dieser Dienstvereinbarungen ergänzen und konkretisieren die in § 5 DV KLR enthaltenen Grundsätze zur Leistungserfassung.
Eine individuelle Leistungskontrolle von Mitarbeitern wird durch eine restriktive Berechtigungsverwaltung verhindert. Lediglich der direkte Vorgesetzte bzw. sein Vertreter, sowie KLR-Verantwortliche und CATS-Anwendungsbetreuer haben die Berechtigung zur Einzelpostensicht.
Bei der Überleitung der erfassten Leistungsdaten werden zudem lediglich die für die KLR erforderlichen Daten in Form von Monatssummen je Sender-Empfängerkombination (ohne Personalnummer) ins SAP CO-Modul übergeleitet.
Nach Beendigung der KLR-Abschlussarbeiten werden die erfassten Leistungsdaten aus der CATS-Datenbank spätestens zum 31.03. des Folgejahres unverzüglich gelöscht.[14]
Im Hinblick auf die Reformbestrebungen einer leistungsgerechten Besoldung bei den Beamten bzw. einer entgeltgruppengerechten Bezahlung der Beschäftigten ist die DV zur Leistungserfassung aus Sicht des Verfassers generell auf den Prüfstand zu stellen.
3.1.4 Dienstanweisungen
Dienstanweisungen (DA) zur Kostenrechnung sind rein fachliche, auf das Instrument Kostenrechnung bezogene Ausführungshinweise. Sie regeln die Ziele, die Einsatzbereiche und die Ausgestaltung der Kostenrechnung innerhalb der Stadt Stuttgart.
Die „Dienstanweisungen zur Führung der Kosten- und Leistungsrechnung“ wurde nach erfolgter Einführung der neuen Finanzsoftware SAP/R3 und dem Aufbau der neuen Struktur des Rechnungswesens notwendig.
Aus diesem Grund entwickelte die Stadtkämmerei Stuttgart im Januar 2001 detaillierte Rahmenregelungen, die es ermöglichen sollten, dass die KLR dezentral in den Fachämtern wahrgenommen werden kann. Dabei werden in den Bestimmungen auch die wahrzunehmenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Fachämter benannt, um sicherzustellen, dass es stadtweit eine einheitliche, koordinierte Vorgehensweise beim Führen der Kosten- und Leistungsrechnung gibt.
Die KLR wird dabei stadtweit ausschließlich im SAP Modul CO (SAP Controlling) durchgeführt, so dass die bis zu diesem Zeitpunkt eingesetzten Drittverfahren abgelöst wurden.
In der Dienstanweisung werden verschiedene Funktionsträger mit jeweils eigenen Aufgabenprofilen benannt. Dabei unterscheidet man die Aufgaben des
1. KLR-Verantwortlichen im Fachamt
2. Kostenstellenverantwortlichen
3. Produktverantwortlichen.
Anhand des Schaubilds kann man die Aufgaben der unterschiedlichen Personengruppen entnehmen.[15]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6 KLR-Aufgaben der Verantwortlichen im Fachamt
Formalrechtlich wurden die Grundlagen und Zuständigkeiten für ein erfolgreiches Führen einer Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart geschaffen. Die praktische Umsetzung in den Fachämtern kann aber derzeit nicht flächendeckend gewährleistet werden. Es bestehen vor allem Defizite bei den Kostenstellenverantwortlichen, da hier kein stadtweites Prüfungsberichtswesen existiert und keinerlei budgetwirksame Auswirkungen erkennbar werden, das die betreffenden Mitarbeiter dazu anhält, z.B. monatlich die vorgenommenen Buchungen auf deren Kostenstelle zu kontrollieren.
3.1.5 Geschäftsanweisung „Interne Leistungsverrechnung“
Die Geschäftsanweisung „Interne Leistungsverrechnung“ (GA-ILV) regelt die Inanspruchnahme der internen Service- und Steuerungsbereiche und die verursachungsgerechte Verrechnung der innerstädtischen Leistungen.
Ziel der GA-ILV ist eine vollständige, verursachungsgerechte Kostenzuordnung, um stadtweit die Leistungsbeziehungen zwischen den Fachbereichen darzustellen und um das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken.
Durch die vollständige Leistungs- und Kostenermittlung werden Wirtschaftlichkeitsvergleiche mit privaten Anbietern erst ermöglicht, da z.B. auch Overheadkosten (Steuerungsumlage) in die Produktkostenzuordnung mit einfließen.
Damit werden zugleich die Grundlagen für Make-or-Buy-Entscheidungen geschaffen.
Ferner wird in der GA-ILV auch geregelt, welche innerstädtischen Leistungen von den Fachbereichen abzunehmen sind und welche nach eingehender Prüfung der Referate Wirtschaft, Beteiligung und Finanzen (WFB) und Allgemeine Verwaltung und Krankenhäuser (AK) gekündigt werden dürfen.[16]
Leider bestehen bei der derzeitigen Umsetzung der neuen GA-ILV immer noch kleinere Defizite, die es in der Zukunft noch abzustellen gilt.
- So ist manchen Fachbereichen trotz der Regelungen unklar, welche und an wen erbrachte Leistungen verrechnet werden dürfen.
- Ferner werden bei der Verbuchung der Overheadkosten (Steuerungsumlage) bislang nicht die tatsächlichen Kosten, sondern die veranschlagten Planzahlen des kameralen Haushalts zu Grunde gelegt.
3.2 Stellenausstattung für den Betrieb der KLR
Zur Einführung der neuen Finanzsoftware SAP R/3 und dem gleichzeitigen Aufbau weiterer neuer Steuerungsinstrumente (z.B. Budgetierung, KLR) im Jahr 1999 wurden 21,5 neue Stellen geschaffen. Neben der Ernennung von KLR-Verantwortlichen in den Fachbereichen wurden sieben Personalstellen (drei davon mit kw-Vermerk) zentral in der Haushaltsabteilung (20-2) geschaffen.[17]
Nach Abschluss des Projektes und Aufbau der Istkostenrechnung erfolgte Anfang 2004 ein Stellenabbau bei der Stadtkämmerei.
Seitdem erbringen nun drei Mitarbeiter der Stadtkämmerei im Sachgebiet Kosten- und Leistungsrechnung als zentrale Organisationseinheit zentrale Dienstleistungen im Rahmen der KLR gegenüber den Referaten, Ämtern und einzelnen Abteilungen.
Neben der Hauptaufgabe „Beratung in Grundsatzfragen zur Kosten- und Leistungsrechnung“ (Konzeption von KLR-Strukturen und Verrechnungsmodellen) und Aufrechterhaltung des SAP-Betriebs weist das KLR-Team noch weitere zusätzliche Dienstleistungen aus:
- Unterstützung der Fachämter bei den KLR- Jahresabschlussarbeiten
- SAP-Anwendungsbetreuung der Module Controlling (CO), Projektsystem (PS), Cross Application Time Sheet (CATS, Zeiterfassung)
- Überwachung der Einhaltung des CO Fachkonzeptes, Dienstvereinbarungen (DV) und Dienstanweisungen (DA)
- Erstellung von allgemeinen und kundenspezifischen SAP-Berichten, (Bereitstellung von Informationen für das Fach-Controlling)
- Wirtschaftlichkeitsanalysen von Abteilungen und Servicebetrieben im Rahmen von Entscheidungsprozessen
- Unterstützung und Beratung bei der Erstellung von Gebühren- und Entgeltkalkulationen
- SAP-Anwenderschulungen (Fachmodule CO, PS und CATS)
Wie bereits unter Gliederungspunkt 3.1.4 erwähnt sind die KLR-Verantwort-lichen für das Führen, die Pflege und Weiterentwicklung der KLR in den
Fachämtern zuständig. Als Ansprechpartner der Stadtkämmerei und Lieferant von internen Amtsberichten sollte dieser Personenkreis fungieren – allerdings sieht die Realität nach knapp sieben Jahren leider anders aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7 Organisatorische KLR-Struktur der Stadt Stuttgart
In den vergangenen Jahren wurde die KLR als Angebot für ein internes Ämterinformationssystem ohne weitere zentrale Vorgaben den Fachämtern überlassen. Folglich entwickelte sich in den vergangenen Jahren, je nach Interessenlage der Fachbereiche, die KLR sehr unterschiedlich.
Während in den technischen Ämtern, z.B. Stadtmessungsamt sich ein konsequent geführtes KLR-Berichtswesen unter Einhaltung der städtischen Regelungen etabliert hat, nehmen in einigen Ämtern (z.B. Standesamt, Branddirektion, Stadtplanungsamt) die Mitarbeiter aufgrund der mangelnden Nachfrage an KLR-Berichten seitens ihrer Verwaltungsführung, aber auch seitens der Stadtkämmerei nunmehr andere Aufgaben innerhalb der Fachbereiche wahr. Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind neben eines schleichenden Know-How-Verlusts im Bereich der KLR, Demotivation und ein stetig wachsendes Akzeptanzproblem innerhalb der Stadtverwaltung.
3.3 SWOT-Anlayse der Kosten- und Leistungsrechnung
Mit Hilfe der SWOT-Analyse soll nun in weiteren Schritten die derzeitige Istsituation der Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Stuttgart zusammengefasst und im Hinblick auf ihre Stärken und Schwächen, sowie auf mögliche Chancen und Risiken noch weiter untersucht werden.
Die nachfolgenden Analyseergebnisse resultieren dabei aus Gruppengesprächen mit Kollegen der Haushaltsabteilung (20-2), aus Fachämtern sowie einem externen Berater des Consultingunternehmens DS Infra (Drees & Sommer).
3.3.1
Stärken
Die Stärken der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart liegen zum einen
- in ihrer flächendeckend einheitlichen Struktur, die sich am eigens entworfenen Controlling-Fachkonzept (CO-Fachkonzept) orientieren. In diesem Fachkonzept werden den Fachämtern bestimmte Standards und Mindestanforderungen zur Führung der KLR gestellt.
- in den ausführlichen Rahmenregelungen in Form von Dienstanweisungen (DA) und Dienstvereinbarungen (DV) zur Führung der Kosten- und Leistungsrechnung. In diesen werden die verschiedenen Rollen (Produktverantwortlicher, KLR-Verantwortlicher, Kostenstellenverantwortlicher) und deren Zuständigkeiten explizit geregelt.
- in der organisatorisch dezentral angelegten KLR-Struktur mit den jeweiligen KLR-Verantwortlichen (KLRV), die für die Führung dieses Instruments in ihrem jeweiligen Amt zuständig sind und zentral in Grundsatzfragen vom KLR-Team der Stadtkämmerei unterstützt werden.
- in der Tatsache, dass die KLR in das Rechnungswesen integriert ist, Daten in Echzeit gebucht werden und somit die Voraussetzungen für ein unterjähriges Berichtwesen als Reporting-Instrument geschaffen sind.
- in der weit fortgeschrittenen und stets weiterentwickelten Gebühren- und Entgeltkalkulation.
[...]
[1] Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die weibliche Form verzichtet. Selbstverständlich sind beide Geschlechter gemeint.
[2] Vgl. § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Baden-Württemberg
[3] Vgl. Dienstvereinbarung der Stadt Stuttgart zur Führung der Kosten- und Leistungsrechnung
[4] Vgl. § 12 Abs.1 GemHVO
[5] Vgl. Schuster, Falko: Kommunale Kosten- und Leistungsrechnung, München, 1999, S.10ff
Vgl. auch. Bayerische Verwaltungsschule (Hrsg): Kosten senken durch Kostensteuerung, Wick, Thomas, Kosten- und Leistungsrechnung, S.125f
[6] Vgl. Homann, Klaus: Kommunales Rechnungswesen, 6.Auflage,2005, S.113f
Vgl. auch Fiebig, Helmut: Kommunale Kostenrechnung und Wirtschaftlichkeitssteuerung, 3.Auflage, 2004
[7] Vgl. Faiss/Faiss/Giebler/Lang/Schmid, Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg,6.Auflage, Seite 423
[8] Vgl. Rieder, Lukas: Kosten- und Leistungsrechnung für die Verwaltung, S.56f
[9] Vgl. Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg, Seite 47
[10] Vgl. Leitlinien zur kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg, Seite 49
Vgl. auch Homann, Klaus: Kommunales Rechnungswesen, 6.Auflage,2005, S.143f
[11] Vgl. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Handbuch Kostenrechnung, S.153
Vgl. auch Homann, Klaus: Kommunales Rechnungswesen, 6.Auflage,2005, S.162 f
[12] Siehe Anhang: Geschäftsanweisung Interne Leistungsverrechnung
[13] Vgl. Dienstvereinbarung über Einführung und Durchführung von KLR bei der Landeshauptstadt Stuttgart, Seite 3 (siehe Anhang)
[14] Vgl. § 11f. DV zur Leistungserfassung mit dem SAP-Arbeitszeitblatt (CATS) bei der Stadt Stuttgart (siehe Anhang)
[15] Vgl. Dienstanweisung zur Führung der Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Stuttgart (siehe Anhang)
[16] Vgl. Geschäftsanweisung Interne Leistungsverrechnung der Stadt Stuttgart (siehe Anhang)
[17] Siehe Anhang – Gemeinderatsdrucksache (GRDrs 42/2000)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2007
- ISBN (eBook)
- 9783836624008
- DOI
- 10.3239/9783836624008
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Steinbeis-Hochschule Berlin – Business Administration and International Entrepreneurship
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Dezember)
- Note
- 1,1
- Schlagworte
- kosten- leistungsrechnung finanzcontrolling nonprofit organisation öffentliche verwaltung marketingmix
- Produktsicherheit
- Diplom.de