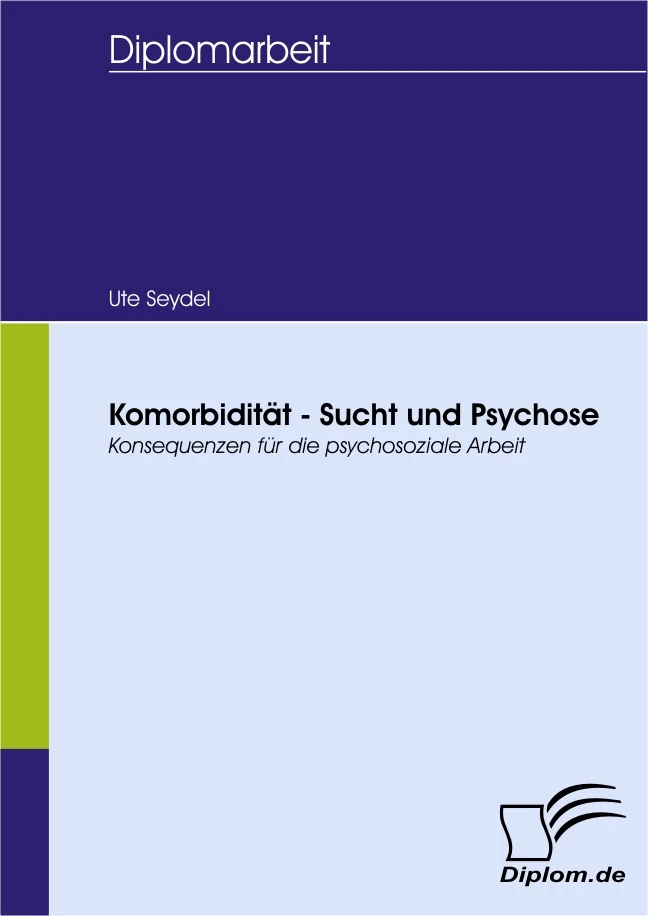Komorbidität - Sucht und Psychose
Konsequenzen für die psychosoziale Arbeit
Zusammenfassung
Das häufige Auftreten der Komorbidität rückte in den letzten 15 Jahren in den Fokus des klinischen und wissenschaftlichen Interesses. Vor allem Einrichtungen der medizinischen und psychosozialen Versorgung sehen sich zunehmend mit Klienten konfrontiert, die sowohl eine Substanzstörung als auch eine psychische Erkrankung aufweisen. Dieser Personenkreis ist inzwischen mehr die Regel als die Ausnahme. In der Versorgung dieser Klienten ergeben sich vielfältige Probleme, welche nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Ansätzen der Suchthilfe und der Psychiatrie, sowie fehlenden konkreten Behandlungsrichtlichtlinien resultieren. Die Komorbidität von Sucht und schizophrener Psychose - um die es in dieser Arbeit überwiegend geht gilt als besonders schwer behandelbar. Sie zeichnet sich unter anderem durch eine hohe Rehospitalisierungsquote und somit einen hohen Kostenaufwand, begrenzte Bereitschaft zur Mitarbeit im therapeutisch-medizinischen Prozess, oftmals fehlende Abstinenzmotivation, eine Tendenz zur Chronifizierung der Erkrankungen, vermehrtes Abgleiten in die Obdachlosigkeit und eine deutlich erhöhte Suizidrate aus. Dies alles deutet auf eine eingeschränkte Lebensqualität der Betroffenen hin. Ziel dieser Arbeit ist zum einen die umfassende Darstellung des Phänomens der Komorbidität und dessen Behandlung, zum anderen die Erarbeitung der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die psychosoziale Praxis.
Als Einführung in die Thematik werden zunächst die zentralen Begrifflichkeiten - Substanzmittelabhängigkeit, Schizophrenie und Komorbidität definiert. Darauf aufbauend wird das Vorkommen der Komorbidität von Sucht und schizophrener Psychose in der Bevölkerung anhand verschiedener empirischer Studien untersucht.
Im Anschluss wird bei der Schilderung des Verlaufs beider Erkrankungen auf charakteristische Besonderheiten eingegangen. Daraufhin erfolgt die Darstellung verschiedener Theorien zur Entstehung der Komorbidität. Diese mögen einen guten Ansatz zum tieferen Verständnis sowohl der Betroffenen als auch der Störungskombination selbst in sich bergen. Der Behandlung der Komorbidität auf die gegenwärtige Situation in Deutschland bezogen und der Bedeutung eines integrierten Ansatzes in Berlin sollen im folgenden Kapitel Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.
Im empirischen Teil dieser Arbeit geben die Betroffenen anhand geführter Interviews einen Einblick in das Erleben ihrer Krankheit. Experten zum Thema stellen die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Stand der Forschung zur Komorbidität von Sucht und Psychose
2.1. Komorbidität
2.1.1. Substanzmittelabhängigkeit
2.1.2. Psychose
2.2. Epidemiologie
2.3. Verlauf
3. Ätiologische Theorien zur Komorbidität
3.1. Theorie der Psychoseinduktion
3.2. Theorien der Sekundarsuchtentwicklung
3.2.1. Supersensitivitäts-Hypothese
3.2.2. Selbstmedikations-Hypothese
3.2.3. Sozial-Drift-Hypothese
3.3. Theorien der gemeinsamen Faktoren
3.3.1. Genetische Faktoren
3.3.2. Dissoziale/Antisoziale Persönlichkeitsstörung
3.3.3. Sozialwissenschaftliche Faktoren
3.3.4. Psychose als Suchtverhalten
4. Behandlung der Komorbidität
4.1.Situation in Deutschland
4.2. Integrierter Behandlungsansatz in Berlin
5. Empirische Erhebung
5.1. Fragestellung und Methode
5.2. Expertenergebnisse
5.3. Betroffenenergebnisse
5.4. Hypothesendiskussion
6. Bedeutung der Komorbidität für die psychosoziale Praxis
6.1. Psychosoziale Auswirkungen
7. Perspektive
8. Literaturverzeichnis
9. Eidesstattliche Versicherung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung
Abbildung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Prävalenz von Suchterkrankungen bei schizophrenen Patienten (n=232)
Tabelle 2: Missbrauchte Drogen bei Patienten mit einer ersten schizophrenen Episode
Tabelle 3: Merkmale ätiologisch relevanter Subtypen bei Komorbidität von Sucht und Psychose
Tabelle 4: Expertenkategorien
Tabelle 5: Betroffenenkategorien
1. Einleitung
Das häufige Auftreten der Komorbidität rückte in den letzten 15 Jahren in den Fokus des klinischen und wissenschaftlichen Interesses. Vor allem Einrichtungen der medizinischen und psychosozialen Versorgung sehen sich zunehmend mit Klienten[1] konfrontiert, die sowohl eine Substanzstörung als auch eine psychische Erkrankung aufweisen. Dieser Personenkreis ist inzwischen mehr die Regel als die Ausnahme. In der Versorgung dieser Klienten ergeben sich vielfältige Probleme, welche nicht zuletzt aus den unterschiedlichen Ansätzen der Suchthilfe und der Psychiatrie, sowie fehlenden konkreten Behandlungsrichtlichtlinien resultieren. Die Komorbidität von Sucht und schizophrener Psychose - um die es in dieser Arbeit überwiegend geht gilt als besonders schwer behandelbar. Sie zeichnet sich unter anderem durch eine hohe Rehospitalisierungsquote und somit einen hohen Kostenaufwand, begrenzte Bereitschaft zur Mitarbeit im therapeutisch-medizinischen Prozess, oftmals fehlende Abstinenzmotivation, eine Tendenz zur Chronifizierung der Erkrankungen, vermehrtes Abgleiten in die Obdachlosigkeit und eine deutlich erhöhte Suizidrate aus. Dies alles deutet auf eine eingeschränkte Lebensqualität der Betroffenen hin. Ziel dieser Arbeit ist zum einen die umfassende Darstellung des Phänomens der Komorbidität und dessen Behandlung, zum anderen die Erarbeitung der sich daraus ergebenden Konsequenzen für die psychosoziale Praxis.
Als Einführung in die Thematik werden zunächst die zentralen Begrifflichkeiten - Substanzmittelabhängigkeit, Schizophrenie und Komorbidität definiert. Darauf aufbauend wird das Vorkommen der Komorbidität von Sucht und schizophrener Psychose in der Bevölkerung anhand verschiedener empirischer Studien untersucht.
Im Anschluss wird bei der Schilderung des Verlaufs beider Erkrankungen auf charakteristische Besonderheiten eingegangen. Daraufhin erfolgt die Darstellung verschiedener Theorien zur Entstehung der Komorbidität. Diese mögen einen guten Ansatz zum tieferen Verständnis sowohl der Betroffenen als auch der Störungskombination selbst in sich bergen. Der Behandlung der Komorbidität auf die gegenwärtige Situation in Deutschland bezogen und der Bedeutung eines integrierten Ansatzes in Berlin sollen im folgenden Kapitel Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.
Im empirischen Teil dieser Arbeit geben die Betroffenen anhand geführter Interviews einen Einblick in das Erleben ihrer Krankheit. Experten zum Thema stellen die Komorbidität und den Umgang sowie die Schwierigkeiten mit dieser Klientel aus ihrer Sicht dar. Die Interviews werden danach auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten untersucht und verglichen.
Der empirischen Untersuchung liegen folgende Hypothesen zugrunde:
1. Die Psychose als Maske der Sucht- ein komorbider Patient, welcher sich in Suchttherapie befindet und dort psychotisch wird, verlagert dadurch lediglich seine Suchterkrankung.
2. Wird der Behandlungsfocus auf nur eine Krankheit (Sucht oder Psychose) gerichtet, dann werden die Symptome der zweien Diagnose proportional größer.
3. Es sind mehr Psychotiker zugleich suchtmittelabhängig, als bisher angenommen, daher sollten diese generell auf eine Suchterkrankung hin untersucht werden.
4. Diese Klientel darf keine medikamentöse Eigenverantwortung übernehmen, da sie diese aufgrund ihrer Suchterkrankung zwangsläufig missbrauchen.
5. Weder die Psychiatrie noch das Suchthilfesystem sind adäquate Lösungen für diese Klientel.
Schließlich werden die Ergebnisse der Interviews erarbeitet und die Hypothesen diskutiert. Im nächsten Kapitel werden die Bedeutung, die Probleme und Auswirkungen der Komorbidität für die psychosoziale Praxis dargestellt, um letztlich im Schlussteil zu einem Konsens einerseits und adäquaten Perspektiven sowohl für die Betroffenen als auch das gesamte Versorgungssystem andererseits zu gelangen.
2. Stand der Forschung zur Komorbidität von Sucht und Psychose
Im folgenden Kapitel möchte ich die dieser Arbeit zugrunde liegenden Krankheitsbilder - Sucht, Psychose und Komorbidität, gemeinhin auch als „Doppeldiagnose“ bekannt für das weitere Verständnis erläutern.
2.1. Komorbidität
Zur Einführung in die Thematik der Komorbidität möchte ich den Begriff zunächst in wörtlicher Übersetzung herleiten: Die Silbe Ko- in der Bedeutung „mit “ sowie Morbus, „die Krankheit “ bezeichnen Komorbidität demnach als „ die Mit-Krankheit“ (vgl. Duden 2005, 547, 679), folglich all das, was eine Person an Störungen oder Erkrankungen mit Krankheitswert hat. Diese wortgetreue Übersetzung sagt jedoch nichts darüber aus, um welche Art von Störungen es sich handelt. Eine genauere Untersuchung des Begriffs scheint hier angebracht. Zaudig legt die Komorbidität als „das Auftreten von mehr als einer spezifisch diagnostizierbaren psychischen Störung bei einer Person in einem definierten Zeitintervall“, fest. „Das Auftreten psychischer Störungen gemeinsam mit körperlichen Erkrankungen wird als Multimorbidität definiert“ (Zaudig et al. 2006, 395). Moggi et al. einigen sich auf den Begriff der Doppeldiagnose, als einen besonderen Fall von Komorbidität, der das Ko-Existieren einer Substanzstörung und einer andersartigen psychischen Störung bei einer Person bedeutet (vgl. 2004, 3). Löhrer hingegen wertet den Begriff der Doppeldiagnose als umgangssprachlich und verweist hierbei auf dessen Einführung aus der sozialarbeiterischen Literatur der USA ((„Dual Diagnosis“) in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Dieser Terminus beschreibt das gleichzeitige Vorhandensein von mehreren psychiatrischen Störungsbildern, später jedoch wird dieser begrenzt auf die Parallelität einer Suchterkrankung und einer weiteren psychischen Störung. Zu Beginn der 90er Jahre lässt sich der Begriff Doppeldiagnose auch im deutschen Sprachgebrauch nieder (vgl. Löhrer 1999, 15).
Erst eine genaue Beschreibung eines Krankheitsbildes bzw. das Diagnostizieren geben dem Komorbiditätsgedanke seine gegenwärtige Bedeutung. Mit Einführung der Krankheitsklassifizierungskataloge ICD-10[2] und DSM-IV[3] der World Health Organization (WHO) ist es möglich geworden, das gleichzeitige Vorliegen von mehreren psychiatrischen Störungen zu benennen. Zuvor wurden alle wahrgenommenen Symptome eines Patienten auf eine einzige Grundstörung zurückgeführt, so dass das Parallelvorkommen zweier gleichrangiger Krankheiten unbeachtet blieb (vgl. Moggi 2002, 16).
Die Verwendung des Komorbiditätsbegriffes differenziert jedoch nicht zwischen der Intensität der einzelnen Erkrankungen. Eine sozial integrierte Person, die an einer Dysthymie[4] und schädlichem Alkoholgebrauch leidet, bekommt zunächst dieselbe Diagnose der Komorbidität wie eine heroinsüchtige, obdachlose Person mit einer paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie (vgl. Moggi et al. 2004, 3f.).Bachman et al. machen außerdem darauf aufmerksam, dass die Komorbidität kein diagnostisches Problem ist, sondern ein therapeutisches . Ihrer Auffassung nach ist aus klinisch-praktischer Sicht Komorbidität eindeutig daran zu erkennen, dass die Therapie der einen Störung durch die andere Erkrankung erheblich erschwert wird (vgl. Bachmann et al. 1997, 261).
Es erscheint bei der Verwendung des Begriffes Komorbidität notwendig, die genaue Störungskombination mit zu benennen, da eine Vielzahl an verschiedenen Komorbiditäten bekannt sind. Als Beispiel könnte das komplette Klassifikationssystem ICD-10 oder DSM-IV fungieren, mithin jede schwere psychiatrisch diagnostizierbare Störung in Kombination mit einer diagnostizierten Substanzstörung, welche ebenfalls zu den psychiatrischen Erkrankungen zählt [d. V.].
In der vorliegenden Arbeit wird sowohl der Begriff Komorbidität als auch der Begriff Doppeldiagnose verwendet und soll hier als gleichzeitiges Vorkommen einer stoffgebundenen Abhängigkeitserkrankung und einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis verstanden werden.
2.1.1. Substanzmittelabhängigkeit
Der Begriff der Abhängigkeit gilt als behandlungsbedürftige Krankheit und wurde 1968 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geprägt. Dadurch wurde der bis dato eher unscharfe Terminus „Sucht“ ersetzt und in die Umgangssprache übernommen (vgl. Möller et al. 1996, 283). In dieser Arbeit werden beide Begriffe benutzt. Sucht möchte hier als sprachlicher Oberbegriff für die Kategorie Substanzmittelabhängigkeit verstanden werden.
Aus psychiatrischer Sicht meint Substanzmittelabhängigkeit ein zwingendes Verlangen, eine bestimmte Substanz wieder und wieder einzunehmen, auch wenn negative Konsequenzen damit einhergehen. Dieses zwanghafte Angewiesensein auf gewisse Stoffe darf nicht zu der Annahme verleiten, dass diese das ausschlaggebende Element der Abhängigkeitserkrankung seien. (vgl. Möller et al. 1996, 283).Gross sieht die Substanzen als Mittel zum Zweck, um eine Veränderung der gesamten seelischen Verfassung zu erwirken - er definiert Abhängigkeit als „unabweisbares Verlangen nach einem bestimmten Gefühls-, Erlebnis- und Bewusstseinszustand“ (Gross 1992, 13). Die Herbeiführung von Lustzuständen, wie das Erleben von Verbundenheit mit sich selbst und anderen, Freude und Harmonie sollen herbeigeführt und Unlustgefühle wie Angst, Schmerz Ärger und Trauer vermieden werden. Der konsumierende Mensch ist nicht in der Lage, das Leben, wie es ist - mit all seinen Facetten an Gefühlen - auszuhalten beziehungsweise es geschehen zu lassen. Er fühlt sich gezwungen, seine Gefühle durch psychotrope, d.h. das Bewusstsein verändernde Mittel zu manipulieren (vgl. Tretter 2001, 22 ff).
Als Suchtmittel sind alle Mittel geeignet, die das Gehirn bzw. das Handeln beeinflussen (vgl. Dörner et al. 2002, 250).
Die Destruktivität einer Abhängigkeit kann sich auf mehreren Ebenen ereignen: Körperlich, psychisch und sozial. Die körperliche Abhängigkeit zeigt sich deutlich an Entzugserscheinungen bei Nichtzufuhr der Substanz, außerdem entwickelt der Körper eine Toleranz gegenüber der konsumierten Substanz, was eine kontinuierliche Dosissteigerung zur Folge hat- der Körper braucht mehr Wirkstoff, um die gleiche Wirkung zu erzielen. (vgl. Gross 1992, 14).
Mit Fortschreiten der Abhängigkeitserkrankung und Gewöhnung an die Substanz werden zumeist noch andere Mittel zusätzlich konsumiert, um den gewünschten Effekt zu erreichen beziehungsweise einen berauschten Zustand herbeizuführen. Die Abhängigkeit von mehreren Substanzen wird als Polytoxikomanie bezeichnet, sie ist heute mehr die Regel denn die Ausnahme (vgl. van Treeck 2004, 473).
Kennzeichnend für die psychische Abhängigkeit ist das „süchtige Verlangen“, Craving genannt - der Betroffene verspürt eine geistige Besessenheit, den übermächtigen Wunsch nach dem Suchtstoff, gegen die der Verstand ohnmächtig ist, er fügt sich dem Verlangen (vgl. Tretter 2001, 22 f). Soziale Folgen der Abhängigkeit zeigen sich in der generellen Bereitschaft und der Versuch, sich das Mittel um jeden Preis zu beschaffen. Prostitution ist für die Mehrheit der süchtigen Frauen, ein Weg zur Beschaffung. Auch kriminelle Handlungen, wie z. B. Diebstahl, Raub oder Hehlerei etc. sind Mittel zum Zweck, um an Geld für Drogen zu gelangen.
Ferner ist ein Verlust der Kontrolle, über den Substanzmittelkonsum zu beobachten, jede erdenkliche Situation wird dazu benutzt, sich das Mittel einzuverleiben, sei es, um einer konfliktgeschwängerten Situation zu entfliehen und ein Lusterlebnis (künstlich) herbeizuführen. (vgl. Gross 1992, 11 ff). Die Abhängigkeit entwickelt zunehmend eine krankheitswertige Eigendynamik (vgl. Tretter 2001, 23). Schließlich dient alles Handeln und Denken des Betroffenen der Beschaffung, dem Verbrauch des Mittels und der Vertuschung der Krankheit. Früher oder später beginnt die soziale Abwärtsspirale, negative Folgen machen sich bemerkbar – Straffälligkeit, Probleme am Arbeitsplatz, soziale Beziehungen werden vernachlässigt, Schulden entstehen, nicht zuletzt zum Nachteil der Angehörigen, dem weiteren Umfeld des Betroffenen, sowie der allgemeinen Bevölkerung (vgl. Gross 1992, 14). Der Abhängige selbst befindet sich in der Gewalt dieser ständig fortschreitenden Krankheit, deren Ende bei Nichtbehandlung immer das Gleiche ist: Gefängnis, Anstalt oder Tod (Narcotic Anonymous 1993, 9).
Der Anteil der Abhängigen beträgt ca. 5 bis 7 % der Bevölkerung. Ca. 2,5 bis 3 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig, das sind 3 bis 5 % der Gesamtpopulation. Die Zahl der Drogenabhängigen liegt bei ca. 150 000 Menschen
(vgl. Möller et al. 1996, 289) und der Medikamentenabhängigen bei etwa 1,4 Millionen (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 2008, 18).
Abhängige stellen in psychiatrischen Versorgungskrankenhäusern die größte Patientengruppe dar (vgl. Möller et al. 1996, 289).
Bedeutsam für diese Arbeit ist neben den Begriffen der Abhängigkeit und Sucht auch der Terminus „Substanzmissbrauch“ und „schädlicher Konsum“. Im Gegensatz zur Abhängigkeit wird dieser nicht als Krankheit klassifiziert, sondern als auffälliges, von der Norm abweichendes Verhalten, welches nicht unbedingt den Bedarf einer Behandlung impliziert. Das ICD-10 ersetzte den Begriff „Missbrauch“ durch „schädlicher Konsum“ oder „schädlicher Gebrauch“ und meint damit den Konsum von psychotropen Substanzmitteln in übermäßiger Dosierung, der zu einer nachweisbaren Schädigung auf der körperlichen oder/und psychischen Ebene führt. Als Beispiel kann auf der körperlichen Ebene die Infizierung mit Hepatitis durch unsaubere Injektion einer Substanz genannt werden, im psychischen Bereich z. B. eine depressive Episode nach massivem Alkoholkonsum (vgl. Dilling et al., 2002, 116). Im DSM-IV dagegen wird der Begriff „Missbrauch“ beibehalten. Es zieht neben psychischen und physischen auch soziale Folgeschäden bei der Diagnosestellung mit in Betracht (vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen E. V. 2008, 219).
Innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten muss mindestens ein Kriterium wie folgt vorliegen:
„1. Wiederholter Substanzbebrauch, der zu einem Versagen bei der Erfüllung
wichtiger Verpflichtungen bei der Arbeit, in der Schule oder zu Hause führt.
2. Wiederholter Substanzgebrauch, in Situationen, in denen es aufgrund des
Konsumes (!) zu einer körperlichen Gefährdung kommen kann.
3. Wiederkehrende Probleme mit dem Gesetz in Zusammenhang mit dem
Substanzgebrauch.
4. Fortgesetzter Substanzgebrauch trotz ständiger oder wiederholter sozialer
oder zwischenmenschlicher Probleme, die durch die Auswirkungen der psycho-
tropen Substanz verursacht oder verstärkt werden“
(Kemper In: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen E. V. 2008, 220).
Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema „Abhängigkeit“ sind fließende Übergänge festzustellen: vom gelegentlichen, episodischen Gebrauch (von z. B. Medikamenten wie Schlafmitteln) zum gewohnheitsmäßigen Konsum (mehrmals in der Woche über einen längeren Zeitraum hinweg) bis hin zum Missbrauch (z. B. dasselbe Schlafmittel wird jetzt bei empfundenem Ärger auch tagsüber zur Beruhigung eingenommen) und über den schädlichen Gebrauch (es machen sich Folgeschäden bemerkbar) bis hin zur Abhängigkeit (das Gefühl, nicht mehr ohne das Schlafmittel leben zu können) (vgl. Tretter 2001, 23).
Sowohl der Missbrauch als auch die Abhängigkeit von psychotropen Substanzen
ist nach dem „biopsychosozialen“ Ursachenmodell (nach Feuerlein 1989) das Resultat einer länger andauernden wechselseitigen Beeinflussung dreier Faktoren :
Die Person im Hinblick auf den Entwicklungstand und der Veranlagung,
Die Umwel t (welches Beziehungsgefüge in welcher Gesellschaft),
Die konsumierte/n Substanz/en (Wirkung, Erreichbarkeit) (vgl. Tretter 2000, 26).
Heckmann hat als erweitertes und Modell zur Suchtentstehung das 5-Faktoren-Modell entwickelt. Es unterscheidet zwischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, Entstehungszusammenhängen, Anlässen, Voraussetzungen und begünstigenden Faktoren. Die genannten Faktoren sind in jedem Fall immer individuell zu bewerten (vgl. Heckmann 1997, 101).
Eine nähere Erläuterung der vielen verschiedenen Ursachen – und Erklärungsmodelle zur Entstehung und der sich gegenseitig bedingenden Faktoren der Suchterkrankung soll hier nicht Thema sein. Ich verweise hierbei auf die einschlägige Fachliteratur.
2.1.2. Psychose
Im Folgenden möchte ich den Terminus „Psychose“ und „Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis“ näher erläutern.
Der Begriff Psychose meint allgemein „psychische Störungen, die mit einem strukturellen Wandel des Erlebens einhergehen.“ (Pschyrembel 2002, 1380)
Wahrnehmung, Gefühl und Denken sind grundlegend verändert, die Sinne entwickeln ein Eigenleben - das ganze Dasein gewinnt eine andere Bedeutung und wird in einem neuen Zusammenhang erlebt (vgl. Bock 2003, 12).
Die Psychosen lassen sich in zwei Untergruppen aufteilen:
Die exogenen, auch organischen Psychosen genannt, sind psychische Störungen, die auf nachweisbaren Hirnschädigungen oder Hirnfunktionsstörungen beruhen.Die endogenen oder nicht-organischen Psychosen, bei denen anlagebedingte Faktoren eine wichtige Rolle spielen, werden in affektive, schizo-affektive und schizophrene Psychosen unterteilt. Beispiele für affektive Psychosen sind endogene Depression, Manie und die Bi-polare Erkrankung. Im Fall der affektiven Psychosen stehen Störungen des Gefühlslebens und des Antriebes im Vordergrund (vgl. Tölle 1999, 236). Die schizophrenen Psychosen oder aber Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis, um die es in dieser Arbeit geht werden auch als kognitive Psychosen bezeichnet, weil dabei das Denken des Betroffenen bedeutend verändert ist (vgl. Bock 2003, 12). Schizo-affektive Psychosen sind Mischformen, die sowohl Symptome der affektiven Psychose als auch der kognitiven Psychose aufweisen (vgl. Pschyrembel 2002, 1380).
Eugen Bleuler, Arzt und Forscher, prägt den Begriff der Schizophrenie 1911 (vgl. Finzen 2001, 21). Etymologisch leitet sich das Wort „Schizo“ (gespalten, getrennt) „Phrenie“(Geist) aus dem Griechischen ab (vgl. Duden 2005, 937). Bleuler hoffte damit zu zeigen, dass die Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen eine der grundlegendsten Eigenschaften der Schizophrenie ist (vgl. Finzen 2001, 21).
Häufig wird der Ausdruck als „gespaltene Persönlichkeit“ missverstanden. Laut Finzen hat sich dieses Klischee bis heute hartnäckig gehalten - es habe sich im deutschen Umgangssprachgebrauch sogar eine Eigendynamik entwickelt, die mit der eigentlichen Erkrankung sehr wenig zu tun hat. Schizophrenie ist zur Metapher mutiert - für alles, was als widersinnig, irr, unberechenbar und geistesgestört betrachtet wird (vgl. Finzen 2001, 24). “ Schizophrenie ist Innbegriff der Geisteskrankheit“ (Finzen 2000, 24). Um dieser Stigmatisierung, die dem Terminus der Schizophrenie anhaftet entgegenzusteuern, wird die Bezeichnung „Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“ bevorzugt.
Beim Diagnostizieren einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis gelten folgende Symptome und Symptomgruppen laut Bleulers Schizophreniekonzept als relevant:
1. Im kognitiven Bereich: Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung, Gedanken-
entzug, Zerfahrenheit (zusammenhangloses, unlogisches
Denken), Gedankenabreißen, Gedankenausbreitung
2. Wahn wahrnehmung : Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Stimmenhören,
Sinnestäuschungen( akustische, optische, taktile
Halluzinationen)
Wahnbildung (z. B. Vergiftung, religiöser Wahn,
Verfolgungswahn, Größenwahn)
katatone Symptome sind Störungen der Psychomotorik
(Bewegungsunfähigkeit wechselt mit psychomotorischer
Unruhe)
3. Im affektiven Bereich: inadäquate Gefühlsreaktionen, Ambivalenz,
Entscheidungsunfähigkeit, Instabilität der Stimmungslage
mangelnder Kontakt, affektive Verflachung, Angst,
erlebte Gefühlsverarmung, depressive Verstimmungen,
aber auch ekstatische Glücksgefühle mit Entrücktheit
4. Ich-Störungen: Desintegration von Denken, Fühlen, Wollen und Handeln,
Autismus (Rückzug aus der Wirklichkeit), Entfremdungs-
erlebnisse (Depersonalisation), Verlust der eigenen
Grenzen ( z. B. das Gefühl, dass die Gedanken gelesen
werden), Gedankendrängen, Unkontrollierbarkeit der Ge-
danken (vgl. Möller et al. 1996, 133 ff.)
5 . intakte Funktionen: Wahrnehmung der Außenwelt, Gedächtnis, Orientierung
in Zeit und Raum, Bewusstsein, Aufmerksamkeit,
intellektuelle Fähigkeiten (vgl. Finzen 2000, 58)
Die Symptome können unterschiedlich schwach bis stark ausgeprägt sein. Für die Diagnose „Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“ nach dem ICD-10 ist mindestens eines der unter 1., 2. oder 3. genannten Erscheinungen innerhalb eines Zeitraumes von einem Monat festzustellen. Für das DSM-IV ist wiederum der soziale Faktor mit von Bedeutung: Das Funktionsniveau in den Bereichen Arbeit, soziales Gefüge oder Hygiene ist deutlich gesunken im Vergleich zu dem zuvor erreichten Niveau. Darüber hinaus ebenso mindestens ein Phänomen aus den ersten drei Gruppen (s. o). Manche Anzeichen für eine Störung können mindestens ein halbes Jahr andauern. In diesem Zeitraum treten zusätzlich und mindestens während eines Monats Symptome aus den anderen Bereichen auf (z. B. neben dem bereits 6 Monate andauernden „Vergiftungswahn“ eines Betroffenen sind soziale Folgen bemerkbar geworden, der Betroffene isst nichts mehr aus Angst vor vergifteter Nahrung, hat merklich abgenommen, dazu kommen nun als neuerliches Symptom deutlich affektive Störungen wie Panik und Gereiztheit) (vgl. Andres 1997, 14).
Erwähnenswert für die Beschreibung der Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis ist die Unterscheidung der Symptome in so genannte Minus- und Plussymptome. Zu den Minussymptomen, auch negative Symptome genannt, zählen u. a. Antriebsmangel, Affektarmut und Störungen, die die Funktionen Intentionalität und Antrieb und die Psychomotorik betreffen. Diese Symptome beeinträchtigen in besonderem Maße die soziale Leistungsfähigkeit des Betroffenen, da sie zu völligem Rückzug, Antriebslosigkeit und sozialer Verwahrlosung führen können (vgl. Rahn et al. 1999, 239). Zur Plussymptomatik oder auch den produktiven Symptomen gehören u. a. Wahn, Halluzinationen und formale Denkstörungen. Die Symptome können dabei zwischen Minus- und Plussymptomatik wechseln (vgl. Möller et al. 1996, 127 ff.)
Nach dem Klassifizierungskatalog ICD-10 der Kategorie F2 lassen sich die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis in weitere Untergruppen, die sich im jeweiligen Zustandsbild unterscheiden, aufteilen:
Paranoide Schizophrenie:
A. die allgemeinen Kriterien für eine Schizophrenie sind erfüllt
B. vordergründige Symptomatik sind Wahn, insbesondere Verfolgungs-,
Beziehungs-, Abstammungs-, Sendungs- oder Eifersuchtswahn,
Halluzinationen wie z. B. drohende oder imperative Stimmen treten auf
C. verflachter oder inadäquater Effekt, katatone Symptome oder Zerfahren-
heit dominieren nicht
Hebephrene Schizophrenie:
A. die allgemeinen Kriterien für eine Schizophrenie sind erfüllt
B. eine eindeutige und anhaltende Verflachung, Inadäquatheit oder Oberflächlichkeit
des Affektes liegen vor
C. zielloses Verhalten oder Denkstörungen, die sich als weitschweifige oder
zerfahrene Sprache äußern
D. Halluzinationen oder Wahnphänomene dominieren nicht.
Für die hebephrene Form verwendet das DSM-IV den Ausdruck: „disorganized type“
Katatone Schizophrenie
A. die allgemeinen Bedingungen für Schizophrenie sind erfüllt
B. wenn für mindestens zwei Wochen eines oder mehrere Merkmale auftreten:
Stupor (Bewegungsstarre) , Erregung, Haltungssterotypien, Negativismus,
wächserne Biegsamkeit, Rigidität (Unnachgiebigkeit, Steifheit)
oder Befehlsautomatismus
Schizophrenia simplex
A. vorwiegende Negativsymptomatik , einhergehend mit sozialem Rückzug,
Antriebsverlust, Passivität, Verhaltensauffälligkeiten wie verminderte non-
verbale Kommunikation, Sprachverarmung, Interessenverlust, zielloses
Verhalten, wirres Denken
B. deutliche Abnahme der beruflichen oder schulischen Leistung
C. eine organische Störung ist auszuschließen
Weiterhin existieren unterschiedliche Mischformen aus oben genannten Subtypen
sowie relativ selten vorkommende atypische Restkategorien (vgl. Andres et al. 1997, 15f.), welche für das Verständnis dieser Arbeit nicht von Bedeutung sind.
Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis treten verhältnismäßig häufig in der Bevölkerung auf. Eine genaue Angabe über die Zahl der Erkrankten gestaltet sich als schwierig, da sich die Krankheit in vielfältigen Erscheinungsformen mit wechselndem Verlauf präsentiert (vgl. Jakubaschk 1997, 25). Insgesamt lässt sich festhalten, dass 0,8% bis zu 1,8% der weltweiten Allgemeinbevölkerung im Alter von über 15 Jahren irgendwann im Laufe ihres Lebens an einer schizophrenen Psychose erkranken (vgl. Arolt et al. 2004, 98 ff.). Hinsichtlich der Prognose handelt es sich bei Schizophrenie um eine der gravierendsten psychischen Störungen (vgl. Möller et al. 1996, 127), deren Verlauf ein breites Spektrum von einerseits völliger Heilung bis hin zur Chronifizierung des Leidens, das den Betroffenen in einem Pflegeheim enden lässt, beinhaltet (vgl. Jakubaschk 1997, 25).
Nach Bleuler kommt man der Wirklichkeit am nächsten, wenn man sich klarmacht, „dass… die Krankheit zeitlich und qualitativ ziemlich regellos verlaufen kann; kontinuierliches Fortschreiten, Stillestehen, Schübe, Remissionen sind jederzeit möglich. “ (zit.n. Bleuler in: Finzen 2001, 95).
In dieser Arbeit haben auch die drogeninduzierten Psychosen einen besonderen Stellenwert. Zur drogeninduzierten Psychose zählen psychotische Erscheinungen, die während oder nach einem Substanzgebrauch auftreten, aber nicht durch die akute Intoxikation erklärt und auch nicht dem Entzugssyndrom zugerechnet werden können. Drogeninduzierte psychotische Störungen sind vor allem im Zusammenhang mit der Einnahme von Alkohol, Cannabis, Kokain und Stimulantien beschrieben worden (vgl. Rahn et al. 1999, 418). Die Symptome der drogeninduzierten Psychose und der paranoiden Schizophrenie weisen eine immense Übereinstimmung auf. Selbst der Verlauf stimmt nach Täschner mit dem der Schizophrenie überein (vgl. Täschner 1992, 37 f.). In der Praxis können die Ähnlichkeiten der Symptome zu einer erschwerten Abgrenzung gegenüber Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis führen, daher erachte ich es als für notwendig, die drogeninduzierten Psychosen hier gesondert zu erwähnen.
2.2. Epidemiologie
Im Folgenden möchte ich einige Fakten zum Vorkommen der Komorbidität von Sucht und Psychose darstellen, um die Bedeutung dieser Störungskombination für das Suchthilfesystem und das psychiatrische Versorgungssystem aufzuzeigen. Zunächst werden die zentralen Begrifflichkeiten, die in diesem Kapitel von Bedeutung sind, vorgestellt.
Die Epidemiologie ist ein Wissenschaftszweig, der sich mit der Verteilung von Krankheiten und deren physikalischen, chemischen, psychischen und sozialen Folgen und Determinanten[5] innerhalb der Bevölkerung befasst (vgl. Pschyrembel 2002, 460). Prävalenz ist einer der am häufigsten gebrauchte Ausdruck in der epidemiologischen Forschung. Unter diesem Terminus wird „die absolute Häufigkeit einer Krankheit in einer bestimmten Population während eines bestimmten Zeitraumes (Periodenprävalenz) oder zu einem bestimmten Zeitpunkt (Punktprävalenz) verstanden.“ (Rahn et al. 1999, 29). Wird die gesamte Lebenszeit als Zeitraum betrachtet, so spricht man von Lebenszeitprävalenz (vgl. Lieb et al. 2002, 31).
Insgesamt liegen derzeit zur Koexistenz von Sucht und schizophrener Psychose nur vereinzelte repräsentative epidemiologische Befunde vor. Obwohl Komorbidität schon vor dem 2. Weltkrieg im Augenmerk von z. B. Stringaris aus Heidelberg stand, welcher Psychosen in Folge von Cannabiskonsum beschrieb und auch Bleuler bereits um die Jahrhundertwende reges Interesse am Phänomen der Doppeldiagnose (Schizophrenie und Alkoholabhängigkeit) zeigte, verschwand dieser Personenkreis wieder aus dem wissenschaftlichen Blickfeld. Rink mutmaßt, dass das zwiespältige Verhältnis von Sucht und Psychiatrie dafür mitverantwortlich sein könne und beruft sich dabei auf Krausz (1994) (vgl. Rink 2003, 87 f.).
In den USA sorgte die Deinstitutionalisierung der psychiatrischen Versorgung und deren Auswirkungen Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts für fachliches Interesse. Darüber hinaus ist seit Anfang der 80er Jahre ein immenser Zuwachs an Veröffentlichungen zum Themengebiet der Komorbidität zu beobachten (vgl. Krausz et al. 1999, 101). In Deutschland hingegen mutmaßte Täschner erstmals nach Einsetzen der sogenannten Drogenwelle in Deutschland Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts einen Zusammenhang zwischen schizophrener Psychose und Drogenkonsum – 15% der Drogenkonsumenten wiesen laut seiner erhobenen Untersuchung psychotische Symptome auf. Im Vergleich hierzu stellte er fest, dass die Prävalenz von schizophrenen Psychosen in der Bevölkerung - ca. eine von hundert Personen wird im Laufe ihres Lebens an Symptomen der schizophrenen Psychose erkranken - doch deutlich niedriger liegt. Diese Feststellung war Ausgangspunkt für erste empirische Überprüfungen in Deutschland (vgl. Täschner 1992, 35). Epidemiologische Befunde zur Komorbidität von Sucht und psychischen Erkrankungen lassen sich zum einen in repräsentativen Bevölkerungsstichproben untersuchen, zum anderen an Patienten im stationären oder ambulanten Behandlungskontext erheben. Die klinischen Stichproben (z. B. Allan, 1995; DeJong et al., 1993; Driessen, 1999;) implizieren jedoch eine mögliche Verzerrung der Befunde durch die sogenannte Stichprobenselektivität (vgl. Lieb 2002, 31), welche darüber hinaus nur begrenzt vergleichbar sind, weil deren Ergebnisse durch unterschiedliche Untersuchungsmethoden, Einrichtungsmerkmale und Zuweisungs-
effekte beeinflusst werden (vgl. Moggi 2002, 18).
Mueser et al. gehen sogar davon aus, dass die erhobenen Ergebnisse der meisten Komorbiditätsschätzungen im klinischen Behandlungssetting im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung in die Höhe getrieben worden sind, denn nach dem so genannten Berkson`schen Irrtum (Berkson 1949) erhöht jede Störung, die an einer Person feststellbar ist, die Wahrscheinlichkeit, dass die betroffene Person eine Behandlung erhält. Demzufolge nehmen Menschen mit einer Doppeldiagnose häufiger Einrichtungen der psychosozialen Versorgung in Anspruch als Menschen mit nur einer Diagnose - dadurch sind diese in klinischen Studien oft überrepräsentiert (vgl. Mueser et al. 2002, 94). Die größte epidemiologische Studie an einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von ca. 20.000 untersuchten Personen ist die amerikanische „Epidemiological Catchment Area Study“ (ECA) von Regier et al., 1990. Diese ergab, „dass eine Lebenszeitprävalenz von psychischen Erkrankungen bei 22,5%, diejenige von Alkoholmissbrauch- oder abhängigkeit bei 13,5% und diejenige von Drogenmissbrauch- oder abhängigkeit bei 6,1% liegt. Von den Personen mit psychischen Störungen leiden 29% auch an einer Substanzstörung bzw. ihre Wahrscheinlichkeit, an einer Sucht zu erkranken, ist bei ihnen im Vergleich zu Personen ohne psychische Störungen 2,7-mal höher. Ausschließlich unter einer psychischen Störung leiden lediglich 16.2%. Bei Personen mit Alkoholstörungen ist die Zweiterkrankungsrate von Drogenstörungen und/oder psychischen Störungen 45%, bei Drogenstörungen gar 72%. Rund ein Drittel der Personen mit einer Alkoholstörung und rund die Hälfte der Personen mit einer Drogenstörung leiden irgendwann im Leben auch unter einer psychischen Störung. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Alkoholstörung zusätzlich an einer psychischen Störung zu erkranken, ist um den Faktor 2,3, bei einer Drogenstörung um den Faktor 4,5 erhöht .
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abildung 1: (S. 21) zeigt die Lebenszeitprävalenz von psychischen und Substanzstörungen in dieser repräsentativen Bevölkerungsstichprobe (Moggi, Donati 2004, 9f.) [6] .
Im Folgenden wird die Lebenszeitprävalenz von Erkrankten mit einer Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis für eine Suchterkrankung nach den Ergebnissen der ECA – Studie dargestellt. Zur Erinnerung: Die Lebenszeitprävalenz von Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis in der Allgemeinbevölkerung liegt bei 1 -1,5%.
Abbildung 2: Lebenszeitprävalenz der Störungskombination Sucht und Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis nach der Epidemiological Catchment Area Study (ECA)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(vgl. Moggi, Donati 2004, 10).
Gegenüber der Prävalenz in der Allgemeinbevölkerung sind die dargestellten Werte bis auf den Alkoholmissbrauch für alle Suchterkrankungen signifikant erhöht. Bei Menschen mit einer Substanzstörung liegt die Lebenszeitprävalenz, an einer schizophrenen Psychose zu erkranken, deutlich über den Werten der Allgemeinbevölkerung. Bei schizophrenen Patienten lag die Komorbiditätsrate bei 47%, an einer Abhängigkeit zu erkranken. Für Betroffene mit einem Alkoholmissbauch oder einer Alkoholabhängigkeit liegt das relative Risiko, an einer bestimmten psychischen Störung zu erkranken, bei 3,8%, für Menschen mit Drogenmissbrauch bei 6,9%, bei Drogenabhängigkeit bei 4,2% (Regier, C.A. et al.: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Results from the Epidemiological Catchment Area Study 1990, Nr. 264, 2511-2518; zit. nach Gouszoulis-Mayfrank 2003, 2).
„Das relative Risiko ist das Risiko, an einer bestimmten Suchtstörung zu erkranken, wenn auch eine psychische Störung vorliegt und umgekehrt.“ (Moggi, Donati 2004, 10).
Zur Komorbiditätsprävalenz im klinischen Behandlungssetting existieren eine Reihe von Erhebungen. Exemplarisch hierfür sollen an dieser Stelle die Ergebnisse der so genannten ABC-Schizophrenie-Studie von Hambrecht et al. 1996 gezeigt werden, in welcher das Vorkommen von Suchterkrankungen bei schizophrenen Patienten untersucht wurde. 1987 – 1989 wurden 392 Patienten mit einer ersten Episode von Schizophrenie oder paranoider Störung im Erhebungsfeld (Mannheim, Vorderpfalz, Heidelberg) erfasst. Ein besonderes Augenmerk legten Hambrecht et al. auf 66 Merkmalsausprägungen, die die psychische Störung bezeichnen, und auf eine exakte Datierung des Beginns der benannten Symptome. Durch parallele Interviews mit Angehörigen konnten die Angaben der Patienten nachgeprüft werden. Als Vergleichsgruppe diente eine alters- und geschlechtsgleiche Kontrollgruppe aus der Allgemeinbevölkerung. Nach Aussondierung blieben 232 Patienten, an denen die Auswertungen zur Komorbidität vorgenommen wurden.
Tabelle 1: zeigt die Prävalenz von Suchterkrankungen bei schizophrenen Patienten (n=232) im Hinblick auf den Geschlechtsunterschied, die Kategorie Missbrauch enthält dabei auch alle Formen des leichten bis schweren Missbrauchs und der Abhängigkeit (vgl. Hambrecht et al. 1996, 36 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Hambrecht et al. 1996, 40)
Die Vergleichsgruppe aus der Normalbevölkerung wies keine wahnhafte oder schizophrene Störung auf, jedoch bei 12,3 % (7 Personen) wurde eine Alkoholstörung und bei 7% (4 Personen) Drogenmissbrauch vermerkt. Anhand dieser Ergebnisse stellen Hambrecht et al. fest, dass die Häufigkeit von Alkohol- und Drogenmissbrauch bei Patienten, die eine erste schizophrene Episode erleben, bereits hoch angesiedelt ist – jeder vierte Patient hatte zum Zeitpunkt der ersten Behandlung bereits Alkohol missbraucht und jeder siebente Patient Drogen.
Die Lebenszeitprävalenz von 24% bzw. 14% liegt nahezu doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe aus der Allgemeinbevölkerung (vgl. Hambrecht et al. 1996, 36 ff.).
In Tabelle 1 wird darüber hinaus deutlich, dass ein erheblicher Unterschied zwischen männlichen und weiblichen schizophren Erkrankten zu beobachten ist. Die männlichen Patienten neigen demnach zu einem höheren Risiko für einen Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder kombinierten Missbrauch verschiedener Substanzen.
Wie in Tabelle 2 zu sehen ist, ergibt die Studie, dass Cannabis die am häufigsten konsumierte Droge bei diesen Patienten neben Alkohol ist. Fast 90% der Patienten, die Drogenmissbrauch betreiben, gaben Cannabis als konsumierte Droge an, aber nur 36,4% davon hatten ausschließlich Cannabis konsumiert. Auch Halluzinogene und Stimulantien (Kokain, Amphetamine) waren präsent. Auffällig ist, dass in keinem Fall Opiate eingenommen wurden (vgl. Hambrecht et al. 1996, 40 f.). Das seltene Auftreten der Komorbidität von schizophrener Psychose und Opiatabhängigkeit wird auch von Krausz et al. bestätigt. Dieser fand in seiner Hamburger Studie unter Opiatabhängigen mit Kontakt zum Drogenhilfesystem Prävalenzraten für Schizophrenie von nur 5 %, weitaus höhere Prävalenzraten aber für Opiatabhängigkeit und andere psychische Erkrankungen (Krausz et al. 1998, 557). Vor allem Persönlichkeitsstörungen werden als weitere häufigste Diagnose bei Suchtpatienten gestellt. Nach einer Übersichtsarbeit von Verheul, Brink Hartgers (1995) wurden Prävalenzraten von bis zu 79% bei Opiatabhängigen bekannt (vgl. Krausz, Verthein et al. 1999, 101).
Tabelle 2: Missbrauchte Drogen bei Patienten mit einer ersten schizophrenen Episode
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Hambrecht et al. 1996, 41)
Die hohen Prävalenzzahlen der ECA-Study und der ABC - Schizophreniestudie deuten auf einen Zusammenhang zwischen Substanzmittelabhängigkeit und Psychose hin, der nicht zufällig ist. Betroffene die bereits an einer Störung erkrankt sind, sind für das Risiko, an der jeweils anderen Störung zu erkranken, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung prädestiniert.
Gouszoulis-Mayfrank meint eine weitere Verschärfung des Komorbiditätphänomens von Sucht und schizophrener Psychose zu erkennen. Sie nennt aktuellere Studien der amerikanischen Literatur der letzten 10 Jahre z. B. von Chambers et al. 2001, der die Lebenszeitprävalenz für Substanzmissbrauch/-abhängigkeit unter Patienten mit Schizophrenie mit bis zu 60% ermittelt hat. Eine genauere Zusammenfassung der Daten ergibt für Kokainmissbrauch 15 – 20 %, Amphetamin 2 – 25%, Alkohol 20 – 60% und Cannabis 12 – 42%. (vgl. Gouszoulis-Mayfrank 2003, 2). Wie bereits erwähnt, fehlen große repräsentative Stichproben aus Europa, doch Gouzoulis- Mayfrank hält die Situation bezogen auf die Gesamtprävalenzzahlen in Deutschland durchaus vergleichbar mit der in Amerika, wobei es jedoch Unterschiede bezüglich der verschiedenen Substanzgruppen gibt. Je nach Verfügbarkeit in den verschiedenen Ländern dominiert eine Substanzgruppe. Prävalenzraten für den Kokainmissbrauch in Schweden, England und Frankreich (Cantor-Graae et al. 2001, Duke et al. 2001, Dervaux et al. 2001) ergaben 0 - 8,7% im Gegensatz von 15 – 50% in Amerika (vgl. Gouzoulis-Mayfrank 2003, 3).
Insgesamt lassen diese Studien den Schluss zu, dass komorbide Patienten insofern keine Randerscheinung, sondern die Kerngruppe unter den schizophren Erkrankten darstellen.
2.3. Verlauf
In diesem Kapitel möchte ich die Besonderheiten des Krankheitsverlaufs beim Zusammentreffen von schizophrenen Psychosen und Suchterkrankung herausstellen.
Laut Bachmann et al. ist der Verlauf der Doppeldiagnose als insgesamt ungünstig zu betrachten. Die Doppelsymptomatik beeinflusst sowohl die Psychose wie auch die Substanzmittelabhängigkeit nachteilig. Als Hauptursache wird die geringe Compliance[7] dieser Patienten genannt. Diese wird vor allem durch die Suchtstörung herabgesetzt. Der Drogenkonsum steht häufig in Wechselwirkung mit den ärztlich verordneten Psychopharmaka, wobei die Wirkungen herabgemindert werden oder aber andere ungünstige Nebeneffekte auftreten können. Außerdem merkt Bachmann an, dass Mitarbeiter des Versorgungssystems vermehrt mit Disziplin-, Kommunikations- und Kooperationsschwierigkeiten konfrontiert werden (vgl. Bachmann et al. 1997, 262). Das Drogenmilieu, welches nicht zuletzt aus einem Kreislauf der Beschaffung von Drogen und Mittel zur Beschaffung (Geld) besteht, „führt zu einer Verfestigung marginaler [8] Ueberlebensstrategien(!) und verstärkt die negative Spirale sozialer Randständigkeit bis hin zu sozialer Entwurzelung. Der Verbleib im Rahmen der Drogenszene kann ausserdem (!) die Identität als Süchtige fördern und zur Abwehr der Schizophreniediagnose führen“ (Bachmann et al. 1997, 262). Auch Moggi und Donati prognostizieren den tendenziell ungünstigen Verlauf von Doppeldiagnosepatienten. Sie betonen hierbei, dass der Verlauf und die Prognose von der Schwere der jeweiligen Störung abhängen: ist die Substanzstörung (z.B. langjährige Polytoxikomanie) und die psychische Störung (z. B. Schizophrenie oder Bipolare Störung) stark ausgeprägt, so ist auch der Verlauf ungünstiger als bei Patienten mit leichter Substanzstörung (z. B. Cannabismissbrauch) und weniger starker psychischer Störung (z. B. einfache Phobie). Phasen der Besserung und Verschlechterung der Komorbidität alternieren[9].
[...]
[1] Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit nur die männliche Form benutzt.
[2] ICD-10 ist die Abkürzung für International Classification of Diseases und bezeichnet das Krankheitsklassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der 10. Fassung. Anhand dieser Klassifizierung wird in Deutschland die Diagnose einer psychischen Erkrankung, wie z. B. der Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis oder aber Substanzmittelabhängigkeit etc., gestellt (vgl. Möller et al. 1996, 57).
2 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders der American Psychiatric Association (APA) ist ein weiteres weit verbreitetes Klassifizierungssystem, in dem die Kriterien für eine Diagnose von z. B. Substanz- und psychischen Störungen formuliert sind (vgl. Moggi et al. 2004, 5).
3 Eine ständig anhaltende depressive Verstimmung, die jedoch nicht die Kriterien einer typischen depressiven Episode oder einer Major Depression nach DSM-IV erfüllen. Die Betroffenen haben gewöhnlich ein Kontinuum an Tagen oder Wochen, in denen sie ein gutes Befinden beschreiben, aber insgesamt fühlen sie sich zumeist müde und depressiv, und nur schwer im Stande, mit den täglichen Anforderungen des Lebens fertig zu werden.
Die Diagnose wird erst im Verlauf von mindestens 2 Jahren gestellt (vgl. Peters, 1999, 149 f.).
[5] entscheidende Faktoren (Duden 2005, 224).
[6] Regier, C.A. et al.: Comorbidity of mental disorders with alkohol and other drug abuse. Journal of the American Medical Association 264, 2511-2518; zit. nach Moggi, Donati 2004, 10.
[7] Compliance (engl. Bereitschaft, Einwilligung): meint die Bereitschaft eines Patienten zur Zusammenarbeit mit dem Arzt bzw. zur Mitarbeit bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen, z. B. Zuverlässigkeit mit der therapeutische Anweisungen befolgt werden, z.B. bei der Einnahme der Medikamente (Pschyrembel 2002, 310).
[8] marginal (lat.): am Rande, auf der Grenze liegend; in den unsicheren Bereich zwischen zwei Entscheidungsmöglichkeiten fallend (Duden 2005, 633).
[9] alternieren (lat.): abwechseln, einander ablösen (Duden 2005, 55)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836623803
- DOI
- 10.3239/9783836623803
- Dateigröße
- 570 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Magdeburg-Stendal; Standort Magdeburg – Sozial- und Gesundheitswesen
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- substanzmittelabhängigkeit psychose doppeldiagnose komorbidität drogenpsychose
- Produktsicherheit
- Diplom.de