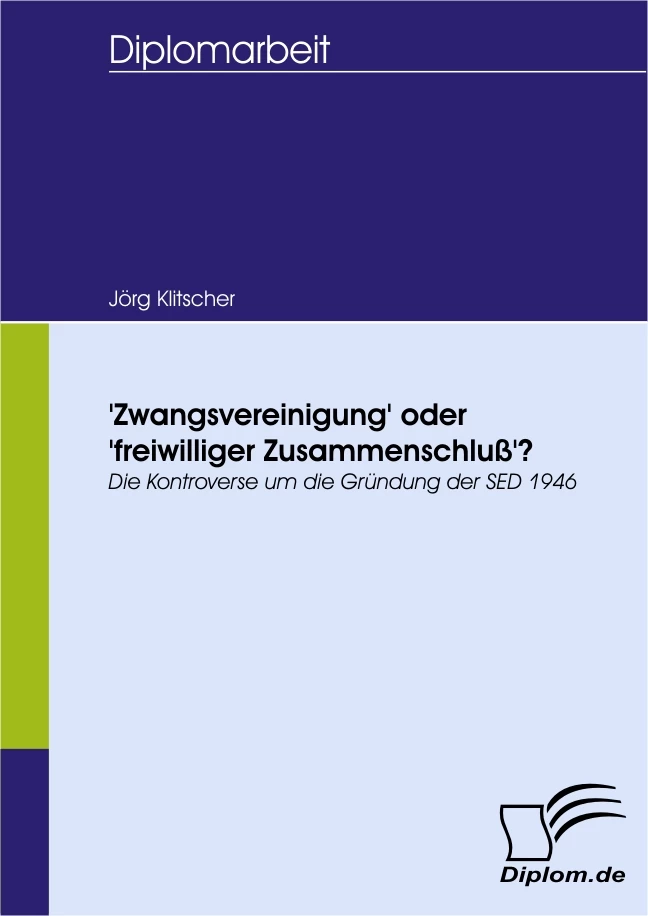'Zwangsvereinigung' oder 'freiwilliger Zusammenschluß'?
Die Kontroverse um die Gründung der SED 1946
Zusammenfassung
Anläßlich des 50. Jahrestages der Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) ist im Frühjahr 1996 eine alte Kontroverse neu belebt und in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Handelte es sich um eine Zwangsvereinigung, wie von sozialdemokratischer Seite und namhaften Historikern wie z.B. Hermann Weber seit jeher konstatiert wurde oder war es ein freiwilliger Zusammenschluß beider Parteien, wie DDR-Historiker immer wieder behauptet haben? In einer Flut von Presseartikeln, Diskussionsveranstaltungen und Fernsehsendungen erörterten Historiker, Politiker und Zeitzeugen diese Frage. Die Resonanz, die dieses Themas fand sowie die emotional aufgeladene Diskussion darüber, erklärt sich u.a. daraus, daß die Frage nach dem Zustandekommen der SED auch darauf zielt, wer die Verantwortung für den Ursprung der vierzigjährigen Herrschaft dieser Partei in der ehemaligen DDR trägt. So wies die CDU/CSU den Sozialdemokraten eine Mitverantwortung für die SED-Diktatur mit der These vom freiwilligen Zusammenschluß zu. Im Zusammenhang mit dem Magdeburger Modell (rot-grüne Minderheitsregierung mit Duldung durch die SED-Nachfolgepartei PDS) wurde die SED-Gründung von konservativer Seite als historisches Beispiel für die Gefahr einer linken Volksfront politisch instrumentalisiert.
Von aktueller politischer Bedeutung ist die Frage nach der Zwangsvereinigung auch für das Verhältnis zwischen SPD und PDS, insbesondere was eine mögliche Zusammenarbeit beider Parteien in den fünf neuen Bundesländern betrifft. So forderte die SPD im Zusammenhang mit Diskussionen um eine SPD-PDS-Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern von der PDS eine eindeutige Erklärung zum Zwangscharakter der SED-Gründung. Zum 50. Jahrestag der SED-Gründung hat die Historische Kommission der PDS ein Thesenpapier zu diesem Thema vorgelegt. Darin wurden zwar Elemente von Zwang bei der Fusion von SPD und KPD eingestanden, gleichwohl wurde der Begriff der Zwangsvereinigung als politischer Kampfbegriff aus der Zeit des Kalten Krieges verworfen, da er die Widersprüchlichkeit und Komplexität des damaligen Vereinigungsprozesses nicht angemessen beschreibe. Auch einige Historiker vermeiden diesen Begriff, weil er für eine wissenschaftlich-analytische Geschichtsaufarbeitung zu einseitig sei. Wolfgang Leonhard spricht alternativ dazu von einer diktatorischen Vereinigung und Harold Hurwitz von […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
I. 1. Fragestellung / Zielsetzung
I. 2. Methodik und Aufbau der Arbeit
I. 3. Forschungsstand
II. Von der Wiedergründung der Arbeiterparteien 1945 über die Vereinigung von SPD und KPD 1946 zur ‘Partei neuenTyps’ 1948/49
II. 1. Der Rekonstruktionsprozeß der KPD
II. 2. Der Reorganisationsprozeß der SPD in Berlin und der SBZ
II. 3. Parteienblock statt Einheitspartei
II. 4. Die Vereinigungskampagne
II. 5. Von der Gründung der SED bis zur Umwandlung in eine ‘Partei neuen Typs’ 1948/49
II. 6. Fazit
III. Die kontroversen Deutungen der Vereinigung von SPD und KPD in beiden deutschen Staaten
III. 1. Deutungen der SED-Gründung in der DDR
III. 1. 1. Zur politischen Funktion der Geschichte in der DDR
III.1. 2. Die Deutung der SED-Gründung in der Ulbricht-Ära
III. 1. 3. Deutungswandel in der Honecker-Ära
III. 1. 4. Fazit
III. 2. Deutungen der SED-Gründung in der BRD
III. 2.1. Zur politischen Funktion von Geschichte in der BRD
III. 2. 2 Die Interpretationen von Kurt Schumacher und Gustav Dahrendorf
III. 2. 3. Deutungen der SED-Gründung in der Zeit des Kalten Krieges
III. 2. 4. Deutungen der SED-Gründung in der Phase der Entspannungspolitik
III. 2. 5. Fazit
IV. Die Kontroverse zum 50. Jahrestag der Vereinigung von SPD und KPD
IV. 1. Zum Verhältnis von SPD und PDS
IV. 2. Das Wiederaufleben der Kontroverse nach 1989
IV. 3. Die Erklärung der Historischen Kommission der PDS zur SED-Gründung
IV. 4. Der Verlauf der Kontroverse im Frühjahr 1996
V. Zusammenfassung
VI. Quellen- und Literaturverzeichnis
V. 1. Gedruckte Quellen
V. 1. 1. Monographien und Aufsätze
V. 1. 2. Zeitungen
V. 2. Literatur
I. Einleitung
Anläßlich des 50. Jahrestages der Vereinigung von SPD und KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) ist im Frühjahr 1996 eine alte Kontroverse neu belebt und in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden. Handelte es sich um eine ‘Zwangsvereinigung’, wie von sozialdemokratischer Seite und namhaften Historikern wie z.B. Hermann Weber seit jeher konstatiert wurde oder war es ein ‘freiwilliger Zusammenschluß’ beider Parteien, wie DDR-Historiker immer wieder behauptet haben? In einer Flut von Presseartikeln, Diskussionsveranstaltungen und Fernsehsendungen erörterten Historiker, Politiker und Zeitzeugen diese Frage. Die Resonanz, die dieses Themas fand sowie die emotional aufgeladene Diskussion darüber, erklärt sich u.a. daraus, daß die Frage nach dem Zustandekommen der SED auch darauf zielt, wer die Verantwortung für den Ursprung der vierzigjährigen Herrschaft dieser Partei in der ehemaligen DDR trägt. So wies die CDU/CSU den Sozialdemokraten eine Mitverantwortung für die SED-Diktatur mit der These vom ‘freiwilligen Zusammenschluß’ zu. Im Zusammenhang mit dem „Magdeburger Modell“ (rot-grüne Minderheitsregierung mit Duldung durch die SED-Nachfolgepartei PDS) wurde die SED-Gründung von konservativer Seite als historisches Beispiel für die Gefahr einer linken Volksfront politisch instrumentalisiert. Von aktueller politischer Bedeutung ist die Frage nach der ‘Zwangsvereinigung’ auch für das Verhältnis zwischen SPD und PDS, insbesondere was eine mögliche Zusammenarbeit beider Parteien in den fünf neuen Bundesländern betrifft. So forderte die SPD im Zusammenhang mit Diskussionen um eine SPD-PDS-Zusammenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern von der PDS eine eindeutige Erklärung zum Zwangscharakter der SED-Gründung.[1]Zum 50. Jahrestag der SED-Gründung hat die Historische Kommission der PDS ein Thesenpapier zu diesem Thema vorgelegt. Darin wurden zwar ‘Elemente von Zwang’ bei der Fusion von SPD und KPD eingestanden, gleichwohl wurde der Begriff der ‘Zwangsvereinigung’ als politischer Kampfbegriff aus der Zeit des Kalten Krieges verworfen, da er die Widersprüchlichkeit und Komplexität des damaligen Vereinigungsprozesses nicht angemessen beschreibe.[2]Auch einige Historiker vermeiden diesen Begriff, weil er für eine wissenschaftlich-analytische Geschichtsaufarbeitung zu einseitig sei.[3]Wolfgang Leonhard spricht alternativ dazu von einer „diktatorischen Vereinigung“[4]und Harold Hurwitz von einer „Nötigung stalinistischer Prägung“.[5]
I. 1. Fragestellung/Zielsetzung
Im Zentrum der vorliegenden Diplomarbeit steht nicht primär die Darstellung des historischen Entwicklungsprozesses, der zur Gründung der SED führte. Vielmehr geht es darum, wie das Ereignis der SED-Gründung und ihrer unmittelbaren Vorgeschichte in der Vergangenheit und in der Gegenwart gedeutet wurde und wird. Es soll geklärt werden, welche Interessen und Motivationen hinter der jeweiligen Deutung der SED-Gründung als ‘Zwangsvereinigung’ oder ‘freiwilligem Zusammenschluß’ bzw. ‘Vereinigung mit Elementen von Zwang’ liegen. Wie wurde das Thema in der Geschichtsschreibung der alten Bundesrepublik behandelt und politisch interpretiert? Welche Kontroversen gab es dabei unter Umständen? Wie wurde die SED-Gründung in der ehemaligen DDR dargestellt und gedeutet? Hierbei ist auch die politische Funktion von Geschichte in der DDR und der BRD zu berücksichtigen.
Im Bezug auf die aktuelle Debatte soll geklärt werden, warum die alte Kontroverse wieder auflebt, was die zentralen Streitpunkte und Argumente sind, welche parteipolitischen Interessen möglicherweise im Hintergrund der Argumentation stehen. Welche Bedeutung hat die jeweilige Deutung der SED-Gründung für das Selbstverständnis von SPD und PDS sowie für das Verhältnis beider Parteien zueinander? Bedeutet die Erklärung der historischen Kommission der PDS eine neue Sichtweise gegenüber den alten apologetischen Erklärungsmustern der DDR-Geschichtswissenschaft? Worin bestehen Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
Mit dieser Diplomarbeit soll versucht werden, Klarheit in diese zeitgeschichtliche Kontroverse zu bringen und ihren geschichtspolitischen Gehalt herauszuarbeiten.
I. 2. Methodik und Aufbau der Arbeit
Geschichte ist kein im Wandel der Zeiten „gleichsam naturwüchsig anfallendes Produkt“, sondern sie wird von der jeweiligen Gesellschaft kulturell produziert, indem bestimmte Ereignisse der Vergangenheit gezielt vergegenwärtigt und gedeutet werden, während andere Ereignisse dem Vergessen anheimfallen. Das, was von der Vergangenheit unvergessen bleiben soll, wird in ein spezifisches Geschichtsbild integriert, wodurch die Vergangenheit „Teil der Kontinuität und Identität (wird), auf die jede Gesellschaft angewiesen ist.“[6]Die jeweilige Erklärung und Beurteilung der Vergangenheit ist „zu keiner Zeit und in keinem politischen System allein eine wissenschaftlich-akademische Übung gewesen“, sondern häufig auch das Produkt nichtwissenschaftlicher Zielsetzungen, die versuchen, Geschichte politisch zu instrumentalisieren.[7]Deutlich wird dies in historisch-politischen Kontroversen, bei denen „die Politik den Primat über Geschichte (gewinnt), indem diese von den Erfordernissen der Gegenwart ausgeht und so die Vergangenheit erreicht und gestaltet.“ Die Auseinandersetzung um die Deutung der Vergangenheit wird dabei häufig von politischen Akteuren als Ressource zur Mobilisierung der Anhängerschaft sowie der Öffentlichkeit oder als Mittel zur Diskreditierung politischer Gegner eingesetzt.[8]Infolge ihrer „mobilisierenden, politisierenden und legitimierenden Wirkungen“ wird die Auseinandersetzung um den Einfluß auf das vorherrschende Geschichtsbild immer wichtiger, zumal in pluralistischen Gesellschaften verschiedene gruppenspezifische Geschichtsdeutungen miteinander konkurrieren. Handelt es sich um eine bewußte Einflußnahme politischer Akteure auf die Vergangenheitsdeutung in der Öffentlichkeit oder um „den Versuch, politische Entscheidungen historisch zu legitimieren (und auf diese Weise gegen Kritik zu immunisieren)“, dann läßt sich von Geschichtspolitik sprechen.[9]Geschichtspolitische Strategien spekulieren darauf, daß „die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung füllt, die Begriffe prägt und die Vergangenheit deutet.“[10]Als Indikatoren für Geschichtspolitik können die Errichtung von Denkmälern und Gedenkstätten, die Einrichtung historischer Museen, die Inszenierung von Staatsfeier- und Gedenktagen gelten.[11]Aber auch Kontroversen um die Deutung vergangener Ereignisse wie z.B. die SED-Gründung können eine geschichtspolitische Dimension haben. Insbesondere dann, wenn politische Akteure (z.B. Parteien, Interessenverbände) versuchen, mit der Diskussion um die Geschichte „politische Konstellationen zu verändern, Gegner zu diskreditieren und gute Ausgangspunkte für künftige Konflikte zu schaffen. Diese Diskussionen können auch der Ablenkung von anderen Herausforderungen oder Verantwortlichkeiten dienen, sie vermögen sogar, in Verbindung mit Vorhaltungen neue Zusammenhänge zu schaffen und Identitäten zu bilden, die wieder politisch mobilisierbar sind.“[12]Dementsprechend zielen geschichtspolitische Fragestellungen nicht auf die Rekonstruktion vergangener Wirklichkeiten ab, sondern untersuchen durch die Analyse von Erinnerungsreden, Gedenkinszenierungen und öffentlichen Diskursen, „wie Traditionen konstituiert werden, wie sie sich wandeln, wie Ereignisse im nachhinein gedeutet und politisch ‘wiederverwendet’ werden.“[13]
Diesem Untersuchungsansatz folgt die vorliegende Diplomarbeit anhand der divergierenden Deutungen der SED-Gründung sowohl in der alten Bundesrepublik und der DDR als auch im wiedervereinigten Deutschland, besonders im Zusammenhang mit der Kontroverse um den 50. Jahrestag der SED-Gründung 1996.
Im ersten Teil soll zunächst in Form eines historischen Überblicks ausgehend vom aktuellen Forschungsstand dargestellt werden, wie sich der Neuaufbau der Arbeiterparteien SPD und KPD nach Kriegsende in der SBZ und Berlin vollzog, wie sich das Verhältnis beider Parteien zueinander entwickelte, welche Rolle die Besatzungsmacht dabei spielte. Es sollen der Verlauf der Fusionskampagne bis zum Vereinigungsparteitag am 21./22. April 1946 sowie die Hintergründe und Motivationen für die Fusion aufgezeigt werden. Die Rolle Kurt Schumachers und die Entwicklung der SPD in den Westzonen kann dabei aus Gründen der Umfangsbegrenzung nur am Rande erwähnt werden, zumal sich die dortige Entwicklung unter völlig anderen besatzungspolitischen Rahmenbedingungen als in der SBZ vollzog. Außerdem soll ein kurzer Ausblick über die weitere Entwicklung der SED bis zu ihrer Umwandlung in eine ‘Partei neuen Typs’ gegeben werden, der die innerparteiliche Verfolgung und Bekämpfung sozialdemokratischer Positionen darstellt. Dies ist u.a. deshalb notwendig, weil viele Sozialdemokraten der SED beitraten, um sozialdemokratische Positionen in der Einheitspartei geltend zu machen. Die weitere Entwicklung der SED war jedoch von einer allmählichen Eliminierung sozialdemokratischer Positionen geprägt, woran sich zeigte, daß die ursprünglichen Hoffnungen auf gleichberechtigte Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und Kommunisten illusionär waren.
Im zweiten Teil soll dargestellt werden, wie die SED-Gründung in den beiden deutschen Staaten historisch gedeutet wurde, wobei zunächst jeweils als Grundlage auf die politische Funktion von Geschichte bzw. Geschichtswissenschaft in DDR und BRD eingegangen wird. Bei der Darstellung der divergierenden Deutungen in Ost und West werden aus Gründen der Umfangsbegrenzung Erinnerungsreden zu ausgewählten Jahrtestagen, die wichtige Zäsuren darstellen (1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986) sowie geschichtswissenschaftliche Darstellungen als Quellenbasis benutzt.
Im dritten Teil soll die aktuelle Kontroverse zum 50. Jahrestag der ‘Zwangsvereinigung’ sowie ihre unmittelbare Vorgeschichte näher untersucht werden. Hierzu werden Presseartikel, Diskussionsbeiträge und Erklärungen der Parteien herangezogen und analysiert. Es soll herausgearbeitet werden, worin die zentralen Differenzen bestehen und welche Bedeutung die unterschiedlichen Interpretationen der Ereignisse für das Selbstverständnis der Parteien sowie ihr Verhältnis zueinander haben. Außerdem soll geklärt werden, welche parteipolitischen Interessen hinter den unterschiedlichen Deutungen stehen.
I. 3. Forschungsstand
Zum Themenkomplex Vereinigung von SPD und KPD zur SED in der Sowjetischen Besatzungszone wurden in der Vergangenheit eine Fülle historischer Publikationen veröffentlicht. Neben Darstellungen aus der Sicht engagierter Zeitzeugen[14]erschien bereits Ende der fünfziger Jahre eine Studie zur Entstehung und Entwicklung der SED von Carola Stern, die die Überlegungen der KPD in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung des Vereinigungsprozesses stellte, wobei die Probleme der Sozialdemokraten in der SBZ kaum berücksichtigt wurden.[15]Albrecht Kaden beschäftigte sich Mitte der sechziger Jahre mit der Wiedergründung der SPD nach 1945 und legte den Schwerpunkt auf die Entwicklung in den Westzonen, wobei er jedoch auch die organisationspolitischen Bestrebungen der SPD in der SBZ berücksichtigte und erstmals versuchte, die Entstehungsgeschichte der SED empirisch fundiert zu erforschen.[16]Erst Anfang der siebziger Jahre begann in der Bundesrepublik eine intensivere Beschäftigung mit der Entstehungsgeschichte der SED, was vor allem auf die mangelnde Zugänglichkeit von wichtigen Quellen, die in der DDR lagerten, zurückzuführen ist. Frank Moraw legte in diesem Zusammenhang eine wichtige Arbeit vor, die sich schwerpunktmäßig mit den Konzeptionen und Entscheidungen des Berliner Zentralausschusses der SPD im Vereinigungsprozess beschäftigte und die Quellen, die hierzu in der Bundesrepublik vorhanden waren, umfassend auswertete.[17]Die Programmatik der KPD nach 1945 analysierte Mitte der siebziger Jahre Dietrich Staritz.[18]Beatrix Bouvier analysierte Mitte der siebziger Jahre regionale Unterschiede im Verhältnis von Sozialdemokraten und Kommunisten in der SBZ.[19]Bouvier interviewte außerdem zusammen mit Horst-Peter Schulz SPD-Mitglieder und ehemalige SPD-Funktionäre der mittleren sowie der unteren Ebene aus der SBZ und lieferte damit wichtige Quellen aus der Perspektive von Zeitzeugen.[20]Werner Müller untersuchte Ende der siebziger Jahre den gescheiterten Versuch der KPD, eine Einheitspartei mit der SPD in den Westzonen zu bilden.[21]Die Nachkriegsentwicklung der SPD und den Widerstand der Sozialdemokraten gegen eine Fusion mit der KPD in Berlin untersuchte Dietmar Staffelt, der sich primär auf die Ebene der mittleren und unteren Parteieinheiten konzentrierte.[22]Ebenfalls mit der Vereinigungskampagne auf Berliner Ebene beschäftigte sich Harold Hurwitz, der mit seinem vierbändigen Werk zahlreiche neue Quellen vor allem aus Beständen der Westallierten erschloß und die Geschichte der Berliner SPD vom Kriegsende bis zur SED-Gründung minutiös darstellte.[23]
Die Geschichtsschreibung der DDR zur SED-Gründung hatte eine legitimatorische Funktion und versuchte, eine Kontinuität von KPD und SED nachzuweisen, wobei der Entwicklung der SPD nach 1945 in der SBZ wenig Beachtung geschenkt wurde. Außerdem waren auch für DDR-Historiker die wirklich wichtigen Quellen in den SED-Parteiarchiven nur begrenzt zugänglich.[24]Neben den parteioffiziellen Geschichtsdarstellungen in Überblickswerken[25]wurden zahlreiche Regionalstudien zur Vorgeschichte der SED-Gründung vorgelegt, die z.T. wertvolle Quellenhinweise lieferten, jedoch den zentralen Vorgaben zur Darstellung der SED-Gründung folgten.[26]Bezogen auf die Entwicklung der KPD im Jahr 1945 wurde von Günter Benser Mitte der achtziger Jahre eine materialreiche, differenzierte Studie vorgelegt, die trotz ihrer Parteilichkeit wichtige Aspekte der Organisations- und Politikgeschichte der KPD präsentierte.[27]
Nach dem Zusammenbruch der DDR wurde erstmals ein ungehinderter Zugang zu Quellen aus den SED-Parteiarchiven möglich, so daß im Rahmen der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit auch zur Vorgeschichte der SED-Gründung zahlreiche Quelleneditionen und Forschungsergebnisse präsentiert wurden.[28]Im Zusammenhang mit der SED-Gründung ist die umfangreiche Quellenedition von Andreas Malycha von besonderer Bedeutung. Sie dokumentiert den Weg zur Einheitspartei SED in breitem regionalen Zugriff und untermauert die These vom Gleichschaltungsdruck, dem Sozialdemokraten bei ihrer Entscheidung für eine Fusion mit der KPD in der SBZ ausgesetzt waren.[29]Malycha hat ebenfalls eine Studie vorgelegt, die sich mit der Entwicklung der SED in den Jahren 1946 bis 1950 beschäftigt und die Durchsetzung stalinistischer Strukturen in der Einheitspartei analysiert.[30]Zur gleichen Problematik hat auch Bouvier unlängst eine Studie veröffentlicht, die den Weg von Sozialdemokraten in die Einheitspartei nachzeichnet und schwerpunktmäßig die Ausschaltung ehemals sozialdemokratischer Funktionäre der mittleren Ebene in der SED behandelt. Sowohl die Rolle von Sozialdemokraten in den Führungsgremien der SED als auch der innerparteiliche Kampf gegen den Sozialdemokratismus und sozialdemokratische Aktivitäten am 17. Juni 1953 werden darin untersucht.[31]
Nach diesem Überblick über den Forschungstand zum Themenkomplex der SED-Gründung ist festzustellen, daß diese Thematik von der historischen Forschung in Ost und West (mit unterschiedlichen Ergebnissen) große Beachtung gefunden hat und in ihren Grundzügen als hinreichend erforscht betrachtet werden kann. Eine Untersuchung der geschichtspolitischen Kontroverse um die Deutung der SED-Gründung, insbesondere der Diskussionen um den 50. Jahrestag der ‘Zwangsvereinigung’ ist jedoch bisher nicht vorgelegt worden und soll deshalb mit dieser Diplomarbeit versucht werden.
II. Von der Wiedergründung der Arbeiterparteien 1945 über die Vereinigung von SPD und KPD 1946 zur ‘Partei neuenTyps’ 1948/49
Am 8. Mai 1945 ging der Zweite Weltkrieg in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht zu Ende. Einen Monat später, am 5. Juni 1945, übernahmen die alliierten Siegermächte die oberste Regierungsgewalt über das in Besatzungszonen aufgeteilte Deutschland. Der politische Neubeginn nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Herrschaft vollzog sich also in allen Zonen unter unmittelbarem Einfluß der Besatzungsmächte.[32]So planten die Sowjets ursprünglich, einen „Block der kämpferischen Demokratie“[33]als Sammlungsbewegung von Kommunisten, Sozialdemokraten, Liberalen und Konservativen zu bilden und somit vorerst keine eigenständigen Parteien zuzulassen. Jedoch genehmigte die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) bereits am 10. Juni 1945 - noch bevor die Alliierten in Potsdam über das weitere Vorgehen im besetzten Deutschland beraten konnten - den Aufbau antifaschistischer, demokratischer Parteien in ihrer Zone.[34]Die Gründe für diese „überraschende(n) und bedeutungsvolle(n) Sinnesänderung“ der Sowjets sind unklar, aber mit dieser Entscheidung nahmen sie eine entscheidende politische Weichenstellung vor, da die späteren Parteigründungen in den Westzonen dem ostzonalen Vorbild folgten. Deren Vorstände befanden sich wiederum im sowjetischen Einflußbereich (Ostberlin), was der SMAD „nicht unbeträchtliche Kontroll- und Einflußmöglichkeiten auf die Entwicklung dieser Parteien“ verschafft hätte, wenn es zu einem gesamtdeutschen Parteiensystem gekommen wäre.[35]
II. 1. Der Rekonstruktionsprozeß der KPD
Bereits am 11. Juni 1945 konnte das aus dem sowjetischen Exil zurückgekehrte und unter der Führung von Wilhelm Pieck stehende Zentralkomitee (ZK) der KPD mit einem Gründungsaufruf an die Öffentlichkeit treten. Dieser Schritt wurde ermöglicht durch eine jahrelange programmatische und strategische Vorbereitung des ZK der KPD auf seine Rolle im Nachkriegsdeutschland. Es hatte ein großes Funktionärspotential um sich gesammelt, das im Gefolge der Roten Armee Anfang Mai 1945 in drei Initiativgruppen nach Ostdeutschland zurückkehrte, um Schlüsselpositionen in den neuzubildenden Verwaltungen zu besetzen sowie die Wiedergründung der Partei organisatorisch vorzubereiten. Die Kommunisten wurden dabei von der sowjetischen Besatzungsmacht unterstützt und verschafften sich so „einen Vorteil (gegenüber den anderen Parteien), der nie ausgeglichen werden konnte.“[36]Beim Neuaufbau der Partei mußten sich diese zurückgekehrten KPD-Führer jedoch zunächst einmal gegen Widerstände von Altkommunisten durchsetzen, die während des NS in Deutschland geblieben waren. Es mußte „ein Höchstmaß an Umerziehungsarbeit“ geleistet werden, denn viele der Altkommunisten hingen immer noch der ultralinken KPD-Strategie der endzwanziger Jahre an und verbanden mit dem Einmarsch der Roten Armee Hoffnungen auf eine sofortige revolutionäre Umwälzung.[37]Außerdem bestand bei vielen ein „tiefes Mißtrauen gegen die Moskauer Exilführung“ sowie eine Abneigung gegen sowjetische Bevormundung. Trotzdem konnte sich die Parteiführung schließlich mit dem Argument durchsetzen, daß der Aufbau der Partei vordringlicher sei als der Aufbau des Sozialismus und weil sie den Altkommunisten „Geltung und Macht in Verbindung mit Sicherheit und Ordnung durch Anlehnung an einen mächtigen ‘Vater Staat’“, d.h. die sowjetische Besatzungsmacht in Aussicht stellen konnte.[38]
In ihrem Gründungsaufruf präsentierte sich die KPD als grundsätzlich gewandelte Partei, die für die „Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes einer parlamentarischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk“ eintrat. Als erste Schritte auf dem Weg dorthin wurden die Bildung freier Gewerkschaften und Parteien, die Säuberung des gesamten Bildungs- und Erziehungswesens von ehemaligen Nazis und der Wiederaufbau demokratischer Selbstverwaltungsorgane auf allen Ebenen propagiert.[39]Es wurde weder der Marxismus-Leninismus als ideologische Basis der Partei erwähnt, noch der Sozialismus als Zielperspektive. Statt dessen ging es der KPD um die „Vernichtung des Hitlerismus“ sowie die „Demokratisierung Deutschlands“ als Fortsetzung der Revolution von 1848. Das „Sowjetsystem“ sollte Deutschland nicht aufgezwungen werden, da laut KPD-Aufruf dieser Weg nicht den damaligen Entwicklungsbedingungen in Deutschland entsprach.[40]Die KPD verstand ihren Aufruf als „Aktionsprogramm“, das als „Grundlage zur Schaffung eines Blocks der antifaschistischen, demokratischen Parteien (...) dienen (sollte)“, weil ihrer Meinung nach nur „die feste Einheit aller (...) demokratischen und fortschrittlichen Volkskräfte“ die dringendsten Aufgaben des Wiederaufbaus lösen konnte.[41]Diese „Volksfront/Blockdemokratie-Konzeption (hatte) den taktischen Vorteil, die KPD aus ihrem früheren Sektierertum herauszuführen, die Partei politik- und bündnisfähig zu machen und ihr die Chance zu eröffnen, von der Spitze einer breiten politischen Sammlungsbewegung aus in die vier Besatzungszonen hinein zu wirken.“[42]Um dieses Ziel nicht zu gefährden, wurde auch darauf verzichtet, den „Übergangs-Charakter des antifaschistisch-demokratischen Regimes zu betonen“[43]oder eine sofortige Organisationseinheit der Arbeiterbewegung herzustellen, die die Bereitschaft bürgerlicher Parteien zur Blockpolitik hätte dämpfen können.[44]Der KPD-Gründungsaufruf „brach radikal mit den Programmtraditionen aus den Jahren vor 1933“[45], zugleich wurde jedoch an die Wende der kommunistischen Weltbewegung zur Einheits- und Volksfrontpolitik im Kampf gegen den Faschismus in den Jahren 1934/35 angeknüpft.[46]Innerhalb dieser Konzeption mußte sich die KPD „von einer Agitations- und Propagandapartei zu einer staatstragenden und gouvernementalen Organisation (...), von einer proletarischen Weltanschauungs- und Klassenpartei zu einer sozial übergreifenden Volkspartei (wandeln).“[47]Nachdem die anglo-amerikanischen Truppen die anfänglich von ihnen besetzten Gebiete in Thüringen und Teilen Sachsen-Anhalts im Juli 1945 geräumt hatten und auch dort die SMAD als Besatzungsmacht fungierte, bildete sich in der SBZ eine „einheitliche, flächendeckende Organisations-Gliederung“ heraus. Das ZK der KPD war bestrebt, überall arbeitsfähige Parteileitungen zu installieren, so daß sich der Parteiaufbau von oben nach unten unter Anleitung und Kontrolle des ZK vollzog. Dies erleichterte es, ‘linkssektiererische’ Tendenzen der dem Kurs der KPD-Führung kritisch gegenüberstehenden Parteimitglieder zu neutralisieren.[48]Um innerparteiliche Widerstände gegen die Linie des ZK auszuschalten, wurde mit restriktiven Aufnahmerichtlinien versucht, die Altkommunisten in eine Minderheitenposition zu drängen, während Neuaufnahmen von ehemaligen Sozialdemokraten oder Katholiken nicht an strenge Bedingungen geknüpft wurden. „Die neuen Parteimitglieder“, so Frank Stößel, „hoffte man leichter als die alten Genossen führen zu können, denn aus der Zeit vor 1933 wußte (das ZK), daß mit einem Funktionärskorps, ohne ideologische Traditionen (...), die Partei leichter zu lenken war.“[49]Das ZK der KPD konnte vom Juli 1945 an regelmäßige Verbindungen zu allen Bezirken, z.T. auch in den Westzonen unterhalten und durch die Entsendung von Instrukteuren die Entwicklung der unteren Parteieinheiten lenken und kontrollieren. So gelang es dem ZK, relativ schnell die Pflicht zur Parteidisziplin und die verbindliche Anerkennung von ZK-Beschlüssen innerparteilich durchzusetzen. Ihre Organisationsstruktur paßte die Partei dem staatlich-administrativen Aufbau in der SBZ an. Vor allem den Parteigruppen in Behörden und Verwaltungen wurde großes Gewicht beigemessen, ebenso wie dem Aufbau von Betriebsgruppen in Großbetrieben sowie in den Verkehrs- und Versorgungsunternehmen. Charakteristisch für die KPD-Parteiorganisation war der im Verhältnis zu anderen Parteien große Anteil hauptamtlicher Parteifunktionäre.[50]Mit 150 000 Mitgliedern Ende August 1945 sowie 260 000 Mitglieder Ende Oktober 1945 in Berlin und der SBZ konnte die KPD beachtliche Werbe- und Rekrutierungserfolge für sich verbuchen. Begünstigt durch die gemäßigte Linie der Partei, konnten vor allem jüngere Menschen und ehemalige Kritiker der KPD-Politik aus dem kommunistischen Spektrum angesprochen werden. Auf dem Lande konnte die KPD mit der seit Anfang September eingeleiteten Kampagne zur Bodenreform ebenfalls ein dichtes Netz von Ortsgruppen aufbauen und ihre politische Basis verbreitern. Außerdem strömten der Partei Kommunisten aus den früheren Ostgebieten zu.[51]So erreichte die KPD im Herbst 1945 bereits wieder ihren zahlenmäßigen Mitgliederstand von 1932 und konnte ihn sogar geringfügig überschreiten.[52]
II. 2. Der Reorganisationsprozeß der SPD in Berlin und der SBZ
Der Wiederaufbau der sozialdemokratischen Parteiorganisation im Nachkriegsdeutschland vollzog sich, aufgrund fehlender überregionaler Verkehrs- und Kommunikationsverbindungen, dezentral und eigenständig auf kommunaler und regionaler Ebene. Maßgeblich daran beteiligt waren ehemalige Funktionäre aus der Weimarer Zeit, die sich in verschiedenen Gründerkreisen zusammenfanden. Dementsprechend vielfältig waren die theoretischen Positionsbestimmungen und die Konsequenzen, die aus dem von vielen Sozialdemokraten als kritisch beurteilten Erfahrungen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus gezogen wurden. Trotz der Distanzierung von der SPD-Politik in der Weimarer Republik und dem Willen, einen politischen Neuanfang zu versuchen, blieb jedoch die Anknüpfung an die Parteitradition ein konstitutives Element der Wiedergründungsphase. Allerdings gab es auch Sozialdemokraten, die die SPD nicht wiedergründen wollten, sich an der Bildung lokaler Einheitsparteien mit der KPD beteiligten oder organisiert der KPD beitraten. Der Umfang dieser Verhaltensweisen ist jedoch nur schwer quantifizierbar. Die Bereitschaft, „zur KPD ein neues Verhältnis zu finden, das sich deutlich von der scharfen Konfrontation der Weimarer Zeit abheben sollte“, war zwar ein wesentlicher Bestandteil des politischen Neuanfangs, doch ist „mit Sicherheit anzunehmen, daß die Bereitschaft zur sofortigen organisatorischen Vereinigung (mit der KPD) nur bei einer Minderheit der Sozialdemokraten ausgeprägt war.“[53]Zudem ging es dieser Minderheit vornehmlich „um die Einbeziehung der Kommunisten in eine sozialdemokratisch orientierte und dominierte Einheitspartei.“[54]
In Berlin vereinigten sich Anfang Juni 1945 drei sozialdemokratische Gründungsinitiativen und konstituierten den „Zentralausschuß der SPD“ (ZA). Es handelte sich um Funktionäre der Weimarer SPD und der freien Gewerkschaften, die sich in einem „Zufallsgremium“ zusammenfanden, das „keineswegs das Ergebnis eines innerparteilichen Willensbildungsprozesses“ war.[55]Zum ZA gehörten u.a. Otto Grotewohl, Erich Gniffke, Max Fechner und Gustav Dahrendorf. Überrascht durch das Hervortreten der KPD als eigenständige Partei reagierte der ZA mit einem eigenen Aufruf, ohne sich mit Sozialdemokraten in der SBZ abstimmen zu können.[56]Der am 15. Juni 1945 veröffentlichte Gründungsaufruf des ZA begrüßte „auf das wärmste“ den KPD-Aufruf und stimmte ihm darin zu, daß der Neuaufbau Deutschlands von den gegenwärtigen Entwicklungsbedingungen abhängig sei sowie in Richtung einer „parlamentarisch-demokratischen Republik“ erfolgen müsse. Die sozialdemokratische Zielsetzung wurde auf die prägnante Formel „Demokratie in Staat und Gemeinde, Sozialismus in Wirtschaft und Gesellschaft!“ gebracht. Die daraus abgeleiteten Gegenwartsforderungen orientierten sich an traditionellen Programmpunkten der Weimarer SPD. Neben der Forderung nach „Verstaatlichung der Banken, Versicherungsunternehmen (...), der Bodenschätze (...), der Bergwerke und der Energiewirtschaft“ wurde für Gewerkschaften sowie Betriebsräte eine große Rolle bei der Reorganisation und Demokratisierung des Wirtschaftslebens eingefordert.[57]Ebenso wie die KPD bekannte der ZA sich zur restlosen „Vernichtung aller Spuren des Hitlerregimes in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung“, betonte aber, daß der Kampf um die Neugestaltung „auf dem Boden der organisatorischen Einheit der deutschen Arbeiterklasse“ geführt werden müsse. Als „moralische Wiedergutmachung politischer Fehler der Vergangenheit“, also der Spaltung der Arbeiterbewegung und ihr Scheitern 1933, sollte der jungen Generation „eine einheitliche politische Kampforganisation“ in die Hand gegeben werden.[58]Anders als die KPD demonstrierte der ZA mit diesem Aufruf ein Festhalten an traditionell sozialistischen Forderungen und präsentierte sich so „als die scheinbar radikalere der beiden Arbeiterparteien“, doch in den „wesentlichen Aussagen stimmten beide Programme (...) überein.“[59]Am 17. Juni 1945 fand die erste sozialdemokratische Funktionärsversammlung in Berlin mit etwa 1500 Teilnehmern statt. Die Versammlung bestätigte den ZA einstimmig als Führungsgremium der Partei und billigte den Gründungsaufruf, nachdem Otto Grotewohl eine „große pathetische Rede“ gehalten hatte, die im Appell zur Einheit der Arbeiterklasse gipfelte.[60]Zugleich wurde der Versammlung ein Parteistatut vorgelegt und diskussionslos gebilligt, das den ZA „mit Befugnissen ausstattete, die eigentlich dem zukünftigen Parteiausschuß der Gesamtpartei (...) vorbehalten waren.“ So nahm der ZA für sich in Anspruch, die Partei bis zum ersten Parteitag zu repräsentieren und vollkommen verbindlich zu vertreten.[61]Das Einheitsangebot seitens der SPD-Führung stieß bei der KPD auf wenig Resonanz. Bei der ersten Besprechung zwischen Vertretern des ZA und des ZK am 19. Juni 1945 erteilte Walter Ulbricht dem Ansinnen einer sofortigen Fusion beider Parteien eine offizielle Absage. Er erklärte, daß eine verfrühte Verschmelzung beider Parteien ohne vorherige Klärung ideologischer Fragen den „Keim neuer Zersplitterung“ in sich tragen und so den Gedanken der Einheit diskreditieren könnte. Statt dessen wurde übereinstimmend vereinbart, einen gemeinsamen zentralen Arbeitsausschuß als Ausdruck der Aktionseinheit beider Parteien zu bilden. In diesem Ausschuß, bestehend aus je fünf Vertretern des ZK und des ZA, sollten ideologische Fragen gemeinsam beraten werden, um in einem Prozeß der Annäherung Voraussetzungen für eine spätere Vereinigung zu schaffen. Zugleich sollten die Parteiführungen den nachgeordneten Instanzen beider Parteien empfehlen, ähnliche Gremien zur Zusammenarbeit auf Bezirks-, Kreis- und Ortsebene zu etablieren.[62]
Mit dem Ablehnen einer sofortigen Fusion durch das ZK war die Initiative des ZA in dieser Frage erst einmal gebremst worden. Zugleich bot sich dem ZA damit die Möglichkeit, nun alle Kräfte auf den Aufbau der sozialdemokratischen Parteiorganisation zu lenken.[63]
Der regional recht unterschiedlich verlaufene Reorganisationsprozeß der SPD in der SBZ wurde stark beeinflußt vom Verhältnis zur örtlichen KPD und SMA. Zunächst war die Notwendigkeit kaum umstritten, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, allerdings auf der Basis völliger Selbständigkeit und Gleichberechtigung der Parteien sowie im Interesse der Lösung tagespolitischer Probleme. Nach zentralem Vorbild wurden gemeinsame Ausschüsse von SPD und KPD geschaffen, aber dabei gab es in manchen Regionen erhebliche Verzögerungen. So blieben in Sachsen-Anhalt die Einheitsausschüsse eher die Ausnahme und in Mecklenburg-Vorpommern wurde erst Anfang Oktober 1945 auf Landesebene ein solcher Ausschuß gebildet. Zwar überwog das Bemühen, lokale Probleme der Bevölkerung gemeinsam zu lösen, doch in den Einheitsausschüssen bot sich in „den seltensten Fällen (...) ein Bild harmonischer Zusammenarbeit.“ In Leipzig fehlte sogar auf sozialdemokratischer Seite jegliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der KPD, was jedoch eine Ausnahme darstellte.[64]
Das Verhältnis zwischen Sozialdemokraten und der sowjetischen Besatzungsmacht gestaltete sich sehr unterschiedlich. So verzögerte sich die Zulassung der Partei in Mecklenburg-Vorpommern, weil die sowjetische Militärkommandantur in Schwerin darauf bestand, daß auch dort der Sitz des SPD-Landesvorstandes sein müsse, während die Sozialdemokraten dies ablehnten, weil Rostock traditionell Sitz des Landesvorstandes war und bleiben sollte. Außerdem griffen die Sowjets in innerparteiliche Personalentscheidungen ein und reagierten mit Versammlungsverboten, wenn „das Besatzungsregime öffentlich einer kritischen Betrachtung unterzogen wurde.“[65]Weniger Probleme mit den Sowjets hatten dagegen der SPD-Landesvorstand in Dresden und der Provinzialvorstand in Halle, denn offenbar „hing auch sehr viel vom persönlichen Verhältnis des Landes- und Bezirksvorsitzenden der SPD zur Kommandantur ab.“[66]Besondere Spannungen gab es z.B. zwischen Hermann Brill und dem Chef der SMA Thüringen Kolesnitschenko, die zur zeitweiligen Verhaftung und schließlich zur Absetzung Brills führten. Der Hintergrund war Brills Konfrontationskurs gegenüber den Sowjets, die Demonstration eigener Stärke sowie das Beharren auf einem organisationspolitischen und programmatischen Eigenleben der SPD in Thüringen. So wurde die SPD in Thüringen erst Ende August 1945 offiziell zugelassen, weil die SMA die Anerkennung des ZA in Berlin als zentraler Leitungsinstanz der SPD in der SBZ forderte, während die von Brill betriebene Gründung des Bundes demokratischer Sozialisten „praktisch eine Kampfansage an die in Berlin im Juni von Grotewohl (...) organisierte alte SPD (darstellte).“[67]
Bis zum September 1945 vollzog sich der Aufbau der sozialdemokratischen Parteiorganisation in der SBZ sehr erfolgreich. In den traditionellen Zentren der Sozialdemokratie wie Sachsen, Thüringen und in der Provinz Sachsen erreichte die SPD durch die Reorganisierung der alten Mitgliedschaft bis Ende 1945 wieder die Stärke der Weimarer Zeit. Ab Spätherbst 1945 und verstärkt Anfang 1946 setzte auch ein Zustrom neuer, vor allem junger Mitglieder ein. Laut Mitgliederstatistik hatte die SPD am 31. Dezember 1945 in der SBZ und Berlin 407 623 Mitglieder. Regional sehr unterschiedlich gestalteten sich die ersten Erfahrungen von SPD-Anhängern in der Zusammenarbeit mit Kommunisten, d.h. „man wird genügend Belege für die eine oder andere Deutung finden können“, so Andreas Malycha. Insbesondere der Hegemonieanspruch der Kommunisten, „der in einer Weise durchgesetzt (wurde), die das Selbstwertgefühl der Sozialdemokraten entscheidend verletzte“, erzeugte Unmut bei der SPD. „Ernüchterung und Desillusionierung“ folgten so der anfänglichen Kooperationsbereitschaft und dem emotionalen Bedürfnis nach einer einheitlichen Arbeiterbewegung. Konflikte mit den Kommunisten gab es vor allem bei der Besetzung von Bürgermeisterposten, Landratsämtern oder Stellen in den Länderverwaltungen. Dabei wurden die Kommunisten aufgrund ihrer ideologischen Gemeinsamkeiten von den Vertretern der SMAD bevorzugt, während Sozialdemokraten eine „offensichtliche Benachteiligung“ erlebten. Eine prägende Erfahrung für Sozialdemokraten war außerdem, daß „eine offene Konfrontation mit der Besatzungsmacht den Handlungsspielraum der Partei arg einengte.“[68]
II. 3. Parteienblock statt Einheitspartei
Die Weigerung des ZK, einer sofortigen Fusion zuzustimmen, wird unterschiedlich gedeutet.[69]Allerdings war die Einheitsperspektive „von vornherein ein integrales, wenn auch nicht vordringliches Ziel der KPD-Politik[70], die doppelgleisig sowohl in Richtung Arbeitereinheit als auch in Richtung eines Blocksystems mit bürgerlichen Parteien unter Dominanz der KPD agierte. Das Aktionsabkommen zwischen SPD und KPD war demzufolge von Seiten der KPD nicht als unmittelbare Vorstufe einer Parteiverschmelzung, sondern als „Sicherheitsventil für den Fall des Scheiterns der Blockpolitik“ gedacht.[71]
Im Juli 1945 erreichte die KPD ihr Ziel, einen Parteienblock zu gründen. Nachdem von der SMAD auch die Bildung bürgerlicher Parteien zugelassen worden war, traten am 26. Juni 1945 die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDUD) und am 5. Juli 1945 die Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (LDPD) mit Gründungsaufrufen an die Öffentlichkeit. Die CDUD bejahte das Privateigentum, plädierte aber für die Verstaatlichung von Bodenschätzen und Schlüssselindustrien, während die LDPD für eine freie Wirtschaft eintrat.[72]
Am 14. Juli 1945 gründeten die Vertreter von SPD, KPD, LDPD und CDUD in Berlin die „Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien“. Sie kamen überein, bei gegenseitiger Anerkennung ihrer Selbständigkeit einen gemeinsamen Ausschuß aus je fünf Vertretern jeder Partei zu bilden, um das Nachkriegsdeutschland auf antifaschistisch-demokratischer Grundlage aufzubauen und die Maßnahmen der SMAD durchzuführen. Ähnliche Ausschüsse sollten auch auf den Ebenen von Ländern, Bezirken, Kreisen und Gemeinden konstituiert werden. Die Geschäftsordnung sah vor, daß für alle Parteien bindende Beschlüsse auf dem Wege der Vereinbarung, nicht der Abstimmung gefaßt werden sollten. So entstand eine „unkündbare Koalition“, die die Aktionschancen der bürgerlichen Parteien entscheidend einschränkte.[73]Durch die beschlossene Geschäftsordnung konnten von vornherein Mehrheiten ohne oder gar gegen die KPD nicht zustande kommen, wodurch „für die Zukunft (...) die Möglichkeit der Oppositionsbildung ausgeschlossen (war).“[74]Dem ZK der KPD war damit innerhalb kürzester Zeit gelungen, sein Ziel zu verwirklichen - nämlich „die Schwächung der Sozialdemokratie durch eine Einheitsfront und die Gewinnung von Teilen des Bürgertums und der Mittelschichten.“[75]
II. 4. Die Vereinigungskampagne
Für viele Sozialdemokraten schmälerte die erfolgreiche Mitgliederwerbung und die organisatorische Konsolidierung der Partei im Herbst 1945 die Attraktivität eines Zusammenschlusses mit der KPD. Hinzu kam die Verschärfung lokaler Konflikte zwischen beiden Parteien, z.B. in der Frage der Bodenreform, bei der sich die KPD mit Hilfe der Besatzungsmacht gegen sozialdemokratische Vorstellungen durchsetzte. Vielerorts wurde das Verhältnis zwischen beiden Parteien selbst von Sozialdemokraten, die bislang für eine enge Kooperation mit der KPD eingetreten waren, als unhaltbar eingeschätzt.[76]Denn wechselseitiges „Mißtrauen und Gegnerschaft entsprachen eher der Realität als die offiziell verkündete Partnerschaft zwischen SPD und KPD.“[77]Trotzdem „glaubten im September/Oktober 1945 viele Sozialdemokraten nach wie vor an den Sinn einer Einheitspartei, auch jene, die (...) zum Ende des Jahres zu den hartnäckigsten Kritikern der Einheitspartei zählen sollten.“[78]Die schnelle Entwicklung der SPD zur mitgliederstärksten Partei in der SBZ und der daraus abgeleitete Sympathievorsprung in der Bevölkerung ließ das Selbstbewußtsein der Sozialdemokraten wachsen. Dies führte zu einem „Drang nach Profilierung und Verselbstständigung“ sowie zu Bestrebungen in der SPD, „sich öffentlich sichtbarer von der KPD abzugrenzen und zu distanzieren.“[79]Otto Grotewohl verlieh dieser veränderten Haltung innerhalb der SPD am 14. September 1945 Ausdruck, als er vor Parteifunktionären eine Rede hielt, in der er ein Resümee der bisherigen Zusammenarbeit mit der KPD zog. Er sprach die Zweifel vieler Sozialdemokraten am kommunistischen Bekenntnis zur Demokratie an und beklagte, daß „in den kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften oft unter völliger Außerachtlassung der Grundsätze demokratischer Parität der Versuch gemacht wird, sich gegenseitig den Rang abzulaufen.“ Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit war es nach Grotewohl notwendig, daß die Kommunisten sich daran gewöhnen, „in ihren sozialdemokratischen Kameraden nicht mehr den Verräter zu sehen.“ Als unbedingte Voraussetzung einer Vereinigung beider Parteien mahnte er die „wirkliche beiderseitige Abstimmung auf eine echte Kameradschaft“ an. Diese Voraussetzung sah er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht als erfüllt an.[80]Grotewohl rückte zwar nicht vom Ideal der Einheitspartei ab, „aber es blieb eine pathetische Beschwörungsformel, dessen Realisierung in die Ferne gerückt wurde“, denn im Vordergrund stand für ihn die Schaffung einer einheitlichen Sozialdemokratischen Partei für ganz Deutschland.[81]Zugleich formulierte er einen Führungsanspruch für die Sozialdemokratie in Deutschland, da weder die bürgerlichen Parteien von den Sowjets noch die KPD von den Westmächten als berufene Vertreter der Deutschen anerkannt werden würden. Dementsprechend käme der SPD die Aufgabe zu, „für die politische Willensbildung als Sammellinse zu wirken, in der sich die Ausstrahlungen der übrigen Parteien (...) treffen.“[82]Beim Neuaufbau der Demokratie käme der SPD eine Führungsaufgabe zu, denn wenn „ein neuer Staat (...) aufzubauen ist, so ist die deutsche Arbeiterklasse und in ihr die Sozialdemokratische Partei Deutschlands dazu berufen, diesen neuen Staat zu errichten.“[83]Von der KPD wurde Grotewohls Rede als offene Kampfansage gedeutet und veranlaßte die Parteiführung zu einem radikalen Kurswechsel. Wenige Tage später, am 19. September reagierte Wilhelm Pieck mit dem Aufruf, eine einheitliche Arbeiterpartei zu schaffen, wobei er an die SPD-Mitglieder appellierte, jenen Parteiführern nicht zu folgen, die eine einheitsfeindliche Politik betreiben.[84]
Zugleich begann die KPD mit einer Kampagne zur Werbung neuer Mitglieder, um ihren Mitgliederrückstand gegenüber der SPD auszugleichen und so aus einer Position der Stärke heraus die Fusion mit der SPD anzusteuern. Vor diesem Hintergrund kam es vom 5. bis 7. Oktober 1945 in Wenningsen bei Hannover zur ersten Begegnung zwischen Otto Grotewohl und Kurt Schumacher, der Führungsfigur der SPD in den Westzonen. Schumacher war ein entschiedener Gegner aller Einheitsbestrebungen mit der KPD. Bereits am 6. Mai 1945 hatte er während einer Rede vor dem wiedergegründeten SPD-Ortsverein in Hannover gesagt, daß zwischen SPD und KPD schon deshalb eine klare Trennungslinie gezogen sei, weil „die Kommunisten fest an eine einzige der großen Siegermächte und damit an Rußland als Staat und an seine außenpolitischen Ziele gebunden (seien).“ Demgegenüber lehne es die SPD ab, „das autokratisch gehandhabte Instrument eines fremden imperialen Interesses (zu) sein.“[85]Außerdem war es für Schumacher undenkbar, „für den geschwächten Parteikörper der KP den Blutspender abzugeben und auf irgendeinen Annäherungsversuch auch nur andeutungsweise einzugehen.“[86]Praktische Zusammenarbeit bei der Lösung sozialer Fragen sowie bei der Überwindung des Faschismus unter der Voraussetzung völliger ideologischer und organisatorischer Selbständigkeit beider Parteien bejahte er allerdings.[87]Seine Überzeugungen mußte Schumacher nach Kriegsende gegen auch im Westen vorhandene Einheitsbestrebungen durchsetzen. Er etablierte in Hannover eine SPD-Parteizentrale („Büro Dr. Schumacher“) und es gelang ihm bis Ende August 1945, seinen Führungsanspruch in den Westzonen durchzusetzen.[88]Auf der Konferenz von Wenningsen trafen erstmals SPD-Vertreter aus den Westzonen, der SBZ und Abgesandte des Londoner Exil-Parteivorstands zusammen. Bestimmendes Thema des Treffens war die Frage der Parteieinheit. Grotewohl verfolgte das Ziel, den ZA durch Hinzuziehung von Vertretern der Westzonen und des alten Parteivorstandes zur provisorischen gesamtdeutschen Leitungsinstanz der SPD umzugestalten, denn die Einheit der Partei galt ihm als Klammer für die Einheit des Reiches. Dem widersprach Schumacher mit dem Argument, daß es keine gesamtdeutsche SPD mit zentraler Leitung geben könne, solange Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt sei. Damit trat er dem Führungsanspruch des ZA entgegen, um dessen Einflußnahme auf die Westzonen zu verhindern.[89]Als Ergebnis der Unterredungen wurde ein Kompromiß vereinbart, der den status quo fixierte. Bis zur Verwirklichung der Reichseinheit und damit der organisatorischen Einheit der Partei sollte der ZA als Parteiführung in der SBZ und Schumacher als politischer Beauftragter der SPD in den Westzonen fungieren.[90]Die Konsequenz dieser Vereinbarung war „eine faktische Ost-West-Teilung der SPD“[91], die sich verhängnisvoll auf die Position des ZA in der SBZ auswirkte. Denn durch die Isolierung von der West-SPD verlor der ZA den „politisch-moralischen Rückhalt bei den Funktionären, die bereit waren, dem Schumacherschen Parteikurs zu folgen.“ Zudem wurde die Manövrierfähigkeit des ZA gegenüber der KPD eingeschränkt, weil die Zurückhaltung gegenüber dem Einheitswerben der Kommunisten nicht mehr mit dem Verweis auf den Vorrang einer Parteifusion in gesamtdeutschen Maßstab plausibel gemacht werden konnte.[92]Trotzdem betonte Grotewohl bei seiner Rede zum Jahrestag der Novemberrevolution von 1918 am 11. November 1945, daß über eine Vereinigung von SPD und KPD nur ein Reichsparteitag der SPD entscheiden könne und erteilte der zonenmäßigen Fusion eine Absage. Die Vereinigung könne, so Grotewohl, nicht das Werk zentraler Instanzen, sondern müsse „der eindeutige und überzeugende Wille aller deutschen Klassengenossen sein.“ Außerdem dürfe die Einheit nicht „das Ergebnis eines äußeren Drucks oder indirekten Zwanges sein, (sondern müsse) aus dem Bewußtsein völliger freier Selbstbestimmung (...) zustande kommen.“ Weiterhin knüpfte Grotewohl die Einheitspartei an die Bedingung eines „sozialistischen und demokratischen Aufbaus“, womit er sich gegen die Ablehnung von KPD und SMAD gegenüber dem Sozialismus als Gegenwartsaufgabe wandte. Auch übte er Kritik an der Demontagepolitik der Sowjets.[93]Sowohl von der KPD als auch von der SMAD wurden Grotewohls Äußerungen „als Affront und als Gefährdung ihrer wesentlichen politischen Zielsetzungen interpretiert.“ Diese Rede markierte einen Wendepunkt, denn die KPD intensivierte nun ihre Einheitsagitation, machte die Frage der Vereinigung zur „Schicksalsfrage des antifaschistisch-demokratischen Aufbaus“ und wurde dabei jetzt auch von den Sowjets, die sich zuvor noch weitgehend zurückgehalten hatten, massiv unterstützt.[94]Ziel der kommunistischen Einheitskampagne war es, „die SPD (...) zu spalten, Parteigliederungen für sich zu gewinnen oder sich gefügig zu machen und einzelne Funktionäre, insbesondere die Landesvorsitzenden an sich zu binden.“ Die Sozialdemokraten in der SBZ standen diesen zentral gesteuerten Initiativen zumeist hilflos gegenüber.[95]Die SPD-Ortsvereine, die von den Kommunisten bedrängt wurden, gemeinsame Mitglieder- und Funktionärsversammlungen abzuhalten, reagierten häufig mit einer Verzögerungstaktik. Sie beriefen sich auf fehlende zentrale Beschlüsse, aber ein „grundsätzliches Nein schien den meisten Sozialdemokraten auf Grund ihrer emotionalen Bereitschaft, den Weg in die Einheitspartei zu gehen, sowie angesichts der spezifischen Besatzungssituation nicht möglich.“ Zugleich setzten viele Sozialdemokraten ihre Hoffnung auf einen Reichsparteitag, um eine gesamtdeutsche Lösung der Frage zu erreichen und Unterstützung durch die westdeutsche Sozialdemokratie zu erhalten.[96]
Die KPD setzte ein vielschichtiges Arsenal von Mitteln ein, um die SPD in der SBZ zur Vereinigung zu bewegen. Mit einer gezielten Propagandakampagne sollte Einfluß auf die Handlungsfreiheit und die innere Autonomie der SPD genommen werden. Ortskommandanten der Besatzungsmacht setzten SPD-Funktionäre unter Druck, einer Fusion notfalls auch gegen den Willen des ZA zuzustimmen. Zudem regierten SMAD und KPD in die Personalhoheit der SPD hinein, um Einheitsgegner aus ihren Positionen zu drängen. Gegner wurden diffamiert, bedroht, verhaftet oder mit Versprechungen gelockt und konnten aufgrund der sowjetischen Zensurmaßnahmen ihre Meinung nicht öffentlich artikulieren, während Einheitsbefürworter in der SPD gefördert wurden.[97]Seit Anfang Dezember 1945 wurde seitens der KPD versucht, die zentralen Instanzen der SPD von der untersten Ebene her unter Druck zu setzen, indem Orts- und vor allem Betriebsgruppen bearbeitet wurden, um Resolutionen für einen baldigen Zusammenschluß zu verabschieden.[98]Im Dezember 1945 gab der ZA dem wochenlangen Drängen der KPD nach, eine gemeinsame Funktionärskonferenz beider Parteien zur Einheitsfrage durchzuführen. Am 20./21. Dezember 1945 kamen je dreißig Funktionäre von SPD und KPD (‘Sechziger-Konferenz’) in Berlin zusammen. Es handelte sich dabei um Vertreter der Landes- und Bezirksverbände beider Parteien sowie der Parteileitungen. Grotewohl ging in seinem Eröffnungsreferat, das mit einem Bekenntnis zur Einheit begann, auf die Mißstimmungen im Verhältnis beider Parteien ein und erteilte dem Vorschlag der KPD eine Absage, die Vereinigung nur in der SBZ durchzuführen sowie mit der Fusion so schnell wie möglich schon auf Orts-, Bezirks- und Länderebene zu beginnen.[99]Nachdem einige Passagen gestrichen worden waren, denen die SPD-Funktionäre nicht zustimmen wollten, wurde auf dieser Konferenz eine Entschließung angenommen, die im wesentlichen dem KPD-Entwurf folgte. Die konträren Standpunkte insbesondere über den Weg der Vereinigung kamen darin jedoch nicht zum Ausdruck, was den Eindruck entstehen ließ, die Parteiführungen befänden sich in vollem Einvernehmen.[100]In der Entschließung hieß es, daß eine Erweiterung und Vertiefung der Aktionseinheit „den Auftakt zur Verwirklichung der politischen und organisatorischen Einheit der Arbeiterbewegung, d.h. zur Verschmelzung der (SPD) und der (KPD) zu einer einheitlichen Partei bilden (sollte).“[101]Weder ein konkreter Zeitpunkt noch eine definitive Entscheidung über den Weg der Vereinigung - Reichsparteitag oder separate Fusion in der SBZ - waren damit vorgegeben, aber an der SPD-Parteibasis herrschte einige Verwirrung, auch wenn der ZA mit einem Rundschreiben seine Position konkretisierte und untere Parteigliederungen davor warnte, eigenmächtig die Fusion mit der KPD zu betreiben. Gleichzeitig organisierte die KPD vor allem in den Betrieben Stellungnahmen, die die Entschließung der ‘Sechziger-Konferenz’ begrüßten und sie startete eine Versammlungskampagne, um SPD-Mitglieder einzubinden.[102]Die Reaktion der sozialdemokratischen Parteibasis auf die Beschlüsse der „Sechziger Konferenz“ war „teils zustimmend, teils ablehnend, überwiegend unsicher.“ In der SBZ wurde vielerorts von Sozialdemokraten eine Urabstimmung gefordert, um jedes einzelne Mitglied über die Vereinigung mit der KPD entscheiden zu lassen.[103]
[...]
[1]Merseburger, Peter: Einleitung, in: Friedrich-Ebert-Stiftung/Bernstein-Kautsky-Kreis e.V. (Hg.): Der alte Streit: Freiwilliger Zusammenschluss oder Zwangsvereinigung? Die Vereinigung von SPD und KPD zur SED vor 50 Jahren, Berlin 1996, S. 11 f.
[2]Vgl. Zum 50. Jahrestag des Zusammenschlusses von KPD und SPD. Erklärung der Historischen Kommission der PDS, in: Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, Nr. 1/1996, S. 44 - 58.
[3]Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Diplomarbeit der Begriff ‘Zwangsvereinigung’ stets in Anführungszeichen gesetzt.
[4]Leonhard, Wolfgang: Sechs Thesen zur Vereinigung von SPD und KPD, in: F.-Ebert-Stiftung: Der alte Streit, a.a.O., S. 30.
[5]Hurwitz, Harold: Diskussionsbeitrag, in: ebd., S. 32.
[6]Reichel, Peter: Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit, München 1995, S. 26.
[7]Steinbach, Peter: Zur Geschichtspolitik. (Kommentar), in: Kocka, Jürgen/Sabrow, Martin (Hg.): Die DDR als Geschichte: Fragen - Hypothesen - Perspektiven, Berlin 1994, S. 159.
[8]Wolfrum, Edgar: „Kein Sedanstag glorreicher Erinnerung“. Der Tag der Deutschen Einheit in der alten Bundesrepublik, in: Deutschlandarchiv Nr. 3/1996, S. 432 f.
[9]Steinbach, P.: Geschichtspolitik, a.a.O., S. 161.
[10]Stürmer, Michael: Geschichte in geschichtslosem Land, in: „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München - Zürich4 1987, S. 36.
[11]Wolfrum, E.: Kein Sedanstag, a.a.O., S. 433.
[12]Steinbach, Peter: Vergangenheitsbewältigung in vergleichender Perspektive. Politische Säuberung, Wiedergutmachung, Integration, hrsg. von der Historischen Kommission zu Berlin, Informationen, Beiheft 18 1994, S. 7.
[13]Wolfrum, E.: Kein Sedanstag, a.a.O., S. 433 f.
[14]Vgl. Schulz, Klaus-Peter: Auftakt zum Kalten Krieg. Der Freiheitskampf der SPD in Berlin 1945/46, Berlin 1965; Dahrendorf, Gustav: Die Zwangsvereinigung der Kommunistischen und der Sozialdemokratischen Partei in der russischen Zone (1946), in: ders.: Der Mensch das Mass aller Dinge. Reden und Schriften zur deutschen Politik 1945 - 1954, Hamburg 1955, S. 89 - 124; Gniffke, Erich: Jahre mit Ulbricht, Köln 1966; Germer, Karl J.: Von Grotewohl bis Brandt. Ein dokumentarischer Bericht über die SPD in den ersten Nachkriegsjahren, Landshut 1974; Leonhard, Wolfgang: Die Revolution entläßt ihre Kinder, Köln - Berlin2 1990. Bei meiner Darstellung des Forschungsstandes stütze ich mich im wesentlichen auf die Ausführungen von Andreas Malycha: Einleitung, in: Ders.: Auf dem Weg zur SED. Die Sozialdemokratie und die Bildung einer Einheitspartei in den Ländern der SBZ. Eine Quellenedition, Bonn 1995, S. XI-XXI.
[15]Vgl. Stern, Carola: Porträt einer bolschewistischen Partei. Entwicklung, Funktion und Situation der SED, Köln 1957.
[16]Vgl. Kaden, Albrecht: Einheit oder Freiheit. Die Wiedergründung der SPD 1945/46, Berlin - Bonn 1980.
[17]Vgl. Moraw, Frank: Die Parole der „Einheit“ und die Sozialdemokratie. Zur parteiorganisatorischen und gesellschaftspolitischen Orientierung der SPD in der Periode der Illegalität und in der ersten Phase der Nachkriegszeit (1933-1948), Bonn2 1990.
[18]Vgl. Staritz, Dietrich: Sozialismus in einem halben Lande. Zur Programmatik und Politik der KPD/SED in der Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in der DDR, Berlin 1976.
[19]Vgl. Bouvier, Beatrix: Antifaschistische Zusammenarbeit, Selbständigkeitsanspruch und Vereinigungstendenz. Die Rolle der Sozialdemokratie beim administrativen und parteipolitischen Aufbau in der sowjetischen Besatzungszone 1945 auf regionaler und lokaler Ebene, in: Archiv für Sozialgeschichte, Bd. XVI, 1976, S. 417 - 468.
[20]Vgl. Bouvier, Beatrix/Schulz, Horst-Peter (Hg.): „...die SPD aber aufgehört hat zu existieren.“ Sozialdemokraten unter sowjetischer Besatzung, Bonn 1991.
[21]Vgl. Müller, Werner: Die KPD und die „Einheit der Arbeiterklasse“, Frankfurt a. M. - New York 1979.
[22]Vgl. Staffelt, Dietmar: Der Wiederaufbau der Berliner Sozialdemokratie 1945/46 und die Einheitsfrage. Ein Beitrag zur Nachkriegsgeschichte der unteren und mittleren Organisationsgliederungen der SPD, Frankfurt a. M. - Bern - New York 1986.
[23]Vgl. Hurwitz, Harold: Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945, Bd. 1 - 4.2, Berlin 1983 - 1990.
[24]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. XI f.
[25]Vgl. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in acht Bänden. Bd. 6.: Von Mai 1945 bis 1949, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin (Ost) 1966; Geschichte der SED. Abriß, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Berlin (Ost) 1978; Badstübner, Rolf u.a. (Hg.): Die antifaschistisch-demokratische Umwälzung, der Kampf gegen die Spaltung Deutschlands und die Entstehung der DDR von 1945 bis 1949 (= Deutsche Geschichte in zwölf Bänden, Bd. 9), Berlin (Ost) 1989.
[26]Vgl. Thomas, Siegfried: Entscheidung in Berlin. Zur Entstehungsgeschichte der SED in der deutschen Hauptstadt 1945/46, Berlin (Ost) 1964; Voßke, Heinz: Die Vereinigung der KPD und der SPD zur SED in Mecklenburg-Vorpommern. Mai 1945 bis April 1946, Rostock 1966; Bensing, Manfred: Im revolutionären Kampf geschmiedet. Über das Ringen um Aktionseinheit der Arbeiterklasse und die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in Leipzig 1945/46, Leipzig 1978.
[27]Vgl. Benser, Günter: Die KPD im Jahre der Befreiung. Vorbereitung und Aufbau der legalen kommunistischen Massenpartei (Jahreswende 1944/45 bis Herbst 1945), Berlin (Ost) 1985.
[28]Vgl. Erler, Peter/Laude, Horst/Wilke, Manfred (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“. Dokumente zur Programmatik der Moskauer KPD-Führung 1944/45 für Nachkriegsdeutschland, Berlin 1994; Keiderling, Gerhard (Hg.): „Gruppe Ulbricht“ in Berlin. April bis Juni 1945. Von der Vorbereitung im Sommer 1944 bis zur Wiedergründung der KPD im Juni 1945. Eine Dokumentation, Berlin 1993; Heimann, Siegfried: Die Sonderentwicklung der SPD in Ost-Berlin 1945-1961, in: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995, Bd. II,4, S. 1649 - 1688.
[29]Vgl. Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., passim.
[30]Vgl. Malycha, Andreas: Partei von Stalins Gnaden? Die Entwicklung der SED zur Partei neuen Typs in den Jahren 1946 bis 1950, Berlin 1996.
[31]Vgl. Bouvier, Beatrix: Ausgeschaltet! Sozialdemokraten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR 1945 - 1953, Bonn 1996.
[32]Kleßmann, Christoph: Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945 - 1955, Bonn2 1991, S. 121.
[33]Vgl. Erler, P./Laude, H./Wilke, M. (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“, a.a.O., S. 89 ff.
[34]Benz, Wolfgang: Potsdam 1945. Besatzungsherrschaft und Neuaufbau im Vier-Zonen-Deutschland, München3 1994, S. 140. In den Westzonen wurde die Erlaubnis zur Gründung von Parteien erst im August/September 1945 erteilt und war zudem auf die Kreisebene beschränkt sowie mit vielen bürokratischen Hindernissen verbunden In der französischen Besatzungszone wurden Parteien sogar erst ab Dezember 1945 zugelassen. Ebd.
[35]Stern, C.: Porträt einer bolschewistischen Partei, a.a.O., S. 13 f. Dokumentarisch belegbare Erklärungen für den sowjetischen Sinneswandel gibt es bisher nicht, aber aus einem Telegramm der Politischen Hauptverwaltung der 1. Belorussischen Front an die Moskauer Zentrale geht hervor, daß zu diesem Zeitpunkt die alten Parteien der Weimarer Republik wieder in Erscheinung traten und den Sowjets daran gelegen war eine bestimmte Form zu schaffen, um die Aktivitäten der Deutschen in ihrem Sinne zu kanalisieren. Erler, P./Laude, H./Wilke, M. (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“, a.a.O., S. 120 f.
[36]Müller, Werner: Die Gründung der SED. Zwangsvereinigung, Demokratieprinzip und gesamtdeutscher Anspruch, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 16-17/1996, S. 13. Zur programmatischen Vorarbeit der KPD-Führung im Moskauer Exil vgl. Erler, P./Laude, H./Wilke, M. (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“. a.a.O., passim.
[37]Schlegelmilch, Arthur: Hauptstadt im Zonendeutschland. Die Entstehung der Berliner Nachkriegsdemokratie 1945 - 1949, Berlin 1993, S. 146 f.
[38]Hurwitz, Harold: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1: Führungsanspruch und Isolation der Sozialdemokraten, Köln 1990 (= Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945, Bd. 4,1), S. 122 f.
[39]Aufruf des ZK der KPD vom 11. Juni 1945, in: Erler, P./Laude, H./Wilke, M. (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“, a.a.O., S. 394 ff. Die ökonomischen Forderungen des Aufrufs richteten sich auf die „Enteignung des gesamten Vermögens der Nazibonzen und Kriegsverbrecher“, die Liquidierung des Großgrundbesitzes der „Junker, Grafen und Fürsten“ zur Verteilung des Ackerbodens an landlose Bauern, sowie die Verstaatlichung „jener Betriebe, die lebenswichtigen Bedürfnissen“ dienten (Verkehrsbetriebe, Wasser-, Gas- und Elektrizitätswerke usw.). Zugleich wurde für die „ungehinderte Entfaltung des freien Handels und der privaten Unternehmerinitiative auf der Grundlage des Privateigentums“ plädiert und der Grundbesitz von Großbauern garantiert. Ebd., S. 396. Zum Zustandekommen des Aufrufs vgl. ebd., S. 120 ff.
[40]Ebd., S. 394.
[41]Ebd., S.396.
[42]Schlegelmilch, A.: Hauptstadt im Zonendeutschland, a.a.O., S. 149.
[43]Staritz, D.: Sozialismus in einem halben Lande, a.a.O., S. 28.
[44]Schlegelmilch, A: Hauptstadt im Zonendeutschland, a.a.O., S. 146.
[45]Müller, Werner: Entstehung und Transformation des Parteiensystems der SBZ/DDR 1945-1950, in: Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundestag, Baden-Baden 1995, Bd. II,4, S. 2332.
[46]Diese Konzeption ging davon aus, daß die Diktatur des Proletariats bzw. der kommunistischen Parteien nicht kurzfristig, sondern nur nach einer langen Übergangsphase zu erreichen sei. In der Übergangsphase müsse die KPD in einem Bündnis mit Sozialdemokraten, aber auch mit konservativen Kräften auf demokratischer Basis zusammenwirken, um „die in den ‘Bündnis’-Organisationen erfaßten ‘Massen’ anzusprechen, sie für die Politik der KPD zu gewinnen und somit die Außenseiter-Stellung der KPD im Parteienspektrum zu überwinden. Müller, W.: Entstehung und Transformation, a.a.O., S. 2329.
[47]Ebd., S. 2331.
[48]Müller, W.: Entstehung und Transformation, a.a.O., S. 2335. Vgl. zur parteiinternen Opposition gegen den Gründungsaufruf der KPD und die Blockpolitik Stößel, Frank Thomas: Positionen und Strömungen in der KPD/SED 1945-1954, Köln 1985, S. 73 ff.
[49]Stößel, F.: Positionen und Strömungen, a.a.O., S. 50. Vgl. „Anweisungen für die Anfangmaßnahmen zum Aufbau der Parteiorganisation“ - Maschinenschriftlicher Entwurf Walter Ulbrichts vom 15. Februar 1945, in: Erler, P./Laude, H./Wilke, M. (Hg.): „Nach Hitler kommen wir“, a.a.O., S. 327 f.
[50]Müller, W.: Entstehung und Transformation, a.a.O., S. 2334. Aus dem starken hauptamtlichen Funktionärsapparat der KPD ergab sich ein „Organisationsmißverhältnis“ zwischen SPD und KPD, weil bei der SPD das „ehrenamtliche tätige Element im Funktionärskörper“ überwog. Bei der KPD war im Gegensatz zur SPD selbst im kleinsten Ort der Parteiapparat großzügiger aufgebaut, wodurch die Kommunisten größere Aktivität und Mobilität entfalten konnten, während SPD-Ortsvereine häufig mit der Verarbeitung von KPD-Vorschlägen überfordert waren. Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXI.
[51]Müller, W.: Entstehung und Transformation, a.a.O., S. 2334 f.
[52]Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 16.
[53]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. XXVI ff. Einzelne später führende Sozialdemokraten wie z.B. Max Fechner hatten bereits Anfang Mai 1945 vergeblich versucht, über die Schaffung einer Einheitspartei mit der KPD ins Gespräch zu kommen. Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 85.
[54]Grebing, Helga/Kleßmann, Christoph/Schönhoven, Klaus: Zur Situation der Sozialdemokratie in der SBZ/DDR im Zeitraum zwischen 1945 und dem Beginn der 50er Jahre. Gutachten für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Marburg 1992, S. 49. Ein Beispiel hierfür ist die Entwicklung in Thüringen. Dort bildeten Sozialdemokraten um Hermann Brill den „Bund demokratischer Sozialisten“, der sich am Buchenwalder Manifest vom April 1945 orientierte. Darin wurde die Verwirklichung des Sozialismus als unmittelbare Gegenwartsaufgabe bezeichnet und die Einheit der sozialistischen Bewegung gefordert. Moraw, F.: Die Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 65 ff. Brills Einheitskonzept lehnte sich am Modell der britischen Labour Party an. Konkrete Angebote, eine gemeinsame Arbeiterpartei zu bilden, wurden von der KPD jedoch abgelehnt, u.a. wegen ideologischer Differenzen. Wichtiger für diese Ablehnung war allerdings die Befürchtung in einer Einheitspartei von den Sozialdemokraten majorisiert zu werden. Denn für die KPD „waren die strukturellen und kaderpolitischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen, um in einer Einheitspartei die ‘politische Linie’ zu bestimmen. Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LVI.
[55]Bouvier, B.: Ausgeschaltet, a.a.O., S. 36 f.
[56]Ebd., S. 37. Vgl. hierzu auch Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 85 ff.
[57]Aufruf des Zentralausschusses der SPD vom 15. Juni 1945 zum Aufbau eines antifaschistisch- demokratischen Deutschlands, in: Dokumente und Materialien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Reihe III, Bd. 1: 1945-1946, hrsg. vom Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED, Berlin (Ost) 1959, S. 28 ff.
[58]Ebd., S. 29 ff. Günter Benser zufolge spricht der Umstand, daß die SPD mit einem eigenen Aufruf auf den KPD-Aufruf reagierte „nicht für eine generelle und intensive Orientierung auf die Einheitspartei im Zentralausschuß.“ Benser, G.: KPD im Jahre der Befreiung, a.a.O., S. 175.
[59]Staritz, Dietrich: Die Gründung der DDR. Von der sowjetischen Besatzungsherrschaft zum sozialistischen Staat, München² 1987, S. 83.
[60]Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 89. Zu Grotewohls Rede am 17. Juni 1945 vgl. auch Triebel, Wolfgang: Otto Grotewohls Weg in die Einheitspartei. Hintergründe und Zusammenhänge. Eine Betrachtung seines politischen Denkens und Handelns zwischen Mai 1945 und April 1946, Berlin 1993 (hefte zur ddr-geschichte Nr. 13), S. 10 ff.
[61]Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 153. Der Anspruch des ZA auf die Leitung der Partei dokumentierte sich auch darin, daß wenig später die Berliner Parteiorganisation verselbstständigt wurde und „der ZA mit Billigung der sowjetischen Administration seinen Anspruch (anmeldete,) über Berlin hinaus (als Führung der gesamten SPD in der SBZ) zu wirken.“ Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 89. Werner Müller dagegen behauptet, daß der ZA von der sowjetischen Besatzungsmacht „in die Rolle der Parteiführung für die sowjetische Zone gedrängt wurde.“ Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 15. Dieser Sichtweise widerspricht allerdings die Tatsache, daß die ZA-Mitglieder im Sommer 1945 von der SMAD daran gehindert wurden, diese Rolle wahrzunehmen und die SBZ zu bereisen. Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 299.
[62]Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 94. Vgl. hierzu die Vereinbarung des Zentralausschusses der SPD und des Zentralkomitees der KPD vom 19. Juni 1945, in: Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Bd. 6., a.a.O., S. 352 f. Hurwitz zufolge waren die ZA-Mitglieder im Vorfeld des Treffens vom 19. Juni durchaus nicht einhellig der Meinung, bei den Verhandlungen mit dem ZK auf eine sofortige Vereinigung zu drängen. Vor allem Dahrendorfs Einfluß erzwang eine diesbezügliche Stellungnahme im ZA, während Grotewohl nicht eindeutig Stellung bezog. Ideologische Differenzen waren bei der Zusammenkunft vom 19. Juni 1945 hinsichtlich der Frage aufgetaucht, ob der Sozialismus auf der Tagesordnung stehe. Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 154 f.
[63]Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 94.
[64]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. XXIX f. In Leipzig stützte sich die Reorganisation der SPD auf ihren alten traditionsbewußten Funktionärsstamm, der keine Veranlassung sah ein neues Verhältnis zur KPD zu finden. Die traditionelle Feindschaft zwischen SPD und KPD blieb hier auch nach 1945 erhalten und führte bis April 1946 zu beständigen parteipolitischen Spannungen. Außerdem versuchte man in Leipzig Autonomie zum sächsichen SPD-Landesvorstand zu wahren und bezweifelte die Führungskompetenz des ZA in Berlin. Das führte dazu, daß die Organisationstätigkeit von den Sowjets stark behindert und die Partei erst Mitte August 1945 offiziell zugelassen wurde, denn die „Kommandantur akzeptierte (...) nur eine zentralistisch aufgebaute Organisation“ mit dem ZA an der Spitze. Die Sowjets vermuteten im Leipziger Bezirksvorstand der SPD eine Bastion der ‘rechten’ Sozialdemokraten, weshalb das Verhältnis der SPD zur örtlichen Kommandantur in Leipzig bis zum April 1946 „äußerst gespannt“ blieb. Ebd., S. XLV ff.
[65]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. XXXII ff.
[66]Malycha, Andreas: Sozialdemokraten und die Gründung der SED. Gleichschaltung und Handlungsspielräume, in: Deutschland Archiv, Nr. 2/1996, S. 200. So bemühten sich Landesfunktionäre wie z.B. Bruno Böttge und Ernst Thape in Sachsen-Anhalt von Anfang an, „unter Zurückstellung persönlicher Vorbehalte eine Art Vertrauensbasis zur Besatzungsmacht zu finden“, um das Mißtrauen der Sowjets gegenüber Sozialdemokraten abzubauen. Einige Sozialdemokraten wie Otto Buchwitz oder Heinrich Hoffmann pflegten sogar ein freundschaftliches Verhältnis zum Ortskommandanten. „Oft handelte es sich aber um Sozialdemokraten, die sich bereits vor der Vereinigung in einigen wesentlichen Fragen die geistig-politische Argumentation der Kommunisten angeeignet hatten.“ Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXII f.
[67]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LVI ff.
[68]Ebd., S. LXII f.
[69]Laut Haritonow ging die SMAD aufgrund ihrer antisozialdemokratischen Ressentiments davon aus, die SPD werde keinen größeren Einfluß auf die Bevölkerung gewinnen und könne deshalb auch kein Partner der KPD sein. Die politische Passivität der Bevölkerung habe bei SMAD und KPD-Führung den Eindruck erweckt, ihren Einfluß festigen zu können, weshalb eine Einheitspartei als nicht notwendig erschien. Haritonow, Alexandr: Freiwilliger Zwang. Die SMAD und die Verschmelzung von KPD und SPD in Berlin, in: Deutschland Archiv, Nr. 3/1996, S. 408. Werner Müller ist der Ansicht, die KPD habe die sozialdemokratischen Vereinigungsbestrebungen „aus der Position mutmaßlicher Überlegenheit zurückgewiesen (...), zumal die Sozialdemokratie inhomogen, desorientiert und führungsschwach erschien.“ Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 16. Demgegenüber findet Dietrich Staritz die Verweigerungshaltung der KPD angesichts der langen Feindschaft zwischen beiden Parteien durchaus plausibel. Entscheidender für die Haltung der KPD-Führung erscheint ihm jedoch die „ideologische Vielfalt in den eigenen Reihen“ sowie die Unsicherheit darüber, „mit welcher Spielart sozialdemokratischer Politik die Kommunisten in der SBZ konfrontiert waren, ob mit (der SPD) eine Einheitspartei überhaupt erstrebenswert war.“ Staritz, D.: Gründung der DDR, a.a.O., S. 84. Ob die Behauptung zutrifft, daß aufgrund des in „breiten Kreisen der Mitgliedschaft beider Parteien (vorhandenen) ehrliche(n) Willen(s) zum gemeinsamen Neubeginn“ im Juni 1945 „die Verschmelzung ohne jeglichen Zwang und ohne den Druck der Besatzungsmacht vollzogen (worden wäre), wenn das ZK der KPD den „zweifellos innerer Überzeugung entspringenden Vorschläge(n) der SPD-Führung“ zugestimmt hätte, kann bezweifelt werden. Stern, C.: Porträt einer bolschewistischen Partei, a.a.O., S. 18. Denn weder repräsentierte der ZA die gesamte SPD der SBZ, noch waren alle Kommunisten vorbehaltlos für eine Vereinigung mit den Sozialdemokraten. Außerdem war die KPD-Führung „nicht an der Einheit schlechthin, sondern nur an einer Verschmelzung interessiert (...), die eine Partei hervorbrachte, in der das traditionelle kommunistische Partei- und Politikverständnis dominierten.“ Staritz, D.: Sozialismus in einem halben Lande, a.a.O., S. 65.
[70]Schlegelmilch, A.: Hauptstadt im Zonendeutschland, a.a.O., S. 173 f.
[71]Ebd., S. 152 f.
[72]Weber, Hermann: DDR: Grundriß der Geschichte 1945-1990, Hannover 1991, S. 25 f.; Vgl. Fröhlich, Jürgen (Hg.): „Bürgerliche Parteien“ in der SBZ/DDR. Zur Geschichte von CDU, LDPD, DBD und NDPD 1945-1953, Köln 1995.
[73]Staritz, D.: Gründung der DDR, a.a.O., S. 95
[74]Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 95.
[75]Staritz, D.: Gründung der DDR, a.a.O., S. 96.
[76]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXIV f.
[77]Bouvier, B.: Ausgeschaltet, a.a.O., S. 50.
[78]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXVI.
[79]Ebd., S. LXVII f.
[80]Grotewohl zit. n. Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O, S. 344.
[81]Bouvier, B.: Ausgeschaltet, a.a.O., S. 50. Werner Müllers Einschätzung, daß Grotewohl „eine klare Absage an die Einheit mit der KPD“ in seiner Rede ausgedrückt habe, ist zu bezweifeln. Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 17. Immerhin hatte Grotewohl explizit erklärt: „Die organisatorische Vereinigung der deutschen Arbeiterbewegung und die Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft sind unser unverrückbares Ziel. Damit dürfte unser Verhältnis zur Bruderpartei (KPD) geklärt sein.“ Zit. n. Krusch, Hans-Joachim/Malycha, Andreas: Einführung, in: Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung? Die Sechziger-Konferenzen von KPD und SPD 1945 und 1946. Mit einer Einführung von Hans-Joachim Krusch u. Andreas Malycha, Berlin 1990, S. 11. Indem die Vereinigung jedoch an Voraussetzungen geknüpft wurde, „ergab sich praktisch die Möglichkeit, eine Vereinigung von KPD und SPD auf unbestimmte Zeit hinauszuschieben.“ Ebd., S. 12.
[82]Zit. n. Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 105.
[83]Zit. n. Triebel, W.: Grotewohls Weg in die Einheitspartei, a.a.O., S. 27.
[84]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXVIII f. Pieck knüpfte damit wieder an die alte Einheitsfrontaktik der KPD aus der Weimarer Zeit an, indem er zwischen Führung und Mitgliedschaft sowie zwischen ‘rechten’ und ‘linken’ Führern der SPD differenzierte, um so die Basis der SPD gegen ihre Führung zu mobilisieren. Die Haltung zur Einheitsfrage wurde so zum Maßstab für die KPD, um ‘rechte’ und ‘linke’ Sozialdemokraten zu unterscheiden und Kritik am Einheitskurs als ‘reaktionär’ auszugrenzen. „Auf dieser Basis war eine sachliche Diskussion des Für und Wider (der Einheitspartei) von vornherein zum Scheitern verurteilt“ und der Handlungsspielraum der SPD stark eingeengt. Ebd.
[85]Zit. n. Albrecht, Willy (Hg.): Kurt Schumacher. Reden - Schriften - Korrespondenzen 1945 - 1952, Berlin-Bonn 1985, S. 229.
[86]Kurt Schumacher: Konsequenzen deutscher Politik, zit. n. Kleßmann, Ch.: Die doppelte Staatsgründung, a.a.O., S. 417.
[87]Kaden, A.: Einheit oder Freiheit, a.a.O., S. 80.
[88]Benz, W.: Potsdam 1945, a.a.O., S. 141 ff. Zu Schumachers politischer Konzeption vgl. Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 69 ff.; Sühl, Klaus: Kurt Schumacher und die Westzonen-SPD im Vereinigungsprozeß, in: Einheitsfront/Einheitspartei. Kommunisten und Sozialdemokraten in Ost- und Westeuropa 1944 - 1948, hrsg. von Dietrich Staritz u. Hermann Weber, Köln 1989, S. 108 ff.
[89]Sühl, K.: Schumacher und die Westzonen-SPD, a.a.O., S. 118. Nicht nur in der Frage der Parteieinheit gab es zwischen Schumacher und dem ZA ein „scharfes Konkurrenzverhältnis“. Hinzu kam der „programmatische Grunddissens zwischen der Schumacherschen These vom ‘Sozialismus als Gegenwartsaufgabe’ und der auf der Linie der ‘antifaschistisch-demokratischen Umwälzung’ liegenden ZA-Politik sowie (..) der Widerspruch (zwischen) Schumachers freiheitlich-pluralistischer Demokratieauffassung und der vom ZA mitvertretenen Blockdemokratie der Sowjetischen Besatzungszone.“ Zudem hatten der ZA und Schumacher unterschiedliche außenpolitische Konzepte. Ausgehend von den besatzungspolitischen Realitäten in der SBZ vertrat der ZA (wenn auch nicht öffentlich) das Konzept einer „Ostorientierung“, während Schumacher „Europäisierungs- und Neutralisierungsvorstellungen“ vertrat. Schlegelmilch, A.: Hauptstadt im Zonendeutschland, a.a.O., S. 178 ff. Zum Konzept der Ostorientierung des ZA vgl. Moraw, F.: Parole der „Einheit“, a.a.O., S. 96 ff.; Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 333 ff.
[90]Kaden, A.: Einheit oder Freiheit, a.a.O., S. 149.
[91]Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 17.
[92]Staritz, D.: Gründung der DDR, a.a.O., S. 115. Die Interpretation der Vereinbarung von Wenningsen sowie ihrer Konsequenzen ist sehr kontrovers. So würdigt A. Kaden sie als Voraussetzung „für eine von den Sowjets und ihren kommunistischen Anhängern in Deutschland freie Entwicklung der SPD“ in den Westzonen, auch wenn damit die Einheit der sozialdemokratischen Organisation aufs Spiel gesetzt wurde. Kaden, A.: Einheit oder Freiheit, a.a.O., S. 153. Demgegenüber vertritt K. Sühl die Ansicht, daß Schumachers Politik, „die SPD in der SBZ und in Berlin allein zu lassen, (...) es der KPD und der SMAD ohne Frage (erleichterte), die Sozialdemokraten in der SBZ unter Druck zu setzen.“ Sühl, K.: Schumacher und die Westzonen-SPD, a.a.O., S. 123.
[93]Zit. n. Hurwitz, H.: Die Anfänge des Widerstands, Teil 1, a.a.O., S. 529 f.
[94]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXII f. Ausschlaggebend für die forcierte Einheitskampagne der KPD waren auch die Ergebnisse der Parlamentswahlen in Ungarn am 11. November, die eine absolute Mehrheit für die Partei der kleinen Landwirte brachte sowie die Niederlage der Kommunisten bei den Parlamentswahlen in Österreich am 25. November (ÖVP: 85 Sitze, SPÖ: 76 Sitze, KPÖ: 4 Sitze). Ebd., S. LXXII.
[95]Bouvier, B.: Ausgeschaltet, a.a.O., S. 52.
[96]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXIV f.
[97]Müller, W.: Gründung der SED, a.a.O., S. 17 f. Vgl. Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXXI ff.
[98]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXX. Zu den SPD-Betriebsgruppen vgl. ebda., S. LXXVII ff.
[99]Stenographische Niederschrift über die gemeinsame Konferenz des Zentralkomitees der KPD und des Zentralausschusses der SPD mit Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin, SPD-Haus, Behrenstraße, in: Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung?, a.a.O., S. 60 ff. Zum Verlauf der Konferenz vgl. Hurwitz, Harold: Die Anfänge des Widerstands, Teil 2: Zwischen Selbsttäuschung und Zivilcourage: Der Fusionskampf, Köln 1990 (= Demokratie und Antikommunismus in Berlin nach 1945, Bd. 4.2), S. 669 ff.
[100]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXXV. Dissens bestand u.a. auch in der Frage gemeinsamer Kandidatenlisten bei zukünftigen Wahlen. Ebd.
[101]Entschließung der gemeinsamen Konferenz des Zentralkomitees der KPD und des Zentralausschusses der SPD mit den Vertretern der Bezirke am 20. und 21. Dezember 1945 in Berlin, in: Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung?, a.a.O., S. 161.
[102]Bouvier, B.: Ausgeschaltet, a.a.O., S. 54 f.; vgl. Entschließung des Zentralausschusses der SPD vom 15. Januar 1946, in: Einheitsdrang oder Zwangsvereinigung?, a.a.O., S. 172. Darin bekräftigte der ZA seine von der KPD abweichenden Standpunkte: „Keine organisatorische Vereinigung beider Arbeiterparteien im Bereich von Bezirken, Provinzen, Ländern oder einer Besatzungszone“ sowie „Herstellung der organisatorischen Einheit kann nur durch den Beschluß eines Reichsparteitages erfolgen.“ Ebd.
[103]Malycha, A.: Weg zur SED, a.a.O., S. LXXXVII f. Malycha teilt die SPD-Mitglieder in drei Lager ein: „Die Sozialdemokraten, die bereit waren, trotz aller Vorbehalte die Verschmelzung mit der KPD als einen Dienst am Sozialismus konsequent und rasch zu verwirklichen sowie diejenigen, die die Vereinigung bedingungslos ablehnten bildeten eine Minderheit. Die große Mehrheit der Mitglieder wie auch die mittleren und unteren Funktionäre lehnten die Entschließung (der ‘Sechziger-Konferenz’) ‘weniger des Inhalts als der Form wegen ab.’“ Ebd., S. LXXXVII.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1997
- ISBN (eBook)
- 9783836623506
- Dateigröße
- 900 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Politische Wissenschaft, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- parteiengeschichte politikgeschichte
- Produktsicherheit
- Diplom.de