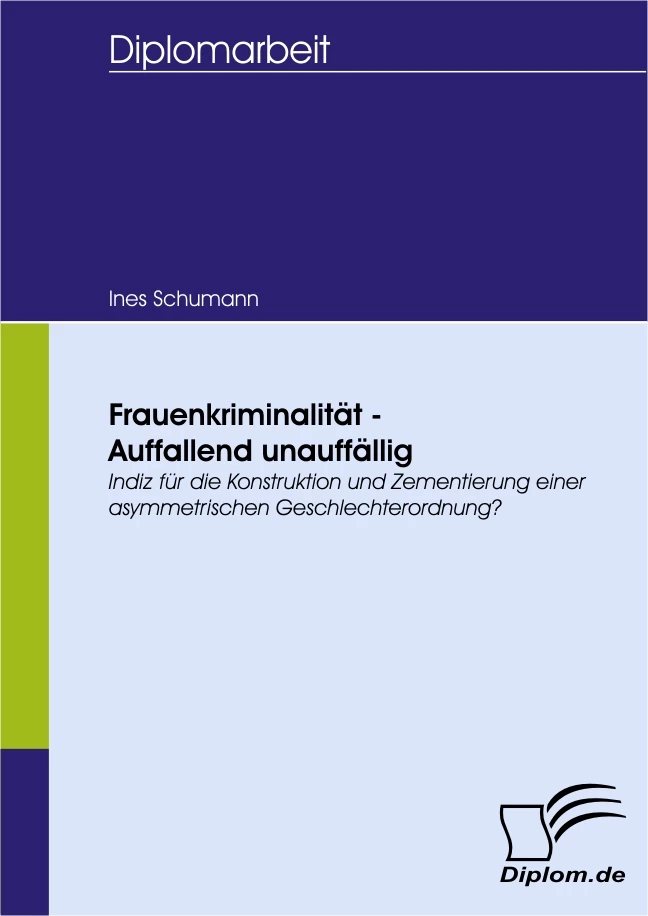Frauenkriminalität - Auffallend unauffällig
Indiz für die Konstruktion und Zementierung einer asymmetrischen Geschlechterordnung?
Zusammenfassung
Abweichendes Verhalten, Kriminalität, Mord und Totschlag sind Themen, ohne die weder die Literatur, die Unterhaltsindustrie noch die gesamte Bandbreite an Printmedien und Tageszeitungen vorstellbar sind.
Auch in der Politik ist seit Anfang der neunziger Jahre das Thema der Inneren Sicherheit insbesondere zum Wahlkampf begleitenden Anliegen geworden als neues Staatsziel wurde aus der Verfassung ein Grundrecht auf Sicherheit abgeleitet.
Bedrohungsszenarien öffentlicher und moralischer Ordnung durch Kriminalität haben je nach politischer und sozialer Wetterlage unterschiedliche Inhalte: mal geht es um gefährdete, mal um gefährliche Jugend oder ein allgemeiner Werteverfall wird beklagt, Präventionsarbeit am besten schon im Kindergarten gefordert kurzum, welche Werte und Normen für unsere Gesellschaft maßgeblich sind, erfahren wir in erster Linie über den Bruch mit ihnen.
Kriminalität ist ein Teil der Gesellschaft, ohne den sie, wie es scheint, gar nicht auskommen kann.
Bereits 1895 bemerkte der Soziologe Emile Durkheim: ... das Verbrechen ist deswegen normal, weil eine Gesellschaft, die frei davon wäre, ganz und gar unmöglich wäre und er setzt hinzu Das Verbrechen ist eine notwendige Erscheinung und ... nützlich .... für die Entwicklung des Rechtes und der Moral unentbehrlich. Ungeachtet ihrer Nützlichkeit haben sich Kriminologen unterschiedlicher Epochen und Theorieansätze auf die Suche nach Ursachen von Kriminalität begeben, um sogenannte kriminalitätsbegünstigende Faktoren herauszustellen. Angefangen bei Lombroso (1876), der auf der Basis der Darwinschen Evolutionstheorie Kriminelle aufgrund biologischer Eigenschaften von der übrigen Gesellschaft separieren wollte und aufgehört bei der Betrachtung des Täters in seinen sozialen Bezügen konnte bislang weder aus einem einzelnen Faktor, noch aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren eine befriedigende Voraussage über kriminelles Verhalten abgeleitet werden.
Einzig ein Merkmal, welches gleichzeitig eine eher beiläufige Erwähnung findet, kann diese Voraussage mit immerhin 90 %er Trefferquote machen: die Geschlechtszugehörigkeit.
Zu diesen in der kriminologischen Forschung ,unbequemen Tatsachen gehört auch die für das phänomenologische Gesamtbild der Kriminalität allerdings erfreuliche Erscheinung der weiblichen Kriminalität mit ihrer vergleichsweisen relativen Bedeutungslosigkeit ... Ersetzt man im Zitat Kriminalität durch […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Abweichendes Verhalten, Kriminalität, Mord und Totschlag sind Themen, ohne die weder die Literatur, die Unterhaltsindustrie noch die gesamte Bandbreite an Printmedien und Tageszeitungen vorstellbar sind.
Auch in der Politik ist seit Anfang der neunziger Jahre das Thema der „Inneren Sicherheit“ insbesondere zum Wahlkampf begleitenden Anliegen geworden — als neues Staatsziel wurde aus der Verfassung ein „Grundrecht auf Sicherheit“ abgeleitet.
Bedrohungsszenarien öffentlicher und moralischer Ordnung durch Kriminalität haben je nach politischer und sozialer Wetterlage unterschiedliche Inhalte: mal geht es um gefährdete, mal um gefährliche Jugend oder ein allgemeiner „Werteverfall“ wird beklagt, Präventionsarbeit am besten schon im Kindergarten gefordert – kurzum, welche Werte und Normen für unsere Gesellschaft maßgeblich sind, erfahren wir in erster Linie über den Bruch mit ihnen.
Kriminalität ist ein Teil der Gesellschaft, ohne den sie, wie es scheint, gar nicht auskommen kann.
Bereits 1895 bemerkte der Soziologe Emile Durkheim:
„ ... das Verbrechen ist deswegen normal, weil eine Gesellschaft, die frei davon wäre, ganz und gar unmöglich wäre“ und er setzt hinzu „Das Verbrechen ist eine notwendige Erscheinung und ... nützlich für die Entwicklung des Rechtes und der Moral unentbehrlich.“[1]
Ungeachtet ihrer „Nützlichkeit“ haben sich Kriminologen unterschiedlicher Epochen und Theorieansätze auf die Suche nach Ursachen von Kriminalität begeben, um sogenannte „kriminalitätsbegünstigende“ Faktoren herauszustellen. Angefangen bei Lombroso (1876), der auf der Basis der Darwinschen Evolutionstheorie „Kriminelle“ aufgrund biologischer Eigenschaften von der übrigen Gesellschaft separieren wollte[2] und aufgehört bei der Betrachtung des „Täters in seinen sozialen Bezügen“[3] konnte bislang weder aus einem einzelnen Faktor, noch aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren eine befriedigende Voraussage über „kriminelles Verhalten“ abgeleitet werden.
Einzig ein Merkmal, welches gleichzeitig eine eher beiläufige Erwähnung findet, kann diese Voraussage mit immerhin 90 %er Trefferquote machen: die Geschlechtszugehörigkeit.
„Zu diesen in der kriminologischen Forschung ,unbequemen Tatsachen‘ gehört auch die für das phänomenologische Gesamtbild der Kriminalität allerdings erfreuliche Erscheinung der weiblichen Kriminalität mit ihrer vergleichsweisen relativen Bedeutungslosigkeit ...“[4]
Ersetzt man im Zitat „Kriminalität“ durch „Bevölkerung“, so bleibt eine den patriarchalen Vorstellungen entsprechend wünschenswerte, erfreuliche Erscheinung mit vergleichsweiser relativer Bedeutungslosigkeit übrig: die Frau.
Wie ist es möglich, dass ein derart maßgeblicher Bereich, der, wie Durkheim früh erkannte, unter anderem für stete Bekräftigung herrschender Moral sorgt, eine nahezu ausschließlich „männliche Erscheinung“ sein kann? Und das, ohne dass es bis dato zu einer übermäßigen Aufmerksamkeit oder einem besonderen Forschungsinteresse geführt hat?
Obwohl die Bekämpfung und Prävention von Kriminalität zu einem ausgewiesenen Staatsziel gehört und Forschungen dahingehend einiges an Steuermitteln beanspruchen, ist die auffallende Geschlechterdiskrepanz in der Kriminalitätsbelastung in Forschungen und Theorien über Ursachen von Kriminalität bislang nie gesondert berücksichtigt worden.
„Kriminalität gilt als ureigenstes Gebiet des Mannes. Männer sind Täter, Frauen Opfer; diesen Eindruck vermitteln kriminologische Studien; dieser Eindruck herrscht auch in der Öffentlichkeit vor. Wenn von ,Kriminalität‘ gesprochen wird, ist Männerkriminalität gemeint. Frauenkriminalität verschwindet oft ganz einfach in der ,allgemeinen‘ Kriminalität.“[5]
Ginge es hier nicht um Kriminalität, sondern um erstrebenswerte Positionen in einer männerdominierten Arbeitswelt, hätte diese offensichtliche Männerdominanz längst eine feministische Kritik auf den Plan gerufen. Aber die Frauenbewegung hatte bislang ein recht ambivalentes Verhältnis zu Kriminalität. Frauen als (gleichwertige) Täterinnen zu verorten vertrug sich nicht mit dem Anliegen, ihren Opfer- und Unterdrücktenstatus zu enthüllen. Gleichzeitig passt(e) das Bild des vornehmlich männlichen Täters nahtlos in die feministische Gesellschaftskritik. Nicht ohne Grund beklagen kritische Kriminologinnen und Strafrechtlerinnen die teilweise kontraproduktive Einstellung von Feministinnen zur Kritischen Kriminologie.
Die feministische Perspektive bewegt sich dabei in dem Konflikt, das Strafrecht einerseits als repressives Instrument patriarchaler Macht zu kritisieren, andererseits aber für eine Stärkung eben dieser Macht einzutreten:
„Die Vertreterinnen einer feministischen Perspektive innerhalb der Kriminologie sehen sich derzeit mit dem Vorwurf konfrontiert, daß sie als ,atypische Moralunternehmerinnen‘ mit ihren ,Kreuzzügen‘ zu einer Stärkung des repressiven Strafrechts, insbesondere des Sexualstrafrechts beitrügen.“[6]
Verstehen wir weibliche Schwäche und männliche Stärke als Zuschreibungen patriarchaler Geschlechterpolitik, so verwundert es, wenn eine Frauenkriminalität, die in Art und Inhalt eben diesen Zuschreibungen so auffallend entspricht, allgemein als spezifisch weibliches Verhalten oder gar als „normkonformes Problemlösungsmuster“[7] gesehen wird.
Dabei müsste spätestens seit der Erkenntnis über die Konstruktion und Funktion patriarchaler, dichotomer Geschlechterstereotypen die auffallende Kongruenz von „Weiblichkeit“ und „Frauenkriminalität“ gerade Feministinnen stutzig machen: Sollte an diesem Punkt doch eine deutliche Differenz der Geschlechter hervortreten? Oder führt nicht gerade diese Differenz zum Verdacht einer konstruierten (Verbrechens-)Wirklichkeit?
Um diesem scheinbar so eindeutigen Zeugnis geschlechterdifferenten Verhaltens auf den Grund zu gehen, lohnt es sich, die Definition von Kriminalität als eine Voraussetzung für kriminelle Handlungen näher zu beleuchten.
Das Phänomen „Frauenkriminalität“ lässt sich nur erklären, wenn beide darin enthaltenen Kategorien gesehen werden: Geschlecht und Kriminalität. Das Verhältnis beider Kategorien zueinander sollte unter folgender Fragestellung kritisch geprüft werden:
Wieso ist Kriminalität so ausgesprochen „männlich“? Definieren Kriminalität und Weiblichkeit dieselben Instanzen? Ist es möglich, dass Kriminalität ebensowenig ein Abbild vorwiegend männlichen Verhaltens ist, wie Passivität dem weiblichem entspricht?
In dieser Arbeit soll u.a. der Frage nachgegangen werden, an welchen Stellen und in welcher Form, traditionelle, patriarchale Vorstellungen männlicher und weiblicher Geschlechtsidentitäten in die unterschiedlichen Disziplinen und Instanzen der Jurisprudenz mit einfließen und auf diese Weise das Bild einer geschlechterdiskrepanten Kriminalitätsbelastung mitbestimmen.
Inwieweit steht gerade das Strafrecht als staatliches „Disziplinierungsorgan“ im Dienste der Aufrechterhaltung traditioneller Rollenbilder und Strukturen?
Dieses Vorgehen beinhaltet eine kritische Beleuchtung von Strafrecht und Kriminologie, insbesondere im Umgang mit der Kategorie Geschlecht. (Kap. 1 u. II)
Des weiteren wird der Frage nachgegangen, welche Erklärungen bspw. die kriminologischen Theorien zu der auffallend geringen Kriminalitätsbelastung von Frauen hatten und haben? (Kap. II)
Inwiefern greift gerade die Kriminologie, die sich als „Erfahrungswissenschaft“ bezeichnet, auf vorgegebene Stereotypen zurück? Wie sieht das Verhältnis herrschender kriminologischer Theorien zum Strafrecht aus? Und welche Rolle spielen Kriminologie und Strafrecht hinsichtlich der Legitimation und Aufrechterhaltung patriarchaler Strukturen?
Die Hinterfragung der herrschenden Definition von Kriminalität und Anwendung von Strafrecht und Strafe erfolgte erstmals durch die „Kritische Kriminologie“. Die kritische Beleuchtung herrschender Kriminalpolitik und angewendeter kriminologischer Theorien sieht einen Zusammenhang zwischen der Zuschreibung von Kriminalität und der Legitimation sozialer Ungleichheiten.(Kap. 2.1) Was sagt diese Erkenntnis hinsichtlich des Zwecks einer geschlechterselektiven Zuschreibung von Kriminalität aus?
Um die Konstruktion „weiblicher Verbrechertypen“ geht es im Kapitel III. Insbesondere das Giftmord-Stereotyp veranschaulicht die enge Verknüpfung von Geschlechtscharakteren und „Täterinnenprofil“. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Bereiche einer ursprünglich mystifizierten und dämonisierten (kriminellen) Weiblichkeit sich bis heute in der Darstellung und Erklärung von Frauenkriminalität niedergeschlagen haben.
Einseitige Interpretationsmuster und stereotype Bewertung „weiblicher Kriminalität“ durch die Instanzen der Strafverfolgung sollen des weiteren Auskunft über eine geschlechtsspezifische Bestrafung und geschlechterselektive Strafverfolgung geben. (Kap. 3.2)
Im letzten Kapitel soll der Zweck konstruierter, geschlechterselektiver Kriminalität besprochen werden. Das offensichtliche Abhängigkeitsverhältnis der Kategorien Geschlecht und Kriminalität soll auf seine Funktion in der Herstellung von „Normalitätsvorstellungen“ untersucht werden.
Medienberichte sollen auf eine geschlechtsspezifische Darstellung von Kriminalität geprüft werden. Dabei wird die Frage gestellt, inwiefern eine spezifisch „weibliche“ Frauenkriminalität den gesellschaftlichen Normalitätsvorstellungen entspricht und welchen Einfluss mediale Darstellung und traditionelle Vorstellungen auf das gesellschaftliche Erscheinungsbild von Kriminalität ausüben? Kann umgekehrt von der Herstellung und Zementierung der asymmetrischen Geschlechterordnung mittels selektiver Kriminalisierungsprozesse und Kriminalitätsdarstellungen gesprochen werden?
Folgende zentrale Fragen liegen meiner Arbeit zugrunde:
1. Welche Funktion haben Strafrecht und Kriminalität und gibt es einen Zusammenhang zum Erscheinungsbild von Frauenkriminalität?
2. Welche kriminologischen Erklärungen gibt es für den auffallend niedrigen Frauenanteil an der Gesamtkriminalität und was besagen sie?
3. Welchen Zweck erfüllt eine „typisch weibliche“ Kriminalität?
4. Welche Zusammenhänge zeigen weibliche kriminelle Unauffälligkeit und die Mystifizierung weiblicher TäterInnen?
5. An welchen Stellen sorgen Kriminalisierungsprozesse und Kriminalitätsdarstellungen für die Herstellung der asymmetrischen Geschlechterhierarchie ?
1. Gesellschaftliche Funktion von Strafe, Strafrecht und Kriminalität
Die gesellschaftliche Bedeutung des Strafrechts umfasst weit mehr, als die Verdeutlichung des Legalitätsprinzips. Neben der gesetzlichen Differenzierung von „kriminellem“ und „konformem“ Handeln, sorgt es gleichzeitig für die Darstellung und Reproduktion der herrschenden Ideologie.
Im Wirkungsbereich des Strafrechts ist der Gebrauch von Stereotypen zwangsläufig. Ob es um die Definition, die Erklärung für oder die Bekämpfung von Kriminalität geht — zunächst fassen Strafrechtler und Kriminologen menschliches Verhalten und soziale Orte in Kategorien zusammen. Alltagsweltliche Vorstellungen und eigenes „sittliches“ Empfinden der Justizorgane von Moral und Gerechtigkeit spielen eine erhebliche Rolle in der strafrechtlichen Verfolgung und Aburteilung. Dass hier ein gesellschaftlicher Bereich geradezu prädestiniert ist, um traditionelle, patriarchale Vorstellungen männlicher und weiblicher „Geschlechtscharaktere“ aufrechtzuerhalten, scheint nicht verwunderlich.
Im folgenden sollen die statistische Messung und Darstellung sowie die strafrechtliche Definition von Kriminalität dargestellt werden. Darauf aufbauend wird auf die ideologische und symbolische Funktion des Strafrechts eingegangen.
1.1 Die statistische „Messung“ von Kriminalität
Ist von Kriminalitätsbelastung pro Einwohner oder einem „besorgniserregenden Zuwachs“ an Kriminalität die Rede, so wird, falls nötig, dabei auf die Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik verwiesen.
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) weist die innerhalb des Berichtszeitraumes von einem Jahr ermittelten Tatverdächtigen aus. Als tatverdächtig wird jede Person definiert, „die nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis aufgrund zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte verdächtig ist, eine rechtswidrige (Straf-)Tat begangen zu haben. Dazu zählen Mittäter, Anstifter und Gehilfen.“[8]
Sie gibt darüber hinaus Auskunft über Steigerung, Rückgang oder Stagnation deliktspezifischer Entwicklungen. Eine reale Kriminalitätsentwicklung lässt sich allerdings nur bedingt aus der PKS ablesen.
So weist selbst das Bundeskriminalamt darauf hin, dass die PKS kein getreuliches Abbild der „tatsächlichen Verbrechensentwicklung“ wiedergibt. Vielmehr bildet diese Statistik lediglich das ab, was die Polizei als mögliche Vergehen registriert. Dabei handelt es sich größtenteils um Vorkommnisse, die auf Anzeigen von BürgerInnen basieren und nicht auf polizeilichen Ermittlungstätigkeiten.
Das Anzeigeverhalten der Bevölkerung hängt wiederum stark von den Konjunkturen jeweils vorherrschender Bedrohungsszenarien und Feindbilder ab.[9]
Daneben erfasst die Strafverfolgungsstatistik die wegen eines Verbrechens oder Vergehens abgeurteilten und verurteilten Personen innerhalb des Berichtszeitraumes.
Beide Statistiken lassen sich nur bedingt miteinander vergleichen, da ihnen unterschiedliche Erfassungskriterien zugrunde liegen. Nicht auf jede Tatverdächtigung folgt auch eine Verurteilung und umgekehrt, kann eine Verurteilung verschiedene Tatverdächtigungen umschließen.
Zwischen beiden Statistiken ist ein beträchtlicher Zahlenschwund zu verzeichnen. 1990 kamen auf 4.455 333 angezeigte Straftaten 46 172 Abgeurteilte, die am 31.12. 1991 die Gefängspopulation der alten Bundesländer ausmachten.[10] Smaus sieht hierin eine „enorme Selektionsleistung des Strafrechts im Hinblick auf putative Güterverletzungen, Taten und Täter, mit denen es sich nicht befaßt.“[11]
Helga Cremer-Schäfer unterzieht die Funktion von Kriminalstatistiken einer kritischen Würdigung:
„Die ,Kriminalstatistik‘ zeigt uns nicht mehr und nicht weniger verzerrt die Quantität von ,Kriminalität‘ an, sondern mehr oder weniger detailliert die Politiken der Nachfrage nach dem Strafrecht, Strategien des Anzeigens, der Überwachung und Ermittlung, der Anklage, der Verurteilung und der Bestrafungen. Die Politik der moralisch legitimierten Ausschließung wird dokumentiert.“[12]
Eingedenk ihrer nur begrenzten Aussagekraft und politischen Funktion, geben die Kriminalstatistiken folgende Auskunft über die Quantität und Qualität von Frauenkriminalität:
1.1.1 Frauenkriminalität als statistischer Befund
In den entwickelten Industrieländern liegt der durchschnittliche Anteil der Frauen an den Verurteilten bei etwa 10-20 %, in den Entwicklungsländern bei 3-5 %. 1995 entsprach der Frauenanteil an den Tatverdächtigen in der BRD 22,1 %, auf eine Tatverdächtigenbelastung pro 100 000 EinwohnerInnen kamen am 1.1.1995 1.0006 Frauen und 3.533 Männer.[13]
Innerhalb der nachfolgenden Strafverfolgungsinstanzen verringert sich der prozentuale Anteil der Frauen noch weiter. Ihr Anteil an verurteilten Personen liegt seit 1970 durchgehend zwischen 19 und 20 %.[14]
Der Anteil der weiblichen Strafgefangenen, die nach dem StGB (ohne Jugendstrafe) verurteilt wurden und eine Freiheitsstrafe verbüßen mussten, lag an den jeweiligen Stichtagen im März der Jahre 1996 bis 1998 bei nur noch im Bereich von3,6 bis 5,2 %.[15]
1.1.2 Qualität der Delikte
Nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch in der Deliktstrukur unterscheidet sich die Frauenkriminalität zu der männlichen im statistischem Erscheinungsbild.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[16]
Es zeigt sich, dass Frauen bei allen ausgewiesenen Straftatengruppen deutlich unterrepräsentiert sind und mit als weniger schwerwiegend geltenden Delikten in der Kriminalstatistik aufgeführt werden.
Heide Wunder weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kriminalstatistiken u.a. Grundlage für die Konstruktion einer geschlechtsspezifischen Delinquenz bilden. Dabei entwickeln die geschlechterbezogenen Daten der Kriminalstatistik die Basis für typisch „männliche“ und typisch „weibliche“ Deliktstrukturen, von denen auf eine geschlechtsspezifische Kriminalität geschlossen wird.[17]
„Als signifikante Unterschiede wird bei der Kriminalität von Männern auf ihre größere Bereitschaft zu Gewalttätigkeiten verwiesen, während bei Frauen ,passive‘ Formen der Konfliktaustragung bezeichnend seien. Damit ereignet sich unversehens der Umschlag von Quantitäten in Qualitäten. Die Bewertungen, die unausgesprochen in diesem Umschlag wirken, werden nicht reflektiert.“[18]
Nach ihrer These ist die statistische Kategorie „Geschlecht“ keinesfalls beschreibend, sondern ausgesprochen kulturell geprägt. Die „weibliche Kriminalität“ ist dabei ist demnach Resultat einer sozialer Konstruktion.[19]
1.2 Die strafrechtliche Definition von Kriminalität
Im folgenden soll gezeigt werden, welche Annahmen hinter der strafrechtlichen Definition von Kriminalität stehen, welche Bereiche sie einschließt und welche ausgeschlossen sind.
Die oben angeführten Delikte und Deliktgruppen geben ein anschauliches Beispiel dafür, was öffentlich unter Kriminalität verstanden und präsentiert wird. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass Begriffe wie Diebstahl, Betrug, Mord, Totschlag und Vergewaltigung auch von der Allgemeinheit mit einem moralischen Unwerturteil belegt werden.
So eindeutig und klar, wie die moralische Verurteilungen dieser Handlungen offensichtlich fällt, so unklar bleibt die eigentliche Definition einer kriminellen Handlung.
Eine deutliche Abgrenzung legaler von illegalen Handlungen findet erst durch strafrechtliche Festlegung statt. Dem Strafrecht kommt somit die eigentliche „conditio sine qua non“ strafbarer Handlungen zu. Dabei fällt auf, dass nicht die Handlung als solche, sondern vielmehr ihre Titulierung als „rechtswidrig“ bspw. in einem Fall zum Diebstahl und im anderen zur unternehmerischen Gewinnmaximierung wird.
So lehrt uns der § 242 StGB, dass die „ rechtswidrige Zueignungsabsicht“ einem Diebstahl vorausgehen muss. Umgekehrt können rechtmäßige Zueignungsabsichten durchaus als Motor einer kapitalistischen Wirtschaft bezeichnet werden.
Erst kürzlich wurde dieser Zusammenhang sogar per Gerichtsurteil bestätigt. Danach wurde ein Speditionskaufmann verurteilt, Steuern für den Handel mit gestohlenem Gasöl zu entrichten:
„Dass die ,ausgeübte Tätigkeit gesetzlich verboten gewesen ist‘, stehe der ,Beurteilung als unternehmerischer Tätigkeit und damit der Besteuerung nicht entgegen‘, heißt es in dem [...] Urteil des 5. Senates.“[20]
Auch Mord, Totschlag und Körperverletzung finden ihre legalen Entsprechungen in Krieg, Folter und Freiheitsentzug.
Nicht die Tötung oder Verletzung eines Menschen ist der inkriminierte Teil der Handlung, sondern wer sie warum und in welcher Funktion begeht, macht sie abwechselnd zu Mord, Totschlag, Notwehr oder Pflichtausübung. In Erich Frieds umstrittenem Ausruf „Soldaten sind Mörder“ wurde einmal mehr diese staatliche Doppelmoral kritisiert
Auch Paragrafen wie die „Straftaten gegen die Umwelt“ offenbaren eher den rechtmäßigen Spielraum gewinnträchtiger Naturausbeutung und -zerstörung, denn eine grundsätzliche Verurteilung solcher Handlungen. So wird lediglich in den §§ 324 und 326 umweltschädigendes Verhalten originär strafrechtlich erfasst. Über diese Paragrafen kommen als Täter nur Kleinverschmutzer in Frage. Soziale Gruppen hingegen, deren Tätigkeit von vornherein umweltverwaltungsrechtliche Relevanz aufweist, können sich eher auf Straffreistellungsgründe berufen.[21]
Um zwischen legalen und illegalen Handlungen zu unterscheiden, legt das Strafrecht fest, welche Güter als Rechtsgüter und öffentlich schützenswert gelten. Hier findet ein weiterer normativer Schritt bei der Definition von Kriminalität statt.
Die im Strafrecht eigens definierten Rechtsgüter erhalten als solche eine neue Wertigkeit. Auf diese Weise generiert der Schutz eines ungleichverteilten Eigentums vom Vorrecht der Reichen unversehens zum „sittlichen“ Wert.
„Aber auch Güter, die nicht Einzelpersonen, sondern der Allgemeinheit zustehen, benötigen strafrechtlichen Schutz. Welche andere Möglichkeit bestünde denn, Meineide und falsche Aussagen zu verhindern, Strolche von Überfällen auf alleingehende Frauen abzuhalten, etc. Mit Schadensausgleich ist hier nicht geholfen. Diese Einsicht ist so trivial, daß man, bei allem Rätseln über die Aufgabe des Strafrechts und der Strafe, doch nie seine bzw. ihre Notwendigkeit in Frage gestellt hat.“[22]
Diese Erläuterung der Aufgaben von Strafe und Strafrecht repräsentieren zugleich die zentralen Annahmen im Strafrecht:
1. Es gibt „Kriminelle“ (hier: „Strolche“), vor der die Gesellschaft sich schützen muss.
2. Ein Schutz vor Kriminalität erfolgt über die Androhung und Ausübung staatlicher Strafe. Der angenommene Erfolg ist somit gleichzeitig die Begründung der ausgewiesenen Strafzwecke.
3. Das Bild „alleingehende Frau wird vom Strolch überfallen“ ist ein typisches Beispiel für mitgelieferte Rollenerziehung über das Strafrecht. Es suggieriert eine geschlechtsspezifische Gefahr, die gleichzeitig eine Warnung an „alleingehende Frauen“ aussendet. Die beschriebene Gefahr entspricht nicht einmal strafrechtlicher Realität. Statistisch ist Gefahr für Frauen, v.a. durch sexuelle Übergriffe, hauptsächlich in den eigenen vier Wänden zu finden. Auf die Verwendung solcher Szenarien wird noch unter Punkt 1.3 eingegangen.
Bereits in der Entstehungsgeschichte von Recht und Strafrecht haben Frauen die sexuelle Doppelmoral zugunsten des Mannes und die ungenügende Berücksichtigung weiblicher Interessen im Strafrecht beklagt.
1908 formulierte der Bund Deutscher Frauen (BDF) die Forderung nach Neudefinierung von Rechtsgütern. Vergewaltigung sollte nicht nur im „außerehelichen“ Fall bestraft werden (erst knapp 90 Jahre später ist dieser Forderung, mit Einschränkungen, nachgekommen), Körperverletzung sollte auch die psychische Misshandlung (Quälsucht) mit einbeziehen, selbstverschuldete Trunkenheit sollte nicht mehr strafmildernd gewertet werden, die Bestrafung wissentlicher Ansteckung von Geschlechtskrankheiten erfolgen, die Tötung eines Neugeborenen durch seine uneheliche Mutter sollte nicht länger als Mord gelten, der Vater sollte ebenfalls zur Verantwortung gezogen werden u.v.a.m.[23]
Ungeachtet der eindeutig interessenbedingten Auswahl schützenswerter Rechtsgüter wird bis heute in Lehrbüchern der Grundgedanke des Strafrechts als moralisch-sittlich unantastbar, ähnlich religiösen Geboten, dargestellt.
„Den Zehn Geboten entspricht in etwa der Kernbereich echten Kriminalstrafrechts.“[24]
Strafrechtskritik wurde und wird damit schnell in die Nähe „unsittlicher“ Gedanken gerückt — sind doch „Strafrechtsnorm und sittliche Normen [ ... ] in der Wurzel verwandt.“[25]
Der Staat und staatliches Handeln stehen somit außerhalb jeder moralischer Kritik, da sie Recht und Gesetz, aber auch eine übergeordnete Moral stets auf ihrer Seite haben. Die Tatsache, dass jede illegale Handlung eine legale Entsprechung hat, macht die staatliche Doppelmoral offensichtlich.
Festzuhalten bleibt:
- Nicht die eigentliche Handlung, sondern die Berechtigung dazu unterscheidet legale von illegalen Handlungen.
- Die Auswahl der zu schützenden Rechtsgüter ist interessenbedingt und folgt der Logik heterogener Verteilung von Macht und Eigentum.
1.3 Adressaten des Strafrechts
„Die Abfassung der strafrechtlichen Tatbestände war von Anfang an auf bestimmte Adressaten zugeschnitten, sowohl im Hinblick darauf, was als Rechtsgut in Frage kommt, als auch hinsichtlich des ungleich verteilten Zugangs zu verschiedenen Eigentumsformen. Diese wiederum bedingen die schichtspezifische Begehungsart des Delikts: Wer über nichts als seine körperliche Kraft verfügt, wird wahrscheinlich Diebstahl begehen; wem regelmäßig Geld zur Aufbewahrung anvertraut wird, der kann Unterschlagung begehen.“[26]
Wie gezeigt werden konnte, sind nicht nur bestimmte Bereiche strafrechtlich immunisiert, sondern es werden auch die „Täter“ in Zusammenhang mit den vermeintlich von ihnen begangenen „Taten“ unterschiedlich über das Strafrecht und die Gerichte erfasst und behandelt. Als „Diebstahl“ werden gemeinhin Eigentumsdelikte von Mitgliedern der untersten Schichten bezeichnet, während Eigentumsdelikte der Mittelschicht hingegen i.d.R. als Unterschlagung, Betrug oder Steuerhinterziehung gelten. Gleichzeitig verschleiert der universalistische Sprachstil des Strafrechts gerade diese Tatsache. Allein der Gebrauch des unspezifischen Begriffs „Eigentum“ bewirkt u.a., dass sich das Strafrecht intentional gegen diejenigen richtet, die keines besitzen und auch nicht versuchen, es mit ehrlicher Arbeit zu erwerben. Das Vorhandensein sogenannter „krimineller Energie“ wird vorzugsweise Deliktarten zugeordnet, bei dem sich bspw. der Täter einen den Zugang zu (fremden) Eigentum in Verbindung mit (körperlicher) Gewalt verschaffen muss.[27]
Diese schichtspezifische Abfassung der Eigentumsdelikte ist unmittelbar relevant für die vorgesehen Sanktion. Während beim „gemeinen“ (Laden-)Diebstahl die gesetzlich vorgegebenen Tatbestandsmerkmale mit der Tat automatisch erfüllt werden, ist insbesondere im Bereich der „Wirtschaftskriminalität“ die Tatbestandsstruktur so angelegt,
„daß aufgrund der objektiven Merkmale der Taten die meisten putativen kriminellen Handlungen ausscheiden oder nicht erfaßt werden, wodurch aus dem Prozeß der strafrechtlichen Verfolgung vorzugsweise Angehörige höherer Schichten ausscheiden.“[28]
Wird bspw. einer ganz bestimmten Klientel die Möglichkeit eröffnet, sich bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung Straf- oder Bußgeldfreiheit durch Selbstanzeige zu verschaffen, so wäre diese Möglichkeit z.B. beim Ladendiebstahl völlig abwegig. Außerdem werden hierbei die Verfahren selten eingestellt, eine Verurteilung wegen (Laden-)Diebstahls ist bspw. dreimal so wahrscheinlich wie bei einer Unterschlagung.[29]
Obwohl das Ausmaß an „illegal umverteilten Gut“ durch Taten Angehöriger höherer Schichten bei weitem den Schaden überwiegt, der durch gemeine Diebstähle der Unterschicht verursacht wird, bildet eben jene Unterschicht den größten Teil der Gefängnispopulation. Gerlinda Smaus sieht hierin die These begründet, dass durch die Selektivität des Strafrechts die „kriminelle Population“ nicht nur schlicht reproduziert wird, „sondern im wahrsten Sinne des Wortes produziert wird“.[30]
Ob ein Rechtsbruch gerichtlich als Straftat, der oder die Tatverdächtige für die Tat zur Verantwortung gezogen werden kann, hängt des weiteren von der Prüfung der Intentionalität ab. Wer bspw. gerichtlich für unzurechnungsfähig befunden wird, oder aber die Tat ohne jeden strafwürdigen Vorsatz begangen hat, kann nicht für schuldig erklärt werden. Die Prüfung der Intentionalität ist ein entscheidendes Kriterium bei der Bewertung einer (strafbaren) Handlung. Ohne Motiv bzw. Absicht kann keine strafbare Handlung begangen werden. Auf diese Weise schafft sich das Strafrecht einen entscheidenden Selektionsmechanismus:
„Ob eine strafbare Handlung vorliegt oder nicht, wird nicht an der Handlung, sondern anhand der Personenmerkmale der Verdächtigen oder Angeklagten entschieden.“[31]
Der in Kap. 1.1 angezeigte Zahlenschwund zwischen Anzeigen und Verurteilungen liegt in der Selektionsleistung der Staatsanwaltschaft. Hier wird nicht streng nach dem Legalitätsprinzip (wonach alle Taten zu verfolgen sind) entschieden, sondern die Staatsanwaltschaft orientiert sich an Vorabentscheidungen der richterlichen Kriterien des Unrechts- (Tatkriterium) und Schuldgehalts (Täterkriterium) der Strafzumessungspraxis. Einstellungen wegen Geringfügigkeit oder Anklageerhebung bzw. Strafbefehl sind mögliche Konsequenzen der Staatsanwaltschaft auf eine Anzeige. Die Bewertung der Persönlichkeit eines putativ Verdächtigen spielt demnach bereits im frühen Stadium der Strafverfolgung eine entscheidende Rolle. Bei der Strafzumessung soll die erwartete Wirkung der Strafe auf den Täter berücksichtigt werden, das impliziert die Notwendigkeit, sich ein „Bild“ vom Typus des Angeklagten zu machen. Die Folge sind Kategorien typisierter „Täterpersönlichkeiten“.[32]
Nach Smaus liegt es bereits in der Logik des Strafprozesses begründet, dass soziale Persönlichkeitsmerkmale über die Bewertung der Tat entscheiden, „Gesinnungsjustiz“ sich somit nicht unmittelbar auf die Einstellung der jeweiligen Richter und Staatsanwälte zurückführen lässt, wohl aber auf die Auswahlmechanismen des Strafrechts.[33]
Gleichwohl zeigen Umfrageergebnisse bei Strafrichtern deren eindeutige Zuweisung von „Kriminalität“ zu Unterschicht. Insbesondere eine „selbstverschuldete Not“ durch „arbeitsscheues Verhalten“ gilt als unentschuldbares und häufigstes Motiv für „kriminelle“ Handlungen.[34]
Umgekehrt sind die Motive eines Täters „aus gutem Hause“ eigentlich unerklärlich, eine Motivzuschreibung fällt juristisch schwer. Peters stellt fest, dass, obwohl gerade bei den besser gestellten Tätern mehr Handlungskompetenz, Beherrschung etc. angenommen werden müsste, ein „zeitweiliger Verlust der Handlungssteuerung“ angenommen wird, während den „Dümmlichen“ stets die volle Verantwortung zugeschrieben wird. Auch bei der „Verführung“ sei es die bleibende positive Einstellung des Täters zu der verletzten Norm, die seitens der Richter honoriert werde.[35]
[...]
[1] Durkheim, Emile, zit. n. Lautmann, Rüdiger 1998, S. 45
[2] vgl. Lamnek, Siegfied 1994, S. 128
[3] vgl. Göppinger, Hans 1997, S. 209
[4] Cremer, Carl Gustav 1972, S. 13
[5] Ulbricht, Otto 1995, S. 5
[6] Karstedt, Susanne 1995, S. 143
[7] vgl. Gipser, Dietlinde / Stein-Hilbers, Marlene 1980
[8] Polizeiliche Kriminalstatistik 1995, S. 11
[9] vgl. Frankfurter Rundschau vom 24.01.2000, S. 10
[10] vgl. Smaus, Gerlinda 1998, S. 220
[11] ebd.
[12] Cremer-Schäfer, Helga 1997, S. 71
[13] PKS 1995, S. 76
[14] vgl. http://www.statistik-bund.de/basis/d/recht/rechts3.htm vom 3.02.2000
[15] vgl. Berechnet nach Strafgefangenenstatistik aus: http://www.statistik-bund.de/basis/d/recht/rechts6.htm vom 3.02.2000
[16] Berechnet nach: Statistisches Bundesamt 2000, Strafverfolgung 1997
[17] vgl. Wunder, Heide 1990, S. 41
[18] ebd.
[19] ebd., S. 43
[20] Frankfurter Rundschau vom 14.4.2000
[21] vgl. Smaus, Gerlinda 1998, S. 253
[22] Baumann 1979, S. 21
[23] vgl. Dürkop, Marlies 1988, S. 194 f
[24] Baumann 1979, S. 18
[25] ebd.
[26] Smaus, Gerlinda 1998, S. 222
[27] vgl. ebd.
[28] ebd. S. 242
[29] vgl. ebd. S. 245
[30] Smaus, Gerlinda 1998, S. 238
[31] ebd., S. 254
[32] vgl. ebd. S. 257
[33] vgl. ebd. S. 259 ff
[34] vgl. Peters, Dorothee 1973, S. 42
[35] vgl. ebd. S. 83 ff; S. 110 ff
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783836622431
- Dateigröße
- 438 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Georg-August-Universität Göttingen – Soziologie
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- frauenkriminalität kriminologie gewalt giftmörderin strafverfolgung
- Produktsicherheit
- Diplom.de