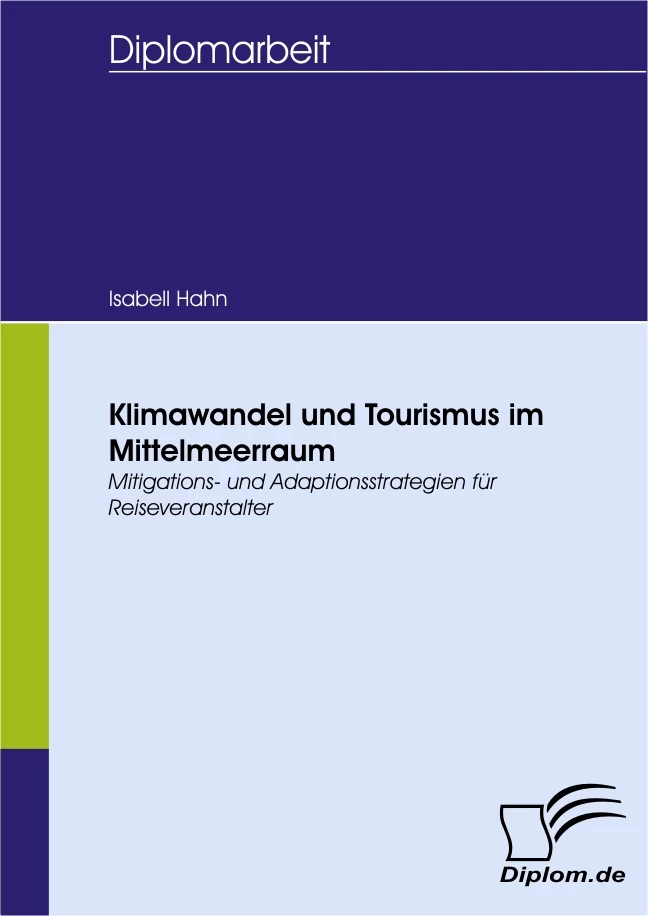Klimawandel und Tourismus im Mittelmeerraum
Mitigations- und Adaptionsstrategien für Reiseveranstalter
Zusammenfassung
Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Spätestens seit dem vierten Sachstandsbericht des IPCC bestehen keine Zweifel mehr, dass sich die Klimabedingungen ändern werden und wir uns selbst dann auf Klimaänderungen einstellen müssen, wenn wir kurzfristig ein Konzept zur massiven Treibhausgassenkung umsetzen würden. Unsicherheiten bestehen allerdings noch in den Projektionen über das Ausmaß der Auswirkungen, die wiederum abhängig von zukünftigen Emissionen sind.
Letzteres bedeutet einen Handlungszwang für uns alle, vorrangig allerdings für die Politik und die Wirtschaft, eben für die Personen und Institutionen, die Einfluss auf die zukünftige nachhaltige Planung und Entwicklung haben.
Auf der Suche nach den Verantwortlichen erscheint auch die Tourismusbranche zunehmend in den Medien. Mit Titelmeldungen wie [ ] auf Mallorca sollen auch noch die Strände verschwinden. ( ), Wird Spanien zur Wüste? oder Ankündigungen wie in 50 Jahren macht kein Tourist mehr Mittelmeer-Urlaub wird Aufmerksamkeit erregt. Die Verantwortung der Tourismusunternehmen rückt endgültig in den Vordergrund durch Schlagzeilen wie Umweltsünder Tourismus oder durch Fernsehsendungen wie die BBC-Dokumentation Klimakiller Fliegen.
Deutlich wird in jedem Fall, dass sowohl Strategien zur Verminderung und Vermeidung von weiteren Emissionen, als auch Pläne entwickelt und umgesetzt werden müssen, wie mit den Auswirkungen der Klimaänderung umgegangen werden soll. Zwar sollte sich das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Reisenden über seinen persönlichen Beitrag zum Treibhauseffekt entwickeln und steigern, was z.B. zu einem Abwägen über die Art der Reise und die Wahl des Verkehrsmittels führen könnte. Die Grundlage dafür muss aber von den Reiseveranstaltern geschaffen werden, die für und durch ihr touristisches Angebot Verantwortung tragen. Die Entwicklung und Anwendung von Konzepten und Maßnahmen für die Verminderung von Treibhausgasemissionen sowie für die Anpassung der touristischen Leistungen an die projizierten Veränderungen stellen die Haupthandlungsdeterminanten und damit Herausforderungen für die Reiseveranstalter dar.
Inwieweit sich die einzelnen Klimaänderungen auswirken, hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Regionen ab. So sind zum Beispiel flache Küstengebiete generell stark vom Meeresspiegelanstieg und von Überflutungen bedroht, während Gebirgsregionen wie die Alpen mit dem Rückgang der Gletscher sowie mit zukünftigem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Einführung in die Thematik
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Der Klimawandel
2.1 Der Treibhauseffekt
2.2 Tatsachen und Projektionen der Forschung über Änderungen des Klimas
2.3 Bedeutungen des Klimawandels
2.4 Optionen, dem Klimawandel zu begegnen
3. Tourismus im Mittelmeerraum
3.1 Ein Überblick über das touristische System und dessen Institutionen
3.2 Die touristische Bedeutung des Mittelmeerraums
3.3 Ökonomische Bedeutungen des Tourismus im Mittelmeerraum
4. Auswirkungen des Klimawandels auf touristische Regionen im Mittelmeerraum
4.1 Der Mittelmeerraum und dessen Verwundbarkeit
4.2 Der Forschungsstand der Auswirkungen des Klimawandels im Mittelmeerraum
4.3 Auswirkungen auf den Tourismus im Mittelmeerraum
4.4 Mögliche Folgen der Auswirkungen
5. Mögliche Mitigations- und Adaptionsstrategien für Reiseveranstalter
5.1 Verantwortung und Handlungspflicht der Reiseveranstalter
5.2 Mögliche Strategien und Maßnahmen
5.2.1 Mitigationsstrategien und –maßnahmen
5.2.1.1 Die Beförderung
5.2.1.2 Die Unterbringung
5.2.1.3 Aktivitäten und Attraktionen
5.2.1.4 Kompensationsprojekte
5.2.1.5 Schlussfolgerungen über die möglichen Mitigationsstrategien und –maßnahmen
5.2.2 Adaptionsstrategien und –maßnahmen
5.2.2.1 Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen der steigenden Temperaturen
5.2.2.2 Maßnahmen zum Umgang mit Extremwettersituationen, Land- und Küstendegradierung sowie Strandverlust
5.2.2.3 Maßnahmen zur Erhaltung der touristischen Ressourcenbasis
5.2.2.4 Maßnahmen hinsichtlich der möglichen Änderungen der Nachfrage
5.2.2.5 Sonstige Anpassungsstrategien und –maßnahmen
5.2.2.6 Schlussfolgerungen über die möglichen Adaptionsstrategien und –maßnahmen
5.3 Bedingungen für das Umsetzen der Mitigations- und Adaptionsstrategien
6. Mitigations- und Adaptionsstrategien der TUI
6.1 Mitigationsstrategien und –maßnahmen
6.1.1 Allgemeine Mitigationsstrategien und –maßnahmen
6.1.2 Klima- und Kompensationsprojekte
6.1.3 Die Beförderung
6.1.4 Die Unterbringung
6.1.5 Aktivitäten und Attraktionen
6.2 Adaptionsstrategien und –maßnahmen
6.2.1 Maßnahmen zur Erhaltung der touristischen Ressourcenbasis
6.2.2 Maßnahmen zum Umgang mit Extremwettersituationen, Land- und Küstendegradierung sowie Strandverlust
6.2.3 Bestehende nachhaltigkeitsorientierte Produkte und Angebote
6.3 Strategie- und Maßnahmenvergleich und weitere Handlungsoptionen
7. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Schlüsseltechnologien und –praktiken zur Emissionsminderung nach Sektoren (IPCC, 2007c: 50)
Tab. 2: Anpassungsoptionen für verwundbare Sektoren (IPCC, 2007d: 70)
Tab. 3: International Tourist Arrivals World (UNWTO, 2007: 3)
Tab. 4: International Tourist Arrivals World’s Top 10 (UNWTO, 2007: 5)
Tab. 5: International Tourist Arrivals Europe (UNWTO, 2007: 6)
Tab. 6: International Tourism Receipts Europa in Euro (UNWTO, 2006a)
Tab. 7: International Tourism Receipts North Africa in Euro (UNWTO, 2006b)
Tab. 8: Gegenüberstellung der Mitigationsstrategien (eigene Darstellung)
Tab. 9: Gegenüberstellung der Adaptionsstrategien (eigene Darstellung)
Tab. 10: Zusammenfassung Temperaturen und Niederschlag (Giannakopoulos et al., 2005: 35)
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Änderungen von Temperatur, Meeresspiegel und nordhemisphärischer Schneebedeckung (IPCC, 2007a: 6)
Abb. 2: Multimodell-Mittel und geschätzte Bandbreiten für die Erwärmung an der Erdoberfläche (IPCC, 2007a: 14)
Abb. 3: Dichte der touristischen Nachfrage (Eurostat, 2002: 4)
Abb. 4: Projizierte Klimaänderungen für den Mittelmeerraum (eigene Darstellung)
Abb. 5: Auswirkungen auf die Regionen des Mittelmeerraums (eigene Darstellung)
Abb. 6: Mögliche Folgen der Klimaänderung (eigene Darstellung)
Abb. 7: Die Mittelmeerländer gehören zu den Verlierern (Deutsche Bank Research, 2008: 30)
Abb. 8: Prozesspfeile Klimawandel (eigene Darstellung)
Abb. 9: Mögliche Mitigationsstrategien für Reiseveranstalter (eigene Darstellung)
Abb. 10: Mögliche Adaptionsstrategien für Reiseveranstalter (eigene Darstellung)
Abb. 11: Prozess der strategischen Planung (Kreilkamp, 1998: 292)
Abb. 12: Marktanteile nach Umsatz in Prozent der größten deutschen Reiseveranstalter (FVW, 2007)
Abb. 13: Emissionsszenarien des IPCC (IPCC, 2007a: 18)
Abb. 14: Darstellung von Unsicherheiten der Aussagen der dritten Arbeitsgruppe des IPCC (IPCC, 2007c: 66)
Abb. 15: TUI Umweltkriterien für Destinationen 2007 (TUI AG, 2008q)
Abb. 16: TUI Umweltcheckliste Hotel (TUI AG, 2008m)
1. Einleitung
1.1 Einführung in die Thematik
Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Spätestens seit dem vierten Sachstandsbericht des IPCC bestehen keine Zweifel mehr, dass sich die Klimabedingungen ändern werden und wir uns selbst dann auf Klimaänderungen einstellen müssen, wenn wir kurzfristig ein Konzept zur massiven Treibhausgassenkung umsetzen würden. Unsicherheiten bestehen allerdings noch in den Projektionen über das Ausmaß der Auswirkungen, die wiederum abhängig von zukünftigen Emissionen sind.
Letzteres bedeutet einen Handlungszwang für uns alle, vorrangig allerdings für die Politik und die Wirtschaft, eben für die Personen und Institutionen, die Einfluss auf die zukünftige nachhaltige Planung und Entwicklung haben.
Auf der Suche nach den Verantwortlichen erscheint auch die Tourismusbranche zunehmend in den Medien. Mit Titelmeldungen wie „[…] auf Mallorca sollen auch noch die Strände verschwinden. […]“ (manager-magazin.de, 2007), „Wird Spanien zur Wüste?“ (Streck, 2007) oder Ankündigungen wie „in 50 Jahren macht kein Tourist mehr Mittelmeer-Urlaub“ (Welt ONLINE, 2007) wird Aufmerksamkeit erregt. Die Verantwortung der Tourismusunternehmen rückt endgültig in den Vordergrund durch Schlagzeilen wie „Umweltsünder Tourismus“ (FOCUS online, 2007) oder durch Fernsehsendungen wie die BBC-Dokumentation „Klimakiller Fliegen“ (BBC Germany, 2007).
Deutlich wird in jedem Fall, dass sowohl Strategien zur Verminderung und Vermeidung von weiteren Emissionen, als auch Pläne entwickelt und umgesetzt werden müssen, wie mit den Auswirkungen der Klimaänderung umgegangen werden soll. Zwar sollte sich das Verantwortungsbewusstsein jedes einzelnen Reisenden über seinen persönlichen Beitrag zum Treibhauseffekt entwickeln und steigern, was z.B. zu einem Abwägen über die Art der Reise und die Wahl des Verkehrsmittels führen könnte. Die Grundlage dafür muss aber von den Reiseveranstaltern geschaffen werden, die für und durch ihr touristisches Angebot Verantwortung tragen. Die Entwicklung und Anwendung von Konzepten und Maßnahmen für die Verminderung von Treibhausgasemissionen sowie für die Anpassung der touristischen Leistungen an die projizierten Veränderungen stellen die Haupthandlungsdeterminanten und damit Herausforderungen für die Reiseveranstalter dar.
Inwieweit sich die einzelnen Klimaänderungen auswirken, hängt von den spezifischen Gegebenheiten der Regionen ab. So sind zum Beispiel flache Küstengebiete generell stark vom Meeresspiegelanstieg und von Überflutungen bedroht, während Gebirgsregionen wie die Alpen mit dem Rückgang der Gletscher sowie mit zukünftigem Schneemangel durch den Temperaturanstieg konfrontiert werden. Viele touristische Regionen liegen meist in den von den Auswirkungen des Klimawandels stärker betroffenen Gebieten. Dort besteht die Aufgabe einerseits darin, die Infrastruktur und das örtliche ökologische Umfeld an die Klimaänderungen anzupassen und andererseits, die Attraktivität für Touristen aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus zu erhalten.
Der Mittelmeerraum gehört zu diesen stark betroffenen Gebieten. Er gehört zu den meist bereisten Gebieten überhaupt und stellt in Europa die beliebteste Urlaubsregion und damit für die Reiseveranstalter einen bedeutenden Markt dar. Um diesen Markt weiterhin bedienen zu können und den Ansprüchen und Wünschen der Touristen, aber eben auch denen der Einheimischen gerecht zu werden, bedarf es der Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Verminderungs- und Anpassungsstrategien, so genannte Mitigations- und Adaptionsstrategien.
1.2 Aufbau der Arbeit
In Kapitel zwei werden zunächst die Grundlagen des Klimawandels sowie der Stand der Forschung und Entwicklung der bestehenden Untersuchungsberichte erläutert. Hierbei beschränke ich mich auf einen für diese Arbeit relevanten Auszug aus den bisherigen Beobachtungen und zukünftigen Projektionen. Anschließend gehe ich auf die Bedeutung der Klimaänderungen für die natürliche Umwelt und für die sozioökonomischen Sektoren ein.
Um die Beziehung des Tourismus zum Klimawandel aufzuzeigen, werden in Kapitel drei zunächst die wichtigsten Grundzüge des touristischen Systems sowie dessen Institutionen erläutert. Anschließend verdeutliche ich anhand von Reisestatistiken die touristische und ökonomische Bedeutung des Tourismus im Mittelmeerraum.
Die durch Wissenschaftler und Studien prognostizierten Auswirkungen und Folgen des Klimawandels bezogen auf den Mittelmeerraum werden in Kapitel vier zunächst allgemein und anschließend in Hinblick auf ausgewählte Mittelmeerdestinationen dargestellt. Eine Übersicht über die möglichen Folgen für den Tourismus soll als Grundlage für die Strategie- und Maßnahmenentwicklung für Reiseveranstalter in Kapitel fünf sowie für die Analyse der Strategien und Maßnahmen der TUI in Kapitel sechs dienen.
Die möglichen Mitigations- und Adaptionsstrategien für Reiseveranstalter erarbeite ich mit Hilfe von wissenschaftlichen Ansätzen über Anpassung und Vermeidung für die Tourismusbranche und branchenfremde Bereiche. Diese entwickelten Strategien und Maßnahmen dienen im sechsten Kapitel dem Vergleich mit den Strategien und Maßnahmen der TUI, die unter Verwendung der Internetpräsentation, der Produktkataloge sowie weiterer Informationsmaterialien ermittelt werden. Nach der Analyse und Beschreibung der Ergebnisse werde ich weitere mögliche Handlungsoptionen ableiten. Im siebten Kapitel fasse ich die Erkenntnisse der Arbeit in einer Schlussbetrachtung zusammen.
2. Der Klimawandel
„Climate is defined as the average atmospheric conditions taken over a long (usually months, seasons, years or decades) period of time“ (Boodhoo, 2003: 3).
Der allseits gebräuchliche Begriff Klimawandel bzw. Klimaänderung meint in vielen Fällen den vom Menschen verursachten Prozess, der das Klima in höherer Geschwindigkeit verändert, als es sich ohne diesen verändern würde. Das Klima an sich wandelt sich seit der Entstehung der Atmosphäre und wird sich auch in Zukunft als Folge natürlicher Ursachen verändern (vgl. Bode, Stiller & Wedemeier, 2007: 10). Allerdings ist der heutige und zukünftige Klimawandel verstärkt, belegt durch Wissenschaftler, auf den zusätzlichen, durch den Menschen verursachten Treibhauseffekt zurückzuführen (vgl. Abschnitt 2.1; Boodhoo, 2003: 4).
Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ist ein zwischenstaatlicher Ausschuss, auch Weltklimarat genannt, der von der World Meteorological Organization (WMO) und der United Nations Environment Programme (UNEP) 1988 gegründet wurde, um über den wissenschaftlichen Forschungsstand zu berichten und mögliche Mitigations- und Adaptionsstrategien (vgl. 2.4) für Politiker und Entscheidungsträger zu entwickeln (vgl. IPCC, 2008). Der Begriff Klimawandel bezieht sich in den Berichten des IPCC
„auf jegliche Klimaänderung im Verlauf der Zeit, sei es aufgrund natürlicher Schwankungen oder als Folge menschlicher Aktivitäten. Dieser Gebrauch unterscheidet sich von demjenigen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, wo unter Klimaänderung eine Änderung des Klimas verstanden wird, die direkt oder indirekt menschlichen Aktivitäten, welche die Zusammensetzung der Erdatmosphäre verändern, zugeordnet werden kann und die zu den über vergleichbare Zeiträume beobachteten natürlichen Klimaschwankungen hinzukommt“ (IPCC, 2007a: 2).
Die Ausführungen dieser Arbeit schließen sich der Definition des IPCC an.
2.1 Der Treibhauseffekt
Die Ursache für die in der Einleitung genannten bevorstehenden Auswirkungen wie der Meeresspiegelanstieg und der Rückgang des Permafrosts ist der befürchtete Temperaturanstieg. Dieser ist die Folge des steigenden Kohlendioxidgehalts der Atmosphäre, auch Treibhauseffekt genannt, der im Folgenden kurz erläutert werden soll.
Die Erdoberfläche strahlt umso mehr Wärme ab, desto höher ihre Temperatur ist. Diese Wärme wird in der Atmosphäre von den wichtigsten klimawirksamen Gasen Wasserdampf, Kohlendioxid und Methan absorbiert. Dies sind die so genannten Treibhausgase, wobei die Konzentration des Wasserdampfes vom Menschen nicht direkt beeinflusst werden kann. Die Wärme wird von den Gasen gleichmäßig in alle Richtungen abgestrahlt und damit auch zurück an die Erdoberfläche, wo durch die Treibhausgase also mehr Strahlung ankommt als nur durch die Sonnenstrahlung. Um einen Ausgleich zu schaffen, muss die wärmere Erdoberfläche auch mehr abstrahlen. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt, der 33 Grad Celsius ausmacht, betrüge die Temperatur minus 18 Grad Celsius. Aufgrund dieses starken Effekts kann schon eine Erwärmung von mehreren Grad durch prozentual geringe Steigerungen des Treibhauseffektes verursacht werden (vgl. Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 30-35). Problematisch ist daher der verstärkende Treibhauseffekt durch den Menschen, der so genannte anthropogene Treibhauseffekt, ausgelöst durch die Gase Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4) und Lachgas bzw. Distickstoffoxid (N2O), wobei der Kohlendioxidanteil am größten ist. Hauptsächlich wird CO2 durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) ausgestoßen, Methan und Lachgas werden durch die Landwirtschaft verursacht (vgl. IPCC, 2007a: 2).
2.2 Tatsachen und Projektionen der Forschung über Änderungen des Klimas
Institutionen wie das IPCC oder auch die European Environment Agency (EEA) und weitere Arbeitsgemeinschaften von Wissenschaftlern veröffentlichen Forschungsberichte mit Klimadaten, Prognosen über das zukünftige Klima und dessen Auswirkungen. Klimaforschungen und deren Messdaten belegen inzwischen den schon im dritten Sachstandsbericht des IPCC aus dem Jahre 2001 deutlich gemachten Zusammenhang, dass der Anstieg der Durchschnittstemperatur sehr wahrscheinlich, d.h. größer als 90 Prozent, die Folge des durch den Menschen verursachten Anstiegs der Treibhausgaskonzentration vor allem in den letzten Jahrzehnten ist (vgl. IPCC, 2007a: 3-10). Wie dem vierten Sachstandsbericht des IPCC im Oktober 2007 zu entnehmen ist, gewinnen die Schätzungen der Wissenschaftler immer mehr an Sicherheit.
Beobachtete Klimaänderungen zeigen, dass der gesamte Temperaturanstieg vom Jahr 1850 bis 2005 0,76 Grad Celsius beträgt. „Elf der letzten zwölf Jahre (1995–2006) gehören zu den zwölf wärmsten Jahren seit der instrumentellen Messung der globalen Erdoberflächentemperatur[1] (seit 1850)“ (IPCC, 2007a: 5). Der Meeresspiegel ist von 1961 bis 2003 durchschnittlich um 1,8 Millimeter pro Jahr gestiegen. Die Ursachen liegen in der Abnahme der Gebirgsgletscher und Schneebedeckung, in der Abnahme der Eisschilde in der Antarktis und in Grönland sowie in der thermischen Ausdehnung. Abbildung 1 zeigt die beobachteten Änderungen der mittleren globalen Temperatur, des mittleren globalen Meeresspiegelanstiegs und der nordhemisphärischen Schneebedeckung im März und April bezogen auf das Mittel des Zeitraums 1961 bis 1990. Die Kreise entsprechen den jeweiligen Jahreswerten, die geglätteten Kurven stellen die über ein Jahrzehnt gemittelten Werte und die Schattierungen die geschätzten Unsicherheitsbereiche dar (vgl. IPCC, 2007a: 6).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Änderungen von Temperatur, Meeresspiegel und nordhemisphärischer Schneebedeckung (IPCC, 2007a: 6)
Bedeutende Niederschlagszunahmen wurden ebenfalls in großräumigen Regionen in der Zeit von 1900 bis 2005 beobachtet. Nordeuropa gehört u.a. zu diesen Regionen (vgl. IPCC, 2007a: 5-9).
Weitere Beobachtungen zeigen aufgrund von verbesserten Messtechnologien, dass die Gesamtheit der Klimabeiträge mit dem beobachteten Meeresspiegelanstieg weitestgehend übereinstimmt. Die Fläche der Permafrostschicht hat seit 1990 in der nördlichen Hemisphäre aufgrund von drei Grad Celsius gestiegenen Temperaturen um sieben Prozent abgenommen (vgl. IPCC, 2007a: 7-8). Permafrost ist dauerhaft, bis auf eine dünne Oberschicht im Sommer, gefrorener Erdboden, der durch Erwärmung auftaut (vgl. Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 60).
Während die Berichte des IPCC global ausgerichtet sind, beziehen sich die Berichte der EEA auf die europäischen Gebiete. Der technische Report aus dem Jahr 2005 informiert über die Verletzbarkeit der unterschiedlichen geographischen Gebiete und mögliche Anpassungsmaßnahmen (vgl. EEA-Report, 2005). Im Jahr 2000 wurde von Martin Parry in Zusammenarbeit mit der University of East Anglia, United Kingdom, und der Europäischen Kommission das ACACIA Projekt veröffentlicht, das besonders die Auswirkungen und Anpassungsmaßnahmen auf die unterschiedlichen europäischen Ökosysteme und Wirtschaftszweige untersucht (vgl. Parry, 2000). Auf die Ausführungen des EEA-Reports und des ACACIA Projekts wird in den folgenden Kapiteln Bezug genommen.
Die den o.g. Berichten zugrunde liegenden Szenarien entstammen dem IPCC Sonderbericht zu Emissionsszenarien aus dem Jahre 2000 (SRES-Szenarien). Daraus wurden Szenarien mit jeweils unterschiedlich möglichen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen ausgearbeitet, um zukünftige Klimaänderungen berechnen zu können. Hierbei wurden keine ausdrücklichen Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt.
Die im Anhang aufgeführte Abbildung 13 soll einen kurzen Überblick über die Szenarien verschaffen. Im schlechtesten Szenario A1F1 wird eine Vervierfachung der Emissionen bis zum Jahr 2100 angenommen und im besten Szenario B1 wird von einem moderaten Anstieg der Emissionen ausgegangen, „[…] gefolgt von einer allmählichen Abnahme auf einen Bruchteil der heutigen Werte“ (Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 48).
Unter Verwendung der SRES-Szenarien wurden Trends ermittelt, die auf Projektionen für das 21. Jahrhundert basieren. Wärmere und weniger kalte sowie wärmere und häufiger heiße Tage und Nächte über den meisten Landflächen gelten als praktisch sicher, was eine Wahrscheinlichkeit von größer als 99 Prozent bedeutet. Sehr wahrscheinlich (größer als 90 Prozent) nehmen die Wärmeperioden und Hitzewellen, definiert als zehn oder mehr Tage (vgl. Perry, 2000: 3) über den meisten Landflächen zu. Auch die Häufigkeit der Starkniederschlagsereignisse nimmt mit einer Wahrscheinlichkeit von größer als 90 Prozent zu. Weiterhin lassen sich mit einer Wahrscheinlichkeit von größer als 66 Prozent die steigende Aktivität starker Wirbelstürme in tropischen Gebieten vorhersagen sowie die Zunahme der von Dürre betroffenen Flächen und zunehmendes Auftreten von extrem hohem Meeresspiegel (vgl. IPCC, 2007a: 8).
Die einzelnen Klimaänderungen sind in unterschiedlich starker Weise durch die angestiegenen anthropogenen Treibhausgaskonzentrationen verursacht worden. Zusammenfassend kann jedoch festgestellt werden, dass letztere sehr wahrscheinlich den größten Teil der angestiegenen mittleren globalen Temperatur verursacht haben (vgl. IPCC, 2007a: 10-12).
Projektionen der Klimaänderung und die Abschätzung derer Wahrscheinlichkeiten für den Zeitraum 2000-2100 wurden anhand von Klimamodellen und den zusätzlichen Beobachtungen ermittelt. Dabei wurden die SRES-Musterszenarien und konstante Treibhausgaskonzentrationen zugrunde gelegt, die denen des Jahres 2000 entsprechen oder höher sind. Wie in Abbildung 2 zu sehen, verändert sich je nach Szenario die Temperatur unterschiedlich stark. Je nach Emissionsszenarien wird die mittlere globale Erwärmung bis zum Jahre 2100 innerhalb Bandbreiten[2] von 1,1 bis 6,4 Grad Celsius liegen. Hervorzuheben ist jedoch, dass die Berechnungen selbst bei auf dem Niveau vom Jahr 2000 konstanten Treibhausgaskonzentrationen eine Erwärmung von 0,1 Grad Celsius pro Jahrzehnt aufzeigen. Unabhängig von der Wahl des SRES-Szenarios wird die Erwärmung pro Jahrzehnt doppelt so hoch sein, wenn die Treibhausgaskonzentrationen innerhalb der Bandbreiten der Szenarien liegen. Dabei liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die jeweiligen Klimaänderungen größer als die im 20. Jahrhundert wären, bei über 90 Prozent. Dazu gehören u.a. folgende Projektionen: Die Niederschläge in den subtropischen Landregionen werden wahrscheinlich um 20 Prozent nach dem A1B Szenario bis 2100 abnehmen. Sehr wahrscheinlich nehmen die Anzahl der Hitzewellen und Starkniederschlagsereignisse zu. Bei auf die Szenarien B1 oder A1B stabilisierten Treibhausgaskonzentrationen im Jahre 2100 würde sich die mittlere globale Temperatur trotzdem noch um 0,5 Grad Celsius bis 2200 erhöhen. Der Meeresspiegel würde aufgrund der thermischen Ausdehnung noch von 0,3 bis 0,8 Meter bis zum Jahr 2300 ansteigen (vgl. IPCC, 2007a: 12-17). Die Szenarien und deren unterschiedlich hohen Temperatursteigerungen haben eine massive Bedeutung für die Auswirkungen und deren Folgen für die Umwelt und die sozioökonomischen Sektoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Multimodell-Mittel und geschätzte Bandbreiten für die Erwärmung an der Erdoberfläche (IPCC, 2007a: 14)
2.3 Bedeutungen des Klimawandels
Die im vorherigen Abschnitt aufgeführten Klimaänderungen beeinflussen jedes Gebiet oder jede Region in unterschiedlicher Weise. Die Verletzbarkeit, der Grad der Verwundbarkeit oder die Anfälligkeit einer Region wird in der Literatur als Vulnerabilität bezeichnet und ist abhängig von den Rahmenbedingungen und von der Anpassungsfähigkeit der Region. Sie sagt aus, wie stark eine Region von den Klimaänderungen betroffen ist und wie stark sie sich auswirken. Im IPCC Bericht der zweiten Arbeitsgruppe wird Vulnerabilität wie folgt definiert: „Verwundbarkeit zeigt an, inwieweit ein System für nachteilige Auswirkungen der Klimaänderungen, inklusive Klimaschwankungen und -extreme anfällig ist bzw. nicht fähig ist, diese zu bewältigen. Die Verwundbarkeit leitet sich ab aus dem Charakter, der Größenordnung und der Geschwindigkeit der Klimaänderung und -abweichung, der ein System ausgesetzt ist, ebenso wie aus der Empfindlichkeit und Anpassungskapazität dieses Systems“ (IPCC, 2007b: 38). Der EEA-Report enthält eine kürzere, aber sinngemäß gleiche Definition. (vgl. EEA-Report, 2005: 6).
Die „Anpassungsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Systems, sich auf Klimaänderungen (inklusive Klimaschwankungen und -extremen) einzustellen, um potenzielle Schäden abzuschwächen, Vorteile aus Möglichkeiten zu ziehen oder die Folgen zu bewältigen“ (IPCC, 2007b: 38).
Die in den o.g. Definitionen genannten Systeme meinen die natürliche Umwelt und die sozioökonomischen Sektoren. Dazu gehören Ökosysteme, Wasserressourcen, Boden- und Landressourcen, die Forst- und Landwirtschaft, Fischerei, das Versicherungswesen, Verkehrs-/Transport-, Energie- und andere Industrien, die Tourismus- und Freizeitbranche, das Gesundheitssystem, Küstenregionen und Gebirgsregionen. Jedes dieser Systeme wird von Temperatursteigerungen direkt oder indirekt betroffen sein, wie den Berichten des IPCC, der EEA und auch dem ACACIA Projekt zu entnehmen ist. Bei den natürlichen Systemen erscheinen die Auswirkungen, wie im Abschnitt zwei schon erläutert, als logische Folge. So können z.B. die Wasserressourcen in südlichen Regionen in Trockenzeiten knapper und durch Überflutungen verunreinigt werden. Ebenfalls besteht ein hohes Vertrauen, d.h. die Aussage ist in acht von zehn Aussagen richtig, in der Annahme einer Überschreitung der Widerstandskraft der Ökosysteme durch Auftreten von Störungen wie Dürre, Flächenbrände, Insekten, Ozeanversauerung und Überschwemmungen. Hinzu kommen die Übernutzung der Ressourcen und Änderungen der Landnutzung. 20 bis 30 Prozent der Tier- und Pflanzenarten sind wahrscheinlich vom Aussterben bedroht, wenn die Temperatur über 1,5 bis 2,5 Grad Celsius steigen wird. In der Land- und Forstwirtschaft kann es bei zunehmender Häufigkeit von Dürren und Überschwemmungen mit einem hohen Vertrauen zu einem negativen Einfluss auf die Produktion vor Ort kommen, insbesondere in den niedrigen Breiten in den Bereichen, in denen die Produktion existenziell ist. Küstenregionen und tief liegende Gebiete sind in besonderem Maße von Überschwemmungen, Küstenerosionen und dem Meeresspiegelanstieg bedroht. Hier besteht sehr hohes Vertrauen, d.h. die Aussage ist in neun von zehn Aussagen richtig. Durch die intensive Nutzung durch den Menschen, wird diese Gefahr noch verstärkt. Menschen, Ökosysteme und Industrien sind am verwundbarsten in Küsten- und Flussdeltaregionen und dort, wo die Urbanisierung schnell voranschreitet und die Menschen an klimatisch sensible Ressourcen wie z.B. Wasser und Boden gebunden sind.
Das Gesundheitssystem des Menschen wird ebenfalls in hohem Maße von den Auswirkungen betroffen sein. Menschen werden höheren Temperaturen, Hitzeperioden und Überschwemmungen, Stürmen und Bränden ausgesetzt sein, wodurch es zu erhöhter Sterblichkeit, Herz- und Atemwegserkrankungen, Verletzungen und Verbreitung von Krankheitserregern sowie in einigen Regionen zur Ausbreitung von Malaria kommen kann. Allerdings werden positive Ereignisse wie weniger Kältetode und weniger Rheumafälle eintreten. Für alle Vorhersagen besteht ein hohes Vertrauen.
Auch die Energieindustrie wird die steigenden Temperaturen zu spüren bekommen. Die Nachfrage nach Energie wird aufgrund des höheren Bedarfs und Einsatzes an Klimaanlagen steigen (vgl. IPCC, 2007b: 24-34).
Wie zu Beginn des Abschnittes erklärt, hängt das Ausmaß der Auswirkungen auf bestimmte Regionen und deren Systeme von der jeweiligen Vulnerabilität ab. Eine besonders verwundbare und anfällige Region ist zum Beispiel der Mittelmeerraum. Dessen Anfälligkeit und die Auswirkungen des Klimawandels auf bestimmte Regionen und den Tourismus im Mittelmeerraum werden in Kapitel vier gesondert erläutert. Vorab kann jedoch festgehalten werden, dass im Grunde alle oben bereits genannten Auswirkungen, die jedoch nur einen Auszug aus denen der Forschungsberichte darstellen, auch die Tourismusbranche beeinflussen.
2.4 Optionen, dem Klimawandel zu begegnen
Nach dem vorherigen Kapitel ist der Handlungsbedarf deutlich geworden. Wie unter Abschnitt 2.2 erläutert, kann eine Reduzierung der Emissionen eine Erwärmung des Klimas nicht grundsätzlich aufhalten, wohl aber weitere noch größere Folgen vermeiden. Die Politik, die Wirtschaft und letztlich auch jeder einzelne Mensch müssen daran arbeiten, die Treibhausgasemissionen soweit wie möglich zu reduzieren bzw. zu vermeiden und zusätzlich Anpassungsmaßnahmen an die veränderten klimatischen Bedingungen zu entwickeln und entsprechend umzusetzen. Deshalb ist es notwendig, dass so genannte Mitigations- und Adaptionsstrategien entwickelt werden. Mitigationsstrategien bezeichnen Maßnahmen, die Treibhausgasemissionen zu vermeiden, zu reduzieren und zu stabilisieren, um die Klimaänderungen zu begrenzen. Adaptionsstrategien bezeichnen Maßnahmen, die auf die Anpassung an sich verändernde Klimabedingungen abstellen und damit die Verwundbarkeit verringern (vgl. Smit et al., 1999: 200; Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 92).
Laut dem vierten IPCC Bericht besteht „[…] signifikantes wirtschaftliches Potenzial für die Minderung von globalen Treibhausgasemissionen über die nächsten Jahrzehnte, das den projizierten Zuwachs globaler Emissionen kompensieren oder die Emissionen unter die aktuellen Werte senken kann“ (IPCC, 2007c: 48). Diese Aussage der entsprechenden IPCC Autoren beruht auf hoher Übereinstimmung mit Aussagen in der Literatur sowie auf hoher Beweislage durch Menge und Qualität unabhängiger, den IPCC entsprechenden Quellen[3] (vgl. IPCC, 2007c: 48). Das wirtschaftliche Potenzial wird vom IPCC als Emissionsminderungspotenzial definiert, das soziale Kosten, Gewinne und Diskontraten mit einbezieht[4]. Dabei wird eine Verbesserung der Effizienz des Marktes durch Politiken und Maßnahmen sowie ein Hemmnisabbau angenommen (vgl. IPCC, 2007c: 47). Weiterhin besteht hohe Übereinstimmung sowie hohe Beweislage in der Aussage des IPCC, dass bei den derzeitigen Klimaschutzpolitiken und die damit verbundenen Maßnahmen die globalen Treibhausgasemissionen zunehmen werden (vgl. IPCC, 2007c: 43). Letzteres und die o.g. Annahmen deuten auf den Bedarf an konsequenten politischen Maßnahmen hin, damit die unterschiedlichen Wirtschaftssektoren handeln. Tabelle 1 zeigt die vom IPCC zusammengefassten Sektoren und deren möglichen Emissionsminderungstechnologien und –praktiken.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Schlüsseltechnologien und –praktiken zur Emissionsminderung nach Sektoren (IPCC, 2007c: 50)
Gerade im Verkehrssektor gibt es vielfältige Methoden zur Emissionsminderung, denen das Wachstum des Sektors sowie Verbrauchervorlieben und politische Rahmenbedingungen entgegenstehen (vgl. IPCC, 2007c: 54).
In Abbildung fünf nicht aufgeführte mögliche Änderungen des Lebensstils und Verhaltens können ebenfalls zur Emissionsminderung beitragen. Hierin besteht hohe Übereinstimmung und mittlere Beweislage (vgl. IPCC, 2007c: 52). Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungsprogramme sowie Maßnahmen zur Beeinflussung des Konsum- und Verkehrsverhaltens können helfen, das Klimawandelbewusstsein anzuregen sowie das Verhalten bzw. den Lebensstil zu ändern (vgl. IPCC, 2007c: 52-53).
Wie die Auswirkungen der Klimaprojektionen und deren Bedeutungen auch die Tourismusindustrie betreffen, stellen die Emissionsminderungspraktiken für die unterschiedlichen Sektoren ebenso für die Tourismusindustrie Anhaltspunkte der Klimaschutzpolitik dar.
Ein erstes durch die Politik umgesetztes Emissionsminderungsinstrument ist das Kyoto-Protokoll, das 1997 in Kyoto in Japan zur Umsetzung der Klimarahmenkonventionen der UNFCCC ratifiziert wurde und am 16. Februar 2005 in Kraft trat. Es berechtigt einige der Vertragsstaaten zu weiteren Emissionen und verpflichtet andere, die Emissionen bis 2012 um einen individuellen festgelegten Wert zu reduzieren. Dieses Instrument wird in den Medien sowie in der Fachliteratur stark kritisiert. Schlagzeilen wie „Kyoto ist nur der erste Schritt. Um die globale Erwärmung wirksam in Grenzen zu halten, sind weitaus drastischere Reduzierungen des CO2-Ausstoßes vonnöten“ oder „Meilenstein für den internationalen Klimaschutz oder Tropfen auf den heißen Stein?“ (Stern, 2005) erscheinen schon am Tage des Inkrafttretens des Protokolls. Britische Wissenschaftler behaupten, „es ist Zeit, das Abkommen über Bord zu werfen“ (sueddeutsche.de, 2007). Gründe für die Kritik sind die schwer nachvollziehbaren Berechnungen, die Reduktionsverpflichtungen, die als zu gering erachtet werden und somit nur einen ersten Schritt zur Halbierung der Emissionen bis 2050 bedeuten sowie die Zulassung der so genannten flexiblen Mechanismen (vgl. Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 104-106). Vertragsstaaten können durch den erlaubten Emissionshandel anderen Staaten Emissionsrechte abkaufen, wenn sie nicht in der Lage sind, die Emissionsgrenze einzuhalten. Der Mechanismus der gemeinsamen Umsetzung ermöglicht Industrieländern, Klimaschutzprojekte durchzuführen, wobei das Vorhaben in einem anderen Land realisiert wird, aber von dem Industrieland finanziert wird. Damit werden die eingesparten Emissionen dem Konto des Finanzierungslandes gutgeschrieben. Der Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklungen ähnelt dem eben genannten, mit dem Unterschied, das hier ein Industrie- und ein Entwicklungsland beteiligt sein müssen. Der Hintergrund des Emissionshandels beruht auf der Tatsache, dass es irrelevant ist, wo Treibhausgase emittiert und reduziert werden, weil sie sich über kurze Zeit in der Atmosphäre verteilen und dort dann über lange Zeit erhalten bleiben (vgl. UNFCCC, 2008). Der IPCC sieht in der Schaffung des Kyoto-Protokolls die Grundlage für zukünftige Anstrengungen zur Emissionsminderung (vgl. IPCC, 2007c: 64).
Insgesamt stehen den Regierungen viele Politiken und Instrumente zur Verfügung, die Anreize für Maßnahmen zur Emissionsminderung in den jeweiligen Sektoren schaffen könnten (vgl. IPCC, 2007c: 61). Aber auch freiwillige Maßnahmen und Projekte der Industrie sowie solcher, die in Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Regierung oder auch mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) erfolgen, haben zwar keine bedeutenden Emissionsrückgänge zur Folge, können aber die Bewusstseinsbildung der Menschen beeinflussen und zu Verhaltensänderungen führen (vgl. IPCC, 2007c: 62).
Nur Mitigationsmaßnahmen allein reichen nicht aus, dem Klimawandel zu begegnen, weil auch bei konstanten Treibhausgaskonzentrationen eine Erwärmung und deren Auswirkungen aufgrund der Emissionen aus der Vergangenheit nicht mehr zu vermeiden sind. Aus diesem Grund sind für das Bewältigen kurzfristiger Folgen Anpassungsmaßnahmen nötig (vgl. IPCC, 2007b: 35;37). Lt. dem IPCC wurden bereits Anpassungen an beobachtete und zukünftige Auswirkungen durchgeführt, die jedoch noch umfangreicher werden müssen, um die Verwundbarkeit gegenüber den projizierten Klimaänderungen zu reduzieren. Die Hemmnisse beruhen auf Unsicherheiten über den Erfolg bzw. Grenzen der Maßnahmen bzgl. der Risikoverringerung, die von den geografischen und klimatischen Gegebenheiten der Region sowie von politischen und finanziellen Rahmenbedingungen abhängen. Der IPCC sieht viele Möglichkeiten, Anpassungen umzusetzen. Dazu gehören technologische, wie z.B. Schutzbauten am Meer, Änderungen der Wirtschaftspraxis sowie Änderungen im Konsum- und Freizeitverhalten (vgl. IPCC, 2007b: 35). Tabelle 2 beinhaltet die vom IPCC zusammengestellten Anpassungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Sektoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Anpassungsoptionen für verwundbare Sektoren (IPCC, 2007d: 70)
Die Verwundbarkeit kann durch nichtklimatische Belastungen, sog. Stressfaktoren, erhöht und dadurch die Anpassungsfähigkeit an die Auswirkungen des Klimawandels reduziert werden. Derzeitige Klimagefahren, Armut und Trends der wirtschaftlichen Globalisierung zählen z.B. zu solchen Stressfaktoren. Sie sind bedeutende Faktoren in den unterschiedlichen SRES-Szenarien für das Betroffenheitsrisiko der Menschen. So ist das Risiko der Überflutungen für Menschen im Szenario A2 deutlich größer als in anderen Szenarien. Weiterhin kann eine nachhaltige Entwicklung die Verwundbarkeit vermindern, indem die Anpassungsfähigkeit erhöht wird. Allerdings wird aufgrund der projizierten Klimaänderungen von einer Verlangsamung der nachhaltigen Entwicklung ausgegangen (vgl. IPCC, 2007b: 36-37).
Um die Reduzierungen der Emissionen zu realisieren und Anpassungen an die Klimaänderungen vorzunehmen, sind Strategien nötig, die Minderung und Anpassung in die Entwicklungsplanung mit einbeziehen, um auf die Veränderungen vorbereitet zu sein und mögliche Chancen nutzen zu können.
3. Tourismus im Mittelmeerraum
Der Tourismus im Mittelmeerraum ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Um dies zu verdeutlichen, soll zunächst ein Überblick über das touristische System und die Beteiligten geschaffen werden.
Der Begriff Tourismus umfasst einen sehr breiten Bezugsrahmen. Selbst in der Literatur findet sich eine ganze Reihe von Definitionen. Die Europäische Kommission und die United Nations World Tourism Organization (UNWTO) definieren Tourismus folgendermaßen: „Tourismus ist die Tätigkeit von Personen, die zu Orten außerhalb ihrer gewohnten Umgebung reisen und sich dort höchstens ein Jahr lang zu Urlaubs-, geschäftlichen oder anderen Zwecken aufhalten“ (vgl. Becken & Hay, 2007: 10; Eurostat, 2007a: 1).
Während die zeitliche Dauer eine nachrangige Bedeutung einnimmt, ist der Ortswechsel das prägende Kriterium. Ein Blick bezüglich der Entwicklung des Tourismus in das Altertum kann schon aufweisen, dass Sporttourismus bereits 770 v. Chr. zur Olympiade stattgefunden hat. Der Tourismus, wie wir ihn heute kennen, besteht seit den 1960er Jahren. Er hat sich seit dem 19. Jahrhundert von einem Luxusgut bis heute zu einem existenziellen Gut entwickelt (vgl. Kaspar, 1998: 18-21).
Die heutigen Formen und Arten lassen je nach Zweck und Motivation, Entfernung oder Dauer, Art der Reise alle möglichen Bezeichnungen und Kombinationen zu (vgl. Becken & Hay, 2007: 87). So lassen sich bspw. nach dem Kriterium der Motivation folgende Tourismusarten unterscheiden: Erholungstourismus, kulturorientierter Tourismus, Bildungs- und Alternativtourismus, gesellschaftsorientierter Tourismus, aktiver und passiver Sporttourismus, wirtschaftsorientierter Tourismus (z.B. Geschäftsreisen, Messe- und Kongresstourismus), politikorientierter Tourismus (vgl. Kaspar, 1998:18-19).
3.1 Ein Überblick über das touristische System und dessen Institutionen
Aus der o.g. Definition des Tourismus lässt sich ableiten, dass die Personen, die den Ortswechsel vornehmen, als Touristen bezeichnet werden können. Im allgemeinen Sprachgebrauch verbindet man den Begriff des Touristen mit Freizeit und Freizeitbeschäftigung, die keinen Arbeitsbezug aufweist. Die Definition der UNWTO integriert Geschäftsreisende und Verwandtenbesucher in den Begriff des Touristen aufgrund der Nutzung derselben Infrastruktur und Leistungen bzw. Services (vgl. Becken & Hay, 2007: 87).
Die Touristen tätigen vor, während und nach ihrer Reise Konsumausgaben, die auch intangible Produkte wie z.B. Erlebnisse und Entspannung beinhalten. Diese Konsumausgaben fließen in die Gesamtheit der Geschäfte ein, die touristische Produkte oder Services anbieten, in die so genannte Tourismusindustrie. Der Tourismussektor beinhaltet zusätzlich die Leistungen der Regierungen und Gemeinden und der Umwelt. Das touristische System nach heutiger Auffassung ist als komplexes, adaptives System anzusehen, das wie ein natürliches Ökosystem aus vielen Einzelkomponenten besteht und eben auch von externen Faktoren und Ressourcen, wie z.B. dem Klima, abhängig ist (vgl. Becken & Hay, 2007: 10-12). Die touristische Struktur und Entwicklung wird von der ökonomischen, soziokulturellen, politischen, technologischen und ökologischen Umwelt beeinflusst (vgl. Kaspar, 1998: 22-26).
Der Tourismussektor besteht aus Institutionen wie den Tourismusorten selbst, Tourismusunternehmen und touristische Organisationen wie z.B. die internationale Organisation United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Typische Unternehmen sind z.B. Reiseveranstalter (vgl. dazu Kapitel fünf), Hotels und Gastronomiebetriebe, Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen. Das Merkmal für ein Tourismusunternehmen ist, dass es die Existenzgrundlage aus dem Tourismus zieht und seine Leistungen hauptsächlich diesem dienen (vgl. Kaspar, 1998: 31). Das touristische Angebot kann von den Klimaänderungen, wie in Kapitel vier und fünf aufgeführt, in hohem Maße betroffen sein (zu den natürlichen Bedingungen des Angebots siehe Althof, 2001: 88-96). Es setzt sich aus dem ursprünglichen und dem abgeleiteten Angebot zusammen. Ersteres beinhaltet vor allem die natürlichen Gegebenheiten einer Region sowie die allgemeine Infrastruktur, letzteres die örtlichen Einrichtungen sowie die touristische Infrastruktur[5] (vgl. Kaspar, 1998: 29-31). Ein Hauptbestandteil des Angebots ist das Reiseziel bzw. die Destination. Sie ist der geographische Raum, der als Reiseziel ausgewählt wird und als Gesamtkonstrukt betrachtet, Anbieter, Nachfrager, Produkte und Dienstleistungen verbindet (vgl. Breidenbach, 2002: 41). Die Destination bildet letztlich auch das touristische Produkt, das aus Einzelleistungen wie Beförderung, Beherbergung, Reiseleitung und der Souvenirindustrie besteht (vgl. Breidenbach, 2002: 43).
3.2 Die touristische Bedeutung des Mittelmeerraums
Der Mittelmeerraum gehört zu den meist bereisten touristischen Gebieten weltweit. Wie Tabelle 3 zu entnehmen ist, verzeichnet das Gebiet Südeuropa/Mediterranes Europa mit circa 165 Millionen internationalen touristischen Ankünften im Jahr 2006 fast so viele wie das gesamte Gebiet Asien und Pazifik.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: International Tourist Arrivals World (UNWTO, 2007: 3)
Die Länder Frankreich, Spanien und Italien gehören zu den fünf meist bereisten Ländern der Welt. Betrachtet man zusätzlich die internationalen touristischen Einkünfte, werden diese drei genannten Länder in der Top-Ten Liste um die Türkei an neunter Stelle erweitert (vgl. Tabelle 4).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: International Tourist Arrivals World’s Top 10 (UNWTO, 2007: 5)
Betrachtet man Europa, dann stellt der Mittelmeerraum sogar das meistbereiste Gebiet dar, repräsentiert durch Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, Kroatien und die Türkei (vgl. Tabelle 5). Dabei kommt der Haupttouristenstrom aus dem nördlichen Europa (vgl. Gössling, 2006: 184-185). Die nordafrikanischen Mittelmeeranrainerländer Tunesien und Marokko tragen mit jeweils circa 6,5 Millionen internationalen touristischen Ankünften zu den Ankünften insgesamt im Jahr 2006 mit bei (vgl. UNWTO, 2007: 9)[6].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 5: International Tourist Arrivals Europe (UNWTO, 2007: 6)
Die Tabellen belegen zahlenmäßig die touristische Bedeutung der Mittelmeerländer. Die Beliebtheit des Mittelmeerraumes ist begründet durch die jeweils unterschiedlichen Kulturen der geschichtsträchtigen Länder und deren Städte, vor allem aber durch das mediterrane Klima (vgl. dazu auch 4.1). Dies ist durch kontrastreiche Temperaturen im Sommer und Winter, durch Niederschläge im Herbst und Winter sowie durch subtropische Vegetation gekennzeichnet. Die Wintermonate sind mild und feucht, während die Sommermonate trockenes und warmes Klima aufweisen (vgl. Begni, 2003: xv). Die kontrastreichsten Monate Oktober und November im Vergleich zu dem nordeuropäischen Klima weisen acht bis zehn Grad Celsius höhere Temperaturen als z.B. in London auf (vgl. Perry, 2000: 2-3). Bereits im 19. Jahrhundert reisten Aristokraten und seit dem letzten Jahrhundert ältere Menschen an das Mittelmeer, um den dunklen Wintermonaten zu entfliehen (vgl. Perry, 2005: 86;94). Das mediterrane Klima wird besonders von älteren Menschen als gesundheitsfördernd empfunden (vgl. Parry, 2000: 223). Seit den 1950er Jahren hat sich die Hauptsaison des Tourismus in Form von Erholungs-, Sonnen- und Badeurlaub auf die Sommermonate verlagert und sich zu einem Massentourismus entwickelt. Dabei sind das Genießen der Sonne und Wärme sowie der Strand als Entspannungs- und Unterhaltungsort in den Vordergrund gerückt (vgl. Perry, 2000: 1-2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Dichte der touristischen Nachfrage (Eurostat, 2002: 4)
Abbildung 3 macht bereits anhand der südeuropäischen Mittelmeerländer deutlich, dass die touristische Nachfragedichte in den meisten Mittelmeerregionen mindestens im Bereich zwischen sieben und fünfzehn Übernachtungen pro Einwohner liegt.
3.3 Ökonomische Bedeutungen des Tourismus im Mittelmeerraum
Tabellen 6 und 7 zeigen die internationalen touristischen Einnahmen der europäischen und nordafrikanischen Länder im Mittelmeerraum von Jahr 1990 bis 2005. Die enorme wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus am Mittelmeer wird deutlich, wenn man die gesamten europäischen internationalen touristischen Einnahmen in Relation zu denen des mediterranen Raums betrachtet. Der Marktanteil des mediterranen Raums an den gesamten internationalen touristischen Einnahmen in Europa im Jahr 2005 beträgt 40,3 Prozent. Innerhalb der mediterranen Länder in Europa haben Spanien (13,8 Prozent) und Italien (10,2 Prozent) den höchsten Marktanteil.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 6: International Tourism Receipts Europa in Euro (UNWTO, 2006a)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 7: International Tourism Receipts North Africa in Euro (UNWTO, 2006b)
Frankreich wird von der UNWTO unter den westeuropäischen Ländern aufgeführt und erzielt neben dem Mittelmeertourismus seine touristischen Einnahmen u.a. aus Regionen wie dem Alpen- und Atlantikraum sowie aus dem Städtetourismus und Binnenregionen wie z.B. dem Elsass. Der Marktanteil beträgt 12,1 Prozent an den gesamten europäischen touristischen Einnahmen (vgl. UNWTO, 2006a).
Die nordafrikanischen Mittelmeeranrainerländer haben einen Marktanteil von circa einem Drittel an den gesamten internationalen touristischen Einnahmen in Afrika, wobei die Einnahmen des Landes Marokko auch aus dem touristischen Atlantikgebiet erzielt werden.
Indikatoren für den Wirtschaftsfaktor Tourismus sind z.B. der prozentuale Anteil der internationalen touristischen Einnahmen an dem Bruttoinlandsprodukt eines Landes sowie, europabezogen, der Anteil der internationalen touristischen Übernachtungen in einem Land an den gesamten internationalen Übernachtungen der Länder der Europäischen Union. In Spanien beträgt der Anteil aus internationalen touristischen Einnahmen am Bruttoinlandsprodukt für das Jahr 2005 4,3 Prozent sowie 12,2 Prozent an den gesamten EU-Übernachtungen. Griechenland erwirtschaftet 6,1 Prozent des BIP durch den Tourismus und hat einen Anteil von 4,6 Prozent an den Gesamtübernachtungen. Auf der Insel Zypern beträgt der BIP Anteil sogar 13,8 Prozent und der Anteil an den Gesamtübernachtungen 1,6 Prozent. Frankreich ist weniger stark vom Tourismus abhängig, der BIP Anteil beträgt 2,0 Prozent, allerdings finden dort 12,2 Prozent der gesamten internationalen touristischen Übernachtungen in der EU statt (vgl. Eurostat, 2005: 46-48; 50-51).
Insgesamt verzeichnen die Mittelmeerländer wie z.B. Spanien (+4 Prozent), Griechenland (+9 Prozent) und Italien (+12 Prozent), Marokko (+12 Prozent) und Tunesien (+4 Prozent) von dem Jahr 2005 auf 2006 Wachstumszahlen. Italien hat das große Plus unter anderem der Austragung der olympischen Winterspiele 2006 in Turin zu verdanken (vgl. UNWTO, 2007: 6;9). Auch in Zukunft wird ein stetiges Wachstum des Mittelmeertourismus erwartet, auch wenn der Marktanteil aufgrund des steigenden Wachstums des asiatischen und pazifischen Raums leicht zurückgeht (vgl. UNWTO, 2007: 11).
Aus der wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus in dem Land oder der Region lässt sich auch auf die Beschäftigungswirkung indirekt oder unmittelbar schließen. Der Tourismus schafft Arbeitsplätze im Zielgebiet in der touristischen Infrastruktur, aber eben auch indirekt in Ländern, in denen die Vermittlung der Reisen stattfindet. Je größer der Wirtschaftsfaktor Tourismus ist, desto mehr Menschen werden denselben als Arbeitgeber haben und auch von diesem abhängig sein. In der Europäischen Union sind circa zwei Millionen Unternehmen in der Tourismusbranche tätig, deren Anteil am BIP und an der Beschäftigung circa fünf Prozent beträgt (vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2001: 4). Insgesamt sind in Europa neun Millionen Menschen in der Tourismusindustrie beschäftigt, in Griechenland z.B. sind 10,0 Prozent der Beschäftigten in der Tourismusindustrie tätig (vgl. Parry, 2000: 218), in Spanien 9,5 Prozent (vgl. Viner & Agnew, 1999: 23).
Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsfaktor sind die Multiplikatoreffekte, ausgelöst über die Einkommenswirkung. (vgl. Kaspar, 1998: 23). Durch die Ausgaben der Touristen in der jeweiligen Region profitieren die örtlichen Unternehmen direkt oder indirekt von dem Tourismus, woraus steigende Einnahmen und damit steigende Einkommen und Ausgaben der Beschäftigten resultieren. Die dadurch entstehende Produktionsfunktion des Tourismus löst also einen Wertschöpfungseffekt über alle Stufen aus, der wiederum eine Erhöhung der Steuereinnahmen nach sich zieht. Der Wertschöpfungseffekt ist die Schaffung eines Wertzuwachses, der als Summe der Bruttolöhne und Bruttogehälter zuzüglich der Arbeitgeberanteile an den Sozialbeiträgen definiert werden kann und damit direkt einkommenswirksam ist (vgl. Althof, 2001: 138).
Der Anteil des Reiseverkehrs an den gesamten Dienstleistungen eines Landes weist die Zahlungs- bzw. Devisenbilanz eines Landes auf. So lag die Europäische Union im Jahre 2005 hinsichtlich der Einnahmen (Ausgaben der Ausländer in der EU) auf dem zweiten und hinsichtlich der Ausgaben (Ausgaben der Bürger der EU im Ausland) im Reiseverkehr auf dem ersten Platz (vgl. Eurostat, 2007b: 1-2). Der Kapitaltransfer aus der touristischen Nachfrage in den südlichen Ländern des Mittelmeerraums kommt zum großen Teil aus den nordeuropäischen Regionen (vgl. Perry, 2000: 1-2).
Eine weitere ökonomische Funktion kann der Tourismus durch den Ausgleich zwischen der übrigen Wirtschaft und dem Tourismus erfüllen, wenn strukturschwache Regionen touristisch erschlossen werden und dadurch neue Erwerbschancen für die Bevölkerung entstehen (vgl. Althof, 2001: 137). So können z.B. die Touristenströme aus Industrieländern in die Entwicklungsländer zur Wohlstandverteilung beitragen (Becken & Hay, 2007: 262).
4. Auswirkungen des Klimawandels auf touristische Regionen im Mittelmeerraum
Wie in Kapitel zwei erläutert, wirken sich die Projektionen der Klimaänderungen in Abhängigkeit von der Verwundbarkeit und der Anpassungskapazität der einzelnen Regionen unterschiedlich auf die verschiedenen Destinationen aus (vgl. Giupponi & Shechter, 2003: 226). Im Rahmen dieses Kapitels werden zunächst die allgemeinen Auswirkungen auf den Mittelmeerraum beschrieben und anschließend die touristischen Auswirkungen erläutert. Aufgrund der Ähnlichkeit der Auswirkungen in den einzelnen Mittelmeerregionen werden für einige Auswirkungen Beispielregionen aufgeführt und spezifische Auswirkungen auf einzelne Regionen separat erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die beschriebenen Auswirkungen keine ersten Vermeidungs- und Anpassungsmaßnahmen beinhalten. Die möglichen Folgen für den Tourismus werden aufgrund der Auswirkungen abgeleitet und erläutert.
4.1 Der Mittelmeerraum und dessen Verwundbarkeit
150 bis 250 Millionen Bewohner zählt der Mittelmeerraum, je nach der Miteinbeziehung des Hinterlandes der jeweiligen Küsten. Das Bevölkerungswachstum konzentriert sich auf die südöstlichen Länder, wobei an den nördlichen Küsten eher ein Einwanderungsverhalten in den städtischen Gebieten zu verzeichnen ist (vgl. EEA-Report, 2005: 62). 70 Prozent der Bevölkerung der Mittelmeerländer leben heute an den Küstenzonen, die 80 Prozent der industriellen und 90 Prozent der touristischen Einnahmen der Länder generieren (vgl. Georgas, 2003: 225). Mehr als 70 Prozent des Küstenabschnittes von Barcelona bis Neapel sind bis zum Jahre 2000 urbanisiert worden. In Italien sind 29 Prozent des Küstengebietes frei von Bebauung. Tunesien weist 140 mit Hotels und Zweitwohnsitzen bebauten Küstenkilometer auf, 220 Kilometer urbanisierte Küste haben einen Anteil von circa 18 Prozent an der gesamten Küste Tunesiens (vgl. WWF, 2001; de Stefano, 2004).
Das Mittelmeer selbst ist 3.800 Kilometer lang, 400 bis 740 Kilometer breit. Der jährlich sinkende Niederschlag liegt durchschnittlich zwischen 200 Millimeter und 600 Millimeter. Davon fällt der Hauptteil des Regens im Herbst und Winter, während sehr wenig bis gar kein Regen in den trockenen Sommermonaten fällt. Die Trockenzeit kann von einem Monat bis zu sechs Monaten andauern. Letzteres lässt auf teilweise anpassungsfähige Vegetation schließen (vgl. EEA-Report, 2005: 62).
Die hohe Verwundbarkeit bzw. Anfälligkeit des Mittelmeerraums bezüglich des Klimawandels ergibt sich durch die Kombination aus steigenden Temperaturen, weniger Niederschlag, der hohen Bevölkerungsdichte, dem hohen Tourismusaufkommen an den Küstenregionen und der weiter voranschreitenden Urbanisation. Gerade in den Sommermonaten ist die Nachfrage nach Wasser für die Landwirtschaft, die Bevölkerung und für den Tourismus am höchsten. Das Risiko der Wasserknappheit lässt sich kaum vermeiden, wenn der Trend der steigenden Wassernachfrage durch die wachsende Bevölkerung sowie zusätzlich durch das steigende Tourismusaufkommen von weiterhin sinkenden Niederschlägen in der Zukunft begleitet wird (vgl. EEA-Report, 2005: 63-66)[7].
4.2 Der Forschungsstand der Auswirkungen des Klimawandels im Mittelmeerraum
Seit dem vierten Sachstandsbericht des IPCC sind nun durch neue Forschungsarbeiten genauere Informationen bezüglich der Auswirkungen auf viele Systeme und Sektoren verfügbar (vgl. IPCC, 2007b: 31). Aufgrund der durch den vierten Sachstandsbericht bestätigten Projektionen bzw. präzisierten Auswirkungen des dritten Sachstandsberichts können auch die Aussagen des EEA-Reports aus dem Jahre 2005 für noch vertrauenswürdiger erachtet werden, weil diese auf wissenschaftlichen Forschungsberichten der am IPCC beteiligten Autoren und auf dem dritten Sachstandsbericht des IPCC basieren. Sie bestätigen die Aussagen und Zusammenfassungen von Martin Parry im europäischen ACACIA Project aus dem Jahre 2000, die unter anderem auf dem zweiten Bericht des IPCC und des EEA basieren.
Der Mittelmeerraum ist aufgrund der bereits stattfindenden Auswirkungen, der Projektionen und der begrenzten Anpassungsfähigkeit eine der anfälligsten Regionen Europas (vgl. EEA-Report, 2005: 26-27;57;62). Je nach Lage des betrachteten Raums, Inland oder Küstenlage, werden durchschnittliche Temperatursteigerungen von zwei Grad Celsius bis zum Jahre 2060 erwartet, die auf Berechnungen der A2 und B2 Szenarien basieren (vgl. Giannakopoulos et al., 2005: C). Die Temperatursteigerungen wirken sich im Sommer (plus vier Grad Celsius) und im Herbst (plus zwei bis drei Grad Celsius) am stärksten aus. Im Winter und Frühling werden Steigerungen von bis zu zwei Grad Celsius erwartet. In Abhängigkeit von der Lage der Region werden circa drei bis vier Wochen mehr Sommertage hinzukommen sowie ein bis drei Wochen zusätzlich heiße Tage, an denen die Temperatur höher als 30 Grad Celsius sein wird. Ebenso wird die Anzahl der tropischen Nächte steigen, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius sinken. Die Anzahl der Frostnächte mit Temperaturen unter Null Grad Celsius werden um ein bis zwei Wochen an der Küste sinken sowie um circa vier Wochen im Inneren des Landes. Die Häufigkeit und Intensität der Niederschläge nimmt insgesamt ab, wobei hier die Jahreszeit und Lage der Region besonders bedeutend sind. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Sommer noch trockener werden und der meiste Regen im Winter fallen wird (vgl. Giannakopoulos et al., 2005: 14-33). Die im Anhang aufgeführte Tabelle 10 zeigt einen Überblick über die Temperatur- und Niederschlagsänderungen in den unterschiedlichen Mittelmeerländern.
[...]
[1] „Der Durchschnitt der bodennahen Lufttemperatur über dem Land und der Meeresoberflächentemperatur“ (IPCC, 2007a: 5).
[2] Die Bandbreiten ergeben sich aus der Klimasensitivität, die eine Maßzahl für den Anstieg der Temperatur bzw. Reaktion des Klimasystems in Abhängigkeit von dem Strahlungsantrieb ist. Letzterer bezeichnet die Stärke der Wirkung der Treibhausgaskonzentration (vgl. Rahmstorf & Schellnhuber, 2007: 42; IPCC, 2007a: 12).
[3] Vgl. dazu die Darstellung von Unsicherheiten der IPCC Aussagen Abbildung 14 im Anhang.
[4] Vgl. dazu Detailinformationen IPCC, 2007c: 47.
[5] Die touristische Infrastruktur beinhaltet alle Einrichtungen, die von Touristen genutzt werden können wie z.B. Hotels, Restaurants, Kino, Schwimmbad, Ärzte, Polizei (vgl. Althof, 2001: 97).
[6] Das Mittelmeeranrainerland Ägypten wird in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt, weil der Tourismus dort größtenteils am Roten Meer und am Nil stattfindet und die UNWTO Ägypten deshalb zu den Ländern des Nahen Ostens rechnet (vgl. UNWTO, 2007: 9).
[7] Zu weiteren Determinanten des Wasserangebots und der Wassernachfrage siehe EEA-Report, 2005: 64-65.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836621748
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Leuphana Universität Lüneburg – Fakultät Wirtschafts-, Verhaltens- und Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, Abt. Empirische und angewandte Tourismuswissenschaft und Tourismusmanagement
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- klimawandel tourismus mitigation reiseveranstalter mittelmeerraum
- Produktsicherheit
- Diplom.de