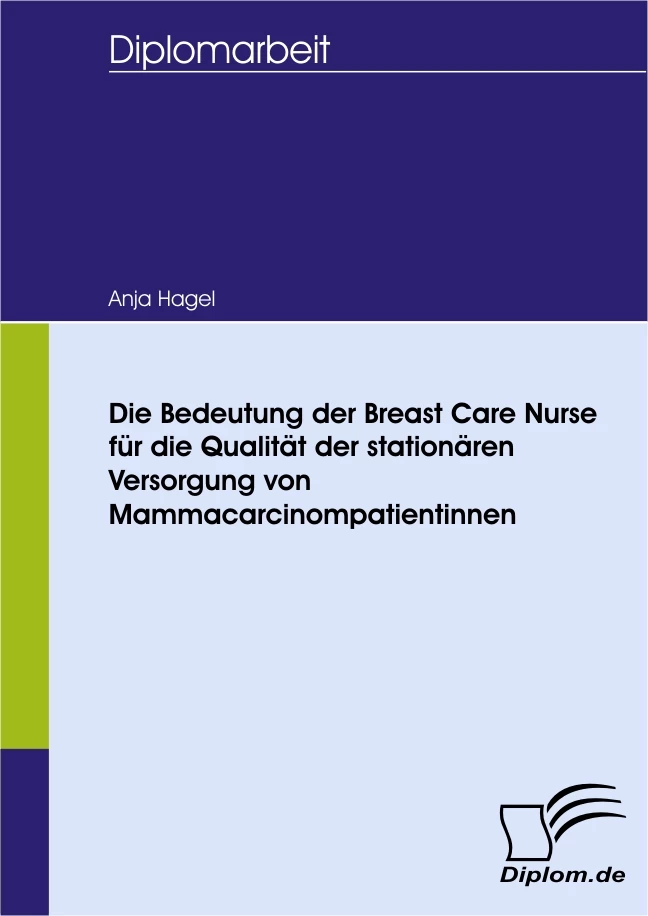Die Bedeutung der Breast Care Nurse für die Qualität der stationären Versorgung von Mammacarcinompatientinnen
©2008
Diplomarbeit
79 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Die demographische Entwicklung in Deutschland lässt einen enormen Zuwachs der älteren Bevölkerung erwarten. Chronische Erkrankungen wie Krebserkrankungen nehmen im Alter stark zu und werden deshalb in Zukunft vermehrt unsere Aufmerksamkeit fordern. Weltweit erkrankten nach Schätzungen der WHO im Jahr 2000 über eine Million Frauen an einem Mammacarzinom. Die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung von Brustkrebspatientinnen ist damit zu einer großen medi-zinischen und gesundheitspolitischen Herausforderung geworden. Die deutschen Krankenhäuser sind jedoch zunehmend mit ökonomischen Sachzwängen, wie knappen Ressourcen und der Einführung des DRG-Systems, konfrontiert. Wirtschaftlichkeitssteigerungen und Qualitätsver-besserungen sowie Effizienzerhöhung sind Grundvoraussetzungen, um als Unternehmen am Markt bestehen zu können. Darüber hinaus zwingen die rechtlichen Rahmenbedingungen die Leistungserbringer zur Qualitätssicherung. Die freiwillige Teilnahme an Zertifzierungen, die die Qualität der Dienstleistung mitarbeiter- und kundenorientiert in den Vordergrund stellen, nutzen viele Kliniken als Mittel der Außendarstellung und somit als Marketinginstrument. Die Rolle der Pflegenden ist maß-geblich durch den Anteil, den sie im Wertschöpfungsprozess Kranken-behandlung leisten, definiert. Der immer komplexer werdendenDynamik in der Versorgung der Patienten begegnet die Pflegewissenschaft in den letzten Jahren mit Weiterbildungsmaßnahmen, die Pflegefachkräfte zu spezialisierten Pflegefachkräften werden lassen. Als Beispiel wird in dieser Arbeit die Tätigkeitder Breast Care Nurse mit ihrer Wirkung auf die Versorgungsqualität von Brustkrebspatientinnen dargestellt, um folgende Frage zu untersuchen: Können speziell ausgebildete Breast Care Nurses den Patientinnen und Kliniken in der Qualitätssteigerung und -darstellung dienen? Dies impliziert auch die ökonomischen Facetten der Wirkung eines Imagegewinns durch eine gelungene Außendarstellung - denn: Fallzahlen sind die Lebensader der Kranken-häuser.
Die vorliegende Arbeit behandelt zunächst die Erkrankung Brustkrebs mit ihrer Epidemiologie sowie die Krankheitsverarbeitung. Dabei bildet im Besonderen die Recherche zu den Bedürfnissen der betroffenen Patientinnen deren Versorgungswunsch ab. Der Darstellung der Versorgungswirklichkeit folgt das Aufzeigen von Versorgungslücken, wobei die psychosoziale Betreuung im Vordergrund steht. Darüber hinaus wird den Pflegenden […]
Die demographische Entwicklung in Deutschland lässt einen enormen Zuwachs der älteren Bevölkerung erwarten. Chronische Erkrankungen wie Krebserkrankungen nehmen im Alter stark zu und werden deshalb in Zukunft vermehrt unsere Aufmerksamkeit fordern. Weltweit erkrankten nach Schätzungen der WHO im Jahr 2000 über eine Million Frauen an einem Mammacarzinom. Die bestmögliche medizinische und pflegerische Versorgung von Brustkrebspatientinnen ist damit zu einer großen medi-zinischen und gesundheitspolitischen Herausforderung geworden. Die deutschen Krankenhäuser sind jedoch zunehmend mit ökonomischen Sachzwängen, wie knappen Ressourcen und der Einführung des DRG-Systems, konfrontiert. Wirtschaftlichkeitssteigerungen und Qualitätsver-besserungen sowie Effizienzerhöhung sind Grundvoraussetzungen, um als Unternehmen am Markt bestehen zu können. Darüber hinaus zwingen die rechtlichen Rahmenbedingungen die Leistungserbringer zur Qualitätssicherung. Die freiwillige Teilnahme an Zertifzierungen, die die Qualität der Dienstleistung mitarbeiter- und kundenorientiert in den Vordergrund stellen, nutzen viele Kliniken als Mittel der Außendarstellung und somit als Marketinginstrument. Die Rolle der Pflegenden ist maß-geblich durch den Anteil, den sie im Wertschöpfungsprozess Kranken-behandlung leisten, definiert. Der immer komplexer werdendenDynamik in der Versorgung der Patienten begegnet die Pflegewissenschaft in den letzten Jahren mit Weiterbildungsmaßnahmen, die Pflegefachkräfte zu spezialisierten Pflegefachkräften werden lassen. Als Beispiel wird in dieser Arbeit die Tätigkeitder Breast Care Nurse mit ihrer Wirkung auf die Versorgungsqualität von Brustkrebspatientinnen dargestellt, um folgende Frage zu untersuchen: Können speziell ausgebildete Breast Care Nurses den Patientinnen und Kliniken in der Qualitätssteigerung und -darstellung dienen? Dies impliziert auch die ökonomischen Facetten der Wirkung eines Imagegewinns durch eine gelungene Außendarstellung - denn: Fallzahlen sind die Lebensader der Kranken-häuser.
Die vorliegende Arbeit behandelt zunächst die Erkrankung Brustkrebs mit ihrer Epidemiologie sowie die Krankheitsverarbeitung. Dabei bildet im Besonderen die Recherche zu den Bedürfnissen der betroffenen Patientinnen deren Versorgungswunsch ab. Der Darstellung der Versorgungswirklichkeit folgt das Aufzeigen von Versorgungslücken, wobei die psychosoziale Betreuung im Vordergrund steht. Darüber hinaus wird den Pflegenden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Anja Hagel
Die Bedeutung der Breast Care Nurse für die Qualität der stationären Versorgung von
Mammacarcinompatientinnen
ISBN: 978-3-8366-2159-5
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Hamburger Fern-Hochschule, Hamburg, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Hagel, Anja 1081301
2/77
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS... 5
ABBILDUNGSVERZEICHNIS ... 7
1 EINLEITUNG ... 8
1.1
Problemstellung ... 8
1.2
Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit... 9
2 EPIDEMIOLOGIE DES MAMMACARZINOMS ... 10
2.1
Inzidenz ... 10
2.1.1
Begriff ... 10
2.1.2
Inzidenz des Mamacarzinoms in Deutschland ... 10
2.2
Prävalenz... 11
2.2.1
Begriff ... 11
2.2.2
Prävalenz des Mammacarzinoms... 12
2.3
Mortalität ... 12
2.3.1
Begriff ... 12
2.3.2
Mortalität des Mammacarzinoms in Deutschland ... 12
3 DIE BEWÄLTIGUNG DER DIAGNOSE ,,BRUSTKREBS"... 14
3.1
Therapieverlauf ... 14
3.2
Depression und Angst ... 14
3.3
Das posttraumatische Belastungssyndrom ... 16
3.4
Die Bedürfnisse betroffener Patientinnen ... 17
3.4.1
Ergebnisse der Literaturstudie... 17
3.4.2
Eine eigene Erhebung der subjektiven Befindlichkeit von
Brustkrebspatientinnen... 20
4 AKTUELLE VERSORGUNGSSITUATION UND IHRE LÜCKEN ... 23
4.1
Prävention ... 23
4.1.1
Begriff ... 23
4.1.2
Formen der Prävention und deren Implementierung bei
Mammacarzinom ... 23
Hagel, Anja 1081301
3/77
4.2
Die medizinische Versorgungslandschaft... 25
4.3
Die Notwendigkeit psychosozialer Betreuung... 27
5 DIE ROLLE DER PFLEGE IN DER VERSORGUNG VON
BRUSTKREBSPATIENTINNEN ... 30
5.1
Pflegekonzepte in der Onkologie ... 30
5.2
Die Ausbildung zur Breast Care Nurse... 31
5.2.1
Aktuelle Weiterbildungen... 31
5.2.2
Die Guidelines der EUSOMA ... 32
6 SICHERUNG DER DIENSTLEISTUNGSQUALITÄT IM
KRANKENHAUS... 35
6.1
Gesetzliche Grundlagen... 35
6.2
Begriffsdefinitionen... 37
6.2.1
,,Qualität"... 37
6.2.2
,,Qualität der Pflege als Dienstleistung" ... 38
6.3
Dimensionen von Qualität nach Donabedian... 42
6.3.1
Strukturqualität ... 42
6.3.2
Prozessqualität ... 42
6.3.3
Ergebnisqualität... 43
6.3.4 Kritik an Donabedian`s Dimensionen ... 44
6.4
Der PDCA-Zyklus als Instrument des Total Quality
Managements (TQM)... 46
6.5
Qualitätsmanagementsysteme ... 47
6.5.1
Vorteile von QM-Systemen... 47
6.5.2
Überblick ... 48
6.5.3
Das EFQM-Modell für Business-Excellence ... 50
7 DER EINFLUSS DER BREAST CARE NURSE AUF DIE
PFLEGEQUALITÄT ... 54
7.1
Vorbemerkung ... 54
7.2
Die Relevanz der BCN für die Ergebnisqualität ... 54
7.2.1
Gesellschaftsbezogene Ergebnisse ... 54
7.2.2
Mitarbeiterbezogene Ergebnisse ... 55
7.2.3
Schlüsselergebnisse... 56
7.2.4
Kundenbezogene Ergebnisse ... 58
7.3
Die Relevanz der BCN für die Prozessqualität... 60
7.4
Die Relevanz der BCN für die Strukturqualität... 64
Hagel, Anja 1081301
4/77
7.4.1
Politik und Strategie... 64
7.4.2
Partnerschaften und Ressourcen ... 65
7.4.3
Die Mitarbeiter als Befähiger ... 67
7.4.4
Führung ... 68
8 FAZIT UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EINSATZ DER BCN ... 70
LITERATURVERZEICHNIS ... 73
Hagel, Anja 1081301
5/77
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
BCN
Breast Care Nurse
BC-PASS
Breast Cancer Psychosocial Assessment Screening
Scale
BQS
Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung
bzw.
beziehungsweise
DIN
Deutsches Institut für Normung
DMP
Disease Management Programm
DRG
Diagnosis Related Groups
EFQM
European Foundation For Quality Management
EN
European Norm
et al.
et altera
EU
Europäische Union
EUSOMA
European Society of Mastology
EQA
European Quality Award
ISO
International Organization for Standardization
JCAHO
Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organisations
Kap.
Kapitel
KTQ
Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesund-
heitswesen
KV
Kassenärztliche Vereinigung
MAC
Mental Adjustment to Cancer
Mamma-Ca
Mammacarzinom
PES
Pflegeexpertinnen und -experten Schweiz
PDCA
Plan-Do-Check-Act
PO-Bado
Psychoonkologische Basisdokumentation
PTBS
Posttraumatisches Belastungssyndrom
RADAR
Results-Approach-Deployment-Assessment-Review
SGB
Sozialgesetzbuch
sog.
sogenannt(e)
TQM
Total Quality Management
Hagel, Anja 1081301
6/77
vgl.
vergleiche
WHO
World Health Organization
z.B.
zum Beispiel
Hagel, Anja 1081301
7/77
Abbildungsverzeichnis
Seite
Abb. 1:
Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2002
11
Abb. 2:
Prozentualer Anteil an der Zahl der Krebssterbefälle in 13
Deutschland 2002
Abb. 3:
Die Bedürfnisse von Brustkrebspatientinnen 19
Abb. 4:
Subjektive Einschätzung des körperlichen Befindens
von Brustkrebspatientinnen
21
Abb. 5:
Subjektive Einschätzung des Lebensgefühls von
Brustkrebspatientinnen
21
Abb. 6:
Subjektive Einschätzung der emotionalen Stress-
reaktion von Brustkrebspatientinnen 22
Abb. 7:
Kernelemente, die die Kompetenz der BCN in jeder
Unterrolle kennzeichnen 34
Abb. 8:
Schematische Darstellung des PDCA-Zyklus nach
DEMING 46
Abb. 9:
Die 8 Grundkonzepte des EFQM-Modells 51
Abb.10:
Bildliche Darstellung des EFQM-Modells für Excellence 52
Abb.11:
Schematische Darstellung eines Patientinnenprozes-
ses - Auszug- 63
Hagel, Anja 1081301
8/77
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die demographische Entwicklung in Deutschland lässt einen enormen
Zuwachs der älteren Bevölkerung erwarten. Chronische Erkrankungen
wie Krebserkrankungen nehmen im Alter stark zu und werden deshalb in
Zukunft vermehrt unsere Aufmerksamkeit fordern. Weltweit erkrankten
nach Schätzungen der WHO im Jahr 2000 über eine Million Frauen an
einem Mammacarzinom. Die bestmögliche medizinische und pflegerische
Versorgung von Brustkrebspatientinnen ist damit zu einer großen medi-
zinischen und gesundheitspolitischen Herausforderung geworden. Die
deutschen Krankenhäuser sind jedoch zunehmend mit ökonomischen
Sachzwängen, wie knappen Ressourcen und der Einführung des DRG-
Systems, konfrontiert. Wirtschaftlichkeitssteigerungen und Qualitätsver-
besserungen sowie Effizienzerhöhung sind Grundvoraussetzungen, um
als Unternehmen am Markt bestehen zu können.
Darüber hinaus zwingen
die rechtlichen Rahmenbedingungen die Leistungserbringer zur
Qualitätssicherung. Die freiwillige
Teilnahme an Zertifzierungen, die die
Qualität der Dienstleistung mitarbeiter- und kundenorientiert in den
Vordergrund stellen, nutzen viele Kliniken als Mittel der Außendarstellung
und somit als Marketinginstrument. Die Rolle der Pflegenden ist maß-
geblich durch den Anteil, den sie im Wertschöpfungsprozess ,,Kranken-
behandlung" leisten, definiert. Der immer komplexer werdenden Dynamik
in der Versorgung der Patienten begegnet die Pflegewissenschaft in den
letzten Jahren mit Weiterbildungsmaßnahmen, die Pflegefachkräfte zu
,,spezialisierten Pflegefachkräften" werden lassen. Als Beispiel wird in
dieser Arbeit die Tätigkeit der ,,Breast Care Nurse" mit ihrer Wirkung auf
die Versorgungsqualität von Brustkrebspatientinnen dargestellt, um
folgende Frage zu untersuchen: ,,Können speziell ausgebildete Breast
Care Nurses den Patientinnen und Kliniken in der Qualitätssteigerung
und -darstellung dienen?" Dies impliziert auch die ökonomischen
Facetten der Wirkung eines Imagegewinns durch eine gelungene
Außendarstellung - denn: ,,Fallzahlen sind die Lebensader der Kranken-
häuser" (
REITER
2006, 27).
Hagel, Anja 1081301
9/77
1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit behandelt zunächst die Erkrankung ,,Brustkrebs"
mit ihrer Epidemiologie sowie die Krankheitsverarbeitung. Dabei bildet im
Besonderen die Recherche zu den Bedürfnissen der betroffenen
Patientinnen deren Versorgungswunsch ab. Der Darstellung der
Versorgungswirklichkeit folgt das Aufzeigen von Versorgungslücken,
wobei die psychosoziale Betreuung im Vordergrund steht. Darüber
hinaus wird den Pflegenden als zentralen Akteuren in der Versorgung
von Mamma-Ca-Patientinnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet -
einschließlich einer Darstellung der Weiterbildung zur Breast Care Nurse.
Nachfolgend werden die Grundlagen des Qualitätsmanagements im
Krankenhaus dargestellt - mit den Schwerpunkten Qualitätsdimension
nach
DONABEDIAN
und Qualitätsmanagementsysteme mit dem übergeord-
neten Qualitätskonzept des EFQM-Modells für Excellence. Diese sind
Basis der Untersuchung des Einflusses der Breast Care Nurse auf die
Pflegequalität in der stationären Versorgungssituation. Eine empirische
Untersuchung der Fragestellung ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.
Entlang der Gliederung der EFQM-Kriterien erfolgt auf einem hohen
Abstraktionsniveau eine Sammlung geeigneter Indizien für den Einsatz
der Breast Care Nurse im Rahmen der Qualitätsentwicklung im
stationären Bereich.
Ein Fazit der Untersuchungen sowie Empfehlungen für den künftigen
Einsatz der BCN schließen diese Arbeit ab, die sich einer Fragestellung
annimmt, die im Hinblick auf die Professionalisierung der Pflege eine
stetig wachsende Bedeutung gewinnt.
Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird häufig die grammatikalisch
männliche Sprachform gewählt, wobei darunter sowohl die männliche als
auch die weibliche Sprachform zu verstehen sind.
Hagel, Anja 1081301
10/77
2 Epidemiologie des Mammacarzinoms
2.1 Inzidenz
2.1.1 Begriff
,,Unter Inzidenz versteht man die Zahl der Neuerkrankungen in einem
bestimmten Zeitraum und einer definierten Population" (
BEAGLEHOLE
et al.
1997, 30). ,,Sie soll das Maß dafür sein, wie schnell sich eine Krankheit
ausbreitet, bzw. wie groß die Wahrscheinlichkeit für eine Person ist, die
Krankheit zu bekommen." (
HELLMEIER
et al. 2003, 241).
2.1.2 Inzidenz des Mamacarzinoms in Deutschland
Insgesamt sind im Jahr 2002 206.000 Frauen in Deutschland an Krebs
erkrankt. Das sind pro 100.000 Einwohner 462,7 Neuerkrankungen. Der
Anteil an Brustkrebserkrankungen liegt bei 55.150 Fällen bzw. 26,8%
(vgl. Abb.1). ,,Der europäische Vergleich zeigt auf, dass Holland,
Frankreich, Belgien, Schweden, Finnland, England, Deutschland, Irland,
Malta, Island und die Schweiz an der Spitze stehen und die zwölf Länder
(in dieser Reihenfolge) mit der höchsten Inzidenz-Rate darstellen, gefolgt
von den Frauen aus 26 weiteren europäischen Ländern" (
GLAUS
et al.
2004, 386). Damit ist Brustkrebs die häufigste Krebserkrankung bei
Frauen (vgl.
BERTZ
et al. 2006). ,,Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei
etwas über 62 Jahren, knapp 7 Jahre unter dem mittleren Erkrankungs-
alter bei Krebs gesamt" (
BERTZ
et al. 2006, 52). Somit ist Brustkrebs für
40% der Krebsneuerkrankungsfälle bei Frauen unter 60 Jahren
verantwortlich. Die Inzidenzzahlen sind im Zeitverlauf ansteigend (vgl.
BERTZ
et al. 2006).
Hagel, Anja 1081301
11/77
Abb.1: Krebsneuerkrankungen in Deutschland 2002
(Quelle:
BERTZ
et al. 2006, 14)
2.2 Prävalenz
2.2.1 Begriff
,,Die Prävalenz einer Krankheit ist die Anzahl der Krankheitsfälle in einer
definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt" (
BEAGLEHOLE
et al.
1997, 30). ,,Prävalenz = Inzidenz x Krankheitsdauer" (
HELLMEIER
et al.
2003, 242). Von großem Nutzen ist die Prävalenzrate, die die Anzahl der
Fälle durch die entsprechende Zahl von Menschen in einer Risiko-
population dividiert, denn diese spiegelt den Betreuungsbedarf wieder.
Hagel, Anja 1081301
12/77
2.2.2 Prävalenz des Mammacarzinoms
Daten über die Prävalenz von Krebserkrankungen liegen nicht
flächendeckend vor, so dass keine verlässlichen Informationen über
gesamtdeutsche Zahlen existieren. Das Saarländische Krebsregister hat
Zahlen veröffentlicht, wobei eine Differenzierung nach mit der Diagnose
verbrachten Lebensjahren vorgenommen wurde. Per Stichtag 31.12.2005
lebten im Saarland 9.436 Patientinnen mit der Diagnose ,,Brustkrebs",
wobei dies einer Prävalenzrate von 37,1% aller Malignome entspricht -
nach Lokalisationen gewichtet. Der Anteil der unter 65-Jährigen betrug
41,2% (vgl.
STEGMAIER
et al.
2007). Diese hohe Zahl ist durch die
gestiegene Inzidenz und die hohe Überlebensrate zu erklären. ,,Die
relative 5-Jahres-Überlebensrate für Brustkrebspatientinnen beträgt
mittlerweile - über alle Stadien betrachtet - 79%" (
BERTZ
et al. 2006, 52).
2.3 Mortalität
2.3.1 Begriff
,,Die Mortalität...bezeichnet die Anzahl der Todesfälle in einem
bestimmten Zeitraum im Verhältnis zur Anzahl der Individuen der
betreffenden Population in diesem Zeitraum. Sie wird durch die
Sterberate ausgedrückt" (
WIKIPEDIA
2007a).
2.3.2 Mortalität des Mammacarzinoms in Deutschland
Im Jahr 2002 sind in Deutschland 100.349 Frauen an Krebs gestorben;
das sind 238,5 pro 100.000 Einwohner. Davon waren 17,8% bzw. 17.814
Fälle von Brustkrebs zu verzeichnen; dies entspricht dem prozentual
höchsten Anteil aller Krebssterbefälle (vgl. Abb. 2).
Hagel, Anja 1081301
13/77
Abb.2: Prozentualer Anteil an der Zahl der Krebssterbefälle in Deutschland 2002
(Quelle:
BERTZ
et al. 2006, 13)
Die altersstandardisierte Mortalitätsrate erfährt im Zeitfenster 1970-2002
keine wesentliche Veränderung. Die Altersverteilung zeigt eine sehr hohe
Mortalitätsrate der über 75-Jährigen mit 172,4 pro 100.000 Fälle (vgl.
BERTZ
et al. 2006).
Hagel, Anja 1081301
14/77
3 Die Bewältigung der Diagnose ,,Brustkrebs"
3.1 Therapieverlauf
Je nach Tumorstadium bei Diagnosestellung sind die Krankheitsverläufe
der einzelnen Patientinnen individuell verschieden. Dennoch kann die
Versorgung grundsätzlich in Primärtherapie und Nachsorge unterschie-
den werden. Während der Primärtherapie, die nach Angaben der
Mediziner etwa ein Jahr dauert, muss sich der überwiegende Anteil der
Erkrankten zunächst einer Operation unterziehen. Das weitere Vorgehen
richtet sich nach dem Operationsverfahren und dem individuellen
Tumorprofil. Je nach Tumorstadium, dessen biologischen Eigenschaften
sowie dem Grad der Metastasierung schließen sich Chemotherapie,
Strahlentherapie, Hormontherapie und Antikörpertherapie an (vgl.
TEIGELER
, 2007). ,,Insgesamt haben die Behandlungsfortschritte zu einer
Komplexität der multimodalen Behandlungsoptionen geführt, die für viele
Patientinnen und Therapeuten kaum noch durchschaubar ist" (
DITZ
et al.
2006, 52).
Mit Abschluss der Primärtherapie beginnt die Nachsorge. In Leitlinien hat
die Deutsche Krebsgesellschaft formuliert, in welcher Weise die
Patientinnen durch Gynäkologen im Rahmen der Tumornachsorge
betreut werden sollen. Ziel ist es vor allem, keine relevanten
Neuerkrankungen zu übersehen, darüber hinaus aber auch Unter-
stützung zum Erlangen und Erhalten einer guten Lebensqualität zu
leisten.
3.2 Depression und Angst
Jede Krebsdiagnose - unabhängig von der tatsächlichen Schwere der
Erkrankung und der Prognose - führt zu einer existentiellen Verunsiche-
rung. Die Endlichkeit des Daseins, das Faktum der Sterblichkeit wird für
die Betroffenen spürbar. Zusätzlich bringt eine energieraubende Therapie
die Frauen oftmals an den Rand der physischen und psychischen
Erschöpfung. D
ITZ
et al. zitieren unterschiedliche Studien zur Ausprägung
Hagel, Anja 1081301
15/77
von Depressionen bei Mamma-Ca-Patientinnen. Hierzu existieren eine
Untersuchung von Weis und Koch (1998), eine EU-Studie von Isermann
et al. (2001) und die bekannte Studie von Watson et al. (1999) (vgl.
DITZ
et al. 2006). Diesen Studien gemeinsam ist die Erkenntnis, dass weit
weniger Patientinnen eine depressive Reaktion auf die Brustkrebs-
erkrankung entwickeln als zu erwarten wäre. Watson et al. konnten
lediglich 10 von 578 Patientinnen als depressiv einstufen. ,,Auch die
klinische
Erfahrung
zeigt
eher,
dass
zumindest
ersterkrankte
Brustkrebspatientinnen nicht primär depressiv auf die Erkrankung
reagieren" (
DITZ
et al. 2006, 106-107). Auch eine qualitative Studie von
HOLGRÄWE
et al. mit Brustkrebspatientinnen betreuenden Pflegenden
stellt nicht die Depression, sondern die Ungewissheit und Angst als
primären Belastungsbereich in den Mittelpunkt - neben Operation sowie
den Sorgen um Familie und Partnerschaft (vgl.
HOLGRÄWE
et al. 2007).
Angst - Todesangst - ist das zentrale Thema in der Krankheits-
bewältigung für Patientinnen und deren Angehörige. Die Ausprägung der
Angst ist von vielen Faktoren abhängig - sowohl persönlicher Natur als
auch bezüglich der individuellen Prognose. Die zunächst normale
Angstreaktion kann zur Panik werden - häufig in der Zeit zwischen
Ahnung und Diagnosemitteilung.
Die folgende Zeit des Handlungsdrucks erleichtert zunächst den Umgang
mit der Angst durch die Erfüllung des psychologischen Bedürfnisses nach
eigener Kontrolle. Während der Akutphase richtet sich alle Aufmerk-
samkeit auf die konkreten Auswirkungen von Operation und adjuvanter
Therapie auf die eigene Person. Neben der Erleichterung über das
Entfernen des ,,Bösartigen und Zerstörerischen" steht die konkrete
Auseinandersetzung mit dem Erleben der Therapienebenwirkungen.
Unter Umständen kann sich Angst in körperlicher Symptomatik aus-
drücken wie Schlafstörungen, Engegefühl, Zittern, Herzrasen, Herz-
schmerzen, Schweißausbrüchen und anderen psychosomatischen
Beschwerden. Nach Beendigung der Therapie ist die Gefühlslage meist
widersprüchlich
und
bewegt
sich
zwischen
Erleichterung
und
Unsicherheit. In den ersten Jahren ist die ständige Angst vor einem
Rezidiv Wegbegleiter und nimmt in dieser Zeit sogar noch zu (vgl.
Hagel, Anja 1081301
16/77
CREUTZFELD
-
CLEES
, 2007). Kritische Momente sind die jeweiligen
Nachsorgetermine mit dem bangen Warten auf das Resultat. Dies
entscheidet über die weitere Entwicklung der Angst: Negative
Untersuchungsergebnisse führen mit immer größer werdendem Zeitab-
stand zur Diagnosestellung zu höherer Sicherheit und drängen die Angst
in den Hintergrund. Rezidive und Metastasenbildung lösen jedoch noch
heftigere Reaktionen mit höherer Intensität aus als in der Anfangszeit
erlebt, da ein Therapieversagen unterstellt wird, und die Heilungs-
hoffnung schwindet.
Der Angst ihren überwältigenden Charakter zu nehmen, ist in allen
Krankheitsphasen
maßgeblich
abhängig
von
den
individuellen
Ressourcen der betroffenen Frauen. ,,Stolzsein auf die eigenen
Fähigkeiten, Selbstachtung und ein großes Selbstbewusstsein erleichtern
die Anpassung an die Krankheit" (
CREUTZFELD
-
CLEES
2007, 37).
Professionelle Hilfe in der Angstbewältigung wird notwendig, wenn die
Erkrankung Brustkrebs als seelisches Trauma erlebt wird, für dessen
Bewältigung die eigenen Strategien nicht ausreichen und ein
Kontrollverlust droht.
3.3 Das posttraumatische Belastungssyndrom
VETTER
schreibt in ihrem Ratgeber: ,,Lassen Sie sich durch die
Diagnosemitteilung nicht auf Panikstimmung ein" (
VETTER
1998, 27). Dies
scheint ein wohlgemeinter jedoch ziemlich realitätsferner Rat zu sein,
denn auch die Befragung der betroffenen Frauen ergab bei
SCHMID
-
BÜCHI
,
dass die endgültige Diagnose als Schock erlebt wird (vgl.
SCHMID
-
BÜCHI
et
al. 2005). Auch die EU-Studie von Isermann et al. zeigt etwa ein Drittel
der Patientinnen mit Symptomen einer posttraumatischen Belastungs-
störung, unabhängig von objektiven Krankheitsmerkmalen wie Tumor-
grading oder Operationsform. Es wird ebenso beschrieben, dass in
neueren Veröffentlichungen die PTBS-Prävalenzraten deutlich höher
sind, da lebensbedrohliche Erkrankungen in den Traumakatalog
aufgenommen wurden (vgl.
DITZ
et al. 2006). Die Diagnose der
Hagel, Anja 1081301
17/77
posttraumatischen Belastungsstörung stützt sich auf drei Haupt-
symptome: Intrusion, Hyperarousal und Vermeidungsverhalten.
Intrusionen bezeichnen ein ungewolltes Wiedererleben traumatischer
Situationen mit intensiven Bildern, durch bewusste oder unbewusste
Reize jederzeit auslösbar, in Form von Alpträumen oder sog.
,,Flashbacks". Der Betroffene erinnert sich nicht an Vergangenes,
sondern es geschieht ihm in diesem Moment. Hyperarousal drückt sich
durch eine anhaltende physiologische Erregbarkeit mit Schreckhaftigkeit,
innerer Unruhe, Gedächtnis- und Schlafstörungen aus. Dem dritten
Symptom - dem Vermeidungsverhalten - ist der Rückzug aus
Situationen, die mit dem Trauma zusammenhängen, zuzuordnen.
Emotionale Taubheit - auch Numbing genannt - ist eine der schwerwie-
gendsten Formen (vgl.
DITZ
et al. 2006). Die Verdrängung ist als
Bewältigungsstrategie anzusehen - zum Schutz vor traumabezogenen
Reizen. Obwohl die posttraumatische Stresssymptomatik relativ neu in
der Diskussion um psychische Komorbidität bei Mamma-Ca ist, hat sie
eine
erhebliche
Bedeutung
für
ärztliche,
pflegerische
und
psychotherapeutische Interventionen sowie für die Lebensqualität der
Patientinnen.
3.4 Die Bedürfnisse betroffener Patientinnen
3.4.1 Ergebnisse der Literaturstudie
Schon Mitte des letzten Jahrhunderts proklamierte die Pflege-
wissenschaftlerin Henderson, dass die Aktivitäten der Pflege sich nach
den Bedürfnissen der zu pflegenden Menschen richten müssen. Dies
bedeutet, dass die Pflegende diese Bedürfnisse kennen und wahr-
nehmen muss. Anders als Maslow priorisiert sie diese Bedürfnisse nicht,
sondern lenkt den Betrachter sowohl auf die physischen als auch auf die
emotionalen und sozialen Grundbedürfnisse, die jedem Menschen eigen
sind (vgl.
MÜLLER
2003). Auch andere Pflegetheorien gehen immer davon
aus, dass der Pflegebedarf oder das ,,Selbstpflegedefizit" wie Orem es
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836621595
- DOI
- 10.3239/9783836621595
- Dateigröße
- 720 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hamburger Fern-Hochschule – Gesundheit/Pflege, Studiengang Pflegemanagement
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- breast care nurse qualitätsmanagement efqm krankenhausmanagement pflege
- Produktsicherheit
- Diplom.de