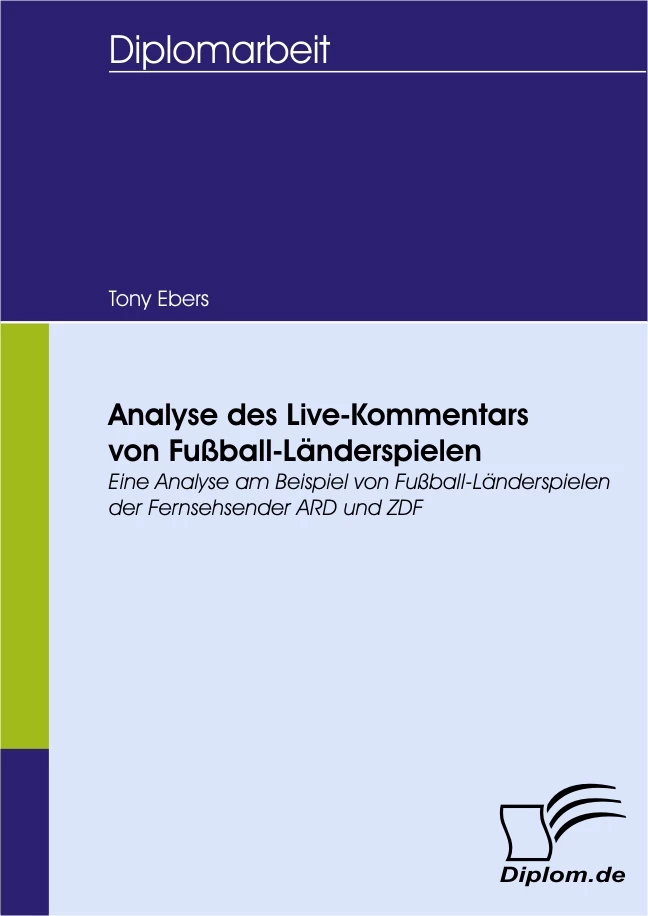Analyse des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen
Eine Analyse am Beispiel von Fußball-Länderspielen der Fernsehsender ARD und ZDF
©2006
Diplomarbeit
138 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der im Juni 2005 zu Ende gegangene FIFA-Confederations-Cup, welcher im Vorfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft immer ein Jahr zuvor als Generalprobe im Gastgeberland stattfindet, hat wieder einmal Millionen von Menschen in Deutschland vor den Fernsehgeräten vereint und die volle Aufmerksamkeit der Bevölkerung genossen. Fußballfans, Sportinteressierte, sowie neutrale Fernsehzuschauer gleichermaßen verfolgten dieses mediale Großereignis entweder live im Stadion, oder fieberten vor den Fernsehgeräten mit. Sportliche Ereignisse wie der FIFA-Confederations-Cup, zumal noch im eigenen Land, werden nach Dankert nicht selten leidenschaftlicher und ausgiebiger in der Bevölkerung diskutiert, als beispielsweise Alltagsprobleme der Menschen oder politische Entscheidungen. Die Regeln des Sports sind fest fixiert, über nationale Grenzen hinweg verbindlich und oft bekannter, als z.B. die Spielregeln der Politik. Am Gespräch über den Fußball nehmen nicht nur Fußballer und der engere Kreis der Fußballfans teil, sondern auch ein sehr weit gezogener Kreis von Laien.
Eine Untersuchung des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen berührt ein gesellschaftliches Phänomen von hohem Interesse und weitreichender Verbreitung. Mehr als 6 Millionen Menschen sind Mitglied im Deutschen Fußballbund, also aktiv oder passiv direkt mit dem Fußball verbunden; ein weitaus größerer Teil der Bevölkerung erlebt den Fußball indirekt als Medienkonsument. Neben seiner aktiven und erlebnisorientierten Seite ist der Fußball auch ein Medienereignis, dessen umsatzsteigernder Wirkung sich weder die Printmedien, noch der Rundfunk oder das Fernsehen entziehen können. Das Produkt bzw. die Ware Fußball soll dem Zuschauer verkauft werden.
Mit dem Ansehen der Spiele im Fernsehen rezipiert man aber nicht nur bewegte Bilder, sondern auch einen bewusst oder unbewusst wahrgenommenen Live-Kommentar des fortlaufenden Spielgeschehens. Der Kommentar soll dem Zuseher bei seinen visuell wahrgenommenen Erkenntnissen unterstützen, sowie erlebte Gefühle und Ausdrücke in ihm auslösen. Kommentatoren lassen den Rezipienten durch die Art ihrer Berichterstattung am Spielgeschehen teilhaben, wodurch man als Zuschauer die Spiele mit mehr Emotionen erlebt.
Die Zuschauer werden somit in eine Form des Dialogs mit dem Medium verwickelt, obwohl der Kommunikationsprozess nur einseitig in Richtung des Zusehers verläuft. Der Empfänger interpretiert durch den Kommentar das Spielgeschehen eines […]
Der im Juni 2005 zu Ende gegangene FIFA-Confederations-Cup, welcher im Vorfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft immer ein Jahr zuvor als Generalprobe im Gastgeberland stattfindet, hat wieder einmal Millionen von Menschen in Deutschland vor den Fernsehgeräten vereint und die volle Aufmerksamkeit der Bevölkerung genossen. Fußballfans, Sportinteressierte, sowie neutrale Fernsehzuschauer gleichermaßen verfolgten dieses mediale Großereignis entweder live im Stadion, oder fieberten vor den Fernsehgeräten mit. Sportliche Ereignisse wie der FIFA-Confederations-Cup, zumal noch im eigenen Land, werden nach Dankert nicht selten leidenschaftlicher und ausgiebiger in der Bevölkerung diskutiert, als beispielsweise Alltagsprobleme der Menschen oder politische Entscheidungen. Die Regeln des Sports sind fest fixiert, über nationale Grenzen hinweg verbindlich und oft bekannter, als z.B. die Spielregeln der Politik. Am Gespräch über den Fußball nehmen nicht nur Fußballer und der engere Kreis der Fußballfans teil, sondern auch ein sehr weit gezogener Kreis von Laien.
Eine Untersuchung des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen berührt ein gesellschaftliches Phänomen von hohem Interesse und weitreichender Verbreitung. Mehr als 6 Millionen Menschen sind Mitglied im Deutschen Fußballbund, also aktiv oder passiv direkt mit dem Fußball verbunden; ein weitaus größerer Teil der Bevölkerung erlebt den Fußball indirekt als Medienkonsument. Neben seiner aktiven und erlebnisorientierten Seite ist der Fußball auch ein Medienereignis, dessen umsatzsteigernder Wirkung sich weder die Printmedien, noch der Rundfunk oder das Fernsehen entziehen können. Das Produkt bzw. die Ware Fußball soll dem Zuschauer verkauft werden.
Mit dem Ansehen der Spiele im Fernsehen rezipiert man aber nicht nur bewegte Bilder, sondern auch einen bewusst oder unbewusst wahrgenommenen Live-Kommentar des fortlaufenden Spielgeschehens. Der Kommentar soll dem Zuseher bei seinen visuell wahrgenommenen Erkenntnissen unterstützen, sowie erlebte Gefühle und Ausdrücke in ihm auslösen. Kommentatoren lassen den Rezipienten durch die Art ihrer Berichterstattung am Spielgeschehen teilhaben, wodurch man als Zuschauer die Spiele mit mehr Emotionen erlebt.
Die Zuschauer werden somit in eine Form des Dialogs mit dem Medium verwickelt, obwohl der Kommunikationsprozess nur einseitig in Richtung des Zusehers verläuft. Der Empfänger interpretiert durch den Kommentar das Spielgeschehen eines […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tony Ebers
Analyse des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen
Eine Analyse am Beispiel von Fußball-Länderspielen der Fernsehsender ARD und ZDF
ISBN: 978-3-8366-2145-8
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen, Deutschland,
Diplomarbeit, 2006
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
1
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis
4
Tabellenverzeichnis
5
Teil I: Analyse, Theorie und Konzeption
1.
Einleitung
6
1.1. Hintergrund
6
1.2.
Ziel
und
Aufbau
der
Arbeit
7
2. Kommunikationswissenschaftlicher
Hintergrund
9
des Themas
2.1. Systematik der Massenkommunikationsforschung
9
2.2.
Aussagen-
und
Inhaltsforschung
11
2.3.
Medienforschung
12
3.
Begriffserklärungen und Erläuterungen
13
3.1. Die Funktion des Kommentars in der Sportberichterstattung
13
des Fernsehens
3.2.
Sportsprache
als
Sondersprache
14
3.2.1. Fußballsprache als Beispiel für eine Fachsprache
17
3.2.2. Fußballjargon als Beispiel für eine Sondersprache
18
3.3.
Zusammenfassung
19
4.
Die Kommentatoren der Fußball-Länderspiele
20
4.1.
Der
ARD-Kommentator
20
4.2.
Die
ZDF-Kommentatoren
21
2
5.
Methodisches Vorgehen und Analysedesign
23
5.1. Forschungsleitende
Fragen 26
5.2.
Hypothesen
27
5.3.
Kategoriensystem
29
5.4.
Testphase
32
5.5.
Untersuchungsmaterial
34
5.6.
Untersuchungsverlauf
35
Teil 2: Ergebnisse und Interpretation
6.
Präsentation und Interpretation der Ergebnisse
37
6.1.
Formale
Analyse
37
6.2. Die Sprache der Kommentierung von Fußball-Länderspielen
45
6.2.1. Spielernennungen
46
6.2.2. Grammatikalische Fehler in der Kommentierung
49
6.2.3.
Vergleiche
51
6.2.4.
Umgangssprache
53
6.2.5. Superlative
55
6.2.6.
Hyperbolik
58
6.2.7. Metaphorik und idiomatische
Redewendungen
59
6.2.8.
Fremdwörter
62
6.2.9.
Fachliche
Fehler
64
6.2.10.Zuschaueransprachen
66
6.2.11.Kollegenansprachen 67
6.2.12.Ich-Wir-Formulierungen
68
6.2.13.Zusammenfassung
71
3
6.3. Die Themen in der Kommentierung von Fußball-Länderspielen
72
6.3.1.
Standardthemen
72
6.3.2.
Hintergrundthemen
76
6.3.3.
Zusammenfassung
79
6.4.
Das
Fachwissen
der
Kommentatoren
80
6.4.1.
Spieler/Trainer/Schiedsrichter
85
6.4.2. Taktik
87
6.4.3.
Reglement
89
6.4.4.
Technik
91
6.4.5.
Ausrüstung
93
6.4.6.
Zusammenfassung
94
6.5. Bewertungen in der Kommentierung
95
6.5.1. Spekulationen/Prognosen
96
6.5.2.
Positive/Negative
Bewertungen
98
6.5.3. Extrem moderate Bewertungen
101
6.5.4.
Moderate
Bewertungen
103
6.5.5.
Eindeutige
Bewertungen
105
6.5.6.
Zusammenfassung
106
7. Ergebniszusammenfassung
107
8. Fazit
111
Literaturverzeichnis
114
Anhang
I
1.
Codebuch
II
2.
Codierbogen
V
3.
Definitionen
der
Kategorien VII
4
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einordnung der Sportsprache in das allgemeine
16
Sprachsystem
Abbildung 2: Kommentaranteile der zu analysierenden Spiele
38
(in %)
Abbildung 3: Absolute Zahlenwerte der Standardthemen und
73
Aussagen zu den Standardthemen pro x Minuten
Kommentarlänge
Abbildung 4: Absolute Zahlenwerte der Hintergrundthemen
76
5
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Kommentarlängen inklusive Sprechpausen nach
39
Halbzeiten getrennt
Tabelle 2: Sprechpausen nach Halbzeiten
getrennt
40
Tabelle 3: Verhältnis Sprechpause Kommentar (in %)
40
Tabelle 4: Ø-Sehbeteiligung (in Mio.) und Marktanteile (in %)
41
der ARD-Spiele
Tabelle 5: Ø-Sehbeteiligung (in Mio.) und Marktanteile (in %)
42
Tabelle 6: Verlauf der Sehbeteiligung Brasilien vs. Griechenland
43
(in Mio.)
Tabelle 7: Verlauf der Sehbeteiligung Japan vs. Mexiko (in Mio.)
44
Tabelle 8: Spielernennungen Japan vs.
Mexiko
46
Tabelle 9: Spielernennungen Brasilien vs. Griechenland
47
Tabelle 10: Spielernennungen Deutschland vs. Australien
48
Tabelle 11: grammatikalische Fehler die Reporter im Vergleich
49
Tabelle 12: vergleichende Äußerungen die Reporter im Vergleich
52
Tabelle 13: umgangssprachliche Ausdrücke die Reporter im
53
Vergleich
Tabelle 14: Superlative absolute und relative Verteilung 56
Tabelle 15: Hyperbolik absolute und relative Verteilung
58
Tabelle 16: Metaphern und Redewendungen die Reporter im
60
Vergleich
Tabelle 17: Anzahl der einzelnen Fremdwörter im Überblick
62
Tabelle 18: Fremdwörter die Reporter im Vergleich
63
Tabelle 19: fachliche Fehler die Reporter im Vergleich
64
Tabelle 20: Zuschaueransprachen die Reporter im Vergleich
66
Tabelle 21: Ich-Wir-Formulierungen die Reporter im Vergleich
69
Tabelle 22: Kommentarlängen ohne Sprechpausen nach 75
Halbzeiten getrennt
Tabelle 23: Analyseeinheiten nach Spielen und Halbzeiten getrennt
77
Tabelle 24: Fachwissen die Reporter im Vergleich (absolute Zahlen) 81
Tabelle 25:
Fachwissen
(in
%)
82
Tabelle 26: Fachwissen Spieler/Trainer/Schiedsrichter
84
Tabelle 27: Spekulationen/Prognosen (absolute
Zahlen)
96
Tabelle 28:
positive/negative
Bewertungen
98
(absolute und relative Zahlen)
Tabelle 29: moderate Bewertungen absolute und relative Verteilung 103
6
1. Einleitung
1.1. Hintergrund
Der im Juni 2005 zu Ende gegangene FIFA-Confederations-Cup, welcher im
Vorfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft immer ein Jahr zuvor als Generalprobe
im Gastgeberland stattfindet, hat wieder einmal Millionen von Menschen in
Deutschland vor den Fernsehgeräten vereint und die volle Aufmerksamkeit der
Bevölkerung genossen. Fußballfans, Sportinteressierte, sowie neutrale
Fernsehzuschauer gleichermaßen verfolgten dieses mediale Großereignis
entweder live im Stadion, oder fieberten vor den Fernsehgeräten mit. Sportliche
Ereignisse wie der FIFA-Confederations-Cup, zumal noch im eigenen Land,
werden nach Dankert (1969) nicht selten leidenschaftlicher und ausgiebiger in
der Bevölkerung diskutiert, als beispielsweise Alltagsprobleme der Menschen
oder politische Entscheidungen. Die Regeln des Sports sind fest fixiert, über
nationale Grenzen hinweg verbindlich und oft bekannter, als z.B. die
Spielregeln der Politik. Am Gespräch über den Fußball nehmen nicht nur
Fußballer und der engere Kreis der Fußballfans teil, sondern auch ein sehr weit
gezogener Kreis von Laien. (vgl. Dankert,1969, S.1)
Eine Untersuchung des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen berührt
ein gesellschaftliches Phänomen von hohem Interesse und weitreichender
Verbreitung. Mehr als 6 Millionen Menschen sind Mitglied im Deutschen
Fußballbund (vgl.
http://www.dfb.de
, 20.09.2005), also aktiv oder passiv direkt
mit dem Fußball verbunden; ein weitaus größerer Teil der Bevölkerung erlebt
den Fußball indirekt als Medienkonsument. Neben seiner aktiven und
erlebnisorientierten Seite ist der Fußball auch ein Medienereignis, dessen
umsatzsteigernder Wirkung sich weder die Printmedien, noch der Rundfunk
oder das Fernsehen entziehen können. (vgl. Schaefer,1990, S.3) Das ,,Produkt"
bzw. die ,,Ware" Fußball soll dem Zuschauer verkauft werden.
Mit dem Ansehen der Spiele im Fernsehen rezipiert man aber nicht nur
bewegte Bilder, sondern auch einen bewusst oder unbewusst
wahrgenommenen Live-Kommentar des fortlaufenden Spielgeschehens. Der
7
Kommentar soll dem Zuseher bei seinen visuell wahrgenommenen
Erkenntnissen unterstützen, sowie erlebte Gefühle und Ausdrücke in ihm
auslösen. Kommentatoren lassen den Rezipienten durch die Art ihrer
Berichterstattung am Spielgeschehen teilhaben, wodurch man als Zuschauer
die Spiele mit mehr Emotionen erlebt.
Die Zuschauer werden somit in eine Form des Dialogs mit dem Medium
verwickelt, obwohl der Kommunikationsprozess nur einseitig in Richtung des
Zusehers verläuft. Der Empfänger interpretiert durch den Kommentar das
Spielgeschehen eines Fußball-Länderspiels in veränderter und emotionaler
Form.
Die Mitteilungen des Kommentators werden dabei in dieser Untersuchung
methodisch analysiert und anschließend in Bezug auf
Kommunikationsmerkmale ausgewertet.
1.2. Ziel und Aufbau der Arbeit
Die Diplomarbeit soll Aufschluss darüber geben, mit welchen
Kommunikationstechniken und Stilmerkmalen des Sprechens der Kommentator
eines Fußball-Länderspiels arbeitet. Charakteristische Merkmale des
Kommunizierens mit Hilfe der Sprache könnten in diesem Zusammenhang eine
gewisse Ungezwungenheit und Lockerheit in der Kommentierung, sowie
ökonomisches Sprechen, Fußball spezifische Fachsprache und Ausdrucksfülle
sein. Bei Betrachtung der einschlägigen Literatur über Sprachkommunikation im
Sport sind Kommunikationstechniken wie Metaphern, idiomatische
Redewendungen und Fremdwörter wichtige Stilmerkmale der Sportsprache.
(vgl. Digel,1975, S.106ff) Hierbei gilt es zu untersuchen, ob der Kommentator
eines Fußball-Länderspiels sich dieser Kommunikationsformen bedient. Zudem
wird bei der Betrachtung des Kommentars von Fußball-Länderspielen
untersucht, ob besondere Auffälligkeiten in der Sprache zu erkennen sind. Die
Sprechpausen des Kommentators an gewissen Stellen im tatsächlichen
Spielverlauf werden ebenfalls erfasst und in die Analyse mit einbezogen.
8
Darauf aufbauend soll geklärt werden, welchen Stereotypen Live-Kommentare
unterliegen. Stereotypen sind in der Psychologie Meinungen bzw. vereinfachte
Abbilder komplizierter Zusammenhänge, denn häufig sind Sachverhalte so
komplex, dass sich der Mensch ersatzweise auf ein Urteil verlässt, das nur ein
oder zwei Seiten einer Sache in Betracht zieht. (vgl. von Bassewitz,1990)
Fernsehkommentatoren unterliegen der ständigen Kritik des mitschauenden
Hörers und können bei allzu häufigen Äußerungen das unmittelbare visuelle
Erfassen stören und den Zuseher somit eventuell verärgern. (vgl. Dankert,1969,
S.103ff) Der Kommentator soll nur ein unterstützender Informant des laufenden
Spiels sein, wobei er sich verschiedenster Kommunikationsformen bzw.
techniken bedienen darf.
Da das visuelle Bild die vorrangige und entscheidende Informationsquelle ist,
stellt der Kommentar nur eine Hilfestellung für das Verständnis des Zuschauers
dar. So sind etwa zur Information des Zuschauers einleitende Bemerkungen,
die Vorstellung der teilnehmenden Mannschaften, die Art und Bedeutung des
Spiels, sowie die häufige Nennung der Namen der Spieler notwendig.
Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind drei Vorrundenspiele des FIFA-
Confederations-Cup 2005 in Deutschland, die von den Fernsehsendern ARD
und ZDF übertragen wurden. Von beiden Sendeanstalten wurde bei der
Auswahl der zu analysierenden Spiele darauf geachtet, dass unterschiedliche
Reporter die Spiele kommentieren, um eine umfassende Analyse und
ausgewogene Betrachtungsweise gewährleisten zu können.
Im ersten Schritt der Diplomarbeit werden die durch den Kommentator eines
Fußball-Länderspiels einseitig an die mitschauenden Hörer gerichteten
Mitteilungen mit Hilfe der Inhaltsanalyse methodisch untersucht. Die
Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv
nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von
Mitteilungen im Kommunikationsprozess. (vgl. Früh,2004, S.25) Dabei gilt es
mit Hilfe eines Codeplans die Mitteilungen in Kategorien einzuordnen und
anschließend zu codieren.
9
Im zweiten Schritt werden die aus der Inhaltsanalyse der Mitteilungen
gewonnenen Erkenntnisse auf die Kommunikationsmerkmale, welche ein
Reporter eines Fußball-Länderspiels verwendet, untersucht. Ein
schwerpunktmäßiger Anteil kommt der Betrachtung der Sprache während des
tatsächlichen Spielverlaufs zu. Die Fachsprache sollte zudem über
terminologische Bestimmungen verfügen, welche die im Fußballspiel
verbindlichen Normen eindeutig fixieren. Darüber hinaus ist zu prüfen, welcher
Jargonwendungen sich der Reporter bedient, um mit diesem ungezwungeneren
und unverbindlicheren Sprachinstrument zu beweisen, dass er zur Gruppe der
Fußballer gehört und mit den Besonderheiten des Fußballspiels vertraut ist. Die
Anwendung des spezifischen Fachvokabulars ermöglicht dies dem
Kommentator nicht in jenem Ausmaß. (vgl. Dankert,1969, S.21)
2. Kommunikationswissenschaftlicher Hintergrund des Themas
2.1. Systematik der Massenkommunikationsforschung
,,Who says what in which channel to whom with what effect?"
Mit dieser Frage fasst der Soziologe Harold D. Lasswell aus den USA die
verschiedenen Bereiche der Kommunikationswissenschaft zusammen. Noch
heute wird die Publizistik ausgehend von dieser Formel systematisiert. Nach
Pürer (1990) unterscheidet man fünf Forschungsfelder.
(1) Publikumsforschung
,,[...] hat die Nutzer der Massenmedien, die Leser, Hörer und Seher zum
Untersuchungsgegenstand, untersucht Reichweiten, Publikumsstrukturen, -
wünsche und erwartungen" (Pürer,1990, S.24).
10
(2) Kommunikatorforschung
,,Im Bereich der Kommunikatorforschung befasst sich die Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft vor allem mit Fragen an und über jene Personen
oder Gruppen von Personen, die an der Produktion von öffentlichen, für die
Verbreitung durch ein Massenmedium bestimmten Aussagen beteiligt sind, [...]"
(Pürer,1990, S.29).
(3) Aussagen- und Inhaltsforschung
,,Die Publizistik- und Kommunikationswissenschaft befasst sich in diesem
Bereich primär mit allen originärpublizistisch verbreiteten oder über die
Massenmedien veröffentlichten Botschaften seien sie gedruckter, auditiver,
visueller oder audiovisueller Natur" (Pürer,1990, S.36).
(4) Medienforschung
,,Der Bereich der Position Medium umfasst alle jenen technischen Instrumente
und Apparaturen, mit deren Hilfe publizistische Aussagen an die Öffentlichkeit
weitergeleitet werden [...] können. [...] Im engeren Sinn ist Medienforschung
konkret auf die Strukturen und Funktionen der Massenmedien bezogen"
(Pürer,1990, S.42f).
(5) Wirkungsforschung
,,Den Wirkungen der Massenmedien versucht die Medienwirkungsforschung auf
den Grund zu gehen. Dabei werden je nach Fragestellung Wirkungen im
Bereich der Wahrnehmung und des Wissens, der Einstellungen und
Meinungen, der Empfindungen und Gefühle sowie der Handlungen und
Verhaltensweisen der Menschen auf den Grund gegangen" (Pürer,1990, S.51).
11
Trotz der formalen Trennung der einzelnen Forschungsgebiete dürfen sie nicht
isoliert voneinander betrachtet werden. Die Kommunikationswissenschaft sieht
sich selbst als interdisziplinäre Sozialwissenschaft und zieht deshalb andere
Wissenschaften als Hilfsdisziplinen heran. Es wird dabei nach den
Sinnaspekten historisch, philosophisch-anthropologisch, soziologisch,
sozialpsychologisch, politologisch, pädagogisch und linguistisch untersucht.
(vgl. Pürer,1990, S. 24f)
Die Analyse der Live-Kommentare von Fußball-Länderspielen der
Fernsehsender ARD und ZDF orientiert sich an dieser Einteilung und lässt sich
innerhalb der Aussagen-, Inhalts- und Medienforschung einordnen.
2.2. Aussagen- und Inhaltsforschung
Nach Aussage des Kommunikationswissenschaftlers Werner Früh gibt die
Inhaltsforschung Aufschluss über die inhaltlichen und formalen Strukturen von
Kommunikation. (vgl. Früh,2004, S.25)
Primär befasst sie sich mit allen originärpublizistisch verbreiteten und über die
Massenmedien veröffentlichten Botschaften. (vgl. Pürer,1990, S.36) Den
größten Teil der Aussagen- und Inhaltsforschung nehmen die Massenmedien in
Anspruch. In diese Kategorie fallen z.B. Zeitungsreportagen,
Fernsehkommentare oder Hörfunkinterviews. Aussagen dieser Beispiele dürfen
jedoch nicht isoliert vom Medium betrachtet werden. ,,Aussagenforschung
befasst sich daher nicht nur mit den publizistischen Aussagen an sich, sondern
auch mit den konkreten Bedingungen gesellschaftlicher, organisatorischer und
technischer Natur unter denen sie entstehen" (Pürer,1990, S.36).
Die ersten Analysen berücksichtigten zunächst nur formale und inhaltliche
Merkmale, danach trat die Untersuchung der journalistischen
Darstellungsformen (Nachricht, Reportage, Feature, Interview, Rundgespräch,
Leitartikel, Kommentar, Kolumne, Essay, Glosse, Feuilleton (vgl. Noelle-
Neumann/Schulz/Wilke,2002, S.126ff)) in den Vordergrund, wobei auch hier nur
die formalen Aspekte von Interesse waren.
Mit dem Entstehen von Strukturanalysen erfuhr die Inhaltsanalyse eine
Weiterentwicklung. Dominierten vorher noch rein quantitative Merkmale,
12
widmete man sich nun verstärkt qualitativen Merkmalen. (vgl. Früh,2004, S.67f)
In dieser Phase wandelte sich die Inhaltsforschung endgültig zu einer stärker
qualitativen Untersuchung, die verlässlich mehr als nur Inhalte auswählen
konnte. (vgl. Atteslander,1993, S.228f) Gegenstand der Inhaltsanalyse sind
heutzutage alle publizistischen Medien und deren Botschaften.
2.3. Medienforschung
Nach Silbermann (1982) ist die Medienforschung der Oberbegriff für
wissenschaftliche Untersuchungen und Studien, die sich nach Aspekten wie
Struktur, Funktion, Organisation, Inhalt und Wirkung, Technik, Ökonomie etc.
den diversen Medien richten. (vgl. Silbermann,1982, S.299)
Laut Pürer (1990) umfasst der Bereich Medium alle Instrumente und
Apparaturen, mit deren Hilfe publizistische Aussagen an die Öffentlichkeit
weitergeleitet und somit potentiell für jedermann zugänglich gemacht werden.
(vgl. Pürer,1990, S.42)
Den Beginn der Medienforschung bestimmte die Pressegeschichte und
Pressegeschichtsschreibung. Mit den Jahren hat sie sich weiterentwickelt zur
Medien- und Kommunikationsgeschichte. Während sich die Mediengeschichte
mit Hörfunk, Film und Fernsehen befasst, geht die Kommunikationsgeschichte
auf die Medienentwicklung im Zusammenhang politischer, ökonomischer,
sozialer und kultureller Entwicklungen ein.
Die moderne Medienforschung hat die Entstehung und Entwicklung der derzeit
bestehenden Medien zum Thema. Früher beschäftigte sich die Forschung
hauptsächlich mit dem Pressewesen, während später verstärkt das Fernsehen
hinzu kam. (vgl. Pürer,1990)
Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Inhalts- und Medienforschung einem
ständigen Entwicklungsprozess ausgesetzt ist, unter dem sie sich von einer rein
quantitativen Betrachtungsweise zu mehr qualitativen-interpretativen Kriterien in
der Betrachtung weiterentwickelt hat.
13
3. Begriffserklärungen und Erläuterungen
3.1. Die Funktion des Kommentars in der Sportberichterstattung des
Fernsehens
Als medienspezifische Berichterstattung im Fernsehen wird der Kommentar
nach Hackforth (1975) als Kommentierung und Erläuterung der audio-visuellen
Eindrücke verstanden. Die optischen Reize müssen durch zusätzliche
Informationen ergänzt werden. Das ohnehin zu Erkennende braucht nicht
erläutert zu werden. Vollständige, grammatikalisch einwandfreie Sätze und eine
ruhige, das Ereignis begleitende Stimme, dazu einige kritische Informationen
sollten die Kommentierung begleiten. Das visuelle Element muss in der
Fernsehsportberichterstattung bei allen Überlegungen im Vordergrund stehen.
Die spezielle Präsentation der Ereignisse muss sich dieser Maxime beugen.
(vgl. Hackforth,1975, S.280)
Kommentar ist dabei nicht nur Information, sondern auch Resonanz, Wieder-
Tönen der bei Sportereignissen grundsätzlich positiven Stimmung, sowohl der
Zuschauer am Ort des Geschehens, als auch der Zuseher vor den
Fernsehbildschirmen. Ist der Kommentator selbst Zeitzeuge (Augen- und
Ohrenzeuge) eines sportlichen Wettkampfes, kann er die jeweilige Stimmung
besser vermitteln, indem er sich zum Sprecher dieser wunderbaren
Stimmungen macht und versucht diese auf den Fernsehzuschauer übergreifen
zu lassen.
Der Kommentator, kommunikationswissenschaftlich als Kommunikator
bezeichnet, ist der stellvertretende Zuschauer, der mit allen Zuschauern an den
Fernsehgeräten die Hoffnungen und Befürchtungen des Ausgangs des
sportlichen Wettkampfes teilt. Er gibt den Zusehern vor den Bildschirmen
,,Stimme", in dem er für sie verbalisiert, was sie auch sagen würden. Aus
diesem Grund muss ein Sportreporter, der für eine deutsche Fernsehanstalt
kommentiert auch Emotionalität zum Ausdruck bringen, wenn er für ein
überwiegend deutsches Publikum berichtet. Die nationale ,,Brille", insbesondere
mit den emotionalen Reaktionen, ist somit nach Hattig (1994) bei der
14
Kommentierung unverzichtbar. (vgl. Hattig,1994, S.284) Ein solches Verhalten
ist wichtig für eine nationale Fernsehanstalt, macht diese Art der
Kommentierung medienkonform, schon weil Bildvorlagen zunächst nur das
Ereignis bildlich wiedergeben, wenn auch in entsprechender Färbung und
perspektivischer Aufbereitung. Der Kommentator ist jedoch derjenige, der als
stellvertretender Zuschauer solcher Bilder die emotionale Resonanz mitliefert,
in die dann die Zuseher mit einstimmen können und sich somit verstanden
fühlen.
Kommentatoren transportieren nicht nur die Stimmungen und Reaktionen des
Publikums vor Ort. ,,Sie würden auch emotional mitgehen, wenn vor leeren
Rängen gespielt würde, da es für Kommentatoren um nichts anderes geht, als
die Hoffnungen und Befürchtungen, die mit dem Ausgang des Wettkampfes
verknüpft sind, und die das Drama des Ereignisses ausmachen, durch
Verbalisierung emotional zu spiegeln: Das ist vom Reporter einzubringende
Resonanz, da ist er Verstärker und gelegentlich auch Dämpfer" (Hattig,1994,
S.284f).
3.2. Sportsprache als Sondersprache
Das wissenschaftlich am häufigsten untersuchte Teilgebiet der Sportpublizistik
ist die Sportsprache. Dies nicht zuletzt deshalb, weil es sich hierbei um ein
interdisziplinäres Forschungsfeld handelt, das sowohl von Linguisten,
Germanisten, Historikern und Publizisten bearbeitet wird. Die Vielzahl der
Arbeiten beschäftigen sich mit den klassischen Medien Presse, Hörfunk und
Fernsehen, aber auch mit dem Begriff Sportsprache, und allgemein mit der
Sprache des Sports oder der ,,Sprache [...] der Sportreporter" (Rost,1972,
S.124).
Die Einordnung der Sportsprache in ein allgemeines Sprachsystem (vgl.
Abbildung 1) verdeutlicht ihre Herkunft als Sondersprache, als schichten- und
standesunabhängig und charakterisiert sie durch zwei Kategorien: die
Fachsprache und den Jargon. (vgl. Hackforth,1975, S.281) Die Sportsprache ist
,,die wichtigste und einflußreichste unter den heutigen Sondersprachen"
15
(Dankert,1969, S.1), zugleich ,,Sprache einer Erscheinung der Gesellschaft"
(Becker,1973, S.37), und bezieht all jene mit ein, die sich in irgendeiner Form
für den Sport interessieren und darüber kommunizieren. Sportsprache gilt nach
Dankert (1969) in erster Linie als ein besonderer Wortschatz, der aus einem
fest normierten Kanon von Begriffen besteht. Sie wird einerseits gegen den
Sportjargon abgegrenzt, der zwar einmalig als Quellbereich für die
Sportsprache mit in Betracht gezogen, aber laut Dankert (1969) unter ganz
anderen Bedingungen gesehen wird. Andererseits hebt sich die Sportsprache
deutlich von der Sprache der Sportberichterstattung ab, von der man annimmt,
dass sie ihr eigenes Vokabular entwickelt habe, das höchstens kurzfristig und
peripher für die eigentliche Sportsprache relevant wird. (vgl. Dankert,1969, S.2f)
Der Stand bei der Erforschung der Sportsprache ist laut Dankert (1969) aber
immer noch unbefriedigend, weil die Vorbedingungen des sprachlichen
Materials dieser Sondersprache bisher kaum reflektiert wurden. Sofern man
überhaupt gefragt hat, wie und von wem die deutsche Sportsprache geprägt
wurde, gab man sich nach Dankert (1969) mit dem pauschalen Hinweis auf die
Gruppe der Sportler zufrieden. Max Ostorp bezeichnet die deutsche
Sportsprache als ,,eine sehr große, verdienstvolle sprachschöpferische Arbeit",
die ,,der deutsche Sport" geleistet habe, und führt aus, ,,daß der deutsche
Sportler begann, selbst sprachschöpferisch zu wirken, also die vielen neuen
fremdländischen Ausdrücke und Bezeichnungen für alle diese neuen Dinge
durch deutsche Wörter zu ersetzen" (Ostorp,1940, S.60).
16
Abbildung 1: Einordnung der Sportsprache in das allgemeine Sprachsystem
GEMEINSPRACHE
Hochsprache, z.B. Hochdeutsch
Schriftsprache
UMGANGSSPRACHE
Fachsprache
spezielle Termini
Vielfältige und differenzierte
Sprache. In ihren extremen
schichten- und
Erscheinungen sowohl der
Sondersprachen standesunabhän-
SPORTSPRACHE
Gemeinsprache
als
auch
gige
Sprachen
zur Mundart tendierend.
Jargon
freie Wort-
schöpfungen,
Entlehnungen
MUNDART
Geographisch fixierte Sprache
Einwurf
11-m-Punkt
Kopfball
Mittelstürmer
Fußball
Abseits
Riesenfelge
Fachsprache
Turnen
Grätsche
Oberarmstand
Salto
Schraube
Eishockey
Penalty
Crosscheck
Scheibe
Befreiungsschlag
Bully
SPORTSPRACHE
Emmas linke Klebe
Sturmtank
Bomber
der
Nation
Abstauber
Hammer
knallte
dröhnende
Rechte
Jargon
(Sportberichterstattung)
Bombe
in die Hose
Schiri
Putzen
fegte
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Hackforth,1975, S.284f
17
3.2.1. Fußballsprache als Beispiel für eine Fachsprache
Jede Sportart, darunter auch der Fußball, verfügt über eine eigene
Fachsprache mit speziellen sportartabhängigen Termini und ebenso hat jede
Form der Berichterstattung, wie z.B. Live-Übertragungen, Aufzeichnungen,
Kurzreportagen und Filmberichte, eigene verbale Normen entwickelt. Dazu
haben etliche Spielsituationen nach Möller (1957) ,,terminologisch festgelegte
Begriffe" (Möller,1957, S.366), so dass den Sportreporter ein starres Sprach-,
Spiel- und Mediengerüst in seiner individuellen Entfaltung hemmt.
Fußballsprache und Sportsprache sind keine Synonyme; die Struktur der
Fußballsprache kann nicht unbedingt mit der Struktur der Sprache anderer
Sportdisziplinen gleichgesetzt werden. Fußballsprache ist laut Dankert (1969)
die verbreitetste und bekannteste Sondersprache des Sports. Dies hängt nicht
zuletzt damit zusammen, dass keine andere sportliche Disziplin in den
Massenkommunikationsmitteln so ausführlich erörtert und dargestellt wird.
Auf die allgemeine Bedeutung, die der sprachlichen Verständigung zwischen
Kommunikator und Rezipient für die Fachsprache überhaupt zukommt, hat der
Zeitungswissenschaftler Prakke (1968) hingewiesen: ,,Kommunikation setzt
voraus, daß Kommunikator und Rezipient an einem für beide verstehbaren
Zeichensystem teilnehmen [...]. Um die Verständigungsbasis zu erweitern, ist
es nötig, den von beiden Partnern im Kommunikationsprozeß eingesetzten
Zeichenvorrat möglichst zur Deckungsgleichheit zu bringen.
Kommunikationsprozesse implizieren die Kongruenz der Zeichenvorräte als
Ideal" (Prakke,1968, S.87).
Auch für die Anfänge der Sportsprache und hierbei im Speziellen bei der
Fußballsprache wird man die von Prakke (1968) angedeutete Erweiterung der
Verständigungsbasis zwischen Kommunikator und Rezipient berücksichtigen
müssen. In diesem unauffälligen, nie durch ernsthafte Sprachschwierigkeiten
aufgehaltenen Prozess kommt es nach Dankert (1969) in der
Fußballkommunikation zu einer de facto vollzogenen Anerkennung
fachsprachlicher Termini.
18
Von den zahlreichen Bezeichnungen, die in der öffentlichen Kommunikation
angeboten und sozusagen zur Diskussion gestellt wurden, haben sich einige
wenige als Fachwörter behaupten können. Somit ist die vom Sportkommentator
geleistete Arbeit nicht als rein reproduktiv aufzufassen. Er beschleunigt nicht
nur den Prozess des Geläufigwerdens, sondern ist produktiv an der Schaffung
und Erweiterung der Fachsprache beteiligt. (vgl. Dankert,1969, S.9ff)
Das Gebiet des Fußballsports empfiehlt sich auch deshalb als Gegenstand
dieser Untersuchung, weil hier ein ausgeprägter Fachwortschatz zur Verfügung
steht, aber auch die direkte private Kommunikation in diesem Sportressort
ebenso lebendig ist, wie die öffentliche. Sowohl das dem Kommentator zur
Verfügung stehende Vokabular, als auch Stil und Stiltendenzen in der
Kommentierung, können nach Dankert (1969) in diesem Bereich des Sports
am besten untersucht werden.
3.2.2. Fußballjargon als Beispiel für eine Sondersprache
Mit dem Terminus Fußballsprache pflegt man nach Dankert (1969) sowohl die
Fachsprache des Fußballs, als auch den Jargon der Fußballspieler und Fußball
interessierten Zuschauer zu bezeichnen und somit mindestens zwei sprachliche
Bereiche zusammen zu fassen, die sich zwar ergänzen, aber in ihren
Grundfunktionen und ihrem Sprachmaterial deutlich zu unterscheiden sind. Die
Fachsprache muss über terminologische Bestimmungen und Konventionen
verfügen, um die im Fußballspiel verbindlichen Normen eindeutig zu fixieren.
Gegenüber der vorhandenen und notwendigen Starrheit und Bestimmtheit der
Fachsprache bietet der Jargon laut Dankert (1969) die Möglichkeit eines
ungezwungeneren und unverbindlicheren Sprechens. (vgl. Dankert,1969,
S.21ff) Die Fachsprache basiert auf einer Reihe von terminologischen
Grundbestimmungen, die den äußeren Ablauf eines Fußballspiels festlegen,
und die als so verbindlich anerkannt werden, dass man im Jargonvokabular
vergeblich nach bedeutungsähnlichen Varianten oder Entsprechungen sucht.
Als Beispiele seien hier die Fachbegriffe Elfmeter, Handspiel und Schiedsrichter
genannt. Diese Begriffe können zwar mundgerechter und elliptisch gebraucht
19
werden, wie z.B. Elfer (statt Elfmeter), Hand (statt Handspiel) oder Schiri (statt
Schiedsrichter), scheinen jedoch von einer so sachorientierten Präzision zu
sein, dass sich jeder weitere Kommentar im Jargonstil erübrigt.
Ein besonderer Wille zur Bildung von Jargonwörtern scheint dagegen nach
Dankert (1969) von fachsprachlichen Bezeichnungen für
Ausrüstungsgegenstände und Geräte, wie z.B. dem Ball, Fußballschuhen,
Fußballtor und allgemeineren Bezeichnungen wie z.B. Fußball spielen, unfair,
regelwidrig, den Ball spielen, schießen etc. auszugehen. Für die Begriffe Ball,
Fußball, Lederball gibt es im Jargon eine ganze Reihe von Umschreibungen,
die eine Distanzierung sowohl von der Neutralität der Sachbezeichnungen als
auch vom Wortschatz der Fußball-Laien ermöglichen. Die Jargonwörter,
Kirsche, Pille, Ei etc. geben, wenn man sie nach ihrem Bildgehalt zu
interpretieren versucht, eine bestimmte Verformung des umschriebenen
Gegenstands an, indem die Form des Fußballs für den Gegenstand selbst
gesetzt wird.
Die in diesen Metaphern laut Dankert (1969) mitschwingende Ironie darf nicht
darüber hinweg sehen lassen, dass sie in der privaten Kommunikation nicht zur
ironischen Distanzierung, sondern im Gegenteil zur Akzentuierung einer engen
Vertrautheit mit dem Fußballspiel dienen. Überhaupt ist nach Dankert (1969)
ein persönliches Engagement für fast alle Jargonprägungen charakteristisch
und als eine Ursache dafür anzusehen, dass die meisten Fußball Jargonwörter
nicht auf eine definitorisch klar abzugrenzende Bedeutung fixiert werden
können. Vielmehr haben sie über den sachlichen Aussagewert hinaus noch
einen gefühlten Bedeutungswert, der zur ,,malerischen" Abbildung eines
Jargonworts wesentlich beiträgt. (vgl. Dankert,1969, S.43f)
3.3. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist anzumerken, dass die Forschung in Bezug auf die
Sportsprache, wie auch Dankert (1969) in seinen Untersuchungen feststellte,
sich häufig zu sehr auf die Sprache der Sportler fokussiert. Fußballsprache und
Fußballjargon sind ebenfalls relativ weitreichend untersucht worden. Die
Begrifflichkeiten der Sportart Fußball sind zudem den meisten Zuschauern
20
bekannt. Der Kommentator ist der Kommunikator für eine heterogene
Zuseherschaft. Reporter müssen somit die Fußball spezifischen Fachbegriffe
sehr genau in ihren Kommentar einbinden und dürfen diesen damit nicht
überfrachten. Wissenschaftliche Analysen zu Sportberichterstattungen und
Live-Kommentaren im Fernsehen müssen sich daher mehr als bisher
untersucht auf die Aussagen der Reporter zu bestimmten Themen beziehen.
Zusätzlich muss das Fachwissen der Berichterstatter analysiert werden, sowie
die Sportsprache der Reporter bzw. Kommentatoren.
4. Die Kommentatoren der Fußball-Länderspiele
4.1. Der ARD-Kommentator
Reinhold Beckmann:
Geboren wurde Reinhold Beckmann am 23. Februar 1956 in Twistringen. Er
absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker an der
Universität Köln. Dort studierte er weiter Germanistik, Theater-, Film- und
Fernsehwissenschaften. Zum Fernsehen kam Beckmann 1980, damals als
freier Journalist für den Westdeutschen Rundfunk (WDR). Im Jahre 1985
begann er mit der Erstellung einiger TV-Reportagen auch für die Sportredaktion
des WDR zu arbeiten. Es folgten einige Jahre als Moderator verschiedener
Sendungen beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), ehe Beckmann 1989 zum
WDR zurückkehrte. Im nächsten Jahr wechselte er zum Privatfernsehen, um
zunächst beim Pay-TV Sender Premiere als Leiter der Sportredaktion
einzusteigen. Ab 1992 leitete Beckmann für SAT 1 den Programmbereich Sport
und rief die Fußballsendungen ,,ran" und ,,ranissimo" ins Leben. Das verhalf ihm
zum Aufstieg zum Programmdirektor des Privatsenders. 1999 erfolgte die
Rückkehr zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen als Moderator der ARD.
Außerdem entwickelte und produzierte Beckmann die Talkshow ,,Beckmann",
die seither regelmäßig montags unter seiner Moderation ausgestrahlt wird.
21
Neben seinen TV-Auftritten ist Beckmann zudem als Geschäftsführender
Gesellschafter seiner Produktionsfirma ,,Beckground TV + Filmproduktion
GmbH & Co. KG, Hamburg" tätig. Er schreibt als Kolumnist für die Hamburger
Wochenzeitung ,,Die Zeit" und für die ,,Welt am Sonntag". (vgl. Beckmann,
Reinhold: Biografie. In: Focus (Online-Ausgabe),
http://www.biografien.focus.msn.de/templ/te_bio.php?PID=1773&RID=1
,
19.10.2005)
Reinhold Beckmann soll am 9. Juli 2006 das Endspiel der Fußball-
Weltmeisterschaft 2006 in Berlin für die ARD kommentieren.
4.2. Die ZDF-Kommentatoren
Wolf-Dieter Poschmann
Geboren am 22. Mai 1951 in Köln absolvierte Wolf-Dieter Poschmann zunächst
seinen Wehrdienst, wo er mit Leichtathletik begann und in die
Sportfördergruppe für talentierte Läufer aufgenommen wurde. 1972 startete
Poschmann in Köln ein Germanistik- und Pädagogikstudium, welches er
zwischendurch unterbrach, um ein Sportstudium an der Sporthochschule Köln
zu beginnen. Dieses Studium schloss er ab und vollendete darauf folgend auch
noch sein Germanistik- und Pädagogikstudium auf Lehramt mit dem ersten
Staatsexamen. Während seiner Studienjahre betrieb er weiter aktiv
Leichtathletik und wurde 15 Mal in die Nationalmannschaft des Deutschen
Leichtathletik Verbandes (DLV) berufen. Hier durfte er auch an zwei
Universaden teilnehmen. Zum Fernsehen gelangte Wolf-Dieter Poschmann
1985, zunächst als Hospitant, dann als freier Journalist und schließlich, seit
1993, als Festangestellter Mitarbeiter in der ZDF-Hauptredaktion ,,Sport". 1995
stieg er dann zum immer noch tätigen Leiter der ZDF-Hauptredaktion ,,Sport"
auf. Poschmann moderiert seit 1994 ,,das aktuelle Sportstudio" im Wechsel mit
mehreren Kollegen und ist Live-Reporter und Moderator verschiedener
22
sportlicher Großveranstaltungen, sowie Experte für die Sportarten
Leichtathletik, Eisschnelllauf und Fußball. (vgl. Von Meisel bis Kerner: Die
Moderatoren des SPORTstudios. In: ZDF (Online),
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/8/0,1872,2060072,00.html
, 19.10.2005)
Béla Réthy
Der am 14. Dezember 1956 in Wien geborene Béla-Andreas Réthy studierte
nach dem Abitur zunächst Publizistik, Soziologie und Ethnologie an der
Johannes-Gutenberg Universität in Mainz. Zum Fernsehen kam Réthy 1979
nach erfolgreichem Studium als Freier Mitarbeiter der ZDF-Hauptredaktion
,,Sport". 1987 folgte eine Festanstellung als hauptamtlicher Redakteur der ZDF-
Hauptredaktion ,,Sport". Béla Réthy wurde zunächst als Reporter bei
Motorsport-Übertragungen eingesetzt, ehe er im März 1992 als Live-Reporter
bei Fußball-Länderspielen im ZDF kommentieren durfte. In dieser Zeit
übernahm er auch die abwesenheitsvertretende Leitung der ZDF-Redaktion
,,Sport-Spiegel" und stieg im Jahre 1994 zum Leiter der ZDF-Redaktion ,,ZDF-
SPORTstudio" auf. Béla Réthy ist in der ZDF-Hauptredaktion ,,Sport" Fachmann
in den Sportarten Fußball, Wassersport und Nordischer Skisport. (vgl. ZDF-
Medienforschung, E-Mail Antwort von Gabriele Berg am 20.10.2005 an das
ZDF-Medienforschungssekretariat,
Berg.G@zdf.de
)
Béla Réthy wird das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Costa Rica der
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 am 9. Juni 2006 in München für das ZDF
kommentieren.
Abschließend ist zu erwähnen, dass sowohl die ARD als auch das ZDF jeweils
im Wechsel drei Kommentatoren als Live-Reporter für die Spiele des FIFA-
Confederations-Cup 2005 eingesetzt haben.
23
5. Methodisches Vorgehen und Analysedesign
Bei der Analyse des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen des FIFA-
Confederations-Cup muss darauf geachtet werden, dass die Untersuchung der
Spiele den Kriterien der Wissenschaftlichkeit genügt. Angestrebt wird ein
Höchstmaß an Objektivität (bezeichnet die Offenlegung des Verfahrens) und
Reliabilität (wird auch als Verlässlichkeit bezeichnet; das Erhebungsinstrument
gilt als verlässlich, wenn verschiedene Personen unabhängig voneinander das
selbe Material untersuchen - meistens eine typische oder repräsentative
Stichprobe aus den zu untersuchenden Mitteilungen im
Kommunikationsprozess - und die Ergebnisse der unabhängigen Analysen
hinreichend übereinstimmen). Weiter wird Wert gelegt auf Validität (auch als
Gültigkeit bezeichnet; allgemein gilt eine Untersuchung bzw. Analyse dann als
gültig, wenn sie tatsächlich das misst, was sie zu messen vorgibt). Die
einzelnen Schritte der Erforschung und die Ergebnisse müssen also
intersubjektiv nachvollziehbar, überprüfbar und diskutierbar sein.
Mit anderen Worten muss die Untersuchung derartig gestaltet werden, dass bei
einer Wiederholung derselben unter gleichen Bedingungen gleiche Ergebnisse
erzielt werden.
Bei dem in dieser Arbeit vorgestellten Forschungsvorhaben geht es im
Wesentlichen um die Untersuchung von Mitteilungen im
Kommunikationsprozess. Als klassische Methode für diese Analyse bietet sich
hierfür die Inhaltsanalyse an. Wie bereits in der Einleitung erwähnt ergibt eine
kritische Reflexion der bisher erschienenen Literatur zur Thematik Live-
Kommentierung von Fußball-Länderspielen, dass die Forschung bisher nur
unzureichend diesem Aufgabenfeld wissenschaftlich Betrachtung
entgegengebracht hat.
,,Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen,
intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler
Merkmale von Mitteilungen; (häufig mit dem Ziel einer darauf gestützten
interpretativen Inferenz)" (Früh,2004, S.25). Sie bietet sich in der Thematik
dieser Untersuchung an, da durch die Inhaltsanalyse eventuelle Aussagen über
24
den gesamten Kontext der Live-Kommentierung von Fußball-Länderspielen
getroffen werden können.
Diese Definition verzichtet bewusst auf Begriffe, wie ,,objektiv", ,,quantitativ" und
,,manifest", wie sie die Definition von Berelson (1952) (,,Content Analysis is a
research technique for the objective, systematic, and quantitative description of
the manifest content of communication") enthält. Die Begriffe sind sicherlich
nicht falsch, aber Früh (2004) ist der Meinung, dass sie in der Vergangenheit
der Forschung oft mehr Verwirrung gestiftet, als zur Klärung beigetragen haben.
Zudem sind die damit angesprochenen Kriterien mit einer etwas modifizierten
Bedeutung auch in der Definition von Früh (2004) enthalten.
Der Begriff ,,empirische Methode" bezeichnet die Art und Weise, in der die
Inhaltsanalyse zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führt bzw. die Modalität des
Zugangs zur Realität. Empirisch ist das Vorgehen dann, wenn das
Erkenntnisobjekt ein wahrnehmbares und intersubjektiv identifizierbares
korrelatives Objekt in der Realität besitzt. Dies darf nicht im Sinne einer
konkreten Existenz der Erkenntnisobjekte missverstanden werden.
Beispielsweise sind Werte und Normen keine realen Objekte, sondern
Konstrukte, die sich an Hand beobachtbarer Merkmale erkennen und
unterscheiden lassen. Beobachtbar und wahrnehmbar bedeuten in diesem Fall
nicht nur primärsinnliche Erkenntnisse, wie z.B. riechen, sehen, hören, tasten
etc.. Vielmehr geht es um innerpsychische Vorgänge, wie Erlebnisse und
Vorstellungen, sofern es gelingt, sie systematisch zu objektivieren. Dies kann
etwa dadurch erfolgen, dass die Vorstellungen und Erlebnisse von der
betreffenden Person selbst nach vorgegebenen Kriterien in ein allgemein
gültiges, verständliches Zeichensystem codiert werden. (z.B. verbale
Kommentierung von Spielszenen im Spielablauf) Die Begriffe ,,beobachtbar"
und ,,wahrnehmbar" bezeichnen lediglich die prinzipielle Möglichkeit, einen
gemeinten Tatbestand intersubjektiv zu reproduzieren, indem angegebene
Operationen erneut durchgeführt werden. Beobachtete empirische
Sachverhalte werden registriert bzw. in Daten überführt. Die Methode bestimmt
dabei die Art und Weise des Zugriffs auf die Realität und die Modalität der
Daten. Als Daten kann man so inhaltsanalytische Codierungen erhalten. (vgl.
Früh,2004, S.25ff)
25
Zum Messen dieser Daten stehen verschiedene ,,empirische Messinstrumente"
und ,,empirische Erhebungstechniken" zur Verfügung. Alle wählen die gleiche
Art des Zugangs zur Realität und produzieren den selben Datentypus. Nach
Früh (2004) wird beim Messen ein empirisches Relativ, das heißt, ein
beobachteter Realitätsausschnitt, in ein numerisches (Zahlen-) Relativ
(Datenstruktur) überführt. Dieses numerische Relativ soll das empirische
Relativ homomorph abbilden. Dies wiederum bedeutet eine einseitige
Abbildungsfunktion zwischen empirischer Struktur und numerischer
Datenstruktur: will man z.B. die Länge der Ski messen, so muss jeder
möglichen Skilänge eine reelle Zahl zugeordnet werden können, aber nicht
notwendig muss jeder reellen Zahl eine Skilänge entsprechen. (eigenes
Beispiel in Anlehnung an Orth,1974, S.17) Das Relativ muss also analoge
Elemente und Beziehungen aufweisen.
In dieser Untersuchung wird als konkretes Mittel das ,,Kategoriensystem mit
Codieranweisungen" verwendet, mit dessen Hilfe die Beobachtungen des Live-
Kommentars von Fußball-Länderspielen in Daten übergeleitet werden. Beim
Codieren werden sukzessiv bestimmten Mitteilungsmerkmalen Kennziffern für
Kategorien zugeordnet, die im Grunde nur als Namen dieser Kategorien
fungieren. Bis hierher haben wir es also in der Regel lediglich mit
systematischen Beobachtungen zu tun, einer laut Orth (1974) notwendigen
Vorbedingung des Messens. (vgl. Orth,1974)
In der Definition von Früh (2004) wird weiter die Forderung nach Systematik
genannt. Sie richtet sich einerseits auf eine klar strukturierte Vorgehensweise
beim Umsetzen der Forschungsaufgabe in eine konkrete
Untersuchungsstrategie und andererseits auf deren konsequente, durchgängig
invariante Anwendung dieser auf das Untersuchungsmaterial. Zur Umsetzung
in konkrete Forschungsoperationen gehören die Formulierung empirisch
prüfbarer Hypothesen, die Festlegung des relevanten Untersuchungsmaterials
(drei Spiele des FIFA-Confederations-Cup), Analyse-, Codier- und
Messeinheiten. Auch die Entwicklung des Kategoriensystems mit Definitionen,
die allgemeinen Codieranweisungen und die Überprüfung von Reliabilität und
Validität sind erforderlich.
26
Die dritte in der Definition von Früh (2004) enthaltene Forderung ist die nach
Objektivität des Verfahrens und gleichzeitig ein ganz zentrales
Qualitätsmerkmal jeder Inhaltsanalyse. Die Methode soll vom analysierenden
Subjekt abgespalten werden, das heißt, die Ergebnisse müssen intersubjektiv
nachvollziehbar und somit auch reproduzierbar, kommunizierbar und kritisierbar
sein. Jede Inhaltsanalyse, die diesem Qualitätskriterium nicht genügen kann, ist
ohne jede Aussagekraft und damit irrelevant.
Sinn dieser Inhaltsanalyse ist es, die Komplexität der Live-Kommentierung von
Fußball-Länderspielen in Bezug auf verschiedene Fragestellungen zu
reduzieren und kommunizierbar zu machen. Die vorliegenden Aussagen in der
Kommentierung sollen mit Hilfe des Kategoriensystems strukturiert und in
einem Codebuch zusammengefasst werden. Die einzelnen Kategorien müssen
entsprechend den Vorgaben eindimensional, valide, trennscharf, erschöpfend
und unabhängig sein. (vgl. Friedrichs,1990)
Um mit Hilfe der Inhaltsanalyse Aussagen über die Live-Kommentierung von
Fußball-Länderspielen machen zu können, müssen die Hypothesen so
formuliert sein, dass sie die Forschungsfrage beantworten.
5.1. Forschungsleitende Fragen
Die Untersuchung des Live-Kommentars von Fußball-Länderspielen des FIFA-
Confederations-Cup der Fernsehsender ARD und ZDF lässt sich in folgende
forschungsleitende Fragen strukturieren:
Welche sprachlichen Mittel werden zur Kommentierung eingesetzt?
Wie häufig nehmen die Kommentatoren Einschätzungen und
Bewertungen vor?
Wie setzen die Kommentatoren ihr Fachwissen ein?
Welche Themen werden berücksichtigt?
27
5.2. Hypothesen
Im Kontext der Beantwortung der forschungsleitenden Fragen lassen sich
folgende Hypothesen formulieren, die im Rahmen dieser Untersuchung auf der
Grundlage der empirisch gewonnenen Ergebnisse verifiziert oder falsifiziert
werden. In der Wissenschaftstheorie versteht man unter der Verifizierung einer
Hypothese den Nachweis, dass diese Hypothese richtig ist und unter der
Falsifizierung einer Hypothese den Nachweis, dass diese Hypothese ungültig
ist.
Hypothese 1:
Der Live-Kommentar von Fußball-Länderspielen beschränkt sich nicht nur
auf bloße Informationen zum tatsächlichen Spielgeschehen (,,1:0
Mentalität")
Hackforth (1975) hat den Mangel an Hintergrundberichterstattung in
Sportsendungen des Fernsehens nachgewiesen und dem Fernsehsport-
Journalismus die Metapher ,,1:0 Mentalität" gegeben. Er prangert an, ,,[...] daß in
Live-Übertragungen, Aufzeichnungen und Filmberichten jedoch mehr als nur
Ereignis und Ergebnis oder besondere Vorfälle vermittelt werden müßten"
(Hackforth,1975, S.245).
Vermutet wird, dass sich im Fußball die Kommentierung von Live-
Übertragungen von Länderspielen nicht nur auf das Ereignis und das
tatsächliche Spielgeschehen beschränken soll. Es bleibt genügend Zeit für
hintergründige Informationen und Anmerkungen.
Hypothese 2:
Die Kommentatoren verfügen über eine gute Fachkompetenz
Bei der Übertragung von Sportereignissen aller Sportarten setzt das Fernsehen
gezielt Kommentatoren ein, die über genügend Fachkompetenz verfügen
28
sollen, beispielsweise ehemalige aktive (Leistungs-) Sportler oder fachkundige
Journalisten. (vgl. Hattig,1994,S.274ff)
Insofern liegt die Annahme nahe, dass sich auch die Kommentatoren von
Fußball-Länderspielen in dieser Sportart auskennen und dem Publikum
Zusatzinformationen über das Spielgeschehen hinaus zukommen lassen
können. Gefragt sind dabei z.B. Kenntnisse über die Spieler und Trainer, aber
auch Erklärungen zur Taktik und zu taktischen Maßnahmen während des
Spiels, sowie zu den Regeln und eventuellen Regelauslegungen.
Hypothese 3:
Die Kommentatoren greifen häufig zu Superlativen, hyperbolischem
Sprachstil oder Metaphern
Kroppach (1970) kam bei seiner Untersuchung zu Beginn der 70er Jahre zu
dem Ergebnis, die Fernsehsportberichterstattung sei zu sorglos in der
Wortwahl. (vgl. Kroppach,1970, S.136f)
Auch 30 Jahre später stellte Wernecken (2000) in einer Studie über nationale
Stereotypen in den Medien zum Thema Sport fest, dass eine ausgeprägte
Tendenz zu Übertreibungen bestehe. (vgl. Wernecken,2000, S.239)
Es wird angenommen, dass auch die Kommentatoren von Fußball-
Länderspielen in dieser Hinsicht keine Ausnahme bilden.
Hypothese 4:
Die Kommentatoren tendieren dazu, das zu verbalisieren, was als Bild
eindeutig zu sehen ist
Hattig (1994) hat in seiner Untersuchung zu den Aufgaben des
Sportkommentators nachgewiesen, dass Kommentatoren häufig dazu neigen,
dass zu verbalisieren, was im Bild für den Fernsehzuschauer eindeutig zu
sehen ist. (vgl. Hattig,1994, S.274f)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836621458
- Dateigröße
- 741 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- sportjournalismus live-kommentar fußball länderspiel fernsehübertragung
- Produktsicherheit
- Diplom.de