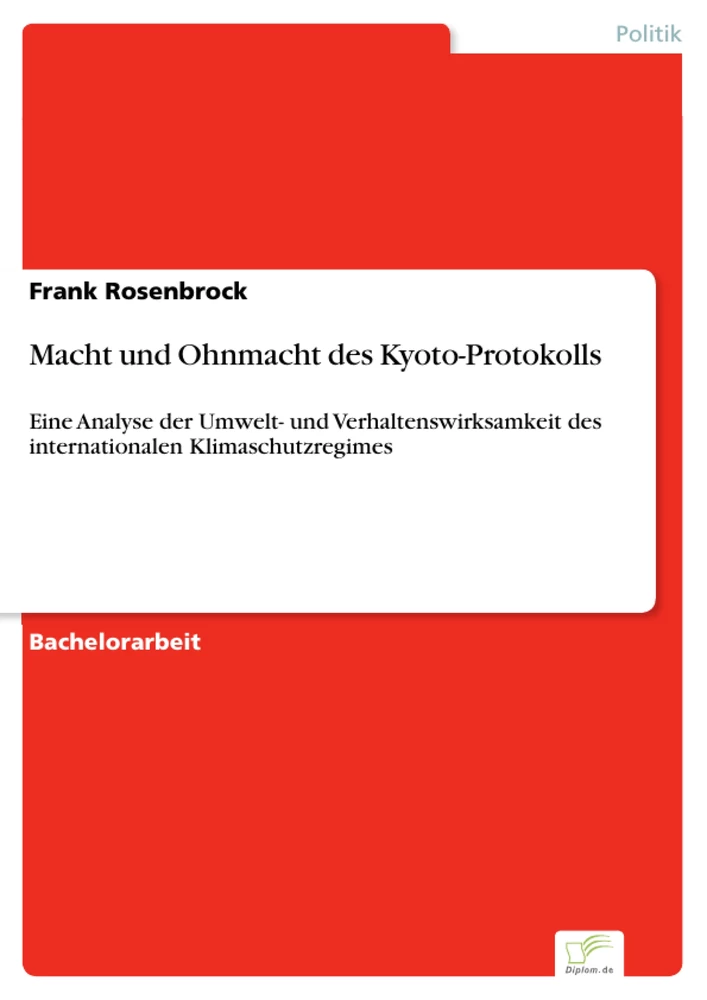Macht und Ohnmacht des Kyoto-Protokolls
Eine Analyse der Umwelt- und Verhaltenswirksamkeit des internationalen Klimaschutzregimes
Zusammenfassung
Ob Stürme, Überschwemmungen oder Dürren. Die extremen Wetterereignisse haben in den vergangen Jahrzehnten drastisch zugenommen und die volkswirtschaftlichen Kosten, die auf solche Wetterereignisse zurückzuführen sind, sind enorm gestiegen. Kaum jemand zweifelt noch ernsthaft daran, dass es sich hierbei um Auswirkungen des Klimawandels handelt, der durch den übermäßigen Ausstoß von Treibhausgasen und somit vom Menschen verursacht wird. Die Frage, die sich die Menschheit daher stellen muss, ist, wie der bereits einsetzende Klimawandel aufzuhalten ist, präziser gesagt wie die Treibhausgase, insbesondere die CO2-Emissionen gesenkt werden können. Verfolgt man den öffentlichen Diskurs scheint die Antwort eindeutig zu sein. Demnach kann die Bekämpfung klimatischer Veränderungen nur über die Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft geschehen. Das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005 durch die Ratifizierung Russlands ist dementsprechend als ein Meilenstein in der Geschichte des Klimaschutzes gewertet worden. In diesem Protokoll verpflichten sich die Industrieländer, ihre CO2-Emissionen im Zeitraum von 2008-2012 um durchschnittlich 5,2Prozent zu senken, bezogen auf das Basisjahr 1990. Trotz des Wissens, dass dies erst ein erster Schritt ist und weitere Schritte erfolgen müssen, sind die Hoffnungen groß, die mit dem internationalen Klimaschutzregime und seinem Kyoto-Protokoll verbunden werden. In Zukunft wird daher weiterhin gelten, auf eine verbesserte Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls hinzuarbeiten sowie ein vielversprechendes Nachfolgeprotokoll nach 2012 zu erzielen. Erst kürzlich auf dem G8-Gipfel in Japan wurden die Hoffnungen in die internationale Politik nochmals genährt, als die Industrieländer erneut ihre Zusammenarbeit bekräftigten und ihr Anliegen demonstrierten, den CO2-Ausstoß bis 2050 um die Hälfte senken zu wollen.
Die hier zum Ausdruck gekommene allgemeine Euphorie, die das Kyoto-Protokoll bei vielen hervorruft, kann jedoch nicht von allen Beobachtern der internationalen Klimapolitik geteilt werden. Während einige das Kyoto-Protokoll massiv kritisieren und kaum eine Wirksamkeit auf den Klimaschutz ausmachen können, gehen andere noch einen Schritt weiter und bewerten das Kyoto-Protokoll mit seinen Instrumenten sogar als hinderlich und plädieren für eine Auflösung des Vertrags. Aufbauend auf dieser Kontroverse möchte ich mich daher mit der Wirksamkeit internationaler Klimapolitik beschäftigen und der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Dieses mal hat die Krise einen Zeitzünder, die Naturvorgänge lassen das volle Ausmaß der Schäden, die wir anrichten, nicht sofort hervortreten[1] (Al Gore)
1. Einleitung
Ob Stürme, Überschwemmungen oder Dürren. Die extremen Wetterereignisse haben in den vergangen Jahrzehnten drastisch zugenommen und die volkswirtschaftlichen Kosten, die auf solche Wetterereignisse zurückzuführen sind, sind enorm gestiegen[2]. Kaum jemand zweifelt noch ernsthaft daran, dass es sich hierbei um Auswirkungen des Klimawandels handelt[3], der durch den übermäßigen Ausstoß von Treibhausgasen – und somit vom Menschen – verursacht wird. Die Frage, die sich die Menschheit daher stellen muss, ist, wie der bereits einsetzende Klimawandel aufzuhalten ist, präziser gesagt wie die Treibhausgase, insbesondere die CO2-Emissionen gesenkt werden können. Verfolgt man den öffentlichen Diskurs scheint die Antwort eindeutig zu sein. Demnach kann die Bekämpfung klimatischer Veränderungen nur über die Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft geschehen. Das Inkrafttreten des Kyoto-Protokolls im Februar 2005 durch die Ratifizierung Russlands ist dementsprechend als ein Meilenstein in der Geschichte des Klimaschutzes[4] gewertet worden. In diesem Protokoll verpflichten sich die Industrieländer[5], ihre CO2-Emissionen im Zeitraum von 2008-2012 um durchschnittlich 5,2% zu senken, bezogen auf das Basisjahr 1990. Trotz des Wissens, dass dies erst ein erster Schritt ist und weitere Schritte erfolgen müssen, sind die Hoffnungen groß, die mit dem internationalen Klimaschutzregime und seinem Kyoto-Protokoll verbunden werden. In Zukunft wird daher weiterhin gelten, auf eine verbesserte Ausgestaltung des Kyoto-Protokolls hinzuarbeiten sowie ein vielversprechendes Nachfolgeprotokoll nach 2012 zu erzielen. Erst kürzlich auf dem G8-Gipfel in Japan wurden die Hoffnungen in die internationale Politik nochmals genährt, als die Industrieländer erneut ihre Zusammenarbeit bekräftigten und ihr Anliegen demonstrierten, den CO2-Ausstoß bis 2050 um die Hälfte senken zu wollen.
Die hier zum Ausdruck gekommene allgemeine Euphorie, die das Kyoto-Protokoll bei vielen hervorruft, kann jedoch nicht von allen Beobachtern der internationalen Klimapolitik geteilt werden. Während einige das Kyoto-Protokoll massiv kritisieren und kaum eine Wirksamkeit auf den Klimaschutz ausmachen können, gehen andere noch einen Schritt weiter und bewerten das Kyoto-Protokoll mit seinen Instrumenten sogar als hinderlich und plädieren für eine Auflösung des Vertrags. Aufbauend auf dieser Kontroverse möchte ich mich daher mit der Wirksamkeit internationaler Klimapolitik beschäftigen und der Frage nachgehen: Kann das Klimaschutzregimes und sein Kyoto-Protokoll eine Wirksamkeit im Sinne einer Verhaltensumkehr in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auslösen, die in der Folge zu einem Rückgang der CO2-Emissionen führt (Umweltwirksamkeit)? Zur Beantwortung der Frage werde ich mich zunächst mit den theoretischen Grundlagen von Umweltregimen beschäftigen und erläutern, warum der Regimeansatz davon ausgeht, dass Umweltregime die beste Antwort zur Lösung globaler Umweltprobleme sind. Daran anhängend werde ich den Begriff der Wirksamkeit, insbesondere den Begriff der Verhaltenswirksamkeit erläutern. Im anschließenden Kapitel wird die Beschäftigung der Ausgestaltung des internationalen Klimaschutzregimes gelten und untersucht werden, ob die im Kyoto-Protokoll verankerten Instrumente umweltwirksam sind. Im vierten Kapitel möchte ich dann die Argumente präsentieren, die der internationalen Klimapolitik ein schlechtes Zeugnis ausstellen und dessen Wirksamkeit anzweifeln. Abschließend werde ich mittels der gesammelten Ergebnisse in einem Fazit die Ausgangsfrage beantworten und darüber hinaus einen Ausblick über die zukünftige Wirksamkeit des Klimaregimes formulieren.
2. Theorie von Umweltregimen
2.1. Zentrale internationale Akteure und ihre Interessen
Die Hauptströmung der Regimeanalyse geht – wie die internationalen Theorien des Realismus und des Institutionalismus – davon aus, dass Staaten die entscheidenden Akteure im inter-nationalen System sind[6]. Bei internationalen Verhandlungen zum Schutz der Umwelt stehen nur ihnen Abstimmungsrechte über die völkerrechtlichen Vereinbarungen zu, auf denen Umweltregime beruhen und zu deren Umsetzung sie sich verpflichten. Dies schließt nicht aus, dass andere Akteure, wie etwa Nichtregierungsorganisationen (NGOs), zu denen Industrie- und Umweltverbände sowie wissenschaftliche Einrichtungen zählen, in der internationalen Umweltpolitik eine wichtige Rolle spielen können. Zumeist jedoch erwirken solche nichtstaatlichen Akteure ihren Einfluss nur, indem sie staatliches Handeln beeinflussen[7]. Selten gelingt es ihnen, direkten Zugang zu einem regimespezifischen Entscheidungsprozess zu erlangen[8]. Inzwischen existieren verschiedene Forschungsarbeiten, die den Einfluss von NGOs bei den Verhandlungen zur Verschärfung von Umweltstandards in internationalen Umweltregimen analysiert haben[9].
Die internationale Politik der einzelnen Staaten, so die Annahme der Regimetheorie, ist geleitet von den eigenen Interessen. Das Handeln der staatlichen Akteure im internationalen System zielt also in der Regel darauf ab, in einer gegebenen Handlungssituation den eigenen Nutzen zu maximieren[10]. Da die Herausbildung der staatlichen Interessen im bestehenden Problemfeld von Wissen, Ideen und Einflussverteilung beeinflusst ist, muss es sich keineswegs um identische nationale Interessen handeln. Dennoch ist die Annahme weithin akzeptiert, dass die Staaten das Ziel der Nutzenmaximierung verfolgen und entsprechend strategisch intentional handeln[11].
Weiterhin wird in der Regimeanalyse, wie bei neorealistischen und institutionalistischen Ansätzen, davon ausgegangen, dass das internationale System durch Anarchie gekennzeichnet ist. Anarchie steht hier allerdings nicht für Chaos oder die Abwesenheit von Ordnung[12], sondern kennzeichnet ein System, in dem Staaten prinzipiell souverän und keiner zentralen Herrschaftsinstanz unterworfen sind[13].
2.2. Notwendigkeit internationaler Kooperation
2.2.1. Der spieltheoretische Erklärungsansatz: Das „Gefangenendilemma“
Das Fehlen einer Herrschaftsinstanz im internationalen System sowie das interessegeleitete, sprich Nutzen maximierende Verhalten der Staaten kann allerdings zu Problemen führen. Mit Hilfe des der Spieltheorie entliehenen Gefangenendilemmas soll daher gezeigt werden, dass das Handeln im Sinne des Eigeninteresses unerwünschte Ergebnisse zur Folge haben kann und der Ausweg in der Kooperation der Staaten liegt[14].
„In einem Gedankenexperiment werden zwei des Einbruchs und des Mordes angeklagte Gefangene angenommen, wobei ihnen nur der Einbruch, nicht aber der Mord nachgewiesen werden kann. Da somit zumindest ein Geständnis notwendig ist, wird ihnen ein Geschäft angeboten: gesteht einer der beiden, kommt der Geständige frei, während der andere wegen Mordes voll verurteilt wird. Sind aber beide geständig, so werden beide wegen des Geständnisses zu einer geminderten Strafe verurteilt. Sollte kein Geständnis vorliegen, können beide nur aufgrund des Einbruchs bestraft werden. Die für beide Gefangene beste Lösung wäre das Leugnen beider, da lediglich eine Strafe wegen Einbruch droht. Jeder für sich stellt sich aber besser, wenn er gesteht, weil sich dadurch seine Strafe verringern kann oder sogar die Freilassung in Aussicht steht, egal wie sich der andere verhält. Dadurch droht allerdings das beiderseitige Geständnis und die Folge der geminderten Strafe. Eine Kooperation zwischen beiden Gefangenen ist deswegen notwendig, um das Eigeninteresse einer möglichst geringen Strafe zu erreichen. Fehlende Kooperation hingegen würde für jeden zu suboptimalen, dem Eigeninteresse widersprechenden höheren Strafen führen“[15].
Obwohl solche spieltheoretischen Modelle der Komplexität der Wirklichkeit nicht gerecht werden können, sind sie in der Lage, die Notwendigkeit der Kooperation in der anarchischen Staatenwelt zu verdeutlichen. Denn wie im Gefangenendilemma ist auch bei globalen Umweltproblemen Kooperation notwendig, um die durch einzelstaatliches Handeln erfolgenden suboptimalen Ergebnisse zu überwinden[16].
2.2.2. Das Problem der gemeinsamen Nutzung: „Tragödie der Gemeinschaftsgüter“
Ein zweites Modell, dessen sich die Regimetheorie zur Begründung von Kooperation in einer anarchischen Staatenwelt bedient, ist die „Tragödie der Allmende“ oder auch die „Tragödie der Gemeinschaftsgüter“[17]. Im Fall der Allmende wird diese von den Bauern eines Dorfes gemeinsam genutzt, um dort ihre Kühe zu weiden. Da jeder versucht möglichst viele Kühe zu seinem eigenen Wohl auf Kosten der Gemeinschaft auf diese Weide zu treiben, droht die Gefahr einer Übernutzung.
Im Falle des hier relevanten Gemeinschaftsgutes – der Erdatmosphäre – haben wir es mit einer vergleichbaren „Tragödie“ zu tun. Auch hier verfügen alle Akteure über ein gemeinsames, jedoch begrenztes Gut, von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Entsprechend versuchen alle Akteure ihren Nutzen zu maximieren, indem sie dieses Gut möglichst ausgiebig für die eigenen Zwecke beanspruchen, während sie zugleich ihren Beitrag zum Erhalt des Gutes minimieren[18]. Das Dilemma eines solchen natürlichen Gemeinschaftsgutes wie der Erdatmosphäre liegt also darin, dass mehrere Akteure Verfügungsrechte über dieses Gut haben und zugleich kein Akteur das Ausmaß der Nutzung durch die anderen Verfügungsberechtigten kontrollieren kann[19]. Wie im Falle des Gefangenendilemmas führt das Verhalten im Sinne der Maximierung des eigenen Nutzens jedoch auch hier zu suboptimalen Ergebnissen. Denn wie im Beispiel der Allmende kommt es auch bei der Erdatmosphäre zu einer Übernutzung. Eine solche Übernutzung wiederum liegt nicht im Interesse der Einzelnen, weil damit das Ausmaß einer weiteren Nutzung des Gutes immer geringer würde[20]. Dementsprechend kann ein optimales Ergebnis nur im Rahmen einer Kooperation der staatlichen Akteure erzielt werden.
Der Zusammenhang zwischen den anarchischen Strukturen in den internationalen Beziehungen und dem Verhalten der Staaten nach eigenen Interessen zeigt zudem, dass sinnvolle und möglicherweise naheliegende Gründe nicht zwangsläufig in eine Zusammenarbeit der Staaten münden. Vielmehr muss die Verfolgung von Eigeninteressen letztlich den Interessen zuwider laufen und damit Kooperation zwingend notwendig machen. Der von der Regimetheorie aufgegriffene spieltheoretische Erklärungsansatz und die Situation der „Tragödie der Gemeinschaftsgüter“ konnten diese Notwendigkeit verdeutlichen[21].
2.3. Aufgabe und Funktion von Umweltregimen
Die Antwort auf das beschriebene Verhaltensdilemma ist laut der Regimetheorie die Bildung eines internationalen Umweltregimes. Internationale Umweltregime gelten als Institutionen, mit deren Hilfe eine Gruppe von Staaten ein gemeinsames Umweltproblem zu bearbeiten sucht, indem sie zur Förderung der gemeinsamen Interessen der beteiligten Akteure einen regimespezifischen Entscheidungsapparat zur Verfügung stellen, der diese durch eine geeignete Organisation des kollektiven Entscheidungsprozesses gezielt fördert und letztlich zum Kern einer „problemfeldspezifischen Regelungsmaschinerie“ wird[22]. Dennoch sind Umweltregime im Vergleich zu internationalen Organisationen keine selbständig handelnden Akteure, da sie keine gegen die Einzelinteressen der Mitgliedsstaaten gerichtete internationale Umweltpolitik erlauben. Zur Lösung des Umweltproblems kommt es darauf an, möglichst viele beteiligte Staaten, darunter die besonders wichtigen Verursacher des Problems, unter die Obhut eines Regimes zu bringen und im Rahmen von Verhandlungen zu ähnlichen Maßnahmen zu bewegen. Im Sinne des Regimeansatzes besteht daher zur Lösung des Umweltproblems ein Bedarf für aktive internationale Umweltpolitik, die in der Lage ist, das Verhalten widerstrebender Akteure zu beeinflussen. Anders als staatlich organisierte Gesellschaften besitzt das internationale System jedoch keine zentrale Herrschaftsinstanz, die fähig ist, verbindliche Normen zu setzen und diese gegenüber abweichenden Akteuren durchzusetzen[23].
Hinsichtlich des Entstehens kollektiven Handelns im Rahmen eines Umweltregimes ist das hier zugrunde gelegte Vorhandensein paralleler Interessen jedoch keineswegs hinreichend. Vielmehr müssen zusätzliche Voraussetzungen erfüllt sein, um Kooperation realisieren zu können[24].
2.4. Voraussetzungen auf dem Weg zur internationalen Kooperation
2.4.1. Das Vertrauens- und Verteilungsproblem
Aufgrund einer fehlenden zentralen Herrschaftsinstanz in den Strukturen der internationalen Beziehungen besteht ein ständiges Vertrauensproblem zwischen den „egoistischen“ Staaten. Dies gilt es zur Verwirklichung von Kooperation zu überwinden. Dazu ist die Frage der Kontrolle und der Sanktionen zu klären. Staaten müssen in der Lage sein sich wechselseitig zu kontrollieren, da es ihnen sonst nicht möglich ist kooperationstreues bzw. -untreues Verhalten anderer Staaten zu erkennen und darauf angemessen zu reagieren. Da automatische Kontrolle nur selten möglich ist, müssen Kontrollmechanismen entwickelt und eingerichtet werden. Bei der Frage der Sanktionen muss die Möglichkeit gegeben sein, Staaten zu bestrafen, die aus der Kooperation austreten und zur Selbsthilfe greifen. Erst dies bedingt das Vertrauen aller anderen beteiligten Akteure in der Kooperation. Sollte also eine Kooperationssituation vorliegen, die zugleich eine längerfristig Zusammenarbeit garantieren soll, müssen in der Folge verlässliche Sanktionsmechanismen und –Maßnahmen gebildet und umgesetzt werden[25].
Neben dem Vertrauens- erweist sich das Verteilungsproblem auf dem Weg zur Kooperation oftmals als zentrales Hindernis. Hier sind die Staaten gezwungen festzulegen, was in der Kooperation jeweils von ihnen verlangt wird. Erst eine Einigung darüber macht es ihnen möglich das Verhalten der anderen beteiligten Staaten zu bewerten, aber auch hinsichtlich des eigenen Verhaltens zu wissen, was von ihnen selbst erwartet wird[26].
2.4.2. Leistungen von Umweltregimen zur Lösung dieser Probleme
Bei der Lösung des Vertrauensproblems, also der Frage von Kontrolle und Sanktionen, können internationale Regime Erwartungs- und Rechtssicherheit zur Verfügung stellen. Durch eine Aufstellung von Verhaltensrichtlinien für alle beteiligten Akteure und der damit verbundenen Festlegung von Urteilsmaßstäben wird eine Stabilisierung von Verhaltenserwartungen erreicht. Zusätzlich wird auf diese Weise Rechtssicherheit erzeugt, indem diese durch ein „quasi-Recht“ in Form von Spielregeln die Einhaltung und Durchsetzung regelkonformen Verhaltens erzwingen kann[27].
Auf der Basis eines gelösten Verteilungsproblems kann dann das Vertrauensproblem bearbeitet werden, indem die Festlegung der Frage der Verteilung den Urteilsmaßstab für Kontrolle und Sanktionen bildet. Vor allem aber wird zugleich mit der Überwindung des Vertrauens- und Verteilungsproblems die in einer Kooperation notwendige Erwartungssicherheit betreffend des Verhaltens der Akteure geschaffen. Für das Zustandekommen von Kooperation ist das Verteilungsproblem von hoher Bedeutung. Oftmals scheitert die von allen gewünschte Kooperation daran, dass keine Einigung über die von den einzelnen Staaten in der Kooperation Verlangten erzielt wird[28].
Zur Lösung des Verteilungsproblems tragen internationale Regime lediglich insoweit bei, dass sie allgemein für eine Bereitstellung und Verteilung von Informationen sorgen und Transaktionskosten senken und somit Verhandlungen ermöglichen und vereinfachen. Die eigene Festlegung des Verhaltens verbleibt aber im Aushandlungsprozess der staatlichen Akteure. Demnach stehen konkrete Funktionsleistungen seitens des Regimes, etwa im Sinne einer Verhaltensbeeinflussung der Akteure, nicht unmittelbar zur Verfügung[29].
2.5. Verhaltenswirksamkeit internationaler Umweltregime
Die Hauptaufgabe eines Umweltregimes – die Überwindung von suboptimalen Ergebnissen – ist jedoch nur zu erfüllen, wenn von ihnen eine Wirkung auf das Akteursverhalten ausgeht[30]. Der zentrale Akteur ist der Staat. Dennoch darf als Akteur nicht ausschließlich der Staat verstanden werden. Bei der Frage nach der Wirksamkeit internationaler Umweltpolitik muss daher die Untersuchung über die Anpassung staatlichen Verhaltens hinausgehen, denn viele Umweltprobleme werden nicht oder nur in geringem Maße von den öffentlichen bzw. staatlichen Akteuren selbst verursacht. Die international vereinbarten Verhaltensstandards eines Regimes müssen daher bewirken, dass auch nichtstaatliche, allen voran die entscheidenden wirtschaftlichen Akteure, aber auch die Gesellschaft als Ganzes ihr Verhalten ändert[31]. Im weiteren Verlauf ist daher zu klären, ob das Klimaschutzregime und sein Kyoto-Protokoll bei den genannten Akteuren eine Verhaltensumkehr auslösen, die dem Schutz des Klimas dienlich ist.
[...]
[1] Gore, Al (2007): Wege zum Gleichgewicht. Ein Marshallplan für die Erde, 3. Auflage, Frankfurt a. M.
[2] Klopp, Tina (2006): Politik nimmt Klimawandel in Kauf. Deutschland muss sich auf steigende Wasserspiegel und eine veränderte Pflanzenwelt einstellen. Deiche statt Kyoto – ist der Kampf gegen den Treibhauseffekt verloren? Zit. n.: Troge, Andreas: Studie des deutschen Umweltbundesamtes. In: Financial Times Deutschland, 07. November, S. SA5, Berlin.
[3] Vgl. Carrapatoso, Astrid Fritz (2008): Ein Klima der Veränderung? Ergebnisse des Weltklimagipfels in Bali 2007, in: GIGA Focus, Nr. 3, S. 1-6, Hamburg.
[4] Vgl. BMU u.a., http://www.bmu.de/klimaschutz/internationale_klimapolitik/kyoto_protokoll/doc/20226.php.
[5] Ausnahme ist die USA, die das Protokoll nicht ratifiziert haben.
[6] Oberthür, Sebastian (1997): Umweltschutz durch internationale Regime. Interessen, Verhandlungsprozesse, Wirkungen, Opladen, S. 25.
[7] Gehring, Thomas / Oberthür, Sebastian, (1997): Internationale Umweltregime. Umweltschutz durch Verhandlungen und Verträge. Opladen, S. 11.
[8] Ebd.
[9] Vgl. insbes. Seybold, Marc (2003): Internationale Umwelt – neuen Formen der Konfliktbearbeitung in der internationalen Politik? Untersuchungen am Beispiel des Klimaschutzregimes. Eine integrative regimetheoretische Untersuchung zum Einfluss von Nichtregierungsorganisationen und Wissenschaftlicher Gemeinschaften auf das internationale Klimaschutzregime, Dissertation, Würzburg.
http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?idn=975013114&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=975013114.pdf.
[10] Gehring, T. / Oberthür, S. 12.
[11] Meinke, Britta (2002): Multi-Regime-Regulierung. Wechselwirkungen zwischen globalen und regionalen Umweltregimen, Wiesbaden, S. 9.
[12] Meinke, S. 8, zit. n.: Waltz, Kenneth N. (1979): Theory of International Politics. Reading, Massachus., S. 88.
[13] Ebd.
[14] Seybold, S. 26, zit. n.: Zangl, Bernhard (1999): Interesse auf zwei Ebenen. Internationale Regime in der Agrarhandels-, Währungs- und Walfangpolitik. Baden-Baden, S. 62-67.
[15] Vgl. Seybold u.a., S. 27.
[16] Ebd., zit. n.: Zangl, S. 65.
[17] Ebd., zit. n.: Hardin, Garrett (1968): The Tragedy of the Commons, S. 1243-1248.
[18] Ebd., S. 29.
[19] Diekmann, Andreas / Preisendörfer, Peter (2001): Umweltsoziologie. Eine Einführung, Reinbek bei Hamburg.
[20] Oberthür, S. 36.
[21] Seybold, S. 26.
[22] Gehring, Thomas / Oberthür, Sebastian (1997): Internationale Regime als Steuerungsinstrumente der Umweltpolitik, in: Ders.: Internationale Umweltregime, Opladen, S. 17.
[23] Ebd., S. 9.
[24] Seybold, S. 33.
[25] Vgl. Seybold, S. 33.
[26] Ebd., S. 35.
[27] Ebd., S. 46.
[28] Ebd.
[29] Ebd., S. 46.
[30] Oberthür, Sebastian / Ott, Hermann E (2000): Das Kyoto-Protokoll: Internationale Klimapolitik für das 21. Jahrhundert, Opladen, S. 347.
[31] Oberthür, S.46-47.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836620703
- Dateigröße
- 385 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Kassel – Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- kyoto klima umweltregime emissionshandel umweltschutz
- Produktsicherheit
- Diplom.de