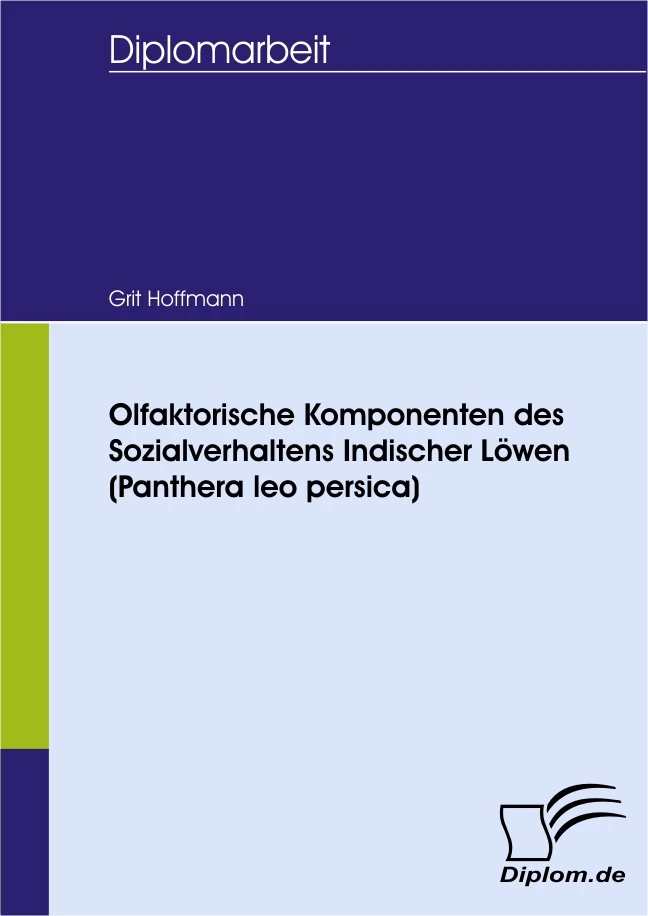Olfaktorische Komponenten des Sozialverhaltens Indischer Löwen (Panthera leo persica)
©2008
Diplomarbeit
97 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Angaben über die Zahl der Indischen Löwen im Gir-Reservat in Kathiawar in Nordwestindien schwankt zwischen 120 und 250 Tieren. Es bedurfte ziemlicher Anstrengungen über 10 Jahre hin, um endlich echte Indische Löwen zu erhalten, eine kleine ebenmäßig gebaute, nicht besonders stark bemähnte Löwenunterart. Inzwischen hat der Tierpark 34 Junge gezüchtet. [.] Junglöwen sind für mich die nettesten Raubtierkinder der Welt.
So schrieb Dathe damals über seine Erfahrungen mit Indischen Löwen. Obwohl es schon sehr lange Indische Löwen in Berlin gibt, verwechseln auch heute noch viele der Besucher die ausgestellten Löwen mit ihren afrikanischen Vettern.
Für die meisten von uns ist der Löwe (Panthera leo) ein Charaktertier der afrikanischen Savanne. Jedoch gibt es auch noch andere wildlebende Löwen, rund 2500 Kilometer von Afrika entfernt.Diese leben in Indien im Gir-Wald auf der Kathiawar Halbinsel, nördlich von Bombay an Indiens Westküste. Dort lebt die letzte kleine Population des Asiatischen Löwen (Panthera leo persica), welcher einst über weite Bereiche des südlichen Asiens verbreitet gewesen ist.
Aufgrund der großen Bedrohung und des endemischen Auftretens sind die Asiatischen Löwen (Indischen Löwen) im Europäischen Zuchtprogramm (EEP). Diese seltenen Tiere sind mit 76 Vertretern in indischen Zoos und 359 Tieren im Gir-Wald nur noch sehr rar vorhanden. Deshalb ist es sehr wichtig, den Arterhalt mit Zuchtprogrammen in Zoos zu gewährleisten.
Eine mit zunehmender Begeisterung verwandte Methode zur Verbesserung der Lebensqualität von Zootieren ist das Environmental Enrichment. In dieser Diplomarbeit wird es vor dem Hintergrund der Stimmungsverbesserung und Beruhigung bearbeitet. Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisSeite 4
AbkürzungsverzeichnisSeite 6
1.EINLEITUNGSeite 7
1.1.Fragestellungen und HypothesenSeite 8
1.1.1.FragestellungenSeite 8
1.1.2.HypothesenSeite 8
1.2.Biologie der Indischen LöwenSeite 9
1.2.1.SystematikSeite 9
1.2.2.Körperliche MerkmaleSeite 10
1.2.3.Natürlicher BestandSeite 12
1.2.4.Bedrohung des Indischen LöwenSeite 14
1.2.5.AktivitätSeite 16
1.2.6.Das Sozialverhalten und SozialsystemSeite 16
1.2.7.SinnessystemSeite 17
1.2.8.Fortpflanzung und EntwicklungSeite 20
1.2.9.NahrungSeite 21
1.2.10.Mensch - Löwe KonfliktSeite 21
1.2.11.Projekte zur ArterhaltungSeite 22
1.3.Zoobestand Indischer LöwenSeite 24
2.MATERIAL UND METHODENSeite 27
2.1.MaterialSeite 27
2.1.1.DüfteSeite […]
Die Angaben über die Zahl der Indischen Löwen im Gir-Reservat in Kathiawar in Nordwestindien schwankt zwischen 120 und 250 Tieren. Es bedurfte ziemlicher Anstrengungen über 10 Jahre hin, um endlich echte Indische Löwen zu erhalten, eine kleine ebenmäßig gebaute, nicht besonders stark bemähnte Löwenunterart. Inzwischen hat der Tierpark 34 Junge gezüchtet. [.] Junglöwen sind für mich die nettesten Raubtierkinder der Welt.
So schrieb Dathe damals über seine Erfahrungen mit Indischen Löwen. Obwohl es schon sehr lange Indische Löwen in Berlin gibt, verwechseln auch heute noch viele der Besucher die ausgestellten Löwen mit ihren afrikanischen Vettern.
Für die meisten von uns ist der Löwe (Panthera leo) ein Charaktertier der afrikanischen Savanne. Jedoch gibt es auch noch andere wildlebende Löwen, rund 2500 Kilometer von Afrika entfernt.Diese leben in Indien im Gir-Wald auf der Kathiawar Halbinsel, nördlich von Bombay an Indiens Westküste. Dort lebt die letzte kleine Population des Asiatischen Löwen (Panthera leo persica), welcher einst über weite Bereiche des südlichen Asiens verbreitet gewesen ist.
Aufgrund der großen Bedrohung und des endemischen Auftretens sind die Asiatischen Löwen (Indischen Löwen) im Europäischen Zuchtprogramm (EEP). Diese seltenen Tiere sind mit 76 Vertretern in indischen Zoos und 359 Tieren im Gir-Wald nur noch sehr rar vorhanden. Deshalb ist es sehr wichtig, den Arterhalt mit Zuchtprogrammen in Zoos zu gewährleisten.
Eine mit zunehmender Begeisterung verwandte Methode zur Verbesserung der Lebensqualität von Zootieren ist das Environmental Enrichment. In dieser Diplomarbeit wird es vor dem Hintergrund der Stimmungsverbesserung und Beruhigung bearbeitet. Inhaltsverzeichnis:InhaltsverzeichnisSeite 4
AbkürzungsverzeichnisSeite 6
1.EINLEITUNGSeite 7
1.1.Fragestellungen und HypothesenSeite 8
1.1.1.FragestellungenSeite 8
1.1.2.HypothesenSeite 8
1.2.Biologie der Indischen LöwenSeite 9
1.2.1.SystematikSeite 9
1.2.2.Körperliche MerkmaleSeite 10
1.2.3.Natürlicher BestandSeite 12
1.2.4.Bedrohung des Indischen LöwenSeite 14
1.2.5.AktivitätSeite 16
1.2.6.Das Sozialverhalten und SozialsystemSeite 16
1.2.7.SinnessystemSeite 17
1.2.8.Fortpflanzung und EntwicklungSeite 20
1.2.9.NahrungSeite 21
1.2.10.Mensch - Löwe KonfliktSeite 21
1.2.11.Projekte zur ArterhaltungSeite 22
1.3.Zoobestand Indischer LöwenSeite 24
2.MATERIAL UND METHODENSeite 27
2.1.MaterialSeite 27
2.1.1.DüfteSeite […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Grit Hoffmann
Olfaktorische Komponenten des Sozialverhaltens Indischer Löwen (Panthera leo
persica)
ISBN: 978-3-8366-2012-3
Herstellung: Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2009
Zugl. Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden und der Verlag, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplomica.de, Hamburg 2009
INHALTSVERZEICHNIS
Inhaltsverzeichnis
Seite 4
Abkürzungsverzeichnis
Seite 6
1.
EINLEITUNG
Seite 7
1.1.
Fragestellungen
und
Hypothesen
Seite 8
1.1.1.
Fragestellungen Seite
8
1.1.2. Hypothesen
Seite 8
1.2. Biologie der Indischen Löwen
Seite 9
1.2.1. Systematik
Seite 9
1.2.2. Körperliche Merkmale
Seite 10
1.2.3. Natürlicher Bestand
Seite 12
1.2.4. Bedrohung des Indischen Löwen
Seite 14
1.2.5.
Aktivität
Seite
16
1.2.6. Das Sozialverhalten und Sozialsystem
Seite 16
1.2.7.
Sinnessystem
Seite
17
1.2.8. Fortpflanzung und Entwicklung
Seite 20
1.2.9.
Nahrung
Seite
21
1.2.10. Mensch Löwe Konflikt
Seite 21
1.2.11. Projekte zur Arterhaltung
Seite 22
1.3. Zoobestand Indischer Löwen
Seite 24
2. MATERIAL UND METHODEN
Seite 27
2.1. Material
Seite 27
2.1.1.
Düfte
Seite
27
2.1.1.1.Auswahlkriterien und die Idee
Seite 27
2.1.1.2.Borretsch
Seite
28
2.1.1.3.Johanniskraut Seite
29
2.1.1.4.Melisse Seite
29
2.1.1.5.Rosmarin
Seite
29
2.1.1.6.Vanille
Seite
30
2.1.1.7.Zimt Seite
30
2.1.1.8.Zitrone Seite
30
2.1.2. Tiere
Seite 31
2.1.3. sonstige Materialien
Seite 32
2.2. Methoden
Seite 33
2.2.1. Beobachtungsmethoden
Seite 33
2.2.2. Einzeltest
Seite 34
2.2.3. Präferenztest
Seite 34
2.2.4. Beobachtungszeitraum
Seite 35
2.2.5. Statistische Auswertung
Seite 36
INHALTSVERZEICHNIS
3. ERGEBNISSE
Seite 38
3.1. Ergebnis des Einzeltests
Seite 38
3.1.1.
Allgemein
Seite
38
3.1.2. Individuelle Ergebnisse zum Einzeltest
Seite 41
3.2. Ergebnisse des Präferenztests
Seite 45
3.3. Einfluss der Gruppengröße
Seite 49
3.4. Einfluss der Temperatur
Seite 51
4. DISKUSSION
Seite 56
4.1. Düfte Auswahl, Verabreichung und Darbietung
Seite 56
4.1.1. Johanniskraut
Seite 57
4.1.2. Die anderen Düfte
Seite 58
4.1.3. Dauer der Duftdarbietung
Seite 58
4.1.4. Häufigkeit der Duftdarbietung
Seite 61
4.2.
Bevorzugte
Düfte
im
Einzeltest
Seite 62
4.3.
Bevorzugte Düfte im Präferenztest
Seite 63
4.4.
Vergleich Einzeltest Präferenztest
Seite 64
4.4.1.
Düfte
Seite
64
4.4.2.
Verhaltensweisen
Seite
67
4.5.
Gruppengröße Welchen Einfluss hat Keera?
Seite 69
4.6.
Temperatureinfluss
Seite 70
4.7. Methodenkritik
Seite 72
4.8. Literaturvergleich
Seite 74
4.9.
Fazit
Seite 75
5. ZUSAMMENFASSUNG
Seite 77
6.
LITERATURVERZEICHNIS
Seite 81
7. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS
Seite 86
7.1. Abbildungsverzeichnis
Seite 86
7.2. Tabellenverzeichnis
Seite 87
8.
ANHANG
Seite 88
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis
°C Grad
Celsius
Abb.
Abbildung
AZA
American Zoo and Aquarium Association
BHAG
Behavior and Husbandry Advisory Group
bspw.
Beispielsweise
bzgl.
bezüglich
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
cm
Zentimeter
d. h.
das heißt
DNS
Desoxyribonukleinsäure
EEP
Europäisches Erhaltungszuchtprogramm
evtl.
eventuell
ff. folgende
Hz
Hertz
ITIS
Integrated Taxonomic Information System
IUCN
The International Union for Conservation of Nature (Weltschutzorganisation)
Jh.
Jahrhundert
kHz
Kilohertz
km²
Quadratkilometer
m Meter
ml Milliliter
mm
Millimeter
mind.
mindestens
mündl.
mündlich
pers.
persönlich
SSP
Species Survival Programm
u. a.
unter anderem
U.S. ESA
Status under the United States Endangered Species Act
v. l.
von links
EINLEITUNG
1. EINLEITUNG
,,Die Angaben über die Zahl der Indischen Löwen im Gir-Reservat in
Kathiawar in Nordwestindien schwankt zwischen 120 und 250 Tieren.
Es bedurfte ziemlicher Anstrengungen über 10 Jahre hin, um endlich
echte Indische Löwen zu erhalten, eine kleine ebenmäßig gebaute, nicht
besonders stark bemähnte Löwenunterart. Inzwischen hat der Tierpark
34 Junge gezüchtet. [...] Junglöwen sind für mich die nettesten
Raubtierkinder der Welt."
(der langjährige Tierparkdirektor Prof. Heinrich Dathe, 1981)
So schrieb Dathe damals über seine Erfahrungen mit Indischen Löwen. Obwohl es schon sehr
lange Indische Löwen in Berlin gibt, verwechseln auch heute noch viele der Besucher die
ausgestellten Löwen mit ihren afrikanischen Vettern.
Für die meisten von uns ist der Löwe (Panthera leo) ein Charaktertier der afrikanischen
Savanne. Jedoch gibt es auch noch andere wildlebende Löwen, rund 2500 Kilometer von
Afrika entfernt. Diese leben in Indien im Gir-Wald auf der Kathiawar Halbinsel, nördlich von
Bombay an Indiens Westküste. Dort lebt die letzte kleine Population des Asiatischen Löwen
(Panthera leo persica), welcher einst über weite Bereiche des südlichen Asiens verbreitet
gewesen ist (Kappeler, 1998).
Aufgrund der großen Bedrohung und des endemischen Auftretens sind die Asiatischen Löwen
(Indischen Löwen) im Europäischen Zuchtprogramm (EEP). Diese seltenen Tiere sind mit 76
Vertretern in indischen Zoos und 359 Tieren im Gir-Wald (Stand 02.2008) nur noch sehr rar
vorhanden (pers. Mitteilung Neil Dorman, 05.2008). Deshalb ist es sehr wichtig, den Arterhalt
mit Zuchtprogrammen in Zoos zu gewährleisten. Eine mit zunehmender Begeisterung
verwandte Methode zur Verbesserung der ,,Lebensqualität" von Zootieren ist das
Environmental Enrichment. In dieser Diplomarbeit wird es vor dem Hintergrund der
Stimmungsverbesserung und Beruhigung bearbeitet.
EINLEITUNG
1.1. Fragestellungen und Hypothesen
1.1.1. Fragestellungen
In jüngster Zeit hat sich bei vielen Tierarten die Verwendung von Spielsachen mit
,,Futterwert" durchgesetzt, von Naturprodukten, deren Geschmack oder Geruch die Tiere
zusätzlich anregt, sich mit ihnen zu beschäftigen, sie zu zerkauen oder sonstwie zu zerstören
(Grzimek, 1988).
In diesem Sinne werden diverse ätherische Öle in folgender Arbeit an den Indischen Löwen
getestet. Dabei werden folgende Fragestellungen untersucht:
1. Welchen Einfluss haben die ausgewählten ätherischen Öle (Düfte)? Gibt es
Veränderungen in der Häufigkeit des Auftretens der ausgewählten Aktivitäten?
2. Reagieren alle getesteten Löwen gleichermaßen auf die Düfte oder treten individuen-,
geschlechts- oder altersspezifische Unterschiede hinsichtlich der ausgewählten
Verhaltensweisen auf?
3. Gibt es präferierte Düfte bei den beobachteten Löwen?
4. Welchen Einfluss haben äußere Faktoren, wie beispielsweise Temperatur und
Gruppengröße auf die Häufigkeit der Aktivitäten?
5.
Sind die ausgewählten Verhaltensweisen aussagekräftig, um eine
Stimmungsveränderung nachzuweisen?
1.1.2. Hypothesen
Aus den oben gestellten Fragen leiten sich folgende Hypothesen ab:
H
1
: Es wird präferierte Düfte bei den 4 Löwen geben.
H
2
: Die Verhaltensweisen werden mit altersspezifischen Unterschieden auftreten.
H
3
: Äußere Faktoren haben einen Einfluss auf die Reaktion der Löwen auf die Düfte.
Die hier aufgeführte Tierart soll exemplarisch (auch im Hinblick auf deren Bedrohung) diese
Fragestellungen beleuchten. Diese Problematik ließe sich an anderen Tierarten, in leicht
modifizierter Form, gleichermaßen überprüfen.
EINLEITUNG
1.2. Biologie der Indischen Löwen
1.2.1. Systematik
Der Löwe gehört zu dem Phylum Chordata (Chordatiere), dem Subphylum Vertebrata
(Wirbeltiere), der Klasse Mammalia (Säugetiere), der Ordnung der Carnivora (Raubtiere), der
Familie Felidae (Katzen), dem Genus Panthera (Raubkatzen) und schließlich der Art
Panthera leo (Mitra, 2005).
Nach MITRA wird die Art der Löwen seit 23. März 2005 in 12 Unterarten unterteilt. Diese
Unterarten sind folgende:
1. Panthera leo leo Berberlöwe, entdeckt in Nordafrika und seit 1920 in freier
Wildbahn ausgestorben,
2. Panthera leo azandica Kongolöwe,
3. Panthera leo bleyenbergi diese Löwen leben in Angola und Zimbabwe,
4. Panthera leo hollisteri gefunden im Kongo,
5. Panthera leo massaicus diese Löwen sind in Uganda und Kenia (Ostafrika) zu
finden,
6. Panthera leo roosevelti Löwen des Sudans und Äthiopiens,
7. Panthera leo melanochaita Kaplöwen, bereits ausgestorben,
8. Panthera leo senegalensis Löwen im Gebiet von Senegal bis Kamerun
(Westafrikanischer Löwe),
9. Panthera leo somaliensis Somalilöwe,
10. Panthera leo krugeri Südafrikanischer Löwe oder Transvaal- und Kalaharilöwe,
11. Panthera leo nubica Ostafrikanischer Löwe,
12. Panthera leo persica Asiatischer oder Indischer Löwe.
Üblich ist jedoch laut MITRA die wissenschaftliche Einteilung der Löwen in 7 Unterarten,
wie folgt:
1. Panther leo leo Berberlöwe, gefunden in Nordafrika und seit 1920 in freier
Wildbahn ausgestorben,
2. Panthera leo bleyenbergi diese Löwen leben in Angola, Zaire und Zimbabwe,
3. Panthera leo massaicus diese Löwen kommen im Osten Afrikas (Tansania und
Kenia) vor,
EINLEITUNG
4. Panthera leo melanochaita Kaplöwen (ausgestorben seit 1860),
5. Panthera leo senegalensis Löwen im Gebiet von Senegal bis Kamerun
(Westafrikanischer Löwe),
6. Panthera leo krugeri Südafrikanischer Löwe oder Transvaallöwe,
7. Panthera leo persica Asiatischer oder Indischer Löwe.
Laut KAPPELER (1998) wird die Art der Löwen gewöhnlich in 7 bis 9 Unterarten gegliedert.
Es sind also hinsichtlich dieser Systematik, trotz moderner Technik, immer noch Fragen
offen.
Nach KHALAF-VON JAFFA (2006) beweisen molekularbiologische Untersuchungen der
DNS, dass sich die Asiatischen Löwen erst vor 50 000 bis 100 000 Jahren von den
Afrikanischen Löwen getrennt und danach in separater Richtung weiter entwickelt haben.
Somit sind die genetischen Unterschiede nicht größer als die zwischen den Menschenrassen.
Aus diesem Grund lassen sich Löwen aus Indien in Menschenobhut auch problemlos mit
Löwen aus Afrika kreuzen. Diese mögliche Hybridisierung erschwert natürlich die Zucht
reinrassiger Indischer Löwen zur Arterhaltung. Außerdem gibt es aufgrund der
Hybridisierungsmöglichkeit viele Variationen von ,,Indischen Löwen".
1.2.2. Körperliche Merkmale
Der Indische Löwe ist etwas kleiner und hat im Gegensatz zu seinem afrikanischen
Gegenstück eine longitudinale Bauchfalte. Die Mähne der Löwen ist ein sexueller
Dimorphismus und nur bei den Männchen zu finden. Die Farbe und die Beschaffenheit der
Mähne variieren von Ort zu Ort und charakterisieren die Unterarten. Die Dichte der Mähne ist
offensichtlich bei der indischen Unterart geringer als bei der afrikanischen. Vermutlich ist der
Grund hierfür der geringere Genpool (Mitra, 2005).
Nach dem Asiatic Lion Information Centre © 2000 ist die kürzere Mähne der Indischen
Löwen eine Anpassung an den Lebensraum. Mit dieser Mähne ist es für die Löwenmännchen
einfacher durch den dichten Gir-Wald hindurch zu kommen. Hingegen wachsen Asiatischen
Löwen in Zoos in der gemäßigten Zone öfter lange Mähnen. Womöglich ist die Temperatur
der jeweiligen Klimazone ein Faktor, der die Mähnenlänge beeinflusst.
EINLEITUNG
Der Längenunterschied (der Mähnen) zwischen in Zoo und freier Wildbahn lebenden Tieren
kommt zustande, weil die Gir-Löwenmännchen nicht miteinander um die Rudel konkurrieren
und deshalb keine langen ,,Show-Mähnen" benötigen
.
Auffällig ist, dass die asiatischen Löwenmännchen einen bescheideneren Mähnenwuchs
zwischen den Ohren haben als ihre afrikanischen Verwandten. Dadurch sind die Ohren der
indischen Löwenmännchen, anders als die der Afrikanischen Löwen, stets gut sichtbar.
Außerdem haben Indische Löwen Fellbüschel ( Hemmer, 1966) am Ellenbogen, der sowohl
bei männlichen als auch bei weiblichen Tieren auftritt. Ein männlicher Indischer Löwe hat ein
Gewicht von 160 bis 190 kg. Die Weibchen hingegen werden zwischen 110 und 120 kg
schwer. Die Schulterhöhe männlicher Löwen beträgt 100 bis 120 cm und die der Weibchen 80
bis 107 cm. Die Kopf-Rumpf-Länge beträgt bei Indischen Löwenmännchen 1,75 bis 2,5 m
und bei den Löwenweibchen 1,4 bis 1,8 m. Der Schwanz der Indischen Löwen ist 0,7 bis 1,05
m lang (Mitra, 2005). Prägnant ist außerdem die stark ausgeprägte schwarze Schwanzquaste,
in der sich ein zurückgebildeter Wirbel befindet, welcher Hornstachel genannt wird. Die
eventuelle Funktion von diesem ist noch unklar. Der Stachel sitzt mit seiner Grundfläche der
Haut der Schwanzspitze auf und steht durch eine etwa 2 cm lange Sehne mit dem letzten
Schwanzwirbelglied in Verbindung (Bekker, 1855). Das größte je gemessene
Löwenmännchen hatte eine Körperlänge (inklusive Schwanz) von 2,92 m (Zoo Frankfurt am
Main, 03.2008).
Die Fellfarbe der Löwen, verschiedene Sand- und Ockertöne, unterscheidet sich in den
Unterarten. Der Asiatische Löwe ist zotteliger und hat ein dichteres Fell als der Afrikanische
(Mitra, 2005). Genau wie bei den Afrikanischen Löwen ist das Fell der Jungtiere
leopardenartig gefleckt (Zoo Frankfurt am Main, 2008). Jedoch ist die Befleckung laut
Aussagen des Tierpflegers im Tierpark Berlin (mündl. Mitteilung von Herrn Jany, 2008) bei
den indischen Jungtieren hervorstechender und geht schneller wieder verloren. Bei 2 Jahre
alten Indischen Löwen sind Reste dieser Flecken noch an den Extremitäten zu erkennen. Laut
MITRA sind diese Flecken an den hinteren Extremitäten auch noch bei ausgewachsenen
Indischen Löwen zu finden. Die gleichmäßige Färbung des Fells tarnt die Indischen Löwen in
ihrem präferierten Habitat, dem trockenen Laubwald von Gir.
Die Schwanzquaste der indischen Großkatzen ist sehr markant und länger als die der
afrikanischen Spezies. Ein weiterer hervorstechender Unterschied ist, dass die Indischen
Löwen außergewöhnlich furchtlos gegenüber Menschen sind und man deshalb sehr nah an sie
EINLEITUNG
herankommen kann. Diese unglaubliche Beziehung konnte nur in Indien bezeugt werden
(Mitra, 2005).
Nach MITRA (2005) wächst die Mähne eines Asiatischen Löwens ab einem Alter von 2
Jahren und dunkelt mit zunehmendem Alter nach. Die Mähne dünnt dann im hohen Alter aus,
was mit dem Rückgang der Testosteronmenge zusammenhängt.
1.2.3. Natürlicher Bestand
Der momentane natürliche Lebensraum der
Indischen Löwen ist der Gir National Park
mit einer Größe von 258,7 km². Der Gir-
Wald liegt auf der Kathiawar-Halbinsel
(siehe Abbildung 2), nördlich von Bombay
an Indiens Westküste im Bundesstaat
Gujarat. Um diesen Nationalpark herum gibt
es ein Schutzgebiet mit einer Größe von
weiteren 1153,4 km² und außerdem noch eine Art Pufferzone mit einer Größe von 470,5 km².
Somit beträgt die Fäche der Gir Conservation Area 1882,6 km² (Mitra, 2005).
Das Gir-Wildreservat (siehe Abbildung 3)
ist ein hügeliges Gelände mit offenem
Buschland sowie trockenen Teak- und
Akazienwäldern. Und obschon die
regenbringenden Monsunwinde in manchen
Jahren vorbeiziehen, führen einige Flüsse
immer Wasser. Dies ist auch die Grundlage
für einen recht vielgestaltigen Tierbestand
mit 30 Großsäuger- und rund 300
Brutvogelarten, neben den heute 280 bis 300
Löwen (Kappeler, 1998).
Abb. 2: Kathiawar-Halbinsel Indiens
(Quelle: wikipedia.org)
Abb. 3: Gir National Park
(Quelle: wikipedia.org)
EINLEITUNG
Nach dem Asiatic Lion Information Centre © 2000 beträgt die Regenmenge im Gir-Wald ca.
850 mm pro Jahr. Dürren sind im Reservat während der Trockenzeit sehr häufig. In dieser
Zeit kann die Temperatur einen Wert von bis zu 46°C erreichen. Laut MITRA (2005) glauben
Biologen, dass der Löwe den Indischen Halbkontinent vom Westen her vor ungefähr 40 000
Jahren erreicht hat. Früher ist der Asiatische Löwe von Südeuropa über den gesamten Nahen
und Mittleren Osten bis nach Indien verbreitet gewesen. Auf der Balkanhalbinsel verschwand
die Großkatze bereits im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Östlich des Bosporus
überlebte sie hingegen gebietsweise bis weit ins 19 Jh. hinein (Khalaf-von Jaffa, 2005).
Noch bis zu Anfang des 19. Jh. war der Asiatische Löwe über weite Teile der nördlichen
Hälfte Indiens verbreitet. Auch aus diesem Grund trägt Indien noch heute drei Löwen in
seinem Wappen. Es wurde auch auf dem indischen Subkontinent gnadenlos Jagd auf die
Großkatze gemacht, weil sie ein Statussymbol für Jäger ist. Aus diesem Grund stand der
Asiatische Löwe gegen Ende des 19. Jh. auch in Indien kurz vor der endgültigen Ausrottung.
Lediglich eine kleine Population im Gir-Wald überlebte. Einer der dort ansässigen Fürsten der
Nawab von Junagadh erklärte die letzten Löwen zu seinem Eigentum und schütze sie somit
vor Wilderern (Khalaf-von Jaffa, 2006).
Nur der Fürst und seine privaten Jagdgäste durften die Löwen schießen. Die Größe des
damaligen Bestandes im privaten Jagdrevier des Fürstens ist unklar. Der Fürst sprach damals
von weniger als 20 Tieren. Jedoch schien er damit absichtlich ,,tief zu stapeln", um etwaige
Trophäenjäger zu entmutigen. Der wirkliche Bestand dürfte seinerseits bei rund 100 Tieren
gelegen haben (Kappeler, 1998).
Nach PAULSON (1999) wurde das Gir Wildlife Sanctuary 1965 gegründet und der Gir
National Park im Jahre 1975. Diese wichtigen Ereignisse spiegeln sich auch in den Zahlen
über die im Gebiet vorhandenen Löwen wider. Die Population der Gir-Löwen hatte (nach
Saberwal et al., 1994) 1893 die geringste Individuenzahl. Nach der Gründung der Wildlife
Sanctuary wuchs der Bestand der indischen Löwen im Jahre 1968 auf immerhin 177
Individuen (Joslin, 1985). Fast 3 Jahrzehnte später, im Jahr 1994, waren es schon 284
Indische Löwen, die im Gir-Wald lebten (Chellam und Johnsingh, 1994).
Trotz steigender Bedrohung vieler Tierarten durch die menschliche Population und die
Modernisierung setzt sich die Regierung Indiens auch im 21. Jh. für das Wachsen des
Löwenbestandes im Gir Nationalpark. ein (Mitra, 2005).
EINLEITUNG
In Tabelle 1 (Seite 14) kann man den Verlauf der Population der Indischen Löwen im Gir-
Wald nachvollziehen. Bei der Asiatic Lion Organisation erfährt man zusätzlich, dass nach
dem Tod des Fürstens von Junagadh jährlich 12 bis 13 Löwen geschossen wurden.
Ab dem Jahr 1911 wurde der Abschuss der Löwen streng von der Britischen Administration
kontrolliert. Im Jahr 1913 stellte der Chief Forest Officer of Junagadh fest, dass nicht mehr
als 20 Tiere im Gir-Wald vorhanden seien. Jedoch konnte sich in den folgenden Jahrzehnten
die Population der Großkatzen wieder erholen. Die aktuellen Zahlen sind von 2005 und
besagen, dass sich 359 Indische Löwen im Forest Department Gurajat aufhalten.
Tabelle 1: Individuenzahl (Quelle: Asiatic Lion Organisation) Auflistung der Individuenanzahl der
Asiatischen Löwen im Gir Forest von 1880 bis 2005, gezählt durch verschiedene Einrichtungen. Zusätzlich
befindet sich im rechten Teil der Tabelle eine Auflistung des geschätzten Verhältnisses von männlichen,
weiblichen und juvenilen Löwen im Zeitintervall von 1979 bis 2005.
Population of the Asiatic Lion in the Gir forests
Estimated Ratio
Year
Authority
No. of
Animals
1880
Col. Watson (E)
~12
1893
The then Junagadh State
~31
1905 Maj.
Carnegie 60-70
1905
The then Junagadh State
~100
1913
Mr. Wallinger (E)
<20
1920
Sir. P.R. Cadell (E)
~50
1936
The then Junagadh State
287
1950
Mr. Winter Blyth
227
1955
Mr. Winter Blyth
290
1963
Forest Department Gujarat
285
1968
Forest Department Gujarat
177
1974
Forest Department Gujarat
180
1979
Forest Department Gujarat
205
1984
Forest Department Gujarat
239
1990
Forest Department Gujarat
284
1995
Forest Department Gujarat
304
2001
Forest Department Gujarat
327*
2005
Forest Department Gujarat
359
Male
Female
Cub
1979 76 100 85
1985 88 100 64
1990 82 100 67
1995 94 100 71
2001 92 100 56
2005 72 100 60
* 271 in Gir PA and 56 in surrounding areas.
Außerdem wird in Indien, laut des Kölner Zoos, nach einem zweiten Gebiet gesucht, in
welchem die Indischen Löwen zusätzlich neu angesiedelt werden können. Im Bundesstaat
Madhya Pradesh wurde ein potentielles Gebiet ausgewählt, welches noch ausreichend
Beutetiere (Hirsche und Antilopen) bietet. Aus diesem wurde vorsorglich bereits der
überwiegende Teil der dort lebenden Menschen umgesiedelt.
EINLEITUNG
1.2.4. Bedrohung
Der Indische Löwe ist Bestandteil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), da es
in freier Wildbahn nur noch ca. 200 bis 300 Individuen gibt. Für das Überleben der Unterart
(Panthera leo persica) kommt erschwerend hinzu, dass die Löwen in der Wildnis laut
MITRA 70 bis 80% deformierte Spermien besitzen. Der Grund dafür ist der kleine Genpool
der Löwen. Diese bedenklich geringe Fertilität ist leider keine gute Voraussetzung für ein
erfolgreiches Zuchtprogramm in Zoos, deren Grundlage Löwen aus freier Wildbahn sind. Der
Beginn des Zuchtprogramms in Zoos startete in den 60er Jahren des 20. Jh., um die
genetische Armut dieser Spezies zu konservieren. In den 70er Jahren des 20 Jh. bekam das
Zuchtprogramm mehr Struktur. 1981 wurde das Species Survival Plan® Programm (SSP)
durch die American Zoo and Aquarium Association (AZA) eingeführt (siehe auch:
http://www.aza.org). Zusätzlich wurde ein Zuchtbuch angelegt, um die genetischen und
demografischen Daten der Spezies aufzuzeichnen (Mitra, 2005). Laut Integrated Taxonomic
Information System (ITIS) (März 2008) ist der Indische Löwe nach dem Status der Under the
United States Endangered Species Act (U.S. ESA) bedroht und nach dem International Union
for Conservation of Nature (IUCN) kritisch bedroht.
Nach KAPPELER (1998) ist der längerfristige Fortbestand der Asiatischen Löwen noch nicht
gesichert. Durch das endemische Vorkommen im Gir-Wald könnte beispielsweise eine
einzige Krankheit den ganzen Bestand innerhalb kurzer Zeit ausrotten. Die Gefahr der
Einschleppung einer Krankheit besteht vor allem durch die große Anzahl von Menschen, die
sich ständig im Schutzgebiet aufhält. Neben den rund 7500 Maldharis, die noch innerhalb des
Schutzgebietes leben, gibt es viele Reisende, die sich auf den fünf, den Gir-Wald
durchquerenden, Hauptstraßen fortbewegen. Außerdem sind viele Pilger, welche die vier
großen Tempel im Reservat besuchen, und Einheimische, die in der Nachbarschaft des
Reservates leben und sich im Randgebiet desselben Feuerholz beschaffen, permanent im
Reservat unterwegs. Diese Menschenmassen stellen potentielle Krankheitsüberträger dar.
Um dieses inselartige Vorkommen abzuändern, ist eine Wiederansiedlung der Asiatischen
Löwen in Gebieten zweier anderer Bundesstaaten Indiens geplant. Bislang fehlt allerdings
noch die Genehmigung der indischen Zentralregierung in Delhi. Deshalb müssen die letzten
Asiatischen Löwen in ihrem beschränkten Rückzugsgebiet im Gir-Wald gemäß der
Weltschutzorganisation (IUCN) als ,,vom Aussterben bedroht" betrachtet werden (Kappeler,
1998).
EINLEITUNG
1.2.5. Aktivität
Löwen verbringen 20 bis 21 Stunden, also rund 89% des Tages, schlafend und ruhend.
Messungen der Gehirnwellen von Hauskatzen haben gezeigt, dass sie ca. 12 Stunden leicht
und 3 bis 6 Stunden fest schliefen. Ähnliche Werte könnten auch für Löwen gelten (Schaller,
1976).
Da Löwen dämmerungs- und nachtaktive Tiere sind, jagen sie dementsprechend auch meist
zwischen der Abend- und der Morgendämmerung. Auf die Nahrungssuche entfallen
durchschnittlich 10 bis 14% des Tages, auf das Jagen und Fressen 5 bis 8% und für die
sozialen Aktivitäten nutzen frei lebende Löwen ca. 1 bis 2% ihrer Zeit (Mitra, 2005).
1.2.6. Sozialverhalten und Sozialsystem
Der Löwe ist die einzige Katze, die in Sozialverbänden lebt (Mitra, 2005). Die Lebensweise
der Asiatischen Löwen im Gir-Nationalpark ist jener der Afrikanischen Löwen recht ähnlich.
Auch Indische Löwen leben im Rudel zusammen, wie ihre afrikanischen Vettern. Laut
Kölner Zoo bleiben die weiblichen Löwen ihr Leben lang im Rudel. Die Männchen verlassen
dieses hingegen im Alter von 2 bis 3 Jahren, wenn ihre Mähnen beginnen zu wachsen, und
schließen sich zu sogenannten Junggesellengruppen zusammen. Laut dem Asiatic Lion
Information Centre (2008) bestehen diese Junggesellengruppen meist aus einer Koalition von
2 bis 6 territorialen Männchen.
Diese Junggesellengruppen, auch ,,Banden" genannt, besetzen gemeinsam ein Territorium. In
diesem bewegen sich eine oder mehrere Weibchengruppen (Rudel) umher. ,,Fremde
Männchen" werden von den Banden unnachgiebig aus dem Territorium verjagt. Die
Männchenbanden schließen sich jedoch den Weibchengruppen nicht ständig an, wie dies bei
den Afrikanischen Löwen der Fall ist, sondern tun dies im Allgemeinen nur zum Zweck der
Fortpflanzung (Kappeler, 1998).
Nach MITRA (2005) umfasst ein Rudel 3 bis 6 Individuen. Jedoch besteht dann ein solches
Rudel aus lediglich 2 oder 3 erwachsenen Weibchen und deren Jungen (Kappeler, 1998). M.
K. Ranjitsinh (Mitra, 2005) beobachtete, dass lediglich 42% der Rudel ein ausgewachsenes
Männchen als Rudelmitglied besitzen. Man kann also davon ausgehen, dass die Asiatischen
Männchen nicht sehr bedeutend in einem Rudel sind und deshalb oft separat als Singles oder
den bereits erwähnten Junggesellengruppen anzutreffen sind.
EINLEITUNG
Löwen können eine Geschwindigkeit von bis zu 37 Meilen pro Stunde (ca. 60 km pro Stunde)
erreichen. Jedoch fehlt den Löwen die Ausdauer für Langstreckenläufe. Sie müssen bis auf
30 m an ihre Beute heran kommen, bevor sie ihren Angriff starten (Cotsworld Wildlife Park,
2008).
Löwengebrüll kann man in ca. 10 km Entfernung noch hören. Es wird genutzt, um den
anderen Rudelmitgliedern den eigenen Standort anzuzeigen und um das Territorium anderen
Löwenmännchen gegenüber abzugrenzen. Ein solches Territorium kann eine Größe von 150
Quadratmeilen aufweisen. Die Größe ist abhängig von den vorhandenen Beutetieren und dem
Gruppendruck. Die Löwen markieren ihre Territoriumsgrenzen mit Urin und Kot (Cotsworld
Wildlife Park, 2008).
Durch Besenderung fanden CHELLAM und JOHNSINGH (1994) heraus, dass Männchen
jährlich ein Gebiet von etwa 100 km² als Streifgebiet nutzen. Außerdem durchwandern die
territorialen Katzen regelmäßig Bereiche außerhalb des Schutzgebietes. Die Streifgebiete der
weiblichen Löwen sind mit rund 50 km² nur halb so groß.
1.2.7. Sinnessystem
Für das Verhalten der Katzen haben die Sinne eine unterschiedliche Relevanz. Katzen werden
zu Recht als Augentiere bezeichnet. Sowohl für die Beutesuche als auch bei der innerartlichen
Verständigung spielen visuelle Eindrücke eine ausschlaggebende Rolle. Von gleicher
Funktionstüchtigkeit ist der Gehörsinn. Beide Sinne sind beispielsweise denen des Hundes
überlegen. Geschmacks- und Geruchssinn hingegen sind im Vergleich mit denen des Hundes
weniger gut ausgebildet und haben nur bei der Orientierung in der Nahdistanz Bedeutung (BI-
Lexikon, 1990). Wie bei allen Raubtieren sind die Augen, zum räumlichen Sehen, nach vorne
gerichtet. Die Augen der Katze sind im Verhältnis zum Schädel relativ groß. Durch die fast
parallele Stellung der Augenachsen, die starke Wölbung der Hornhaut und die weite
Ausdehnung der Retina verfügen Katzen über ein weites Gesichtsfeld. Im Zusammenspiel
beider Augen wird das binokulare (räumliche) Sehen möglich, welches unter den Säugetieren
nur bei den Primaten und den Raubtieren hoch entwickelt ist. Das Gesichtsfeld der Löwen
entspricht in etwa dem des Menschens. Diese Eigenschaft der Augen ist für den Löwen als
Beutegreifer sehr wichtig. Am Schärfsten soll die Katze zwischen 2 und 6 m sehen.
EINLEITUNG
Die Sehschärfe entspricht in etwa der des Menschens. Jedoch sind Katzen aufgrund
verschiedener Spezialisierungen ihrer Augen zu einem viel besseren Nachtsehen befähigt. Als
Dämmerungstier ist die Netzhaut der Katze überwiegend mit Stäbchen (lichtempfindlichen
Sinneszellen auf der Netzhaut) ausgestattet. Hinter der lichtempfindlichen Netzhaut der
Katzen liegt eine Schicht reflektierenden Gewebes, das so genannte Tapetum lucidum. In das
Auge einfallendes Licht wird durch das Tapetum lucidum reflektiert und durchläuft die
Rezeptoren der Netzhaut ein zweites Mal. Der Lichtreiz wird verstärkt und die Fähigkeit des
Dämmerungssehens nimmt zu (BI-Lexikon, 1990).
Katzenpupillen können stark geweitet werden, welches das gute Nachtsehen unterstützt
(Hagen und Hagen, 1992). Visuelle Eindrücke spielen, wie bereits erwähnt, bei der
innerartlichen Kommunikation eine große Rolle. So verstärken beispielsweise die schwarzen
Lippen und die schwarzen Flecken an der Rückseite der Ohren des Löwen die Mimik und
erlauben dem Artgenossen so, die übermittelten Stimmungen klar abzulesen (Schaller, 1976).
Löwen besitzen, wie alle Katzen, einen empfindlichen Gehörsinn. Dies ist für den Löwen als
überwiegend nacht- und dämmerungsaktiven Jäger von großer Bedeutung. Aber auch bei der
Kommunikation spielen die sehr vielfältigen Lautäußerungen, zu denen Löwen befähigt sind,
eine entscheidende Rolle (Hagen und Hagen, 1992).
Der Hörbereich der Katzen reicht weit über die obere Hörgrenze des Menschens hinaus.
Leider liegen fast nur Untersuchungen der Hörfähigkeit von domestizierten Katzen vor. Diese
sind vermutlich eher für die kleinen Katzen repräsentativ (Kiltie, 1991). Nach NEFF und
HIND (1955) (BI-Lexikon, 1990) liegt diese bei 60 kHz. Elektrophysiologische
Untersuchungen ergaben sogar Werte um 100 kHz. Die untere Hörgrenze soll nach FOSS und
FLOTTORP (1974) (BI-Lexikon, 1990) bei 60 Hz liegen. Jedoch schwanken die angegebenen
Werte wegen der unterschiedlichen Untersuchungsmethoden erheblich. Über die Bedeutung
der Ultraschallwahrnehmungen der Katze ist viel spekuliert worden. Sicher spielt sie bei der
Lokalisierung der Beute eine herausragende Rolle. Plausibel ist auch die Wahrnehmung von
arteigenen Ultraschalllauten, die nach Untersuchungen von HÄRTEL (1972) (in BI-Lexikon)
bei der Verständigung der Mutter mit den Jungentieren von Bedeutung sein sollen.
Die Ohren der Feliden stehen aufrecht, sind spitz bis rundlich und können in verschiedene
Richtungen gedreht werden. Die Ohren einer Katze lassen sich unabhängig voneinander in
einem weiten Radius drehen, wodurch es ihr möglich ist, Beutetiere aufgrund des Hörens
EINLEITUNG
in der Richtung gut zu lokalisieren. Die Ohrmuscheln der Katze sind mit Ohrhaaren besetzt,
um das Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern. Die Stimmung der Katze lässt sich auch
an den Ohren bzw. deren Stellung ablesen (www.wikipedia.org, 2008).
Die Katze kann genau die räumliche Lage einer Schallquelle orten, da sie in der Lage ist, die
Zeitdifferenz zu messen, mit der die Laute an den beiden Ohrmuscheln eintreffen. In diesem
Zusammenhang spielen die reflektorisch gesteuerten Bewegungen der Ohrmuschel eine
wichtige Rolle (BI-Lexikon, 1990).
Die Tasthaare (Vibrissen, Sinushaare) kennzeichnen die Katze als vorwiegend nachtaktives
Tier. Wichtigste Formen bei der Katze sind die Schnurrhaare auf der Oberlippe, die Spürhaare
in der Augenregion und die über das gesamte Fell verstreuten Leithaare. Vom normalen Haar
weichen die Sinneshaare in ihrem Aufbau ab. Ein Muskel gestattet die aktive Bewegung des
Sinneshaares, besonders der Schnurrhaare (BI-Lexikon, 1990). Außerdem können Vibrissen
durch Luftbewegung in Vibration versetzt werden. Dadurch wird ein grobes räumliches Bild
der Umgebung erzeugt, welches der Katze auch in der Dunkelheit ermöglicht, gut zu sehen.
Die Vibrissen sind bereits bei neugeborenen Katzen vollständig ausgebildet, was die
Bedeutung des Tastsinns deutlich macht (Sproule, 1984).
Der Geruchssinn ist bei Löwen besser ausgeprägt als allgemein angenommen. Er spielt
sowohl beim Wittern der Beute als auch bei der interspezifischen Kommunikation eine große
Rolle. So imprägnieren sich die Mitglieder eines Rudels gegenseitig durch Wangenreiben und
gegenseitiges Belecken mit ihrem ,,Rudelgeruch". Dieser ist für die soziale Bindung in einer
Gruppe von immenser Bedeutung. Außerdem werden Territorien durch Duftmarken markiert.
Der Geruch des Urins der Weibchen lässt die Männchen erkennen, ob sich ein Weibchen im
Östrus befindet (Hagen und Hagen, 1992).
Obwohl die Katze zu den sogenannten Makrosmaten (Riechtieren) zählt, dient die Nase als
Sinnesorgan nur im Nahkontakt (BI-Lexikon, 1990). Neben der Nase hat als Geruchsrezeptor
der Katze das Jacobson`sche Organ (Vomeronasalorgan) eine große Bedeutung. Dieses wird
genutzt, wenn Urin, Fäkalien und Drüsensekrete von Artgenossen und andere nicht-
biologische Gerüche analysiert werden. Der Eingang des Organs befindet sich am Gaumen.
Wenn Katzen dieses Organ nutzen, bringen sie ihren Kopf nahe an die Quelle des zu
perzipierenden Stoffes und kräuseln die Lippe. Dies wird als ,,Flehmen" bezeichnet (Bateson,
Turner, 1988).
EINLEITUNG
1.2.8. Fortpflanzung und Entwicklung
Die Weibchen verlassen während der Paarung und der Geburt der Jungtiere ihr Rudel (Mitra,
2005). Gir-Löwen pflanzen sich zu jeder Jahreszeit fort. Die Gestation dauert rund dreieinhalb
Monate (100 bis 119 Tage). Je Wurf bringt das Löwenweibchen meist 2 bis 4 maximal 6
Junge (Cotsworld Wildlife Park, 2008) zur Welt. Diese werden in den ersten 6 bis 7 Monaten
gesäugt. Erst im Alter von 2 Jahren, später als jede andere Katzenart, sind sie vollwertige
Jäger. Geschlechtsreif werden sie im 4. Lebensjahr und sind mit etwa 6 Jahren vollständig
ausgewachsen (Khalaf-von Jaffa, 2006).
Die Löwenweibchen sind super fecund (Cotsworld Wildlife Park, 2008; übersetzt:
,,superfruchtbar"). Dies bedeutet, dass sich die Weibchen mit mehreren Männchen verpaaren
können. Die Jungtiere aus einem Wurf können aufgrund dessen von verschiedenen Vätern
sein. Während der Paarungszeit, die 5 bis 7 Tage andauern kann, kopuliert das Löwenpaar 20
bis 40 mal pro Tag. Trotz dieser großen Häufigkeit ist die Wahrscheinlichkeit der
Befruchtung sehr gering. In dieser Zeit verzichten die Paare auch meist auf das Jagen. In
Gefangenschaft reproduzieren sich die Indischen Löwen sehr gut. Die Weibchen in einem
Rudel synchronisieren ihren Reproduktionszyklus, sodass sie beim Aufziehen und Säugen der
Jungen miteinander kooperieren können (Cotsworld Wildlife Park, 2008).
Das Löwenmännchen schnuppert am Harn des Weibchens und kräuselt dabei die Lefzen zu
einer charakteristischen Grimasse das Flehmen. Wie schon oben erwähnt, erkundet das
Männchen mittels Flehmen den Hormonspiegel und die eventuelle Paarungsbereitschaft des
Weibchens (Denis-Huot, 2000).
Laut des BI-Lexikons für Rassekatzen (1990) ist das Flehmen eine Wahrnehmungsform von
chemischen Signalen innerhalb der Chemokommunikation. Dieses kommt vor allem bei
Huftieren und Raubtieren vor. Ursprünglich wurde diese Verhaltensweise als Rümpfgebärde
bezeichnet. Das Flehmen ist durch das Hochziehen der Oberlippe, leichtes Öffnen des Maules
und Verschließen der Nasenöffnung gekennzeichnet. Es wird sowohl von männlichen als
auch weiblichen Tieren ausgeführt, überwiegend kommt es jedoch bei Katern im
Funktionskreis des Sexualverhaltens vor. Leyhausen (1982) (BI-Lexikon) vermutet die
Existenz eines, dem Lockduft der weiblichen Katze ähnlichen, universellen Geruchfaktors
den Pheromonen, der als Schlüsselreiz für das Flehmen wirkt. Laut The Asiatic Lion
Information Centre © 2000 beträgt ein Geburtenintervall bei Indischen Löwen 16 bis 26
Monate. Die Ovulation wird während der Kopulation hervorgerufen.
EINLEITUNG
Deshalb wird der Löwe, wie auch die domestizierte Katze, als Reflex-Ovulator bezeichnet.
Die Zeugungsfähigkeit bleibt bei beiden Geschlechtern bis ins Alter von ca. 15 Jahren
erhalten.
Das Höchstalter liegt für Weibchen im Allgemeinen bei 17 bis 18 Jahren. Bei den männlichen
Löwen rechnet man mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 15 bis 16 Jahren (Khalaf-
von Jaffa, 2006). In Gefangenschaft können laut dem Cotsworld Wildlife Park (2008) die
Indischen Löwen ein Alter von bis zu 30 Jahren erlangen.
Aufgrund von Nahrungskonkurrenz und Infantizid sterben 80% der Jungtiere in freier
Wildbahn, bevor sie 2 Jahre alt sind (Cotsworld Wildlife Park, 2008).
1.2.9. Nahrung
Wie sein afrikanischer Vetter ist der Asiatische Löwe hauptsächlich ein Großwildjäger.
Darüber hinaus zeigt er kaum besondere Vorlieben, sondern richtet sich nach der
,,Verfügbarkeit" der lokalen Wildtiere. Deshalb ist heute der Axishirsch (Axis axis), das
häufigste Großwild im Gir-Wald, auch die häufigste Beute der Gir-Löwen. Bei fast der Hälfte
der Tötungen sind Axishirsche die Opfer. Daneben erlegen die Großkatzen vor allem Indische
Sambarhirsche (Cervus unicolor), Wildschweine (Sus scrofa), Nilgauantilopen (Boselaphus
tragocamelus), Indische Gazellen (Gazelle bennettii), Vierhornantilopen (Tetracerus
quadricornis) und hin und wieder ein Rind oder ein anderes Haustier (Kappeler, 1998).
Ein ausgewachsener männlicher Löwe benötigt ungefähr 7 kg Fleisch pro Tag. Ein Weibchen
benötigt rund 5 kg. Jedoch können sich die Löwen mit großen Mengen voll fressen, wenn sie
genügend Beute reißen (Cotsworld Wildlife Park, 2008).
Ein Männchen ist in der Lage über 30 kg Fleisch in einer einzigen Mahlzeit zu verschlingen.
Danach kann es für eine ganze Woche lang nüchtern bleiben (Denis-Huot, 2003).
1.2.10. Mensch Löwe Konflikt
Noch vor wenigen Jahrzehnten bildeten die Haustiere der ansässigen Bevölkerung vor allem
Zeburinder und Wasserbüffel die Hauptbeute der Gir-Löwen. Die Entstehung dieses
Problems geht auf eine Entscheidung des Fürstens von Junagadh
EINLEITUNG
zurück. Er gestattete um 1860 einem nomadischen Hirtenvolk, den Maldharis, seine
Haustierherden im Gir-Wald weiden zu lassen. Daraufhin waren bald 20 000 Stück Vieh,
während der Trockenzeit sogar doppelt bis dreimal soviel, im Gir-Wald vorhanden. Diese
vielen Tiere überweideten das Gebiet hoffnungslos. Die Haustiere ließen für die natürlichen
Beutetiere der Löwen kaum mehr Nahrung übrig, sodass die Wildbestände stark
zurückgingen. Zwangsläufig mussten die Löwen auf die Haustiere umstellen. So ergaben
Kotuntersuchungen, dass bis zu 75% der Löwenbeute aus diesen Haustieren bestand
(Kappeler, 1998). Zu Beginn der 70er Jahre ließ die Forstbehörde von Gujarat eine Mauer um
den ganzen Nationalpark bauen. Mit Hilfe dieser Mauer sollen die Zeburinder und
Wasserbüffel aus dem Gir-Wald ferngehalten werden. Zusätzlich wurde etwa die Hälfte der
Maldharis aus dem Nationalpark ausgesiedelt und anderenorts sesshaft gemacht. Dadurch
sollen zum einen die Vegetation und zum anderen die Wildtierbestände die Möglichkeit
erhalten, sich wieder zu erholen. Tatsächlich hat sich bspw. der Bestand der, für die Löwen so
wichtigen, Axishirsche inzwischen wieder sehr gut erholt und zählt heute rund 38 000
Individuen (Kappeler, 1998). Bemerkenswerter Weise nahmen die Maldharis es den Löwen
nie übel, wenn diese eines ihrer Rinder oder einen ihrer Büffel schlugen. Die Maldharis
respektieren die Löwen und sind sich dessen bewusst, dass sie im Lebensraum der Löwen
sind. Desweiteren bekommen die Hirten, die im Durchschnitt drei bis fünf Rinder je Familie
und Jahr verlieren, vom Staat eine Entschädigung (Kappeler, 1998).
1.2.11. Projekte zur Arterhaltung
Nach Informationen vom Zoo Zürich hat die
Indische Regierung in Zusammenarbeit mit dem
Bundesstaat Madhya Pradesh das Kuno Wildlife
Sanctuary gegründet. Denn dieses soll zur
zweiten Heimat des Indischen Löwen werden.
Eine Umsiedlung von 5 bis 8 Tieren aus dem
Gir Nationalpark ist zur Gründung dieser
zweiten Population vorgesehen.
Das über 345 km² große Kuno
Naturschutzgebiet liegt im Nordwesten von
Abb. 4: Lage der Reservate in Indien
(Quelle: Re-introduction News, 1999)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836620123
- DOI
- 10.3239/9783836620123
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Studiengang Biologie
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Oktober)
- Note
- 1,6
- Schlagworte
- indischer löwe verhalten ätherische environmental melisse
- Produktsicherheit
- Diplom.de