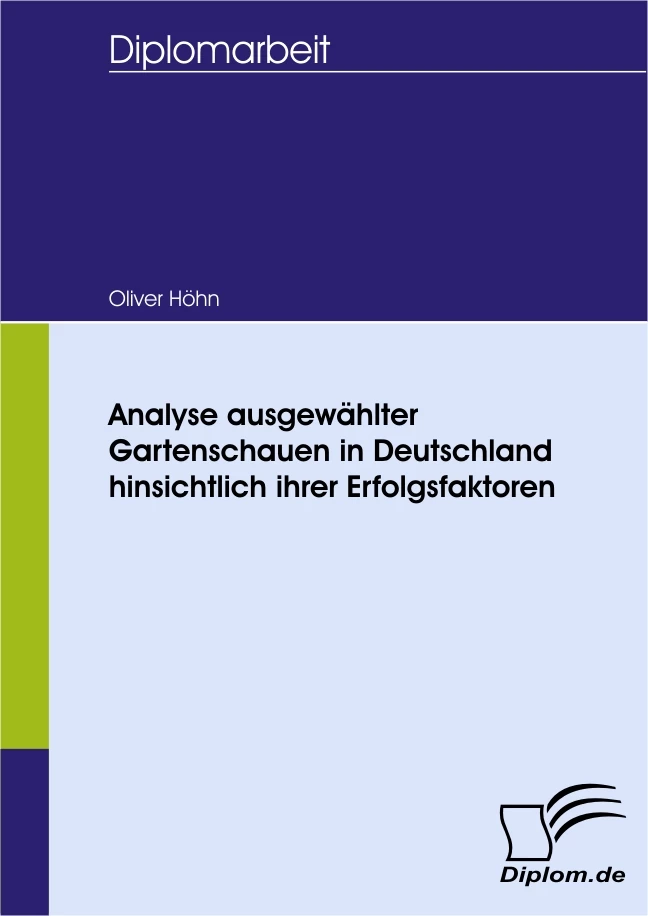Analyse ausgewählter Gartenschauen in Deutschland hinsichtlich ihrer Erfolgsfaktoren
Zusammenfassung
Zur Lebensqualität in Städten gehören Parks und sonstige Grünflächen schon seit langer Zeit ins Stadtbild. Sie werden sogar immer wichtiger, weil bereits heute in den Industrieländern Europas, Nordamerikas und in Japan 75 % der Bewohner in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern leben.
Waren die Anlagen früher für den gemeinen Bürger nicht gedacht, sondern für den gehobenen Bürgerstand oder gar den Adel, änderte sich dies mit der französischen Revolution. Der normale Bürger kam ebenfalls in den Genuss des Flanierens, Entspannens und Entdeckens im Park. Der Stellenwert der Parks wuchs in zunehmendem Maße, gerade die dichter werdende Bebauung in den Städten zur Zeit der Industrialisierung übte ein noch höheres Verlangen nach Grün aus. In der Stadtentwicklung wurde dem durch Landschaftspläne, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne Rechnung getragen.
Die ersten Vorläufer der heutigen Gartenschauen waren im 18. Jahrhundert die Blumenschauen (siehe dazu Kapitel Gartenschauen: Vergangenheit und Gegenwart, ab Seite 5). Heute dienen Gartenschauen auch dazu, die Stadtentwicklung voranzutreiben bzw. bei der Verwirklichung von Großprojekte zu helfen, die aufgrund ihrer Kosten sonst nicht oder erst viel später realisiert werden würden. Der Imagegewinn für die jeweilige Stadt spielt auch eine gewisse Rolle. Je nach Größe der Stadt finden entweder Regionalgartenschauen, Landesgartenschauen, Bundesgartenschauen oder sogar Internationale Gartenbauausstellungen statt.
Der Zeitgeist veränderte auch die Anforderungen an die Schauen bzw. die zu behandelnden Themen (siehe dazu Kapitel 6, Einschübe Zeitgeist).
Der eigentliche Zweck der Ausstellungen ist aber weiterhin die Leistungsschau und Information des Fachpublikums, auch wenn dies nicht auf Anhieb in den Programmen ersichtlich ist. Um viele Interessenten anzulocken und damit das Defizit für die Stadt möglichst klein zu halten, wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Diese Eventkultur oder Festivalisierung trifft jedoch nicht immer auf Zuspruch.
In den letzten Jahren hat unter anderem durch die Rio-Konferenz 1992 der Begriff Nachhaltigkeit Einzug in dieses Metier gehalten. Eine Definition folgt (siehe dazu im Anhang).
Vielfach ist bereits die Frage gestellt worden, ob es nicht auch ohne Gartenschauen möglich, und damit auch billiger wäre, Grünflächen zu erhalten oder neu zu schaffen.
Die Veranstalter kontern häufig mit dem Argument, dass ohne die Schau derart große Projekte […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1.0 Einführung
1.1 Einleitung
1.2 Heutige Situation
1.3 Problemstellung
1.4 Ziel der Arbeit
1.5 Arbeitsschritte
2.0 Gartenschauen: Vergangenheit und Gegenwart
2.1 Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg
2.2 Entwicklungen ab dem Zweiten Weltkrieg
2.3 Kategorien von Gartenschauen
2.4 Exkurs Landesgartenschauen
3.0 Beweggründe für Gartenschauen
3.1 Motivation zur Durchführung einer Buga oder IGA
3.2 Aufgaben und Ziele einer Buga oder IGA
3.3 Anforderungen an die veranstaltende Stadt
3.4 Anforderungen an Gartenschauen
3.5 Fazit der Erfahrungen
4.0 Organisatorisches zu Gartenschauen
4.1 Interessengruppen
4.2 Zentralverband Gartenbau e.V
4.3 Die Deutsche Bundesgartenschau GmbH
4.4 Gremien einer Gartenschau
4.5 Vertragsverhältnisse
4.6 Beteiligungsverhältnisse
4.7 Finanzierung einer Gartenschau
4.8 Blick in die benachbarten Staaten
4.9 Grenzüberschreitende Gartenschauen
5.0 Besucherbefragung
5.1 Negative Einflussfaktoren auf die Besucherzahlen
5.2 Auswertung der Besucherbefragungen
5.3 Abschlussberichte
6.0 Erfolgskriterien
6.1 Erläuterung der Vorgehensweise
6.2 Kritik an Gartenschauen
6.3 Positive Äußerungen zu Gartenschauen
6.4 Sammlung der Erfolgskriterien
6.5 Komponentenbildung
7.0 Analyse von Gartenschauen
7.1 Einschub Zeitgeist 50er Jahre
7.2 Analyse Buga Hannover
7.2.1 Analyse IGA Hamburg
7.3 Einschub Zeitgeist der 60er und 70er Jahre
7.4 Analyse Buga Stuttgart 1961
7.4.1 Analyse IGA Hamburg 1963
7.4.2 Analyse Buga Karlsruhe 1967
7.4.3 Analyse IGA Hamburg 1973
7.4.4 Analyse Buga Mannheim 1975
7.4.5 Analyse Buga Stuttgart 1977
7.5 Einschub Zeitgeist 80er Jahre
7.6 Analyse IGA München 1983
7.6.1 Analyse Buga Berlin 1985
7.7 Einschub Zeitgeist 90er Jahre
7.8 Analyse Buga Stuttgart 1993
7.8.1 Analyse Buga Magdeburg 1999
7.8.2 Analyse Buga Potsdam 2000
7.8.3 Analyse IGA Rostock 2003
8.0 Auswertung der Analysen
8.1 Fazit der Analysen
9.0 Resümee
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Danksagung
Anhang
1.1 Einleitung
Zur Lebensqualität in Städten gehören Parks und sonstige Grünflächen schon seit langer Zeit ins Stadtbild. Sie werden sogar immer wichtiger, weil bereits heute in den Industrieländern Europas, Nordamerikas und in Japan 75 % der Bewohner in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern leben.[1]
Waren die Anlagen früher für den gemeinen Bürger nicht gedacht, sondern für den gehobenen Bürgerstand oder gar den Adel, änderte sich dies mit der französischen Revolution. Der normale Bürger kam ebenfalls in den Genuss des Flanierens, Entspannens und Entdeckens im Park. Der Stellenwert der Parks wuchs in zunehmendem Maße, gerade die dichter werdende Bebauung in den Städten zur Zeit der Industrialisierung übte ein noch höheres Verlangen nach Grün aus. In der Stadtentwicklung wurde dem durch Landschaftspläne, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne Rechnung getragen.
Die ersten Vorläufer der heutigen Gartenschauen waren im 18. Jahrhundert die Blumenschauen (siehe dazu Kapitel Gartenschauen: Vergangenheit und Gegenwart, ab Seite 5). Heute dienen Gartenschauen auch dazu, die Stadtentwicklung voranzutreiben bzw. bei der Verwirklichung von Großprojekte zu helfen, die aufgrund ihrer Kosten sonst nicht oder erst viel später realisiert werden würden. Der Imagegewinn für die jeweilige Stadt spielt auch eine gewisse Rolle. Je nach Größe der Stadt finden entweder Regionalgartenschauen, Landesgartenschauen, Bundesgartenschauen oder sogar Internationale Gartenbauausstellungen statt.
Der Zeitgeist veränderte auch die Anforderungen an die Schauen bzw. die zu behandelnden Themen (siehe dazu Kapitel 6, Einschübe Zeitgeist).
Der eigentliche Zweck der Ausstellungen ist aber weiterhin die Leistungsschau und Information des Fachpublikums, auch wenn dies nicht auf Anhieb in den Programmen ersichtlich ist. Um viele Interessenten anzulocken und damit das Defizit für die Stadt möglichst klein zu halten, wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Diese „Eventkultur“ oder „Festivalisierung“ trifft jedoch nicht immer auf Zuspruch.
In den letzten Jahren hat unter anderem durch die Rio-Konferenz 1992 der Begriff Nachhaltigkeit Einzug in dieses Metier gehalten. Eine Definition folgt (siehe dazu im Anhang).
Vielfach ist bereits die Frage gestellt worden, ob es nicht auch ohne Gartenschauen möglich, und damit auch billiger wäre, Grünflächen zu erhalten oder neu zu schaffen.
Die Veranstalter kontern häufig mit dem Argument, dass ohne die Schau derart große Projekte nicht durchsetzungsfähig wären.
1.2 Heutige Situation
Seit 1951 haben in der Bundesrepublik 6 Internationale Gartenbauausstellungen (IGA) und 22 Bundesgartenschauen (Buga) stattgefunden (Buga 2005 in München mitgezählt). Die erste Bundesgartenschau nach dem 2. Weltkrieg, begann mit einer Fläche von 20 ha und 1,6 Mio. Besuchern in Hannover. Die Entwicklung zu immer größeren Flächen (Spitzenwert Buga Kassel 1981: 235 ha) und zu mehr Besuchern (Spitzenwert IGA München 1983: 8,3 Mio. Besucher) verlief bis Mitte der 80er Jahre konstant steigend. Spätere Gartenschauen waren nicht annähernd so gut besucht. Ein Vergleich der Gartenschauen findet mehrheitlich nur über die erreichte Besucherzahl bzw. über die Größe der Schau statt. Dies sind jedoch keine aussagekräftigen Kriterien, denn sie berücksichtigen zu wenig die Einflüsse, Wetter, Lage der Stadt, negative Presse im Vorfeld und ähnliche. Außerdem sollten auch andere Ziele, die viel wichtiger einzustufen sind, einbezogen werden. Zum Beispiel: Nachhaltigkeit einer Gartenschau, die Wirkung als Impulsgeber einer Region und langfristige Image- und Ansehenssteigerung der jeweiligen Stadt, um nur einige zu nennen.
1.3 Problemstellung
Im Vorfeld von Gartenschauen gibt es sehr viele Erwartungen von verschiedensten Gruppen. Bürger, Politiker, Verbände und „Spezialisten“ wollen sich und ihre Anliegen berücksichtigt sehen. Die Euphorie ist allerseits sehr groß. Es wird viel diskutiert in den Gremien und in den Medien. Lokalpolitiker wollen sich profilieren und sich teilweise „ein Denkmal setzen“. Bis zu Beginn der Schau konnten viele Versprechen nicht eingehalten werden. Viele Beteiligte zwingen zu vielen Kompromissen. In der Presse schlägt sich dies mit entsprechend gefärbten Artikeln nieder. Die Schauen der letzten Jahre blieben meist hinter den in sie gesetzten (Besucher-) Erwartungen zurück. Der langfristige Nutzen wird dabei selten berücksichtigt.
Nach der Schau gibt es kaum Veröffentlichungen um die Veranstaltung. Es gibt zwar Anschlussberichte der Deutschen Bundesgartenschau Gesellschaft (DBG), diese werden jedoch „unter Verschluss“ gehalten.
Nach der Schau werden die pflegeaufwändigeren Teile ab- bzw. rückgebaut. Zurück bleibt ein Park, der desöfteren nur gegen Eintritt zu betreten ist. Die
angespannte Finanzlage zwingt zu weiteren Einsparungen und die ehemaligen Gartenschauen führen ein unterschiedliches Schicksal. Einige von ihnen werden sehr gut angenommen (Beispiel Stuttgart, Hamburg), andere verlieren nach der Schau weiter an Attraktivität (Magdeburg, Rostock). Eine Untersuchung zu den Gründen, warum dies bei der jeweiligen Schau der Fall ist, gibt es nicht.
1.4 Ziel der Arbeit
In dieser Arbeit soll eine Analyse ausgewählter Gartenschauen anhand eines selbst erstellten Kriterienkataloges durchgeführt werden.
Zuvor wird die Geschichte der Gartenschauen in Deutschland vorgestellt. Es folgen Informationen, die die Vorgänge vor der Gartenschau betreffen.
1.5 Arbeitsschritte
Nach der Vorstellung der Geschichte der Gartenschauen in Deutschland, folgt ein Überblick zum Aufbau, den beteiligten Organisationen, den Interessengruppen und der Finanzierung der Schauen. Die Informationen sollen das Bild der Gartenschauen zu ergänzen und aufzuzeigen, warum es unter Umständen schwierig ist, eine erfolgreiche Schau durchzuführen.
In Kapitel 5, ab Seite 42 werden Pro-Argumente und Contra-Argumente zusammen getragen. Daraus ergeben sich schon die ersten Kriterien.
Anschließend werden weitere Kriterien aus Literatur und sonstigen Quellen dazu gefügt. Dabei sollen sie kurz erläutert werden, um zu verdeutlichen, warum diese ausgewählt wurden. Nach der Erstellung des Kriterienkatalogs folgt das Kapitel mit den Analysen. Dazwischen finden sich kurze Einschübe zum Zeitgeist der jeweiligen Dekade, um das Verständnis zu fördern. Die Gartenschauen werden kurz vorgestellt und anschließend bewertet. Am Ende der Arbeit findet sich eine zusammenfassende Tabelle und ein Fazit.
2.0 Gartenschauen: Vergangenheit und Gegenwart
Gartenschauen in ihrer heutigen Form haben eine lange Tradition in Deutschland. Das Interesse der Bevölkerung an Pflanzen war schon immer groß. So entwickelte sich eine Ausstellungskultur, die weitgehend bis heute in der ursprünglichen Form erhalten ist. Heute muss sie sich den Herausforderungen der Moderne stellen. Unterschiedlichen Interessen der Kommunen, der Bevölkerung und der Interessenverbände von Gartenbau und Landschaftsarchitektur gilt es gerecht zu werden.
2.1 Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg
Der Ursprung der Gartenschauen liegt in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Es hatten weitreichende philosophische, soziale und politische Veränderungen statt gefunden. Auch auf dem Gebiet der Botanik wurden große Erfolge erzielt, z.B. Mendel`sche Regeln 1865).
Forschungsreisen in exotische Länder brachten Botanikern eine Fülle an neuem Forschungsmaterial. Häufig nahmen sie Samen und teilweise auch ganze Pflanzen mit in die Heimat. Möglich wurde der Transport von kompletten Pflanzen auf Schiffen durch die Erfindung des Ward`schen Kastens, einem kleinen Gewächshaus mit konstanter Atmosphäre.
Das war die Zeit der großen, privaten Pflanzensammlungen. Wer Geld hatte, und dies zur Schau stellen wollte und sich dabei noch als gebildet darstellen wollte, kaufte sich für viel Geld exotische Pflanzen. Diese wurden in ein Gewächshaus gestellt und von Zeit zu Zeit der Öffentlichkeit zum Bestaunen gezeigt. Das waren die ersten Blumenschauen.
Mit ihnen ein neuer Berufszweig, nämlich die Kunst – und Handelsgärtner, (neben den Hof – und Herrschaftsgärtnern) die Zucht und Handel mit allerlei Pflanzen betrieben. Die Erwerbsgärtner stellten ihre Produkte der Öffentlichkeit durch Öffnung ihrer Flächen vor.
Somit sind private Pflanzenliebhaber und die gewerblichen Schauen der Züchter Ausgang der Gartenschauen. Diesen privaten Blumenschauen waren in Vielfalt und Dauer der Ausstellung Grenzen gesetzt.
Das steigende Interesse an Pflanzen führte schließlich zur Gründung verschiedener Pflanzengesellschaften, wie z.B. der englischen Royal Horticultural Society (1904) oder der belgischen Société d` Agriculure et de Botanique de Gand (1908).
Die Durchführung von Gartenschauen gehört mit zu ihren Aufgaben und so richtete bereits 1809 die belgische Gesellschaft die erste Pflanzen – und Blumenausstellung auf dem europäischen Kontinent aus. 1837 fand eine erste Internationale Blumenausstellung in Belgien statt.
In Deutschland kam es 1822 auf Anordnung Königs Friedrich Wilhelm III. zur Gründung des „Vereins zur Förderung des Gartenbaues in den Königlich Preußischen Staaten“, aus dem später die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft wurde.
In Berlin fand 1830 erstmals eine Ausstellung der Gartenbauvereine statt. Diese dauerte nur wenige Tage.
Im Mai 1869 folgte die erste Gartenbauausstellung in Hamburg mit internationaler Beteiligung aus Belgien, Frankreich, Großbritannien, Niederlanden, Italien, Norwegen, Schweden, Portugal und den Vereinigten Staaten von Amerika. Es wurden heimische und exotische Zuchterfolge präsentiert.
1897 veranstaltete Hamburg erneut eine Internationale Gartenbauausstellung. Sie fand vom 1. Mai bis zum 4. Oktober statt. Damit war sie die erste Ausstellung mit halbjähriger Dauer und internationaler Beteiligung. Außerdem ging es nicht nur um die Ausstellung der neusten Züchtungserfolge und Gartenprodukte, sondern rückte das Gelände, immerhin 14 ha groß, mit in den Mittelpunkt der Ausstellung. Somit war die IGA in ihren Grundzügen geboren und alle folgenden Schauen übernahmen dieses Konzept aus Hamburg.
Die 1907 in Mannheim zum ersten Mal stattfindende Gartenausstellung befasste sich neben den Pflanzen auch mit dauerhaften, städtebaulichen Akzenten. Es entstanden der Friedrichsplatz und die Augustaanlage: sie gingen wegen ihrer gartengestalterischen Einmaligkeit in die Geschichte der Gartenbaukunst ein.
In der wirtschaftlichen Krise nach dem 1. Weltkrieg wurden die Gartenschauen vermehrt dazu genutzt, Lebensfreude zu vermitteln und die Bevölkerung von den Alltagssorgen abzulenken. Es gab in der Zeit keine zeitlichen oder räumlichen Konzepte. Im Jahr 1925 wurden 28 Gartenausstellungen in ganz Deutschland veranstaltet! Der Beschluss wurde von der Kommune oder dem Berufsstand gefällt, nur die Finanzierung der Ausstellung musste gesichert sein.
Bei der "Großen Ruhrländischen Gartenschau" (GRuGa) 1929 in Essen war die Arbeitsbeschaffung mitten in der Weltwirtschaftskrise das größte Anliegen.
Damit war die GRuGa auch Anregung für die Nationalsozialisten, die 1938 das Gelände auf 47 ha vergrößerten und dort populistische Sportveranstaltungen und Fackelzüge unter dem Namen der "Zweiten Reichsausstellung des deutschen Gartenbaus" veranstalteten.
Ferner wurde die Gartenschauidee neu definiert und die Reichsgartenschau mit einem 3-jährigen Rhythmus beschlossen. Veranstaltet wurde die letzte der "Reichsgartenschauen" 1939 in Stuttgart.
Die Stuttgarter Gartenschau schuf einen reinen Erholungspark und revitalisierte das alte Steinbruchgelände am Killesberg. Der Entwurf von Hermann Mattern war für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich, weil er auf pathetische und axiale Elemente, sogar auf Axialität verzichtete. Die Anlage zeigt auch heute noch als einzige die Gartenbaukunst der Zwischenkriegszeit. Der Ausbruch des 2. Weltkrieges führte zum Abbruch der Schau, das Gelände wurde von 1939 bis 1945 von den Nazis als Sammelstelle für württembergische Juden missbraucht.
Für heutige Gartenschauen ist der gärtnerische Wettbewerb selbstverständlich, aber auch zu Beginn der Gartenbauausstellungen wurden bereits Preise verliehen. Zwar fiel der Wettbewerb mit einer einzig verliehenen Silbermedaille 1809 in Gent noch bescheiden aus. Auch 1833 auf der deutschen Schau wurden seltene Topfpflanzen als Preise verliehen. Trotzdem wurde der Wettbewerb unter den Ausstellern fortgesetzt und war auch von diesen erwünscht.
Einheitliche Bewertungsmaßstäbe gab es erst später.
Wenige Jahre später wurden Spezialschauen eingeführt, unter anderem fand 1842 bereits die dritte Georgien-Ausstellung in Dessau statt.
Es wurde für Besucher wie auch für Aussteller immer unübersichtlicher auf den Gartenschauen. Die Züchter hatten eine unüberschaubare Anzahl an Züchtungen produziert, weil sie keine Auswahl trafen zwischen sortimentsbereichernden Pflanzen und nicht bereichernden Pflanzen.
Es folgten Spezialschauen zu bestimmten Arten, Rassen und Züchtungen. Dadurch wuchs der Platzbedarf. Die Schauen wurden damals in kleinen Räumen, später in Hallen und Sälen präsentiert. Im Jahr 1869 fand die erste Gartenschau unter freiem Himmel in Hamburg statt. Die Fläche betrug 14 ha, die Ausstellungsdauer war mit zehn Tagen eher kurz. 1897 war die Internationale Gartenbauausstellung wieder zu Gast in Hamburg. Jedoch betrug die Ausstellungsdauer damals fünf Monate, die Ausstellungsfläche blieb erhalten (Planten un Blomen) und wurde der Bevölkerung für Erholung und Erfreuung zugänglich gemacht. Diese IGA in Hamburg kann als die erste Schau im herkömmlichen Sinn betrachtet werden, die alle Elemente enthielt, die heute noch vorgegeben sind: Der Wettbewerb, Spezialschauen, die Darstellung aller Pflanzenbereiche, die halbjährige Dauer in einem dauerhaftem, erhalten gebliebenen Park.
Die Nationalsozialisten nahmen das Konzept der Gartenschauen auf, weil sie über diese Institution viele Menschen erreichen konnten. Deshalb begann 1930 der Reichsverband des Deutschen Gartenbaues Richtlinien für die Veranstaltungen zu erarbeiten. Der Gartenbauverband wurde unter Herrschaft der Nationalsozialisten in den Reichsnährstand überführt. Nichtsdestotrotz, die Richtlinien der Gartenschauen hatten weiterhin Bestand. Die Gartenschauen wurden in die Propaganda-Maschinerie integriert und wurden in „Reichsgartenschauen“ umbenannt (siehe auch weiter oben). Diese fanden 1936 in Dresden, 1938 in Essen und die letzte 1939 in Stuttgart statt.[2]
2.2 Entwicklungen ab dem Zweiten Weltkrieg
Während des 2. Weltkrieges fand keine Gartenschau statt aber nur vier Monate nach Kriegsende veranstalteten Erfurter Betriebe die erste kleine Gartenschau. Es folgten weitere kleinere, regionale Ausstellungen, z.B. Landau 1949 mit der "Süwega", der Südwestdeutschen Gartenschau, Stuttgart 1950 mit der Deutschen Gartenschau und 1951 fand die erste Bundesgartenschau in Hannover statt.[3]
2.3 Kategorien von Gartenschauen
Eine Bundesgartenschau (Buga), findet seit 1951 im zweijährigen Turnus statt, im zehnten Jahr wird sie durch eine IGA ersetzt. Die Städte bewerben sich aufgrund der langen Vorplanungszeit ca. 10 Jahre vor dem Wunschtermin bei der DBG. Der Name Bundesgartenschau bezieht sich nicht auf die Finanzierung dieser Schauen (dazu später mehr), sondern auf die potentielle Veranstaltungsebene, nämlich auf die Bundesebene. Es finden sich Beiträge aus allen deutschen Bundesländern.
Die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) ersetzt eine Bundesgartenschau in jedem zehnten Jahr. In Hamburg fand die erste IGA 1953 auf dem Planten un Blomen-Gelände statt. Eine IGA wird an Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern vergeben. Im Unterschied zur Bundesgartenschau zeigen verschiedene Nationen Ausstellungsgärten und präsentieren sich mit einem landestypischen Pavillon.
In den vergangenen 50 Jahren wurden über 2000 ha Grünflächen mit Hilfe der Schauen neu gestaltet und erhalten.[4]
2.4 Exkurs Landesgartenschauen
Seit 1980 finden in den Jahren zwischen den Bugas die Lagas (Landesgartenschauen) statt. Diese Regelung wurde getroffen, um zu verhindern, dass in jedem Jahr eine Gartenschau präsentiert wird und sich die Schauen gegenseitig die Besucher streitig machen. Die erste LaGa fand bundeslandübergreifend in Ulm/Neu Ulm (Baden Württemberg/Bayern) statt. Der Unterschied zwischen einer LaGa und einer IGA/Buga ist das Nichtvorhandensein von gärtnerischen Wettbewerben. Die Leistungsvergleiche finden nur auf der Bundesebene statt. Wie häufig LaGa´s stattfinden, entscheidet das betreffende Bundesland autonom. Die Finanzierung ist in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen über fest im Landeshaushalt eingeplante Budgets größtenteils gewährleistet.[5]
Landesgartenschauen sind für mittlere und kleinere Städte gedacht, denen es mit ihrer geringeren Finanzkraft schwer fällt, sich den Problemen der innerstädtischen Grün- und Freiräume sowie der Naherholung zu widmen. Im Zuge der Umweltbewegung haben Landesgartenschauen über den Agenda-Prozess eine zunehmend ökologische Orientierung erfahren, wie zum Beispiel die Renaturierung an Gewässern, die Anlage von Feuchtbiotopen sowie die Entsiegelung von Flächen. Das Verfahren zur Entwicklung einer LaGa ist abhängig von der jeweiligen Landesregelung und von meist extern erstellten Machbarkeitsstudien. Hierbei treten die Gemeinden vielfach in Konkurrenz zueinander, wenn nicht das jeweilige Bundesland steuernd eingreift und Vergabekriterien entwickelt. Baden-Württemberg und Bayern sind die Bundesländer mit der längsten Erfahrung auf diesem Gebiet, sie veranstalten alle zwei Jahre eine LaGa und verlangen Abschlussdokumentationen von den Ausstellungsstädten. Andere Bundesländer wie Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen haben dieses Instrument erst in jüngster Zeit belebt und dabei auf die veröffentlichten Daten und Richtlinien anderer Bundesländer zurückgegriffen. Schleswig-Holstein führt keine Gartenschauen durch, während Nordrhein-Westfalen Lagas mit regionalen und lokalen Präsentationen verbindet.[6]
Es wird teilweise die Auffassung vertreten, Lagas seinen nachhaltiger als Bugas und IGAs, da die Einbindung in die Stadt besser funktioniert. Dies rührt aus kürzeren Organisationswegen her. Vermutlich kann dadurch eine bessere Kosteneffizienz erreicht werden.
Im Anhang befindet sich eine Aufstellung mit allen bisher veranstalteten Bugas und IGAs.
3.0 Beweggründe für Gartenschauen
3.1 Motivation zur Durchführung einer Buga oder IGA
Zur Verdeutlichung der Interessenkonflikte und um die Komplexität der daraus resultierenden Anforderungen der Beteiligten, führt dieser Abschnitt die unterschiedlichen Interessen der aller Beteiligten auf.
Was erhoffen sich Städte, wenn sie sich für eine Gartenschau in 10 Jahren bewerben? Dies sind heute zumindest andere Ziele als zu den Anfängen der Gartenschauen. Zunächst war der Motor für die Durchführung einer Weltausstellung nationaler oder auch städtischer Prestigegewinn. Unter diesen Vorzeichen konzentrierten sich die Organisatoren ausschließlich auf die Inszenierung des Festes und den reibungslosen Ablauf. Doch unter politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen und Zwängen wurde der Rechtfertigungsdruck für die Veranstalter größer. Der Gedanke an eine rentable langfristige Nutzung der Einrichtungen rückte immer mehr in den Vordergrund. Heute versuchen die Veranstaltungsorte, mit dem Schub des Großereignisses ihre städtische Entwicklung anzukurbeln.[7]
Land
Um die Ziele des jeweiligen Bundeslandes darzustellen, sind die Ziele des Landes Baden-Württemberg exemplarisch ausgewählt worden.
In den Grundsätzen zur Durchführung von Landesgartenschauen sind die Ziele wie folgt formuliert:
Das vorrangige Ziel des Landesprogrammes ist die Planung und Gestaltung von
Freiräumen und die Schaffung von dauerhaften Grünzonen im Siedlungsbereich zur Verbesserung
- der Lebensqualität und des sozialen Umfeldes für die Bürger,
- der Möglichkeiten der Freizeitgestaltung,
- der Naherholungsmöglichkeiten,
- der ökologischen Qualität der Flächen, einschließlich des Wasserschutzes sowie
- des Stadtklimas.
Zudem sollen innerörtliche Strukturen verbessert werden, weil auch städtebauliche
Konzeptionen mit der Schaffung von modernen Verkehrsanlagen, Hoch- und Tiefbauten und etwaigen Maßnahmen des Denkmalschutzes bei der Neugestaltung von Grünzonen in die Gesamtplanung einbezogen werden sollen. Die Bevölkerung soll durch beispielhafte Landschaftsgestaltung, Ausstellungen und Lehrschauen sensibilisiert und aktiviert werden.
Städte
Gartenschauen sollen individuelle Konzepte für stadtplanerische Aufgabenstellungen liefern. Oft sind sie auch Impulsgeber für städtebauliche und grünpolitische Entscheidungen, die weitere Investitionen (Ausbau ÖPNV, Umgestaltungsmaßnahmen, Bau einer benötigten Einrichtung) auslösen, die sonst aufgrund Finanzmangels zurückgestellt sind.
Es gibt weitere Gründe, die in ihrer Zeit, d.h. zu dem Zeitpunkt der Gartenschau aktuell waren, umgangssprachlich auch als Zeitgeist bekannt. Nach dem Krieg war es der Wiederaufbau bzw. die Wiederherstellung von Grünflächen. In den 60iger und 70iger Jahren war es die Lösung verkehrstechnischer Probleme. In den 80´ern verlangten die Bürger eine stärkere Einbeziehung von Umweltbelangen. Eine ausführliche Behandlung dieser Faktoren findet im Vorfeld der Untersuchung der jeweiligen Schau statt.
Folgende Punkte finden sich noch in der Literatur, wobei der Verfasser die jeweiligen Auswirkungen eher gering einschätzt:
- Steigerung der Lebensqualität bzw. des Freizeitwertes im unmittelbaren bis mittelbaren Umfeld, dadurch positive Auswirkungen auf Gewerbeansiedlungen und Einwohnerzahl
- Schaffung innerstädtischer und stadtnaher intensiv nutzbarer Grünräume
- Verbesserung des Stadtklimas (Tallage Stuttgarts)
- Kurze Wege zur Naherholung, dadurch Verminderung des Individualverkehrs im Umland der Städte
- Erhöhung der Einwohnerzahl -> Kaufkrafterhöhung, Schaffung von Arbeitsplätzen -> Vermehrte Steuereinnahmen
- strukturschwache Gegenden -> Strukturwandel
- Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wirtschaft (Mittelstandsförderung) und auf der Buga selber (70-95% des Investitionsvolumens verbleiben in der Region)[8]
Gartenbau
Eine Motivation für den Gartenbau stellt die immer wiederkehrende Herausforderung für Ideenreichtum und Schaffenskraft da. Verbunden mit viel Idealismus, denn die Kosten werden kaum gedeckt, auch nicht durch den Gewinn einer Medaille. Der Gartenbauverband verspricht sich eine Leistungssteigerung in den Betrieben und den dort arbeitenden Angestellten.
Andere Wirtschaftzweige versuchen ebenfalls von einer Gartenschau zu profitieren, indem sie vorinformieren und dadurch auf Ihre Produkte Aufmerksamkeit lenken, direkt z.B. durch den Verkauf von Pflanzen, Gartenzubehör und Büchern. Oder indirekt durch das Sponsern der Schau, z.B. Banken, örtliche Versorger, große Firmen usw.
Die Planer und die ausführenden Firmen versprechen sich Folgeaufträge und einen Weg, auf sich und Ihre Ideen aufmerksam zu machen.
3.2 Aufgaben und Ziele einer Buga oder IGA
Mit dem Beschluss, eine Gartenschau durchzuführen, ergeben sich umfangreiche Verpflichtungen. So stehen an erster Stelle, je nach Veranstaltung, nicht unerhebliche Verpflichtungen finanzieller Art. Diese Maßnahmen belasten vor, während und nach der Durchführung die meist ohnehin stark strapazierten Stadtfinanzen. Die Übernahme einer Großveranstaltung bringt für die Ausrichter eine umfangreiche organisatorische Belastung mit sich. Konzepte müssen entworfen, Gesellschaften gegründet, Mitarbeiter eingestellt, Aufträge an Baufirmen oder Werbeagenturen vergeben werden, um nur einige der Belastungen zu nennen. Die Stadt muss die Öffentlichkeit frühzeitig informieren, sich gegebenenfalls mit Widerstand auseinandersetzen und diesen überwinden. Dazu müssen Konzepte, Argumentationen und Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet werden, die viele Arbeitsstunden erforderlich machen. Aufgrund des gestiegenen Umweltbewusstseins müssen die Aspekte einer Großveranstaltung auch aus diesem Blickwinkel betrachtet und geprüft werden (Anreise, innerstädtischer Transfer, Versorgung, Besucherspitzen an Feiertagen etc.). Die Verantwortlichen in den Städten müssen Vorstellungen darüber haben, was mit der Übernahme dieser Verpflichtungen für die eigene Gemeinde erreicht werden kann. Dies eröffnet die Möglichkeit, den bestehenden Flächennutzungsplan und gegebenenfalls den Bebauungsplan der Gemeinde für das die Großveranstaltung betreffende Gebiet neu zu überdenken und, falls nötig, nach neuesten Gesichtspunkten und Erkenntnissen anzupassen. Zum anderen bietet eine derartige Großveranstaltung der Stadt die Möglichkeit, regional oder auch überregional ein positives Image von sich zu erzeugen.
Ziele
Die Organisatoren der Schau (ZVG und die Stadt mit ihren Gesellschaften) sind an einem reibungslosen, positiv erscheinenden Ablauf der Veranstaltung interessiert.
Die einzelnen Fachleute wie Planer, Architekten, Aussteller usw. haben vor allem folgende Ziele:
- Werbung
- Repräsentation
- Verbesserung des Freizeit- und Erholungsangebotes
- Die Interessen der Besucher lassen sich auf zwei Schwerpunkte reduzieren.
- Fachliche Information
- Erholung und Vergnügen
- Sie schaffen soziales Grün und tragen somit wesentlich zu zeitgerechter
ökologischer Stadtentwicklung bei. Das bedeutet Harmonisierung von
Ansprüchen aus Industrie, Gewerbe, Wohnen und Freizeit sowie die:
- Entwicklung und Aufwertung der Grünsituation
- Rückgewinnung, Überarbeitung und Entwicklung neuer Grünräume und
Grünverbindungen
- Sicherung ökologisch bedeutender Freiflächen
- Verbesserung der Wohnsituation und der Verkehrssituation
Gartenschauen als Großveranstaltungen leisten:
- Darstellung eines positiven Bildes der Stadt - Image Aufbesserung
- Modellprojektion für weitere städtebauliche Entwicklungen
- Kommunikationsmedium für Fachkreise und Bürger
- Impulse zur regionalen Wirtschaftsentwicklung[9]
Selbstverständlich kann eine Bundesgartenschau nicht alle Wünsche gleichermaßen erfüllen. Aufgrund bisher gemachter Erfahrung kann aber behauptet werden, dass bei Intensivierung des Kontaktes zwischen Organisation, Fachleuten und Besuchern Probleme leichter zu lösen sind.[10]
3.3 Anforderungen an die veranstaltende Stadt
Die Stadt bekundet offiziell ihr Interesse an der Durchführung einer Buga beim ZVG (Zentralverband Gartenbau, Vorstellung in Kapitel 4, Seite 24). Es werden Sondierungsgespräche geführt. Der Stadtrat muss den Plänen zuzustimmen, hat er dies getan wird ein Grundsatzbeschluss gefasst für die Bewerbung beim ZVG. Mit dessen Unterstützung wird eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das ermöglicht die offizielle Bewerbung der Stadt. Nach der Untersuchung der Pläne hinsichtlich der Bewerbungskriterien des DBG (Deutsche Bundesgartenschau GmbH, Vorstellung in Kapitel 4, Seite 25) wird dem Verwaltungsrat, der die Entscheidung für oder gegen die Stadt spricht, das Projekt präsentiert.
Bewerbungskriterien sind:
- der Buga-Standort soll unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und
Landesplanung ausgesucht werden
- Der Standort muss planungsrechtlich gesichert bzw. kurzfristig zu sichern
sein, d.h. die Eigentumsverhältnisse müssen (schnell) geklärt sein
- Das Motto der Schau muss mit Kennzeichen einer ökologischer
Stadtentwicklung zeigen
- Es müssen neue Grünflächen entstehen, wahlweise auch
Grünzugverbindungen und Überarbeitung von Grünflächen
- Eine dauerhafte, bestandsfähige Nachnutzung muss gewährleistet sein
- Das Gesamte Areal soll 50-70 ha nicht unterschreiten
- Das Kerngebiet muss mindestens 35 ha groß sein
- Das Gelände muss die Integration gärtnerischer Ausstellungen
gewährleisten, eine ausreichende innerstädtische/außenräumliche
Verkehrsanbindung haben oder bekommen
- Die Finanzierung muss gesichert sein
- Die Durchführung mit dem ZVG im Rahmen einer Durchführungsgesell-
schaft wird vereinbart[11]
3.4 Anforderungen an Gartenschauen
Welche Anforderungen werden an Städte und ihre Planung für eine Gartenschau gestellt? In Ihrem Buch „Die Bundesgartenschauen, Eine blühende Bilanz seit 1951“ hat Helga Panten aus den Erfahrungen der Vergangenheit folgende Anforderungen ermittelt:
- Beachtung der zukünftigen Entwicklungen
Bei der Um- oder Neugestaltung von Stadtteilen oder Grünbereichen sollte die Entwicklung der Bevölkerung beachtet werden: ist mit einem Zuzug und einem Bevölkerungswachstum oder eher mit Abwanderung aus dieser Stadt / diesem Stadtteil zu rechnen?
- Ausreichende Zeitplanung
Über die genaue Planungs- und Vorbereitungszeit für eine Landesgartenschau gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Rheinland-Pfalz hat für die Landesgartenschau 2008 die Bewerbungsfrist der Städte auf den April 2004 festgelegt, für die weiteren Planungen stehen also knapp 4 Jahre zur Verfügung (Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, 2003, 3). Die Vorgabe von Baden-Württemberg sieht die endgültige Willensbekundung der Stadt zur Durchführung einer Landesgartenschau spätestens 5 Jahre vorher vor. (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum, Baden-Württemberg, 2002). In Hessen ist der Beginn der städtischen Planungen mindestens 8 Jahre vor der Landesgartenschau vorgesehen, über den Zuschlag wird ca. 6-7 Jahre vor der Landesgartenschau entschieden Auswahl der tatsächlich förderungswürdigen Stadtgebiete
Mit der Durchführung einer Gartenschau werden große finanzielle Mittel in einem begrenzten Teil der Stadt konzentriert. Die Folgen sind häufig, dass weitere Investitionen in den Folgejahren und in anderen Stadtteilen nicht möglich sind. Diese Konzentration der finanziellen Mittel sollte wohlüberlegt in tatsächlich förderungswürdigen Stadtteilen erfolgen.
Für die fachgerechte Planung der Stadtentwicklung durch eine Gartenschau ist somit die Zusammenarbeit aller betroffenen Ressorts notwendig, die Fachkenntnisse von Grünplanung, Stadtplanung, Verkehrsplanung, Architektur, Landwirtschaft, Forst und Umweltschutz müssen hier zusammen finden. Die so entwickelten, durch die Landesgartenschau zu erreichenden Ziele sind detailliert darzustellen.
- Schaffung eines Grünflächensystems
Die Maßnahmen der Gartenschau sollten sich nicht nur auf eine oder wenige zentrale Flächen beschränken, sondern es sollte ein stadtweites System an vernetzten Grünflächen entwickelt werden, das auch Grünverbindungen in die Landschaft mit einschließt. Sollte dies mit der Gartenschau allein nicht realisiert werden können, sollte dieses Entwicklungskonzept jedoch in den folgenden Jahren endgültig realisiert werden. Bereits vorhandene Planungen sind dabei zu berücksichtigen.
- Sicherung der Flächen durch Bauleitplanung
Die Flächen müssen durch die Aufstellung entsprechender Bauleitpläne gesichert werden, um somit die investierten finanziellen Mittel für die Naherholung langfristig zu sichern.
- Lösung von Verkehrsproblemen
Die Anlage einer Gartenschau soll zum Anlass genommen werden, das örtliche und regionale Rad- und Wegenetz zu verbessern, ebenso die Anbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Beide Maßnahmen sollten das Ziel haben, die Innenstadt und die Wohnbereiche von Verkehr zu befreien. Eine Maßnahme kann dabei auch die Verlegung größerer Durchgangsstraßen sein, was jedoch im Widerspruch zur Vorgabe des nachhaltigen Wirtschaftens mit der Ressource Fläche und der optimalen Bodennutzung stehen kann. Eine Abwägung der verschiedenen Interessen wird durch das Baugesetzbuch § l (6) ermöglicht.
- Umweltschutz
Unter dem Begriff "Umweltschutz" werden in diesem Zusammenhang Maßnahmen der Renaturierungen von Gewässern, Wiederherstellung von Landschaften und kulturhistorischen Landnutzungen und die Wiedergewinnung von versiegelten Flächen für Flora und Fauna zusammengefasst. Maßnahmen zur Entwicklung von Flora und Fauna stehen jedoch häufig im Widerspruch zum „Ereignischarakter" einer Gartenschau. Sinnvoll sind hier natürlich die Unterrichtung und Weiterbildung der Bevölkerung durch Anschauung in den neu entwickelten Biotopen, jedoch hindern hohe Besucherzahlen und weit verzweigte Spazierwege eine ungestörte Entwicklung der Natur. Bei der Gestaltung dieser Bereiche ist deshalb auf eine für Besucher entsprechend reduzierte Zugänglichkeit zu achten, gegebenenfalls ist zu überlegen, ob dieser Bereich aus dem eigentlichen "Schaubereich" herausgenommen werden.
- Nachnutzung
Die auf die Landesgartenschau folgenden Nutzungen der Flächen und der Gebäude sollen in einem Nachnutzungskonzept dargestellt werden. Dieses muss finanziell kalkuliert und abgesichert sein. Zum Beispiel ist die Pflege der Freiflächen in den Haushalten der Städte und Gemeinden für die folgenden Jahre einzuplanen, Firmen oder Investoren für die Nachnutzung von Gebäuden sollten an feste Zusagen gebunden werden.
- Partizipation
Um die Akzeptanz der Gartenschau in der Bevölkerung zu sichern, sind verschiedene Ansätze der Beteiligung möglich:
- frühzeitiges Anschreiben von Vereinen, Verbänden und Schulen mit Vorschlägen und Anfragen zur Gestaltung des Geländes und des begleitenden Programms
- Einrichtung eines Bürgerbeirates, der für Anregungen und Bedenken auch einzelner Bürger zur Verfügung steht
- Information der Bürger
Mit einer Gartenschau sollten die Möglichkeiten, die Besucher über Themen des Umweltschutzes im weitesten Sinne zu unterrichten, genutzt werden, dazu können beispielsweise neueste Entwicklungen der Umwelttechnik (beispielsweise über energiesparendes Bauen, Regenwassernutzung, umweltgerechte Automobilentwicklungen) oder Erkenntnisse über Zusammenhänge von Flora und Fauna und die Einflüsse der Klima- und Wetterentwicklungen gehören.
- Stärkung des regionalen und städtischen Selbstverständnisses
Die Herausbildung des individuellen Stadtbildes und der Eigenschaften der Region sollte anlässlich einer Gartenschau entwickelt bzw. ergänzt werden. Dazu können die Entwicklung eines Stadtmarketing- und Tourismuskonzeptes beitragen, welches für die Stadt mit der Gartenschau überregional wirbt und die Stadt und Region auch nach der Gartenschau bekannt macht. Bestandteil dieses Aspektes ist jedoch auch die Vermarktung aller regionalen Erzeugnisse auf der Gartenschau. Dazu zählen einerseits die klassischen landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber auch Erzeugnisse der Industrie, die für diese Region typisch sind.
Erweitert werden kann dieses Angebot durch Ausstellungen, die die regionalen Spezialitäten und Besonderheiten darstellen.
- Nutzung der Initialwirkung
Der mit der Durchführung einer Gartenschau eintretende Entwicklungsschub für eine Stadt oder Gemeinde sollte so weit wie möglich von allen Bereichen der Stadtentwicklung genutzt werden. Die schon beschriebene frühzeitige Zusammenarbeit mit allen betroffenen Ressorts in der Verwaltung ist die Grundlage für ein weitgreifendes Entwicklungskonzept, das weit über die Gartenschau hinausgehen kann.
- Reduzierung der Rückbaukosten durch Vermeidung des Eventcharakters
Um den Durchführungshaushalt zu sichern, ist den Ausrichtern der Gartenschauen eine möglichst hohe Besucherzahl wichtig. Da die Besucherzahlen zudem häufig als (einzige) Grundlage für die Bewertung des Erfolges der Gartenschau herangezogen werden, bieten sich spektakuläre Attraktionen als Besuchermagnet an, deren meist unverhältnismäßig teure Finanzierung jedoch zu Lasten der Dauerinvestitionen gehen.
Grundsätzliches Ziel ist deshalb, die so genannten "Rückbauten" so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig ein attraktives Angebot für die Besucher zu schaffen. Als Richtwert für den Aufwand, der für den Eventcharakter der Landesgartenschau betrieben wurde, können die Kosten des Rückbaus angenommen werden.
Es besteht ein grundsätzliches Interesse der Bevölkerung an Pflanzen und Blumen. Der Informationsstand der Bevölkerung hat sich durch die Flut von Gartenbüchern, Fernsehsendungen und die Spezialisierung vieler Garten- und Baumärkte verbessert. Dadurch haben sich Interessen der Verbraucher stark weiterentwickelt.
Dies bedeutet für die Gartenschauen, dass tatsächlich neue Ideen entwickelt werden müssen, d.h. der Vorplanung muss ausreichend Zeit gegeben werden. Gleichzeitig sollte man nicht beim Garten stehen bleiben, sondern den energie- und ressourcensparenden Hausbau mit einbeziehen.
- Detaillierte Kostenschätzung und nachfolgend Einhaltung der Kosten
Nach den Erfahrungen von einem halben Jahrhundert Gartenschaupraxis sollte eine Kostenschätzung und deren Einhaltung bei der Planung und Durchführung einer Gartenschau möglich sein. Sie sollte aufgeteilt sein in den Durchführung- und Investitionshaushalt. Eine Offenlegung der Finanzierung sowohl in der Planungs- und Ausführungsphase als auch eine detaillierte Kostenaufstellung nach Abschluss der Gartenschau sollte der Bevölkerung und nachfolgenden Gartenschauinitiatoren (und Diplomanten, Anm. des Verfassers) zur Verfügung stehen.
Folgende Anforderungen wurden von einem Gartenschaukolloquium vereinbart, das sich aus 31.01.1983 in der Bildungsstätte des Deutschen Gartenbaues traf. Es bestand aus Experten verschiedener Fachrichtungen. Auslöser war die damalige heftige Kritik an den Gartenschauen im Zuge der Ökobewegung.
"- Größere Flexibilität und Bereitschaft zu Innovationen bei allen an der Durchführung von Bundesgartenschauen Beteiligten. Der Gartenbau muss hier stärker zur Antriebskraft werden.
- Entwicklung der Bundesgartenschau aus der jeweiligen, konkreten Stadtsituation heraus. Keine Aneinanderreihung erfolgreicher Versatzstücke früherer Bundesgartenschauen.
- Erarbeitung einer Leitidee auf der Grundlage der örtlichen Situation, die die Inhalte der Bundesgartenschau bestimmt.
- Stärkere Berücksichtigung dezentraler Themen.
- Zuordnung der dezentralen Themen zu einem intensiven, zentralen Ausstellungsbereich, der den Wünschen der Besucher nach Ausstellung und Fest gerecht wird.
- Größere Vorsicht bei Strukturveränderungen; Substanzerhaltung aus ökologischer, sozialer und städtebaulicher Sicht in den Vordergrund rücken.
- Offenere Entscheidungsfindung für die Bundesgartenschau; damit größere Unabhängigkeit von Veränderungen durch Wechsel in der politischen Landschaft.
- Intensivere Bürgerbeteiligung, um die Identifikation der Bürger mit der Bundesgartenschau zu gewährleisten.
- Bewusstseinsbildung für Fragen des Öffentlichen Grüns und Information über das private Grün in den Mittelpunkt der Bundesgartenschau-Themen stellen.
- Bessere Information über Zusammenhänge, Hintergründe, Zwänge und Konflikte bei der Entstehung der Bundesgartenschau.
- Keine generelle Bevorzugung von "Blumenschau" oder "Ökoschau". Je nach Ausgangssituation und Leitidee Betonung des einen oder anderen Aspektes in fachgerechter Darstellung."[12]
3.5 Fazit der Erfahrungen
Mit den Erfahrungen aus über 50 Jahren Bundesgartenschau konnte beobachtet werden, dass Gartenschauen stadtstrukturelle Veränderungen bewirken können.
Die wichtigsten Erkenntnisse des Abschnitts lauten: Eine Gartenschau muss richtig organisiert werden, damit sie ihre Sinn und ihre Ziele erfüllen kann. Die Vorkommnisse in der näheren Vergangenheit haben gezeigt, dass eine gute Organisation, viel Unannehmlichkeiten und Geld sparen können. Negativbeispiel: das Nichtvorhandensein eines Nachnutzungskonzeptes zum Ende der Schau in Rostock. Dadurch gab es einen großen Zeitdruck zum Erstellen dieses Konzeptes. Der Faktor Geld gewinnt bei knappen öffentlichen Kassen immer mehr an Bedeutung. Im Widerspruch dazu steht der Eventcharakter der Gartenschauen, der durch viele fachfremde Veranstaltungen
höhere Kosten verursacht.
Wichtig ist die frühe Einbeziehung der Bürger in die Planungen und die Verminderung von Kritik, indem eine Transparenz im Planungsprozess gewährleiste und die Öffentlichkeit über die wesentlichen Schritte regelmäßig informiert wird.
4.0 Organisatorisches zu Gartenschauen
4.1 Interessengruppen
„Bundesgartenschauen sind sehr komplexe Gebilde aus Ideen, Vorstellungen und Erwartungen verschiedenster Interessengruppen. Dass die Ziele und Vorstellungen nicht miteinander vereinbar sind oder teilweise sogar gegensätzlich, verkompliziert die Planungen erheblich und kostet viel Zeit.“[13]
Wenn der Entschluss einer Stadt zur Ausrichtung der Gartenschau gefasst ist, treten die Interessenvertreter an die Stadt und die Planer heran. Welche Interessengruppen dabei eine Rolle spielen, zeigt folgende Grafik anschaulich.[14]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zwei wichtige Interessenvertreter werden im Folgenden vorgestellt. Der Zentralverband Gartenbau und die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft. Die beiden Organisationen bringen ihr know-how bei der Vorbereitung der Schau mit ein und werden Vertragspartner der Städte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.2 Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG)
„Der ZVG ist ein Dachverband von Berufs- und Wirtschaftsverbänden. In 17 Landesverbänden sind deutsche Gartenbaubetriebe zusammengeschlossen. Diese Landesverbände sind Mitglied im Zentralverband.
Die Aufgaben des ZVG umfassen die Beratung seiner Mitglieder. Ferner wird eine Koordination der Interessen mit anderen internationalen Verbänden im internationalen Verband des Erwerbsgartenbaues (AIPH) angestrebt.
Wichtig für die Bundesgartenschauen ist die Partnerschaft zwischen den Städten und dem ZVG. Er präsentiert den Bürgern die Leistungen der Gärtner, zeigt neue Züchtungen, gibt Informationen zu Gartenfragen und stellt Beispielgärten und Grabgestaltungen her.
Ein Verbandsrat bestimmt die zentrale Berufspolitik im ZVG“.[15]
4.3 Die Deutsche Bundesgartenschau GmbH (DBG)
Deutsche Bundesgartenschau
GmbH – DBG
„Die Spitzenverbände des Berufsstandes, der Zentralverband Gartenbau e.V. (ZVG), Bonn, der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL), Bad Honnef und der Bund deutscher Baumschulen (BdB), Pinneberg, gründeten 1993 die Deutsche Bundesgartenschau GmbH (DBG), die das fach-liche und personelle Know-how aus 50 Jahren Gartenschauen bündelt.“[16]
Der ZVG vertritt bei den Gartenschaustädten die Interessen der Berufssparte Gärtner und ist ideeller Träger der Veranstaltung. Die DBG übernimmt sämtliche Verantwortung vom ZVG und ist somit an der Vorbereitung, Programmzusammenstellung und Durchführung aller Bugas und IGAs zuständig.
Kontaktpflege zu den internationalen Verbänden des Erwerbsgartenbaues (AIPH) und Kontaktherstellung sind weitere Aufgaben.[17]
Anmeldung einer Buga, IGA
Nachdem die Entscheidung für die Durchführung einer Buga oder IGA durch den ZVG getroffen worden ist, werden sie vom ZVG bei der Association Internationale des Producteurs de l`Horticulture (AIPH) angemeldet. Der AIPH ist die Vereinigung der internationale Gärtnereiverband. Die Buga wird von der AIPH mit dem Status B1-Ausstellung als nationale Ausstellung mit internationaler Beteiligung genehmigt.
Internationale Gartenbauausstellungen müssen ebenfalls von der AIPH genehmigt werden. Sie erhalten den Status A1-Ausstellung als internationale Weltfachausstellung. Zusätzlich müssen IGAs von der Bundesrepublik Deutschland beim Bureau International des Expositions (BIE) beantragt werden. Die endgültige Entscheidung zur Durchführung trifft das BIE.
Ist diese Entscheidung positiv für die Stadt ausgefallen, wird mit der Gründung der GmbH begonnen und die weiteren Gremien entstehen. Ein kurzer Blick auf die folgenden Grafiken verdeutlicht die Zuständigkeiten und Abhängigkeiten.
Die folgenden Grafiken und Texte sind aus der Dokumentation der Bundesgartenschau 1997 in Gelsenkirchen entnommen. Sie sind, bis auf kleine Unterschiede aber mit der Organisation anderer Gartenschaustädte vergleichbar.
4.4 Gremien einer Gartenschau
Am Beispiel der Buga Gelsenkirchen 1997 GmbH soll exemplarisch die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen beteiligten Organen dargestellt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Um die Buga zu realisieren wurde 1991 die Bundesgartenschau Gelsenkirchen GmbH gegründet. Sie war für die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung des gesamten Projektes zuständig. Die Buga GmbHs sind selbstlos, d.h. sie sollen keinen Gewinn und möglichst wenig Verlust aufweisen.[18]
4.5 Vertragsverhältnisse
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Grafik zeigt, wie das Treuhändersystem, das erstmals bei einer Buga zum Einsatz kam, funktioniert. Um die Beratungsverfahren so effizient wie möglich zu gestalten, beschloss die Stadt Gelsenkirchen, einen Buga-Beirat als beratendes Fachgremium des Rates zur Seite zu stellen. Gab es Beratungsbedarf seitens des Rates der Stadt zu dem Vorhaben, musste nur in einem Gremium beraten werden, bevor sie dem Haupt-, Wirtschafts- und Finanzausschuss bzw. dem Rat der Stadt vorgelegt wurden. Die Stadt war so sehr eng eingebunden und kurze Informations- und Abstimmungswege setzten die Gelsenkirchener Verwaltung in die Lage, den Bebauungsplan für den Landschaftspark in elf Monaten aufzustellen! Auch bei der Ausführung und Koordination der Bauarbeiten wurden neue, richtungweisende Wege beschritten. Die Probleme waren: Kosten- und Terminzwänge, Qualitäts- und Quantitätsanforderungen. All dies unter dem Aspekt, nach öffentlichen Vergabevorschriften die Aufträge vergeben zu müssen.[19]
Die Herausforderungen wurden durch ein neues Konzept angegangen, eines, dass das eigene Personal auf ca. 1/3 der Mitarbeiter vorangegangener Schauen reduzierte.
Ein neues Konzept wurde entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Das beauftragte Unternehmen steuert und koordiniert treuhänderisch die Maßnahmen, handelt aber im Interesse der Buga GmbH. Die termingerechte Fertigstellung wird vorher mit einem festen Kostenrahmen vereinbart. Anders als bei einem Generalunternehmer muss der Treuhänder sich ergebende Einsparungen für andere Projekte verwenden und steigert dadurch nicht seinen persönlichen Gewinn. Dadurch konnten in Gelsenkirchen Maßnahmen durchgeführt werden, die aus finanziellen Engpässen später vorgesehen waren. Durch die Verpflichtung von erfahrenen Bauunternehmen erschließt man sich deren Fachwissen. Das in Gelsenkirchen verpflichtete Hochbauunternehmen STRABAG Hoch- und Ingenieurbau AG wurde nicht als Bauunternehmen tätig, sondern bereitete Ausschreibung und Vergabe vor, überwachte die Bauausführung und stellte die Abschlussrechnung, Auftraggeber blieb die Buga Gelsenkirchen 1997 GmbH.
Dieses in Gelsenkirchen erstmals praktizierte Verfahren hat sich dort bewährt. Die DBG stellte den nachfolgenden Städten dieses Konzept im Rahmen ihrer Dienstleistungen zur Verfügung.
Das Treuhandprinzip sollte für die nächsten Gartenschauen angewandt werden. Nicht nur wegen des reduzierten Personalbedarfs, sondern weil sich die jeweilige Buga GmbH auf ihre inhaltliche Aufgabe und die Überwachung von Qualitäten konzentrieren kann. Einzig Rostock mit seiner IGA 2003 nahm das Angebot an.
4.6 Beteiligungsverhältnisse
Um die Beteiligungsverhältnisse aufzuzeigen, hier ein Beispiel für die Beteiligungsverhältnisse der einzelnen Organe. Die Grafik zeigt die Verknüpfung der Buga Gelsenkirchen 1997 GmbH. Deutlich wird, dass die Stadt fast sämtliches finanzielles Risiko trägt, falls die Buga Gelsenkirchen GmbH finanziellen Nachschub benötigt hätte. Außerdem trägt sie die Risiken und Kosten, die durch die Grunderwerbe entstehen.[20]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
4.7 Finanzierung einer Gartenschau
Die Finanzierung einer Bundesgartenschau oder IGA kann keine Stadt allein bewerkstelligen. Es müssen andere Wege über Bundesmittel, EU-Mittel, Sponsoring und Werbeeinnahmen eingeschlagen werden, um die Schauen zu finanzieren. Die neuen Bundesländer kamen bisher in den Genuss so genannter GA-Mittel der EU zur Förderung von Tourismus und Gewerbeansiedlungen. Zwei Vorraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: 1. der andere Teil des Geldes muss im Haushalt der Stadt zur Verfügung stehen. 2. zehn Jahre lang müssen die geförderten Maßnahmen dem Verwendungszweck entsprechend nachgenutzt werden.[21]
Bund und Länder fördern unter bestimmten Bedingungen kulturelle und städtebauliche Maßnahmen, Bodensanierungen und Radwegeprogramme, Sportstätten und Spielplätze.
Ministerien können durch Ausstellungsbeiträge in Form von Infoständen zusätzliches Geld für Pavillons einbringen. Für die Förderung gilt allerdings eine zehnjährige Nutzungsbindung des Geländes. In dieser Zeit sind die Betreiber dieser Anlage nicht in der Lage, das grundlegende Konzept des Parks zu ändern. Das gleiche gilt für die gemeinnützige Ausrichtung der Buga GmbH. Diese kann Steuervorteile für sich geltend machen, unterliegt aber der Nutzungsbindung.
Als Beispiel für eine Finanzplanung ist im Anhang die Etatplanung für die Bundesgartenschau 2015 in Osnabrück eingefügt.
4.8 Blick in benachbarte Staaten
Der Vollständigkeit halber zum Thema Gartenschauen möchte diese Arbeit auch das Gartenschaugeschehen in Deutschlands Nachbarländern kurz vorstellen.
Deutschland ist das einzige der untersuchten Länder, das eine derartige Ausstellungskultur vorweisen kann. In keinem anderen Land gibt es Schauen von derartiger Größe und Dauer wie die Bugas und IGA´s. Es folgenden die jeweiligen Länder mit Ihren Schauen:
Dänemark: Kleinere Herstellermessen/-ausstellungen an verschiedenen Standorten[22]
Niederlande: Alle 10 Jahre findet eine „Floriade“ statt, die nächste wird 2012 in Venlo präsentiert. Dies ist die größte Gartenbauausstellung in den Niederlanden, daneben gibt es kleinere Herstellermessen.[23]
Belgien: Alle fünf Jahre gibt es in der Stadt Gent große Hallenschauen, die „Genter Floraliën“. Diese haben eine lange Tradition. 1809 fand dort die erste „Hallenschau“ der Gärtner statt.
Im Jahr 2003 verbanden sich einmalig die “Floriade“ und die Internationale Messe in Lüttich zur “Floraliës internationales de Liège 2003“.[24]
Luxemburg: In Luxemburg gibt es bis heute keine Gartenschauen, „(…) wir beschäftigen uns aber jetzt seit einem Jahr, als Gartenbauverband, intensivst mit dem Thema Gartenschau und versuchen die politischen Entscheidungsträger für ein solches Projekt hier in Luxemburg zu gewinnen. Zwar eher in kleiner Ausführung, max. 20 ha, von April bis Oktober. Wir sehen in hochwertigen Grünanlagen den gesellschaftlichen Mehrwert und betrachten solche Schauen als Impuls für Wirtschaft und Landschaft sowie eine solche Schau eine Präsentationsplattform für eine ganze Region darstellt.
Momentan gibt es hier in Luxemburg nur kleinere Events ohne kohärente Planung wie die Messe Gartenträume oder diverse Gartenfestivals oder eine Aktion die sich jardins à suivre nennt (…).“ [25]
[...]
[1] Prof. Dipl.-Ing. Schmid, Arno Sighart, Vortrag Bundeskongress „Wohn- und Lebensraum Stadt. Grün als Motor der Stadtentwicklung am 15. Mai 2003 in Rostock, Quelle: www.bdla.de/download/Vortrag%20Schmid%20Langfassung.pdf, am: 31.05.2005
[2] www.bundesgartenschau.de, o.J. und www.Buga2005.de, beide am 21.06.2005
[3] www.bundesgartenschau.de, o.J., am 21.06.2005
[4] Meiberth, Friedrich, Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft, Bonn in „Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft“, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, 2002, Seite 9
[5] Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft, S. 13
[6] Preisler-Holl, Luise, Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, 2002, S.23
[7] www.tu-cottbus.de/BTU/Fak2, am: 06.04.2005
[8] Preisler-Holl, Luise, Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, 2002, S. 15
[9] www.g-net.de/zvg/dbg.htm#2., am: 06.04.2005
[10] Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Gartenbaues der Technischen Universität München- Weihenstephan, Die Bundesgartenschau Stuttgart 1977, Umfrage bei Besuchern und Fachleuten; im Auftrag des Zentralverbandes Gartenbau, Bonn-Bad Godesberg, Freising 1978
[11] Meiberth, in Preisler-Holl, Luise, Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, Seite 12
[12] Helga Panten, Die Bundesgartenschauen, Eine blühende Bilanz seit 1951, Hrsg. Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn, Ulmer Verlag Stuttgart, April 1987, S.154-155
[13] Panten, Helga, Die Bundesgartenschauen, Eine blühende Bilanz seit 1951, Hrsg. Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn, Ulmer Verlag Stuttgart, April 1987, S. unbekannt
[14] Lindemann, K.E.R., S.18
[15] Homepage des ZVG, www.g-net.de/zvg/aufgaben.htm, am: 23.07.2005
[16] www.bundesgartenschau.de, am: 27.10.2004
[17] Homepage der DBG, http://www.bundesgartenschau.de, 27.10.2004
[18] Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 –Dokumentation-, Hrsg. Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 GmbH, S. 9
[19] Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 –Dokumentation-, Hrsg. Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 GmbH, S. 10
[20] Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 –Dokumentation-, Hrsg. Bundesgartenschau Gelsenkirchen 1997 GmbH, S. 11
[21] Preisler-Holl, Luise, Gartenschauen – Motor für Landschaft, Städtebau und Wirtschaft, Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin, 2002, S.14
[22] Dansk Erhvervsgartnerforening (DEG), telef. 11.07.2005
[23] www.floriade.nl, am: 11.07.2005
[24] www.floralien.be/DE/history.aspx, am: 11.07.2005
[25] Walentiny, Josiane, Fédération Horticole Luxembourgeoise, Email 16.06.2005
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783836620086
- DOI
- 10.3239/9783836620086
- Dateigröße
- 3.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Weihenstephan; Abteilung Triesdorf – Landschaftsarchitektur
- Erscheinungsdatum
- 2008 (Oktober)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- bundesgartenschau internationale gartenschau erfolgskritierien untersuchung analyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de