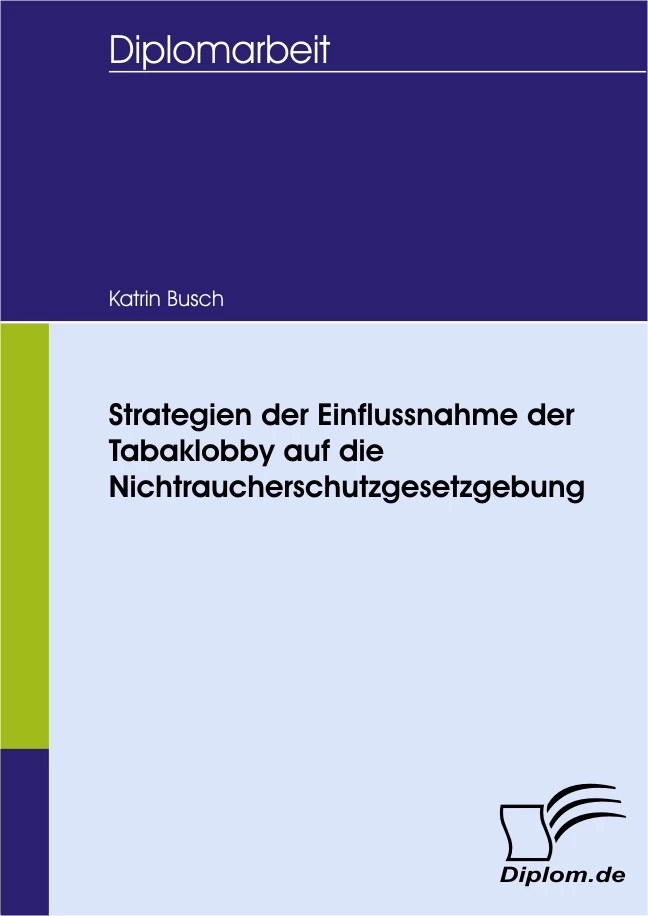Strategien der Einflussnahme der Tabaklobby auf die Nichtraucherschutzgesetzgebung
Zusammenfassung
Der Begriff Tabaklobby beinhaltet zwei Wortteile, die in der deutschen Bevölkerung negative Assoziationen auslösen. Tabak und das damit verbundene Rauchen sind für ihre gesundheitsgefährdende Wirkung bekannt und werden von einem Großteil der gut 60 Millionen Nichtraucher in Deutschland abgelehnt. Mit dem Wort Lobby wird die Einflussnahme von Interessengruppen auf politische Entscheidungen verknüpft, wobei die verwendeten Mittel und Methoden für die Öffentlichkeit zumeist nicht ersichtlich sind und daher nicht immer rechtmäßig erscheinen. Aufgrund dieser Tatsachen erfahren die Vertreter der Tabaklobby in der Gesellschaft eine geringe Wertschätzung.
Der Begriff Lobbyismus wurde erst in den letzten Jahren wieder entdeckt und ist seitdem eine Art Modewort geworden. Allerdings gibt es Lobbys und Lobbyisten seit Gesetze existieren, seit sich Individuen zusammenschließen, um ihre Interessen innerhalb höherer Machtstrukturen durchzusetzen. Dennoch wissen viele Menschen nicht, was sich hinter diesem Begriff wirklich verbirgt. Für einen Außenstehenden ist es fast unmöglich, die Arbeit von Interessenvertretern nachzuvollziehen. Die Interessenvertretung erscheint deswegen geheimnisvoll, geheimniskrämerisch und hintergründig.
In den Augen vieler Bürger hat Lobbyismus mehr mit unlauteren Methoden zu tun als mit legitimer Interessenvertretung. Dieser Eindruck wird insbesondere durch den informellen Charakter des Lobbyismus verstärkt. Keiner der beteiligten Akteure hat ein Interesse daran, seine Tätigkeit der Öffentlichkeit preiszugeben. Aber gerade dadurch wird der Anschein vermittelt, dass eine heimliche Macht starker ökonomischer Interessen erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. In der Realität hat Lobbying nichts mit zwielichtigen Aktivitäten zu tun, sondern vielmehr mit dem Einwirken auf Entscheidungsträger mittels präziser Information.
In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Methoden im Lobbyismus benutzt werden und inwiefern sie wirklich illegitim sind oder ob sie nicht doch zu den rechtmäßigen Mitteln der Interessenvertretung gehören. Anhand der Tabakindustrie werden diese lobbyistischen Strategien untersucht. Zunächst wird eine Einführung in die theoretischen Grundlagen des Lobbyismus gegeben. Dafür werden die theoretischen Konzepte des Pluralismus und Korporatismus näher betrachtet werden. In ihnen werden die Ursachen und Wirkungen von Interessenvertretung behandelt. Danach […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorie
2.1 Begriffe
2.2 Konzepte
2.2.1 Pluralismus
2.2.2 Korporatismus
2.2.3 Lobbyismus
3. Die verbandliche Organisation der Tabaklobby
3.1 Politikfeld
3.2 Der Verband der Cigarettenindustrie
3.3 Weitere Verbände
3.4 Die Gegner der Tabakindustrie
4. Methoden des Lobbyismus am Beispiel der Tabakbranche
4.1 Interessenvertretung gegenüber der Politik und der Verwaltung
4.1.1 Adressaten
4.1.2 Vermitteln von Informationen
4.1.3 Glaubwürdigkeit
4.1.4 Strategien
4.1.5 Kontaktaufnahme
4.1.6 Parlamentarische Abende
4.1.7 Spenden und Sponsoring
4.1.8 Individuelle Interessenvertretung und Allianzen
4.1.9 Ministerielle und parlamentarische Anhörungen
4.1.10 Weitere Möglichkeiten der Einflussnahme
4.1.11 Externe Beratungsfirmen
4.1.12 Zusammenfassung
4.2 Indirekte Einflussnahme über Dritte
4.2.1 Wissenschaft
4.2.2 Medien
4.3 Gesetzgebung
5. Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Internetverzeichnis
Ehrenwörtliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Tabelle 1: Verbrauchersteuereinnahmen ab 1999 (in Millionen Euro)
Abbildung 1: Marktanteile der Mitglieder des VdC
Abbildung 2: Strategische Schritte des Lobbyings
1. Einleitung
Der Begriff „Tabaklobby“ beinhaltet zwei Wortteile, die in der deutschen Bevölkerung negative Assoziationen auslösen. „Tabak“ und das damit verbundene Rauchen sind für ihre gesundheitsgefährdende Wirkung bekannt und werden von einem Großteil der gut 60 Millionen Nichtraucher in Deutschland abgelehnt. Mit dem Wort „Lobby“ wird die Einflussnahme von Interessengruppen auf politische Entscheidungen verknüpft, wobei die verwendeten Mittel und Methoden für die Öffentlichkeit zumeist nicht ersichtlich sind und daher nicht immer rechtmäßig erscheinen. Aufgrund dieser Tatsachen erfahren die Vertreter der Tabaklobby in der Gesellschaft eine geringe Wertschätzung.
Der Begriff Lobbyismus wurde erst in den letzten Jahren wieder entdeckt und ist seitdem eine Art Modewort geworden. Allerdings gibt es Lobbys und Lobbyisten „seit Gesetze existieren, seit sich Individuen zusammenschließen, um ihre Interessen innerhalb höherer Machtstrukturen durchzusetzen.“[1] Dennoch wissen viele Menschen nicht, was sich hinter diesem Begriff wirklich verbirgt. Für einen Außenstehenden ist es fast unmöglich, die Arbeit von Interessenvertretern nachzuvollziehen. Die Interessenvertretung erscheint deswegen geheimnisvoll, geheimniskrämerisch und hintergründig.[2]
In den Augen vieler Bürger hat Lobbyismus mehr mit unlauteren Methoden zu tun als mit legitimer Interessenvertretung. Dieser Eindruck wird insbesondere durch den informellen Charakter des Lobbyismus verstärkt. Keiner der beteiligten Akteure hat ein Interesse daran, seine Tätigkeit der Öffentlichkeit preiszugeben. Aber gerade dadurch wird der Anschein vermittelt, dass eine „heimliche Macht starker ökonomischer Interessen“[3] erheblichen Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. In der Realität hat Lobbying nichts mit zwielichtigen Aktivitäten zu tun, sondern vielmehr mit dem Einwirken auf Entscheidungsträger mittels präziser Information.[4]
In der vorliegenden Arbeit soll aufgezeigt werden, welche Methoden im Lobbyismus benutzt werden und inwiefern sie wirklich illegitim sind oder ob sie nicht doch zu den rechtmäßigen Mitteln der Interessenvertretung gehören. Anhand der Tabakindustrie werden diese lobbyistischen Strategien untersucht. Zunächst wird eine Einführung in die theoretischen Grundlagen des Lobbyismus gegeben. Dafür werden die theoretischen Konzepte des Pluralismus und Korporatismus näher betrachtet werden. In ihnen werden die Ursachen und Wirkungen von Interessenvertretung behandelt. Danach werden das Politikfeld und die verbandlichen Strukturen in diesem näher bestimmt. Anschließend folgt eine nähere Auseinandersetzung mit den lobbyistischen Methoden der Tabakindustrie. Das Hauptaugenmerk wird auf den Einflussstrategien liegen, die die Interessenvertreter direkt gegenüber der Politik und Verwaltung anwenden. Darüber hinaus werden indirekte Methoden zur Beeinflussung der Politik über die Einflussnahme auf Wissenschaftler und Journalisten sowie die aktuelle Gesetzgebung betrachtet.
Aufgrund des nichtöffentlichen Charakters ist es schwierig, die Erfolge der Lobbyarbeit zu bewerten. Die Einflussformen und Wirkungen sind so komplex, dass sich nicht genau verfolgen lässt, welche lobbyistischen Interessen sich zu welchem Grad durchgesetzt haben.[5] Um dennoch einen Eindruck von dem Betätigungsfeld eines Lobbyisten zu bekommen, wurden für diese Arbeit Interviews mit Vertretern der Tabaklobby und mit Mitarbeitern im Bundestag, die in diesem Bereich tätig sind, durchgeführt. Dadurch können sowohl Einblicke in die Arbeit der Lobbyisten als auch der Entscheidungsträger gewährt werden. Dennoch ist es ist nur schwerlich möglich, den tatsächlichen Einfluss der Tabaklobby auf die Gesetzgebung im Nichtraucherschutzbereich heraus zu filtern. Vielmehr soll in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden, welche Möglichkeiten der Einflussnahme es für die Interessenvertretung gibt und wie die Tabaklobby[6] sie eingesetzt hat. Eine Bestimmung des Erfolges dieser Methoden ist im Rahmen dieser Arbeit leider nicht möglich.
2.Theorie
2.1 Begriffe
Pluralismus und Korporatismus sind grundlegende Konzepte der Interessenvermittlung. Sie bilden die theoretische Grundlage für diese Arbeit. Bevor auf diese beiden theoretischen Konzepte eingegangen werden kann, müssen im Folgenden einige essentielle Begriffe geklärt werden. Dabei ist zu beachten, dass es, wie bei fast allen politikwissenschaftlichen Begriffen, keine eindeutigen Definitionen gibt. Oftmals werden Begriffe synonym verwendet, da keine scharfen Abgrenzungen für sie existieren. Beispielsweise werden „Interessengruppe“, „Pressure Group“ und „Verband“ oftmals verwendet, um das Gleiche auszudrücken.
Mit dem Interesse wird in politikwissenschaftlicher Hinsicht der Antrieb für bestimmte Handlungen beschrieben.[7] Durch die Wahrnehmung und Festlegung von Interessen kann erklärt werden, wieso verschiedene Handlungen vollzogen werden. Jedoch werden erst durch die Bildung von Interessengruppen und -organisationen die Interessen auch „politikfähig“ und können als Ausgangspunkt für Lobbying genutzt werden.[8]
Zunächst einmal ist die Interessenvermittlung ein „grundlegendes Merkmal moderner, d.h. funktional ausdifferenzierter und demokratisch strukturierter Gesellschaften.“[9] Für moderne Gesellschaften und demokratische Regierungssysteme sind die Bündelung, Vertretung und Durchsetzung von Interessen essentiell notwendig.[10]
Die Aufgabe der Interessenvermittlung übernehmen sowohl „Interessengruppen“, „Pressure Groups“ als auch „Verbände“. Allen gemein ist, dass sie neben den politischen Parteien eine wichtige Rolle in der Vermittlung von Forderungen der Gesellschaft (in diesem Fall ihrer Mitglieder) an die Gesetzgeber und die Administration innehaben.[11] Im Gegensatz zu den Verbänden haben Parteien ein verbrieftes Recht an der Willensbildung teilzunehmen. Dadurch ergibt sich für sie eine politische Verantwortung, die Verbände nicht haben.
Vereinfacht gesagt, sind Interessengruppen Gebilde, die durch ein gemeinsames Interesse der Gruppenmitglieder zusammengehalten werden und sonst über keine formale Struktur verfügen.[12] Interessengruppen sind das „Rohmaterial der Politik“, die ihre Ziele durch das Ausüben von Druck und Gegendruck erreichen.[13] Oftmals werden in den Definitionen für Interessengruppen drei Elemente verwendet:
1. der Versuch der Einflussnahme auf die Politik in einem bestimmten Themenbereich,
2. der Wunsch, zwar politischen Einfluss zu haben, nicht aber zu regieren und
3. eine an den Interessen orientierte Mitgliederschaft.[14]
Deshalb definiert Speth Interessengruppen als „Gruppen von Menschen, die gleiche oder ähnliche politische, soziale, ökonomische, religiöse, kulturelle, geschlechtliche, ethnische oder andere Interessen aufweisen und organisatorische Strukturen ausgebildet haben, die Interessen zu bündeln, abzugleichen und zu vertreten.“[15] Zu den Zielen einer Interessengruppe zählt es, die gruppenspezifischen Interessen der Mitglieder zu artikulieren und in den politischen Entscheidungsprozess einzubringen.[16] Interessengruppen geben nicht nur Informationen an ihre Mitglieder bzw. die Wähler weiter, sondern auch an Politiker. Dadurch tragen sie zu einer Verminderung des Ressourcenaufwands für die Informationsgewinnung und die Konsensbildung im politischen Prozess bei.[17] Der besondere Anreiz der Interessengruppen besteht laut Leif und Speth darin, ihre Interessen in verbindliche Entscheidungen einfließen zu lassen und auf diese Weise „demokratisch geadelt“[18] zu werden.
Bei Pressure Groups wird die Vorgehensweise der Gruppe in den Mittelpunkt gestellt. Die Gruppe versucht überall dort, wo politische Entscheidungen getroffen werden, über die Ausübung von Druck Einfluss zu gewinnen. Dieser Druck kann z. B. über die Mobilisierung der Öffentlichkeit durch die Medien, Kundgebungen und Großdemonstrationen sowie durch die Entziehung finanzieller Unterstützung erfolgen.[19]
Der Begriff des Verbandes hebt im Gegensatz zu den Pressure Groups die organisatorische Komponente der Gruppe hervor. Wie bei den anderen Gruppen ist Ziel eines Verbandes die Beeinflussung politischer Entscheidungen, ohne an Wahlen teilnehmen zu müssen und dennoch die Interessen der Mitglieder bestmöglich zu erfüllen.[20] Neben einer gewissen internen Formalisierung und Strukturbildung sind die freiwillige, unbezahlte Mitgliedschaft, die Vertretung individueller Interessen und Bedürfnisse, die Produktion von Dienstleistungen sowie die gesellschaftliche Integration der Mitglieder charakteristische Merkmale von Verbänden.[21] Bei Verbänden ist wichtig hervorzuheben, dass das Ziel der Einflussnahme aus den Interessen der Verbandsmitglieder resultiert, wobei das Interesse „die aus den Organisationszielen abgeleitete Handlungsorientierung“[22] ist. Weiterhin richtet sich die verbandliche Einflussnahme vor allem auf staatliche Institutionen, wodurch die Verbände eine Nahtstelle zwischen Bürgern und Staat bilden.[23]
Alle drei Gruppen sind dadurch charakterisiert, dass sie ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen mit gleichen Interessen sind, eine arbeitsteilige, meist hierarchische Organisation haben und als Ziel die individuellen, materiellen oder ideellen Wünsche ihrer Mitglieder erfüllen wollen.[24] Weiterhin ist für alle wichtig, dass entscheidend für das politische Gewicht einer Gruppe ist, inwiefern sie in der Lage ist, sich zu organisieren und die für den politischen Verteilungskampf notwendigen Ressourcen aufbringen kann.[25]
Aufgrund der fehlenden Trennschärfe und den vielen Gemeinsamkeiten der einzelnen Begriffe, wird in dieser Arbeit „Verband“ und „Interessengruppe“ synonym verwendet.
2.2 Konzepte
Sowohl der Pluralismus als auch der Korporatismus sind Reaktionen auf die Entwicklung der organisierten Interessen in Zeiten der Industrialisierung. Beide Konzepte gehen davon aus, dass Interessengruppen für liberale Demokratien eine Grundvoraussetzungen sind, da sie im Gegensatz zu Parteien gesellschaftliche Interessen auch außerhalb des politischen Systems vertreten.[26] Der Unterschied besteht allerdings darin, dass der Pluralismus der Typus einer Gesellschaftsformation ist, während es sich beim Korporatismus um ein System der Interessenvermittlung zwischen Staat und Interessengruppen handelt.[27]
2.2.1 Pluralismus
Der Pluralismus entstand als Gegenmodell zum traditionellen monistischen Staatsmodell und betont dabei das Agieren von Interessengruppen gegenüber dem souveränen Staat als notwendiges Element im demokratischen Willensbildungsprozess.[28] Dabei werden die Verbände nicht als Gefahr für die Souveränität des Staates gesehen, sondern vielmehr als Chance für die Gestaltung des Gemeinwohls.[29] In Deutschland wurde insbesondere der (Neo-)Pluralismus nach dem Zweiten Weltkrieg als Abgrenzung zum Totalitarismus genutzt, da er die Erfahrungen mit dem „Dritten Reich“ und dem Kommunismus verarbeitete.[30]
Das pluralistische Modell lässt sich besonders auf die westlichen Demokratien anwenden, da demokratische Rahmenbedingungen notwendig sind, um Interessen verwirklichen zu können. So betont Ernst Fraenkel, dass der Pluralismus an „die Voraussetzung einer freiheitlichen, die Vielfalt ermöglichenden Verfassung gebunden [ist]. Freiheit ist die Bedingung der Möglichkeit einer pluralistischen Gesellschaftsordnung.“[31] Damit der Pluralismus wirklich zum Gemeinwohl führen kann, müssen die Spielregeln des politischen Wettbewerbs, die Rechtsnormen, die den politischen Willensbildungsprozess regeln, und die Grundprinzipien des gesitteten menschlichen Zusammenlebens eingehalten werden.[32]
Die Pluralismustheorie geht weiterhin davon aus, dass die Gesellschaft voller unterschiedlicher Interessen ist, diese gleichberechtigt und organisierbar sind und es eine Chancengleichheit bei ihrer Durchsetzung gibt.[33] Die Verbände sind ein „organisatorisches Spiegelbild der Gesellschaft.“[34] Zur Bildung von Interessengruppen kommt es, da bestimmte soziale Interessen noch nicht in der Politik vertreten sind.[35] Die Interessengruppen versuchen sich gegenüber dem Staat als Pressure Groups zu behaupten und ihre Ziele zu verwirklichen. Sie gehen nicht auf enge Wechselbeziehungen und Tauschgeschäfte mit dem Staat ein und übernehmen keine staatlichen Aufgaben. Die einzelnen Verbände stehen in Konkurrenz und Wettbewerb zueinander, können aber auch punktuell miteinander kooperieren.[36] Somit liegt die Betonung auf einer Vielzahl von konkurrierenden Verbänden, die demokratisch organisiert sind und versuchen, den Staat einseitig zu beeinflussen. Grundsätzlich geht der Pluralismus davon aus, dass der Ablauf und der Inhalt der Politik durch die Kooperation, die Konflikte und die Machtverteilung zwischen den organisierten Interessen zu erklären ist.
Laut Schmitter (1974) kann der Pluralismus „definiert werden als ein System der Interessenvermittlung, dessen wesentliche Bestandteile in eine nicht näher bestimmte Anzahl verschiedener, freiwilliger, in Wettbewerb stehender, nicht hierarchischer und autonomer Gruppen organisiert sind. Diese Gruppen besitzen weder eine besondere staatliche Lizenz, Anerkennung oder Unterstützung, noch sind sie auf staatliche Initiative hin gebildet worden oder unterliegen staatlicher Kontrolle hinsichtlich der Rekrutierung von Führungspersonal oder der Interessenartikulation. Außerdem können sie kein Repräsentationsmonopol innerhalb der von ihnen vertretenen Bereiche in Anspruch nehmen.“[37]
Auf diesen Grundlagen aufbauend hat Ulrich von Alemann Minimalbedingungen des Pluralismus aufgestellt:
1. Alle wesentlichen Interessen der Gesellschaft sind über Verbände und Parteien organisierbar bzw. organisiert,
2. für alle organisierten Interessen herrschen unabhängig von ihrer späteren Durchsetzung die gleichen Spielregeln und Wirkungsmöglichkeiten,
3. das System ist offen und empfänglich für sich neu artikulierende Interessen und
4. es droht eine Monopolisierung oder eine einseitige Interessendurchsetzung, so dass die Garantie einer Gegenverbandsbildung besteht.[38]
Erst wenn diese Bedingungen erfüllt werden, kann von einem vorherrschenden Pluralismus gesprochen werden.
Wie an anderen Konzepten wurde auch am Pluralismus Kritik geübt. Grundsätzlich wurde kritisiert, dass von einer Organisierbarkeit aller Interessen ausgegangen wird. Es kann aber nicht erklärt werden, warum sich trotz der gegebenen Voraussetzung, beispielsweise einer veränderten Umwelt oder sozialer Ungleichheit, nicht immer Interessengruppen herausbilden. Weiterhin wird die fehlende Chancengleichheit der am politischen Prozess teilnehmenden Gruppen bemängelt. Von der konservativen Seite richtet sich die Kritik besonders gegen die fehlende Trennung von Staat und Gesellschaft. Für sie kann nur der Staat das Gemeinwohl erkennen und realisieren. Wenn dies aber auch gesellschaftliche Gruppen wollen, besteht die Gefahr, dass sie den Staat für ihre partikularen Interessen missbrauchen.[39] Von linker Seite wurde kritisiert, dass die Interessenorganisationen und somit auch ihre Mitarbeit im politischen Prozess nicht demokratisch legitimiert seien. Außerdem wirken sie als strukturkonservierendes Element der kapitalistischen Gesellschaft, da mit einer höheren Anzahl von Akteuren die Verschiebung des Status Quo schwieriger wird.[40]
2.2.2 Korporatismus
Der Korporatismusbegriff wurde in den 70er Jahren als Reaktion auf den Pluralismus gebildet. Der Pluralismus konnte die Realität der Interdependenzen und Austauschbeziehungen zwischen Staat und Interessengruppen nicht mehr ausreichend widerspiegeln. Vielmehr sah der Pluralismus die Interessengruppen als „Pressure Groups“, die dem Staat nur fordernd gegenübertraten.[41]
In Deutschland muss von einem Neokorporatismus ausgegangen werden, da der Korporatismus ursprünglich die Ordnung eines autoritären und zwangsmitgliedschaftlich verfassten Staates bezeichnete und besonders mit den rechten Diktaturen in Verbindung stand. Um diesem autoritären Begriff etwas entgegenzusetzen, definierte Schmitter (1974) Korporatismus „als ein System der Interessenvermittlung, dessen wesentliche Bestandteile organisiert sind in einer begrenzten Anzahl singulärer Zwangsverbände, die nicht miteinander in Wettbewerb stehen, über eine hierarchische Struktur verfügen und nach funktionalen Aspekten voneinander abgegrenzt sind. Sie verfügen über staatliche Anerkennung oder Lizenz, wenn sie nicht sogar auf Betreiben des Staates hin gebildet worden sind. Innerhalb der von ihnen vertretenen Bereiche wird ihnen ausdrücklich ein Repräsentationsmonopol zugestanden, wofür sie als Gegenleistung bestimmte Auflagen bei der Auswahl des Führungspersonals und bei der Artikulation von Ansprüchen und Unterstützung zu beachten haben.“[42]
Der Kernpunkt des Korporatismus ist die wechselseitige Austauschbeziehung zwischen Staat und Interessengruppen. Somit stellen die Interessengruppen nicht nur einseitig Forderungen und der Staat kann wiederum seine Politik nicht einseitig durchsetzen. Dabei ist wichtig, dass diese Beziehungen institutionalisiert sind. Die Verbände bekommen nicht nur die Unterstützung des Staates, sondern wurden teilweise auf sein Betreiben hin gegründet und besitzen in bestimmten Bereichen ein Repräsentationsmonopol gegenüber dem Staat[43] Dadurch ergeben sich für beide Seiten Vorteile. Der Staat kann Aufgaben übertragen und so das Konfliktpotential seiner Entscheidungen mindern und die Verbände können durch ihre Teilnahme am politischen Entscheidungsprozess ihre Interessen besser einbringen. Somit entstehen eine erhebliche Entlastung des Staates und eine Milderung gesellschaftlicher Konflikte durch Kompromissbildung.[44] Die freiwillige Teilnahme an diesen Austauschsystemen ist somit nicht als Alternative für das parlamentarische System gedacht, sondern als Ergänzung und Unterstützung.[45]
Im Unterschied zum Pluralismus befasst sich der Korporatismus mit den großen Zwangsverbänden, den kollektiven herrschaftsorientierten Gruppenprozessen und den vielseitigen Abhängigkeitsverhältnissen zwischen Staat und Verbänden.[46] Der Pluralismus betont hingegen die individualistischen Verbände und ihre einseitigen Versuche der Politikbeeinflussung. Während im Pluralismus davon ausgegangen wird, dass sich Menschen über ein gemeinsames Interesse zusammenfinden und einen Verband gründen, sind im Korporatismus kollektive Interessen nicht gegeben. Sie werden erst in einem fortlaufenden Prozess durch soziale Institutionen definiert.[47] Demnach kann nicht über die Interessen auf Verbandshandeln geschlossen werden und es kann nicht als Erklärungsfaktor für die Gründung von Verbänden dienen. Somit repräsentieren die Verbände nicht einfach die Interessen ihrer Mitglieder, da es ein solches Interesse nicht gibt, sondern müssen aktiv an der Definition mitarbeiten.[48] Dennoch ist zu beachten, dass auch in stark korporatistisch geprägten Systemen die Verbandseinflüsse nicht nur auf institutionalisierten, sondern auch auf informellen Wegen verlaufen.[49]
Zu den Gefahren des Korporatismus zählt das Elitenkartell. Vom Wähler nicht legitimierten Verbandsvertretern wird dauerhaft eine Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess garantiert. Dabei kann es zu intransparenten, nicht öffentlichen Entscheidungen kommen, für die die Verantwortlichkeiten nicht eindeutig zugewiesen werden können.
2.2.3 Lobbyismus
Lobbyismus wird meist als ein Teil des Pluralismus betrachtet. Von Alemann spricht sogar davon, dass der Lobbyismus die „nackte Verkörperung des Pluralismus“[50] sei. Im Pluralismus und damit auch im Lobbyismus gibt es einen erwünschten Einfluss der Interessengruppen auf den Staat, wodurch das Gemeinwohl gewährleistet werden kann, welches sich aus den konkurrierenden Einzelinteressen zusammensetzt.[51] Im Lobbyismus und Pluralismus versucht jeder seine eigenen Interessen durchzusetzen. Damit das ganze System funktionieren kann, müssen bestimmte demokratische Spielregeln eingehalten werden. Im Korporatismus hingegen werden die eigenen egoistischen Interessen durch den Zwang zur Verhandlung und zum Konsens etwas angepasst. Deswegen wird im Korporatismus auch nicht von lobbyistischen Methoden gesprochen.[52] Da es aber zu einer immer größer werdenden Individualisierung der Interessen und zu einer Aufspaltung der alten Verbändelandschaft[53] kommt, werden die korporatistischen Strukturen etwas zurückgedrängt, während die pluralistischen oder auch die lobbyistischen Strukturen ausgebaut werden.
Ein wichtiges Element am Lobbyismus ist sein informeller Charakter. Es wird in der Regel auf nicht förmlichen Wegen von Vertretern gesellschaftlicher Interessen versucht, auf politische Entscheidungsträger einzuwirken, um so Politikergebnisse in ihrem Sinne zu verändern.[54] Politische Entscheidungen werden nicht nur im Parlament getroffen, sondern vor allem im „vorpolitischen Raum der Willensbildung.“[55]
Seit Anfang der 1990er Jahre gab es große Veränderungen in gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Hinsicht, die die Rahmenbedingungen für die Interessenvertretung entscheidend verändert haben.[56] Die Gesellschaft wird immer individualisierter. Das zeigt sich daran, dass alle großen Verbände, die Parteien oder auch die Kirche an Mitgliedern verlieren. Damit verlieren diese Organisationen an Macht, da sie keinen umfassenden Vertretungsanspruch mehr und somit größere Schwierigkeiten bei der Durchsetzung ihrer Interessen haben. Gleichzeitig gibt es immer mehr kleinere Verbände, die auf die Politik zugehen und eigene Interessen vertreten. Durch die Globalisierung und Europäisierung haben sich neue Adressaten für die Lobby gebildet. Immer mehr Entscheidungen werden nicht mehr auf nationaler, sondern auf europäischer Ebene getroffen. Folglich haben immer mehr Interessenorganisationen Zweigstellen in Brüssel eröffnet, um frühzeitig in den Entscheidungsprozess eingreifen zu können.
In diesem Kapitel wurden die theoretischen Grundlagen für die vorliegende Arbeit erläutert. Die Interessenvertretung wird als legitimes Mittel sowohl im Pluralismus als auch im Korporatismus angesehen. Es gibt allerdings Unterschiede in der Beteiligung der Interessenorganisationen im Willensbildungsprozess. Im Korporatismus werden die wenigen großen Verbände auf institutionalisierten Wegen in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden. Im Pluralismus hingegen versuchen die vielen Einzelverbände einseitig Einfluss auf den Staat auszuüben und übernehmen keine Aufgaben für ihn. In Deutschland sind sowohl korporatistische als auch pluralistische Strukturen vorhanden, in denen die Tabaklobby versucht, ihren Einfluss auszuüben.
Auf dieser Grundlage sollen die Methoden erläutert werden, welche die Tabaklobby nutzt, um ihre Interessen durchzusetzen. Im nächsten Kapitel wird soll ihre verbandliche Organisation betrachtet werden. Es werden die wichtigsten Verbände und Unternehmen sowie ihre größten Gegner vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird genauer auf die Zusammenarbeit der Akteure miteinander eingegangen.
3.Die verbandliche Organisation der Tabaklobby
3.1 Politikfeld
Nach den Streitigkeiten um den Nichtraucherschutz in den Jahren 2006 und 2007 stellt sich die Frage, wieso es so schwierig ist, einen umfassenden Nichtraucherschutz zu verabschieden, wenn die Gefahren des Passivrauchens wissenschaftlich nachgewiesen und allgemein bekannt sind. Das Problem liegt zum einen daran, dass ein komplettes Rauchverbot zwar der Gesundheit der Menschen wohl tun, jedoch den Finanzen des Staates schaden würde. Zum anderen führt der deutsche Föderalismus dazu, dass der Zentralstaat nicht die Kompetenzen hat, in allen Bereichen den Nichtraucherschutz zu regeln. Im Bereich der Gastronomie haben die Bundesländer die Entscheidungskompetenz und müssen sich entweder auf gemeinsame Standards einigen oder 16 verschiedene Gesetze verabschieden.
Das Thema des Schutzes vor den Gefahren des Passivrauchens gehört hauptsächlich in den Bereich der Gesundheitspolitik. Von hier gehen die meisten Bestrebungen für ein generelles Rauchverbots aus und hier besteht der größte Konsens zu diesem Thema. Allerdings stoßen die Gesundheitspolitiker meist schon auf parteiinternen Widerstand unter den Finanz- und Haushaltspolitikern, da jedes Jahr mehrere Milliarden Euro an Tabaksteuer in den Haushalt fließen. Im Jahr 2006 waren es 14,4 Milliarden Euro, davon entfielen 12,5 Milliarden Euro allein auf die Fertigzigaretten. Damit war die Tabaksteuer nach der Mineralölsteuer die ertragreichste besondere Verbrauchersteuer.[57]
Tabelle 1: Verbrauchersteuereinnahmen ab 1999 (in Millionen Euro)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Aufgrund dieses hohen Steueraufkommens kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Gesundheits- und Finanzpolitikern. Besonders die Finanzpolitiker stehen einem generellen Rauchverbot eher negativ gegenüber, da sie dadurch eine Reduzierung des Steueraufkommens und ein Defizit im Haushalt befürchten. Weiterhin wird immer wieder das Argument der wegfallenden Arbeitsplätze gegen einen stärkeren Nichtraucherschutz vorgebracht. Bei einem sinkenden Absatz von Zigaretten durch ein komplettes Rauchverbot seien Arbeitsplätze im Tabakanbau und in der tabakverarbeitenden Industrie gefährdet.
3.2 Der Verband der Cigarettenindustrie
Insbesondere aufgrund des hohen Steueranteils hat sich die Tabakindustrie eine gute Position für ihre Interessenvertretung sichern können. Der Verband der Cigarettenindustrie (VdC) bestand bis zu seiner Auflösung im Jahr 2007 aus nur sieben Mitgliedern, die sich fast den gesamten Zigarettenmarkt in Deutschland teilen.[58] Daher konnte ein so kleiner Verband, einer der stärksten in Deutschland werden.
Abbildung 1: Marktanteile der Mitglieder des VdC
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthaltenQuelle: Internetseiten der Unternehmen
Der VdC war der mächtigste Akteur innerhalb der Tabaklobby. Zu dieser gehören neben den Produzenten auch die Importeure, die Vermarkter und die Automatenindustrie. Die Lobby ist zwar recht weit gefächert, aber gut organisiert. Der mächtige VdC hat erfolgreich mit den Verbänden der anderen Gruppen zusammen gearbeitet. Die einzelnen Verbände stehen untereinander in Kontakt und arbeiten des Öfteren zusammen, um ihre Ressourcen zu bündeln und gemeinsam handeln zu können.
Der VdC war einer der „erfolgreichsten und meistgehassten Lobbyorganisationen Deutschlands.“[59] Er vertrat eine relativ kleine Branche mit etwa 9.000 Beschäftigten, bei einem Jahresumsatz von ca. 20 Milliarden Euro (2006).[60] Er war so etwas wie der federführende Verband der Tabakindustrie, der oftmals politischer war als die anderen Verbände.[61]
Das Auseinanderbrechen des Verbandes fing mit dem Ausstieg des Marktführers Philip Morris im Mai 2007 an, der über einen Marktanteil von ca. 37% verfügt. Jacek Olczak, Vorsitzender der Geschäftsführung der Philip Morris GmbH, nannte folgende Gründe für den Austritt: „Das politische und gesellschaftliche Umfeld, in dem sich der VdC und die Philip Morris GmbH bewegen, hat sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert und damit auch die Rolle und Bedeutung des VdC. Die Mitgliedsunternehmen des VdC vertreten heute unterschiedliche Meinungen in wichtigen Fragen unserer Industrie. Wir (Philip Morris) verbinden mit diesem Schritt ein nachdrückliches Eintreten unseres Unternehmens für eine umfassende, sich an gesundheitspolitischen Zielen orientierende Regulierung der Tabakwirtschaft in Deutschland. Dazu gehört unser Bestreben um eine faire Besteuerung aller Tabakprodukte einschließlich der Formulierung einer klaren und eindeutigen Tabaksteuer-Definition, die keinen Interpretationsspielraum zulässt und Missbrauch ausschließt. Wir wollen nicht, dass Kinder und Jugendliche rauchen. Deshalb streben wir die Anhebung des Mindestinhalts von Zigarettenpackungen an und unterstützen strikte rechtliche Auflagen für die Tabakwerbung.“[62]
Durch den Austritt von Philip Morris aus dem Branchenverband wurden die schon vorher schwelenden Differenzen zwischen den einzelnen Mitgliedern offensichtlich. Das zeigt sich auch an den Reaktionen des VdC. In offiziellen Pressemitteilungen wird mit Verständnis auf das Verlassen reagiert, inoffiziell und in manchen Interviews wird dagegen kritischer argumentiert. So findet der Vorsitzende des VdC, Titus Wouda Kuipers, die angegebenen Gründe „scheinheilig“ und unterstellt rein geschäftsorientierte Motive. Philip Morris` Forderung einer Anhebung der Steuern für Feinschnitt[63], die der VdC nicht unterstützt, beruhe nur auf der Tatsache, dass der Konzern mit den billigen Feinschnittprodukten nur wenig Umsatz macht und dieses Segment lieber vom Markt verdrängen wolle. Weiterhin komme das geforderte Werbeverbot dem Marktführer gelegen, da es eine Schwächung des Wettbewerbs bewirke. Wouda Kuipers sieht die Gründe von Philip Morris nur als vorgeschoben an und meint, der Austritt sei vorhersehbar gewesen.[64]
Diese Konflikte sind Anzeichen eines harten Verdrängungswettbewerbs zwischen den Tabakunternehmen, die mit sinkenden Gewinnen zu kämpfen haben.[65] Die Tabaklobby musste im Jahr 2007 verschiedene Niederlagen einstecken, wie z. B. durch die gesetzlichen Rauchverbote in Ämtern, Zügen und der Gastronomie einzelner Bundesländer, wobei weitere im Januar 2008 hinzukamen.[66] Außerdem ist es der „Gegenlobby“ durch Kampagnen gelungen, dem VdC das „Image hinterhältiger Todesengel zu verpassen.“[67] Dies alles führte zu einem großen Imageschaden für den Verband.
Es ist davon auszugehen, dass die Lobby durch das Auflösen des VdC nur kurzzeitig geschwächt wird. Zum einen geht die Lobbyarbeit natürlich weiter, was sowohl den Tabakunternehmen als auch ihren Gegnern bewusst ist. Zum anderen wird Anfang des Jahres 2008 ein neuer Lobbyverband mit den großen Verbänden der Branche, die auch ohne Philip Morris noch über ca. 60% des Marktanteils in Deutschland verfügen, gegründet.[68] Allerdings hat sich auf Nachfrage bei den Mitarbeitern der Fachpolitiker durch den Wegfall des Verbandes nicht viel geändert.[69]
Am Beispiel des VdC lässt sich erkennen, dass obwohl sich die Unternehmen in einzelnen Verbänden zusammenschließen, sie dennoch nicht unbedingt die gleichen Ziele verfolgen. Besonders bei Philip Morris zeigt sich, dass das Unternehmen den Verband teilweise sogar eher als Hemmnis wahrgenommen hat und deswegen ausgetreten ist. Im Verband wurden Positionen vertreten, die nicht mit den geschäftlichen Zielen von Philip Morris zusammen passten, wie z. B. die geringere Besteuerung von Feinschnittprodukten. Philip Morris versuchte erst innerhalb des Verbandes dagegen vorzugehen und hat sich mangels Erfolg aus dem Verband zurückgezogen. Für diesen Zigarettenhersteller ist es leicht möglich, allein seine Interessen zu vertreten, da er über mehr als ein Drittel der Marktanteile auf dem deutschen Tabakmarkt verfügt. Für kleinere Unternehmen wie JT International oder die Heintz van Landewyck GmbH ist es hingegen schwieriger, allein ihre Interessen gegenüber der Politik durchzusetzen. Für sie ist ein solch starker Verband wie der VdC wichtig und notwendig.
[...]
[1] M. Strauch: Die Kunst des Einwirkens, in: M. Strauch (Hrsg.), Lobbying. Wirtschaft und Politik im Wechselspiel, Frankfurt am Main, 1993, S. 17-60, hier: S. 17.
[2] Vgl. K. Broichhausen: Kniffe und Knigge für Lobbyisten, Bonn u. a. 1982, S. 10.
[3] T. Leif/R. Speth: Die fünfte Gewalt. Anatomie des Lobbyismus in Deutschland, in T. Leif/R. Speth (Hrsg.), Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland, Bonn 2006, S. 10-36, hier S. 15.
[4] Vgl. ebda., S. 19.
[5] Vgl. T. Leif/R. Speth: Anatomie des Lobbyismus. Einführung in eine unbekannte Sphäre der Macht, in: T. Leif/R. Speth (Hrsg.), Die stille Macht. Lobbyismus in Deutschland, Wiesbaden 2003, S. 7-32, hier S.29.
[6] Zur Tabaklobby zählen in dieser Arbeit die Unternehmen und Verbände, die Tabak bzw. Tabakprodukte herstellen oder mit ihnen handeln.
[7] Vgl. Leif/Speth (2006), S. 13.
[8] Vgl. ebda.
[9] J. Schmid: Verbände. Interessenvermittlung und Interessenorganisationen , München u. a. 1998, S. 15.
[10] Vgl. R. Kleinfeld u. a.: Lobbyismus und Verbändeforschung. Eine Einleitung, in: R. Kleinfeld u. a. (Hrsg.), Lobbying. Strukturen, Akteure, Strategien, Wiesbaden 2007, S. 7-35, hier S. 7.
[11] Vgl. J. Hartmann 1985: Verbände in der westlichen Industriegesellschaft. Ein international vergleichendes Handbuch, Frankfurt (u. a.) 1985, S. 15.
[12] Vgl. S. Tietz-Weber: Interessengruppen und Rechnungslegungsregeln. Eine Analyse des Umsetzungsprozesses der 4. EG-Richtlinie in das Bilanzrichtlinien-Gesetz, Wiesbaden 2006, S. 9.
[13] Vgl. Schmid, a.a.O., S. 33.
[14] Vgl. G. Jordan u. a.: Looking for Democracy: The Democratic Contribution of Membership-based Interest Groups, 2007, S. 28 (siehe Internetverzeichnis).
[15] R. Speth: Interessengruppen, in: M. Althaus u. a.(Hrsg.), Handlexikon Public Affairs, Opladen 2005, S. 188-191, hier S. 188.
[16] Vgl. T. Märtz: Interessengruppen und Gruppeninteressen in der Demokratie. Zur Theorie des Rent-Seeking, Frankfurt am Main (u. a.) 1990, S. 72.
[17] Vgl. Märtz, ebda. 74.
[18] Leif/Speth (2006): 13.
[19] Vgl. U. von Alemann: Organisierte Interessen in der Bundesrepublik, Opladen 1989, S. 172.
[20] Vgl. Tietz-Weber, a.a.O., S. 9.
[21] Vgl. Schmid , a.a.O., S. 17.
[22] R. Tiedemann: Aufstieg oder Niedergang von Interessenverbänden? Rent-seeking und europäische Integration, Baden-Baden 1994, S. 18.
[23] Vgl. ebda. S. 19.
[24] Vgl. A. Straßner: Begriffliche und theoretische Grundlagen, in: M. Sebaldt u. a. (Hrsg.), Verbände in der Bundesrepublik Deutschland. Wiesbaden: 2004, S. 15-69, hier S. 22.
[25] Vgl. Märtz, a.a.O., S. 79.
[26] Vgl. A. Steiner u. a.: Public Affairs. Neue Akteure in der Grauzone der politischen Kommunikation, 2006, S. 6f. (siehe Internetverzeichnis).
[27] Vgl. Straßner, a.a.O., S. 41.
[28] Vgl. Schmid, a.a.O., S. 33.
[29] Vgl. U. von Alemann u. a.: ): Verbände und Staat. Vom Pluralismus zum Korporatismus. Analysen, Positionen, Dokumente, Opladen 1979, S. 16.
[30] Vgl. Schmid. a.a.O., S. 80.
[31] E. Fraenkel u. a.: Staat und Politik, Frankfurt am Main 1957, S. 256.
[32] Vgl. E. Fraenkel: Deutschland und die westlichen Demokratien. Frankfurt am Main 1964, S. 274f.
[33] Vgl. Straßner, a.a.O., S. 29.
[34] B. Zeitler: Verbände als organisatorisches Spiegelbild der Gesellschaft. David B. Truman, in: M. Sebaldt u. a. (Hrsg.): Klassiker der Verbändeforschung. Wiesbaden 2006, S. 57–71, hier S. 62.
[35] Vgl. D.Truman: The Governmental Process. Political Interest and Public Opinion, New York 1964, S. 33.
[36] Vgl. Schmid, a.a.O., S. 36.
[37] Schmitter in Schmid, a.a.O., S. 93.
[38] Vgl. U. von Alemann, a.a.O., S. 43.
[39] Vgl. Schmid a.a.O., S. 83.
[40] Vgl. J. Kirsch: Geographie des deutschen Verbandswesens, Münster 2003. S.36.
[41] Vgl. T. von Winter: Vom Korporatismus zum Lobbyismus. Paradigmenwechsel in Theorie und Analyse der Interessenvermittlung, In: Zeitschrift für Parlamentsfragen, H. 4/2004, S. 761–776, hier S. 762.
[42] Schmitter in Schmid, a.a.O., S. 93f.
[43] Vgl. Straßner, a.a.O., S. 42.
[44] Vgl. ebda. S. 41.
[45] Vgl. Schmid, a.a.O., S. 38.
[46] Vgl. Straßner, a.a.O., S. 44.
[47] Vgl. W. Streeck: Staat und Verbände. Neue Fragen. Neue Antworten?, in: W. Streeck (Hrsg.): Staat und Verbände, Opladen 1994: S. 7-34, hier S. 12.
[48] Vgl. Streeck a.a.O., S. 13.
[49] Vgl. von Winter (2004). S. 763.
[50] Vgl. U. von Alemann 2000: Vom Korporatismus zum Lobbyismus? Die Zukunft der Verbände zwischen Globalisierung, Europäisierung und Berlinisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ), (2000) 26 - 27, S. 3 – 6 (siehe Internetverzeichnis).
[51] Vgl. Leif u. a. (2006). S. 17.
[52] Vgl. ebda.
[53] Das zeigt sich z. B. daran, dass kleine Gewerkschaften wieder aus den großen Dachorganisationen austreten oder sich auch der größte Verband der Tabaklobby, der Verband der Cigarttenindustrie (VdC), aufgelöst hat. (Zum VdC in Kapitel 3.1 mehr ).
[54] Vgl. Kleinfeld u. a., a.a.O., S. 10.
[55] P. Köppl 2005: Lobbying, in: Althaus u. a. (Hrsg.): Handlexikon Public Affairs, Münster 2005, S. 191–195, hier S. 192.
[56] Vgl. R. Speth: Wege und Entwicklungen in der Interessenpolitik, In: Leif u. a. (Hrsg.): Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland, Bonn 2006, S. 38–52, hier S. 43. (2006a).
[57] Vgl. Bundesministerium der Finanzen (siehe Internetverzeichnis).
[58] Philip Morris GmbH (bis 2007), British American Tobacco Germany GmbH, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Gallaher Deutschland GmbH (Konzern Japan Tobacco), JT International Germany GmbH (Konzern Japan Tobacco), Tabak- und Cigarettenfabrik Heintz van Landewyck GmbH, Johann Wilhelm von Eicken GmbH Lübeck.
[59] G. Löwisch: Asche zu Asche. Aber die Lobby lebt (siehe Internetverzeichnis).
[60] Vgl. Unbekannter Autor (c): Zigarettenlobby löst sich auf (siehe Internetverzeichnis).
[61] Interview mit Franz Peter Marx (VdR), geführt am 10.12.2007.
[62] Pressemitteilung Philip Morris International (siehe Internetverzeichnis).
[63] Feinschnitt ist eine besonders feine Tabakschnittart, die insbesondere zum Selbstherstellen von Zigaretten genutzt wird. Aufgrund einer geringeren Besteuerung ist er billiger als fertige Zigaretten.
[64] Vgl. A. Graw: VdC-Chef greift Philip Morris heftig an (siehe Internetverzeichnis).
[65] Vgl. B. Nicolai: Philip Morris verlässt die Tabak-Lobby (siehe Internetverzeichnis).
[66] Vgl. Löwisch, a.a.O.
[67] ebda.
[68] Vgl. Unbekannter Autor (b): Zigarettenindustrie. Neuer Verband. (siehe Internetverzeichnis).
[69] Hintergrundgespräch mit einer Referentin der Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU/CSU-Fraktion, geführt am 6.12.2007; Hintergrundgespräch mit einer Referentin der Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Fraktion, geführt am 7.12.2007; Hintergrundgespräch mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, geführt am 7.12.2007; Interview mit Daniel Rühmkorf, Referent für Gesundheitspolitik und Pflege von DIE LINKE-Fraktion, geführt am 7.12.2007.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836619462
- Dateigröße
- 626 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Politikwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- lobbyismus interessenvertretung tabakindustrie pluralismus korporatismus verband cigarettenindustrie politikfeld
- Produktsicherheit
- Diplom.de