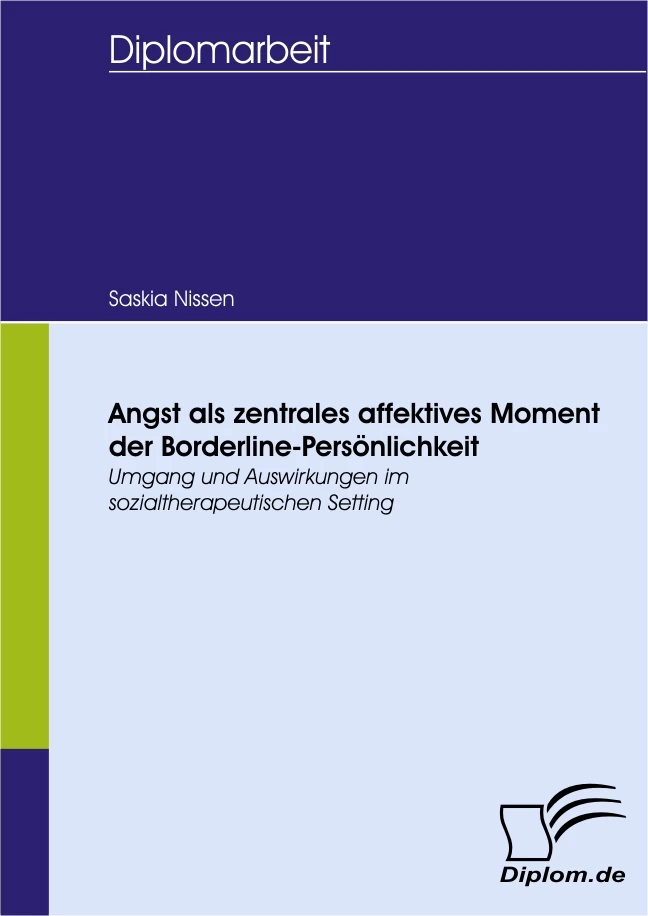Angst als zentrales affektives Moment der Borderline-Persönlichkeit
Umgang und Auswirkungen im sozialtherapeutischen Setting
Zusammenfassung
Jeder Mensch empfindet Angst, der eine mehr, der andere weniger. Für jeden Menschen ist es gesund, in bestimmten Situationen Angst zu empfinden, manchmal ist es sogar lebensnotwendig, da nur das Gefühl der Angst es uns ermöglicht, in einer gefährlichen Situation adäquat reagieren zu können. Sie dient uns als Schutzfunktion und bereitet unseren Körper auf eine Fluchtreaktion vor. Die Übergänge zwischen kleinen, alltäglichen Ängsten und echten Angsterkrankungen sind dabei fließend, was eine genaue Betrachtung unter der Fragestellung ab wann Angst (eigentlich) krankhaft wird zur Diagnosestellung voraussetzt.
Während meiner Arbeit in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe für Frauen mit Persönlichkeitsstörungen, in der vornehmlich Frauen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betreut werden, begegnen mir die Ängste der Bewohnerinnen in zahlreichen Facetten und werden zu einem relevanten Thema im Betreuungsalltag. Ich stelle fest, wie gravierend das tägliche Leben der Betroffenen, die Beziehungsgestaltung und die pädagogische Zielplanung vom Gefühl der Angst der Betreuten begleitet wird. Bronisch geht in Anlehnung an Bohus davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Angststörung bei einer Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörung bei einem Prozentsatz von 24-81 Prozent liegt. In nicht wenigen Fällen kann man demnach von Komorbidität sprechen. Gleichzeitig plädieren Dulz und Schneider dafür, dass zunächst einmal alle Symptome einer einzigen Erkrankung zuzuordnen seien. Aus einzelnen Symptomen jeweils eine eigene Krankheit (morbus) machen zu wollen, ignoriert die Symptomatologie der Borderline-Störungen auf eindrucksvolle Weise. Angebracht wäre allenfalls der Begriff einer Kosymptomatik. Die Symptome seien lediglich heterogen und dementsprechend werden etwa multiple Phobien und Zwänge dem Symptomkatalog der Borderline-Persönlichkeit zugeordnet.
Daneben beeinflussen aber gerade die Borderline-typischen Ängste, wie die panische Angst vor dem Verlassenwerden, dem Alleinsein oder der Veränderung den Umgang mit dieser Personengruppe. Borderline-Persönlichkeiten kennen Ängste, die mit psychotischem Erleben entstehen, einem Verfolgungswahn etwa, wobei ihnen, allein durch die Tatsache, dass sie, im Gegensatz zum Psychotiker, meist um den halluzinatorischen Hintergrund ihrer Angst wissen, diese nicht genommen wird.
Viele Betroffene nehmen ihre Ängste anders als andere Menschen oder gar auch nicht wahr; einem […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Angst
2.1. Begriff und Definition von Angst
2.2. Wie entsteht Angst
2.3. Wie äußert sich Angst
2.4. Ab wann Angst krankhaft wird
2.5. Angsterkrankungen im Überblick
3. Borderline-Persönlichkeitsstörung
3.1. Entstehung des Borderline-Begriffes
3.2. Borderline-Persönlichkeitsstörung in den Klassifikationssystemen
3.2.1. Borderline-Persönlichkeitsstörung im DSM-4
3.2.2. Borderline-Persönlichkeitsstörung im ICD-10
3.3. Genese der Borderline-Persönlichkeitsstörung
3.3.1. Biologische Einflussfaktoren
3.3.2. Borderline – eine frühe Störung
3.3.3. Psychoanalytischer Ansatz – eine Triebkonflikttheorie
3.3.4. Entwicklungspsychologischer Ansatz – eine Störung im Wiederannäherungsprozess
3.3.5. Verhaltenstherapeutischer Ansatz – ein Scheitern an der Dialektik
3.3.6. Borderline als Folge traumatischer Erlebnisse – sexueller Missbrauch
3.3.7. Soziokultureller Ansatz - Borderline als Ausdruck unserer Kultur
4. Angst als Motor der Entstehung anderer Symptome
4.1. Chronische, frei flottierende Angst
4.2. Multiple Phobien
4.3. Zwangssymptome im Sinne überwertiger Ideen
4.4. Konversionssymptome
4.5. Dissoziative Reaktionen und die Multiple Persönlichkeit
4.6. Depression
4.7. Polymorph-perverse Sexualität
4.8. Psychosomatische Symptome
4.9. Psychotische Symptome
4.10. Verlust der Impulskontrolle
4.11. Sozialverhalten / Delinquenz
4.12. Suizidalität
5. Abwehrmechanismen – das Grundsystem der Angstreduktion der Borderline-Persönlichkeit
5.1. Spaltung
5.2. Primitive Idealisierung
5.3. Projektion und projektive Identifizierung
5.4. Omnipotenzgefühl und Entwertung
5.5. Verleugnung
6. Die Grund-Ängste der Borderline-Persönlichkeit nach Hoffmann
6.1. Angst vor Überwältigung durch konflikthafte Impulse und Vorstellungen
6.2. Angst vor struktureller Regression
6.3. Angst vor dem Alleinsein
6.4. Angst vor Selbstverlust
6.5. Angst vor einem phantasiertem Verschlungenwerden
7. Umgang und Auswirkungen im sozialtherapeutischen Setting
7.1. Auswirkungen der Angst als zentrales Phänomen der Psychodynamik
7.1.1. Auswirkungen auf den Betreuungs-Alltag
7.1.2. Auswirkungen auf die Beziehungsgestaltung
7.1.2.1. Autonomie vs. Symbiose
7.1.3. Auswirkungen auf die individuelle Zielplanung
7.1.3.1. Veränderung vs. Regression
7.2. Mögliche Methoden im Umgang mit Ängsten
7.2.1. Angstreduktion durch Überprüfung der Wahrnehmung
7.2.1.1. Protokollführung / Selbstbeobachtungsprotokoll
7.2.1.2. Achtsamkeitstraining nach M. Linehan
7.2.2. Angstreduktion durch Kontrollsteigerung
7.2.2.1. Tagebuch – kreatives Schreiben
7.2.2.2. Verhaltensanalyse – organisiertes Schreiben
7.2.2.3. Angstübung
7.2.3. Angstreduktion durch Distanzierungstechniken
7.2.3.1. Imaginationsübungen
7.3. Unterstützende Struktur in der sozialtherapeutischen Einrichtung
7.3.1. Tagesstruktur
7.3.2. Bezugsbetreuung
7.3.3. Schutzraum
7.3.4. Arbeitsstruktur des Teams
7.3.4.1. Kommunikationsstrukturen
7.3.4.1.1. SET-Kommunikation
7.3.4.1.2. Dialektische Strategien
7.3.4.2. Supervision Exkurs: Übertragung und Gegenübertragung
8. Resümee
9. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Jeder Mensch empfindet Angst, der eine mehr, der andere weniger. Für jeden Menschen ist es gesund, in bestimmten Situationen Angst zu empfinden, manchmal ist es sogar lebensnotwendig, da nur das Gefühl der Angst es uns ermöglicht, „in einer gefährlichen Situation adäquat reagieren zu können.“ (Alsleben et al. 2004, S. 53) Sie dient uns als Schutzfunktion und bereitet unseren Körper auf eine Fluchtreaktion vor. „Die Übergänge zwischen kleinen, alltäglichen Ängsten und echten Angsterkrankungen sind dabei fließend“ (Bandelow 2006, S. 41), was eine genaue Betrachtung unter der Fragestellung „ab wann Angst (eigentlich) krankhaft wird“ (ebd.) zur Diagnosestellung voraussetzt.
Während meiner Arbeit in einer sozialtherapeutischen Wohngruppe für Frauen mit Persönlichkeitsstörungen, in der vornehmlich Frauen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung betreut werden, begegnen mir die Ängste der Bewohnerinnen in zahlreichen Facetten und werden zu einem relevanten Thema im Betreuungsalltag. Ich stelle fest, wie gravierend das tägliche Leben der Betroffenen, die Beziehungsgestaltung und die pädagogische Zielplanung vom Gefühl der Angst der Betreuten begleitet wird. Bronisch et al. (vgl. 2002, S. 90) gehen in Anlehnung an Bohus (1999) davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Angststörung bei einer Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörung bei einem Prozentsatz von 24-81% liegt. In nicht wenigen Fällen kann man demnach von Komorbidität sprechen. Gleichzeitig plädieren Dulz und Schneider (1996, S. 58) dafür, dass „zunächst einmal alle Symptome einer einzigen Erkrankung zuzuordnen seien. (...) Aus einzelnen Symptomen jeweils eine eigene Krankheit (morbus) machen zu wollen, ignoriert die Symptomatologie der Borderline-Störungen auf eindrucksvolle Weise ... . (...) Angebracht wäre allenfalls der Begriff einer Kosymptomatik.“ Die Symptome seien lediglich heterogen und dementsprechend werden etwa multiple Phobien und Zwänge dem Symptomkatalog der Borderline-Persönlichkeit zugeordnet (vgl. ebd., S. 14).
Daneben beeinflussen aber gerade die Borderline-typischen Ängste, wie die panische Angst vor dem Verlassenwerden, dem Alleinsein oder der Veränderung den Umgang mit dieser Personengruppe. Borderline-Persönlichkeiten kennen Ängste, die mit psychotischem Erleben entstehen, einem Verfolgungswahn etwa, wobei ihnen, allein durch die Tatsache, dass sie, im Gegensatz zum Psychotiker, meist um den halluzinatorischen Hintergrund ihrer Angst wissen, diese nicht genommen wird.
Viele Betroffene nehmen ihre Ängste anders als andere Menschen oder gar auch nicht wahr; einem Angstgefühl keine bestimmte Zuordnung geben zu können, sie als diffus zu bezeichnen oder aus der übergreifenden Angst vor Verletzlichkeit vollkommen zu verdrängen ist nicht selten. Dulz und Schneider (1996, S. 14) bezeichnen die Angst der Borderline-Persönlichkeit als „das zentrale Symptom der Behandlung... . Ganz abgesehen davon ist sie der Motor für die Entstehung aller anderen Symptome und der Art der Abwehrmechanismen.“
In meiner Arbeit werde ich, um den vielfältigen Ängsten einer Borderline-Persönlichkeit gerecht zu werden, zunächst einen Überblick über das Phänomen Angst vermitteln, hierzu wird in einem einführenden Kapitel auch darauf eingegangen werden, wie Angst entsteht, sich äußert und wann sie pathologisch wird. Angsterkrankungen werden zum Verständnis lediglich kurz angeführt, da der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit auf der für die Borderline-Persönlichkeit typischen Ängste liegt und zudem die oben aufgeworfene Fragestellung, ob es sich bei Borderline und Angst um eine Komorbidität handelt, nicht im Rahmen dieser Arbeit geklärt werden kann.
Das zweite Kapitel wird sich ausführlich mit der Struktur der Borderline-Persönlichkeit und der Entstehung der Borderline-Störung in Betracht verschiedener Entstehungstheorien beschäftigen.
Ausgehend von der oben genannten These Dulz und Schneiders (vgl. 1996, S. 14), die Angst der Borderline-Persönlichkeit als das zentrale Symptom der Behandlung zu betrachten, gehe ich im Folgenden auf die durch die Angst bestimmten Symptome und Abwehrmechanismen der Borderline-Persönlichkeit ein, sowie, in einem weiteren Kapitel, auf die von Hoffmann (2001) als Grund-Ängste der Borderline-Persönlichkeit herausgearbeiteten Ängste.
Auf der Basis dieses Überblickes ist es möglich im siebten und abschließenden Kapitel auf die Auswirkungen der Borderline-typischen Angst und den möglichen Umgang im sozialtherapeutischen Betreuungs-Setting einzugehen: Welche Bereiche der Alltagsbegleitung sind betroffen, wie lassen sich Methoden zur Angstreduktion in diesem Rahmen umsetzen und welche Unterstützung bietet die Struktur einer Einrichtung?
Eine zusammenfassende Betrachtung wird die Diplomarbeit abschließen.
Es sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der besseren Lesbarkeit die männliche Form im Sprachgebrauch verwendet wird, wobei keine Schlussfolgerungen auf das Geschlecht zu ziehen sind. Das abschließende, siebte Kapitel basiert vorwiegend auf Erfahrungen der sozialpädagogischen Betreuungsarbeit in einer vollstationären Wohngruppe und beschäftigt sich mit der Umsetzung von therapeutisch fundierten Methoden innerhalb dieses Settings. Da in der Wohngruppe ausschließlich Frauen mit Persönlichkeitsstörungen, vorwiegend der Borderline-Persönlichkeitsstörung betreut werden und zudem nur weibliche Mitarbeiterinnen in der Betreuungsarbeit tätig sind, wird sich die Schreibweise dem angleichen.
2. Angst
Angst ist ein Gefühl, das jedem Menschen mehr oder weniger bekannt ist, das ganz natürlich ist, biologisch in unserem Organismus festgelegt und in bestimmten Entwicklungsphasen sogar regelhaft auftritt, so beim „Fremdeln“ des Kleinkindes (vgl. Alsleben et al. 2004, S. 54). Angst wird manchmal sogar gesucht, um dem Leben etwas Neues abzuverlangen. Angst schützt uns, indem sie ein Signal in bedrohlichen Situationen setzt, aber Angst kann uns auch unnötig einschränken, wenn harmlose Situationen subjektiv als gefährlich eingeschätzt werden. Dieses einleitende Kapitel soll einen Überblick über beide Formen der Angst in ihren jeweils vielfältigen Ausgestaltungen geben, wobei der Schwerpunkt schließlich auf der pathologischen Entwicklung liegen wird.
2.1. Begriff und Definition von Angst
Allgemeine umfassende Bezeichnung für emotionale Erregungszustände, die auf die Wahrnehmung von Hinweisen, auf mehr oder weniger konkrete bzw. realistische Erwartungen oder allgemeine Vorstellungen physischer Gefährdung oder psychischer Bedrohung zurückgehen. (Fröhlich 1998, S. 57)
Diese Definition von Angst beinhaltet ihre wichtigsten Formen, da sie die Ebenen der tatsächlichen Wahrnehmung, der mehr oder weniger konkreten Erwartung und der allgemeinen, also durchaus nicht unbedingt realen Vorstellung vereint. Reale Angst als Produkt der Außenwelt steht hier im Gegensatz zur pathologischen, in unserer Innenwelt phantasierten Angst. Den durchaus fließenden Übergang bilden schwer einschätzbare Faktoren, wie sie in einer Gesellschaft, in der etwa Kriminalität oder Klimakatastrophen eine große Rolle spielen, vorkommen (vgl. Flöttmann 2005, S. 17f.).
2.2. Wie entsteht Angst
Angstreaktionen aufgrund realer Gefahrensituationen entstehen als lebensnotwendige Vorbereitungen auf eine Flucht oder einen Kampf. Bei Auftreten eines Stressors kommt es zu einer Schreckminute, in der die Gefahr eingeschätzt wird und zu einer anschließenden Hormonausschüttung von Adrenalin, Noradrenalin und Kortisol. Der
gesamte Körper wird aktiviert: Der Herzschlag erhöht sich, die Muskulatur spannt sich an, die Bronchien erweitern sich und Blutzucker wird zur Erhöhung der Energie ausgeschüttet. Nach einigen Minuten wird die erhöhte Hormonausschüttung wieder gestoppt, die Angstreaktion lässt nach (vgl. Alsleben et al. 2004, S. 55ff.). Die biologischen Reaktionen werden durch das vegetative Nervensystem gesteuert und an dieser Stelle sehr vereinfacht dargestellt: Die angstauslösenden Informationen gelangen zunächst zum Thalamus, der Schaltstelle zum Großhirn. Ohne das es sofort zu einer ausführlichen Auswertung der Informationen kommt, gehen diese auf direktestem Weg zur Amygdala, einer Ansammlung von Zellen im Vorderhirn, die eine sofortige Reaktion ermöglicht und die oben beschriebenen Symptome indirekt hervorruft. Durch die direkte Übertragung der Informationen an die Amygdala kann es auch zu einem Fehlalarm kommen (vgl. Bandelow 2006, S. 188f.). Erst kurze Zeit später nämlich wird die realistische Einschätzung einer Situation möglich, da die Informationen länger brauchen (etwa 0,3 Sekunden) um ins Bewusstsein zu gelangen. Über den Hippocampus, die Relaisstation für Gedächtnis- und Orientierungsfunktionen, wird die Information mit in der Hirnrinde abgespeicherten Vorerfahrungen und Erinnerungen verglichen. Eine unnötige Fluchtreaktion kann in Folge dessen noch abgewendet werden. Bei der klassischen Konditionierung (siehe unten) spielt der Hippocampus die entscheidende Rolle; er ermöglicht das Kontextlernen, um gefährliche, oder scheinbar gefährliche Situationen anhand eines auslösenden Reizes schneller zu erkennen. Besonders über lange Zeit andauernde traumatische Ereignisse beeinflussen den Hippocampus und die Amygdala. Ihr Volumen verringert sich. Es scheint, dass belastende Lebensereignisse neurobiologische Veränderungen hinterlassen. Getestet wurde dies unter anderem an Frauen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung (vgl. ebd., S. 194f.).
Kommt es im Alltag zu Angstreaktionen, die ein sinnvolles Ausmaß überschreiten, ist häufig Stress die Ursache. In Belastungssituationen treten ähnliche körperliche Symptome wie im Angstzustand auf. Bei hoher körperlicher Anspannung, etwa in Folge gesteigerter Erwartungsangst, können auch kleinere Stressbelastungen diese Symptome hervorrufen. Häufig werden die Symptome erst nach dem eigentlichen Ablauf der Stresssituation besonders deutlich: der Adrenalinspiegel sinkt nicht so schnell herab, und im Zustand der Ruhe können die angstauslösenden Symptome besonders intensiv an sich festgestellt werden (vgl. ebd., S. 62). Durch die ängstliche Selbstbeobachtung setzt dann ein „Teufelskreis der Angst“ ein, das heißt, es kommt zu einer positiven Rückkoppelung zwischen körperlichen Symptomen und den mit ihnen einhergehenden bewertenden Gedanken, die zusätzlich angstfördernd wirken (siehe 7.2.2.3.).
Körperliche und seelische Stressoren bewirken aber vor allem ein Gefühl der Machtlosigkeit. Unter Stress hat man das Gefühl eine Situation nicht verändern zu können, also keine Kontrolle über sie zu haben (vgl. ebd., S. 60). Dieses entspricht dem „Modell der erlernten Hilflosigkeit“, welches auch Basis einer der Theorien zur Entstehung der Depression ist. Ein diesbezüglich von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligmann durchgeführtes Experiment mit zwei Ratten sah folgendermaßen aus: beide Ratten erhielten jeweils die gleichen Stromschläge, wobei nur eine von ihnen über die Schläge Kontrolle ausüben konnte, indem sie den Strom mittels eines Hebels ausstellen konnte. Das Ergebnis war, das nur die Ratte erkrankte, die nicht in der Lage war, die Kontrolle auszuüben (vgl. ebd., S. 123f.). Es kann davon ausgegangen werden, dass Kontrollverlust regelmäßig zur Entstehung von Angst beiträgt; Methoden zur Kontrollsteigerung wirken demzufolge angstmindernd (siehe 7.2.1. sowie 7.2.2.).
Stress ist allerdings nicht die einzige Ursache der Entstehung von pathologischer Angst. Verschiedene Entstehungstheorien aus psychoanalytischer, lerntheoretischer und kognitiver Richtung beeinflussen die heute aktuelle therapeutische Umgehensweise mit Angsterkrankungen. Die Psychoanalyse hat sich als Erste ausführlich mit der Entstehung von Angst beschäftigt und sieht in der Trennungsangst des Kindes, das unter mangelnder Liebe, einem Trauma oder gehäuften Frustrationen leidet, einen bedeutenden Faktor. Übermäßige Bindungen, symbiotische Abhängigkeit führe ebenso zur Ausgestaltung der Trennungsangst wie reale Trennungssituationen (vgl. Flöttmann 2005, S. 13f.). Weitere Ursachen von Angst seien ungelöste Triebkonflikte im Sinne Freuds; sexuelle Bedürfnisse die sich nicht mit dem Über-Ich vereinen lassen und bei Zutage treten mit Bestrafung bedroht werden. Da die Triebwünsche unbewusst sind, spürt der Betroffene lediglich die Angstsymptomatik (vgl. Bandelow 2006, S. 143f.).
Im Gegensatz zu den folgenden Ansätzen, hat die Psychoanalyse heute in der Behandlung von Angstpatienten eine untergeordnete Rolle eingenommen. Kognitiv-verhaltenstherapeutische Methoden haben sich durchgesetzt, was allerdings nicht gleichzusetzen ist mit der Annahme, dass die Lerntheorie als einzige Ursachenerklärung für die Entsehung von Angst heranzuziehen ist (vgl. ebd., S. 122). Aus der Kognitiven Angsttheorie folgen Schlüsse über die Bedeutung der subjektiven Bewertung einer Situation auf Basis bestehender, in der frühen Kindheit erworbener, kognitiver Schemata (vgl. Fröhlich 1998, S. 58f.). Manifeste Wahrnehmungsverzerrungen entstehen aus sich selbst verstärkenden Bewertungen einer Situation oder eines Reizes, weshalb therapeutische Interventionen vorwiegend auf die Veränderung eben dieser Bewertungsmaßstäbe abzielen (siehe 7.2.1.) um den Teufelskreis aufzulösen (vgl. Linehan 1996a, S.177).
In der Lerntheorie wird davon ausgegangen, dass emotionale Abwehrreaktionen durch klassische Konditionierung im Sinne Pawlows an ursprünglich neutrale Reize gekoppelt werden (Anblick eines harmlosen Haustieres). Die Angst wird durch Reizgeneralisierung zudem auf andere, ähnliche Gegenstände übertragen (Tiere mit Fell). Die Tendenz zur vermeidenden Flucht sei auf die operante Konditionierung zurückzuführen, da eine erfolgreiche Flucht das Erregungsniveau schlagartig senke und als Gewohnheitsreaktion andere Erfahrungen ausschließe (vgl. Fröhlich 1998, S. 58). Die Entstehung von Angst basiere also auf fehlerhaften Lernprozessen. Eine verhaltenstherapeutische Therapie setzt an diesem Punkt an: die gelernten Ängste werden wieder abtrainiert.
Nicht jede Angst kann aber konditioniert werden, gleichzeitig sind viele Ängste scheinbar prädestiniert für eine Konditionierung. Besonders im Bereich spezifischer Phobien wird dies deutlich, so Bandelow (2006, S. 170):
Phobien entwickeln sich vor Dingen, die heute harmlos sind, in der Urzeit aber bedrohlich waren – wie Spinnen. Sie entwickeln sich nicht vor Dingen, die heute gefährlich sind, die es früher aber nicht gab – wie Steckdosen. Und sie entwickeln sich nicht vor Dingen, die früher harmlos waren und es heute auch noch sind – wie Gänseblümchen.
Es scheint also angeborene oder in unserem Gehirn vorprogrammierte Ängste zu geben, die in typischen Situationen leichter gelernt werden können, die aber auch ohne das Durchleben einer bestimmten Erfahrung entstehen können und in diesem Falle nicht konditioniert sind (vgl. ebd., S. 168). Eine wichtige Komponente beim Erlernen von ängstlichem Verhalten ist hierbei immer die individuelle und anlagebedingte Hemmschwelle für Angstreaktionen, die durch bestimmte Lebenserfahrungen noch herabgesetzt werden kann.
Zusammenfassend ist demnach zu bemerken, dass die Lerntheorie nicht überwiegend für die Entstehung von Ängsten heranzuziehen ist, wohl aber für die Begründung der Aufrechterhaltung von Ängsten. So kann eine Panikattacke spontan entstehen, das auf die Panikattacke folgende Vermeidungsverhalten aber, welches die eigentliche Einschränkung im Leben darstellt, ist Objekt eines Lernvorganges (vgl. ebd., S. 175).
2.3. Wie äußert sich Angst
Angst äußert sich immer auf vier Ebenen; einer körperlichen, einer gedanklichen, einer gefühlsmäßigen sowie auf der Ebene des Verhaltens. Die Ausprägung der Ebenen ist dabei individuell unterschiedlich. Körperliche Symptome sind teilweise erst Auslöser der gedanklichen und gefühlsmäßigen Einschätzung und des daraus resultierenden Verhaltens (vgl. Alsleben et al., S. 63).
Typische körperliche Symptome (Angstäquivalente) sind unter anderem: Schwindel, Schweißausbrüche, Muskelverspannungen und –krämpfe, Heißhunger, innere Unruhe, Mundtrockenheit, Reizbarkeit, Herzklopfen, Herzschmerzen, Arrhythmie, Zittern, Kribbeln auf der Haut, Magenbeschwerden und Atembeschwerden. Die zahlreichen Beschwerden, die ursprünglich nur den Körper auf den Kampf oder die Fluchtreaktion vorbereiten sollen, verdeutlichen, wie es dazu kommen kann, dass allein ihr Auftreten einen Angstanfall konstituieren kann. Besonders häufig beschreiben Patienten die Angst, aufgrund des Schwindels in Ohnmacht zu fallen, wegen der Unregelmäßigkeit des Herzschlages einen tödlichen Herzanfall zu erleiden oder an Atemnot zu ersticken. Dementsprechend verstärkt sich die Angst, und überwältigende Hilflosigkeit oder das Gefühl, verrückt zu werden tritt an die Stelle der regulierenden Verstandesfunktion (vgl. Flöttmann 2005, S. 25ff.).
Auf der Verhaltensebene löst Angst im Regelfall ein systematisiertes Vermeidungsverhalten aus, welches Gefahr läuft von der ursprünglich angstauslösenden Situation auf zahlreiche ihr ähnliche Situationen ausgeweitet zu werden. Missglückte Versuche, sich dem Objekt der Angst zu nähern, machen die Angst davor noch stärker. Folge ist zwangsläufig ein eingeschränkter Handlungs- und Lebensradius (vgl. ebd., S. 28).
2.4. Ab wann Angst krankhaft wird
Es gibt natürlich keine allgemeingültige Regel, ab wann Angst krankhaft wird. Die Übergänge sind wie bereits erwähnt fließend und Angst an sich stellt noch keine krankhafte Reaktion dar. Grundsätzlich kann aber festgestellt werden, dass Angst immer dann pathologisch wird, wenn sie in besonderem, das allgemeine Ausmaß übertreffendem Maße, die Lebensqualität einschränkt. Das tut sie regelmäßig, wenn
- sie unangemessen stark ist
- sie zu häufig und zu lange auftritt
- man das Gefühl hat die Kontrolle zu verlieren
- man Angstsituationen häufig vermeidet oder aus ihnen flüchtet („Angst vor der Angst“)
- man einen starken Leidensdruck verspürt (Alsleben et al. 2004, S. 66)
Weitere Hinweise sind, wenn ständiges Nachdenken über die Angst dazu führen, das man das Leben dementsprechend umstellt. Wenn man sich depressiv und niedergeschlagen fühlt, vermehrt zu Alkohol oder Beruhigungsmitteln greift, Probleme in Partnerschaft oder Beruf entstehen oder Selbstmordgedanken als Lösungsversuch in Betracht gezogen werden (vgl. Bandelow 2006, S. 355).
2.5. Angsterkrankungen im Überblick
Die wichtigsten Angsterkrankungen sollen im Folgenden nach Meermann und Okon (vgl. 2006, S. 16-21) kurz dargestellt werden:
Spezifische Phobie (ICD-10 F40.2): Die Angst vor einem klar erkennbaren Objekt oder einer Situation, wobei die Konfrontation regelmäßig zur Ausbildung einer vorhersagbaren Angstreaktion führt. Auslöser Spezifischer Phobien sind zumeist Tiere (vorwiegend Insekten), Naturgewalten (Sturm, Wellen, Wasser), Blut und Injektionen oder situative Momente (Fahrt im Fahrstuhl oder Flugzeug).
Panikstörung (ICD-10 F41.0): Die Panikstörung zeichnet sich durch schwere, spontan auftretende Angstattacken aus, die mit gravierenden körperlichen Symptomen, und folglich häufig mit der Angst zu sterben, einhergeht. Starke Tendenz zur Vermeidung von Situationen, in denen eine Panikattacke befürchtet wird führt zur häufigen Kombination der Panikstörung mit der Agoraphobie.
Agoraphobie (ICD-10 F40.0): Unter Agoraphobie wird die Furcht vor Menschenmengen, öffentlichen Plätzen oder dem Reisen ohne Begleitung in Zügen, Bussen und Pkw’s verstanden. Jede größere Distanz vom Heimatort schürt zudem die Angst, im Falle einer Panikattacke nicht weitreichend versorgt werden zu können. Psychische Symptome wie Schwindel und Schwäche, aber auch Derealisations- und Depersonalisationserleben (siehe 4.5) gehen mit der Erkrankung einher. Massive Einschränkungen im sozialen Leben (etwa Erreichen des Arbeitsplatzes) sind Folgen der häufig chronisch verlaufenden Agoraphobie.
Generalisierte Angststörung (ICD-10 F41.1): Die Generalisierte Angststörung ist zumeist durch eine weniger schillernde Symptomatik gekennzeichnet. Leitsymptome wie Nervosität, Zittern, Schwitzen zeigen sich allerdings länger anhaltend. Es besteht die starke Tendenz, sich über alles Sorgen zu machen oder sich in Vorahnungen bezüglich schlimmer Ereignisse zu verlieren.
Soziale Phobie (ICD-10 F40.1): Die Soziale Phobie zeigt sich vorwiegend im Kontakt mit kleineren Gruppen oder im Einzelkontakt, da in diesen Situationen Angst vor der Bewertung durch andere Menschen ansteigt. Vermeidung bestimmter sozialer Situationen ist regelmäßige Folge.
3. Borderline-Persönlichkeitsstörung
Die Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung wird in der Gesamtbevölkerung auf etwa 2% geschätzt, wobei die Häufigkeit innerhalb der klinischen Population bei etwa 10-20% liegt. Etwa zu 75% wird die Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Frauen diagnostiziert, was auf gravierende geschlechtsspezifische Unterschiede hinweist. Unklar ist hierbei aber weitgehend, inwiefern diagnostische Vorurteile das Überwiegen der Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Frauen ausmachen (vgl. Akthar 2001, S. 374).
Zum einleitenden Verständnis wird zunächst die Borderline-Persönlichkeitsstörung anhand eines geschichtlichen Rückblickes, sowie aktueller Diagnosekriterien der Klassifikationssysteme DSM-4 und ICD-10 dargestellt. Abschließen wird das Kapitel in der Darstellung relevanter Theorien zur Genese der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hier werden sich auch Hinweise auf mögliche Ursachen einer höheren Prävalenz der Erkrankung innerhalb der weiblichen Bevölkerung finden (siehe 3.3.6.).
Im Fachlexikon der Sozialen Arbeit wird darauf hingewiesen, dass der Begriff der Borderline-Störung sich ursprünglich auf ein „Grenzgebiet“ zwischen Neurose und Psychose bezog. Tatsächlich war sie lange Zeit ein Grenzfall, wie der Begriff „Borderline“ (genauer: Grenzlinie) sagt, und dadurch definiert, „was sie nicht ist, nämlich nicht mehr Neurose und noch keine Psychose.“ (Möhlenkamp 2005, S. 9)
Im Folgenden definiert das Fachlexikon der Sozialen Arbeit Personen mit Borderline-Störung als emotional instabil, mit wechselhafter, launischer Stimmung und einem unsicheren, diffusen Selbstbild. Sie zeigen eine geringe Impulskontrolle einhergehend mit selbstschädigenden Tendenzen, Selbstverletzungen und Suizidversuchen. Betont wird der zentrale Abwehrmechanismus der Spaltung, ein frühkindlicher Mechanismus zur intrapsychischen Trennung von unvereinbaren positiven und negativen Selbst- und Objektrepräsentanzen, vermutlich entstanden durch frühe Traumatisierungen; dem Kind war es nicht möglich, stabile und vorwiegend positiv belegte innerseelische Bilder der Bezugspersonen und seiner Selbst auszubilden (vgl. Zimmermann 2002, S. 162). In der 2. Auflage der Neuausgabe des psychiatrischen Standartwerkes „Irren ist menschlich“ (2004) werden weiterhin die Psychose und die Neurose als Grenzländer beschrieben, die das Phänomen ‚Borderline’ umgeben. Die Grenzgänger selbst als Menschen, die „Entspannung, Harmonie, Nähe nicht aushalten, gleichzeitig auf der Suche (sind)“ und als Menschen, „die überall Ablehnung erfahren, deren Gier unstillbar ist, die auf Frustration mit (Selbst-) Aggression reagieren (und) aus gebrochenen und oft gewaltsamen Milieus kommen.“ Bei Gefahr „schaukeln (sie) sich weg, in ein anderes Grenzland.“ (Dörner et al. 2004, S.302)
3.1. Entstehung des Borderline-Begriffes
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung wurde bereits erstmalig im Jahre 1884 von Hughes unter dem Begriff „borderland“ erwähnt, was darauf schließen lässt, dass der Begriff „älter als jener der Schizophrenie (...) und wohl kaum als eine Modeerscheinung abzuwerten (ist)“ (Dulz; Schneider 1996, S. 3); Der Begriff Schizophrenie wurde tatsächlich erst im Jahre 1907, also gute 20 Jahre später, von Bleuler eingeführt (vgl. ebd.).
Unterschiedlichste Theorien und Begrifflichkeiten, deren Wurzeln sich hauptsächlich in der Psychoanalyse und der klassischen Psychopathologie finden, führten zu einer späten Einordnung der Borderline-Persönlichkeitsstörung in die Klassifikationssysteme ICD und DSM-3 (1980) (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - Diagnostisches und Statistisches Handbuch Psychischer Störungen) (vgl. Rahn 2001, S. 43).
Nach Dulz und Schneider (vgl. 1996, S.4) finden sich die Ursprünge des Borderline-Begriffes in zunächst zwei verschiedenen Strömungen. Die eine rechnete die Borderline-Störungen den Psychopathien zu, die andere den Hysterien.
Der ersteren wurde sie zugeordnet, da man viele Kriterien der Borderline-Störung in den 1916 von Bleuler aufgestellten Charakteristiken einer psychopathischen Persönlichkeit wiederfand, wie etwa, die Wut- und Angstanfälle der „Erregbaren“, die Abhängigkeit von momentanen Einflüssen der „Haltlosen“ oder die fehlende Einheitlichkeit im Seelenleben der „Verschrobenen“, um nur einige Beispiele zu nennen. Der Begriff „Psychopath“, der sich hieraus ergab, schloss sicherlich höchste Entwertung mit ein (vgl. ebd.).
Der anderen Strömung zuzuordnen sind unter anderem Freud und Reich, ein Schüler Freuds. Freud beschreibt 1893 in seinem und Breuers Werk „Studien über Hysterie“ einige Fälle, die aus heutiger Sicht als Borderliner bezeichnet werden würden (vgl. ebd.). Die heutige Borderline-Konzeption konnte aber nicht direkt auf Freud zurückgeführt werden, obwohl dieser bereits zentrale Begriffe, wie die Ich-Spaltung prägte (vgl. Kind 2001, S. 27). Einen Schritt weiter in Richtung Differenzierung zwischen Hysterie und Borderline-Störung ging erst sein Schüler Reich, der sogenannte „Grenzfälle“ in seinem Werk „Der triebhafte Charakter“ beschreibt (vgl. Dulz; Schneider 1996, S. 5). Die hieraus entstandene differenzierte Betrachtung der Hysterie, ursprünglich ein Ausdruck für alle durch emotionale Konflikte ausgelöste Störungen, benennt Rahn (vgl. 2001, S. 43) als den Ursprung des Borderline-Begriffes in der Psychoanalyse.
1934 prägt Helene Deutsch den Begriff der „Als-ob“-Persönlichkeit in einer Patientenbeschreibung, die später der Borderline-Störung zugeordnet wurde (vgl. Kind 2001, S. 31). „Als-ob“-Persönlichkeiten scheinen in ihrer emotionalen Reaktion kraftlos, sind passiv in Beziehungen und fehlende stabile Objektbindungen führen zu Identitätsstörungen; es ist „so als ob sich etwas zwischen ihnen und den anderen Menschen befände.“ (Grinberg 2001, S. 277) Kernberg (vgl. 1983, S. 23) bezeichnete die Arbeiten von Helene Deutsch als den ersten wichtigen Beitrag zum Verständnis der Borderline-Struktur und ihrer verinnerlichten Objektbeziehungen.
1938 erscheint der erste umfassende Bericht mit dem Titel „border line group of neuroses“ von Adolph Stern, ein noch heute gültiger Artikel über Borderline-Störungen (vgl. Dulz; Schneider 1997, S. 5). Erstmalig wird tatsächlich der Begriff „Borderline“ als nosologisch, das heißt systemisch krankheitsbeschreibend, von Stern verwandt (vgl. Herpertz; Saß 2001, S. 115). Gleichzeitig enthält die Arbeit bereits viele grundlegende, wenn auch noch nicht theoretisch fundierte, Elemente der heutigen Borderline-Konzeption in Bezug auf die Ich-Psychologie und die Objektbeziehungstheorien. Sie sei, so Kind (2001, S. 31), „der eigentliche Beginn der psychoanalytischen Borderline-Ära.“
Aus seiner therapeutischen Ansatzweise heraus entwickelt Stern wesentliche Charakteristika der Borderline-Störung, wie die Projektion des allmächtigen Objektes, die Angst bei Irritationen dieses Objektes durch ein Fehlverhalten des Therapeuten, der Wechsel des guten in ein feindseliges Objekt und die psychotische Regression und gestörte Realitätsprüfung begrenzt auf die therapeutische Übertragungssituation (vgl. ebd.).
Die Arbeiten Kernbergs:
Als der eigentliche Beginn einer Theoriebildung jedoch stehen in der Fachliteratur die Arbeiten Kernbergs in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts (vgl. Möhlenkamp 2005, S. 10). Seine Definition der Borderline-Persönlichkeitsorganisation „beeinflusste gemeinsam mit den Kriterien von Gunderson und Singer sehr wesentlich das Team der für das DSM-3 verantwortlichen Diagnostiker.“ (Stone 2001, S. 3)
Kernberg trug wesentlich dazu bei, dass sich „zwischen den beiden klassischen Polen Neurose und Psychose ... ein eigenständiger dritter Weg (entwickelte)“ (Kind 2001, S. 28). Ursprung seines Konzeptes war die intrapsychische Suche, im Gegensatz zur symptomorientierten Suche. Er gruppierte die heterogene Gruppe der Borderliner um das Phänomen Spaltung und schaffte so eine Einheitlichkeit (vgl. ebd. S. 32), bei der die „endgültige Diagnose ... nicht von der deskriptiven Symptomatik ..., sondern vom Nachweis der charakteristischen Ichstörung (abhängt).“ (Kernberg 1983, S. 26).
Eine spezifische Ich-Störung beeinflusst laut Kernberg den gesamten psychischen Apparat in pathogener Weise, wobei der Kern dieser Störung in der „Unfähigkeit zur Entwicklung reiferer Abwehrmechanismen, vor allem der Verdrängung ...“ (Rohde-Dachser 2004, S. 63) liegt, und durch archaische und vom Ich aktiv eingesetzte Abwehrmechanismen ersetzt wird. Durch die Spaltung werden nicht integrierbare Ich-Zustände um den Preis der Realitätsverleugnung separiert, was eine korrespondierende Spaltung der Selbstrepräsentanz beinhaltet und somit der Bildung einer stabilen Ich-Identität im Wege steht.
Kernberg unterscheidet zwischen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und einer Borderline-Persönlichkeitsorganisation im weiteren Sinne (vgl. Clarkin; Dammann 2001, S. 125), die in seiner Klassifikation neben der psychotischen und der neurotischen Persönlichkeitsorganisation steht (vgl. Kernberg 2006, S. 30f.). Kern der BPO (Borderline-Persönlichkeitsorganisation), unter die er neben der Borderline-Persönlichkeitsstörung die schizoide, die schizotypische, die paranoide, die narzisstische sowie die antisoziale Persönlichkeitsstörung und die Hypochondrie ordnet, ist eine diffuse Identität und die Ausbildung von überwiegend primitiven Abwehrmechanismen, vorwiegend, wie bereits erwähnt, dem Abwehrmechanismus Spaltung (vgl. ebd., S. 32f.).
In seinem Werk „Borderline-Störungen und pathologischer Narzißmus“ schreibt er 1983 (S. 22):
Der Ausdruck ‚Borderline’ sollte jedoch nach meiner Auffassung nur auf solche Patienten angewendet werden, bei denen eine chronische Charakterorganisation besteht, die ihrer Art nach weder typisch neurotisch, noch typisch psychotisch genannt werden kann und die gekennzeichnet ist durch
1. bestimmte typische Symptomkomplexe
2. eine typische Konstellation von Abwehrmechanismen des Ichs
3. typische Störungen im Bereich der verinnerlichten Objektbeziehungen und schließlich
4. charakteristische genetisch-dynamische Besonderheiten
Eine Unterscheidung zwischen Selbst- und Objekt ist weitgehend möglich, was eine grundsätzliche Realitätsüberprüfung gewährleistet, im Gegensatz zur psychotischen Persönlichkeitsorganisation. Die Fähigkeit ambivalente Beziehungen zu anderen zu integrieren und sie nicht in idealisierte oder verfolgende Objekte aufzuspalten ist dagegen nicht gegeben, weshalb er von fehlenden Entwicklungsschritten zur Bildung einer integrierten Ich-Identität ausgeht (vgl. Kernberg 2006, S. 32, 25). Im Bereich enger zwischenmenschlicher Beziehungen gibt es keine stabilen Ich-Grenzen (vgl. Kernberg 1983, S. 62).
Vereinfacht ausgedrückt bewirkt eine mangelnde Selbst- und Objektrepräsentanz die emotionale Unfähigkeit sich Selbst und nahe Bezugspersonen als eigenständige Individuen anzusehen, die sowohl gute als auch schlechte Eigenschaften in sich vereinen (vgl. Sender 2005, S. 22).
Gerade die Abwehrmechanismen und die primitiven Objektbeziehungen haben das Interesse Kernbergs (vgl. Z. Psychotherapie im Dialog 4/2000, S. 84) geweckt, die strukturelle Ebene der Diagnostik, welche in den Klassifikationssystemen kaum Bedeutung findet, und so kritisiert er ebenda die enge Orientierung am äußeren Verhalten, die seiner Meinung nach je nach Persönlichkeitsstruktur unterschiedliche Funktionen haben kann (vgl. Kernberg 2006, S. 19). Weiterführendes zu den Abwehrmechanismen siehe Kapitel 5.
Die Arbeiten Gundersons:
Neben Kernberg waren die Ausführungen von Gunderson mitbegründend für die Erstellung der DSM Kriterien. Die „Vielfalt der Symptome (wurde) zum Anlaß (!) genommen, eine Entwicklung geeigneter diagnostischer Kriterien zur Abgrenzung der Borderline-Störung gegen andere Krankheitsbilder vorzunehmen“ (Dulz 2001a, S. 57) Es ist die bereits 1975 von Gunderson entwickelte sechs Kriterien umfassende Liste zur Grundlage der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die letztendlich dazu führt, dass der Diagnose ein offizieller Status durch die Aufnahme in das DSM 3 verliehen wird (vgl. Akhtar 2001, S. 374):
1) intensive Affekte, gewöhnlich feindselig oder depressiv
2) eine Geschichte von Impulshandlungen
3) eine gewisse soziale Angepasstheit
4) kurze psychotische Erlebnisse
5) unzusammenhängendes Denken in unstrukturierten Situationen
6) Beziehungen, die zwischen flüchtiger Oberflächlichkeit und intensiver Abhängigkeit schwanken (Leichsenring 2003, S. 12) Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass kurze psychotische Erlebnisse in den Kriterienkatalog nach Gunderson bereits mit aufgenommen werden. Im DSM findet man sie erst seit 1994 in der 4. Version (vgl. ebd., S. 17).
Auf Grundlage dieser Kriterien entwickelten Gunderson und Kolb das DIB, das „Diagnostic Interview for Borderlines“ mit den folgenden fünf Bereichen, seit 1985 in deutscher Übersetzung vorliegend (vgl. Dulz, Schneider 1996, S. 6):
1. Soziale Anpassung
2. Impulshandlungsmuster
3. Affekte
4. Psychose
5. Zwischenmenschliche Beziehungen (Leichsenring 2003, S. 13)
Es handelt sich um ein halbstrukturiertes, im Originalzustand (es erfolgte eine Revidierung, das BIB-R, in der u. a. der erste Bereich aufgrund geringer Trennschärfe entfiel) 134 Fragen umfassendes Interview zur Diagnostik der Borderline-Störung (vgl. Eckert; Biermann-Ratjen 2001, S. 607). Durch Selbsteinschätzung und Beschreibung konkreter Erfahrungen des Betroffenen kann die Schwere der Symptomatik mit Skalenwerten belegt werden und durch die Aufsummierung der Werte erhält man einen DIB-Gesamtwert, welcher über das Vorliegen der Störung bestimmt (vgl. Leichsenring 2003, S. 13).
Zur Relevanz des DIB gibt es unterschiedliche Auffassungen, so ist es nach Leichsenring (2003, S. 13) das „wohl am besten untersuchte und am häufigsten verwendete Instrument zur Diagnostik der Borderline-Störung.“ Auf der anderen Seite wird ein Bedeutungsverlust des DIB-R betont, unter anderem aufgrund der schlechten Abgrenzung zu den affektiven Störungen (vgl. Clarkin; Dammann 2001, S. 132).
Borderline-Störung – eine Persönlichkeitsstörung
Die heute aktuelle Sichtweise ordnet die Borderline-Störung den Persönlichkeitsstörungen zu. Die Symptomatik der betroffenen Personen mag sich zwischen Neurose und Psychose ansiedeln, es zeigen sich „unterschiedlichste Symptome und Symptom-Kombinationen“ (Dulz; Schneider 1996, S. 5). Die hinter der Symptombildung stehenden und sie bedingenden Störungen sind aber von größerer Kontinuität und sie entwickeln sich über einen längeren Zeitraum. Folglich wurde die Borderline-Störung schließlich als Persönlichkeitsstörung betrachtet (vgl. Rahn 2001, S. 44).
Der Begriff „Persönlichkeitsstörung“ seinerseits ist „rein beschreibend“ (Bronisch et al. 2002, S. 14) und löste die Begriffe „Psychopathie“ und „Charakterneurose“ ab. In psychoanalytischer Geschichte verstand man unter diesen Begriffen in Abgrenzung zur „Symptomneurose“ jene Patienten, „bei denen die psychische Störung Teil der Gesamtpersönlichkeit geworden ist.“ (Clausen et al. 1997, S. 92) Trotz dieser Zuordnung ist die Borderline-Störung weiterhin kein einheitlicher Begriff und eine allgemeingültige Definition lässt sich nicht finden. Vielmehr stehen verschiedene Konzepte zum Begriff „Borderline“ im Raum mit denen unterschiedliche diagnostische Merkmale verbunden sind.
Nach Leichsenring (vgl. 2003, S. 8) gehören vier Konzepte zu den heute relevanten: Das Konzept der „Borderline-Schizophrenie“, der „Borderline-Persönlichkeitsstörung des DSM“, der „Borderline-Persönlichkeitsstörung“ nach Gunderson et al., und der „Borderline-Persönlichkeitsorganisation“ nach Kernberg. Die beiden letzteren wurden weiter oben bereits genauer erläutert.
Die „Borderline-Persönlichkeitsstörung des DSM“ findet im nächstfolgenden Abschnitt über die Einordnung des Borderline-Begriffes in die Klassifikationssysteme Beachtung und ist zudem eine Mischung aus dem Konzept von Kernberg und Gunderson. Ob ein Betroffener als „Borderliner“ bezeichnet wird, hängt in jedem Falle davon ab, welche Kriterien angewendet werden (vgl. Stone 2001, S. 3f).
3.2. Borderline-Persönlichkeitsstörung in den Klassifikationssystemen
Die wichtigsten Kriterienkataloge, die heute aktuelle amerikanische Klassifikation DSM-4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) und die WHO-Klassifikation ICD-10 (International Classification of Diseases), sollen im folgenden Abschnitt erläutert werden. Eine ausführliche Darstellung der Diagnose-Kriterien des DSM-4 wird das Störungsbild erklären. Grundlage beider Kataloge sind so klar wie möglich abgrenzbare und beschreibbare Kriterien einer Störung, um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit zu erreichen (vgl. Rohde-Dachser 2004, S. 187). Psychodynamische und strukturelle Gesichtspunkte werden nicht integriert.
Beide Kataloge weisen eine Reihe von Persönlichkeitsstörungen auf, deren gemeinsame Merkmale nach dem ICD-10 darin liegen, dass „die charakteristischen und dauerhaften inneren Erfahrungs- und Verhaltensmuster der Betroffenen insgesamt deutlich von kulturell erwarteten und akzeptierten Vorgaben (‚Normen’) (abweichen).“ (Dilling 2006, S. 151) Die Abweichungen zeigen sich in den Bereichen Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung sowie der Art des Umgangs mit anderen und der Handhabung zwischenmenschlicher Beziehungen (vgl. ebd.).
Ähnlich im DSM-4 (Saß et al. 2003, S. 750): „Nur dann, wenn Persönlichkeitszüge unflexibel und unangepasst sind und in bedeutsamer Weise zu Funktionsbeeinträchtigungen oder subjektivem Leiden führen, bilden sie eine Persönlichkeitsstörung.“
Wesentliche Merkmale aller Persönlichkeitsstörungen sind:
A. ein andauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, das merklich von den Erwartungen der soziokulturellen Umwelt abweicht. Dieses Muster manifestiert sich in mindestens zwei der folgenden Bereiche:
1) Kognition (also die Art, sich selbst, andere Menschen und Ereignisse wahrzunehmen und zu interpretieren,
2) Affektivität (also die Variationsbreite, die Intensität, die Labilität und Angemessenheit emotionaler Reaktionen),
3) Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen
4) Impulskontrolle
B. Das übergreifende Muster ist unflexibel und tiefgreifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen
C. Das übergreifende Muster führt in klinisch bedeutsamer Weise zu Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen
D. Das Muster ist stabil und langdauernd, und sein Beginn ist zumindest bis in die Adoleszenz oder in frühe Erwachsenenalter zurückzuverfolgen
E. Das überdauernde Muster lässt sich nicht besser als Manifestation oder Folge einer anderen psychischen Störung erklären
F. das überdauernde Muster geht nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz (z. B. Droge, Medikament) oder eines medizinischen Krankheitsfaktors (z. B. Hirnverletzung) zurück. (ebd., S. 753f.)
Es handelt sich bei Persönlichkeitsstörungen um im frühen Erwachsenenalter auftretende und durch das Verhalten gekennzeichnete Erkrankungen. Grundsätzlich sind viele der Verhaltensweisen oder -muster Nicht-Betroffenen ebenfalls bekannt; eine geringere Ausprägung und Persistenz führt aber zu keiner gravierenden Beeinträchtigung in der Lebensführung (vgl. Sender 2005, S. 7).
3.2.1. Borderline-Persönlichkeitsstörung im DSM-4
Die Borderline Persönlichkeitsstörung reiht sich im DSM-4 unter insgesamt 11 Persönlichkeitsstörungen, welche jeweils einer von drei Hauptgruppen, sogenannten Chlustern, zugeordnet sind:
- Chluster A: die paranoide, schizoide und schizotypische Persönlichkeitsstörung. Personen mit diesen Störungen werden häufig als sonderbar und exzentrisch bezeichnet.
- Chluster B: die histrionische, narzistische, antisoziale und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Häufig als dramatisierend, emotional oder launisch beschrieben.
- Chluster C: die selbstunsichere, abhängige, zwanghafte Persönlichkeitsstörung. Ängstlich und furchtsam erscheinen die Betroffenen. (Bronisch 2002, S. 22)
Innerhalb dieser Chluster-Kategorien werden bestimmte Diagnosen mit Hilfe von Prototypen dargestellt; eine kategoriale Erfassung von Merkmalen und deren Einordnung entsprechend der gegebenen Prototypen ermöglicht letztendlich die Diagnosestellung (vgl. ebd.).
Im DSM-4 werden neun Kriterien zur Borderline-Persönlichkeitsstörung aufgeführt, von denen mindestens fünf nachweisbar sein müssen, um eine Diagnose zu stellen (Saß et al. 2003, S. 777):
Ein tiefgreifendes Muster von Instabilität in zwischenmenschlichen Beziehungen, im Selbstbild und in den Affekten sowie von deutlicher Impulsivität. Der Beginn liegt im frühen Erwachsenenalter und manifestiert sich in den verschiedenen Lebensbereichen. (...)
(1) verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden. Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.
(2) Ein Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist.
(3) Identitätsstörung: ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung.
(4) Impulsivität in mindestens zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgaben, Sexualität, Substanzmissbrauch, rücksichtsloses Fahren, „Fressanfälle“). Beachte: Hier werden keine suizidalen oder selbstverletzenden Handlungen berücksichtigt, die in Kriterium 5 enthalten sind.
(5) Wiederholte suizidale Handlungen, Selbstmordandeutungen oder –drohungen oder Selbstverletzendes Verhalten
(6) Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (z. B. hochgradige episodische Dysphorie, Reizbarkeit oder Angst, wobei diese Stimmungen gewöhnlich einige Stunden und nur selten mehr als einige Tage andauern).
(7) Chronische Gefühle von Leere.
(8) Unangemessene heftige Wut oder Schwierigkeiten, die Wut zu kontrollieren (z. B. häufige Wutausbrüche, andauernde Wut, wiederholte körperliche Auseinandersetzungen).
(9) Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder dissoziative Symptome.
Zu (1): Die Angst vor dem Alleinsein steht in direktem Zusammenhang mit der Angst verlassen zu werden, denn verlassen werden bedeutet, dass man „böse“ ist. Auch zeitlich begrenzte Trennungen werden als Zurückweisung erfahren und können intensive Ängste aber auch Wut hervorrufen (vgl. ebd. S. 773). Auch die Angst vor Leere und Langeweile (Kriterium 7) steht im engen Zusammenhang mit der Angst vor dem Alleinsein. Man fürchtet sich nicht direkt davor allein zu sein, weil einem etwas von außen zustoßen könnte. Es ist vielmehr die Angst davor, mit sich allein zu sein. Es ist „die Angst, sich in sich selbst zu verlieren.“ (Knuf et al. 2004, S. 14) Die Angst vor dem Alleinsein wird als eine der Grund-Ängste der Borderline-Persönlichkeit an anderer Stelle näher erläutert (siehe 6.3.).
Zu (2): Beziehungen von Personen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung sind intensiv, aber instabil. Intensiv, da sie sich zunächst einer idealisierten Person nähern, die all ihren Wünschen und Bedürfnissen entgegenzukommen scheint. Diesem bedürfnisbefriedigendem Objekt können sie sich auch ihrerseits fürsorglich zeigen (vgl. Saß et al. 2003, S. 773). Da sie aber häufig nicht in der Lage sind das Verhalten des Gegenübers auch in Zwischentönen zu sehen und die Menschen in ihrer nahen Umgebung in „gut“ oder „böse“ einteilen, kann ein dem entgegenstehendes Verhalten einer „guten“ Bezugsperson nicht im Kontext der Situation gesehen werden. Kritik eines Freundes kann so zum Beispiel nur auf die gesamte eigene Person bezogen sein, unmöglich nur auf das gerade thematisierte Verhalten (vgl. Knuf 2004, S. 17).
Die Entwertung einer zuvor idealisierten Person kann unterschiedliche Zusammenhänge haben; sie dient zum einen als Ausweg aus massiver Verzweiflung über nicht-erfüllte Hoffnungen, die in eine idealisierte Person gesetzt wurden. Zum anderen ist sie eine Notbremse wenn die Nähe zu groß wird oder die Angst verlassen zu werden überwältigt.
Zu (3): Ein instabiles Selbstbild oder instabile Selbstwahrnehmung sind kennzeichnend für die Identitätsstörung. Zum Ausdruck kommt dieses im häufigen Wechsel von Wertvorstellungen, Zielsetzungen, Berufswünschen oder der sexuellen Orientierung (vgl. Saß 2003, S. 773). Wer das Gefühl hat, sich fremd zu sein oder anders zu sein, verhält sich den Erwartungen anderer entsprechend. Da jedes Gegenüber aber andere Erwartungen hat, muss das Verhalten und Erscheinungsbild häufig variiert werden. Ergebnis und Ausgangspunkt ist die Unsicherheit wer man sei, was man kann und möchte (vgl. Knuf 2004, S. 24).
Auch hier besteht eine enge Verbindung zu anderen Kriterien des DSM Kataloges; wer ein unklares Selbstbild hat, befürchtet übergroße Nähe, verbunden mit der Angst sich gänzlich zu verlieren. Gleichzeitig sucht er aber auch danach, um das eigene Verhalten an einer idealisierten Person orientieren zu können, sich nicht einsam zu fühlen und chronischer Leere, die mit dem sich fremden Selbst entsteht, zu entgehen. (Da es sich bei den Punkten 1-3 um Kerninhalte des Nähe-Distanz-Problems von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung handelt, sei an dieser Stelle auf 7.1.2.f. verwiesen).
Zu (4): Selbstschädigendes Verhalten bedeutet nicht zwingend offene Selbstverletzung oder suizidale Handlungen. Besonders in den Bereichen Geldausgaben, Süchte, risikoreiches Fahren, Essen und Sexualität kann eine hohe Impulsivität selbstschädigend sein und „an den Rand der körperlichen und seelischen Belastung führen“ (ebd., S. 17). Häufige Kontaktaufnahme zu Personen zu denen destruktive Beziehungen bestehen gehört ebenfalls in diese Kategorie (vgl. ebd., S. 16).
Zu (5): Selbstverletzendes Verhalten (SVV) ist ein kaum in wenigen Worten zu beschreibendes Phänomen; ebenso facettenreich wie die Arten der Selbstverletzung sind die Auslöser, die Folgen, die Reaktionen der Mitmenschen und die dahinter stehenden Gründe. Auslöser sind häufig drohende Trennungen oder Zurückweisungen, Überforderung durch erhöhte Eigenverantwortlichkeit (vgl. Saß et al. 2003, S. 774) oder Gefühle von Leere, Dysphorie und Hoffnungslosigkeit, in denen eine Selbstverletzung als besseres Antidepressivum wirkt. Selbstverletzungen können aber auch im Rahmen dissoziativer Zustände oder in Zuständen der Depersonalisation auftreten, in denen SVV das Gefühl von Lebendigkeit vermittelt (vgl. Sachsse 2002, S. 52).
„Auf der einfachsten Stufe (ist das SVV) ein globales Ventil für inneren ‚Druck’.“ (ebd., S. 51) Neben den bereits erwähnten Funktionen als Antidepressivum und Antidissoziativum kann das SVV als Suizidprophylaxe wirken, wobei die Betonung auf der Prophylaxe liegt, da es sich tatsächlich um eine bewusste Entscheidung zur Schädigung und nicht zur Tötung des Selbst handelt; um eine abgeschwächte Form der Autoaggression. Wenn SVV eine Kompromissbildung bei Suizidalität einnimmt, kann sie als Suizidprophylaxe angesehen werden (vgl. ebd., S. 52).
SVV kann in das Selbstkonzept integriert und mit Stolz auf die eigene Stärke und Autarkie vom Körper verbunden sein, aber auch als Bestrafung eingesetzt werden, um für das eigene Schlechtsein zu büßen (vgl. Saß et al. 2003, S. 774). Daneben hat SVV eine Reihe von interpersonellen Funktionen, die so meist unbewusst relevant werden oder bei denen unklar bleibt ob die jeweilige Funktion vom Betroffenen intendiert war oder nicht; es hat ohne Frage einen starken appelativen Charakter. Bezugspersonen verstehen es als Hilferuf oder als versteckte Anschuldigung an sie selbst, nicht genug getan zu haben, insuffizient zu arbeiten etc... (vgl. Sachsse 2002, S. 53). Es kann auch unbewusst darum gehen, eine Beziehung auf ihre Tragfähigkeit zu testen (vgl. Knuf 2004, S. 16).
Neben SVV leiden Betroffene unter Suizidgedanken, die so weit gehen können, dass sie den gesamten Alltag über lange Zeit begleiten, man also von „chronischer Suizidalität“ sprechen kann. Bei 8-10% der Betroffenen führt dies zum vollendeten Suizid (vgl. Saß et al. 2003, S. 774).
Zu (6): Die affektive Instabilität der Betroffenen ist auf eine ausgeprägte Reaktivität der Stimmung zurückzuführen; viele trauen der eigenen Wahrnehmung nicht und sind wesentlich von den Stimmungen oder dem ihnen gegenüber gezeigten Verhalten ihrer Mitmenschen beeinflusst. Hinzu kommen die nicht einordbaren eigenen Stimmungen. So können sich Borderline-Betrofffene ihre schnellen Stimmungswechsel, meist auf Basis einer dysphorischen Stimmung, oft selbst nicht erklären. Für Außenstehende vermittelt es den Eindruck als sei der Betroffene nicht echt, was ihn schwer einschätzbar macht (vgl. Knuf 2004, S. 28f).
Zu (7): Chronische Leere und Langeweile können für den Betroffenen extrem belastend und bedrohlich sein. Lässt sich keine Ablenkung finden und ein Alleinsein nicht vermeiden, kann selbstzerstörerisches Verhalten eine Möglichkeit sein, etwas in die Leere zu füllen. Dieses Gefühl wird beschrieben wie das Nichts, Haltlosigkeit, den Boden unter den Füßen zu verlieren, in ein schwarzes Loch gerissen werden, sich im freien Fall zu befinden oder bereits innerlich tot zu sein (vgl. ebd., S. 22f.).
Zu (8): Eine unangemessene Wut und die Schwierigkeit diese zu kontrollieren, extremer „Sarkasmus, anhaltende Verbitterung oder verbale Ausbrüche“ (Saß et al. 2003, S. 774), treten meistens auf wenn die Betroffenen sich von Seiten wichtiger Bezugspersonen zurückgewiesen fühlen. Die Wut kann so stark sein, dass sie die hinter ihr stehenden Gefühle, häufig Trauer, Angst oder Verzweiflung gänzlich überdeckt und ein Zugang zu diesen nur durch das Entladen der Wut möglich ist. Gerade bei Frauen richten sich die Aggressionen meistens gegen sich selbst; was dem weiblichen Umgang mit Aggressionen im Allgemeinen entspricht, und zudem aus der Angst entspringt, dass sich andere Menschen vor ihnen zurückziehen könnten; denn, viele schämen sich für ihre Wut (vgl. Knuf 2004, S. 20).
Zu (9): Paranoide Vorstellungen und dissoziative Symptome treten meist kurzweilig und unter extremen Belastungen auf (vgl. Saß 2003, S. 774). Es handelt sich um Veränderungen in der Wahrnehmung, bei denen die Realität in den Hintergrund gerät, wenn in angstbesetzten Situationen die Erinnerung echter wirkt. „Viele kennen die Angst auseinander zu fallen, zu erstarren, sich aufzulösen, neben sich zu stehen, sich zuzuschauen, oder das Gefühl, unwirklich zu sein.“ (Knuf 2004, S. 21) Gleichzeitig kann das Ausschalten der Realität als früh erworbener Schutzmechanismus in bedrohlichen Situationen angesehen werden. Dieser wirkt, verselbstständigt, seinerseits allerdings ebenso bedrohlich, da die Betroffenen ihren Realitätsbezug soweit erhalten um zu spüren, dass sie einer Sinnestäuschung unterliegen (vgl. ebd.).
Das neunte Kriterium ist im DSM-4 neu hinzugekommen. „Da stressinduzierte paranoide Vorstellungen und dissoziative Symptome sich in der Regel auf schwere traumatische Erfahrungen zurückführen lassen, ... wird im DSM-4 mit dem Kriterium 9 indirekt auch die mögliche Komorbidität der Borderline-Persönlichkeitsstörung mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung (309.81) betont.“ (Rohde-Dachser 2004, S. 194)
3.2.2. Borderline-Persönlichkeitsstörung im ICD-10
Im ICD-10 findet sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung mit der Codierung F60.31 als Borderline-Typus neben dem impulsiven Typus im Bereich der „emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung“, seinerseits Unterpunkt der „Spezifischen Persönlichkeitsstörung“.
Darstellung der Kategorie F60 des ICD 10:
F60 spezifische Persönlichkeitsstörungen
F60.0 paranoide Persönlichkeitsstörung
F60.1 schizoide Persönlichkeitsstörung
F60.2 dissoziale Persönlichkeitsstörung
F60.3 emotional instabile Persönlichkeitsstörung
.30 impulsiver Typ
.31 Borderline Typ
F60.4 histrionische Persönlichkeitsstörung
F60.5 anankastische Persönlichkeitsstörung
F60.6 ängstlich (vermeidende) Persönlichkeitsstörung
F60.7 abhängige Persönlichkeitsstörung
F60.8 sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung
F60.9 nicht näher bezeichnete Persönlichkeitsstörung
(Dilling 2006, S.42)
Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung zeichnet sich laut ICD-10 durch das Ausagieren von Impulsen ohne Berücksichtigung der Konsequenzen bei wechselhafter Laune, sowie explosivem Verhalten bei Ausbrüchen intensiven Ärgers aus. Beim Borderline Typus speziell wird eine emotionale Instabilität nebst unklarem Selbstbild und Präferenzen betont. Ein chronisches Gefühl der Leere, intensive, unbeständige Beziehungen, Suiziddrohungen und selbstschädigende Handlungen gehören ebenso in den Katalog. Die übermäßige Angst vor dem Alleinsein (im DSM an vorderster Stelle) wird im ICD-10 nicht erwähnt (vgl. Rohde-Dachser 2004, S 195f.).
3.3. Genese der Borderline-Persönlichkeitsstörung
Die Borderline-Störung hat sehr wahrscheinlich niemals nur eine Ursache; so wie bei jeder Persönlichkeitsentwicklung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle und beeinflussen die Entwicklung: Biologische Grundlagen, soziale Erfahrungen, Erziehungsverhalten der Eltern und andere Lebenserfahrungen. Ebenso die damit verbundenen angeeigneten psychischen Verarbeitungsmöglichkeiten sowie belastende und traumatische Erfahrungen und deren Bewältigung (vgl. Schäfer et al. 2006, S. 50f.).
3.3.1. Biologische Einflussfaktoren
Unter biologischen Einflüssen an der Entwicklung einer Borderline-Erkrankung versteht man genetische Faktoren sowie ungünstige Bedingungsfaktoren in der Schwangerschaft, aber auch psychiatrische Vorerkrankungen in der Familie (vgl. Sender 2005, S. 23). Grundsätzlich sind die genetischen Bedingungsfaktoren in der Ätiologie der Borderline-Störung schwer auszumachen, da sich aus den quantitativ nicht ausreichenden Familien- und Zwillingsstudien widersprüchliche Ergebnisse ableiten.
Werden allerdings der Borderline-Störung nahestehende Persönlichkeitseigenschaften für sich untersucht, weisen diese auf einen Einfluss genetischer Faktoren hin (vgl. Torgersen 2001, S. 223). So ließen sich in Zwillingsstudien bezüglich des Faktors „impulsive Aggression“ erbliche Faktoren finden: „Genetische Untersuchungen zeigen eine Veränderung des serotonergen Systems bei impulsiver Aggression.“ (Schäfer et al. 2006, S. 54) Störungen im serotonergen System betreffen direkt die Selbst- als auch Fremdaggression, da dieses System hauptverantwortlich für die Regulierung der Gefühle ist. Inwieweit allerdings die genetischen Anlagen die psychische Struktur bedingen oder auf der anderen Seite erst äußere Bedingungen zu den Veränderungen im neurochemischen System führen ist bisher ungeklärt (vgl. ebd., S. 53f.). Zumindest ergibt sich die Annahme, dass die Borderline-Störung mit einer ähnlichen Stoffwechselstörung in Verbindung stehen könnte (vgl. Kreisman; Straus 1992, S. 90).
Auch wenn es keinen Nachweis für ein spezielles Borderline-Gen gibt, gehen einige Forscher davon aus, dass die Veranlagung im Zusammenwirken mit den äußeren Umständen wie der Erziehung zu einer Borderline-Störung führen könne. Chromosomenbedingte Vulnerabilität könnte eine Rolle spielen. Möglicherweise handele es sich „um eine genetische Neigung zur Borderline-Erkrankung, bei der es sich um eine biologische Schwäche bei der Stabilisierung von Stimmungen und Impulsen handelt.“ (ebd., S. 93)
3.3.2. Borderline – eine frühe Störung
Da Frühstörungen oder auch präödipale Störungen in den ersten Lebensjahren entstehen, hat der Betroffene keine Erinnerung und keinen Einfluss auf die Entstehungsbedingungen. Basis einer Frühstörung ist der Umstand, dass bestimmte wichtige innerpsychische Strukturen im Rahmen der Identitätsentwicklung nicht entwickelt werden können; man spricht auch von einer „Strukturpathologie“ (vgl. Röhr 2006, S. 147). Es gibt allerdings auf die Frage, warum eine Person eine Borderline-Störung bekommt, keine eindeutigen Antworten. Rohde-Dachser (2004, S. 115) ist der Auffassung, dass trotz der Uneindeutigkeit und sogar der Zweifel vieler Autoren an einer ganz spezifischen Genese der Borderline-Störung, doch meistens „stillschweigend oder explizit vorausgesetzt (wird), dass das Borderline-Syndrom aus einer frühen und tiefgreifenden Störung der Mutter-Kind-Beziehung resultiere.“
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836618656
- Dateigröße
- 668 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Kiel – Soziale Arbeit und Gesundheit, Studiengang Sozialwesen/Sozialpädagogik
- Erscheinungsdatum
- 2014 (April)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- psychische erkrankung borderline wohnform angst
- Produktsicherheit
- Diplom.de