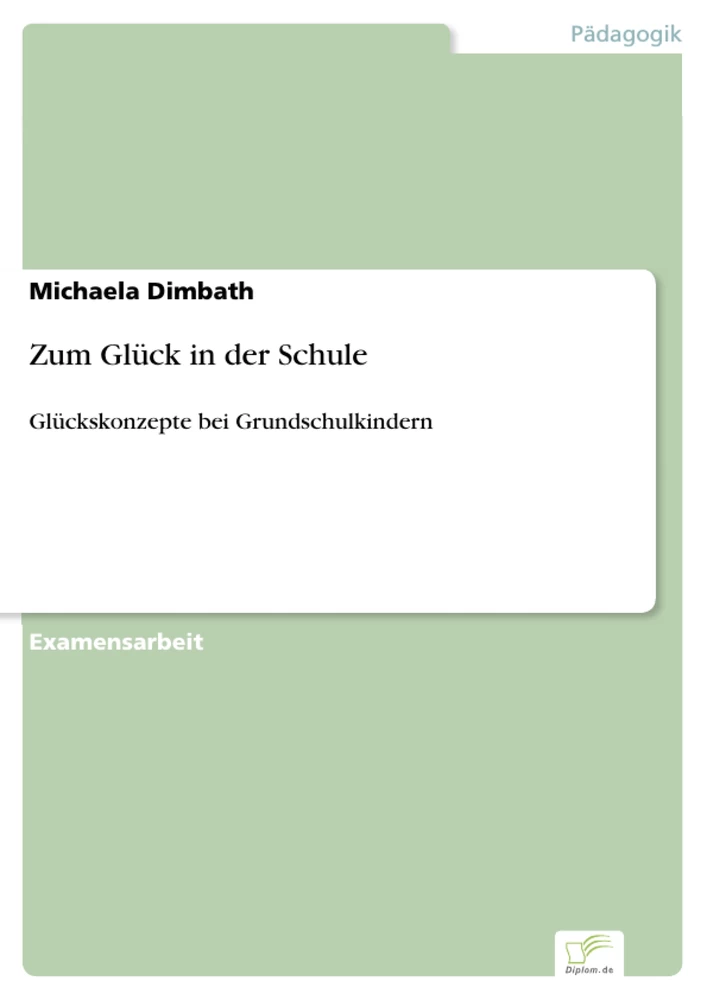Zum Glück in der Schule
Glückskonzepte bei Grundschulkindern
©2003
Examensarbeit
116 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Glücklichen Inseln hinter dem Wind. Wenn man dem Autor James Krüss, oder besser seinem Kapitän Daworin Madirankowitsch, Glauben schenken darf, dann werden auf ihnen alle Menschen und alle Tiere glücklich. Wie kann man sie finden, wenn sie auf keiner Landkarte verzeichnet sind? Wo sonst, wenn nicht auf den beschriebenen Inseln kann man glücklich werden? Was ist eigentlich Glück?
Jeder hat wohl einen anderen Plan vom Glück und sucht diesen auch zu verwirklichen. In Janoschs Geschichte Komm, wir finden einen Schatz, in der der kleine Bär und der kleine Tiger das größte Glück der Erde suchen, besteht dieses für die beiden letztendlich aus den einfachen Dingen ihres Lebens, ihrer Heimat- dem Gesang des Zaunkönigs und dem Flimmern der Sonne über der Wiese. Die Bienen summten, und der Blumenkohl hatte so gut geschmeckt. Hmmm Oh, was war das für ein Glück. Echt wahr. Sieht so auch das Glück bei den Kindern aus, oder stellt sich Janosch, ein Erwachsener, sein Glück so vor? Wissen wir, was Kinder glücklich macht? Wissen sie etwas mit dem Begriff des Glücks anzufangen? Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich zum einen mit dem Glücksbegriff und damit, was man unter Glück verstehen kann. Sie sollen aber auch, gestützt durch eine empirische Erhebung bei Grundschulkindern, deren Glücksverständnis und den Zusammenhang einzelner Glückskomponenten zeigen.
Die Anthropologie beschreibt den Menschen als Sinn suchendes Wesen. Nur der Mensch ist fähig, über sich und sein Leben zu reflektieren. Warum bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens. Wie ist das Leben gut zu bewältigen? Auf dieser zentralen Frage nach einem glücklichen oder guten Leben gründen wesentliche Teile der Philosophie. Es kann somit vorab nicht auf die Vorstellung einiger zentraler Lehren und Konzepte verzichtet werden; auch wenn die jeweiligen Vertreter sich selten mit dem Kindheitsglück selbst befasst haben, so liefern sie dennoch Vorstellungen darüber, was das Glück der Menschen ausmachen und wie man es erreichen kann und zeigen damit, welch unterschiedliche Facetten existierten und noch existieren. Man kann davon ausgehen, dass sich das jeweilige Verständnis von Glück bei Erwachsenen durch deren Erwartungen auch auf ihre Kinder projiziert. Sie geben durch Erziehung ihre eigenen Werte und damit die in der jeweiligen Kultur vorherrschenden Glückskonzepte an ihre Kinder weiter.
Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die theoretischen […]
Die Glücklichen Inseln hinter dem Wind. Wenn man dem Autor James Krüss, oder besser seinem Kapitän Daworin Madirankowitsch, Glauben schenken darf, dann werden auf ihnen alle Menschen und alle Tiere glücklich. Wie kann man sie finden, wenn sie auf keiner Landkarte verzeichnet sind? Wo sonst, wenn nicht auf den beschriebenen Inseln kann man glücklich werden? Was ist eigentlich Glück?
Jeder hat wohl einen anderen Plan vom Glück und sucht diesen auch zu verwirklichen. In Janoschs Geschichte Komm, wir finden einen Schatz, in der der kleine Bär und der kleine Tiger das größte Glück der Erde suchen, besteht dieses für die beiden letztendlich aus den einfachen Dingen ihres Lebens, ihrer Heimat- dem Gesang des Zaunkönigs und dem Flimmern der Sonne über der Wiese. Die Bienen summten, und der Blumenkohl hatte so gut geschmeckt. Hmmm Oh, was war das für ein Glück. Echt wahr. Sieht so auch das Glück bei den Kindern aus, oder stellt sich Janosch, ein Erwachsener, sein Glück so vor? Wissen wir, was Kinder glücklich macht? Wissen sie etwas mit dem Begriff des Glücks anzufangen? Die nachfolgenden Ausführungen beschäftigen sich zum einen mit dem Glücksbegriff und damit, was man unter Glück verstehen kann. Sie sollen aber auch, gestützt durch eine empirische Erhebung bei Grundschulkindern, deren Glücksverständnis und den Zusammenhang einzelner Glückskomponenten zeigen.
Die Anthropologie beschreibt den Menschen als Sinn suchendes Wesen. Nur der Mensch ist fähig, über sich und sein Leben zu reflektieren. Warum bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn des Lebens. Wie ist das Leben gut zu bewältigen? Auf dieser zentralen Frage nach einem glücklichen oder guten Leben gründen wesentliche Teile der Philosophie. Es kann somit vorab nicht auf die Vorstellung einiger zentraler Lehren und Konzepte verzichtet werden; auch wenn die jeweiligen Vertreter sich selten mit dem Kindheitsglück selbst befasst haben, so liefern sie dennoch Vorstellungen darüber, was das Glück der Menschen ausmachen und wie man es erreichen kann und zeigen damit, welch unterschiedliche Facetten existierten und noch existieren. Man kann davon ausgehen, dass sich das jeweilige Verständnis von Glück bei Erwachsenen durch deren Erwartungen auch auf ihre Kinder projiziert. Sie geben durch Erziehung ihre eigenen Werte und damit die in der jeweiligen Kultur vorherrschenden Glückskonzepte an ihre Kinder weiter.
Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die theoretischen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Michaela Dimbath
Zum Glück in der Schule
Glückskonzepte bei Grundschulkindern
ISBN:
978-3-8366-1706-2
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2007
Zugl. Ludwig-Maximilian-Universität München, München, Deutschland, Staatsexamensarbeit,
2003
Coverfoto: Michaela Dimbath
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2007
Printed in Germany
2
Vorwort
Die Tatsache, dass sowohl in der Sprache der Kinder und Jugendlichen, aber auch in der
Gesellschaft der Spaß eine so gewichtige Rolle spielt, brachte mich im Verlauf der
Arbeit zu dem Gedanken, dass in der heutigen Gesellschaft der Spaß die moderne Suche
nach dem Glück darstellt. Was an vielen Stellen dieser Arbeit thesenhaft bleiben muss,
könnte mit weiteren empirischen Erhebungen untersucht werden.
Bei meiner ,Suche nach dem Glück` traf ich glücklicher Weise auf äußerst hilfsbereite
Menschen, bei denen ich mich vorab unbedingt bedanken möchte. Bei Frau Professor
Bäuml- Roßnagl, die den Mut nicht aufgegeben hat, dass aus den vielen losen Ideen in
meinem Kopf auch tatsächlich einmal eine zusammenhängende schriftliche Arbeit
entsteht. Bei Herrn Dr. Igerl, Rektor der Grundschule an der Bergmannstraße, ebenso
wie bei Herrn Griesbeck, Lehrer in Unterföhring an der Grundschule, die jeweils auf
schnelle und unbürokratische Weise mit ihren Klassen die von mir ausgewerteten
Aufsätze und Fragebögen erhoben haben. Meinen Dank auch an Tina Beerdie mir
immer mit Rat und Tat zur Verfügung stand.
3
Inhalt
1. Einleitung ... 4
2. Theoretische Grundlegungen ... 8
2.1 Philosophische Glückskonzepte und Glückslehren... 8
2.1.1 Antike... 8
2.1.2 Mittelalter... 11
2.1.3 Neuzeit ... 13
2.1.4 Gegenwärtiges Glücksverständnis... 15
2.2 Versuch der Konkretisierung des Glücksbegriffs... 15
2.2.1 Das ,,Glückserleben" ... 16
2.2.2 Zusammenhang zwischen Glück, Freude, flow und Spaß... 17
2.3 Zur Psychologie der Emotionen Glückspsychologie... 20
3. Annäherung an das Kindheitsglück... 23
3.1 Kindheit... 23
3.1.1 Pädagogische Sicht der Kindheit... 24
3.1.2 Entwicklungspsychologische Sicht der Kindheit ... 25
3.1.3 Soziokulturelle Sicht der Kindheit ... 25
3.2 Verklärung von Kindheitsglück bei Erwachsenen ... 26
4. Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand... 28
4.1 Kindheitsforschung ... 28
4.2 Glücksforschung ... 29
4.3 Kinderglückforschung... 31
4.4 Kritische Diskussion der Methodenwahl bei der empirischen Erhebung... 41
5. Glücksforschung mit qualitativen Erhebungsstrategien ... 44
5.1 Methodische Vorgehensweise... 44
5.1.1 Fallauswahl, Feldzugang und sozialstrukturelle Merkmale der befragten Schülerinnen und
Schüler ... 44
5.1.2 Erhebungsverfahren ... 46
5.2 Diskussion des Erhebungsdesigns... 48
5.3 Vorgehen bei der Auswertung der Daten ... 49
5.3.1 Auswertung der Fragebögen ... 49
5.3.2 Auswertung der Aufsätze ... 50
5.4 Ergebnisse der Befragung ... 50
5.4.1 Exkurs über Glücksbringer... 50
5.4.2 Ergebnisse der Fragebogenauswertung ... 55
5.4.3 Auswertung der Aufsätze ... 73
6. Zusammenfassung der Ergebnisse der Erhebung und Konsequenzen für die pädagogische Umsetzung
des Themas ,Glück` ... 85
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Erhebung... 85
6.2 Schulische Konsequenzen aus den Ergebnissen... 87
6.2.1 Zur Notwendigkeit einer ,Glücksförderung` in der Schule ... 87
6.2.2 Bedeutung von Emotionen für Lernen und Leistung ... 88
6.2.3 Konsequenzen für die Lehrerbildung ... 90
6.3 Bildungsziele zum menschlichen Existenzial ,Glück` ... 93
6.4 Das Thema ,Glück` im Unterricht Philosophieren mit Kindern... 95
7. Ausblick auf aktuelle Entwicklungen... 98
8. Literaturverzeichnis... 99
9. Anhang ... 103
9.1 Fragebogen und Fragebogenauswertungstabellen... 103
9.1.1 Der Fragebogen ... 103
9.1.2 Auswertungstabellen zum Fragebogen... 104
9.2 Endgültiger Kodebaum zu den ´Statements´ zum glücklichsten Tag/ Moment seit langem ... 111
9.3 Tabellen zu den Diagrammen im Text ... 113
4
1. Einleitung
,,Die Glücklichen Inseln hinter dem Wind." Wenn man dem Autor James Krüss, oder
besser seinem Kapitän Daworin Madirankowitsch, Glauben schenken darf, dann werden
auf ihnen alle Menschen und alle Tiere glücklich.
1
Wie kann man sie finden, wenn sie
auf keiner Landkarte verzeichnet sind? Wo sonst, wenn nicht auf den beschriebenen
Inseln kann man glücklich werden? Was ist eigentlich Glück?
Jeder hat wohl einen anderen ,,Plan vom Glück"
2
und sucht diesen auch zu
verwirklichen. In Janoschs Geschichte ,,Komm, wir finden einen Schatz", in der der
kleine Bär und der kleine Tiger das größte Glück der Erde suchen, besteht dieses für die
beiden letztendlich aus den einfachen Dingen ihres Lebens, ihrer Heimat- dem Gesang
des Zaunkönigs und dem Flimmern der Sonne über der Wiese. ,,Die Bienen summten,
und der Blumenkohl hatte so gut geschmeckt. Hmmm... Oh, was war das für ein Glück.
Echt wahr."
3
Sieht so auch das Glück bei den Kindern aus, oder stellt sich Janosch, ein
Erwachsener, sein Glück so vor? Wissen wir, was Kinder glücklich macht? Wissen sie
etwas mit dem Begriff des Glücks anzufangen? Die nachfolgenden Ausführungen
beschäftigen sich zum einen mit dem Glücksbegriff und damit, was man unter Glück
verstehen kann. Sie sollen aber auch, gestützt durch eine empirische Erhebung bei
Grundschulkindern, deren Glücksverständnis und den Zusammenhang einzelner
Glückskomponenten zeigen.
Die Anthropologie beschreibt den Menschen als Sinn suchendes Wesen. Nur der
Mensch ist fähig, über sich und sein Leben zu reflektieren. Warum bin ich auf der Welt?
Was ist der Sinn des Lebens. Wie ist das Leben gut zu bewältigen? Auf dieser zentralen
Frage nach einem glücklichen oder guten Leben gründen wesentliche Teile der
Philosophie. Es kann somit vorab nicht auf die Vorstellung einiger zentraler Lehren und
Konzepte verzichtet werden; auch wenn die jeweiligen Vertreter sich selten mit dem
Kindheitsglück selbst befasst haben,
4
so liefern sie dennoch Vorstellungen darüber, was
das Glück der Menschen ausmachen und wie man es erreichen kann und zeigen damit,
1
James Krüss (2000): ,Die Glücklichen Inseln hinter dem Wind'.
2
Mit ,,Deinen Plan vom Glück" besingt Herbert Grönemeyer auf seiner CD ,,Mensch" das Glückskonzept
seiner verstorbenen Frau.
3
Vgl. Janosch (1993): Komm, wir finden einen Schatz.
4
Dies mag auch daran liegen, dass Kinder lange Zeit in diesem Sinn, also als ganze Menschen mit
eigenem Glücksempfinden, nicht wahrgenommen wurden (vgl. dazu Ariès 1977).
5
welch unterschiedliche Facetten existierten und noch existieren. Man kann davon
ausgehen, dass sich das jeweilige Verständnis von Glück bei Erwachsenen durch deren
Erwartungen auch auf ihre Kinder projiziert. Sie geben durch Erziehung ihre eigenen
Werte und damit die in der jeweiligen Kultur vorherrschenden Glückskonzepte an ihre
Kinder weiter.
Zunächst möchte ich einen kurzen Überblick über die theoretischen Grundlegungen von
Glückskonzepten von der Antike bis in die heutige Zeit geben. Eine weitere
Annäherung an den Begriff des Glücks, versuche ich anschließend durch die
Abgrenzung anderer, nahe verwandter Begriffe, die in ähnlichen Zusammenhängen
verwendet werden. In der deutschen Sprache gibt es Wörter, die nach ihrer Bedeutung
nur schwer vom Glücksbegriff zu unterscheiden sind und oft auch synonym verwendet
werden. Neudeutsch spricht man von Spaß, traditionell vielleicht eher von Freude und
die Psychologie kennt den Begriff ,flow' (Mihaly Csikszentmihalyi). Sie alle
beschreiben ähnliche Emotionen. Wie stehen diese Begriffe zueinander? Viele Autoren
sind sich der Uneindeutigkeit durchaus bewusst. Zu Beginn seines Textes ,,Versuch
über den geglückten Tag" fordert Peter Handke ein allgemeines Verständnis des
Begriffes Glück. ,,Meinst du ,geglückt' oder bloß 'schön'? Sprichst du von einem
'geglückten' Tag oder einem (...) 'sorglosen'? Ist für dich ein geglückter Tag allein
schon, der ohne Probleme verlief? Siehst du einen Unterschied zwischen einem
glücklichen Tag und einem geglückten?"
5
Die Publizistin Jacqueline Rieger stellt in
ihren Ausführungen zum Spaßfaktor fest: ,,Eng verwandt mit dem Spaß ist die Freude,
die wiederum im Duden als hoch gestimmter Gemütszustand beschrieben wird, als ein
Froh- und Beglücktsein." Weiter erwähnt sie, dass man ,,gewiss lange Abhandlungen
darüber schreiben (kann), ob nach dieser Definition nicht eher der Begriff Freude (...)
treffender wäre als Spaß"
6
und rät im Anschluss, dass jeder selbst entscheiden solle,
welche Emotionen er mit dem Begriff des Glücks charakterisieren will. Für Hermann
Hesse schreibt über Glück, es sei ,,eins von den Wörtern, die ich immer geliebt und gern
gehört habe. Man mochte über seine Bedeutung noch so viel streiten und räsonieren
können, auf jeden Fall bedeutet es etwas Schönes, etwas Gutes und Wünschenswertes.
Und dementsprechend fand ich den Klang des Wortes."
7
5
So Peter Handke (1994, S. 9) im ,Versuch über den geglückten Tag'.
6
Rieger (1999, S. 19): Der Spaßfaktor.
7
Hermann Hesse (1973, S. 44) in ,Glück'.
6
Einen anderen Zugang zum Glück entfaltet die psychologische Begriffsklärung. Die
psychologische Forschung über das Glück ist in der Emotionspsychologie angesiedelt.
Wie entstehen Emotionen? Und was sind eigentlich Emotionen? Dazu gibt es
verschiedene Denkansätze in der Forschung, die überblicksartig vorgestellt werden
sollen.
Das Glück bezieht sich auf das Subjekt. Bei einer weiteren Annäherung an das
Kindheitsglück sollte man das Phänomen der Kindheit erörtern. Durch die im Rahmen
der Sozialisation aufgenommenen Werte und Normen wird auch das Glückskonzept der
Kinder geprägt zum Beispiel durch religiöse Weltanschauungen in der Familie.
Die eigene Kindheit wird von den meisten Menschen als glücklich empfunden,
vielleicht auch, um im Alter sagen zu können: ,,Ja, ich war glücklich in meinem Leben!"
Heute sollen die Kinder mindestens so glücklich sein, wie ihre Eltern es waren. Bei
dieser ,,Zwangsbeglückung"
8
entsteht ein Problem: Was empfinden Kinder heutzutage
als Glück? Was macht sie glücklich? Als Erwachsener kann man diese Frage nach dem
Kindheitsglück von heute auch in Retrospektive auf die eigene Kindheit nicht
ausreichend beantworten, da nur bestimmte Erlebnisse über die Jahre hinweg erinnert
werden. Erinnerung ist selektiv. Sie ist immer eingebettet in die gegenwärtige Situation
und muss in Abhängigkeit zur Gesellschaft gesehen werden. Will man eine realistische
Annäherung an kindliche Glückskonzepte nachvollziehen, so muss man die Kinder
selbst fragen. Was ist der momentane Stand der Forschung? Zur Glücksforschung
allgemein hat Alfred Bellebaum mit anderen Autoren eine ,,Bestandsaufnahme" erstellt.
Anton Bucher hat in einem sehr umfangreichen Survey Kinder zu deren
Glücksvorstellungen befragt. Nachdem diese Studien momentan die umfangreichste
zum Thema Kindheitsglück ist, möchte ich sie ausführlicher vorstellen und versuchen
herauszufinden, ob die gewählte Erhebungs- und Auswertungsmethode geeignet ist, um
Glückskonzepte von Kindern umfassend kennen zu lernen.
Als Alternative oder Ergänzung bei der Feststellung kindlicher Glückskonzepte anhand
einer quantitativen Analyse, habe ich eine qualitative Erhebung bei Grundschulkindern
durchgeführt. Bei der Auswertung der ersten Fragebögen, die aus offenen Fragen
bestanden, zeigte sich, wie schwierig es ist Gefühlszustände abzufragen und Kinder mit
einem Fragebogen so zu erreichen, dass sie ihr Gefühlsleben preisgeben. Die im
8
Vgl. Anton Bucher (2001): ,Was Kinder glücklich macht'.
7
Anschluss an die Fragebögen erhobenen Aufsätze
9
lieferten genauere Informationen
über die Zusammenhänge und Begleitumstände des Glücks bei Kindern. Nach einer
Zusammenfassung der bis dahin erzielen Ergebnisse, stellt sich die Frage, welche
pädagogischen Konsequenzen gezogen werden können und warum es überhaupt ein
pädagogisches Handeln dazu geben muss. Wie steht es um das Glück in der Schule?
Vorschläge für Bildungsziele zum menschlichen Existential Glückserfahrung sollen hier
Möglichkeiten aufzeigen. Einen Zugang zur direkten Umsetzung des Glücksthemas im
Unterricht, bietet das Philosophieren mit Kindern. Mit einem Ausblick auf die
aktuellsten Forderungen für die Schule, die sich aus der IGLU Kommission ableiten,
möchte ich meine Arbeit abschließen.
9
Ich spreche in meiner weiteren Arbeit immer von Aufsätzen, obwohl von den erhobenen Aufsätzen in
nur etwa der Hälfte der Fälle tatsächlich eine Art Aufsatzform eingehalten wurde. Die übrigen
Kinderaufsätze erstrecken sich nur über wenige Sätze und wären somit eher mit dem Begriff ,statement'
zu umschreiben als mit Aufsatz. Für einen schöneren Leseklang habe ich mich aber letztendlich doch
dafür entschieden, den Begriff der Aufsätze beizubehalten.
8
2. Theoretische Grundlegungen
Ludwig Marcuse bezeichnet Glück als einen ,,Abladeplatz für die Ideen und Wertungen
von Jahrhunderten"
10
Tatsächlich gibt es seit der Antike Überlieferungen von
Glückskonzeptionen. Diese Arbeit soll und kann nicht den Glücksbegriff von beinahe
dreitausend Jahren aufarbeiten. Sie sucht vielmehr nach den Glücksvorstellungen, wie
sie bei Grundschulkindern zu finden sind. Da aber Glücksvorstellungen, auch die von
Kindern, niemals isoliert vom geschichtlichen Hintergrund und ohne
sozialisationstheoretische Einbettung gesehen werden können, möchte ich einen kurzen
Überblick über einige wesentliche Glückskonzepte in der Literatur von der Antike bis
zur Moderne geben. Dabei habe ich mich für eine Form der Darstellung entschieden, die
zur jeweiligen Epoche wesentliche Vertreter nennt und deren Vorstellungen vom Glück
kurz wiedergibt.
2.1 Philosophische Glückskonzepte und Glückslehren
,,Jeder Mensch will glücklich sein."
11
Diese Feststellung ist so gut wie allen
Abhandlungen zum Glück gemeinsam. Darin aber, wie das Glück des Einzelnen
aussieht und wie und für wen es zu erreichen ist, zeigen sich Unterschiede.
2.1.1 Antike
Die philosophische Lehre, in der das Glück das Motiv allen menschlichen Strebens ist,
heißt Eudämonismus. Dieser leitet sich vom griechischen Begriff eudaimonia ab, was
soviel bedeutet wie Glücksempfinden oder Glückseligkeit. Im Unterschied zu
theologischen oder moralphilosophischen Lehren darf das Glück hier gleichzeitig auch
das Ziel des Strebens sein. Führende Vertreter der ,,Klassischen Periode der
griechischen Philosophie"
12
sind Platon (428-348) und Aristoteles (384-322).
13
Platon
war Schüler des Sokrates und veröffentlichte nach dessen Tod die Verteidigungsrede
des Sokrates als seine erste Handlung als Philosoph. Aristoteles war lange Schüler bei
10
Schneider (1981, S. 307): ,Glück, was ist das?'
11
Winterswyl (1995, S. 17): ,Das Glück. Eine Spurensuche'.
12
Wlodarek-Küppers (1986, S. 13): ,Glücklichsein'.
13
In der Literatur werden für die Philosophen unterschiedliche Jahreszahlen verwendet (vgl. in diesem
Fall Blum u.a. 1997).
9
Platon, dann Lehrer in dessen Philosophenschule, der Akademie. Später distanzierte er
sich immer von Platons Ideenlehre und gründete letztendlich eine eigene Schule.
Für Platon ergibt sich die ,,Glückseligkeit aus dem rechten Streben."
14
Derjenige, der
,,wohl lebt, wird auch zufrieden und glückselig sein; der Böse hingegen und der
schlecht lebt, elend (...). Dies dünkt mich das Ziel zu sein, auf welches man hinsehen
muss bei der Führung des Lebens, und alles in eigenen und gemeinschaftlichen
Angelegenheiten darauf hinlenkend so verrichten, dass immer Gerechtigkeit und
Besonnenheit dem gegenwärtig bleibe, der glückselig werden will."
15
Im eigenen
Wirken für andere kann dadurch zum Beispiel das Glück für einen selbst entstehen. Das
Glück bei Platon ist ,,die göttliche Idee des Guten und die Teilhabe der Seele an dieser
Idee."
16
Wirklich glücklich können demnach nur sehr wenige werden, ,,denn glücklich
ist der Weise und Gerechte, in dem sich das Göttliche entfaltet."
17
Die wahre
Glückseligkeit wird eigentlich nur den vorbildhaftesten Philosophen zuteil. Erst nach
dem Tod wird entschieden, ob der Mensch seinen ihm ,,zukommenden Platz im Leben
ausgefüllt und die Verähnlichung mit Gott gesucht hat."
18
Bei Aristoteles ist das Glück zwar ebenfalls ,,das höchste Gut,"
19
das ,,Endziel
menschlichen Handelns."
20
Es ist aber nicht mehr nur einer geringen Zahl von
Menschen vorbehalten. Wichtige Bedingung an das Glück ist dabei, dass es sich ein
Selbstzweck ist. ,,Vollkommen nennen wir das um seiner selbst willen Erstrebte
gegenüber dem um anderer Ziele willen Erstrebten."
21
Diesen Zustand der
Glückseligkeit, ein ,,Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenseigenen Tugend und
Tüchtigkeit", muss man aktiv erreichen. Glück ist also kein Zustand, kein Besitz,
sondern etwas, das man tun muss. Aristoteles glaubt dabei an drei Formen des Glücks:
Die erste Form des Glücks ist ein Leben der Lust und der Vergnügungen, die zweite
Form des Glücks ist ein Leben als freier, verantwortlicher Bürger und die dritte ein
Leben als Forscher und Philosoph. Er betont, dass alle drei Formen zusammengehören
müssen, damit der Mensch ein glückliches Leben führen kann. Jede Form der
14
Ebd. Blum (1997, S. 25)
15
Platon, Gorgias 507c-e, zitiert bei Mayring (1991, S. 19)
16
Winterswyl (1995, S. 157)
17
Ebd., S. 157
18
Blum (1997, S. 25)
19
Ebd., S. 31
20
Ebd., S. 37
21
Aristoteles (1972, I5, 1097a 30-34): ,Die Nikomachische Ethik'.
10
Einseitigkeit lehnte er ab.
22
Der Mensch wird als ein ,,zoon politicon", als Wesen, das
nur in Gemeinschaft des Staates ,,gut leben kann" und auf den Staat ausgerichtet ist, nur
glücklich werden, wenn es ,,sich seiner Verpflichtung für die Gemeinschaft bewusst
ist."
23
Weitere Voraussetzung für Glückseligkeit ist eine Glück fördernde Umgebung
und diese kann bei Aristoteles nur in einem geordneten Staatswesen gefunden werden.
Einmal erreichte Glückseligkeit, also das gute Leben in eudaimonia, geht verloren,
wenn sich der Mensch nur mehr auf das Ausleben der leiblichen Genüsse und ein Leben
in Verschwendung beschränkt. ,,Das Leben in körperlicher Lust verdrängt das gute
Leben in eudaimonia."
24
Eudämonie, als Zustand einmal erreicht, kann das ganze
Leben lang bestehen. ,,Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, und ein Tag oder
eine kurze Zeit, (...), macht niemanden glücklich."
25
Im Hellenismus gilt Glückseligkeit oder Glück dann als ,,Ziel der Philosophie
überhaupt."
26
Das Glück steht hier noch über der Tugend. Der Hedonismus, als weitere
philosophische Lehre, in der der Lebensgenuss des Individuums das Motiv und das
legitime Ziel allen Handeln ist, ohne Sorge um das Glück der Mitmenschen, geht von
der ,,Lust und dem Glücksverlangen des einzelnen aus". Er meint damit aber
keineswegs ein ausschweifendes Leben in leiblichen Genüssen. Einer der bedeutendsten
Vertreter dieser Strömung ist Epikur. Philosophie ist für ihn eine Tätigkeit die, durch
Argumentation und Diskussion, zur Glückseligkeit führt.
27
Nachdem Epikur (341-270)
28
seine philosophische Ausbildung bei eher unbekannten
Lehrern beendet hat, lässt er sich in Athen nieder und gründet eine eigene Schule.
Die Lust bei Epikur meint, entgegen anderer Auffassungen, mehr eine Gemütsruhe, die
so genannte Ataraxie,
29
die auf Dauer angelegt ist und nicht eine fleischliche Lust, die
nur der reinen Triebbefriedigung dient. Heute würde man sie vielleicht die kleinen
Freuden des Lebens nennen, um die es Epikur ging. ,,Die genussvolle Wahrnehmung
der keinen Schönheiten, die Freuden der Sinne und die der Erkenntnis."
30
Seiner
Auffassung nach strebt ,,jedes lebendige Wesen (...), sobald es geboren ist, nach Lust
22
Jostein Gaarder (1998, S. 140): ,Sofies Welt'.
23
Braun (1998, S. 47): ,Politische Philosophie'.
24
Ebd., S. 61.
25
Aristoteles zit. bei Winterswyl (1995, S. 96).
26
Hossenfelder (2000, S. 149): ,Der Wille zum Recht und das Streben nach Glück'.
27
Ebd., S. 149.
28
Jahreszahlen aus: Braun (1998).
29
Ebd., S. 70.
11
und freut sich daran als dem höchsten Gut, während es den Schmerz als das höchste
Übel vermeidet."
31
Einen wesentlichen Aspekt, der bei Epikur zur Glückseligkeit
gereicht, möchte ich hier besonders herausstellen. Es ist die Fähigkeit, sich Freunde zu
erwerben.
,,Von allen Gütern, die die Weisheit sich zur Glückseligkeit des ganzen Lebens sich zu
verschaffen weiß, ist bei weitem das größte die Fähigkeit, sich Freunde zu erwerben."
32
Angesichts solcher Aussagen, die an Aktualität nicht verlieren können, irritiert, dass der
Glücksbegriff der Epikuräer, wie die Anhänger des Epikurs genannt werden, lange Zeit
als Schimpfwort galt.
Epiktet (um 50- um 130 n. Chr.) hat sich als Philosoph der Lehre der Stoa verpflichtet.
Diese jüngste der vier griechischen Philosophenschulen beruht unter anderem auf dem
Grundsatz, dass alle Menschen, und damit auch Sklaven, menschlich zu behandeln sind.
Ein Sklave war Epiktet auch, bevor er von seinem Herrn freigelassen wurde.
Unangreifbares Lebensglück lässt sich seiner Meinung nach nur erreichen, wenn man
auf alle gleichgültigen Dinge des Lebens verzichtet und dadurch die nötige Distanz
gewinnt. So kann der Fall eintreten, dass ein Mann zwar reich ist, Weib, Kinder und viel
Sklaven besitzt, den Kaiser kennt und in Rom viele Freunde hat, dass er seine Pflichten
als Staatsbürger erfüllt und Gutes mit Gutem und Böses mit Bösem vergilt, ihm aber
dennoch das Notwendigste und Wichtigste zur Glückseligkeit fehlt.
33
Das Glück liegt
für Epiktet nicht im Körper, es liegt nicht im Besitz, nicht in der Macht oder der
Königsherrschaft. Es liegt ,,da, wo ihr es nicht erwartet und nicht suchen wollt."
34
Da
das Glück etwas Großes, Bedeutendes und Unzerstörbares sein soll, etwas, das niemand
rauben kann, so muss es in einem selbst liegen. Eine innere Größe, die später so auch im
Christentum gefordert wir, und im Rahmen derer erlittenes Unrecht eben nicht mit
gleicher Münze heimgezahlt werden soll.
2.1.2 Mittelalter
Zu Beginn des Mittelalters bzw. zum Ende der Antike, verlieren die römischen und
griechischen Stadtstaaten an Bedeutung oder lösen sich auf. Nachdem unter Konstantin
30
Winterswyl (1995, S. 122).
31
Marcuse (2002, S. 53): ,Philosophie des Glücks'.
32
Ebd., S. 72.
33
Epiktet(1997, S. 62): ,Wege zum glücklichen Handeln'.
34
Ebd. S. 135.
12
dem Großen 313 das Toleranzedikt von Mailand
35
erlassen wurde, das den Christen
Gleichberechtigung und völlige Religionsfreiheit brachte, schreitet die Christianisierung
weiter Teile Europas voran. Vormals Verfolgte zählten nun zu den Verfolgern von
allem, was nicht christlich ist. Kirche und Theologie nehmen immer stärkeren Einfluss
auf die Politik und das Privatleben der Menschen, weshalb sich das Mittelalter durch ein
weitgehend theologisch beeinflusstes Glücksverständnis auszeichnet.
In dieser Zeit lebt der Rhetor, Mönch, Priester und spätere Bischof Aurelius Augustinus
(354-430 n. Chr.). Ebenso wie bei Epikur, besteht für ihn das größte Hindernis für das
Glück in der Furcht.
36
Augustinus gilt als einer der ,,großen Theologen"
37
und das,
obwohl er erst sehr spät zum Christentum gefunden hat. In der Mitte seines Lebens
wendet er sich vom bisherigen Lebenswandel ab und sucht das wahre Glück bei Gott.
Er erkennt, dass man, wenn man alles hat, was man sich wünscht, nicht automatisch
glücklich wird. Im neunzehnten Buch seiner Schrift ,,Vom Gottesstaat" definiert
Augustinus das glückselige Leben als ein ,,Leben in der Gemeinschaft."
38
Nachdem das
Glück für Augustinus ein ,,ewig und immerwährendes" Gut ist und ewig und
immerwährend nur Gott ist, folgert er daraus, dass der glückselig ist, der ,,Gott hat."
39
Auf die Frage, wann ein Leben glücklich ist, antwortet Augustinus: ,,Wenn es ein
ewiges sein wird."
40
Wer also nach der Idee des Augustinus und überhaupt des
Christentums glücklich werden will, sollte fähig sein, in einer ,,vergegenwärtigten
Zukunft"
41
zu leben. Ewige Glückseligkeit kann der Mensch erst nach dem Tod
erlangen. Im Leben bilden Glück und irdisches Wohlbefinden einen Gegensatz.
42
Nachdem das römische Reich untergegangen war, kamen künstlerische und
wissenschaftliche Betätigungen fast gänzlich zum Erliegen und ,,große Teile Europas
fielen für ein halbes Jahrtausend in Dunkelheit" Erst ab dem zehnten Jahrhundert wird
wieder ein Aufschwung und kultureller Fortschritt
43
diagnostiziert. Die Schriften der
Griechen waren im lateinischen Abendland immer mehr in Vergessenheit geraten und
35
Braun (1998, S 74).
36
Marcuse (2002, S. 132).
37
Blum (1997, S. 61).
38
Ebd., S. 67.
39
Marcuse (2002, S. 130).
40
Ebd., S. 131.
41
Ebd., S. 13.
42
Mayring (1991, S. 24).
43
Braun (1998, S. 80).
13
so wurde Aristoteles erst im dreizehnten Jahrhundert wieder entdeckt. Die ,,neueste
Philosophie"
44
war damals die, die sich auf Aristoteles berief.
Einer der Anhänger dieser neuesten Philosophie ist Thomas von Aquin (1224-1274).
Als Mitglied des Dominikanerordens ist er sowohl Priester und Prediger als auch
wissenschaftlicher Forscher und dabei ein großer Verehrer des Aristoteles. Ebenso wie
bei Aristoteles gilt für ihn die Glückseligkeit als oberstes Ziel. Sie ist ,,das Endziel aller
Sehnsucht."
45
Wenngleich bei Aristoteles aber zur Erfüllung der Glückseligkeit der
irdische Rahmen der Polis nicht verlassen werden muss, so gelingt dies bei Thomas in
ihrer vollständigen Gestalt nur im christlichen Jenseits. Unvollständiges Glück kann
zwar auch im Diesseits zuteil werden, es kann aber trotz noch so gläubigem
Lebenswandel nicht eingeklagt werden. Glück bleibt eine Gnade Gottes.
46
,,Da aber die
Sehnsucht jedes vernünftigen Wesens nach einem umfassenden Gut zielt, so wird jenes
Gut allein wirklich glücklich machen können, nach dessen Erlangung kein weiteres zu
wünschen bleibt (...). Kein einziges irdisches Gut ist aber dieser Art (...). Denn nichts
Bleibendes findet sich auf der Erde, und also gibt es nichts Irdisches, was die Sehnsucht
ganz zur Ruhe bringen kann. So kann auch nichts, das von dieser Erde stammt,
glücklich machen."
47
2.1.3 Neuzeit
Das 18. Jahrhundert ist das Zeitalter der industriellen, politischen und mit Immanuel
Kant der geistigen Revolution. ,,Glück wird als Menschenrecht deklariert; damit wird
Glück zur Parole des politischen Kampfes gegen die herrschenden Mächte."
48
Die
Vorstellungen vom Glück rücken aus dem Jenseits wieder in das Diesseits und nehmen
säkulare Formen an. Immanuel Kant erläutert seine Vernunftreligion mit der Aussage:
,,Wer würdig ist glücklich zu sein, darf für ein späteres Leben hoffen, solcher
Glücksumstände aus der Hand eines gerecht urteilenden Gottes teilhaftig zu werden."
49
Nach Immanuel Kant (1724-1804) tritt dem Menschen als endlichem Vernunftwesen
das praktisch notwendige Gesetz als Gebot einer Pflicht gegenüber und in der Erfüllung
der Pflicht bzw. des Gebots entgegen seiner eigentlichen Neigungen kann der Mensch
44
Blum (1997, S. 78).
45
Thomas von Aquin (1975, S 33): ,Über die Herrschaft der Fürsten'.
46
Mayring (1991, S. 24).
47
Aquin (1975, S. 33).
48
Mayring (1991, S. 22).
14
sich einen moralischen Verdienst erwerben. Mit anderen Worten kann er sich die
,,Glückswürdigkeit"
50
erwerben. Das Handeln der Menschen soll immer auf die
Verwirklichung des ,,höchsten Guts" ausgerichtet sein und dieses höchste in einer Welt
mögliche Gut ist ein ,,Zustand des Glücks". Glück ist bei Kant zwar ein individuelles
Gut, das höchste Gut jedoch ist in doppelter Hinsicht an die Gesellschaft gebunden.
Zum einen, da manche Neigungen nur durch die Gesellschaft erfüllt werden können
die Lust der Befriedigung der Neigungen bleibt dabei aber ein individuelles Empfinden.
Zum anderen ist die Gesellschaft aber auch der ,,Rahmen für die Moralität" und setzt
somit Bedingungen für die Würdigkeit zum Glücklichsein fest.
51
Kant bindet das Glück
auch an Gott. Dieser erteilt die Glückseligkeit nur demjenigen, der pflichtgetreu gelebt
hat. Erst mit der Religion tritt bei den Menschen die Hoffnung ein, einer Glückseligkeit
teilhaftig zu werden.
52
Im 19. Jahrhundert bringen die technischen Neuerungen und damit einhergehende
industrielle Erfolge erstmals wachsenden Wohlstand, der vom Grundbesitz losgelöst ist.
England hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Rolle der führenden Macht in der
Industrialisierung inne. Auch in den philosophischen Konzeptionen dieser Zeit schlagen
sich die Auswirkungen von Industrialisierung, Freihandel und Kolonialisierung
nieder.
53
Die Familie Mill lebt in unmittelbarer Nähe von Jeremy Bentham, der als der
Begründer des Utilitarismus gilt, wonach jedes menschliche Handeln unter das
,,Kriterium der Mehrung des Glücks für den einzelnen" zu stellen ist. Das höchste
moralische Gut ist das größte Glück für die größte Anzahl von Menschen. Der
Gesetzgeber als Verantwortlicher für die wachsenden sozialen Missstände und die
daraus entstandenen Aufstände muss dieses Kriterium der Mehrung des Glücks bei der
Steuerung der rechtlichen Normen und des Gewaltmonopols berücksichtigen. Nachdem
John Stuart Mill (1806-1873) von seinem Vater zuhause unterrichtet wurde, konnte
dieser alle anderen gedanklichen Einflüsse, außer Benthams Ideologie von John Stuart
fernhalten. Erst nach dem Tod seines Vaters kann er seinen geistigen Horizont erweitern
und ein eigenes Gedankengebäude errichten.
54
Moralisch richtig sind seiner Auffassung
49
Blum (1997, S. 181).
50
Ebd., S. 182 ff.
51
Ebd., S. 184.
52
Marcuse (2002, S. 249 ff.).
53
Braun (1998, S. 254).
54
Blum (1997, S. 254 ff.).
15
nach alle Handlungen, die das Glück fördern, falsch sind diejenigen, die das Gegenteil
von Glück bewirken.
55
Die Gesellschaft hat hierbei die Aufgabe, das Glück des
einzelnen mit den Interessen der Gesamtheit zusammen zu bringen. Mit seinem
Lustprinzip, wonach unter Glück, Lust und das Freisein von Unlust verstanden wird,
nähert er sich an das Denken der Epikureer an.
2.1.4 Gegenwärtiges Glücksverständnis
Philipp Mayring nennt in seiner Abhandlung ,,Psychologie des Glücks"
56
fünf
ideologische Tendenzen, denen das heutige Glück ausgesetzt ist. Sie kommen einer
Bestandsaufnahe gleich, wie es um das Glück heute bestellt ist. Durch das Streben nach
anderen Zielen wie Wohlstand und Machte wird das Streben nach Glück verdrängt und
dadurch abgewertet. Das verbleibende Reststreben nach Glück wird in die Ehen oder
Familien verlagert und damit privatisiert. Nicht die Gesellschaft fühlt sich für das Glück
der einzelnen Mitglieder verantwortlich. Das Glück wird den Individuen zugeschrieben.
Die weiterhin bestehende Sehnsucht nach Glück nutzt der Markt geschickt aus: Glück
wird kommerzialisiert und ist damit käuflich. Der nicht erklärbare Rest des Glücks, das
nicht Fassbare und nicht Erkennbare, das, was seit Jahrtausenden seinen Reiz
ausgemacht hat, bleibt bestehen. Er schlägt sich nieder in einer Mystifizierung des
Glücks.
Um im weiteren Verlauf der Ausführungen auf einen Begriff des Glücks aufzubauen,
bedarf es einer Konkretisierung, die ähnliche Begriffe abgrenzt und das den
Ausführungen zugrunde gelegte Begriffsverständnis herausstellt.
2.2 Versuch der Konkretisierung des Glücksbegriffs
In der deutschen Sprache wird der Begriff ,,Glück" mit zwei unterschiedlichen
Bedeutungen gebraucht. Zum einen ist es das ,,Glück haben", also durch einen
glücklichen Zufall begünstigt zu sein, zum anderen ist es das ,,glücklich sein". Man
kann Glück gehabt haben, ohne glücklich zu sein und ebenso kann man auch glücklich
sein, ohne Glück gehabt zu haben. Glück haben beschreibt, neben dem Prinzip des
55
Ebd., S. 258.
56
Mayring (1991, S. 91).
16
Zufalls auch einen, ,,von den anderen, von den Mitmenschen wahrgenommen"
57
Zustand. Glücklich sein umschreibt einen mehr oder weniger subjektiven
Erlebenszustand der jeweiligen ,,glücklichen" Person, das was sie ,,im Inneren (für sich)
erlebt."
58
Es kann anderen angezeigt werden, muss aber nicht. Das Glück wird hier zwar
subjektiv erlebt, es muss aber eine Art Idee des Glücks vorhanden sein, um das Glück
auch als solches zu erkennen. Glück wird also durch die Gesellschaft, in der wir es
erleben, transportiert. In dieser Arbeit möchte ich mich ausschließlich mit dem Glück
im Sinne von ,,glücklich sein" beschäftigen. Das Glück soll im Sinne des wirklich
empfundenen Glücks eines bestimmten Menschen, in diesem Fall eines Kindes, zu einer
bestimmten Zeit verstanden werden. Solange ein positives Ereignis im Bereich des
Erwartbaren verbleibt, dann ist man zufrieden. Das Glück tritt erst ein, wenn das
Erwartbare überschritten wird. Wenn das Unerwartete eintrifft.
59
2.2.1 Das ,,Glückserleben"
Mit dem Begriff des Glückserlebens,
60
soll der Versuch unternommen werden, das
Glück in seinen Bedeutungsdimensionen weiter einzugrenzen. In dieser Arbeit geht es
um die Formen von Glück, die Kinder erfahren. Dabei handelt es sich, wie bei den
Erwachsenen um das ,,Glückserleben" und das ,,Lebensglück."
61
Mit dem ,,Erleben"
und ,,Leben" soll die Diesseitigkeit des Begriffsverständnisses verdeutlicht werden.
Nicht das Glück im Jenseits, das beinahe alle Religionen versprechen, nicht die, durch
tugendhaftes Leben bescherte ewige Glückseligkeit der Moralphilosophen soll hier
behandelt werden. Es geht um ein eher alltäglicheres Glück, subjektiv empfunden und
doch durch die Glücksvorstellungen der Umwelt geprägt. Man könnte das
,,Lebensglück" auch umschreiben mit einer Grundzufriedenheit, die einen in jenen
glücklichen Zustand versetzt. Gleichzeitig schafft dieses ,,Lebensglück" auch die Basis
für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit des ,,Glückserlebens".
62
Selma das Schaf beschreibt
es, ohne sich seines Glückes bewusst zu sein.
63
Hier gründet sich das Glück auf eine
57
Reichertz(2002, S. 232): ,,Ich könnte schreien vor Glück".
58
Ebd., S. 232.
59
Ebd., S. 231.
60
Ebd., S. 91.
61
Ebd., S. 91.
62
Ebd., S. 91.
63
Auf die Frage, was ist Glück? Selma das Schaf: Es war einmal ein Schaf, das fraß jeden Morgen etwas Gras.
Lehrte bis Mittags die Kinder sprechen Mäh. Machte nachmittags etwas Sport. Fraß dann wieder Gras. Plauderte
Abend etwas mit Frau Meier. Schlief nachts tief und fest. Gefragt, was es denn tun würde, wenn es mehr Zeit hätte,
17
Lebenszufriedenheit, die sich nach vielen Jahren einstellen kann. Es ist die Form des
Glücks, die eher von Erwachsenen beschrieben wird, bestimmt aber auch bereits von
Kindern erlebt werden kann. Das andere Glück, das ich mit meiner Arbeit beschreiben
möchte, ist jenes ,,Glückserleben" eines Augenblicks, einer ,,konkreten Situation."
64
Im
Gegensatz zum oben beschrieben Glück durch Zufriedenheit, dessen Gegenteil das
Unglücklichsein durch Unzufriedenheit ist, ist beim Glück des Augenblicks das
Gegenteil eher das Unglück durch eine Form der Trauer.
65
Dieses eher kleine Glück ist
es, worüber ich insbesondere forschen möchte. Das ,,Augenblicksglück", das Kinder
viel mehr noch als Erwachsene spüren können, weil sie sich mehr ,,dem Augenblick,
ihrer Fantasie und ihrer Wünsche überlassen"
66
können. Das Glück über kleine
Geschenke und das Glück, das in einer Spiel- oder Traumwelt erlebt wird. Wie es
aussehen könnte und wodurch es eventuell ausgelöst wird, soll die Auswertung meiner
Erhebung, im 5. Kapitel zeigen.
2.2.2 Zusammenhang zwischen Glück, Freude, flow und Spaß
Im Zusammenhang mit dem Verständnis des Begriffs Glück werden auch Spaß, Freude
und flow genannt. Nicht nur im Duden sind die Begriffe Spaß, Freude, Glück und
,flow` in ihren Definitionen eng miteinander verwoben, auch Anton Bucher fasst in
seiner Studie zum Kindheitsglück Begriffe wie ,,Zufriedenheit, Freude, Wohlbefinden"
als ,,Synonyme von Glück" auf.
67
Tatsächlich gestaltet sich eine Abgrenzung zu diesen
Begriffen als äußerst schwierig. Meiner Ansicht nach, beinhaltet das Glück oft, aber
nicht notwendiger Weise immer, verschiedene Wohlfühlgefühle, je nach der Situation,
die das Glücksgefühl ausgelöst hat. Mal überwiegt dabei die Freude, mal ist es der Spaß
oder der ,flow`.
Spaß kann und wird zur Umschreibung von unterschiedlich lang anhaltenden
Gefühlszuständen verwendet. Eine Dimension des Begriffs Spaß ließe sich mit dem
englischen Begriff ,fun` umschreiben. Hier geht es um ein eher ,oberflächliches`
sagte es: Ich würde bei Sonnenaufgang etwas Gras fressen. Ich würde mit den Kindern reden Mäh Mäh. Dann etwas
Sport machen. Fressen. Abends würde ich gerne mit Frau Meier plaudern. Nicht zu vergessen: Ein guter fester Schlaf.
Und wenn Sie im Lotto gewinnen würden? Also ich würde viel Gras fressen... Am liebsten bei Sonnenaufgang. Und
viel mit den Kindern sprechen Mäh Mäh Mäh. Dann etwas Sport machen. Am Nachmittag Gras fressen. Abend
würde ich gerne mit Frau Meier plaudern. Dann würde ich in einen tiefen festen Schlaf fallen.
In: Bauer (1999):
,Selma'.
64
Mayring (1991, S. 91).
65
Otto(2000, S. 222): ,Emotionspsychologie'.
66
Hettlage (2002, S. 136): ,Glück. Erscheinungsreichtum und Bedeutungsvielfalt'.
18
Erlebnis, das heißt, von einer relativ großen Gruppe, zur gleichzeitig und in ganz
ähnlicher Weise erlebte Emotion. Der Spaß ist dabei ,,augenblicksorientiert" und bedarf
der steten ,,Reizerneuerung."
68
Sprachgeschichtlich erschließt sich der Begriff als das
Vertreiben von Zeit. ,,Spasso" im Italienischen heißt Vergnügen oder Zeitvertreib. Diese
Art von Vergnügen oder Spaß bereitet vielen Menschen auch die Rezeption von
Comedy-Sendungen im Fernsehen. Besonders die witzige Komponente des
Spaßbegriffs kommt hier zum tragen. Spaß wird hier verstanden im Sinne von ,,joke"
ein schallendes Lachen, ein witziges Schmunzeln, aus der direkten Reizsituation heraus
entstanden, eine schnelle Erregung, die ebenso schnell auch wieder abflaut, wenn der
äußere Stimulus wegfällt. Neben dem ,nicht abendfüllenden Spaß', könnte eine weiter
Dimension von Spaß auch mit dem Begriff der Freude umschrieben werden. Sie
beinhaltet eine stärkere und länger anhaltende Emotion. Bereits im Duden wird bei Spaß
auf diese tiefere Bedeutung durch den Vergleich mit Freude und Vergnügen
hingewiesen.
Eng verwoben mit dem Spaß und somit auch nicht eindeutig abzugrenzen ist der Begriff
der Freude. Freude findet nach Mihaly Csikszentmihalyi statt, ,,wenn man nicht nur eine
bestehende Erwartung, ein Bedürfnis oder einen Wunsch erfüllt hat"
69
. Das wäre dann
nämlich die Kategorie des Vergnügens. Bei Freude muss man über die jeweilige
Vorprogrammierung hinausgegangen sein und etwas Unerwartetes erreicht haben,
etwas, das man sich davor noch nicht einmal vorgestellt hatte. Die Freude zeichnet
durch das Gefühl, dass man etwas Neues erreicht hat, eine gewisse Vorwärtsbewegung
aus.
Vom Spaß ist gerade in Buchtiteln für die Schule häufig zu lesen, nur wenige
verwenden hier den Begriff der Freude. Meiner Ansicht nach benutzen auch viele
Jugendliche das Wort Spaß, wenn sie eigentlich Freude meinen. So könnte der Begriff
der Freude in einer bestimmten Altersgruppe gänzlich aus der Mode geraten sein, so
dass diese die eigentlichen Freudengefühle dann lieber mit dem Modewort ,,Spaß"
umschreibt.
67
Bucher (2001, S. 69).
68
Kraus (Kraus 2001): ,Freude statt Spaß'.
69
Csikszentmihalyi (1993, S. 70): ,Flow. Das Geheimnis des Glücks'.
19
Abbildung 1:
70
Zusammensetzung des Glücks aus den unterschiedlichsten Komponenten wie zum
Beispiel Freude, Spaß, flow oder Zufriedenheit
Mihaly Csikszentmihalyi hat den Prozess untersucht, wie man ,,Glück durch die
Kontrolle über das eigene Innenleben"
71
erreicht. Beim so genannten ,flow` handelt es
sich um einen Zustand, ,,bei dem man in eine Tätigkeit so vertieft ist, dass nichts
anderes eine Rolle zu spielen scheint."
72
Selbst um einen hohen Preis würde man, nach
einer seiner Umfragen, etwas tun, nur um diese Erfahrung des ,flow` zu erreichen. Es ist
dabei der aristotelische Tätigseinsbegriff vom Glück, der hier umschrieben wird. Der
,flow` ist sich bei Csikszentmihalyi ebenso wie das Glück bei Aristoteles ein
Selbstzweck. Der ,flow` beschreibt einen selbst beeinflussbaren Freuden- und
Glückszustand, für dessen Erreichen es aber keinen ,,Königsweg"
73
gibt. Die
Einzigartigkeit eines jeden einzelnen erfordert einen eigenen Zugang. Jedem, der
erkennt, was ,flow` ist, davon geht Csikszentmihalyi aus, ist es möglich, sein Leben
dahingehend zu verändern. Er kann lernen, durch die Kontrolle der inneren Erfahrungen
70
Die Abbildung soll zeigen, dass meiner Meinung nach im Begriff des Glücks auch immer Momente der
Freude, des Spaßes und des ,flows` mit enthalten sind. Das Glück muss auf Grund seiner subjektiven
Erlebbarkeit und situativen Abhängigkeit aus den verschiedensten Komponenten bestehen. Auch unter
den einzelnen Komponenten können sich dabei Überschneidungen ergeben, die in dieser Graphik nicht
ausreichend dargestellt werden können. Der ,flow` beinhaltet neben Aspekten des Glücks auch solche des
Spaßes u.s.w.
71
Ebd., S. 19.
72
Ebd., S. 16.
73
Ebd., S. 16.
,FLOW`
SPAß
Freude
GLÜCK
20
seine Lebensqualität zu bestimmen. Csikszentmihalyi nimmt in seinen Ausführungen
keine konkrete Abgrenzung zwischen den Begriffen Glück, Freude und Spaß vor. Beim
,flow` handelt es sich damit, ebenso wie bei Spaß und Freude, um einen Teilaspekt von
Glück. Csikszentmihalyi setzt zwar Glück und ,flow` in ihrer Bedeutung gleich,
dennoch muss das Glück als umfassender gesehen werden. So gibt es nicht nur die, von
Aristoteles erkannte, aktive Komponente des Glücks, die aus dem Handeln heraus
entsteht, sondern auch passives Glück, das einen überkommt.
2.3 Zur Psychologie der Emotionen Glückspsychologie
In der Psychologie wird Glück, ,,eine positive, von den meisten Menschen angestrebte
Befindlichkeit, über die letztlich nur das Subjekt selber entscheiden kann,"
74
meist im
Rahmen der Emotionsforschung thematisiert. Dabei existieren nach Dieter Ulich so
viele verschiedene Meinungen darüber, was Emotionen sind, welchen Ursprung sie
haben, wie sie wirken u.s.w., dass noch nicht von Theorien der Emotion in der
Psychologie gesprochen werden kann. Werden Emotionen untersucht, so sind dies
zumeist negative, nämlich Angst oder Stress. Auffällig ist, dass sich im Vergleich dazu
nur wenige mit positiven Emotionen, wie dem Glück beschäftigen.
75
Nach Ewert sind
unterschiedliche Kategorien von Emotionen zu unterscheiden. Sie können zum einen als
kurze, vorübergehende Gefühlsregungen, zum anderen als Gefühlshaltungen, die
während des Lebens aufgebaut werden oder aber schließlich auch als Stimmungen, also
,,umfassende Gesamtbefindlichkeiten" längerfristig auftreten.
76
Des Weiteren kann man
auch unterschiedliche Emotionskomponenten analytisch unterscheiden. Nach
Kleinginna & Kleinginna gilt somit auch für das Glück eine subjektive, eine kognitive,
eine physiologische und eine behavioral-expressive Komponente.
77
Ulich schreibt den vorliegenden Aussagen über Emotionen, nachdem hier noch nicht
von Theorien gesprochen werden könne, eher die Funktion von Denkmodellen zu.
78
Diese begründen sich wie folgt:
74
Pressey, S. & Kuhlen, R. (1957) zit. in: Bucher(2001, S. 68).
75
Mayring (1991, S. 49 f.) bezieht sich hier auf eine umfangreiche Literaturanalyse von Carlson (1966).
Ebenso: Wlodarek-Küppers (1986, S. 4).
76
Ewert zit. bei Mayring (1991, S. 51).
77
Ebd., S. 51.
78
Ulich (1982, S. 99): ,Das Gefühl. Eine Einführung in die Emotionspsychologie'.
21
Nach dem biologisch-physiologischen Ansatz sind Emotionen wie zum Beispiel bei
Darwin ,,reaktivierte, erbbiologisch festgelegte und genetisch gesteuerte, oft nur noch
rudimentär oder spurenhaft vorhandene Reaktionsmuster, die als Dispositionen das
Überleben der Art garantieren". James/Lange gehen ganz entgegen unserem
Alltagsverständnis davon aus, dass Emotionen die ,,Empfindung der körperlichen
Veränderungen"
79
sind, die Rückmeldungen oder Informationen über körperliche
Prozesse geben. Glücksempfinden wäre hier eine Folge von physiologischen Prozessen.
Das hieße, wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern vielmehr sind wir
glücklich weil wir lachen.
80
Von dieser Einseitigkeit der Prioritätenverteilung wird
heute Abstand genommen. Man geht von einer ,,bio-psycho-sozialen Einheit von
Emotionsprozessen" aus.
81
Für Mandler sind Emotionen ,,Bewusstseinsinhalte, die als
Produkt aus physiologischer Aktivierung (Erregung) und der darauf bezogenen
kognitiven Interpretation zustande kommen und möglicherweise nur bei
Unterbrechungen von Handlungsverläufen auftreten."
82
Ebenfalls hier einzuordnen ist
der physiologische Glücksbegriff bei Sigmund Freud. Demnach entspringt, was man im
strengsten Sinne Glück heißt, ,,der eher plötzlichen Befriedigung hoch aufgestauter
Bedürfnisse und ist seiner Natur nach nur als ein episodisches Phänomen möglich."
83
Zur physiologischen Lokalisation des Glücks kann man sagen, dass es sich hierbei um
,,hirnphysiologische Prozesse auf allen Ebenen (...) (handelt), Erregung und Interesse
sind ebenso Voraussetzung wie Lust und Bindung."
84
Bei den kognitiv-handlungstheoretisch begründeten Denkmodellen sind Emotionen
nach Lazarus ,,zustandsbezogene wertende Stellungsnahmen oder Urteile, die als
Produkte kognitiver Aktivität anzusehen sind."
85
Sie sind demnach eher die Folge als
die Ursache der vorangegangenen kognitiven Bewertung einer Situation, was unserem
Alltagsverständnis bedeutend näher kommt, als die umgekehrte Annahme von James
und Lange. ,,Entscheidungsgrundlage für das Handeln sind die kognitiven
Einschätzungen". Emotionen sind demnach "komplexe, organisierte Zustände, die aus
79
Ebd., S. 104.
80
Lachen kann hier auch innerlich gemeint sein. Lachen zeigte sich in meiner Fragebogenauswertung als
häufigste Antwort auf die Frage wie man äußerlich erkennen kann, dass die Kinder glücklich sind.
81
Mayring (1991, S. 59).
82
Ulich (1982, S. 122).
83
Freud zit. bei Köhle(1999, S. 10): ,Wie die Seele das Glück erlebt. Die Sicht der Tiefenpsychologie'.
84
Mayring (1991, S. 59).
85
Ulich (1982, S. 122).
22
kognitiven Einschätzungen, Handlungsimpulsen und körperlichen Reaktionsmustern
bestehen.
86
In der gleichen Denkrichtung liegen zum Beispiel auch Scherer, Weinrich
und andere, denen zufolge Emotionen ,,Regulatoren des Anpassungsverhaltens
(darstellen), indem sie mangelnde Anpassung als Störung signalisieren und bessere
Anpassung anleiten."
87
Eine weitere Kategorie bilden die entwicklungsorientierten Denkmodelle in der
Emotionspsychologie. Aus der neueren Psychoanalyse ergibt sich ein Bild der
Emotionen als ,,erlebnismäßige Zustände, in denen sich vor allem Bedürfnisse und
Erfahrungen aus frühen zwischenmenschlichen Interaktionen und Beziehungen
spiegeln". In den neo-behavioristischen Lerntheorien sind Emotionen ,,gelernte
motivationale Erlebnis- und Handlungsbereitschaften bzw. sekundäre Bedürfnisse, die
das Verhalten beeinflussen". Im Rahmen der soziologischen Ansätze stellen die
Emotionen ,,Erlebnisse (oder aktualisierte Erfahrungen oder Antizipationen) der
Auseinandersetzung mit einer bestimmten Umwelt" dar. Diese Erlebnisse und
Erfahrungen werden dann zu Erwartungen oder Einstellungen. Nur in dieser
Denkrichtung wird darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, Emotionen personen- und
entwicklungsspezifisch bezogen auf die gegebene Umwelt zu untersuchen.
88
Neben der Emotionspsychologie befasst sich auch die Gesundheitspsychologie mit dem
Glück. Gesundheit schließt auch das subjektive Wohlbefinden und somit das Glück mit
ein. Andersherum gesagt, fördert das Glück erwiesenermaßen die Gesundheit.
89
86
Ebd., S. 113.
87
Ebd., S. 122.
88
Ebd., S. 122 f.
89
Mayring (1991, S. 53).
23
3. Annäherung an das Kindheitsglück
Wie aber sieht es mit dem kindlichen Glück aus? Sind Kinder per se glücklich? Goethe
umschreibt im Götz seine Ansicht mit: ,,Glückliches Kind! Das kein Übel kennt, als
wenn die Suppe lang ausbleibt"?
90
Um sich den Glückskonzepten von Kindern anzunähern, ist es ratsam zuerst den Begriff
der Kindheit zu klären und weiter die Entwicklungsphase, in der Kinder sich befinden
näher zu beleuchten.
3.1 Kindheit
Definiert wird Kindheit, als die, ,,sich der Embryonalzeit anschließende Lebensphase
zwischen Geburt und Eintritt der Geschlechtsreife. Nach der K. beginnt die Phase der
Jugend. Im rechtlichen Sinn endet die Kindheit des Menschen mit Erreichen des 14.
Lebensjahres (...). Für den einzelnen Menschen (...) ist die K. hauptsächlich durch das
Zusammentreffen biolog. Reifungs- und soziolog. Prägungsprozesse der
entscheidende Abschnitt seiner körperl., seel. und geistigen Entwicklung."
91
Mir einer solchen lexikalischen Definition werden zwar wichtige Aspekte von Kindheit
genannt; besondere und zum Verständnis beitragende Elemente fehlen jedoch. Die
Kindheit ist insofern ein besonderer Lebensabschnitt, als es hier um die Bewältigung
von elementaren Entwicklungsaufgaben geht. Diese sind nach Heidrun Bründel zum
einen der ,,Erwerb des Urvertrauens", einer ,,tragfähigen Beziehung" zu den Eltern und
der ,,Eintritt in soziale Beziehungen mit Gleichaltrigen". Zum anderen geht es um den
,,Aufbau der Geschlechtsidentität", einer ,,positiven Einstellung zum eigenen Körper",
den ,,Aufbau von intellektuellen Konzepten und Denkschemata" und die ,,Entwicklung
von Gewissen und Moral"
92
. Nur unter diesen Voraussetzungen können Kinder über ihr
eigenes Glücksempfinden reflektieren. Den Zeitraum der Kindheit mit einer
Altersangabe einzugrenzen, gestaltet sich als äußerst schwierig. Es gibt Sechsjährige
Kinder die sich körperlich und geistig auf dem Niveau von Vierjährigen befinden und
auf der anderen Seite auch Achtjährige, die man geradezu mit Zwölfjährigen
90
Goethe zit. bei Baacke (1999, S. 15): ,Die 6-12 Jährigen. Einführung in die Probleme des Kindesalters'.
91
Meyers Enzyklopädisches Lexikon (1975, S. 686).
92
Bründel/Hurrelmann (1996, S. 10): ,Einführung in die Kindheitsforschung'.
24
verwechseln könnte. ,,Jedes Kind kann den ihm gesellten Entwicklungsaufgaben und -
möglichkeiten vorauseilen oder nachhinken und dies wiederum in bestimmter Hinsicht
(Motorik, Intelligenz, Sprachvermögen, Emotionalität usf.)".
93
3.1.1 Pädagogische Sicht der Kindheit
Aus der Sicht der Pädagogik kann man, aufgrund einer Vielfalt von Ansätzen und
Positionen, nicht von einer Theorie der Kindheit sprechen. Im Mittelalter galten Kinder
als halbe, noch unfertige Menschen oder reduzierte Erwachsene mit einer noch nicht
fertigen menschlichen Persönlichkeit.
94
Diese Ansicht begründete die schwarze
Pädagogik, eine harte Erziehung, die darauf abzielte den Willen der Kinder zu brechen
und sie wieder zu Gott zu führen. Das Verständnis von Kindheit, wie wir es heute
kennen, musste erst noch entdeckt werden. Dabei ist dieses Verständnis nicht
gleichzusetzen mit der Zuneigung gegenüber den Kindern selbst.
95
Erst in der
Renaissance wurde Kindheit als etwas von Natur aus Gutes begriffen. Das soziale
Verantwortungsbewusstsein den Kindern gegenüber nahm zu. Rousseau forderte:
,,Menschen, seid menschlich, das ist eure vornehmste Aufgabe!"
96
Die harte Pädagogik
wird abgelöst von einer Pädagogik des ,,Reifenlassens" und der von Rousseau geprägten
,,negativen Erziehung"
97
. Heute gilt Kindheit als vom Erwachsenen unterscheidbare
Weise des Menschseins. Nach Ludwig Dunker zeigt sie sich unter anderem in der
,,staunenden und fragenden Erschließung der eigenen Lebenswelt, in der Artikulation
von Interessen und Wünschen wie in sozialen Handlungen, in den Versuchen,
Phänomene der Wirklichkeit zu deuten und dabei eigenständige Formen des
Philosophierens zu üben."
98
Kindheit ist heute auch eine ,,pädagogische Kindheit", in
der die Erwachsenen immer mehr Taten und Äußerungen filtern. Sie reagieren nicht
spontan, nicht als die Person, die sie sind.
99
Kindheit kennzeichnet sich durch das
Verhältnis von Individuation und Enkulturation. Das heißt, beim Hineinwachsen in die
Kultur muss die Entfaltung der Persönlichkeit des Kindes berücksichtigt sein, damit
dieses sich später aktiv gestaltend an der Gesellschaft teilhaben kann.
93
Baacke (1999, S. 56).
94
Ariès (1977, S. 99 f.): `Geschichte der Kindheit'.
95
Ebd., S. 209.
96
Rousseau (1981, S. 55): ,Emile oder Über die Erziehung'.
97
Ebd., S. 72.
98
Dunker(2001, S. 111 f.): ,Pädagogische Anthropologie des Kindes'.
99
Von Hentig zit. bei Ariès (1977, S. 34).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783836617062
- DOI
- 10.3239/9783836617062
- Dateigröße
- 705 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Psychologie und Pädagogik, Grundschulpädagogik und -didaktik
- Erscheinungsdatum
- 2008 (August)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- psychologie unterricht pädagogik philosophieren grundschule
- Produktsicherheit
- Diplom.de