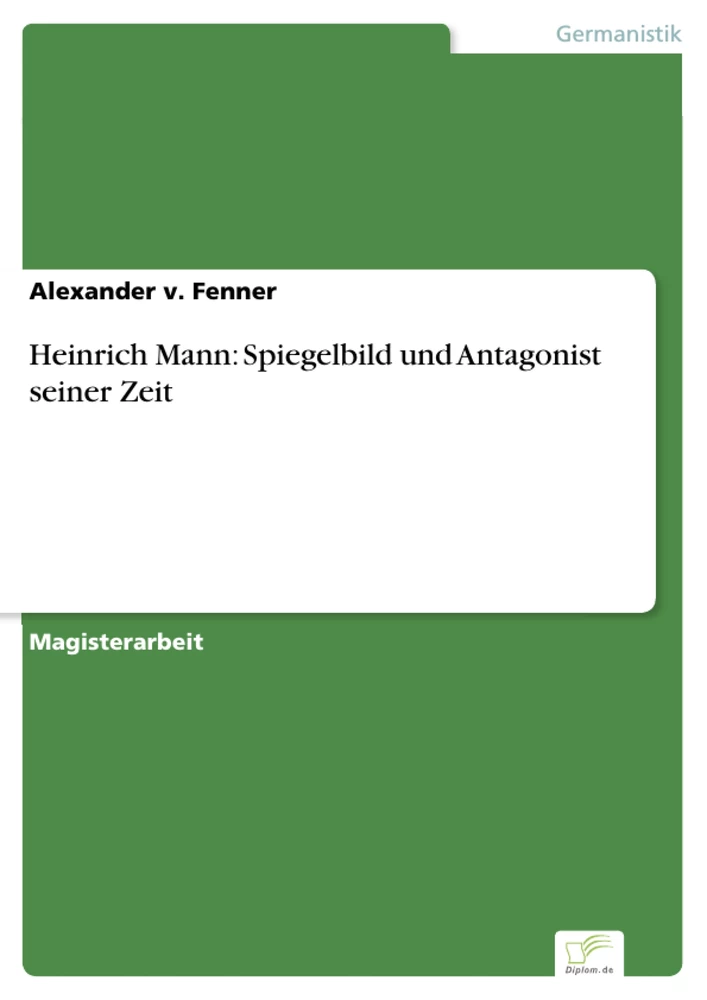Heinrich Mann: Spiegelbild und Antagonist seiner Zeit
©2006
Magisterarbeit
107 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert strömen zahlreiche Veränderungen auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene zusammen. In der ambivalenten Entzeit- und Aufbruchstimmung entfalten sich unterschiedliche Literaturtendenzen. Für den jungen Heinrich Mann wirken diese Prozesse in seinem schriftstellerischen Frühwerk nach, haben Anspruch auf Interpretation und die Hoffnung einer Überwindung der Fin de siécle - Stimmung.
Die in dieser Arbeit ausgewählten Romane - Im Schlaraffenland - Ein Roman unter feinen Leuten, Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen und Die Kleine Stadt bilden eine Entwicklungsreihe dieser Intention. Zunächst erscheinen sie in der Fassung einer satirischen Gesellschaftskritik und später in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts als Entwurf einer demokratischen Gesellschaft. Im folgenden Text werden die beiden erstgenannten Romane ohne Untertitel - Im Schlaraffenland - und - Professor Unrat - bezeichnet.
Diese Arbeit soll eben jene Entwicklungsphase Heinrich Manns zwischen 1900 und 1909 bis zum Beginn seines politischen Schreibens aufzeigen. Aufgrund biographischer und literarischer Einflüsse nimmt er eine gesonderte Stellung ein und zeigt einen Wandel in seinem Frühwerk. Seine kritisch-satirische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft verbunden mit einem besonderen Sprachstil münden nach dem Wendejahr 1905 in ein moralisierend demokratisches Gesellschaftsideal. Auf der einen Seite erschweren diese Positionen die Laufbahn des Literaten im deutsch nationalistischen Kaiserreich. Auf der anderen Seite machen sie ihn zu einem Vorreiter einer avantgardistischen Leserschaft.
Gang der Untersuchung:
Bevor der philosophische Einfluss Friedrich Nietzsches und die literarische Einwirkung vorwiegend französischen Ursprungs auf Heinrich Mann näher beleuchtet werden, wird diese Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über das Literaturverständnis geben.
Danach werden die drei genannten Romane in den Kapiteln 2., 3. und 4. behandelt und in Beziehung zueinander gesetzt. Es wird deutlich werden, dass ein starker Bruch Heinrich Manns zwischen seinen Satiren und seiner demokratischen Utopie besteht. Denn nach 1905 besinnt sich Heinrich Mann zurück auf die Zeit der Aufklärung, Jean Jacques Rousseaus Gesellschaftsideal und die Triasvorstellung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution 1789.
Seine Leitmotive von Macht und Geist, dem Dualismus von Gesellschaft […]
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert strömen zahlreiche Veränderungen auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene zusammen. In der ambivalenten Entzeit- und Aufbruchstimmung entfalten sich unterschiedliche Literaturtendenzen. Für den jungen Heinrich Mann wirken diese Prozesse in seinem schriftstellerischen Frühwerk nach, haben Anspruch auf Interpretation und die Hoffnung einer Überwindung der Fin de siécle - Stimmung.
Die in dieser Arbeit ausgewählten Romane - Im Schlaraffenland - Ein Roman unter feinen Leuten, Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen und Die Kleine Stadt bilden eine Entwicklungsreihe dieser Intention. Zunächst erscheinen sie in der Fassung einer satirischen Gesellschaftskritik und später in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts als Entwurf einer demokratischen Gesellschaft. Im folgenden Text werden die beiden erstgenannten Romane ohne Untertitel - Im Schlaraffenland - und - Professor Unrat - bezeichnet.
Diese Arbeit soll eben jene Entwicklungsphase Heinrich Manns zwischen 1900 und 1909 bis zum Beginn seines politischen Schreibens aufzeigen. Aufgrund biographischer und literarischer Einflüsse nimmt er eine gesonderte Stellung ein und zeigt einen Wandel in seinem Frühwerk. Seine kritisch-satirische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft verbunden mit einem besonderen Sprachstil münden nach dem Wendejahr 1905 in ein moralisierend demokratisches Gesellschaftsideal. Auf der einen Seite erschweren diese Positionen die Laufbahn des Literaten im deutsch nationalistischen Kaiserreich. Auf der anderen Seite machen sie ihn zu einem Vorreiter einer avantgardistischen Leserschaft.
Gang der Untersuchung:
Bevor der philosophische Einfluss Friedrich Nietzsches und die literarische Einwirkung vorwiegend französischen Ursprungs auf Heinrich Mann näher beleuchtet werden, wird diese Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über das Literaturverständnis geben.
Danach werden die drei genannten Romane in den Kapiteln 2., 3. und 4. behandelt und in Beziehung zueinander gesetzt. Es wird deutlich werden, dass ein starker Bruch Heinrich Manns zwischen seinen Satiren und seiner demokratischen Utopie besteht. Denn nach 1905 besinnt sich Heinrich Mann zurück auf die Zeit der Aufklärung, Jean Jacques Rousseaus Gesellschaftsideal und die Triasvorstellung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution 1789.
Seine Leitmotive von Macht und Geist, dem Dualismus von Gesellschaft […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Alexander von Fenner
Heinrich Mann: Spiegelbild und Antagonist seiner Zeit
ISBN: 978-3-8366-1702-4
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
1
Einleitung...1
1. Das Fin de siécle und Heinrich Mann ...6
1.1 Begriffliche
Bestimmung
und
Bedeutung des Fin de siécle...6
1.2
Literarische Aspekte und historisches Umfeld im Fin de Siécle ...9
1.2.1 Literaturgeschichte...9
1.2.2 Zur Literaturkritik um die Jahrhundertwende...12
1.2.3 Kunstverständnis um 1900...16
1.2.4 Zeitgeschehen ...18
1.3
Heinrich Mann und sein Verhältnis zum Fin de siécle ...21
1.3.1 Zur Position Heinrich Manns in der zeitgenössischen Literatur...21
1.3.2 Philosophische Einflüsse Friedrich Nietzsches auf Heinrich Mann...24
1.3.3 Literarische Einflüsse aus Frankreich...28
1.4 Zusammenfassung...32
2. ,,Im Schlaraffenland" (1900)...34
2.1 Entstehungsgeschichte und Plot des Romans ...34
2.1.1 Heinrich Manns Orientierung am Vorbild Guy de Maupassants ,,Bel
Ami" (1885) ...36
2.2 Die Figuren und ihr Beziehungsgeflecht ...37
2.3 Erster sozialkritischer Roman und Gesellschaftssatire ...40
2.4 Erzählform und Stilmittel ...48
2.5 Zusammenfassung...50
2
3. ,,Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen" (1905)...52
3.1 Entstehungsgeschichte und inhaltliche Konzeption...52
3.2 Figurengruppen des Romans...55
3.2.1 Das Machtverhältnis zwischen Unrat und seinen Schülern
Lohmann, von Erztum und Kieselack...55
3.2.2 Unrat und die Künstlerin Rosa Fröhlich ...59
3.2.3 Das Bild Unrats und der kleinstädtischen Bevölkerung ...63
3.3 Lesarten des Romans und Heinrich Manns Entwicklung in seiner
zweiten satirischen Gesellschaftskritik ...67
3.4 Sprache...74
3.5 Zusammenfassung...76
4. ,,Die Kleine Stadt" (1909) Heinrich Manns Beginn als politischer
Schriftsteller ...78
4.1 Entstehungsgeschichte ...78
4.2 Synthese aus Kunst und Leben Die italienische Kleinstadt und die
Operngesellschaft...80
4.3 Das musikalische Thema Giacomo Puccini (1858-1924)...84
4.4 Heinrich Manns ,,Die Kleine Stadt" (1909) als demokratischer Roman ...87
4.5 Zusammenfassung...94
5. Schlussbemerkung und Ausblick ...96
6. Literaturverzeichnis ...101
3
Einleitung
Auf der Schwelle zum 20. Jahrhundert strömen zahlreiche Veränderungen auf
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene zusammen. In der
ambivalenten Endzeit- und Aufbruchstimmung entfalten sich unterschiedliche
Literaturtendenzen. Diese Prozesse haben Einfluss auf dem jungen Heinrich
Mann und wirken sich auf sein schriftstellerisches Frühwerk aus. Sie
entwickeln gleichzeitig den Anspruch auf Interpretation und die Hoffnung auf
eine Überwindung der Fin de siècle - Stimmung. Die im Rahmen dieser Arbeit
ausgewählten Romane ,,Im Schlaraffenland Ein Roman unter feinen
Leuten"
1
(1900), ,,Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen"
2
(1904)
und ,,Die Kleine Stadt"
3
(1909) bilden eine Entwicklungsreihe dieser
Intention. Die Thematik der Reihe beginnt mit einer satirischen
Gesellschaftskritik und endet in der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts als
Entwurf einer demokratischen Gesellschaft. Im folgenden Text werden die
beiden erstgenannten Romane ohne Untertitel, also als ,,Im Schlaraffenland"
und ,,Professor Unrat", erscheinen. Was diese Arbeit zeigen möchte, ist eben
jene Entwicklungsphase Heinrich Manns zwischen 1900 und 1909, die ihn
zum Beginn seines literarischen Schaffens zu einem politischen Autor machte.
Aufgrund biographischer und literarischer Einflüsse nimmt er in diesem
Zeitraum eine gesonderte Stellung ein und zeigt dabei den hier untersuchten
Wandel in seinem Frühwerk. Seine kritisch - satirische Auseinandersetzung
mit der Gesellschaft (verbunden mit einem besonderen Sprachstil) mündet
nach dem Wendejahr 1905 in ein moralisierend demokratisches
Gesellschaftsideal. Auf der einen Seite erschweren gerade diese Positionen die
biographische Laufbahn des Literaten im deutsch - nationalistischen
Kaiserreich. Auf der anderen Seite machen sie ihn zu einem Vorreiter einer
avantgardistischen Leserschaft.
Bevor der philosophische Einfluss Friedrich Nietzsches und die Einwirkung
der Literatur vorwiegend französischen Ursprungs auf Heinrich Mann näher
1
Vgl. Heinrich Mann: Im Schlaraffenland - Ein Roman unter feinen Leuten, Frankfurt a.
Main, 2001
2
Vgl. Heinrich Mann: Professor Unrat, Hamburg, 2005
3
Vgl. Heinrich Mann: Die Kleine Stadt, Frankfurt a. Main, 2003
4
beleuchtet werden, wird diese Arbeit zunächst einen kurzen Überblick über
das Literaturverständnis geben. Danach werden die drei genannten Romane in
den Kapiteln 2., 3. und 4. behandelt und in Beziehung zueinander gesetzt. Es
wird deutlich werden, dass ein starker Bruch Heinrich Manns zwischen den
Satiren und seiner demokratischen Utopie besteht. Denn nach 1905 besinnt
sich Heinrich Mann zurück auf die Zeit der Aufklärung, Jean Jacques
Rousseaus Gesellschaftsideal und die Triasvorstellung von Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit aus der Französischen Revolution von 1789. Manns
Leitmotive von Macht und Geist, dem Dualismus von Gesellschaft und
Individuum und die Künstlerproblematik stehen als literarische Phänomene
seines Schaffens am Anfang des 20. Jahrhunderts.
Als Sekundärliteratur haben an dieser Arbeit besonders die beiden
Dissertationen von Wilfried F. Schoeller ,,Künstler und Gesellschaft Studien
zum Romanwerk Heinrich Manns zwischen 1900 und 1914"
4
und Jürgen Zeck
,,Die Kulturkritik Heinrich Manns in den Jahren 1892 1909"
5
großen Anteil.
Für die Textarbeit an den beiden Satiren sind dazu die Untersuchungen von
Ralf Siebert ,,Heinrich Mann: Im Schlaraffenland, Professor Unrat, Der
Untertan"
6
, Renate Werner ,,Skeptizismus, Ästhetizismus, Aktivismus"
7
, Elke
Emrich ,,Macht und Geist im Werk Heinrich Manns"
8
und Thomas Epple
,,Heinrich Mann Professor Unrat"
9
anzuführen. Die Aufsätze Elke
Segelckes ,,Die Kleine Stadt Das Hohelied der Demokratie"
10
und Stefan
Ringels ,,Heinrich Mann und Puccini"
11
bzw. ,,Heinrich Mann Ein Leben
wird besichtigt"
12
haben dies für den demokratischen Roman ,,Die Kleine
Stadt" geleistet. Zur (Selbst-) Einschätzung Heinrich Manns helfen folgende
4
Vgl. Wilfried F. Schoeller: Diss. Künstler und Gesellschaft Studien zum Romanwerk
Heinrich Manns zwischen 1900 und 1914, München, 1978
5
Vgl. Jürgen Zeck: Diss. Die Kulturkritik Heinrich Manns in den Jahren 1892 1909,
Hamburg,
1965
6
Vgl. Ralf Siebert: Heinrich Mann: Im Schlaraffenland, Professor Unrat, Der Untertan,
Siegen, 1999
7
Vgl. Renate Werner: Skeptizismus, Ästhetizismus, Aktivismus, Düsseldorf, 1972
8
Vgl. Elke Emrich: Macht und Geist im Werk Heinrich Manns, Berlin, 1981
9
Vgl. Thomas Epple: Heinrich Mann - Professor Unrat, München, 1998
10
Vgl. Elke Segelcke: ,,Die Kleine Stadt" als Hohelied der Demokratie, in: Heinrich
Mann Jahrbuch, Bd. 5., Lübeck, 1987, S. 1 - 29
11
Vgl. Stefan Ringel: Heinrich Mann und Puccini, in: Heinrich Mann Jahrbuch, Bd. 19.
Lübeck, 2003, S. 97 - 141
12
Vgl. Stefan Ringel: Heinrich Mann Ein Leben wird besichtigt, Darmstadt, 2000
5
Publikationen: der Briefwechsel Heinrich Mann Ludwig Ewers
13
, André
Banuls ,,Heinrich Mann"
14
, Ulrich Weisstein ,,Heinrich Mann"
15
und Hugo
Dittberner ,,Heinrich Mann"
16
. Alle übrigen Autoren der Sekundärliteratur
ergänzen das Bild Heinrich Manns und meinen Versuch der Wiedergabe
seines Entwicklungsprozesses im Zeitalter des Fin de siècle.
13
Vgl. Heinrich Mann Briefe an Ludwig Ewers 1889 - 1913, Berlin, 1980
14
Vgl. André Banuls: Heinrich Mann, Stuttgart, 1970
15
Vgl. U. Weisstein: Heinrich Mann, Tübingen, 1962
16
Vgl. Hugo Dittberner: Heinrich Mann, Eine kritische Einführung in die Forschung,
1974
6
1. Das Fin de siécle und Heinrich Mann
1.1 Begriffliche Bestimmung und Bedeutung des Fin de siécle
Um den Zeitraum darzustellen, der mit den zu behandelnden Romanen
Heinrich Manns gemeint ist, ist es notwendig auf die Epochenbezeichnung
einzugehen. Eine exakte zeitliche Einordnung ist wie in allen Literaturepochen
kaum möglich. In etwa ist aber ein zwanzigjähriger Abschnitt von den späten
achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts bis 1910 gemeint.
17
Der Begriff ,,Fin de siécle " findet sich als solcher zuerst bei Emile Zola 1886
in seinem Roman ,,L'Oeuvre".
18
Schon bald entwickelte sich dieser dem
lateinischen ,,finis saeculi" entlehnte Begriff zum Mode- und Schlagwort.
Trotz der verschiedenen literarischen Strömungen wird die Décadence zum
wichtigsten Synonym in der europäischen Literatur um die Jahrhundertwende.
Seine Ursprünge reichen aber schon bis in die dreißiger Jahre des 19.
Jahrhunderts zurück.
19
Der hauptsächliche Ansatzpunkt für die Motive der Literaturepoche ist eine
Endzeitstimmung gleichzeitig begleitet von einem Modernitätsbewusstsein.
Gemeint ist damit ist eine allgemeine Vorstellung vom Niedergang des ganzen
Zeitalters auf politischer, gesellschaftlicher, kultureller und moralischer Ebene,
die im besonderen die Thematiken der physischen Schwäche,
Nervenzerrüttung und Hysterie anspricht.
20
Schwerpunkte der
Dekadenzliteratur bilden sich in Frankreich, Österreich (das ,,Junge Wien")
und England. Dabei gehören Flaubert, Baudelaire, Gautier, Hofmannsthal und
Oscar Wilde zu ihren bekanntesten Vertretern.
17
Vgl. Reallexikon d. deutschen Literaturwissenschaft , Hrsg. Klaus Weimar, Berlin, 1997,
,,Bezeichnung für eine Übergangsphase, die mit der Abkehr vom Naturalismus um 1890
(in Frankreich bereits um 1880) beginnt und erst um 1910 mit dem Aufkommen des
Expressionismus endet."
18
Ebenda
19
Vgl. Wolfdietrich Rasch: Die literarische Décadence um 1900, München, 1986, S. 31
20
Vgl. Reallexikon d. deutschen Literaturwissenschaft, Hrsg. Klaus Weimar, Berlin, 1997
7
Im wilhelminischen Deutschland war die Übernahme des Begriffs ,Fin de
siécle` gleichbedeutend mit kritischer Distanzierung.
21
In diesem
Zusammenhang ist Nietzsche, der sich selbst als denjenigen mit dem größtem
Dekadenzverständnis bezeichnete, einer der wichtigsten Gradmesser für
deutsche Schriftsteller. Die entscheidenden Impulse gehen aber von Frankreich
aus: J. K. Huysman wird zur Leitfigur des europäischen Fin de siécle.
22
Sein
Kultbuch ,,A rebours" (,,Gegen den Strich"), in dem der Protagonist Des
Esseintes sich eine künstliche Welt aus einer Position physischer und
psychischer Schwäche schafft, wurde zum Inbegriff der dekadenten Thematik.
Neben den willensschwachen Verfallsmotiven, wie den verfeinerten,
überreizten Nerven sowie den Krankheitsmotiven, steht der begleitende
Lebenskult nicht ausnahmslos im Widerspruch. Im sogenannten
,,Renaissancekult" erzeugt die Dekadenz eine Spannung zwischen
Lebensmüdigkeit und emphatischer Lebensbejahung. Kennzeichnend dafür
sind die Romane J. P. Jacobsons, Hermann Bangs und Heinrich Manns, dessen
Anspruch auf eine hysterische Renaissance in der Romantrilogie ,,Die
Göttinnen" zum Ausdruck kommt.
23
Jens Malte Fischers Kommentar zur Epoche des Fin de siécle setzt sich für
einen begrenzten Zeitraum von 1890 bis 1910 mit einer scharfen Trennung
von Endzeitstimmung und Aufbruchswillen aus. Anders definiert Wolfdietrich
Rasch das Zeitbewusstsein des Fin de siécle im Sinne von Endzeitstimmung
und Modernität: ,,Aus dem französischen meint es nicht jung, nicht naiv, nicht
konventionell, aber auch Müdigkeit, Nervenschwäche und blasierte Skepsis".
24
Eine Formel des Spätzeitlichkeitsbewusstseins kann demnach lauten: ,,... die
Spätzeit einer Zivilisation, das Ende einer Epoche, die zwar von den
Ursprüngen schon weit entfernt ist, aber doch willensstärker ist als die Endzeit
des Jahrhunderts, ... ".
25
Übergeordnet sieht Rasch das zeitgenössische 1900
wie folgt: ,,Es ist das wache Bedürfnis der Menschen, die eigene Gegenwart,
ihre eigene geschichtliche Situation zu verstehen, sich ihrer möglichst genau
bewusst zu werden und in ihrer Lebensgestaltung dem nahe zukommen was
21
Vgl. Reallexikon d. deutschen Literaturwissenschaft, Hrsg. Klaus Weimar, Berlin, 1997
22
Ebenda
23
Ebenda
24
Vgl. Wolfdietrich Rasch: Die literarische Décadence um 1900, München, 1986, S. 31
25
Ebenda, S. 35
8
zeitgemäß ist."
26
Denn nach dem fortschreitenden technischen und
naturwissenschaftlichen Wandel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
legt die Literatur den Schwerpunkt auf das Individuum.
Während Ernst Robert Curtius die Fin de siécle Stimmung von Skepsis,
Pessimismus und dekadenten Genießertum bestimmt sieht, stellen Jacque
Riviére und Ernst Stadler nach 1900 eine andere Entwicklung fest. Stadler
sucht in der Bewegung eine lebenskräftige Ausdrucksgebärde: ,,Der Wille regt
sich vorwärts zu zeigen, statt rückwärts, Anfang zu sein...".
27
Im selben Tenor
schreibt Peter Sprengel, dass die Literatur des Fin de siécle im
Spannungsverhältnis zwischen Positionen des Verfalls und der
Aufbruchstimmung steht. Fritz von Ostini ist hier ein namhafter Vertreter, der
ein Anti - Fin de siécle vertrat: ,,Zur Jahrhundertwende gehört die
Aufbruchstimmung der Jugendbewegung, der Lebensreform und des
Jugendstils ebenso wie das Untergangspathos der Dekadenz" gehörte.
28
Gerade dieser Wandlung der Literaturepoche wird sich Heinrich Mann in
diesem Zeitraum zwischen 1900 und 1910 bewusst. Er nimmt in seinem
Frühwerk ästhetizistische Inhalte an, wendet sich jedoch im Laufe des
Jahrzehnt wieder davon ab. Ausgehend vom Fokus eines
gesellschaftskritischen Blick wendet sich sein Werk zu einer humanistisch
orientierten Perspektive.
26
Vgl. Wolfdietrich Rasch: Die literarische Décadence um 1900, München, 1986, S. 30
27
Ebenda, S. 37
28
Vgl. Peter Sprengel: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870 1900, München,
1998, S. 122
9
1.2 Literarische Aspekte und historisches Umfeld im Fin de Siécle
1.2.1 Literaturgeschichte
Für die Literaturgeschichte heißt es die Literatur in ihren historischen
Zusammenhängen und Entwicklungen zu sehen.
29
In diesem Abschnitt der Arbeit soll die Epoche des Fin de siécle und besonders
ihr Ausklang nach 1900 in Beziehung zur literarischen Historie der Epoche
gezeigt werden. Für den Zeitraum der Jahrhundertwende ist
literaturgeschichtlich zu sehen, dass Begriffe aus der Kunst für die Literatur
übernommen wurden. ,,Naturalismus, Impressionismus und Expressionismus
stammen aus der Kunstgeschichte"
30
. Allerdings sind die vielfältigen
Benennungen problematisch, da der Impressionismus in der
Literaturgeschichtsschreibung zum Beispiel auch ,,Jugendstil", ,,Neuromantik"
und ,,Kunst der Jahrhundertwende" genannt wird.
31
Der Stil des Naturalismus gibt in der Literatur die sozialen Umstände der
Gesellschaft möglichst wirklichkeitsgetreu wieder. In der Dekadenzliteratur
hingegen steht die Künstlichkeit aller Motive im Vordergrund. Für das
Individuum wie für sein Umfeld gilt eine Verfeinerung der Nerven in allen
Lebensbereichen als hauptsächliche Intention. Daraus ergeben sich
Spannungsfelder zwischen Gesellschaft und Individuum, die in der Fin de
siécle Literatur eines der wichtigsten Themen bilden.
Aus der umfangreichen Forschungsliteratur möchte ich hier den Aufsatz
Helmut Koopmanns ,,Entgrenzung. Zu einem literarischen Phänomen um
1900"
32
anführen, der die Problematik der Dekadenzliteratur behandelt.
Einleitend relativiert er die Veränderungen durch diese neue Form der
Literatur: ,,Was sich wie die Proklamation einer neuen eigenen
Kunstauffassung liest, ist freilich in erster Linie offenbar nur eine Reaktion auf
29
Vgl. Metzler Literatur Lexikon, Hrsg. von Günther und Irmgard Schweikle, 2. überarb.
Auflage, Stuttgart, 1990
30
Vgl. Kritik in der Zeit, Hrsg. Manfred Diersch, Halle, 1985, S. 9
31
Ebenda
32
Vgl. Helmut Koopmann: ,,Entgrenzung. Zu einem literarischen Phänomen um 1900", in: Fin
de siècle. Zu Literatur und Kunst in der Jahrhundertwende, hrsg. v. Roger Bauer
u.a., Frankfurt a. M., 1977, S. 73 - 92
10
naturalistische Kunstvorstellungen und Wirklichkeitsinterpretationen."
33
Im
Folgenden erläutert er die Begriffe ,,Entgrenzung" und ,,Erweiterung":
,,Wo die neue Dichtung um 1900 nicht Reaktion auf naturalistische Forderungen und
Vorstellungen ist, da ist sie doch eine solche auf eine vom aufgeklärt
naturwissenschaftlichen Denken immer stärker rationalisierte, eingegrenzte, enger
gewordene Welt. Diese als beengend erfahrene Wirklichkeit poetisch-imaginativ zu
erweitern, ihre Elemente neu zu synthetisieren, ist das Ziel der
Entgrenzungstendenzen."
34
Besonders wirkungsvoll ist dieser Prozess z. B. durch die D'annunzio
Besprechungen Hofmannsthals in den 90er Jahren dargestellt.
Im Zusammenhang mit dem Frühwerk Heinrich Manns ergibt sich aus dieser
neuen Sicht eine Tendenz der Konfliktthematik von Gesellschaft und
Individuum.
35
Dieselbe Entgrenzungstendenz ist nach Helmut Koopmann
besonders in der Romantrilogie ,,Die Göttinnen" beschrieben. Dort ist es das
,,hohe Lebensgefühl" des Individuums, dass die Grenzen der Individualität
sprengt. Herzogin Violante von Assy durchlebt in dieser Trilogie das hohe
Lebensgefühl in drei Stadien als Freiheitskämpferin ,,Diana", als
kunstbeflissene ,,Minerva" und als wollüstige ,,Venus". Die behandelten
Hauptmotive ,,Kunst" und ,,Leben" sind in Heinrich Manns Frühwerk und für
das Fin de siécle von großer Bedeutung.
Zur Ausbildung bestimmter Figurendarstellungen äußert Koopmann sich wie
folgt: ,, ... dort, wo die Entgrenzungstendenzen gegen die Normen und
Grenzen der Gesellschaft stießen, konkretisiert sich dieser Konflikt nicht selten
im Typus des scheiternden oder gescheiterten Abenteurers und in dem des
körperlich oder seelisch Kranken."
36
Daraus ergibt sich ,,eine Erklärung für
33
Vgl. Helmut Koopmann: ,,Entgrenzung. Zu einem literarischen Phänomen um 1900", in: Fin
de siècle. Zu Literatur und Kunst in der Jahrhundertwende, hrsg. v. Roger Bauer u. a.,
Frankfurt a. M., 1977, S. 77
34
Ebenda
35
Ebenda, S. 83: ,,Wie sehr die neue Interpretation des Dichterischen in den letzten Jahren vor
1900 (mit der Intention, die traditionellen Grenzen des dichtenden Ichs zu erweitern, sich
zu entgrenzen) fast automatisch zu Konfliktsituationen mit der Gesellschaft führte
dokumentiert auch das Frühwerks Heinrich Manns."
11
das Interesse am Künstler um 1900"
37
. Denn ,,Künstler sind Abenteurer, die
ihren Entgrenzungsbetrieb kompensiert und sublimiert haben. ... Die Kunst
bietet einen Freiraum, innerhalb dessen die Grenzen der wirklichen Welt
imaginär gesprengt werden können."
38
Für Koopmann ist das Fazit zur
Entgrenzung in der Fin de siécle Epoche:
,,Gewiß ist der Wunsch nach Entgrenzung in vielen Dingen bloß eine Reaktion auf
den Naturalismus und auf die Welt, deren literarischer Ausdruck dieser war. Aber das
mindert nicht seine produktive Bedeutung. Im Bereich der Literatur gibt es kaum
etwas anderes als Reaktionen. Wichtiger ist ohnehin, dass hier Probleme sichtbar
werden, die die Moderne überhaupt betrafen."
39
Außerdem folgert er, dass die nachfolgende Epoche des Expressionismus den
Trend der Entgrenzung nach 1900 fortsetzt.
40
Wie auch Koopmann sieht Zmegac das Interesse am Künstler um die
Jahrhundertwende als eines der Hauptthemen. Für Zmegac bedeutet das
konkret, dass ,,das Motiv der Spaltung von Schaffen und Wirklichkeit und
ebenso die Kluft zwischen dem Leben des Künstlers und dem der ,,anderen"
Menschen ..."
41
eines der zentralen Themen der Jahrhundertwende sind.
Es sind somit die gegensätzlichen Tendenzen, die die Literatur um die
Jahrhundertwende ausmachen. Damit wird auch ein gänzlich verändertes
Leseverhalten bewirkt. Es scheint eine neue Zeit für die Rezeption der
Literatur angebrochen zu sein.
42
Einen anderen Fokus legt Gotthard Wunberg in seinem Werk
,,Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne"
43
auf den
36
Vgl. Helmut Koopmann: ,,Entgrenzung. Zu einem literarischen Phänomen um 1900", in: Fin
de siècle. Zu Literatur und Kunst in der Jahrhundertwende, hrsg. v. Roger Bauer u. a.,
Frankfurt a. M., 1977, S. 87
37
Ebenda, S. 88
38
Ebenda
39
Ebenda, S. 91
40
Ebenda, S. 92
41
Vgl. Viktor Zmegac: Kleine Geschichte der deutschen Literatur, Wiesbaden, 2004, S. 265
42
Ebenda, S. 73
43
Vgl. Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne, Tübingen,
2001
12
literaturhistorischen Zusammenhang. Er geht davon aus, dass aus dem
Interesse an historischen Feldern auch die Schreibweise eine historistische
ist.
44
Das heißt, dass das Verfahren des positivistischen Historismus im Fin de
siécle übernommen wird. Damit sind Aufzählung, Vollständigkeitstendenz,
historisch korrekte Benennung, Detailliertheit und Enzyklopädistik gemeint.
45
Für die Epochenbezeichnung der Dekadenz bedeutet es einen Versuch der
Zeitgenossen ,,die Literatur der Zeit und damit letztlich sich selbst aus den
eigenen historischen Bedingungen zu verstehen."
46
Ein gutes Beispiel für die Vielfalt des Fin de siécle ist der Aufsatz von Bengt
A. Sørensen ,,Der ,,Dilettantismus" des Fin de siécle und der junge Heinrich
Mann", der als These den Dilettantismus als einen ,,Schlüssel zum historischen
Verständnis"
47
der Epoche sieht. Seine These ist insofern bedeutend, da
Heinrich Mann sich in seinem Roman ,,In einer Familie" (1894) mit dem
Dilettantismus beschäftigt hat. Leitendes Vorbild dieser Zeit und dieser
Thematik war der französische Literat Paul Bourget.
1.2.2 Zur Literaturkritik um die Jahrhundertwende
Der Literaturkritik und der Literaturgeschichte ist um die Jahrhundertwende
ein weit umrissener Rahmen eingeräumt worden, der hier nur im Ansatz
dargestellt werden kann.
Gotthart Wunberg hat sich in seiner Untersuchung zur Jahrhundertwende in
einem Kapitel auch mit der Literaturkritik beschäftigt. Grundlegend darin sind
die Thematik des Helden und der Zukunft als Kriterien der Moderne
festzustellen.
48
Interessant ist für Wunberg der Weg, der dazu führte:
44
Vgl. Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne, Tübingen,
2000, S. 59
45
Ebenda, S. 81
46
Ebenda, S. 78
47
Vgl. B. A. Sørensen: Der Dilettantismus des Fin de siécle und der junge Heinrich Mann, in:
Orbis litterarum 24, 1969, S. 251
48
Vgl. Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne, Tübingen,
2001, S. 151
13
,,Speziell für die Literatur erhoffte man sich dementsprechend in den naturalistischen
Kreisen der 80er und 90er Jahre zweierlei: eine ,,Zukunft der Literatur", in der die
Misere der zeitgenössischen Dichtung überwunden wäre; und einen Helden, der das
zuwege brächte, der das gesunkene literarische Niveau etwas anhöbe und dadurch
die deutsche Dichtung den ausländischen Vorbildern ebenbürtig machte:
Skandinavien, Frankreich und Russland vor allem; man wollte sich neben Ibsen, Zola
und Dostojewski sehen lassen können, man wollte wieder konkurrenzfähig sein."
49
Außerdem seien die Zukunftsvorstellungen in Deutschland am Ende des 19.
Jahrhunderts von drei verschiedenen Vorraussetzungen bestimmt. ,,Sie waren
marxistisch im Anstoß und christlich-soteriologisch in der Terminologie, aber
Nietzsche verhilft ihnen wenn auch verzerrt, übertrieben, reaktionär,
moralisch ( ... ) zum Durchbruch."
50
Nach Wunberg hat die Heldenthematik im 19. Jahrhundert eine besondere
Bedeutung:
,,Kein Jahrhundert hat sich so sehr an seine Helden gehalten, ihm so viele Denkmäler
gebaut wie das neunzehnte. Zu keiner Zeit wurden von der Forschung so viele
Biographica gesammelt, um sie zum Monument eines monumentalen
Lebens
zusammenzusetzen. Die Literaturkritik, die ihren Helden, ihren Messias forderte,
wollte nichts anderes."
51
Im weiteren Verlauf sieht Wunberg individuelle und utopische Erwartungen
als Ursachen für die grundlegenden Zukunftsfaktoren der literarischen Kritik.
52
Seine Schlussfolgerung für die Literaturkritik um die Jahrhundertwende lautet:
,,Die Schlagworte der Zeit werden zu Kategorien der Literaturkritik. Die Literatur
der Moderne wird gemessen an ihrer Zukunftsfähigkeit und allem was damit
zusammenhängt. Alles andere hat sich dem unterzuordnen. Begriffe wie ,,Erlöser"
und ,,Messias", ,,Überwindung" und ,,neue Menschen", ja ... ,,neu" beschreiben die
49
Vgl. Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne, Tübingen,
2001, S. 151, S. 150
50
Ebenda, S. 153
51
Ebenda, S. 155
52
Ebenda, S. 158
14
literarische Moderne als Vorstadium, als Vorbereitung auf eine größere Zeit, die die
Erfüllung erst noch bringen wird."
53
Dabei ist ihm folgendes wichtig zu sehen:
,,[D]ie Schlagworte der Zeit ... [werden] zu Kategorien der Literaturkritik ... .
Aufgrund dieser Feststellung blieb nur eine Lösung: ,,Der ,,Ausweg", der sich
schließlich fand, war ein ,,Weg nach Innen"; allerdings in doppelter Hinsicht. Die
Alternative hieß: die eigene Psyche, also, was man gemeinhin Décadence nannte;
oder - die Heimatdichtung."
54
Der wichtigste Literaturkritiker zur Zeit der Jahrhundertwende im
deutschsprachigen Raum ist Hermann Bahr. Er gilt als Vordenker in den
Literaturepochen vom Naturalismus bis zum Expressionismus, oder wie
Wunberg es ausdrückt, ,,Früherkenner von literarischen und kulturellen
Phänomenen"
55
. Seine literarische Quellen waren Ibsen, Bourget, Barrés,
Flaubert, Zola, Maeternlinck, Oscar Wilde, Morris, D'Annunzio, sowie
Spanier, Polen und Tschechen
56
. Ein Teil dieser Quellen dienten auch Heinrich
Mann als literarische Grundlagen. Bahrs Literaturkritik für die Moderne
bedeutete, sie modern zu verstehen: ,,Es heißt sie dynamisch zu verstehen. Sein
[Bahrs] Begriff von Dynamik hieß ,,Überwindung" ..., es komme darauf an,
die Welt, die immer nur verschieden interpretiert worden sei, zu verändern."
57
Mit Hermann Bahr und seinem Konkurrenten Karl Kraus mag der
Theaterkritiker Alfred Kerr aus Berlin noch einen wichtigen Aspekt für den
Kritiker seiner Zeit nennen: ,,So wie Kunst im Zeichen von Vitalismus und
Lebensreform dem Selbstgenuß des Rezipienten, seiner Lebenssteigerung
dienen soll, so gilt jetzt die Rezension als eine Form der Selbstbefriedigung
des Kritikers."
58
53
Vgl. Gotthart Wunberg: Jahrhundertwende. Studien zur Literatur der Moderne, Tübingen,
2001, S. 151, S. 160
54
Ebenda, S. 162
55
Ebenda, S. 343
56
Ebenda, S. 344
57
Ebenda, S. 345
15
Einen anderen Ansatz bietet Oliver Pfohlmann in seinem Beitrag
,,Literaturkritik in der literarischen Moderne" aus ,,Literaturkritik
Geschichte, Theorie, Praxis"
59
. Darin äußert Pfohlmann, dass sich zur
übergreifenden Benennung der Terminus ,,impressionistische Literaturkritik"
durchgesetzt habe.
60
Des weiteren passe sich die Form der Literaturkritik den
Ansprüchen der Literatur an, sie komme zu einer Subjektivierung, zu einer
Wendung nach innen.
61
Wichtiger als die reine Bewertung von Literatur werde
die Wiedergabe von Gefühlen und Assoziationen des Kritikers bei der
Lektüre.
62
Somit hat sich, wie es im Vorwort von ,,Kritik in der Zeit"
63
ausgedrückt wird,
das Dichtungsverständnis dahingehend verändert, dass entgegen dem
Naturalismus nicht mehr die Überbewertung naturwissenschaftlicher
Sachlichkeit und Objektivität als ästhetische Norm gilt.
64
Vielmehr bedeute es:
,,Ausstellung der Subjektivität des produktiven Individuums, das im Werk die
Welt aus sich herausschleudert, wird zum Schaffensideal des
Expressionisten."
65
Inhaltlich dagegen gebe es Verbindungen zum Naturalismus, indem Kritik an
der bedrückenden Gesellschaft des imperialistischen Kaiserreiches geübt
werde.
66
Die Literaturkritik des Fin de siécle war insgesamt im erheblichen
Maß an dem Zukunftsgedanken der Epoche orientiert und passte sich in ihrer
Form an die Dekadenzinhalte an.
58
Vgl. Oliver Pfohlmann: ,,Literaturkritik in der Literatur der Moderne", in: Literaturkritik,
Geschichte Theorie Praxis, Hrsg. Thomas Anz/Rainer Baasner, München, 2004,
S. 101
59
Vgl. Oliver Pfohlmann: ,,Literaturkritik in der Literatur der Moderne", in: Literaturkritik,
Geschichte Theorie Praxis, Hrsg. Thomas Anz/Rainer Baasner, München, 2004
60
Ebenda, S. 99
61
Ebenda
62
Ebenda
63
Vgl. Kritik in der Zeit, Hrsg. Manfred Diersch, Halle, 1985, S. 5 - 22
64
Ebenda, S. 10
65
Ebenda
66
Ebenda
16
1.2.3 Kunstverständnis um 1900
Als abrundendes Bild zur Literatur der Jahrhundertwende möchte ich einige
Aspekte zum Kunstverständnis dieser Epoche behandeln.
Nach dem naturalistischen Kunstprinzip von Arno Holz ist Kunst der Zustand
der Natur weniger eines Faktor x.
67
In Worten ausgedrückt meint er damit:
,,Die Kunst hat die Tendenz, die Natur zu sein; sie wird sie nach Maßgabe
ihrer Mittel und deren Handhabung."
68
Diese Form von Kunstverständnis
hatte natürlich im Fin de siécle keine Bedeutung mehr. Vielmehr wendet sich
der dekadente Literaturbetrieb der Steigerung des l`art pour l`art Prinzips,
Kunst um der Kunst willen, zu. Eckhard Heftrich bezeichnet die Formel l`art
pour l`art als ,,die Tendenz der modernen Kunst" überhaupt.
69
Auch wenn l`art
pour l`art später negativ und sogar als Schimpfwort verwendet wird, kann es
im eigentlichen Sinn als eine der ,,stolzesten Errungenschaften"
70
betrachtet
werden:
,,Der Künstler lädt mit diesem Bekenntnis die ganze Verantwortung auf sich.
Er fühlt sich keinem Menschen, keiner Staatsautorität, keinem sozialen Zwang
mehr verantwortlich; umso mehr aber sich selber, seinem Gewissen und der
Stimme ,du sollst´. Das macht ihn frei und befangen."
71
Im Rückblick auf den Ursprung geht die Entwicklung des literarischen l'art
pour l'art geht auf das Jahr 1830 zurück. Der französische Schriftsteller
Théophile Gautier und später Charles Baudelaire prägten es entscheidend. In
der Zeit des bürgerlichen und werteorientierten Aufschwungs erkennt Gautier
die Kritiker der neuen Literatur des l'art pour l'art. Zum einen sind es die
Tugendwächter seit dem Viktorianismus 1837 und zum anderen die
Utilitaristen. ,,Sie fordern bei allem, also auch bei der Kunst, dass als höchster
67
Vgl. Die deutsche Literatur in Text und Darstellung Naturalismus, hrsg. v. Walter
Schmähling, Stuttgart, 2002, S. 99
68
Ebenda, S. 94
69
Vgl. Eckhard Heftrich,: ,, Was heißt l´art pour l´art ?", in: Fin de siécle - Zu Literatur und
Kunst der Jahrhundertwende, hrsg. v. Roger Bauer u.a., Frankfurt a. M., 1977, S. 17
70
Ebenda, S. 18
71
Ebenda
17
Wert, als höchstes Ziel die Nützlichkeit zu gelten habe."
72
Gautier aber
verurteilt eine Tabuisierung in der Kunst, genauso wie er bekräftigt, dass
,,alles Schöne ohne Nützlichkeit besteht."
73
Als l'art pour l'art Begriff ursprünglich von Benjamin Constant bekannt
geworden, erfährt die Formel in der Spätzeitlichkeit der Dekadenz eine neue
Bedeutung. Eckhart Heftrich erläutert die spätere Verwendung des Begriffs
,l'art pour l'art´ wie folgt:
,,Diese Dekadenzliteratur hat dann im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gewisse
problematische Züge der l'art pour l'art Idee so stark heraustrieben, dass von da an
bis in unsere Tage sich mit dem Begriff fast untrennbar all das verbindet, was aus
dem Wort Kunst für die Kunst eine negative Bestimmung werden ließ."
74
Mitte des 19. Jahrhunderts ist Charles Baudelaire derjenige, der in seinem
Werk das l'art pour l'art Prinzip offensiv vertritt. Die ,,Fleurs du mal" steigern
die artifizielle Künstlichkeit und beeinflussen andere Autoren. Natürlich
zählen zu den französischen Vorbildern auch Stephan Mallarmé und J. K.
Huysmans ,,À rebours", dem Höhepunkt krankhafter Dekadenz. In den
achtziger Jahren erweitert sich dieses Kunstverständnis um den Ästhetizismus.
Als einer der bekanntesten Vertreter gilt Oscar Wilde. Er steht für die radikale
Form des Dandyismus, wie ihn auch Baudelaire in ,,Der Maler des modernen
Lebens" darstellte.
Im Zusammenhang des Fin de siécle und seiner Randform des Dandyismus
steht zum anderen die literarische Ausdrucksweise des Ästhetizismus. Unter
anderem wird der Ästhetizismus von Gisa Briese-Neumann in ihrer
Untersuchung zu Fin de siécle Phänomenen behandelt und in Beziehung zum
Naturalismus gesetzt:
,,Der fin de siécle Ästhetizismus wird (vielfach) pauschalisiert, wenn man
ihn als eine Gegenposition zum Naturalismus auffasst und ihn des weiteren auf
72
Vgl. Eckhard Heftrich,: ,, Was heißt l´art pour l´art ?", in: Fin de siécle - Zu Literatur und
Kunst der Jahrhundertwende, hrsg. v. Roger Bauer u.a., Frankfurt a. M., 1977, S. 21
73
Ebenda
74
Ebenda, S. 26
18
eine enge Affinität zum Impressionismus, Symbolismus und Jugendstil festlegt,
die eigentlich nur durch die Vorliebe für das Künstliche gegeben ist."
75
Im Gegensatz zum Naturalismus spielt das mimetische Prinzip hier im
umgekehrten Sinn die wichtigste Rolle: Kunst bildet die Natur künstlich nach.
. Genauer betrachtet meint der Ästhetizismus im Detail:
,,Als Ausdruck der radikalen Infragestellung des gesellschaftlichen Ganzen bezieht
sich der fin de siécle Ästhetizismus auf ein für die Moderne spezifisches Verhältnis
von Subjekt und Objekt, das seinen Ausdruck in den der totalen Subjektivierung
unterworfenen Sehakten des Betrachters findet und sich am ehesten auf eine
spezifische Form der ,Wahrnehmung´ festlegen lässt."
76
Um die Jahrhundertwende sind es John Ruskin, Hugo von Hofmannsthal und
D'Annunzio, die für die ästhetizistische Dichtung bekannt sind. In
Deutschland gibt Stefan George mit dem George Kreis weitere Impulse.
Durch die Hinwendung zur sinnlichen Wahrnehmung wird in der Décadence
eine weitere Tendenz deutlich. Die Literatur lehnt sich an die Renaissance und
die Antike an. Heinrich Mann lässt beispielsweise in der Göttinnentrilogie im
Zusammenhang mit der Kunst des Malers Jakobus Halm von ,,hysterischer
Renaissance"
77
sprechen.
Mit der Rückwendung und Übersteigerung bekannter Kunstprinzipien grenzt
sich die Dekadenzliteratur also ab und spürt dem Individuum der Gesellschaft
nach, um eine Gegenposition zur politischen und sozialen Wirklichkeit
einzunehmen.
1.2.4 Zeitgeschehen
In diesem Kapitel möchte ich auf das historische Zeitgeschehen eingehen,
denn Literatur ist meines Erachtens immer auch von historischen
Zusammenhängen beeinflusst.
75
Vgl. Gisa Briese - Neumann: Ästhet - Dilettant - Narziss, Frankfurt a.M., 1985, S. 30
76
Ebenda
77
Vgl. Heinrich Mann: Die Göttinnen - Die drei Romane der Herzogin von Assy II.,
Frankfurt. a. M., 1987, S. 246
19
Mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 hatte sich der Kaiserstaat in
den 90er Jahren zu weltpolitischen Interessen entschlossen. Das heißt,
Wilhelm II. und das dominierende Militärwesen setzten auf wirtschaftlichen
und außenpolitischen Erfolg durch imperialistische Maßnahmen.
Heinrich August Winkler vergleicht in seiner zweibändigen Darstellung ,,Der
lange Weg nach Westen"
78
die Phase zwischen 1895 und 1900 mit der
Hochkonjunktur der Gründerzeit.
79
Im Militärwesen hatte seit 1898 die
Flottenpolitik General von Tirpitz den wichtigsten Stellenwert. Durch sie
wurden ein Ausgleich wirtschaftlicher Interessen und ein Gegenpol zur
Sozialdemokratie geschaffen.
80
Der damit einhergehende Nationalismus wird
gerade in Heinrich Manns Werk um die Jahrhundertwende karikiert und in
seinen Romanen satirisch dargestellt.
Winkler verweist auf Naumann, der einen ,Flotten- und Industriekaiser´
vorstellt, der die sozialen Gegensätze durch Machtpolitik überwinden wollte.
81
Gesellschaftlich stand die Bevölkerung hinter Wilhelm II. Das Bürgertum
nahm wenig Einfluss auf staatliche Belange und die Sozialdemokratie war seit
den Sozialistengesetzen Bismarcks 1871 geschwächt. Aber Winkler betont:
,,Die Abschottung gegenüber der übrigen Gesellschaft immunisierte die
Sozialdemokraten bis zu einem gewissen Grad gegen den wilhelminischen
,Zeitgeist´: Das sozialdemokratische Milieu war antimilitaristisch,
antinationalistisch und, im Prinzip jedenfalls auch antikolonialistisch."
82
Weitere bedeutende Entwicklungen für die Gesellschaft um die
Jahrhundertwende nennt Hans Ulrich Wehler in seiner mehrbändigen Reihe
,,Deutsche Gesellschaftsgeschichte"
83
. Mit der fortschreitenden
Industrialisierung hatte eine starke Urbanisierung stattgefunden, die die
Lebenswelt der Reichsdeutschen veränderte und zur Thematik der
Gesellschaftsromane im 19. Jahrhundert wird. Das bemerkenswerteste
Merkmal aus historischer wie auch literarischer Sicht ist aber das
Spannungsverhältnis zwischen Modernisierung und Tradition.
78
Vgl. Heinrich August Winkler: Der lange Weg nach Westen, Bd. 1, München, 2000
79
Ebenda, S. 275
80
Ebenda, S. 272
81
Ebenda, S. 284
82
Ebenda, S. 295
83
Vgl. Hans - Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, München, 1995
20
Wehler bemerkt über das kaiserliche Deutschland:
,,Bei alledem handelte es sich um Prozesse und Ordnungskonfigurationen, bei denen
eine neuartige Dynamik auf tief verwurzelte Beharrungskräfte traf, so dass das
kaiserliche Deutschland zum Schauplatz des klassischen Modernisierungsdilemmas
wurde: Der rasanten sozialökonomischen Evolution stand die Behauptungskraft
gesellschaftlicher und politischer Traditionsmächte gegenüber. Dadurch wurde ein
allzeit gegenwärtiges, oft explosives, ständig über latent belastendes
Spannungsverhältnis geschaffen, aus dem unablässig gravierende Konflikte
hervorgingen, deren Ausgang trotz aller restriktiven Bedingungen häufig ungewiss
war."
84
Diese Spannungen fanden dann auf allen gesellschaftlichen Ebenen statt.
85
Insbesondere das Bürgertum und der Adel nehmen dabei die wichtigsten
Positionen ein. Das Bürgertum erlebt zwar einen Aufstieg im Kaiserreich, aber
der Adel bleibt die beherrschende Macht.
Eine besondere Stellung hat das Bildungsbürgertum: ,,Ganz überwiegend
diente es bereitwillig der autoritären Monarchie, öffnete sich aber auch den
neuen Entwicklungen des Interventions- und Sozialstaats, des kulturellen
Lebens und erst recht den Wissenschaften."
86
Dies spiegelt sich auch in den der Literatur zugrunde liegenden Thematiken
um die Jahrhundertwende wider. Heinrich Mann war am ehesten der Gruppe
des Bildungsbürgertums zuzuordnen und fühlte sich ihr literarisch verbunden.
Wehler erläutert, dass im Bildungsbürgertum ideologische Ansichten
aufeinander trafen.
,,Nicht zuletzt aber traf die Bildungsreligion selber auf mächtige Konkurrenten, die
wie etwa der Nationalismus, der Sozialdarwinismus und der Nietzschanismus, der
wissenschaftsgläubige Positivismus und der elitäre Kulturpessimismus mit ihrer
Verheißung eines überlegenen ,Weltbildes´ oder sogar dem Anspruch einer
84
Vgl. Hans - Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, München, 1995, S.
1251
85
Ebenda, S. 1258, ,,Dadurch wurden hochgradig soziale, politische und kulturelle
Spannungen erzeugt, so dass sich, trotz aller gemeinsamen Grundzüge dieser
sozialökonomischen Umwälzung, gerade mit der auffällig erfolgreichen deutschen
Industrialisierung besondere Charakteristika verbunden haben."
86
Ebenda, S. 1271
21
Säkularreligion zu einer verwirrenden Diversifizierung, damit aber zu einer
Auflösung der ideellen Integration des Bildungsbürgertums beitrugen. Deshalb
herrschte im deutschen Bildungsbürgertum vor 1914 eine tiefe Zerrissenheit."
87
Im Zeitraum um die Jahrhundertwende ist für die Literatur, die Kunst, das
Theater- und das Musikwesen vor allem wichtig, dass trotz aller staatlichen
Einflussnahme im Bürgertum die ,,kulturelle Hegemonie" weiter anhielt.
1.3 Heinrich Mann und sein Verhältnis zum Fin de siécle
1.3.1 Zur Position Heinrich Manns in der zeitgenössischen Literatur
Betrachtet man Heinrich Manns Schaffen zur Zeit des Fin de siécle nimmt er
eine literarisch kritische Haltung ein. Es gibt auf der einen Seite
Übereinstimmungen mit der Literaturepoche, auf der anderen Seite geht er
eigene nicht konforme Wege.
Sein Jugendwerk wird noch beeinflusst von literarischen Tendenzen des Fin de
siécle. B. A. Sørensen bestätigt in seinem Aufsatz ,,Der Dilettantismus des Fin
de siécle und der junge Heinrich Mann"
88
, dass Heinrich Mann insbesondere
an einem Phänomen interessiert ist: ,,Kein zweiter deutscher Schriftsteller hat
sich mit dem Phänomen des Dilettantismus so intensiv beschäftigt wie der
junge Heinrich Mann."
89
Der Literaturkritiker Hermann Bahr erklärt den
Begriff des Dilettantismus wie folgt: ,,Sich verwandeln. Täglich die Nerven
wechseln, so dass dasselbe Leben sich täglich auf einem anderen Planeten
erneut."
90
Außerdem wird der Dilettantismus zusammengeführt mit der im
neunzehnten Jahrhundert beliebten Figur de Dandys.
91
Für Sørensen findet
sich ein Vergleich zwischen dem literarischen Phänomen und Heinrich Mann
87
Vgl. Hans - Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 3, München, 1995,
S. 1271
88
Vgl. B. A. Sørensen: Der Dilettantismus des Fin de Siécle und der junge Heinrich Mann, in:
Orbis Litterarum 24, 1969, S. 251 - 270
89
Ebenda, S. 260
90
Ebenda, S. 254
91
Ebenda, S. 255
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2006
- ISBN (eBook)
- 9783836617024
- DOI
- 10.3239/9783836617024
- Dateigröße
- 828 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – Germanistik/Philosophie, Germanistik
- Erscheinungsdatum
- 2008 (August)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- mentalitätsgeschichte literaturwissenschaft germanistik gesellschaftssatire heinrich mann
- Produktsicherheit
- Diplom.de