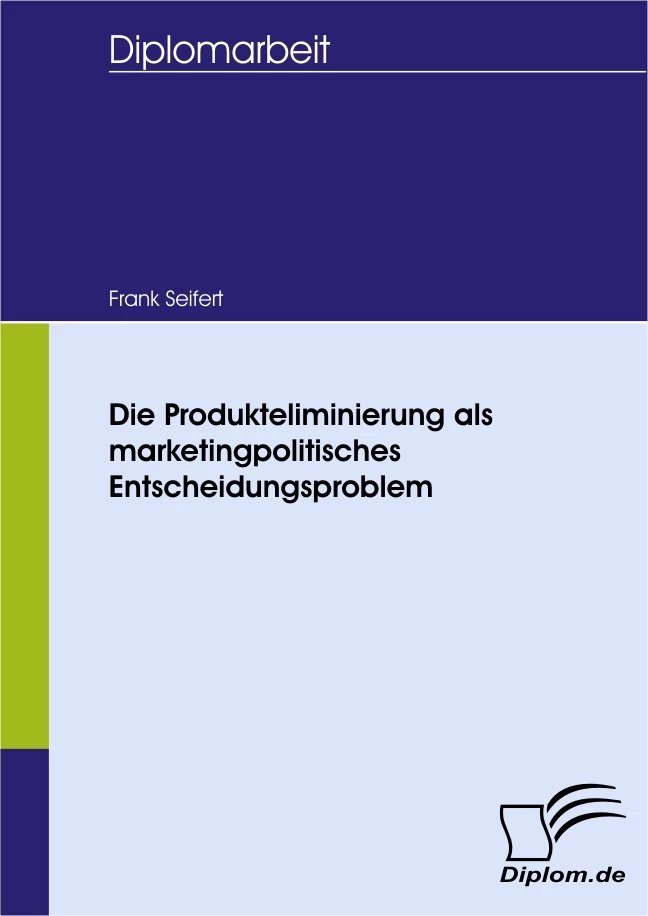Die Produkteliminierung als marketingpolitisches Entscheidungsproblem
©2008
Diplomarbeit
93 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die optimale Ausgestaltung des Absatz- und Produktionsprogramms, von der ersten Produktidee bis zur endgültigen Herausnahme eines Produkts aus dem Programm, stellt eine wesentliche Aufgabe im Unternehmen dar. Das Produkt als Grundlage der Geschäftstätigkeit will verkauft werden, den Konsumentenwünschen entsprechen, besser als das Konkurrenzprodukt sein und überdies Gewinne für das Unternehmen erwirtschaften. Um all dieses zu gewährleisten, muss es Ziel einer jeden Unternehmung sein, alle angebotenen Produkte, d.h. Waren und Dienstleistungen, laufend den sich ändernden Rahmenbedingungen des Absatzmarktes anzupassen. Dabei kommt dem Produktmanagement neben den Entscheidungen zur Einführung neuer und der Pflege etablierter Produkte insbesondere die Aufgabe der Erkennung von Schwächen im Absatz- und Produktionsprogramm, und der damit verbundenen Frage nach der Produkteliminierung, zu. Der Fortbestand defizitärer Produkte und die Verzögerung der Eliminierungsentscheidung kann ein Unternehmen schnell in eine nachhaltige Krise führen. Daher müssen defizitäre Produkte bzw. Produktlinien rechtzeitig erkannt werden, um geeignete Handlungsmaßnahmen treffen zu können.
Dabei gehört die Maßnahme der Produkteliminierung zu den produkt- und programmbezogenen Aktivitäten, welche in den klassischen Bereich des Marketings fallen. Eines der vier P´s im Marketing-Mix, mit denen das absatzpolitische Instrumentarium in der Literatur und auch der vorliegenden Arbeit synonym bezeichnet wird, steht dementsprechend für product. Darüber hinaus betrachtet der Marketing-Mix die Preis- und Konditionenpolitik (price), die Distributionspolitik (place) und die Kommunikationspolitik (promotion).
In den Bereich der Produkt- und Programmpolitik fallen sämtliche Entscheidungen, die die Gestaltung des Leistungsprogramms betreffen. Dazu gehören die physische Gestaltung des Kernprodukts, die optische Gestaltung, die Verpackung sowie produktbezogene Dienstleistungen. Über die Gestaltung des Produkts hinaus befasst sich die Produkt- und Programmpolitik mit allen, das Programm betreffenden Entscheidungen. Dazu gehören die laufende Betrachtung der Produktpalette, die Entwicklung und Einführung neuer Produkte, die Differenzierung und Variation vorhandener Produkte und eben die Frage, ob und wann vorhandene Produkte und Produktlinien aus dem Produktions- und/oder Absatzprogramm genommen werden. Zur Sicherung der Unternehmensziele müssen diese Aufgaben im […]
Die optimale Ausgestaltung des Absatz- und Produktionsprogramms, von der ersten Produktidee bis zur endgültigen Herausnahme eines Produkts aus dem Programm, stellt eine wesentliche Aufgabe im Unternehmen dar. Das Produkt als Grundlage der Geschäftstätigkeit will verkauft werden, den Konsumentenwünschen entsprechen, besser als das Konkurrenzprodukt sein und überdies Gewinne für das Unternehmen erwirtschaften. Um all dieses zu gewährleisten, muss es Ziel einer jeden Unternehmung sein, alle angebotenen Produkte, d.h. Waren und Dienstleistungen, laufend den sich ändernden Rahmenbedingungen des Absatzmarktes anzupassen. Dabei kommt dem Produktmanagement neben den Entscheidungen zur Einführung neuer und der Pflege etablierter Produkte insbesondere die Aufgabe der Erkennung von Schwächen im Absatz- und Produktionsprogramm, und der damit verbundenen Frage nach der Produkteliminierung, zu. Der Fortbestand defizitärer Produkte und die Verzögerung der Eliminierungsentscheidung kann ein Unternehmen schnell in eine nachhaltige Krise führen. Daher müssen defizitäre Produkte bzw. Produktlinien rechtzeitig erkannt werden, um geeignete Handlungsmaßnahmen treffen zu können.
Dabei gehört die Maßnahme der Produkteliminierung zu den produkt- und programmbezogenen Aktivitäten, welche in den klassischen Bereich des Marketings fallen. Eines der vier P´s im Marketing-Mix, mit denen das absatzpolitische Instrumentarium in der Literatur und auch der vorliegenden Arbeit synonym bezeichnet wird, steht dementsprechend für product. Darüber hinaus betrachtet der Marketing-Mix die Preis- und Konditionenpolitik (price), die Distributionspolitik (place) und die Kommunikationspolitik (promotion).
In den Bereich der Produkt- und Programmpolitik fallen sämtliche Entscheidungen, die die Gestaltung des Leistungsprogramms betreffen. Dazu gehören die physische Gestaltung des Kernprodukts, die optische Gestaltung, die Verpackung sowie produktbezogene Dienstleistungen. Über die Gestaltung des Produkts hinaus befasst sich die Produkt- und Programmpolitik mit allen, das Programm betreffenden Entscheidungen. Dazu gehören die laufende Betrachtung der Produktpalette, die Entwicklung und Einführung neuer Produkte, die Differenzierung und Variation vorhandener Produkte und eben die Frage, ob und wann vorhandene Produkte und Produktlinien aus dem Produktions- und/oder Absatzprogramm genommen werden. Zur Sicherung der Unternehmensziele müssen diese Aufgaben im […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Frank Seifert
Die Produkteliminierung als marketingpolitisches Entscheidungsproblem
ISBN: 978-3-8366-1696-6
Druck Diplomica® Verlag GmbH, Hamburg, 2008
Zugl. Fachhochschule Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, Deutschland, Diplomarbeit, 2008
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
© Diplomica Verlag GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2008
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
II
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... II
Abbildungsverzeichnis ... VI
1. Einleitung und Aufbau der Untersuchung ... 1
2. Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung ... 4
2.1. Arten und Strategien der Produkteliminierung... 4
2.1.1. Eliminierung von Produktlinien ... 4
2.1.2. Eliminierung von Produktvarianten ... 5
2.1.3. Die Strategie der Eliminierung ... 6
2.2. Indikatoren zur Erkennung eliminierungsverdächtiger Produkte... 9
2.2.1. Indikatoren im Unternehmensumfeld ... 10
2.2.1.1. zunehmende Marktsättigung ... 10
2.2.1.2. Konkurrenzbedingter Situationswandel ... 11
2.2.1.3. Gesellschaftlicher Situationswandel ... 11
2.2.1.3.1. Werte und Wertewandel ... 11
2.2.1.3.2. Soziale Strukturen ... 13
2.2.1.4. Veränderungen des rechtlichen Rahmens ... 14
2.2.1.5. Währungsrisiken ... 15
2.2.1.6. Produkt-und Markenpiraterie ... 17
2.2.2. Indikatoren im Unternehmen ... 18
2.2.2.1. Die gescheiterte Einführung neuer Produkte ... 18
2.2.2.2. Die Produkte und Produktlinien im Lebenszyklus ... 20
2.2.2.2.1. Die Produktlebenszyklus-Analyse ... 20
2.2.2.2.2. Bedeutung des Produktlebenszyklus für angebotene Produkte ... 22
2.2.2.2.3. Die Marktlebenszyklus-Analyse ... 23
2.2.2.3. Komplexität ... 24
2.2.2.4. Kannibalisierung ... 25
Inhaltsverzeichnis
III
2.2.2.5. Steigende Faktorkosten ... 25
2.2.3. Bewertung der Indikatoren ... 26
2.4. Bindung der Kunden an das Unternehmen ... 26
2.4.1. Kundenbindung ... 27
2.4.2. Mehrmarkenstrategie... 28
3. Alternativen zur Produkteliminierung ... 29
3.1. Produktmodifikation ... 29
3.1.1. Produktvariation ... 29
3.1.2. Repositionierung durch Produktvariation ... 30
3.1.3. Produktdifferenzierung ... 31
3.2. Nutzen von Kostensenkungspotentialen ... 32
3.3. Marktentwicklung ... 33
3.4. Preispolitischer Ausgleich ... 34
3.5. Modernisierung der Produktlinie ... 35
3.6. Herausstellen bestimmter Produkte der Produktlinie ... 35
3.7. Bewerten der Alternativen ... 36
4. Instrumente zur Entscheidungsfindung ... 37
4.1. Kundenzufriedenheits- und Beschwerdeanalyse ... 37
4.2. Programmstrukturanalyse ... 38
4.2.1. Altersstrukturanalyse... 38
4.2.2. Umsatzstrukturanalyse ... 40
4.2.3. Absatzstruktur ... 41
4.3. Lebenszyklus-Analysen ... 41
4.3.1. Produktlebenszyklus-Analyse ... 41
4.3.2. Marktlebenszyklus-Analyse ... 42
4.4. Portfolio-Analysen ... 42
4.4.1. Vier-Felder-Portfolio ... 43
4.4.2. Neun-Felder-Portfolio ... 46
Inhaltsverzeichnis
IV
4.5. Kosten- und Leistungsrechnung ... 48
4.5.1. Vollkostenrechnung ... 48
4.5.2. Teilkostenrechnung ... 48
4.5.3. Bewertung der Kosten- und Leistungsrechnung ... 49
4.6. Verfahren zur Produktbewertung ... 50
4.6.1. Checklisten zur Produktbewertung ... 50
4.6.2. Punktbewertungsverfahren zur Produktbewertung ... 51
4.7. Decision-Support-Systeme ... 52
4.8. Bewertung der Instrumente ... 53
5. Chancen und Risiken der Eliminierungsentscheidung ... 54
5.1. Gründe gegen die Eliminierungsentscheidung ... 54
5.1.1. Die Zielsetzung der Unternehmen ... 54
5.1.2. Verbundeffekte ... 54
5.1.2.1. Arten von Verbundeffekten ... 54
5.1.2.2. Messen und Bewerten von Verbundeffekten ... 56
5.1.3. Image ... 57
5.1.4. Emotionale Restriktionen ... 58
5.1.5. Gesellschaftlich-institutionelle Restriktionen ... 58
5.1.6. Garantie- und Gewährleistungsvorschriften ... 58
5.1.7. Die Gebundenheit des Unternehmens an Lieferanten ... 59
5.1.8. Koppelproduktion ... 59
5.2. Ressourcenallokation ... 60
5.3. Mit der Eliminierung verbundene Handlungsmöglichkeiten ... 62
5.3.1. Lizenzvergabe ... 62
5.3.2. Original Equipment Manufacturing ... 64
5.3. Bewertung der Chancen und Risiken der Eliminierung ... 65
6. Case Study ... 66
6.1. Die Marke ,,Smart" ... 66
Inhaltsverzeichnis
V
6.2. Betrachtung der Produktpalette ... 66
6.2.1. Der Smart fortwo... 66
6.2.2. Der Smart Forfour ... 68
7. Schlussbetrachtung ... 71
Anhang ... VII
Literatur- und Quellenverzeichnis ... XII
Abbildungsverzeichnis
VI
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Dimensionen des Produktprogramms am Beispiel Porsche ... 6
Abbildung 2: Ermittlung des Kapitalwertes zur Bestimmung des Zeitpunkts der
Eliminierung. ... 7
Abbildung 3: Einfluss des Wechselkurses auf den Gewinn für ein fiktives Gut bei
Absatz im Eigen- und Fremdwährungsraum ... 16
Abbildung 4: Das Produktlebenszyklus-Modell ... 21
Abbildung 5: Die Altersstrukturanalyse... 39
Abbildung 6: Die Umsatzstrukturanalyse ... 40
Abbildung 7: Das Vier-Felder-Portfolio ... 43
Abbildung 8: Beispiele möglicher Faktoren der Marktattraktivität und der relativen
Wettbewerbsvorteile. ... 46
Abbildung 9: Das Neun-Felder-Portfolio... 47
Abbildung 10:Produktbewertungsbogen nach Kotler ... 51
Abbildung 11: Das Absatz-und Produktionsprogramm ... 60
Abbildung 12: Die Absatzentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ... 68
1.
Einleitung und Aufbau der Untersuchung
1
1. Einleitung und Aufbau der Untersuchung
Die optimale Ausgestaltung des Absatz- und Produktionsprogramms, von der ersten
Produktidee bis zur endgültigen Herausnahme eines Produkts aus dem Programm,
stellt eine wesentliche Aufgabe im Unternehmen dar. Das Produkt als Grundlage der
Geschäftstätigkeit will verkauft werden, den Konsumentenwünschen entsprechen,
besser als das Konkurrenzprodukt sein und überdies Gewinne für das Unternehmen
erwirtschaften. Um all dieses zu gewährleisten, muss es Ziel einer jeden Unterneh-
mung sein, alle angebotenen Produkte, d.h. Waren und Dienstleistungen, laufend den
sich ändernden Rahmenbedingungen des Absatzmarktes anzupassen. Dabei kommt
dem Produktmanagement neben den Entscheidungen zur Einführung neuer und der
Pflege etablierter Produkte insbesondere die Aufgabe der Erkennung von Schwächen
im Absatz- und Produktionsprogramm, und der damit verbundenen Frage nach der
Produkteliminierung, zu. Der Fortbestand defizitärer Produkte und die Verzögerung
der Eliminierungsentscheidung kann ein Unternehmen schnell in eine nachhaltige
Krise führen. Daher müssen defizitäre Produkte bzw. Produktlinien rechtzeitig er-
kannt werden, um geeignete Handlungsmaßnahmen treffen zu können.
Dabei gehört die Maßnahme der Produkteliminierung zu den produkt- und prog-
rammbezogenen Aktivitäten, welche in den klassischen Bereich des Marketings fal-
len. Eines der ,,vier P´s" im Marketing-Mix, mit denen das absatzpolitische Instru-
mentarium in der Literatur und auch der vorliegenden Arbeit synonym bezeichnet
wird, steht dementsprechend für ,,product". Darüber hinaus betrachtet der Marketing-
Mix die Preis- und Konditionenpolitik (price), die Distributionspolitik (place) und
die Kommunikationspolitik (promotion).
In den Bereich der Produkt- und Programmpolitik fallen sämtliche Entscheidungen,
die die Gestaltung des Leistungsprogramms betreffen. Dazu gehören die physische
Gestaltung des Kernprodukts, die optische Gestaltung, die Verpackung sowie pro-
duktbezogene Dienstleistungen. Über die Gestaltung des Produkts hinaus befasst sich
die Produkt- und Programmpolitik mit allen, das Programm betreffenden Entschei-
dungen. Dazu gehören die laufende Betrachtung der Produktpalette, die Entwicklung
und Einführung neuer Produkte, die Differenzierung und Variation vorhandener Pro-
dukte und eben die Frage, ob und wann vorhandene Produkte und Produktlinien aus
1.
Einleitung und Aufbau der Untersuchung
2
dem Produktions- und/oder Absatzprogramm genommen werden. Zur Sicherung der
Unternehmensziele müssen diese Aufgaben im Zusammenhang betrachtet werden.
Die Produkteliminierung bezeichnet die Bereinigung von Produkten und Produktli-
nien aus dem Angebots- und Produktionsprogramm, wenn eine Fortführung die Un-
ternehmensziele gefährdet (vgl. Nieschlag et al., 2002, S. 710).
Die Produkteliminierung ist dabei als laufende Aufgabe, in erfolgreichen und weni-
ger erfolgreichen Zeiten, anzusehen. (vgl. Hill/Lederer, 2001, S. 90 f., zit. nach:
Bruhn/Hadwich, 2006, S. 266). Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, Indikatoren für
oder gegen die Eliminierung einzelner Produkte und Produktlinien aufzudecken. Der
Zwang zu handeln ergibt sich durch Schwachstellen in der Angebots- und Produkti-
onspalette. Diese Schwachstellen können kurzfristig auftreten und Unternehmen un-
mittelbar zum Handeln zwingen, oder sich in einem schleichenden Prozess entwi-
ckeln. Ursachen für Schwachstellen begründen sich oftmals dadurch, dass der lang-
fristigen Entwicklung der Angebots- und Produktionspalette zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt wird (vgl. Bruhn/Hadwich, 2006, S. 266 f.; vgl. Esch et al., 2005, S.
39).
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aufgezeigt, wie Unternehmen defizitäre
Produkte erkennen und bewerten können und welche Handlungsoptionen ihnen zur
Verfügung stehen. Des Weiteren wird erläutert, wie die mit der Eliminierungsent-
scheidung einhergehenden Konsequenzen aufgefangen werden können und welche
Gründe gegen die Eliminierung einzelner eliminierungswürdiger Produkte und Pro-
duktlinien sprechen. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf dem marketingpoli-
tischen Problem der Produkteliminierung. Aus Plausibilitätsgründen werden alle
Sachverhalte auf Mehrproduktunternehmen im Polypol angewendet, da die Produkt-
eliminierung in Einprodukt-Unternehmen gleichbedeutend mit der Geschäftsaufgabe
wäre. Des Weiteren wird auf die Betrachtung von Produkten, die bereits während der
Entwicklungsphase eliminiert werden ebenso verzichtet, wie auf die Eliminierung
von ganzen Geschäftsbereichen, da diese Entscheidungen im Rahmen der Produkt-
und Programmpolitik nicht getroffen werden können. Darüber hinaus umfasst der
Begriff der ,,Produkteliminierung" in der vorliegenden Arbeit nur die komplette Eli-
minierung von Produkten und Produktlinien auf Gesamtmärkten. Im Verlauf der Ar-
beit vorgestellte Indikatoren, Aspekte und Beispiele beziehen sich auf die Produktion
1.
Einleitung und Aufbau der Untersuchung
3
und den Absatz von technischen Gebrauchsgütern, die Kotler als Produkte für den
längerfristigen Gebrauch definiert, die durch hohe Garantie- und Gewährleistungen
sowie persönliche Beratungsaufwendungen gekennzeichnet sind (vgl. Kotler et al.,
2007, S. 495).
In der vorliegenden Arbeit werden zunächst verschiedene Arten der Eliminierung
betrachtet. Dabei werden die Bereinigung einzelner Produktvarianten und Produktli-
nien und die möglichen Zeitpunkte der Entscheidung vorgestellt. Darüber hinaus
werden mögliche Indikatoren aufgezeigt, die Hinweise auf eine eliminierungsver-
dächtig der betrachteten Produkte und Produktlinien liefern. In Kapitel 2.3 werden
Möglichkeiten erläutert, mit deren Hilfe der Verlust der von der Eliminierung betrof-
fenen Kunden verhindert werden soll. Kapitel 3 zeigt Alternativen zur Produkt- und
Produktlinieneliminierung auf, die weitgehend der Produkt- und Programmpolitik
zuzuordnen sind. Instrumente, die eine Eliminierungsverdächtigkeit bestätigen oder
widerlegen und somit die Entscheidung beeinflussen liefert Kapitel 4. Nachdem in
Kapitel 5 Chancen und Risiken aufgezeigt werden, die für oder gegen die Eliminie-
rung sprechen, folgt in Kapitel 6 eine Fallstudie, in der die Entwicklung der smart
GmbH, insbesondere die Eliminierung des Smart Foufour, betrachtet wird. Kapitel 7
schließt die vorliegende Arbeit mit einem Fazit.
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
4
2. Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
2.1. Arten und Strategien der Produkteliminierung
Der Begriff der Produkteliminierung umfasst sowohl die Reduktion der Anzahl der
Produktvarianten als auch die Verringerung der Produktlinien im Unternehmen. Die
Eliminierung kann dabei sowohl aus dem Produktions- als auch aus dem Absatzprog-
ramm erfolgen. Darüber hinaus stellt sich die Frage nach der Strategie der Produkt-
eliminierung, die in Punkt 2.1.3 beantwortet werden soll.
2.1.1. Eliminierung von Produktlinien
Innerhalb der Produktpalette bezeichnet man Produktlinien als Bündel von Produk-
ten, ,,die aufgrund bestimmter Kriterien wie z. B. Bedarfs- oder Produktionszusam-
menhang in enger Beziehung zueinander stehen" (Meffert et al., 2007, S.401). Bei
der Eliminierung von Produktlinien wird die Breite des Produktprogramms reduziert.
Alle Produkte innerhalb der Produktlinie werden vom Markt genommen.. Entschei-
dungen über die Gestaltung der Produktlinien beeinflussen den langfristigen Erfolg
der Unternehmen nachhaltig. In den Vorteilen sehen Unternehmen insbesondere die
mögliche Fixkostendegression aufgrund höherer Stückzahlen und die Konzentration
auf die eigene Kernkompetenz. Dieser Weg soll zu den langfristigen Gewinnzielen
der Unternehmen führen. Die Gefahr der Eliminierung von Produktlinien liegt darin,
dass Verbundwirkungen auf Anbieter- und Nachfrager-Seite falsch oder gar nicht
wahrgenommen werden, und damit die mit der Eliminierungsentscheidung verfolg-
ten Ziele nicht erreicht werden. Grundlage für eine erfolgreiche Eliminierung ist so-
mit die umfassende Kenntnis über die eigenen Produktlinien und über die Bedingun-
gen und Zukunftserwartungen des Marktes. Die Eliminierung von gesamten Produkt-
linien ist eine weitreichende Entscheidung, die strukturelle Veränderungen im Unter-
nehmen mit sich bringt und stellt damit keine laufende Aufgabe der Unternehmen
dar (vgl. Dornieden, 1976, S. 80). Die Entscheidungen über die Eliminierung ganzer
Produktlinien bedürfen umfassender und vorausschauender Planung.
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
5
2.1.2. Eliminierung von Produktvarianten
Neben der in 2.1.1 dargestellten Eliminierung von kompletten Produktlinien erfolgt
bei der Eliminierung von Produktvarianten eine Verminderung der Produktpalette in
der Tiefe. Einzelne Produktvarianten werden aus der Produktlinie bereinigt. Die An-
gebotsbreite bleibt hierbei unberührt.
Die Entscheidungen über die Reduktion von Produktvarianten ermöglicht die Reak-
tion auf kurzfristige Situationsänderungen. Eine zu späte oder verpasste Reaktion auf
solche Veränderungen kann die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nachhaltig
gefährden. Die Ermittlung des optimalen Umfangs der Produktlinie ist Aufgabe des
Produktmanagements. Bei einem zu geringen Umfang der Produktlinie kann durch
die Hinzunahme neuer Produktvarianten der Gewinn erhöht werden, da die Bedürf-
nisse der Nachfrager besser befriedigt werden. Ist hingegen der Umfang der Produkt-
linie zu hoch, kann durch die Eliminierung der Gewinn erhöht werden. Gründe hier-
für liegen in den hohen Kosten, die mit der Produktvariation verbunden sind. Die
Entscheidung des Umfangs der Produktlinie führt durch unterschiedliche Auffassun-
gen der Unternehmensteile oftmals zu Problemen. Während der Marketingbereich
möglichst viele Varianten der Produkte wünscht, um der maximalen Anzahl von
Nachfragern gerecht zu werden, präferiert der Produktionsbereich kurze Programm-
linien, um aufgrund höherer Stückzahlen Kostendegressionseffekte zu erzielen (Mef-
fert et al., 2007, S. 403).
Produktvarianten entstehen durch Änderungen am Produkt und umfassen neben den
Änderungen von physischen Merkmalen auch etwaige Sekundärleistungen (vgl.
Meffert et al., 2007, S. 457). Die Eliminierung von Sekundärleistungen verringert
somit auch die Programmtiefe.
Abb. 1 liefert einen beispielhaften Überblick über die Produktlinien und Varianten
des deutschen Automobilbauers Porsche.
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
6
Abbildung 1: Dimensionen des Produktprogramms am Beispiel Porsche
Quelle: Meffert et al., Marketing, 2007, S. 402.
Über die betrachteten Arten der Eliminierung wird die Produktvariation in der Litera-
tur gelegentlich als Eliminierung mit Folgeprodukt bezeichnet (vgl. Brauckschulze,
1983, S. 111). Die Entscheidungen über mögliche Variationen werden in der vorlie-
genden Arbeit als Alternative zur Produkteliminierung dargestellt, eine Abgrenzung
diesbezüglich ist maßgeblich vom Umfang der Variation anhängig. Unter der An-
nahme, dass der Produktkern erhalten bleibt, erfolgt bei der Produktvariation eine
Veränderung bereits eingeführter Produkte, die anstelle der bisher angebotenen Pro-
dukten folgen (vgl. Diller, 2001, S. 1421). Die Angebotstiefe bleibt dabei unverän-
dert. Entscheidungen über die Eliminierung von Produktvarianten stellen eine wie-
derkehrende Aufgabe im Rahmen des Produktmanagement dar (vgl. Dornieden,
1976, S. 80).
2.1.3. Die Strategie der Eliminierung
Die Strategie der Eliminierung wird durch den Zeitpunkt und der Art der Eliminie-
rung festgelegt. Ist die Eliminierungsentscheidung gefallen, kann das Produkt zu
einem festen, definierten Zeitpunkt vom Markt genommen werden (ad-Hoc Eliminie-
rung) oder sukzessive vom Markt ausscheiden (gleitende Eliminierung)(vgl. Reiß,
1999, S. 209 ff.). Die Entscheidung darüber ergibt sich aus dem Grund der Eliminie-
rung. Erfolgt die Eliminierung beispielsweise (bspw.) aufgrund rechtlicher Restrik-
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
7
tionen oder Fehlern am Produkt, die sich nicht beheben lassen, empfiehlt sich eine
sofortige Entfernung vom Markt, um eventuelle negative Wirkungen zu verringern.
Erfolgt die Eliminierung aus marktbedingten Gründen und ohne unerwartete Ereig-
nisse kann eine gleitende Eliminierung des Produktes Sinn machen, um bspw. even-
tuelle Lagerbestände abzubauen, oder um Kunden eine letzte Kaufmöglichkeit zu
geben. Dies ist auch dann der Fall, wenn die Eliminierung aufgrund eines bereitste-
henden Nachfolge-Produktes erfolgt. Das Produkt am Markt kann dabei eine domi-
nierende Stellung haben, während sich das neu einzuführende Produkt zunächst am
Markt durchsetzen muss. Durch die gleitende Eliminierung können so weitere Um-
sätze generiert werden (vgl. Pepels, 2003, S. 361). Bei der Wahl nach dem geeigne-
ten Zeitpunkt der Eliminierung ist zu beachten, dass die ad-hoc-Eliminierung unwi-
derruflich ist, während bei der sukzessiven Eliminierung die Entscheidung mögli-
cherweise noch beeinflusst werden kann, sollten bestimmte Einflüsse, wie etwa ein
plötzlicher Anstieg des Absatzes oder mögliche Verbundeffekte, auftreten (vgl. Reiß,
1999, S. 209 ff.). Die Entscheidungsstrategie wird darüber hinaus im Wesentlichen
von den Wirkungen auf der Kosten- und der Erlösseite bestimmt (vgl. Brauckschul-
ze, 1983, S. 136 f.). Einfluss darauf nehmen im Besonderen die entgehenden De-
ckungsbeiträge nach der Eliminierung und die abbaubaren Fixkosten. Erlöse, die
nach der Eliminierung durch Lizenzen und anderen (u.a.) zu erzielen sind, werden in
Kap. 5.3 gesondert betrachtet.
Traditionell wird als Entscheidungshilfe zur Findung des optimalen Zeitpunktes der
sukzessiven Eliminierung die Kapitalwertmethode herangezogen. Mögliche Elimi-
nierungszeitpunkte können durch Abzinsen auf den Zeitpunkt t=0 (heute) miteinan-
der verglichen werden. Der Zeitpunkt mit dem höchsten Kapitalwert (Abb. 2) wird
zur Eliminierung gewählt. Um den Kapitalwert zu ermitteln werden die Zahlungs-
konsequenzen, sowie deren Zustand (positiv oder negativ), zu den Zeitpunkten t (t =
1,..., t
i
) ermittelt. Der Term
(
) stellt dabei die entsprechenden Wahrscheinlichkei-
ten des Eintritts der jeweiligen Zahlungen dar.
=
=1
=
(1 + )
-
Abbildung 2: Ermittlung des Kapitalwertes zur Bestimmung des Zeitpunkts der Elimi-
nierung.
Quelle: Reiß, 1999, S.210
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
8
Neben der Ermittlung der Kapitalwerte der Eliminierung wird der Kapitalwert ermit-
telt, der entsteht, wenn das Produkt beibehalten wird. Diese Beibehaltungsstrategie
beinhaltet die Option, das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt zu eliminieren (Real-
option). Gegenüber der traditionellen Kapitalwertmethode beinhaltet dieser moderne
Ansatz den Wert der Flexibilität, das Produkt beizubehalten bzw. zu einem späteren
Zeitpunkt zu eliminieren. Die Flexibilität kann mit Hilfe der Realoptionstheorie be-
wertet werden. Durch die Betrachtung der Flexibilität ergibt sich ein neuer Kapital-
wert. Dieser ist die Summe des Kapitalwerts und dem Wert der Realoption. Daraus
folgt, dass ein Produkt dann eliminiert wird, wenn der Kapitalwert der Eliminie-
rungsstrategie zum Zeitpunkt t den Kapitalwert der Beibehaltungsstrategie übersteigt.
Der daraus resultierende Wertzuwachs für die Unternehmen ist die Differenz aus
dem Kapitalwert der Eliminierung und dem Kapitalwert der Beibehaltungsstrategie
(vgl. Reiß, 1999, S. 209 ff.).
Bei beiden Arten der Eliminierung, also der ad-hoc-Eliminierung und der sukzessi-
ven Eliminierung, stellt sich ferner die Frage nach eventuell notwendigen Service-
leistungen wie der Ersatzteilversorgung und den notwendigen Garantie- und Gewähr-
leistungsmaßnahmen nach der Eliminierung. Im Bereich der Kommunikationsmaß-
nahmen ist zu prüfen, ob eine kommende Eliminierung des Produkts publik gemacht
wird und der Absatz noch verfügbarer Bestände gefördert wird.
Als Beispiel für eine erfolgreiche Eliminierung wird in der Literatur häufig die Hi-Fi
Sparte der Braun AG genannt. Braun hat den Rückzug aktiv kommuniziert und zu
Ende der Produktion zum 31.03.1991 eine Sonderserie ,,Letzte Edition" aufgelegt.
Diese Serie war auf 6900 Stück limitiert, eine dreijährige Garantie und zehnjährige
Ersatzteilversorgung wurde zugesichert. Für die Braun AG ergab sich dadurch sogar
ein Imagegewinn (vgl. Becker, 2006, S.741). Durch die Bezeichnung ,,Letzte Edition
CC4" konnten die Produkte als ,,Kunst- und Kultobjekt" (Becker, 2006, S. 741)
vermarktet werden.
Als Negativ-Beispiel ist die Liquidation von AEG zu nennen. Kunden der Haus-
haltsgeräte waren verunsichert und sind auf andere Anbieter umgestiegen, obwohl
Electrolux seit langem die Haushaltsgeräte von AEG produzierte. Electrolux hatte es
versäumt, die Trennung bekannt zu machen und so Kunden an das Unternehmen zu
binden. Die Marke AEG verlor deutlich an Marktanteil (vgl. Lötters, 1999, S.85).
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
9
Für den Erfolg der Eliminierung ist die passende Strategie ein entscheidender Faktor.
Durch die Untersuchung von 23 Fällen aus der Praxis stellt McKinsey fest, dass sich
der Erfolg in Abhängigkeit von der eingeschlagenen Strategie auf lediglich 13-50 %
beläuft und demnach ad-hoc-Eliminierungen als riskant anzusehen sind, die ohne
umfassende Programmstrategien durchgeführt werden (vgl. Knudsen et al., 1997, S.
190 f., zit. nach Bruhn/Hadwich, 2006, S. 266).
2.2. Indikatoren zur Erkennung eliminierungsverdächtiger Produkte
Eliminierungsverdächtige Produkte sind solche, die aufgrund stagnierender oder
rückläufiger Absatzzahlen und/oder sich ändernder Rahmenbedingungen quantitative
oder qualitative Unternehmens- und Marketingziele gefährden. Zu den quantitativen
Marketingzielen gehören hierbei insbesondere der Umsatz und Gewinn, Marktantei-
le, Wachstum sowie Kostenziele. Demgegenüber gehören zu den qualitativen Marke-
tingzielen u.a. die Wahrnehmung des Unternehmens bei den Konsumenten und der
Aufbau von Kundenpräferenzen (vgl. Meffert, 2007, S. 246 f.). Gerade im Bereich
der technischen Gebrauchsgüter können Produkte, die nicht den aktuellen techni-
schen, optischen und funktionalen Anforderungen genügen, diese Ziele gefährden,
und bedürfen daher ständiger Verbesserung. Schon ein einzelner der nachfolgenden
Indikatoren zeigt an, ob ein Produkt im Rahmen der Produktpolitik auf eine mögliche
Eliminierung hin überprüft werden muss. Zur Eliminierungsentscheidung werden
darüber hinaus weitere produkt- und produktlinienspezifische Instrumente aufge-
zeigt, die die Eliminierungsentscheidung bestätigen, oder gegebenenfalls widerlegen
(vgl. dazu Kap. 4).
Zur Beantwortung der Frage, wie Unternehmen solche Produkte frühzeitig erkennen,
werden im Folgenden Indikatoren zur Erkennung eliminierungswürdiger Produkte
und Produktlinien dargestellt. Die Indikatoren finden sich dabei sowohl im Umfeld
der Unternehmen, als auch in den Unternehmen selber. Über die genannten Indikato-
ren hinaus werden sich möglicherweise bei der unternehmensindividuellen Prüfung
angebotener Produkte weitere finden lassen.
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
10
2.2.1. Indikatoren im Unternehmensumfeld
Externe Frühindikatoren zur Produkteliminierung finden sich im Unternehmensum-
feld und gliedern sich in geänderte Markt- und Konkurrenzsituationen, gesellschaft-
liche- und politische Veränderungen sowie mögliche Währungsrisiken.
2.2.1.1. zunehmende Marktsättigung
Für Anbieter sind das Potenzial der Märkte und deren Volumen von großer Bedeu-
tung. Das Marktpotenzial bezeichnet den von allen Anbietern am relevanten Markt
erzielbaren Absatz, während das Marktvolumen den von allen Anbietern bisher ab-
gesetzten Mengen entspricht.
Setzt man diese beiden Variablen ins Verhältnis, ergibt sich der Sättigungsgrad der
Märkte. Während bei neuen Märkten der Sättigungsgrad bei null startet, werden im
Zeitablauf neue Konkurrenten die Wettbewerbsintensität erhöhen und damit die
Kundengewinnung für das Unternehmen erschweren. Bei einem hohen Sättigungs-
grad der Märkte ermöglicht die Gewinnung von Kunden, die bisher Produkte von
konkurrierenden Unternehmen erworben haben, oft den einzigen Weg dem entgegen
zu wirken (vgl. Meffert et al., 2007, S. 53 f.).
Neben demographischen und rechtlichen Entwicklungen ist die Marktsättigung als
Hauptgrund für stagnierende Märkte zu sehen. Die Marktsättigung ist auf eine ab-
nehmende Zahl von Nachfragern und sinkende Verwendungsintensität zurückzufüh-
ren. Die sinkende Nachfrage durch die zunehmende Marktsättigung im Zeitablauf
erfordert von Unternehmen verschiedene Maßnahmen. Das kann bspw. durch Diffe-
renzierungsmaßnahmen und/oder der Gewinnung von Kunden, die bisher nicht am
Markt waren, erfolgen. Dies führt zu einer Erhöhung des Marktvolumens (vgl.
Trummer, 1990, S. 199 f.; vgl. Meffert, 2007, S. 276 f.).
Durch die Veränderungen des Wettbewerbs sind Zugewinne im Marktanteil nur zu
realisieren, wenn Wettbewerber an Marktanteil verlieren. Dies kann zum Verdrän-
gungswettbewerb führen, der durch Preiswettbewerb Unternehmen zwingen kann,
ihre Produkte vom Markt zu nehmen. Für stagnierende oder schrumpfende Märkte
werden in der Literatur Behauptungs- oder Aufgabestrategien für strategische Ge-
schäftseinheiten vorgeschlagen (vgl. Trummer, 1990, S. 160 ff.). Zu den Behaup-
tungsstrategien gehören dabei die Kostenführerschaftsstrategie und die Differenzie-
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
11
rungsstrategie, zu Aufgabestrategien die langfristige und die kurzfristige Aufgabe-
strategie.
2.2.1.2. Konkurrenzbedingter Situationswandel
Die Analyse der Konkurrenz gehört zu den laufenden Aufgaben der Unternehmen.
Nur mit umfassender Kenntnis über aktuelle, potentielle und substitutive Konkurren-
ten werden Unternehmen in der Lage sein, ihre Produkte optimal zu planen, zu posi-
tionieren und somit die Chancen auf einen Erfolg am Markt zu erhöhen. Substitutive
Konkurrenten werden versuchen mit Ersatzangeboten Marktanteile zu erzielen. Die
Gefahr, dass Anbieter von Produkten mit substitutivem Charakter in den Markt ein-
treten, ist hoch, wenn es sich um hochpreisige Produkte handelt und sich durch kaum
minderwertigere Produkte auf Seiten der Konsumenten hohe Kostenersparnisse er-
zielen lassen und deshalb auch Produkte mit geringerem Nutzen in die Kaufentschei-
dung fallen. Weiter können die Annahmen, dass am Markt relativ hohe Margen zu
erzielen sind und die Markteintrittsbarrieren allgemein gering sind, potenzielle Kon-
kurrenten veranlassen, auf bisher nicht bedienten Märkten zu agieren (vgl. Pepels,
2005, S. 30 ff.). Durch die zunehmende Homogenisierung der Ländermärkte, bedingt
durch die Liberalisierungspolitik der Europäischen Union, und/oder staatlicher Rest-
riktionen müssen angebotene Produkte zudem neuen Normen und Standards stand-
halten und sich gegen die steigende Konkurrenz behaupten. Infolge dessen werden
Produkte weitgehend substituierbar. Durch den Einsatz von Zusatzleistungen, etwa
Service- und Dienstleistungen muss versucht werden, die eigene Position gegenüber
dem Wettbewerber zu verbessern (vgl. Winkelmann, 2006, S. 219). Die Verbesse-
rung der Wettbewerbsposition und die Erhöhung der Marktanteile erfordern durch
die zunehmende Marktsättigung produktpolitische Maßnahmen, die neben der Ent-
wicklung neuer Produkte auch die rechtzeitige Eliminierung defizitärer Produkte und
Produktlinien betrifft.
2.2.1.3. Gesellschaftlicher Situationswandel
2.2.1.3.1. Werte und Wertewandel
Werte lassen sich allgemein als Auffassung von Wünschenswertem für Individuen
oder Gruppen bezeichnen, die die Grundlage des individuellen Verhaltens bilden
(vgl. Pepels, 2004, S. 148; vgl. Hansen et al., 2001, S. 54). Durch den Einfluss von
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
12
Werten innerhalb der Gesellschaft ist die Relevanz zur Produktpolitik geliefert. Wer-
te beeinflussen die Wahrnehmung von Produkten aus Konsumentensicht. Dadurch
kommen Produkte und Produktlinien in den Verdacht eliminierungswürdig zu sein,
wenn sie zu gängigen Werten nicht kompatibel sind.
Der Begriff des Wertewandels bezeichnet die Veränderung von gängigen Werten hin
zu neuen Werten. Traditionelle Werte verlieren an Bedeutung, andere Werte hinge-
gen erreichen einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft (vgl. Raffée/Wiedmann,
1988, S. 198 ff.). In den vergangenen Jahren haben sich dabei insbesondere der
Wunsch nach persönlicher Entfaltung und dem damit verbundenen Wunsch nach
Individualisierung, eine zunehmende Erlebnisorientierung und die Übernahme von
sozial-ökologischer Verantwortung herauskristallisiert (vgl. Hansen et al., 2001, S.
54). Als weiterer Trend mit Auswirkungen für die Produktpolitik ist die Polarisie-
rung der Märkte zu nennen (vgl. Becker, 1996, S. 34). Die Annahme dahinter ist,
dass auf der einen Seite mehr Konsumenten deutlich mehr Einkommen erzielen,
während gleichzeitig auf der anderen Seite viele Konsumenten über deutlich weniger
Einkommen verfügen. Die Konsequenz ist, dass Produkte im mittleren Preisniveau
tendenziell weniger nachgefragt werden. Ein weiterer Grund für diese Polarisierung
der Märkte ist das vermehrte Aufkommen von hybridem Konsumverhalten. Das be-
sagt, dass Konsumenten auf der einen Seite gehobene Ansprüche haben, zu einem
anderen Zeitpunkt und gegenüber anderen Produkten allerdings auch sehr niedrige
Konsumansprüche stellen, und sich dies in dem Wechsel zwischen Preisbereitschaft
und Sparorientierung widerspiegelt (vgl. Köhler, 2001, S. 52 f.).
Für das Marketing ergibt sich daraus die Aufgabe, Marken und Produkte eindeutig
zu positionieren. Im Rahmen einer möglichen Produkteliminierung ist das von be-
sonderer Relevanz, wenn die angebotenen Produkte sich nicht erfolgreich alternativ
positionieren lassen, um den geänderten Bedürfnissen zu entsprechen, oder durch
den Wertewandel an Stellenwert für den Konsumenten verlieren. Der Wertewandel
ist daher als ein laufender Prozess in der Gesellschaft zu betrachten und Bedarf re-
gelmäßiger Aufmerksamkeit der Unternehmen. Um den Erfolg der angebotenen Pro-
dukte zu sichern, müssen Produkte dem Konsumenten Nutzen bieten. Dieser Nutzen
kann sich im Zeitablauf ändern und somit den Bedarf am angebotenen Produkt redu-
zieren. Folglich müssen Anpassungen am Produkt erfolgen. Bspw. spielten Leistung
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
13
und Komfort einst die entscheidende Rolle beim Autokauf. Demgegenüber legen
Konsumenten heute mehr Wert auf Sicherheit und Umweltschutz. So ist die Reakti-
on auf die anhaltende Diskussion zum Klimaschutz entscheidend für die Wettbe-
werbsfähigkeit deutscher und europäischer Automobilbauer (vgl. o. V., Auto Jahres-
bericht 2007, S. 12).
2.2.1.3.2. Soziale Strukturen
Verschiedene soziale Positionen innerhalb der Gesellschaft werden in ihrer Gesam-
theit als soziale Struktur bezeichnet. Dazu werden verschiedene Aspekte zugrunde
gelegt, bspw. die Zugehörigkeit verschiedener sozialer Schichten, demographische
Merkmale und Lebensstile. Durch den fortschreitenden Wertewandel nimmt die
Bedeutung objektiver Faktoren der Lebensbedingungen, die in der Vergangenheit
Basis für die Bestimmung sozialer Positionen waren, ab. Die Gesellschaft stellt sich
,,(...) als eine Gesamtheit wechselnder differenzierter Gruppen dar, bei denen sich
die Zugehörigkeit der Individuen neben objektiven Merkmalen nach subjektiven
Komponenten aus Erfahrungen, Werten und Wünschen definiert" (Hansen et al.,
2001, S. 55). Diese subjektiven Komponenten begründen Lebensstile als gesell-
schaftliche Orientierungen und gewinnen an Bedeutung.
Im Rahmen der Produktpolitik sind die soziale Struktur und die verschiedenen Le-
bensstile in besonderem Maße für die Entscheidung über die Segmentierung von
Märkten und der damit verbundenen Differenzierung der Leistungen von Bedeutung.
Produkte nehmen demnach eine besondere Stellung ein. Neben der Deckung des
Bedarfs der Konsumenten kommen ihnen symbolische Bedeutungen zu, wie bspw.
die Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, Subkulturen oder ähn-
lichem (o.ä.) (vgl. Hansen et al., 2001, S. 55). Die Produktpolitik hat die Aufgabe,
angebotene Produkte und Produktlinien hinsichtlich der symbolischen Bedeutung zu
gestalten und zu vermarkten. Mit Hilfe des beschriebenen Wandels kann versucht
werden, den Erfolg von Apples Ipod zu erklären. Obwohl der einzig sichtbare Unter-
schied zur Konkurrenz das Design ist, hält Apple auf dem amerikanischen Markt im
dritten Quartal 2007 bei tragbaren MP3-Playern mit dem Ipod einen Marktanteil von
81,9 %, gemessen am Umsatz (vgl. Lambrecht, 2007, in: www.ftd.de). Dem Design
des Ipod wird dabei aus Konsumentensicht eine starke Bedeutung beigemessen.
Konsumenten verwenden den Kopfhörer des Ipod als sichtbares Zeichen der Zugehö-
2.
Strategien und Indikatoren der Produkteliminierung
14
rigkeit zu einer Gruppe, ohne selbst einen Ipod zu besitzen, oder sind bereit für einen
Ipod deutliche höhere Preise bei gleicher Leistung gegenüber ähnlichen Produkten
der Konkurrenz zu zahlen (vgl. Kotler et al., 2007, S.414 f.).
2.2.1.4. Veränderungen des rechtlichen Rahmens
Die unternehmerischen Handlungen sind durch legislative Rahmenbedingungen ab-
gegrenzt. Verfassungsnormen, Verordnungen und Gesetze haben die Funktion, die
unternehmerische Tätigkeit sowohl zu schützen als auch gegenüber anderen (Kon-
kurrenten, Konsumenten und die Gesellschaft als Ganzes) zu beschränken (vgl. Han-
sen et al., 2001, S.67 ff.; vgl. Ahlert/Schröder, 1996, S. 97 ff.). Gegenüber Konkur-
renten werden Unternehmen durch gewerbliche Schutzrechte sowohl geschützt als
auch beschränkt. Die Schutzrechte umfassen das Markengesetz, das Patentgesetz und
das Geschmacksmustergesetz. Verletzungen der Rechte gegenüber Dritten, bewusst
oder unbewusst, können Unternehmen zwingen, Produkte und Produktlinien zu eli-
minieren. Gegenüber Konsumenten sind Unternehmen in der Produktgestaltung be-
schränkt. Verordnungen über Inhaltstoffe bestimmen die Qualität, das Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb (UWG) enthält zudem Vorschriften zum Schutz der
Konsumenten, was in § 1 des UWG ,,Zweck des Gesetzes" definiert ist: "Dieses Ge-
setz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und der Verbraucher
sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauterem Wettbewerb. Es schützt zu-
gleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb". Darü-
ber hinaus wird der Konsument durch den rechtlichen Rahmen vor gefährlichen oder
fehlerhaften Produkten durch die Produkthaftung der Unternehmen geschützt. Als
dritte Interessengruppe ist die Gesellschaft zu nennen, die durch rechtliche Vorgaben
vor Effekten, die mit unternehmerischer Tätigkeit zusammenhängen, geschützt wer-
den. Dabei ist in erster Linie an den Schutz der Umwelt zu denken, der in vielen Ge-
setzen und Verordnungen die Handlungsfreiheit der Unternehmen einschränkt. So
liefert bspw. das Kreislaufwirtschaftsgesetz, welches neben der Vermeidung von
Abfällen die Verwertungen von Abfällen vorsieht, rechtliche Vorgaben für die Pro-
duktpolitik (vgl. o.V., 1996, in: www.bmu.de). In der aktuellen Diskussion zum Kli-
mawandel fällt zu dem immer häufiger der Begriff von ,,Klimakillern", das heißt
(d.h.)von Produkten mit hohem Kohlendioxid-Ausstoß. Hier werden Unternehmen in
der Zukunft gezwungen sein, auf die sich ändernden Rahmenbedingungen einzuge-
hen. Produkte im Programm, die von geänderten Rahmenbedingungen betroffen
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2008
- ISBN (eBook)
- 9783836616966
- DOI
- 10.3239/9783836616966
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen; Gelsenkirchen – Wirtschaft, Studiengang Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2008 (August)
- Note
- 1,8
- Schlagworte
- produkteliminierung produktelimination produktpolitik sortimentsbereinigung angebotspalette
- Produktsicherheit
- Diplom.de